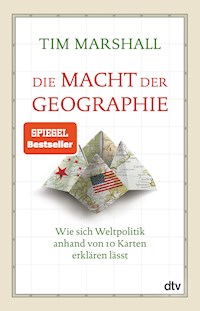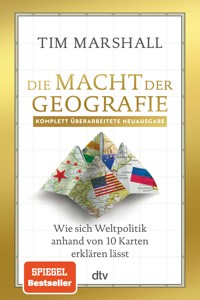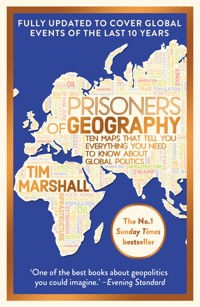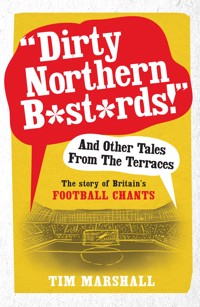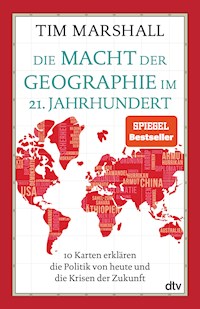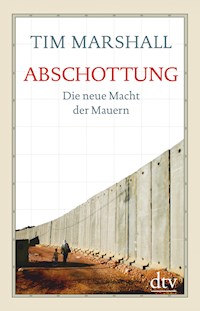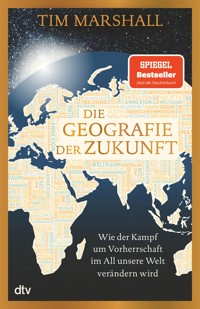
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Großmächte auf Konfrontationskurs: Wem gehört was im Weltraum? Spionagesatelliten in der Umlaufbahn des Mondes. Bodenschätze im Weltraum, wertvoller als das Bruttoinlandsprodukt der meisten Länder. Menschen auf dem Mars in den nächsten zehn Jahren. Das ist keine Science-Fiction, sondern Astropolitik. Der Mensch ist unterwegs ins All – und wir nehmen unsere Machtkämpfe mit. Bald wird das Geschehen im Universum die Weltgeschichte genauso prägen wie die Berge, Flüsse und Meere auf der Erde. Politik-Experte Tim Marshall legt die geopolitischen Realitäten offen: Er zeigt, wie das Rennen um die besten Plätze im All aktuell aussieht, wie Russland, China und die USA vorangehen und welche strategischen Ziele dahinterstehen. Eine unverzichtbare Lektüre über Macht, Politik und die Zukunft der Menschheit. »Marshall begibt sich auf einen durch und durch unterhaltsamen, unglaublich nachdenklich machenden und technologisch schlüssigen Ritt durch das Terrain des Sonnensystems.« Everett Dolman, Professor of Comparative Military Studies and Strategy, US Air Force's Air Command and Staff College. »Tim Marshall stellt erneut seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis, wunderbar fesselnde Bücher zu schreiben, die man unbedingt lesen muss und die verblüffende Tatsachen ans Licht bringen.« Ian Goldin, Professor of Globalisation and Development, Universität Oxford.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Der Weltraum ist das neue strategische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Schlachtfeld unserer Zeit. Weitgehend gesetzlich unreguliert, steht das verheißungsvolle Eroberungsgebiet künftig im Zentrum internationaler Geopolitik. Tim Marshall legt die politischen Realitäten dazu offen. Vor allem die Großmächte USA, Russland und China treiben die Ausweitung ihrer Einflusszone voran. Es steht viel auf dem Spiel: Wer platziert in welchem Orbit seine Spionagesatelliten? Welche Positionen im All sind für Weltraumwaffen strategisch am günstigsten? Wer sichert sich zuerst wichtige Bodenschatze im All? Und wer wird dort als Erster neuen Lebensraum schaffen? Tim Marshall zeichnet den Wettlauf um die Vorherrschaft in seiner ganzen Dramatik packend nach und schärft mit seinen brillanten Analysen das Verständnis für die großen astropolitischen Herausforderungen der Zukunft.
Tim Marshall
Die Geografie der Zukunft
Wie der Kampf um Vorherrschaft im All unsere Welt verändern wird
Aus dem Englischen von Lutz-W. Wolff
Inhaltsverzeichnis
Widmung
VORWORT
ERSTER TEIL DER WEG ZU DEN STERNEN
ERSTES KAPITEL ZUM HIMMEL AUFSCHAUEN
ZWEITES KAPITEL DER WEG NACH OBEN
ZWEITER TEIL HIER UND JETZT
DRITTES KAPITEL DIE EPOCHE DER ASTROPOLITIK
VIERTES KAPITEL OUTLAWS
FÜNFTES KAPITEL CHINA: DER LANGE MARSCH IN DEN WELTRAUM
SECHSTES KAPITEL DIE USA: ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
SIEBTES KAPITEL RUSSLAND: IM RÜCKWÄRTSGANG
ACHTES KAPITEL MITREISENDE
DRITTER TEIL FUTUR ZWEI
NEUNTES KAPITEL WELTRAUMKRIEGE
ZEHNTES KAPITEL DIE WELT VON MORGEN
EPILOG
NACHWORT
DANK
AUSGEWÄHLTE LITERATUR
Sachregister
Für meine Familie
VORWORT
»Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste.«
Susan Sontag
Wir haben die Welt erforscht und entdeckt, dass sie endlich ist. Jetzt, wo unser Territorium und die Ressourcen allmählich knapp werden, stellen wir fest, dass dieser dicke, schöne Ball am Himmel, den wir Mond nennen, voll von den Mineralien und Elementen ist, die wir brauchen. Außerdem ist er ein Sprungbrett: So wie die frühen Menschen von einer Insel zur anderen reisten, um das Meer zu erkunden, so kann uns der Mond erlauben, das Sonnensystem zu erkunden und das, was dahinter liegt.
Es ist also gar nicht so überraschend, dass wir uns in einem neuen Wettlauf zum Mond und zum Weltraum befinden. Dem Sieger die Beute. Die Herausforderung besteht darin, die gesamte Menschheit zum Sieger zu machen.
Der Weltraum hat uns vom Anbeginn an geprägt. Der Himmel lieferte Erklärungen für unsere Schöpfungsgeschichten, beeinflusste unsere Kulturen und inspirierte unsere wissenschaftlichen Fortschritte. Aber unsere Vorstellung vom Himmel ist dabei, sich zu ändern. Der Weltraum wird immer mehr zu einer Erweiterung der irdischen Geografie: Die Menschen tragen die Nationalstaaten und die Konzerne, ihre Geschichte, ihre Politik und ihre Konflikte ins All. Das könnte das Leben auf der Erdoberfläche komplett umwälzen.
Schon jetzt hat der Weltraum unseren Alltag verändert. Er ist für unsere Kommunikation, für die Wirtschaft und die militärische Strategie unentbehrlich und wirkt immer stärker auf die internationalen Beziehungen ein. Außerdem ist er die neueste Arena für den Wettkampf der Menschen untereinander.
Die Anzeichen, dass der Weltraum zum vielleicht größten geopolitischen Narrativ des 21. Jahrhunderts wird, mehren sich schon seit einiger Zeit. Dazu gehören Berichte, dass es auf dem Mond Wasser und seltene Erden gibt, dass private Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk die Kosten für das Verlassen der Erdatmosphäre erheblich gesenkt haben, und dass die führenden Weltraummächte jetzt in der Lage sind, Satelliten auf ihrer Umlaufbahn zu vernichten. Das alles sind Teile der großen Story, die da auf uns zukommt.
Um diese Geschichte zu verstehen, ist es nützlich, wenn man sich den Weltraum als einen Ort mit einer Geografie, also einer klaren räumlichen Gliederung vorstellt: Da oben gibt es Korridore zur Durchfahrt, Regionen mit Bodenschätzen, Bauland und Gegenden, die so gefährlich sind, dass man sie lieber meidet. In den letzten paar Jahrzehnten wurde das alles noch als gemeinsames Erbe der Menschheit betrachtet – kein Einzelner und kein Staat konnte es alleine ausbeuten oder als seinen Besitz beanspruchen. Aber diese Idee vom Gemeingut, die in verschiedenen noblen, aber nicht durchsetzbaren und überholten Verträgen festgelegt worden ist, franst jetzt an den Rändern aus. Die Nationen der Erde wollen alle irgendwie einen Vorteil rausschinden. Das ist nichts Neues. In der gesamten bekannten Geschichte haben Zivilisationen, die über entsprechende Ressourcen verfügten, Technologien entwickelt, die sie stärker machten und ihnen erlaubten, andere zu dominieren.
Es muss aber nicht so sein. Wir haben auch viele Beispiele für internationale Zusammenarbeit im All, und viele Technologien, die im und für den Weltraum entwickelt wurden, unter anderem im Bereich der Medizin oder sauberer Energien, helfen uns allen. Mehrere Länder arbeiten außerdem daran, große Asteroiden, die alles zerstören könnten, von unserem Planeten fernzuhalten. Das ist schon ziemlich gemeinnützig. Wie der Science-Fiction-Autor Larry Niven gesagt hat: »Die Dinosaurier sind ausgestorben, weil sie kein Weltraumprogramm hatten.« Noch mal so einen Treffer hinzunehmen wie damals vor 66 Millionen Jahren wäre echt unschön. Wir haben lange genug gebraucht, bis wir da waren, wo wir jetzt sind.
Die Big-Bang-Theorie geht davon aus, dass vor ungefähr 13,7 Milliarden Jahren alles, was es heute im Universum gibt, noch ein winziges zusammengepresstes Teilchen war, das im Nichts existierte. Manche Vorstellungen über das Universum sind recht schwer zu verstehen, und das »Nichts« gehört zu den Dingen, über die sich Wissenschaftler unendlich streiten können. Sie entwickeln Begriffe wie »Quantenvakuum«, wo kleine Wellen im Weltraum dazu führen, dass Dinge plötzlich zu existieren anfangen, aber nachdem ich diese Theorien immer und immer wieder gelesen habe, bin ich genauso klug wie zuvor. Das Universum dehnt sich aus – aber wo hinein? Was befindet sich jenseits der jetzigen Grenzen? Ich kann mir das Nichts nicht vorstellen. Eine endlose graue Mauer? Vielleicht auch beige? Für einen Augenblick scheint das okay, aber auch »Grau« ist ja etwas und nicht nichts. Irgendwann muss ich dann aufgeben. Zum Glück sind Physiktheoretiker und Kosmologen aus härterem Eisen geschmiedet.
Der Urknall kam also aus dem (rein mathematischen) Nichts. Es war nicht wie »Blitz und Donner«, sondern eher wie »Donner und Blitz«, denn ehe nach der Explosion die ersten Lichtpartikel entstanden, hat es angeblich 380000 Jahre gedauert. Erst dann erschien die kosmische Hintergrundstrahlung, die Wissenschaftler mit ihren Teleskopen sehen können, mit denen sie in die Vergangenheit blicken, fast bis zum Anfang von allem. Man kann sie auch selbst anschauen. Man braucht bloß einen alten, analogen Fernseher auf das statische Rauschen zwischen den Sendern zu richten. Das Universum dehnte sich aus, kühlte ab, es entstanden Raum, Zeit und Materie, und die Schwerkraft machte aus Gaswolken Sterne.
Wir wissen, dass unsere Sonne vor ungefähr 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist – damit ist sie eher ein Neuzugang im Universum. Eine riesige Scheibe aus Gas und schwererem Material wirbelte um den neuen Stern herum, und daraus entstanden dann die Planeten und Monde unseres Sonnensystems.
Der Planet Erde befindet sich hinterm Mond gleich links. Er ist ein schöner Ort zum Leben. Bis jetzt auch der einzige. Denn wenn er irgendwo anders wäre, würde es uns gar nicht geben. Alles, was seit dem Urknall passiert ist, hat die Landschaft geprägt, die wir jetzt sehen, und uns erlaubt, hier zu sein. Die Erde ist ein wahrer Glücksfall unter den Planeten. Nicht zu heiß und nicht zu kalt, genau richtig für das Leben. Jedenfalls wie wir es kennen. Die Stellung der Erde im Weltall, ihre Größe und Atmosphäre – all das trägt dazu bei, dass wir einen Boden unter den Füßen haben. Buchstäblich. Denn die Größe unseres Planeten sorgt dafür, dass seine Schwerkraft stark genug ist, um die Atmosphäre festzuhalten, die wir zum Leben brauchen. Wenn wir in unserem Teil des unendlichen Weltalls woanders hingingen, würden wir entweder verbrutzeln, erfrieren oder ersticken, weil wir keine Luft kriegen.
»Viele Astronauten«, sagt der Kosmologe Carl Sagan in seinem Buch Gott und der tropfende Wasserhahn: Gedanken über Mensch und Kosmos, »haben berichtet, dass sie die dünne blaue Aura am Rand der beleuchteten Hemisphäre gesehen haben, die zeigt, wie dünn unsere Atmosphäre ist. Und dass sie sofort und ganz automatisch darüber nachdachten, wie verletzlich und zart diese Hülle ist. Sie machen sich Sorgen deswegen. Und sie haben auch Grund dazu.« Warum achten wir dann nicht besser auf sie?
Die Menschen sind immer Wanderer gewesen, und im letzten Jahrhundert haben sie sogar angefangen, ihren eigenen Planeten zu verlassen. Das Weltall ist ein unendlicher Raum, und wir haben uns bisher erst in einer winzigen Ecke bemerkbar gemacht. Jetzt können wir unsere Spur gemeinsam überall hinterlassen. Aber wenn wir friedlich und im Geist der Zusammenarbeit in die Ära der Raumfahrt hinaussegeln wollen, dann müssen wir den Weltraum in seinen historischen, politischen und militärischen Zusammenhängen begreifen und erkennen, was er für unsere Zukunft bedeuten wird.
In den nachfolgenden Kapiteln wollen wir uns das gemeinsam anschauen. Zunächst werfen wir einen Blick zurück, um zu sehen, wie der Weltraum unsere Kulturen und unsere Vorstellungswelt beeinflusst hat, angefangen mit dem Götterglauben und der Religion bis hin zu den wissenschaftlichen Revolutionen. Dann folgte das Weltraumrennen des Kalten Krieges mit seinen Innovationen und Kraftanstrengungen, die es schließlich erlaubten, die Schwerkraft hinter uns zu lassen. Kaum waren wir draußen, entdeckten wir neue Chancen, Ressourcen und strategische Positionen, um die man sich bemühen kann. Damit sind wir im Zeitalter der Astropolitik angekommen. Aber wir haben es bisher versäumt, allgemein anerkannte Gesetze und Regeln zu formulieren, wie der Wettbewerb um diese Dinge stattfinden soll. Und ohne Regeln für die menschlichen Aktivitäten im Weltraum sind Streitigkeiten in astronomischen Größenordnungen vorprogrammiert.
Gegenwärtig ist mit drei großen Konkurrenten zu rechnen: China, den USA und Russland. Das sind die drei unabhängigen Raumfahrtnationen, und das, wozu sie sich entscheiden, wird alle anderen beeinflussen. Die Streitkräfte aller drei haben inzwischen Raumkommandos, die den Luft-, See- und Landstreitkräften erfolgreich Hilfestellung leisten. Und alle sind dabei, den Angriff auf gegnerische und die Verteidigung der eigenen Satelliten zu proben.
Die übrigen Nationen wissen, dass sie mit den Großen Drei nicht konkurrieren können, aber sie wollen bei der Frage mitreden, was da oben herumschwirrt und was von da oben herunterkommt. Sie prüfen ihre Optionen und formieren sich zu »Weltraumblöcken«. Wenn wir es nicht schaffen, diese Spaltung zu überwinden und als geeinter Planet zu handeln, sind Wettstreit und Konflikte im Weltraum nahezu unvermeidlich.
Zum Abschluss folgt dann noch ein Blick in die Zukunft. Was hält der Weltraum für uns bereit, auf dem Mond, dem Mars und jenseits davon?
Der Mond und die Sterne ziehen uns an. Wölfe heben die Schnauze und heulen die silberne Scheibe an, die da am nächtlichen Himmel hängt. Die Menschen wollen seine Oberfläche betreten und richten den Blick ins Unendliche. Wir haben das immer getan. Und jetzt sind wir unterwegs.
ERSTERTEIL
DERWEGZUDENSTERNEN
ERSTESKAPITELZUMHIMMELAUFSCHAUEN
»Unsere Aufmerksamkeit nur auf Irdisches zu beschränken, hieße den menschlichen Geist einzuschränken.«
Stephen Hawking
Unser Sonnensystem
Die flackernden Lichter der Sterne erzählen Geschichten. Lange bevor wir je davon träumten, hinaus in den Weltraum zu fliegen, bevor künstliches Licht unseren Blick trübte, starrten wir bereits zum Himmel hinauf und fragten uns: Warum ist da eigentlich etwas – und nicht nichts? Ein großer Teil menschlichen Strebens war von dem Wunsch bestimmt, nach den Sternen zu greifen.
Die ersten schriftlich belegten Theorien über die Schöpfung, die Götter und Sternzeichen entstammen mündlichen Überlieferungen, die weit in die Vorgeschichte zurückreichen. Alle alten Kulturen entdeckten am Himmel ein Modell dafür, wer oder was sie hervorgebracht haben könnte, wer sie waren, was ihre Rolle war und wie sie sich benehmen sollten. Wenn es Götter gab (und was sonst konnte die Dinge erklären, die man da sah?), schien es logisch, dass einige von ihnen da oben im Himmel wohnten. Der Mensch ist so veranlagt, dass er in allem, was er sieht, Muster sucht. Und so verknüpften die Leute das, was sie auf Erden fanden und aus den Legenden kannten, mit dem, was sie am Himmel entdeckten, und machten sich daraus ein Bild. Wer in heißen Zonen lebte, glaubte Skorpione und Löwen zu sehen, während die Bewohner nördlicher Landstriche Bären und Elche am Himmel entdeckten. In Finnland heißt das Nordlicht auch »Fuchsfeuer«, nach einer alten Erzählung, der zufolge ein riesiger Fuchs mit seinem Schwanz Schnee in den Himmel schaufelt, wenn man das Nordlicht sieht. In Afrika gibt es die Legende, dass hinter dem nächtlichen Himmel die Sonne scheint und die Sterne nur kleine Löcher im Firmament sind. Die Sterne waren nicht zu trennen von unseren Geschichten, Legenden und Mythen.
Die ältesten möglichen Hinweise auf eine wissenschaftliche Analyse des Geschehens am Himmel sind etwa 30000 Jahre alt und stammen vom Ende der letzten Eiszeit. 1972 interpretierte der Prähistoriker Alexander Marshack bestimmte Kerben und Schnitzereien in Tierknochen aus der Steinzeit als Mondkalender. Die Knochen weisen Reihen von achtundzwanzig und neunundzwanzig Punkten auf. Die Fachleute streiten sich noch darüber, was die Menschen damals alles gewusst haben, aber es gibt Hinweise, dass sie den Himmel studiert haben. Es wird vermutet, dass diese tragbaren Kalender bei langen Jagdausflügen und Wanderungen, vielleicht auch bei Ritualen benutzt wurden. Es war ja sinnvoll, die Zeit zu messen. Schließlich musste man wissen, wann die Stechmücken ausschwärmten und wann es sich lohnte weiterzuziehen, weil die Bäume woanders Früchte trugen.
Auch als die ersten Jäger und Sammler vor ungefähr 12000 Jahren anfingen, sesshaft zu werden, war es praktisch, den Himmel im Auge zu behalten. Hirten und Bauern mussten ja wissen, wann man säen musste und wann man ernten konnte. Einige Höhlenmalereien aus dem Paläolithikum in Europa stellen möglicherweise Sternbilder dar. Diese Deutungen sind umstritten, aber in den Bildern von Tieren und anderen Mustern kann man auch Sternzeichen sehen. Den Menschen, die in klaren Nächten in den Himmel blickten, ist sicherlich aufgefallen, dass die Lichter ihre Positionen ständig veränderten, selbst wenn sie noch nicht errechnet hatten, dass 365 Tage und Nächte eine Einheit ergeben. Im Sommer 2023 habe ich die Höhlen von Lascaux selbst besucht, und tatsächlich: Der Anblick einiger Malereien in der Großen Halle der Stiere hat mich überzeugt, dass die steinzeitlichen Frühmenschen hier das Sternbild Taurus abzubilden versucht haben.
Wir besitzen bisher keine eindeutigen Beweise dafür, dass die Bewegung von Himmelskörpern schon damals genau gemessen wurde. Auch die ersten Steinkreise bieten nur wenige Anhaltspunkte in dieser Hinsicht.
Der älteste ist wohl Nabta-Playa im heutigen Ägypten. Es wird manchmal das »Stonehenge in der Sahara« genannt, was insofern ein bisschen unfair ist, als es schon vor siebentausend Jahren gebaut wurde, und somit über zweitausend Jahre vor dem berühmten Steinkreis in der englischen Grafschaft Wiltshire. Es liegt wahrscheinlich daran, dass Nabta-Playa erst 1973 entdeckt und der Bericht über die Ausgrabungen dann wiederum erst 1998 veröffentlicht wurde. Man vermutet, dass die Steine von halbnomadischen Hirten aufgestellt wurden, um die beste Zeit für ihre Wanderungen zu ermitteln. Es gibt Hinweise darauf, dass die Steinreihen an besonders auffälligen Sternen wie dem Sirius ausgerichtet wurden, dem hellsten Stern am nächtlichen Himmel. Beweise für die fantasiereichere Behauptung, die Erbauer hätten die Entfernung zum Sirius feststellen wollen, sind sehr viel schwerer zu finden – nach Ansicht von Fachleuten vor allem deshalb, weil es sie gar nicht gibt.
Dasselbe gilt auch für Stonehenge und die vielen anderen Steinkreise im nordwestlichen Europa. Stonehenge wurde vor ungefähr fünftausend Jahren gebaut, als die bäuerliche Lebensweise in der Gegend seit etwa tausend Jahren bestand. Man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass sich das Bauwerk am Sonnenstand der Winter- und Sommersonnenwende orientiert, aber alle anderen Mutmaßungen über astronomische Zusammenhänge sind eher spekulativ. Wegen der 38000 Tierknochen, die in einer drei Kilometer entfernten Siedlung gefunden wurden, kann man vermuten, dass große, vermutlich rituelle Gelage dort stattfanden. Dass Druiden daran teilgenommen haben, ist allerdings unwahrscheinlich, denn die tauchten erst zweitausend Jahre später auf den britischen Inseln auf. Für die Leute, die jedes Jahr in weißen Gewändern über das Monument herfallen und dabei Stöcke und Sicheln schwingen, ist das möglicherweise eine Enttäuschung.
Schriftliche Hinweise darauf, dass die Menschen den Himmel mit größerer Genauigkeit analysierten und bestimmte Erscheinungen ziemlich präzise voraussagen konnten, finden sich erst aus der Zeit vor viertausend Jahren. Mathematik und Schrift ermöglichten diesen Durchbruch.
Gestützt auf die Erkenntnisse der Sumerer definierten die Babylonier etwa 1800 v. Chr. die Tierkreiszeichen anhand der Sternbilder. Sie hatten schon lange den Verdacht, dass die Götter ihnen Warnungen vor künftigen Ereignissen wie Hungersnöten vom Himmel schickten. Priester verzeichneten die Bewegungen der Himmelskörper auf Tontafeln und entwarfen einen Kalender mit zwölf am Mond orientierten Monaten. Das war noch relativ einfach. Aber nachdem sie die Angaben ein paar Generationen lang gesammelt und aufbewahrt hatten, stellten sie mithilfe neuerer mathematischer Methoden fest, dass die Planeten sich von Jahr zu Jahr anders bewegten und erst nach einiger Zeit wieder auf die früheren Bahnen zurückkehrten, sodass gewisse Muster der Wiederholung entstanden. Damit ließ sich dann berechnen, wann und wo ein Planet an einem bestimmten Datum in der Zukunft am Himmel auftauchen würde.
Dass wir die Woche in sieben Tage einteilen, liegt vor allem an den Babyloniern. Sie beobachteten sieben Himmelskörper, kamen zu der Ansicht, dass jeder davon einen Tag verdiente, und teilten die 28 Tage von einem Neumond zum nächsten in vier Einheiten. Die Ägypter rechneten zur gleichen Zeit mit einer Zehn-Tage-Woche, und wenn sie sich durchgesetzt hätten, müssten wir heute noch weitaus mehr arbeiten.
Und das Wochenende? Die Babylonier sahen einen Ruhetag vor, und auch die Kinder Israels ließen uns wissen, dass wir ebenso wie Gott am siebten Tag ruhen sollten. Erst die Gewerkschaften sorgten dafür, dass wir noch einen zweiten Ruhetag kriegten, ob Gott das wollte oder nicht.
Die Assyrer und Ägypter machten ebenfalls große Fortschritte in der Astronomie, aber die Menschen glaubten immer noch, dass die Ereignisse am Himmel von den Göttern verursacht würden. Astronomie und Astrologie waren untrennbar verbunden. Auch die alten Griechen dachten nicht anders, als sie die Arbeit der Pioniere fortsetzten. Die Kosmologie prägten sie wie niemand zuvor, und mit dem Blick auf die Sterne veränderten sie auch, wie wir über die Welt denken.
Die Griechen hatten jahrhundertelang von den Babyloniern gelernt. Auch Pythagoras profitierte von ihrem Wissen, als er circa 550 v. Chr. zu der Erkenntnis gelangte, dass der Morgenstern und der Abendstern ein und derselbe Planet waren: die Venus. Die Durchbrüche, die er und andere erzielten, verdankten sie der Anwendung von Geometrie und Trigonometrie auf kosmische Fragen.
Einer der Größten in diesem Zusammenhang war Hipparch, der auch als Erfinder des Astrolabiums gilt. Das Astrolabium war quasi das Smartphone der Antike, und im Gegensatz zu manchen modernen Geräten gab es kein eingebautes Verfallsdatum. Es wurde fast zweitausend Jahre lang benutzt. Das Astrolabium sagte seinem Benutzer, wo er sich befand, wie spät es war und wann die Sonne untergehen würde. Obendrein stellte es auch noch sein Horoskop. Das alles konnte es mithilfe drehbarer Scheiben ermitteln, die unter anderem die Breitengrade zeigten und bestimmte Sterne verorteten. Aus dem hellenischen Griechenland gelangte das Gerät zu den Arabern und später zu den Westeuropäern. Die Muslime benutzten es, um die Richtung zu finden, in die sie beten mussten (nach Mekka), und Kolumbus benutzte es auf dem Weg nach Amerika.
Schon einige Generationen, ehe Aristoteles sein Opus Über den Himmel schrieb (so ungefähr 350 v. Chr.), wussten die alten Griechen, dass unsere Erde rund ist. Aristoteles gab als Beweis unter anderem an, dass der Schatten der Erde bei einer Mondfinsternis stets eine Krümmung zeigt. Wenn die Erde flach wäre, würde der Erdschatten irgendwann nur noch ein Strich sein, erklärte er.
Entfernungen maßen die alten Griechen in Stadien, und Aristoteles glaubte, die Erde habe einen Umfang von 400000 Stadien, was ungefähr 72000 Kilometern entspricht. Das waren ungefähr 32000 Kilometer zu viel, aber es war dennoch ein großer Fortschritt in unserem Denken.
Hundert Jahre später rechnete Eratosthenes von Kyrene ein bisschen genauer. Er wusste von einem Brunnen in Syene (dem heutigen Assuan), in den die Sonne am Tag der Sommersonnenwende senkrecht hineinschien, ohne einen Schatten darin zu werfen. Dann maß er den Schatten, den ein senkrecht im Boden steckender Pfahl zur selben Zeit in Alexandria warf. Der Unterschied betrug 7,2 Grad, also etwa ein Fünfzigstel eines Kreises. Jetzt musste er nur noch ermitteln, wie weit es von Assuan nach Alexandria war. Er heuerte professionelle Landmesser an, deren regelmäßiges Schrittmaß zuverlässig genug für das Projekt war, und erfuhr, dass die Entfernung fünftausend Stadien betrug. Daraus zog er den Schluss, dass der Umfang der Erde zwischen 40250 und 45900 Kilometern betrug. Heute geht man davon aus, dass der tatsächliche Erdumfang sich auf 40096 Kilometer beläuft.
Im Kern besagte die griechische Wissenschaft, dass dem Universum eine durchgängige Ordnung zugrunde liegt und dass man sie durch Beobachtung und Berechnung finden und auch beschreiben kann. Das bedeutete, dass man sie als natürlichen Vorgang ohne Zutun der Götter begreifen konnte. Die Griechen bemühten sich, den Umfang des Mondes und die Entfernung zwischen Erde und Mond sowie zwischen Sonne und Mond zu berechnen. Allerdings unterschätzten sie die Entfernungen ständig, und obwohl sie theoretische Modelle der Planetenbahnen entwickelten, gingen sie doch davon aus, dass die Planeten nicht die Sonne, sondern die Erde umkreisten – eine Vorstellung, die bis zur Renaissance fortlebte.
Es gab viele große Astronomen in der Antike, und Claudius Ptolemäus (circa 100–170 n. Chr.) fasste ihre Erkenntnisse alle zusammen. Seinen Sternenkatalog mit genauen Ortsangaben gliederte er in achtundvierzig Sternbilder (heute sind es achtundachtzig). Die Namen, die er ihnen gab, sind in vielen Sprachen noch heute geläufig: Wassermann, Pegasus, Stier, Herkules, Steinbock und so weiter. Sein Buch nannte er Mathematike syntaxis (»Mathematische Zusammenstellung«), später dann Megiste syntaxis (»Größte Zusammenstellung«), aber bekannt wurde es unter dem arabischen Namen Almagest. Sein Werk saß allerdings dem gleichen Irrtum auf wie die alten Griechen, denn auch Ptolemäus beharrte auf der Vorstellung, dass die Erde das Zentrum des Universums sei und dass die Planeten und alle anderen Himmelskörper um sie herum kreisten.
Dieses ptolemäische Weltbild beruhte auf dem, was die Leute sahen, und deshalb blieb es rund 1500 Jahre lang gültig. Wir wissen aus der Zeit der Antike von lediglich einer Ausnahme: Aristarch von Samos (etwa 310–230 v. Chr.) vertrat schon damals ein heliozentrisches Weltbild, fand dafür aber nur wenig Anerkennung. Die orthodoxen Schriftgelehrten konnten sich mit der Vorstellung, dass die Erde sich um die Sonne dreht, einfach nicht anfreunden.
Aristarch und andere hatten auch die Entfernung zum Mond bereits richtig berechnet. Die Sonne allerdings, glaubten sie, sei lediglich zwanzigmal so weit weg wie der Mond – damit unterschätzten sie die Entfernung gewaltig, aber ihre Zeitgenossen hielten schon das für stark übertrieben. Die Griechen waren, was die kosmischen Entfernungen angeht, bei weitem zu vorsichtig. Die Berechnungen über das Universum erschreckten sie und überforderten ihre Vorstellungskraft. Proxima Centauri, der Stern, der uns außer der Sonne am nächsten ist, befindet sich etwa 4,34 Lichtjahre (also 40 Billionen Kilometer) entfernt. Selbst das schnellste bisher gebaute Raumschiff würde 18000 Jahre brauchen, um ihn zu erreichen. Auch im 21. Jahrhundert fällt es uns noch schwer, das zu begreifen. Gemessen an dem, was ihnen zur Verfügung stand, gehören die Erkenntnisse der alten Griechen zum Besten, was menschliche Wissenschaft je geleistet hat.
Nach den Griechen hätten als Nächstes die Römer die Chance gehabt, die Astronomie ein Stück weiterzutreiben. Aber sie fanden die Mathematik nicht so interessant wie die Griechen. Stattdessen stürzten sie sich auf die Astrologie, besonders nach dem Ende der Republik im Jahr 27 v. Chr. Die Entfernung zwischen Erde und Sonne war ihnen egal, aber was stellte Mars gerade mit Venus an? Davon konnte das Leben des Kaisers abhängen! Die Römer beschäftigten sich leidenschaftlich mit der Sterndeuterei, vom Beginn der Kaiserzeit bis zum Ende des Westreichs im Jahre 476, das die Astrologen offenbar alle nicht hatten kommen sehen.
In dieser Zeit machten dafür die Chinesen bei der Astronomie und Zeiteinteilung erhebliche Fortschritte. Der Mathematiker Zu Chongzhi (429–500) stellte 463 den Daming-Kalender vor, auch »Kalender großer Helligkeit« genannt. Da seine Erkenntnisse, wie er selbst verlauten ließ, »nicht von Gespenstern und Geistern« stammten, sondern auf »sorgfältigen Beobachtungen und Berechnungen« beruhten, gelang es ihm, das Jahr mit einer Genauigkeit von 99,9998 Prozent festzulegen. Sein Kalender sollte 391 Jahre lang gültig sein, und erst nach 144 Jahren hätte ein Monat zusätzlich eingefügt werden müssen, weil seine Jahre ein kleines bisschen zu lang waren.
Hinter Zus Berechnungen stand dasselbe Ethos wie bei den Griechen. Er wollte empirische Fakten prüfen, um die Welt zu erklären. Aber in den meisten Teilen der Welt herrschte noch der Dämonen- und Geisterglaube. Erst die Wissensexplosion im »Goldenen Zeitalter« des Islam (750–1258), dessen Reich damals von Zentralasien bis nach Spanien reichte und dessen Gelehrte über Kenntnisse der Inder ebenso verfügten wie über die der Griechen, brachte unsere Kenntnisse entscheidend voran.
Im Jahr 900 verkürzte al-Battani die Länge eines Jahres um ein paar Minuten und trug damit dem Umstand Rechnung, dass sich die Entfernung zwischen Erde und Sonne im Lauf des Jahres verändert. Das wiederum bedeutete, dass vielleicht auch die Planeten nicht auf perfekten Kreisbahnen liefen. Manche Gelehrte begannen daran zu zweifeln, dass sich die Erde so gar nicht bewegte, und es setzte sich die Erkenntnis durch, dass sie sich immerhin um sich selbst drehte. Ein brillanter Universalgelehrter namens Nasir at-Tusi stellte einige Punkte des ptolemäischen Weltbilds infrage, die nicht auf dem Prinzip der einheitlichen Kreisbahn beruhten. Allerdings gelang auch ihm nicht der Sprung zum heliozentrischen Weltbild, wonach die Erde um die Sonne kreist.
Während der Islam blühte, lag Westeuropa im Dunkel des »finsteren Mittelalters« (das in letzter Zeit zum »frühen Mittelalter« aufgewertet worden ist). Damit ist die Epoche zwischen dem Ende des weströmischen Reichs im 5. Jahrhundert und der Wiederkehr des urbanen Lebens im 10. Jahrhundert gemeint. Es war eine Zeit, in der es für alles und jeden einen zugewiesenen Platz gab und alles auch genau an seinem Platz war: Alle Himmelskörper umkreisten die Erde, die das Zentrum des Universums war. Darüber thronte Gott, und auf Erden gab es Könige, Bischöfe, Barone und Leibeigene. Jeder hatte zufrieden zu sein mit seinem Los. Da sie meist nicht schreiben konnten, weiß man allerdings nicht, ob die Leibeigenen mit dieser Regelung tatsächlich so einverstanden waren.
Der Begriff »finsteres Mittelalter« stammt von dem italienischen Historiker und Dichter Francesco Petrarca (1304–1374), den das Fehlen historischer Quellen nach dem Ende des Römischen Reiches beunruhigte und der daraus den Schluss zog, dass die Europäer damals im Vergleich zu den Griechen und Römern der Antike »in Dunkelheit« gelebt haben müssten. In seinem Epos Africa schrieb er: »Dieser Schlaf des Vergessens wird aber nicht ewig währen. Wenn die Dunkelheit aufgelöst worden ist, werden unsere Nachkommen wieder im hellen Licht wandeln.« Petrarca lebte kurz vor dem Ausbruch der Renaissance, einer Zeit, die ihm sicher von großer Helligkeit erschienen wäre. Zumindest galt das für die Astronomie, die den Ort des Menschen im Kosmos bald deutlich beleuchten sollte.
Im frühen Mittelalter waren die großen astronomischen Texte der Antike den Westeuropäern nicht zugänglich. Das änderte sich erst, als Männer wie Gerhard von Cremona (1114–1187) nach Toledo zogen, Arabisch lernten und den Almagest des Ptolemäus aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzten (die originale griechische Version war zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren verschollen). Er war das erste von achtzig Werken, die aus der Übersetzerschule von Toledo den Weg nach Europa fanden und das Fundament für die Renaissance und die wissenschaftliche Revolution des 16. Jahrhunderts legten.
Im Bereich der Astronomie war das jedoch mühsam, denn das geozentrische Weltbild des Ptolemäus war von der katholischen Kirche anerkannt und in ihrem Dogma verankert worden – und wehe dem Ketzer, der es zu widerlegen versuchte!
Die europäische Astronomie brauchte Jahrhunderte, um zu den Erkenntnissen der antiken und der islamischen Wissenschaft aufzuschließen. Erst 1543 betrat sie wirkliches Neuland. In diesem Jahr veröffentlichte Nikolaus Kopernikus aus Thorn sein Hauptwerk De revolutionibus orbium coelestium (»Über die Umlaufbahnen der Himmelssphären«), das den Schluss nahelegte, das geozentrische Weltbild sei falsch.
Kopernikus formulierte es vorsichtig: »Wenn die Erde in Bewegung wäre.« Die Kritik war zunächst genauso gedämpft. Er war immerhin ein loyales Mitglied der katholischen Kirche. Und er hatte »wenn« geschrieben. Außerdem starb er sicherheitshalber zwei Monate nach Veröffentlichung seines Buches. Dennoch waren sowohl katholische als auch protestantische Kleriker bemüht, seine Berechnungen zu widerlegen. Die Wissenschaft wurde ermahnt, die Lehren der Kirche nicht anzuzweifeln.
1584 veröffentlichte der italienische Astronom Giordano Bruno trotzdem sein Buch De l’infinito, universo e mondi (»Über das Unendliche, das Universum und die Welten«), in dem er Kopernikus verteidigte. Das Universum sei unendlich, erklärte er, es gäbe unendlich viele Welten darin, die auch von intelligenten Wesen bewohnt seien. Er wurde vor Gericht gestellt, und als er sich nach beinahe acht Jahren im Kerker immer noch weigerte, seine Thesen zu widerrufen, wurde er zum Ketzer erklärt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Unter anderem wurde ihm vorgeworfen, er habe an der Transsubstantiation gezweifelt.
Als Nächster war Galileo dran. Er war der erste Wissenschaftler, der das neu erfundene Fernrohr benutzte, um systematische Beobachtungen am nächtlichen Himmel zu machen. 1610 veröffentlichte er seine Schrift Sidereus Nuncius. Dieser »Sternenbote« machte Galileo bekannt, kostete ihn aber, da er das geozentrische Weltbild infrage stellte, beinahe das Leben.
Seine Beschreibung der Bahnen der Planeten passte offensichtlich zur Theorie des Kopernikus, dass diese (einschließlich der Erde) sich um die Sonne drehten. Es dauerte nicht lange, bis man ihn der Ketzerei beschuldigte, weil er der Bibel widersprochen habe. Dabei berief man sich vor allem auf Josua 10, 12–13, wo Josua nach einem Gespräch mit dem Herrn sagt: »Sonne, bleib stehen über Gibeon / und du, Mond, über dem Tal von Ajalon!« und die Sonne tatsächlich stehen bleibt, und der Mond auch, »bis das Volk an seinen Feinden Rache genommen hatte«. Wenn die Heilige Schrift erklärte, dass sich die Sonne bewegte, wer konnte dann zu behaupten wagen, dass sie es nicht tat?
Der Papst befahl, die Theorie zu verbieten. Die Kirche wusste, dass solche neuen Ideen gefährlich waren, weil sie die hierarchische Ordnung der Welt unterminieren, ihre Legitimität infrage stellen und ihre Macht beseitigen konnten. Wenn die Erde nicht länger das Zentrum des Universums war, wenn es so ein Zentrum vielleicht gar nicht gab – waren dann die Menschen womöglich gar nicht so wichtig? Der französische Theologe und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) erklärte es so: »Wenn ich die kurze Dauer meines Lebens betrachte, das von der vorhergehenden und der darauffolgenden Ewigkeit aufgesogen wird, und den kleinen Raum, den ich ausfülle und den ich noch dazu von der Unendlichkeit der Räume verschlungen sehe, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen, dann erschrecke ich.«
Galileo erklärte sich bereit, stillzuhalten. Aber 1623 wurde sein Förderer Maffeo Barberini zum Papst gewählt (Urban VIII.), und nach einer Audienz bei ihm hielt es Galileo für möglich, an seinem Dialog über die beiden Weltsysteme (Dialogo di Galileo Galilei sopra i due Massimi Sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano) zu arbeiten, der 1632 veröffentlicht wurde. Es war eine sehr ausgewogene Darstellung, aber letztlich erschien es doch ziemlich wahrscheinlich, dass sich die Erde bewegte. Der Papst, der wohl gehofft hatte, Galileo könne nachweisen, dass die Erde stillsteht, war gar nicht glücklich darüber, und es begann ein zwei Monate langes Verfahren.
Galileo verteidigte sich damit, dass er nicht beabsichtigt habe, das kopernikanische Weltbild zu unterstützen, sondern lediglich ermöglichen wolle, dass man es diskutierte. Es nutzte nichts. Er wurde für schuldig befunden, die falsche und der Bibel widersprechende Lehre geglaubt und verteidigt zu haben, dass die Erde sich bewegt und nicht das Zentrum der Welt sei. Er wurde bis zu seinem Tod im Jahr 1642 unter Hausarrest gestellt und aufgefordert, einmal wöchentlich die sieben Bußpsalmen aufzusagen.
Es hätte schlimmer kommen können. Wenn er kein so bekannter Wissenschaftler gewesen wäre, hätte er womöglich denselben qualvollen Tod wie Giordano Bruno erlitten. (Immerhin: 1992, kaum 360 Jahre später, gab der Vatikan zu, sich geirrt zu haben.)
Trotz des päpstlichen (nicht unbedingt göttlichen) Zorns musste die Kirche weiter gegen die wissenschaftlichen Strömungen ankämpfen. Die Erforschung des Himmels hatte jahrhundertealte Weisheiten umgestürzt und ein ganz neues Weltbild geschaffen. Die alten Götter wurden infrage gestellt, ob mit oder ohne Absicht.
Ein Jahr nach Galileos Tod wurde Isaac Newton geboren. Er baute ein neues Fernrohr, ein richtiges Teleskop, das tiefere Einblicke ins Weltall erlaubte als jemals zuvor. Seine Principia von 1687 und andere Werke verkündeten der Welt die Gesetze der Schwerkraft, der Mechanik und der Bewegung und eröffneten ein neues Zeitalter der Physik und Astronomie.
Newton wollte Gott nicht etwa begraben, sondern lobte ihn in den höchsten Tönen. Je weiter er den Kosmos erforschte, desto überzeugter wurde er, dass es sich um eine herrliche Schöpfung eines genialen Schöpfergotts handelte. »Dieses wunderschöne System der Sonne, der Planeten und Kometen kann nur aus dem Ratschluss und der Herrschaft eines intelligenten und mächtigen Wesens herrühren.«
Newton war durchaus der Ansicht, dass die Erde die Sonne umkreiste. Galileo hatte bereits mit der Schwerkraft experimentiert, indem er, wie erzählt wird, Gegenstände vom schiefen Turm von Pisa herabfallen ließ, aber erst Newton erklärte in einer mathematischen Formel, dass die Gesetze der Schwerkraft alle Gegenstände betrafen und im Weltraum ebenso wie auf der Erde galten. So wie andere kluge Köpfe vor ihm erreichte er eine revolutionäre Erkenntnis dadurch, dass er empirische Beobachtungen damit verknüpfte, dass er sich hinsetzte und nachdachte.
Warum fiel der Apfel in einer geraden Linie zu Boden? Warum fiel eine Kanonenkugel in einer flachen Kurve herunter, wenn sie an Geschwindigkeit einbüßte? Welche Kraft zog sie herunter? Newtons universelles Gesetz der Schwerkraft besagte, dass alle Körper sich gegenseitig anziehen, wobei die Anziehungskraft einerseits von der Masse der Körper und andererseits von der Entfernung bestimmt wird. Wenn man also einen Apfel vom höchsten Berg hinauf in den Himmel warf, flog er nicht in gerader Linie ins Weltall, sondern fiel früher oder später aufgrund der Schwerkraft wieder zur Erde. Diese Gravitation, abgeleitet vom lateinischen Wort gravitas, was Schwere oder Gewicht bedeutet, erklärte, warum die Planeten um die Sonne kreisten und nicht ins Weltall hinaussegelten. Je näher sich ein Objekt an einem größeren befindet, desto größer ist diese Anziehungskraft.
Es gab leisen Widerstand gegen seine Theorien, weil sie manche Wissenschaftler an abergläubische Vorstellungen der Vergangenheit erinnerten, die von übernatürlichen Kräften ausgingen. Aber Newton begründete seine Theorien mathematisch und rational und hielt im Übrigen an seinem Gott fest. Er leistete noch vieles andere, und es gibt Leute, die seine wissenschaftlichen Errungenschaften für die größten aller Zeiten halten. Als er 1727 starb, wurde sein Leichnam eine Woche lang in der Westminster Abbey aufgebahrt. Der englische Dichter Alexander Pope schrieb: »Gott sagte: Es werde Newton! Und es ward Licht.«
Es war eine ähnlich aufregende Zeit für die Wissenschaft wie der Hellenismus und das Goldene Zeitalter des Islam, und die Wissenschaft schritt schneller voran als jemals zuvor. Fast jede Entdeckung schlug eine Bresche in die Festung der organisierten Kirche und ihre Machtansprüche. Im Zeitalter der Aufklärung war es sinnlos geworden, einem Wissenschaftler zu erklären, er solle die Bußpsalmen aufsagen, weil er der Heiligen Schrift widersprochen habe.
Unser Blick in den Himmel hatte zu einer Revolution geführt, die unser ganzes Selbstverständnis und unsere Lebensweise veränderte und den Weg zu weiteren Erkenntnissen öffnete. Die Kirche zog sich in den technologisch entwickelten Ländern immer mehr in die Gotteshäuser zurück und überließ die weltliche Sphäre der Wissenschaft.
Seither haben wir noch viele weitere Dinge gelernt, und unsere Wissenschaft tritt geradezu majestätisch auf. Wir sehen fast bis in die Unendlichkeit, wenn wir zum Himmel aufschauen. Ein modernes Teleskop kann sogar in der Zeit zurückblicken und zeigt uns Licht, das mehr als 13000000000 Jahre gereist ist, ehe es unser Auge erreicht.
1931 veröffentlichte Georges Lemaître einen Aufsatz, in dem er die Idee des Urknalls vorstellte. Demnach hatte die Explosion eines einzigen unendlich dichten »Ur-Atoms« zur Entstehung des Universums geführt. Dabei stützte er sich auf die Beobachtungen, die Edwin Hubble in den Zwanzigerjahren mithilfe des riesigen Hooker-Teleskops am Mount Wilson in Kalifornien gemacht hatte. Sie ließen vermuten, dass sich alle sichtbaren Galaxien mit großer Geschwindigkeit in alle Richtungen von der Erde entfernten. Rein rechnerisch musste man also vermuten, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem einzigen Punkt konzentriert gewesen waren, ehe sie explodierten. Diese Theorie wurde als »Big Bang« bekannt. Bis dahin war man weitestgehend von einer »Steady State«-Theorie ausgegangen, wonach das Universum immer schon existiert hatte und das auch so bleiben würde. Aber neue Messungen der Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxien bewegten, gaben Anlass zu der Vermutung, das Universum sei vor 13,7 Milliarden Jahren entstanden. Es war eine weitere revolutionäre Veränderung in unserer Wahrnehmung.
1990 wurde ein zwölf Tonnen schweres, nach Edwin Hubble benanntes Teleskop in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Von den Beschränkungen und Verzerrungen der Erdatmosphäre befreit, blickte das Teleskop tiefer ins Weltall hinaus als jedes andere zuvor und zeigte uns Bilder aus der fernsten Vergangenheit – bis hin zu einem Zeitpunkt, der nur Mikrosekunden nach dem Big Bang lag. Heute können Infrarot-Teleskope auch Strahlen einfangen, die kosmischen Staub durchdringen, aber für das menschliche Auge und Hubble unsichtbar sind. Wenn man ihre Wellenlängen und ihre Zusammensetzung ermittelt, erhält man weiteres Datenmaterial über die Geschichte des Universums.
All diese Untersuchungen sind von dem Bedürfnis getrieben, das Wie und Warum zu erforschen. Die Frage nach dem Wie weiß die Wissenschaft meist zu beantworten, aber dann stellt sich die Frage nach dem Warum nur umso dringlicher. Trotz unseres fortgeschrittenen Wissens haben wir das Wunder des Universums noch längst nicht begriffen. Die Entdeckungen und Theorien des 20. Jahrhunderts machen das Staunen nur größer und haben Fragen aufgeworfen, die man wahrscheinlich nur durch die Erforschung der physischen Realitäten des Alls klären kann.
In den ersten beiden Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts wurde die Welt mit den befremdlich neuen Gedanken der Quantenmechanik, Einsteins Relativitätstheorie und seiner »Raumzeit« konfrontiert. Die Quantentheorie besagt, dass in der subatomaren Welt der kleinsten bekannten Teilchen totale Zufälligkeit herrscht, was sowohl Einsteins als auch Newtons Ansicht widerspricht, dass es allgemeingültige physikalische Gesetze gibt. Die Debatte ist insofern interessant, als die meisten von uns sich in bester Gesellschaft befinden, wenn sie die Quantenphysik nicht verstehen, aber uns Einsteins Reaktion auf diese Theorie einige Hinweise gibt, warum sich unser Schicksal im Weltall entscheiden könnte.
Die Theorie der Quantenverschränkung behauptet, dass ein Teilchen ein anderes auch dann augenblicklich beeinflussen kann, wenn es hunderte Millionen Kilometer entfernt ist. Das Schlüsselwort dabei lautet: augenblicklich. Das passt nämlich gar nicht zu der anerkannten Vorstellung, dass es Naturgesetze gibt, die allgemein gelten. Einstein hatte ja festgestellt, dass im Universum nichts schneller sein könne als Licht. Die von der Quantenmechanik behauptete »spukhafte Fernwirkung« zwischen den Teilchen lehnte er ab, und die Wissenschaft streitet heute noch, ob es sie gibt. Trotzdem bleibt damit die Möglichkeit offen, dass die Naturgesetze nicht allgemeingültig sind. Und wenn das so wäre, könnte es womöglich doch etwas geben, was schneller als Licht ist, so unwahrscheinlich auch immer es sein mag. Einstein blieb in diesem Punkt jedoch eindeutig: »Gott würfelt nicht«, sagte er.
Einstein war ebenso wie Newton der Ansicht, dass der Weltraum drei Dimensionen hat: Höhe, Breite und Länge. Newton glaubte, dass die Himmelskörper diese Dimensionen nicht weiter beeinflussten. Einstein dagegen kam zu dem Ergebnis, dass sie das durchaus taten, denn seine Allgemeine Relativitätstheorie hatte eine vierte Dimension hinzugefügt: Zeit. Er nannte die Kombination aus den vier Dimensionen »Raumzeit«. Dieses vierdimensionale Modell konnte durch große Massen durchaus verformt, verlangsamt oder beschleunigt werden. Den Weltraum konnte man sich dabei wie eine Schaumstoffmatratze vorstellen. Wenn man sich draufstellt, verformt sie sich. Das Gewicht führt zu einer Einsenkung. Nach Einstein führt die Gravitation zu einer solchen Einsenkung oder Krümmung der Raumzeit.
Unsere Vorfahren schauten zum Himmel auf und sahen ein Universum, das sie nicht verstehen konnten, aber sie benutzten seine scheinbare Ordnung, um ihre eigene Welt zu erklären. Heute wissen wir sehr viel mehr, stehen aber immer noch vor einem unendlichen Universum voller Rätsel. Da gibt es dunkle Materie, Schwarze Löcher, Krümmungen, Verwerfungen in der Raumzeit und jede Menge Herausforderungen für unseren Ordnungssinn. Das wusste schon Newton, als er sagte: »Was wir wissen, ist nur ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist aber ein Ozean.«
Die Auswirkungen der Quantenmechanik und der Besonderheiten der Raumzeit auf die Möglichkeiten der Raumfahrt sind uns heute noch unbekannt, aber dass sie in ferner Zukunft neue Wege eröffnen, ist nicht ganz ausgeschlossen. Nach Jahrtausenden der Entdeckungen gibt es immer noch weit mehr Fragen als Antworten, und sogar Fragen, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Manche dieser Fragen und Antworten werden erst auftauchen, wenn wir uns von der Erde entfernen. Aber der Wunsch, diese Dinge herauszufinden und mehr zu wissen, ja vielleicht sogar selbst ins All vorzustoßen, hat sich als unwiderstehlich erwiesen.
ZWEITESKAPITELDERWEGNACHOBEN
»Ich sehe die Erde! Sie ist so schön!«
Juri Gagarin
Astronaut Edwin Aldrin neben der US-amerikanischen Flagge auf dem Mond, 21. Juli 1969.
Die Grenze zum Weltall haben wir erst vor kurzer Zeit überschritten. Nach jahrtausendelanger, langsamer Vorbereitung folgte im 20. Jahrhundert ein erstaunlicher Sprint in wenigen Jahrzehnten der Zeichen und Wunder.
Was uns schließlich hinaufführte, waren allerdings irdische Streitereien. Denn die Technologie, die uns in den Himmel brachte, war ein Produkt des Rüstungswettlaufs im Kalten Krieg.
In der Menschheitsgeschichte war das Weltall immer ganz nahe und doch sehr weit weg. Der britische Astronom Fred Hoyle sagte 1979: »Die Entfernung zum Weltraum ist gar nicht groß. Er wäre nur eine Stunde Fahrzeit entfernt, wenn man mit dem Auto senkrecht nach oben könnte.« Aber die Ingenieure der Formel 1 könnten die Motoren ihrer Boliden noch so sehr hochzüchten, auf die 7,9 Kilometer pro Sekunde, die nötig sind, um die Oberfläche der Erde zu verlassen und auf eine Erdumlaufbahn zu gelangen, kommen sie doch nie. Eine Rakete dagegen …
Eigentlich eine einfache Sache, so eine Rakete. So einfach, dass wir sie im Laden kaufen und zum Geburtstag oder an Silvester im Garten abfeuern können. Sie ins Weltall zu schießen und einen Menschen damit zu befördern, ist dagegen so kompliziert und so aufwendig, dass es bisher erst drei Länder geschafft haben.
Eins der Probleme besteht darin, dass man die Menschen praktisch auf riesige Treibstofftanks setzt und die dann in Brand steckt. Der Space-Shuttle-Astronaut und Professor für Maschinenbau Mike Massimino beschrieb es in seinem autobiografischen Buch Spaceman sehr treffend. Beim Anblick der vergnügten Kollegen, mit denen er zur Abschussrampe marschierte, dachte er: »Sind die verrückt? Wissen sie denn nicht, dass wir uns jetzt gleich an eine Bombe schnallen, die uns hunderte Meilen hinauf in den Himmel sprengt?«
In der Tat. Der Außentank der Raumfähre enthielt 650000 Liter flüssigen Sauerstoff und 1700000 Liter flüssigen Wasserstoff. Die verbrannten die Triebwerke dann mit rasendem Tempo: Der Tank leerte sich so schnell, als hätte man alle zehn Sekunden einen Familien-Swimmingpool ausgekippt.
Im Prinzip war das immer noch dieselbe Technologie, die im 9. Jahrhundert von chinesischen Mönchen erfunden wurde, die eine Mischung aus Schwefel, Kaliumnitrat und Holzkohle, das sogenannte »Schwarzpulver«, für ihre Feuerwerkskörper benutzten. Aus denen wurden dann »fliegende Feuerlanzen« – Raketen mit eigenem Antrieb. Schon kurz vor oder nach dem Jahr 1500 soll sogar jemand versucht haben, die Sterne damit zu erreichen. Der Legende nach befestigte der MandarinWan Hu siebenundvierzig Schwarzpulverraketen an einem Bambusstuhl, band sich daran fest und befahl seinen Dienern, das Zündpapier anzustecken. Er flog tatsächlich ein Stück in die Höhe und verschwand dann in den Rauchwolken der Explosion. Er wurde nie wieder gesehen, und auch der Stuhl blieb verschwunden. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Geschichte tatsächlich passiert ist. Aber es gibt jetzt einen Mondkrater, der nach Wan Hu benannt ist.
Im Lauf der Jahrhunderte hat es – mit wechselnden Ergebnissen – noch weitere Versuche zum Bau von Raketen gegeben; aber wenn man nach den Vorfahren der modernen Trägerraketen sucht, nennen die Historiker der Raumfahrt meist nur drei Namen: Konstantin Ziolkowski (1857–1935), Robert Goddard (1882–1945) und Hermann Oberth (1894–1989). Alle drei waren geniale Pioniere auf diesem Gebiet. Der Amerikaner Robert Goddard war der Erste, der (am 16. März 1926) eine Rakete mit flüssigem Brennstoff zum Abheben brachte – im Gegensatz zu den im China des 9. Jahrhunderts erfundenen Feststoff-Raketen mit Schwarzpulver-Treibstoff. Hermann Oberth aus Siebenbürgen, der schon früh mit den Nazis sympathisierte, wurde aufgrund seiner früheren Veröffentlichungen 1941 an die Heeresversuchsanstalt Peenemünde berufen, wo er an der Entwicklung der V2 (»Vergeltungswaffe 2«) mitarbeitete, die im Zweiten Weltkrieg gegen zivile Ziele eingesetzt wurde. Er unternahm auch Selbstversuche, um zu überprüfen, welche Belastungen der menschliche Körper bei einem Raketenstart und in der Schwerelosigkeit aushalten könnte. Der bedeutendste der drei ist aber wohl Ziolkowski, und zwar aufgrund seiner genialen Vorstellungskraft.
Schon 1903, sieben Monate, ehe das erste motorisierte Flugzeug gestartet war, veröffentlichte der russische Mathematiklehrer einen Aufsatz mit der »Raketengrundgleichung«, die durch eine Berechnung der Schubkraft, des Verbrauchs von Treibstoff und der Geschwindigkeit von Raketen theoretisch nachwies, dass Raumfahrt möglich war. Im selben Jahr flogen die Brüder Wright mit ihrem Motorgleiter in die Geschichtsbücher, während Ziolkowski bis heute nahezu unbekannt ist, obwohl er einer der weitblickendsten Wissenschaftler überhaupt war.
Als fünftes von achtzehn Kindern eines Forstbeamten und seiner tatarischen Frau, erkrankte er mit zehn Jahren an Scharlach und wurde nahezu taub, verließ mit vierzehn die Schule und konnte sich nur noch mit Büchern über Physik, Astronomie und analytische Mechanik aus einer öffentlichen Bibliothek weiterbilden. Auch die Romane von Jules Verne gehörten zu seiner Lektüre. »Außer den Büchern hatte ich keine anderen Lehrer«, schrieb er später.
Schon seine ersten Schriften enthielten visionäre Ideen: Raumstationen, die mit Sonnenenergie betrieben werden; Gyroskope zur Lenkung von Raumschiffen; Luftschleusen, die es erlauben, von einem Raumschiff ins andere zu kommen; Druckanzüge, die es Kosmonauten erlauben, außerhalb ihres Raumschiffs zu arbeiten. Bereits 1895 konzipierte er einen »Weltraumlift«. Sein Aufsatz über die Erforschung des Weltraums mittels Reaktionsapparaten aus dem Jahr 1903, der ihn später berühmt machte, enthielt den ersten mathematischen Beweis, dass eine Rakete die Atmosphäre durchdringen und eine Umlaufbahn um die Erde erreichen kann. Ziolkowski hatte die vertikale Geschwindigkeit ermittelt, die man erreichen muss, um die Erdanziehung zu überwinden, und dass eine Rakete mit einem Treibstoffgemisch aus Sauer- und Wasserstoff dazu in der Lage wäre. Diese nach Ziolkowski benannte Raketengrundgleichung ist die Grundlage für alle Weltraumflüge.
Als die Kommunisten die Macht übernahmen, waren sie gegenüber den quasi-theologischen Gedanken Ziolkowskis sehr misstrauisch. In seinem Aufsatz Gibt es einen Gott? hatte er geschrieben: »Wir unterliegen alle dem Willen und der Herrschaft des Kosmos … wir sind Marionetten, mechanische Puppen.« In Wirklichkeit beherrschte ihn jedoch das Sowjetsystem. Einmal wurde er sogar vom NKDW verhaftet und einige Wochen lang wegen »antisowjetischer Propaganda« im berüchtigten Lubjanka-Gefängnis in Moskau verhört.
Später allerdings erkannten die Sowjets seinen Propagandawert, und er durfte weiter veröffentlichen. 1929 erschien sein Aufsatz über eine Mehrstufenrakete.
Er erlangte in seiner Heimat schließlich doch großen Ruhm, und heute wird er als »Vater der Raumfahrt« und »Vater der Raketentechnik« bezeichnet. Sein bescheidenes Wohnhaus in Kaluga ist öffentlich zugänglich, und in der Nähe befindet sich das nach ihm benannte Staatliche Museum für Raumfahrtgeschichte. Auf der Rückseite des Mondes ist ein großer, von der sowjetischen Raumsonde Luna 3 entdeckter Krater nach dem Visionär benannt, der wusste, dass aus Science-Fiction Fakten werden können.
Science-Fiction-Kennern ist all das bekannt. In der Computerspiel-Serie Assassin’s Creed liest eine Figur aus ZiolkowskisDer Wille des Universums (1928) vor. Und in einer Episode von Star Trek wird ein Raumschiff nach ihm benannt. Er wird in zwei von Sid Meiers Videospielen zitiert und in einer Kurzgeschichte von William Gibson namentlich erwähnt. Beide kannten sicher auch den meistzitierten Spruch von Ziolkowski: »Die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber man kann nicht für immer in der Wiege bleiben.« Kurz vor seinem Tod schrieb er noch: »Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt, dass meine Arbeit die Menschheit zumindest ein bisschen voranbringt.« Das hat sie.
Die Theorie in die Praxis umzusetzen war allerdings schwer. Denn um Ziolkowskis Raketengleichung zu erfüllen, ist eine enorme Beschleunigung nötig. Dafür wiederum braucht man viel Treibstoff. Je mehr man beschleunigen will, desto mehr Treibstoff braucht man. Und je mehr Treibstoff man braucht, desto schwerer wird das Gefährt, das ihn mitführt.
Viele Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts kämpften mit diesem Problem. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es einige Fortschritte, aber erst der Krieg und dann der Kalte Krieg trieben die Raketentechnik entscheidend voran – einfach, weil beide Seiten gewinnen wollten.
Sowohl die Deutschen als auch die Sowjets und die Japaner experimentierten mit raketengetriebenen (Düsen-)Flugzeugen, und die Japaner bauten sogar einen raketengetriebenen Kamikaze-Bomber. Wegweisend aber wurde das deutsche Raketenprogramm in Peenemünde unter der technischen Leitung von Wernher von Braun, der sich auf die Arbeit von Hermann Oberth stützte. Wernher von Braun war Mitglied der NSDAP und auch der SS.
Anfang Oktober 1942 gelang es ihm, mit dem 14 Meter hohen, 13 Tonnen schweren »Aggregat 4« (der ersten Großrakete der Welt) auf eine Gipfelhöhe von 84,5 Kilometern und damit in den Grenzbereich des Weltraums vorzustoßen, am 20. Juni 1944 wurde dann sogar eine Gipfelhöhe von über 174 Kilometern erreicht. Daraufhin wurde die Rakete vom Propagandaministerium als »V2« bezeichnet und auf Befehl Hitlers die Serienherstellung beschlossen. Mit bis zu 5300 Stundenkilometern und einer Reichweite von 320 Kilometern erreichte die Rakete zwar nicht die nötige Geschwindigkeit, um die Erdanziehung zu überwinden, aber als Waffe mit einer »Nutzlast« von über 700 Kilogramm Sprengstoff hatte sie eine große psychologische Wirkung. Wegen ihrer hohen Geschwindigkeit konnte man sie kaum abfangen, denn sie schlug schon drei bis fünf Minuten nach dem Start ein. Ihre Zielgenauigkeit war allerdings so gering, dass praktisch nur zivile Ziele getroffen wurden.
Als Hitlers »Tausendjähriges Reich« nach zwölf Jahren zusammenbrach, setzten sich Wernher von Braun und seine Kollegen nach Bayern ab und ergaben sich den Amerikanern. Ein kluger Schachzug, denn sonst wären sie vielleicht den Russen in die Hände gefallen, die ebenfalls auf der Suche nach den deutschen Geheimwaffen und den Männern waren, die sie konstruiert hatten.
Im Rahmen der »Operation Paperclip« wurden von Braun und ungefähr 120 weitere deutsche Wissenschaftler klammheimlich in die USA geflogen. Die politische Vergangenheit der Männer wurde verschwiegen. Viele von ihnen waren fanatische Nazis (gewesen), aber statt in Nürnberg vor Gericht gestellt und womöglich gehängt zu werden, wurden sie unter Vertrag genommen. Beim Bau der ungefähr dreitausend V2-Raketen kamen zwölftausend Zwangsarbeiter ums Leben. (Einige davon hatte von Braun persönlich in Buchenwald ausgesucht.) Beim Einsatz der Waffe wurden in London, Antwerpen und anderen Städten weitere achttausend Menschen getötet.
Wernher von Braun, der verantwortliche technische Leiter beim Bau der V2, ließ das alles hinter sich. Im Oktober 1959 wurden der immer gut gelaunte und wortgewandte Raketentechniker und sein Team offiziell der NASA unterstellt, und im nächsten Jahr wurde er Direktor des Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, das Raumfahrtprojekte vorantreiben sollte. Seine V2-Raketen, soll er gesagt haben, seien völlig in Ordnung gewesen, nur leider auf dem falschen Planeten gelandet. Seine moralische Lässigkeit fand ihre Entsprechung bei den Amerikanern, die seine Vergangenheit völlig vergaßen, weil sie ihn für ihren neuen, den Kalten Krieg brauchten.
Die Russen verhielten sich ähnlich. Ihre »Operation Paperclip« hieß »Aktion Ossawakim«. Im Oktober 1946 wurden vom sowjetischen Geheimdienst und der Militäradministration (SMAD) mehr als 2200 deutsche Wissenschaftler und noch einmal doppelt so viele Familienangehörige nach Russland gebracht, wo sie in verschiedenen Bereichen, darunter auch am Raketenbau, arbeiten sollten. Der Kalte Krieg hatte endgültig begonnen.
Die Menschen lebten damals im Schatten der Bombe. Die Schulkinder mussten »Duck and Cover«-Übungen mitmachen, die vor der Atombombe schützen sollten, und tausende Amerikaner bauten private Schutzbunker auf ihren Grundstücken, deren Wert im Fall eines thermonuklearen Waffengangs allerdings ziemlich fragwürdig war. Im August 1949 (vier Jahre nach dem Abwurf der amerikanischen A-Bomben über Hiroshima und Nagasaki) fand in einem abgelegenen Gebiet Kasachstans der erste Atomwaffentest der Sowjetunion statt. Ein amerikanisches Spionageflugzeug fing an der sibirischen Küste Spuren der radioaktiven Strahlung auf, und ein paar Wochen später teilte Präsident Truman der Welt mit, dass jetzt auch die Sowjetunion eine Atommacht war. Ein Atomkrieg zwischen den beiden Ländern war nicht mehr auszuschließen. Die Gefahr eines nuklearen Holocausts wuchs zusätzlich, als die Wasserstoffbomben entwickelt wurden.
Zu den Waffen im Kalten Krieg gehörte es, der gegnerischen Seite die Überlegenheit des eigenen politischen Systems zu beweisen, indem man seine Technologien zur Schau stellte. Wer die bessere Technik – und Rüstung – hatte, galt auch politisch als überlegen. Deshalb wurden in den Fünfzigerjahren ballistische Raketen gebaut, die Satelliten aussetzen konnten. Diese wiederum konnten die Dichte der Atmosphäre am Rande des Weltraums messen, Radiowellen untersuchen und Objekte beobachten, die sich auf den Umlaufbahnen befanden. Aber natürlich konnten die Raketen auch für ganz andere Zwecke verwendet werden.
Das sowjetische Raketenprogramm leitete Sergei Koroljow. Bei den stalinistischen »Säuberungen« des Großen Terrors war er 1938 verhaftet worden. Er hatte unter Folter »gestanden«, Mitglied einer konterrevolutionären Verschwörung zu sein und war in den Gulag geschickt worden. In einem sibirischen Straflager hatte man ihn hungern lassen, er verlor viele Zähne und auch sein Unterkiefer wurde beschädigt. Der drohende Krieg mit Deutschland führte dann dazu, dass er in ein Lager in der Nähe von Moskau verlegt wurde, wo er unter Aufsicht des NKDW an der Konstruktion von Flugzeugen arbeitete. Nach dem Krieg stieg er zum Chefkonstrukteur des sowjetischen Raketenprogramms auf, aber sein Name und seine Vergangenheit blieben geheim. Sein Befehl während des Kalten Krieges lautete dann: »Schlag die Amerikaner, schaff es zuerst.« Das gelang ihm. Mit vier Monaten Vorsprung.
Anfang Oktober 1957 fingen Kurzwellen-Funkamateure an der amerikanischen Ostküste eine Serie von eigenartigen Pieptönen auf. Einige von ihnen machten Tonbandaufnahmen und schon Stunden später vernahmen Amerikas Radiohörer und Fernsehzuschauer das Beep-Beep-Beep des ersten menschengemachten Geräts auf einer Umlaufbahn im erdnahen Raum. Die Schwelle zum Weltall war überschritten. Das Raumzeitalter hatte begonnen.
Sputnik 1 (Iskustveni Sputnik Zemli oder »Künstlicher Weggefährte der Erde«) war am 4. Oktober 1957 ins All aufgestiegen. Es war ein einfaches kleines Ding, so groß wie ein Wasserball, wog aber immerhin 83,6 Kilogramm. Seine planetenartige Kugelform war mit vier langen Antennen geschmückt, die aussahen wie ein Kometenschweif. Im Inneren waren ein Sender, ein Thermometer, ein Ventilator, um ihn zu kühlen, und die Batterien, die fast die Hälfte des Gesamtgewichts ausmachten. Den Amerikanern heizte er mächtig ein.
Überall wurde der Sputnik als Sieg der Russen, der Sowjetunion und des Kommunismus gefeiert. Die Prawda kommentierte: »Die ganze Welt hat gehört, dass jetzt ein künstlicher Mond um die Erde kreist.« Der Erste Sekretär der KPdSU, Nikita Chruschtschow, erfuhr um elf Uhr bei einem Empfang im Mariinski-Palast in Kiew von dem Erfolg. Sein Sohn Sergei erinnerte sich später, dass sein Vater ans Telefon gerufen wurde, den Raum verließ und nach ein paar Minuten »mit strahlendem Gesicht« wieder zurückkam. Er saß ein paar Minuten still auf seinem Platz, dann hob er die Hand und erklärte den verständnislosen Genossen »Ein künstlicher Erdsatellit wurde gerade gestartet.«
Das Weiße Haus tat so, als wäre nichts passiert. Präsident Eisenhower nannte den Sputnik »einen kleinen Ball in der Luft«, einer seiner Berater behauptete, die USA spielten im Weltraum nicht Basketball, und ein anderer sprach von einer »albernen Christbaumkugel«. Aber psychologisch war die Wirkung enorm, und die Schlagzeilen der amerikanischen Presse ließen daran keinen Zweifel. »Eine schwere Niederlage«, erklärte die New York Herald Tribune, und der Reporter sprach sogar von einem »nationalen Notfall«. Die kleine Kugel hatte dem Gefühl der Unverwundbarkeit, in dem die Vereinigten Staaten gelebt hatten, einen heftigen Schlag versetzt.
Die auf Hochglanz polierte Aluminiumhülle von Sputnik 1 glänzte so hell, dass die Amerikaner sie drei Monate lang sehen konnten, wenn sie tagtäglich alle neunzig Minuten über ihnen vorbeiflog. Erst im Januar 1958 sank sie zurück in die Erdatmosphäre, wo sie verglühte. Jedes Mal, wenn sie über den Himmel zog, erinnerte sie die Amerikaner daran, dass die Sowjets die amerikanische Technologie überholt hatten. Sputnik 1 war ein Gamechanger. Die Sorgen der Amerikaner bezogen sich allerdings weniger auf den Satelliten selbst als auf die große Rakete, die ihn ins All gebracht hatte. Vor dem Sputnik-Piepen hatten die Amerikaner gedacht, die sowjetischen Flugzeuge mit den Atombomben könne man immer noch abfangen. Jetzt ahnten sie, dass die Sowjets interkontinentale Raketen besaßen, die auch Amerika treffen konnten.
Darüber, was der Sputnik für die US-Regierung und das amerikanische Volk bedeutete, schrieb der Historiker Walter McDougall später: »Die Kommunisten hatten einen technologischen Vorsprung? An einer neuen Front von unendlichem Ausmaß? Sie hatten gewissermaßen die Zukunft erobert? … Was hieß das für uns? Dass die Zukunft dem Kommunismus gehörte?« Die Amerikaner suchten die Roten jetzt nicht mehr nur unter den Betten. Die bösen Kommunisten kreisten über ihnen am Himmel.
Ein paar Tage nach dem Sputnik-Schock kursierte im Weißen Haus ein geheimes Memorandum mit der Überschrift »Reaktionen auf den sowjetischen Satelliten«, das einen Einblick in das Denken der Eisenhower-Regierung gibt. Darin hieß es: »Die öffentliche Meinung in freundlich gesinnten Ländern zeigt eine deutliche Besorgnis, dass sich das militärische Gleichgewicht verschoben haben könnte.« Es endete mit der Feststellung: »Die allgemeine Glaubwürdigkeit der Sowjetunion hat sich deutlich gesteigert.« Ein paar Wochen später starteten die Russen den zweiten Sputnik. Mit an Bord war die Hündin Laika. Sie war das erste Tier, das den Weltraum erreichte – aber leider auch das erste, das nicht zurückkam.
Eisenhower gab jetzt die Anweisung, so schnell wie möglich einen amerikanischen Satelliten ins All zu schießen. Zwei Monate nach dem Sputnik-Schock startete am 6. Dezember 1957 eine Rakete mit dem Vanguard TV3-Satelliten in Cape Canaveral. Sie erreichte eine Gipfelhöhe von etwas mehr als einem Meter, ehe sie explodierte. Im Gegensatz zu den Russen hatten die Amerikaner das Fernsehen eingeladen, und die Sender übertrugen die Bilder innerhalb weniger Stunden von Küste zu Küste. Die Medien hatten einen Mordsspaß mit Schlagzeilen wie »Kaputnik!« und »Flopnik!« Und die Sowjetunion bot den USA ein »Programm zur technischen Hilfeleistung für unterentwickelte Länder« an.
Eisenhower konnte darüber nicht lachen. Das amerikanische Budget für die Raumfahrt wurde innerhalb von zwei Jahren von jährlich 89 Millionen Dollar auf jährlich 401 Millionen Dollar erhöht. Im Januar 1958 stieg Wernher von Brauns Juno-Rakete (eine modifizierte Jupiter C) mit dem Explorer 1 auf und brachte ihn sicher auf seine Umlaufbahn. Er entdeckte den Van-Allen-Strahlungsgürtel der Erde, aber die Russen waren schon zweimal die Ersten gewesen, und beide Seiten warteten auf den nächsten Erfolg.
In den folgenden Jahren gab es sowohl für die Russen als auch für die Amerikaner Erfolge, aber keiner erreichte die Popularität von Sputnik 1. Im Dezember 1958 wurde Präsident Eisenhowers Weihnachtsansprache von einem Satelliten aus auf der Welt verbreitet und war somit die erste menschliche Stimme im Weltraum. Ein paar Wochen später verfehlte die sowjetische Sonde Luna 1 den Mond, segelte daran vorbei und umkreiste fortan die Sonne. Auch damit waren die Russen die Ersten, aber diesmal ganz unabsichtlich.
Dann erzielten die Sowjets erneut einen Treffer, diesmal buchstäblich. Ihre Mondsonde Luna 2 erreichte am 14. September 1959 die Mondoberfläche. Es war allerdings eine »harte Landung«, was in der Sprache der Raumfahrt bedeutet: ein Crash. Trotzdem erfüllte sie ihren Zweck: Sie war das erste menschengemachte Objekt auf dem Mond und verstreute beim Aufprall silberne Plättchen mit sowjetischen Hoheitszeichen. Als kleine Aufmerksamkeit schickte Chruschtschow auch Präsident Eisenhower ein Exemplar.
Die von Koroljow konstruierte Luna 3 gelangte hinter den Mond. Die Sonde wurde im Oktober 1959 gestartet und schickte spektakuläre Bilder von der erdabgewandten Seite unseres Trabanten, die – wie eigentlich meistens – im schönsten Sonnenlicht dalag. Was aber Pink Floyd nicht daran hinderte, noch über ein Jahrzehnt später von der »Dark Side of the Moon« zu singen.
Am 1. April 1960 starteten die Amerikaner den ersten Televisions-Infrarot-Observations-Satelliten (TIROS) zur Wetterbeobachtung. Schon bald entdeckte er einen schweren Sturm vor Madagaskar und bewies damit die Nützlichkeit von Satelliten bei der systematischen Erforschung von Klima und Wetter. Er wurde zum Vorbild für die gesamte heutige Wetterbeobachtung per Satellit. Er konnte zwar nur ziemlich große Objekte erkennen, aber schon das machte Moskau nervös.
Im gleichen Jahr wurden von Sputnik 5 zwei Hunde ins All geschossen und diesmal auch glücklich zurückgebracht: Belka und Strelka. Nach einer Karriere als Medienstar zog sich Strelka aus dem öffentlichen Leben zurück und wurde Mutter. Einer der sechs Welpen hieß Pushinka (»Flauschig«). Chruschtschow erinnerte sich, dass sich Jacqueline Kennedy nach Strelka erkundigt hatte, und schickte Pushinka ins Weiße Haus, komplett mit sowjetischem Reisepass. Präsident Kennedy bedankte sich höflich: »Mrs Kennedy und ich haben uns sehr darüber gefreut, dass wir ›Pushinka‹ erhalten haben. Ihr Flug aus der Sowjetunion in die Vereinigten Staaten war nicht so dramatisch wie der ihrer Mutter, aber doch eine lange Reise, und sie hat sie gut überstanden. Wir sind Ihnen beide sehr dankbar, dass Sie sich trotz Ihres arbeitsreichen Lebens an unsere Anteilnahme erinnert haben.« Pushinka und einer der Kennedy-Hunde entwickelten eine starke Zuneigung, die zur Geburt von vier Welpen führte, die JFK als »Pupniks« bezeichnete. Angesichts der politischen Spannungen in diesen Jahren konnte man sich über solche Augenblicke privater Herzlichkeit nur freuen.
Trotzdem musste das Rennen ins Weltall gewonnen werden. Die Amerikaner beschlossen, Belka und Strelka mit einem Hominiden zu übertreffen, einem Schimpansen namens Ham. Er wurde am 31. Januar 1961