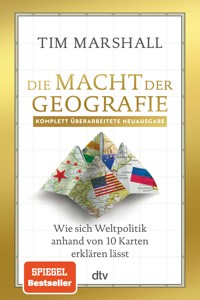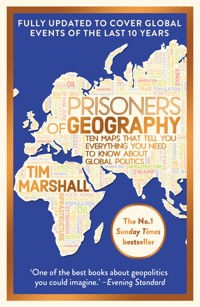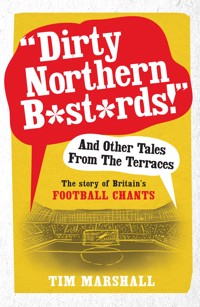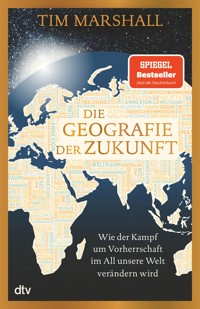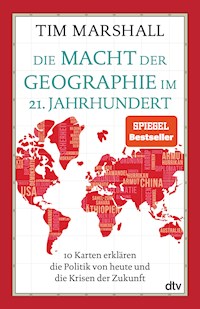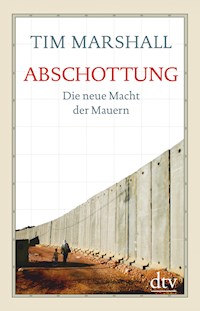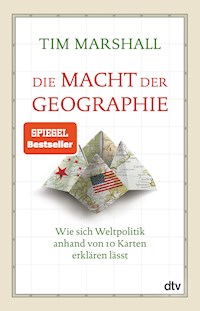
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Weltpolitik ist auch Geopolitik. Alle Regierungen, alle Staatschefs unterliegen den Zwängen der Geographie. Berge und Ebenen, Flüsse, Meere, Wüsten setzen ihrem Entscheidungsspielraum Grenzen. Um Geschichte und Politik zu verstehen, muss man selbstverständlich die Menschen, die Ideen, die Einstellungen kennen. Aber wenn man die Geographie nicht mit einbezieht, bekommt man kein vollständiges Bild. Zum Beispiel Russland: Von den Moskauer Großfürsten über Iwan den Schrecklichen, Peter den Großen und Stalin bis hin zu Wladimir Putin sah sich jeder russische Staatschef denselben geostrategischen Problemen ausgesetzt, egal ob im Zarismus, im Kommunismus oder im kapitalistischen Nepotismus. Die meisten Häfen frieren immer noch ein halbes Jahr zu. Nicht gut für die Marine. Die nordeuropäische Tiefebene von der Nordsee bis zum Ural ist immer noch flach. Jeder kann durchmarschieren. Russland, China, die USA, Europa, Afrika, Lateinamerika, der Nahe Osten, Indien und Pakistan, Japan und Korea, die Arktis und Grönland: In zehn Kapiteln zeigt Tim Marshall, wie die Geographie die Weltpolitik beeinflusst und beeinflusst hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Alle Regierungen unterliegen den Zwängen der Geographie. Berge und Ebenen, Wasser, Sand und Eis setzen ihrem Entscheidungsspielraum Grenzen. In Russland zum Beispiel standen alle Staatschefs, egal ob Peter der Große, Stalin oder Putin, denselben geostrategischen Problemen gegenüber: Die meisten Häfen sind die Hälfte des Jahres zugefroren und die nordeuropäische Tiefebene, die sich von der Nordsee bis zum Ural zieht, ist flach, jeder kann dort einmarschieren.
Tim Marshall erklärt anschaulich und spannend wie zum Beispiel die USA zu der Weltmacht werden konnte, die sie sind, warum Putin so besessen ist von der Krim oder wie die globale Einflussnahme Chinas zu verstehen ist. Ein erhellender Blick hinter die Kulissen der weltweiten Außenpolitik.
Von Tim Marshall außerdem bei dtv erschienen:
Im Namen der Flagge. Die Macht politischer Symbole.
Abschottung. Die neue Macht der Mauern
Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert
Die Geografie der Zukunft
TIM MARSHALL
DIE MACHT DERGEOGRAPHIE
Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt
Aus dem Englischen von Birgit Brandau
VORWORT
Wladimir Putin bezeichnet sich als religiösen Menschen, als engagiertes Mitglied der Russisch-Orthodoxen Kirche. Es könnte also gut sein, dass er, wenn er abends zu Bett geht, seine Gebete spricht und Gott fragt: »Warum hast du nicht ein paar Berge in die Ukraine gestellt?«
Hätte Gott in der Ukraine Berge geschaffen, dann würde das ausgedehnte Flachland der nordeuropäischen Tiefebene nicht zu Angriffen auf Russland einladen, wie es mehrfach der Fall war. So wie es ist, bleibt Putin keine Wahl: Er muss zumindest versuchen, die Ebene im Westen zu kontrollieren. So ergeht es allen Staaten der Welt, seien sie klein oder groß. Die Landschaft nimmt die Regierungschefs gefangen, lässt ihnen weniger Optionen und Raum für Manöver als man denkt. Dies galt für das Athener Imperium, für die Perser wie die Babylonier und frühere Reiche. Es traf auf alle Führer zu, die auf hoch gelegenes Gelände aus waren, um ihren Stamm zu schützen.
Seit jeher hat uns das Land, auf dem wir leben, geformt. Es hat die Kriege, die Macht, die Politik und die gesellschaftliche Entwicklung der Völker geformt, die mittlerweile nahezu jeden Teil der Erde bewohnen. Technologien überwinden scheinbar die mentalen wie räumlichen Entfernungen zwischen uns, sodass leicht vergessen wird, dass das Land, in dem wir leben, arbeiten und unsere Kinder aufziehen, höchst bedeutsam ist und dass die Entscheidungen derer, die die 7,5 Milliarden Bewohner dieses Planeten führen, in gewissem Maße schon immer durch die Flüsse, Berge, Wüsten, Seen und Meere, die uns alle eingrenzen, geformt werden.
Es gibt keinen einzelnen geographischen Faktor, der wichtiger ist als irgendein anderer. Berge sind nicht wichtiger als Wüsten, Flüsse nicht wichtiger als Dschungel. In den unterschiedlichen Gebieten der Erde sind es unterschiedliche geographische Merkmale, die zu den dominanten Faktoren gehören, die bestimmen, was Menschen tun können und was nicht.
Allgemein gesagt: Geopolitik zeigt auf, wie internationale Angelegenheiten vor dem Hintergrund geographischer Faktoren zu verstehen sind. Dabei geht es nicht nur um die tatsächliche Landschaft – die natürlichen Barrieren durch Berge oder die Verbindungen durch Flusssysteme beispielsweise –, sondern auch um Klima, Demographie, Kulturregionen und den Zugang zu natürlichen Ressourcen. Solche Faktoren können erhebliche Auswirkungen auf viele Bereiche unserer Zivilisation haben, von politischen und militärischen Strategien bis hin zur Entwicklung der menschlichen Gesellschaft samt Sprache, Handel und Religion.
Die physischen Realitäten, die der nationalen und internationalen Politik zugrunde liegen, werden zu oft außer Acht gelassen – sowohl bei der Geschichtsschreibung als auch bei der aktuellen Berichterstattung aus aller Welt. Geographie ist eindeutig ein grundlegender Teil des »Warum« und auch des »Was«. Sie ist vielleicht nicht der bestimmende Faktor, aber ganz sicher jener, der am häufigsten übersehen wird. Nehmen wir zum Beispiel China und Indien: zwei gewaltige Länder mit einer riesigen Bevölkerung, die eine sehr lange gemeinsame Grenze haben, aber weder politisch noch kulturell auf einer Linie sind. Es würde also nicht überraschen, wenn sich diese beiden Giganten mehrere Kriege geliefert hätten – doch das haben sie, abgesehen von einer einen Monat dauernden Auseinandersetzung 1962, nicht getan. Warum? Weil zwischen ihnen die höchste Gebirgskette der Welt liegt und es praktisch unmöglich ist, mit großen Militärkolonnen durch oder über den Himalaja vorzustoßen. Mit immer ausgefeilteren Technologien werden natürlich auch Möglichkeiten eröffnet, dieses Hindernis zu überwinden, aber die physische Barriere bleibt eine Abschreckung. Deshalb konzentrieren sich beide Länder bei ihrer Außenpolitik auf andere Regionen, während sie einander argwöhnisch im Auge behalten.
Einzelne Führungspersönlichkeiten, Vorstellungen, Technologien und andere Faktoren spielen alle eine Rolle bei der Ausformung von Ereignissen, aber sie sind vergänglich. Jede neue Generation steht wiederum vor der physischen Blockade, die Hindukusch und Himalaja darstellen. Das Gleiche gilt für die Herausforderungen durch die Regenzeit und die Nachteile aufgrund des beschränkten Zugangs zu Bodenschätzen oder Nahrungsquellen.
Mein Interesse an diesem Thema wurde geweckt, als ich in den 1990ern über die Kriege auf dem Balkan berichtete. Ich konnte aus nächster Nähe beobachten, wie die Führer verschiedener Völker, seien es Serben, Kroaten oder Bosnier, ihre »Stämme« in dieser von Vielfalt gekennzeichneten Region mit voller Absicht an alte Spaltungen und ein uraltes Misstrauen erinnerten. Sobald es ihnen gelungen war, die Völker auseinanderzubringen, war es ein Leichtes, sie gegeneinander aufzubringen.
Der Fluss Ibar im Kosovo ist ein sehr gutes Beispiel. Die osmanische Herrschaft über Serbien wurde mit der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 gefestigt. In der Nähe liegt die Stadt Mitrovica, durch die der Ibar fließt. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte begann sich die serbische Bevölkerung auf die andere Seite des Ibar zurückzuziehen, als muslimische Albaner aus der Bergregion Malësia e Madhe nach und nach in das Kosovo einwanderten, wo sie bis Mitte des 18. Jahrhunderts zur Mehrheit wurden.
Nun ein Zeitsprung ins 20. Jahrhundert: Nach wie vor bestand eine klare ethnische und religiöse Spaltung, die in etwa durch den Fluss markiert wurde. 1999 zog sich das jugoslawische (serbische) Militär, bombardiert von der NATO aus der Luft und der UÇK am Boden, hinter den Ibar zurück, rasch gefolgt vom Großteil der noch vorhandenen serbischen Bevölkerung. Der Fluss wurde de facto zur Grenze dessen, was einige Länder heute als unabhängige Republik Kosovo anerkannt haben.
Mitrovica war auch der Ort, wo der Vormarsch der NATO-Bodentruppen stoppte. Während des dreimonatigen Kriegs hatte es versteckte Drohungen gegeben, die NATO plane, ganz Serbien zu besetzen. In Wahrheit bedeuteten die Einschränkungen sowohl durch die Geographie als auch durch die Politik, dass diese Möglichkeit der NATO-Führung nicht unbedingt offenstand. Ungarn hatte deutlich gemacht, dass es eine Invasion von seinem Gebiet aus nicht erlauben würde, weil man Repressalien gegen die 350000 ethnischen Ungarn in Nordserbien fürchtete. Die Alternative wäre eine Invasion von Süden her gewesen, was die NATO doppelt so schnell an den Ibar gebracht hätte, aber dieser standen die Berge oberhalb der Stadt entgegen.
Ich arbeitete damals mit einem serbischen Team in Belgrad und fragte, was passieren würde, wenn die NATO käme. »Wir legen unsere Kameras weg und nehmen uns Gewehre, Tim«, lautete die Antwort. Es handelte sich um liberale Serben, gute Freunde von mir, die in Opposition zu ihrer Regierung standen, aber sie holten trotzdem Karten hervor und zeigten mir, wo die Serben ihr Territorium in den Bergen verteidigen würden und wo die NATO sich festfahren würde. Es war einigermaßen beruhigend, anhand dieser Geographielektion zu erfahren, dass die Möglichkeiten der NATO begrenzter waren, als die Brüsseler PR-Maschine zugab.
In den folgenden Jahren kam mir das auf dem Balkan erworbene Verständnis, wie entscheidend die Beschaffenheit der Landschaft war, bei der Berichterstattung zugute. Beispielsweise merkte ich 2001, ein paar Wochen nach dem 11. September, wie sehr, selbst bei heutiger moderner Technologie, das Klima immer noch die militärischen Möglichkeiten sogar der mächtigsten Armee der Welt beherrscht. Ich war mit einem Schlauchboot über den Grenzfluss von Tadschikistan nach Nordafghanistan gekommen, um zu den Truppen der Nordallianz (NA) aufzuschließen, die gegen die Taliban kämpften.
Die amerikanischen Kampfflugzeuge und Bomber waren bereits in der Luft und beschossen Taliban- und al-Qaida-Stellungen in den kalten, staubigen Ebenen und Hügeln östlich von Masar-e Scharif, um den Weg für den Vormarsch auf Kabul zu ebnen. Nach ein paar Wochen machte sich die NA offensichtlich bereit, nach Süden vorzustoßen. Doch dann veränderte die Welt plötzlich ihre Farbe.
Es kam der heftigste Sandsturm auf, den ich je erlebt habe, und überzog alles mit senfgelber Farbe. Selbst die Luft um uns herum schien diese Farbe zu haben, so voll war sie mit Sandpartikeln. 36 Stunden lang bewegte sich nichts mehr außer dem Sand. Als der Sturm seinen Höhepunkt erreicht hatte, konnte man nur ein paar Meter weit sehen, und klar war einzig, dass der Vormarsch das Wetter abwarten musste.
Die amerikanische Satellitentechnologie, eine Speerspitze der Wissenschaft, war nutzlos, das Klima in diesem wilden Land hatte sie blind gemacht. Alle, von Präsident Bush und den Joint Chiefs of Staff bis hin zu den NA-Truppen am Boden, konnten nur warten. Dann regnete es, und der Sand, der auf allem und jedem lag, verwandelte sich in Matsch. Der Regen war so stark, dass die Lehmziegelhütten, in denen wir hausten, zu zerfließen drohten. Erneut war klar, dass ein Vorstoß nach Süden unmöglich war. Die Gesetze der Geographie, die bereits Hannibal, Sunzi und Alexander der Große kannten, gelten für die heutigen Führer noch genauso.
Die Geopolitik betrifft alle Länder, sei es im Krieg, wie in diesen Beispielen, oder im Frieden. In jeder einzelnen Region lassen sich Beispiele dafür finden. In diesem Buch kann ich nicht alle anführen: Kanada, Australien und Indonesien zum Beispiel werden nur kurz erwähnt, obwohl allein Australien und die Art und Weise, wie seine Geographie die physischen wie kulturellen Verbindungen zu den anderen Teilen der Welt formte, ein ganzes Buch verdiente. Stattdessen habe ich mich auf die Mächte und Regionen konzentriert, die die Kernpunkte des Buches am besten illustrieren, und mich mit dem historischen Erbe der Geopolitik (der Staatenbildung), den dringlichsten Situationen, denen wir heute gegenüberstehen (den anhaltenden Problemen in der Ukraine, dem wachsenden Einfluss von China), und einem Blick in die Zukunft (dem zunehmenden Wettbewerb in der Arktis) beschäftigt.
In Russland sehen wir den Einfluss der Arktis und wie das eisige Klima dort Russlands Möglichkeiten einschränkt, zu einer echten Weltmacht zu werden. In China erkennen wir, dass die Macht ohne eine global agierende Marine Beschränkungen unterliegt – und mittlerweile ist deutlich zu erkennen, mit welcher Geschwindigkeit China dies ändern will. Das Kapitel über die USA beweist, wie kluge Entscheidungen zur Erweiterung des Territoriums in Schlüsselregionen es den Vereinigten Staaten möglich machten, ihre heutige Position als Supermacht an zwei Weltmeeren zu erlangen. Europa zeigt uns den Vorteil von Tiefebenen und schiffbaren Flüssen beim Aufbau von Verbindungen zwischen den Regionen und der Entwicklung einer Kultur, die den Anschub der modernen Welt ermöglichte, während Afrika ein Paradebeispiel für die Auswirkungen der Isolation ist.
Das Kapitel über den Nahen Osten demonstriert, warum das Ziehen von Linien auf Landkarten ohne die Berücksichtigung der Topographie und, ebenso wichtig, der geographischen Kulturen eines Gebiets nur Probleme mit sich bringen kann. Probleme, die uns in diesem Jahrhundert weiterhin begleiten werden. Das gleiche Thema kommt in den Kapiteln über Afrika und Indien/Pakistan zum Tragen. Die Kolonialmächte zogen auf dem Papier künstliche Grenzen und kümmerten sich überhaupt nicht um die physischen Gegebenheiten der Region. Heute werden blutige Versuche unternommen, sie zu korrigieren; das wird noch einige Jahre andauern, und danach wird die Karte der Nationalstaaten nicht mehr so aussehen wie heute.
Ganz anders als die Beispiele Kosovo oder Syrien sind Japan und Korea, da sie ethnisch überwiegend homogen sind. Allerdings haben sie andere Probleme: Japan ist ein Inselstaat ohne natürliche Ressourcen, während die Teilung von Korea ein Problem ist, das noch auf eine Lösung wartet. Lateinamerika hingegen ist eine Anomalie. Sein äußerster Süden ist so abgeschnitten von der übrigen Welt, dass ein globaler Handel schwierig ist, und die Geographie im Inneren des Kontinents steht der Schaffung eines erfolgreichen Handelsblocks nach EU-Vorbild entgegen.
Zum Schluss kommen wir zu einem der unbewohnbarsten Teile der Welt – der Arktis. Die längste Zeit haben die Menschen die Arktis ignoriert, aber im 20. Jahrhundert haben wir dort Energiequellen entdeckt, und die Diplomatie des 21. Jahrhunderts wird festlegen, wer Eigentümer dieser Ressourcen ist – und sie verkaufen kann.
Die Geographie als maßgeblichen Faktor für den Verlauf der menschlichen Geschichte anzuerkennen, kann auch als pessimistische Weltsicht interpretiert werden, weshalb dies in manchen intellektuellen Kreisen wenig beliebt ist. Denn es legt nahe, dass die Natur stärker als der Mensch ist und wir nur ein Stück weit Herren unseres Schicksals sind. Sicherlich haben eindeutig auch andere Faktoren Einfluss auf den Gang der Ereignisse. Jeder vernünftige Mensch kann sehen, dass die moderne Technologie dabei ist, die ehernen Regeln der Geographie zu brechen. Sie hat Wege über, unter oder durch einige der Barrieren gefunden. Die Amerikaner können jetzt bei einer Bombermission die gesamte Strecke von Missouri nach Mossul fliegen, ohne unterwegs eine Betonpiste zum Auftanken zu benötigen. Dadurch und durch ihre zum Teil autarken großen Flugzeugträgerkampfverbände brauchen sie nicht mehr unbedingt einen Verbündeten oder eine Kolonie, um ihre Reichweite weltweit auszudehnen. Natürlich gibt es noch mehr Optionen für sie, wenn sie einen Flugzeugstützpunkt auf der Insel Diego Garcia haben oder ihnen der Hafen in Bahrain immer offen steht, aber dies ist keine Voraussetzung mehr.
Die Luftfahrt hat also die Regeln verändert, und ebenso – auf andere Weise – das Internet. Aber die Geographie und die Geschichte, wie Staaten sich in dieser Geographie etabliert haben, bleiben wesentlich für unser Verständnis der heutigen Welt und unserer Zukunft.
Die Konflikte im Irak und in Syrien wurzeln darin, dass Kolonialmächte die Regeln der Geographie missachtet haben, während die chinesische Besetzung von Tibet dem Gegenteil zuzuschreiben ist. Die amerikanische Außenpolitik weltweit wird von ihnen bestimmt, und selbst das technische Genie und der Machteinsatz der letzten existierenden Supermacht können die Regeln, die die Natur – odFer Gott – uns gegeben hat, höchstens abschwächen.
Wie lauten diese Regeln? Lassen Sie uns die Erkundung in dem Land beginnen, in dem Macht schwer zu verteidigen ist und seine Führer dies seit Jahrhunderten damit kompensieren, dass sie nach außen vorstoßen. Es ist das Land, das keine Berge im Westen hat: Russland.
ERSTES KAPITEL RUSSLAND
weit (Adjektiv; weiter, am weitesten): von großer räumlicher Ausdehnung, unermesslich, riesengroß
Russland ist ausgedehnt. Am ausgedehntesten. Riesengroß. Es ist über 17 Millionen Quadratkilometer groß, elf Zeitzonen weit, es ist das größte Land der Erde.
Seine Wälder, Seen und Flüsse, seine Tundra, Steppe, Taiga und Berge sind alle riesig. Diese Größe hat sich längst in unserem kollektiven Gedächtnis festgesetzt. Wo immer wir uns befinden, Russland ist da. Vielleicht ist es östlich von uns, vielleicht westlich, vielleicht nördlich oder südlich – der russische Bär ist immer da.
Der Bär ist nicht zufällig das Symbol dieses immens großen Landes. Da hockt er, manchmal in Winterruhe, manchmal grollend, majestätisch und wild. Es gibt ein russisches Wort für Bär, aber die Russen vermeiden es, das Tier bei seinem wahren Namen zu nennen, aus Angst, seine dunkle Seite heraufzubeschwören. Sie nennen ihn medved, »der, der gerne Honig isst«.
Mindestens 120000 dieser medveds leben in dem Land, das sich über Europa und Asien erstreckt. Westlich des Urals liegt das europäische Russland, östlich davon ist Sibirien, das sich bis zum Beringmeer und zum Pazifik ausdehnt. Selbst im 21. Jahrhundert dauert die Durchquerung per Bahn sechs Tage. Russische Führer müssen diese Entfernungen – und Unterschiede – überblicken und ihre Politik entsprechend ausrichten. Seit Jahrhunderten schon haben sie in alle Richtungen geschaut, sich aber meist auf den Blick Richtung Westen konzentriert.
Wollen Autoren zum Kern des Bären vordringen, zitieren sie häufig Winston Churchills berühmte Feststellung zu Russland aus dem Jahre 1939: »Es ist ein Rätsel, das von einem Mysterium umgeben ist und in einem Geheimnis steckt.« Aber wenige nennen auch den zweiten Teil: »Doch vielleicht gibt es einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist das nationale Interesse der Russen.« Sieben Jahre später benutzte er diesen Schlüssel, um seine Version der Lösung dieses Rätsels zu eröffnen, und behauptete: »Ich bin überzeugt, dass sie nichts so sehr bewundern wie Stärke und nichts mehr verachten als Schwäche, insbesondere militärische Schwäche.«
Er hätte über die gegenwärtige russische Führung sprechen können, die, auch wenn sie sich jetzt in den Mantel der Demokratie hüllt, von Natur aus weiterhin autoritär und im Kern von nationalistischen Interessen bestimmt ist.
Wenn Wladimir Putin nicht über Gott und Berge nachdenkt, denkt er an Pizza. Genauer, an die Form eines Pizzastücks.
Das spitze Ende dieses Keils ist Polen. Hier ist die weite nordeuropäische Tiefebene, die sich von Frankreich bis zum Ural (der über 2000 Kilometer von jenseits des Polarkreises bis nach Kasachstan verläuft und eine natürliche Grenze zwischen Europa und Asien bildet) erstreckt, zwischen Ostsee und Karpaten nur knapp 500 Kilometer breit. Die nordeuropäische Tiefebene umfasst den gesamten Westen und Norden von Frankreich sowie Belgien, die Niederlande, Norddeutschland und fast ganz Polen.
Aus russischer Perspektive ist das ein zweischneidiges Schwert. Polen stellt einen relativ schmalen Korridor dar, in den Russland im Bedarfsfall seine Armee schicken kann, um einen Gegner daran zu hindern, Richtung Moskau vorzurücken. Doch ab da wird der Keil breiter: An der russischen Grenze ist er bereits über 3200 Kilometer breit, und das Land ist bis nach Moskau und dahinter nur flach. Selbst mit einer riesigen Armee hätte man seine Schwierigkeiten, sich entlang dieser Linie erfolgreich zu verteidigen. Allerdings wurde Russland nie aus dieser Richtung erobert, was zum Teil seiner strategischen Tiefe zu verdanken ist. Bis eine Armee Moskau erreicht, müsste sie Nachschublinien bedienen, die unhaltbar lang sind – ein Fehler, den Napoleon 1812 machte und Hitler 1941 wiederholte.
Ähnlich schützt die Geographie Russlands fernen Osten. Es ist schwierig, eine Armee aus Asien hinauf in den asiatischen Teil Russlands zu führen, denn außer Schnee gibt es nicht viel, was man angreifen kann. Zudem käme man nur bis zum Ural. Das Ergebnis wäre, dass man – unter schwierigen Bedingungen – ein riesiges Gebiet halten müsste, in dem die Nachschublinien lang wären und man immer mit einem Gegenangriff rechnen müsste.
Man könnte also meinen, dass niemand vorhat, nach Russland einzumarschieren, aber die Russen sehen das anders. Aus gutem Grund. In den vergangenen 500 Jahren wurde Russland mehrfach vom Westen her überrannt. 1605 kamen die Polen durch die nordeuropäische Tiefebene, es folgten 1708 die Schweden unter Karl XII., 1812 die Franzosen unter Napoleon und die Deutschen zweimal, in beiden Weltkriegen, 1914 und 1941. Oder wenn man es anders betrachtet und von der Napoleonischen Invasion 1812 bis zum Zweiten Weltkrieg 1945 rechnet und den Krimkrieg 1853–1856 diesmal einbezieht, waren die Russen durchschnittlich alle 33 Jahre in Kämpfe in oder an der nordeuropäischen Tiefebene verwickelt.
Ende des Zweiten Weltkriegs besetzten die Russen 1945 jene Gebiete in Mittel- und Osteuropa, die Deutschland erobert hatte und von denen einige dann Teil der UdSSR wurden, die sich zunehmend an das alte Russische Reich anglich. 1949 rief ein Zusammenschluss europäischer und nordamerikanischer Staaten die North Atlantic Treaty Organization (NATO) ins Leben, um Europa und den Nordatlantik gegen die Bedrohung durch sowjetische Angriffe zu schützen. Als Antwort gingen die meisten kommunistischen Staaten in Europa 1955 – unter russischer Führung – den Warschauer Pakt ein, einen Pakt zur militärischen Verteidigung und zum wechselseitigen Beistand. Der Pakt sollte aus Eisen gemacht sein, doch im Nachhinein betrachtet, begann er in den frühen 1980er-Jahren zu rosten und zerfiel nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 zu Staub.
Präsident Putin ist kein Anhänger des letzten sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow. Er wirft ihm vor, die russische Sicherheit unterminiert zu haben und bezeichnete den Zerfall der Sowjetunion in den 1990ern als »größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts«.
Seither haben die Russen besorgt beobachtet, wie die NATO immer dichter herankroch und Länder aufnahm, die Russland zufolge versprochenermaßen nicht Mitglieder werden sollten: die Tschechische Republik, Ungarn und Polen 1999, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien und die Slowakei 2004 sowie Albanien 2009. Die NATO behauptet, derartige Zusicherungen habe es nicht gegeben.
Russland denkt wie alle Großmächte in Zeiträumen wie den nächsten 100 Jahren und geht davon aus, dass in dieser Zeit alles passieren kann. Wer hätte vor 100 Jahren gedacht, dass amerikanische Streitkräfte nur einige Hundert Kilometer von Moskau entfernt in Polen und im Baltikum stationiert sein würden? Bereits 2004, nur 15 Jahre nach 1989, war jeder einzelne ehemalige Mitgliedsstaat des Warschauer Pakts außer Russland selbst Mitglied der NATO oder der Europäischen Union geworden.
Davon und von der russischen Geschichte wird das Denken der Moskauer Regierung geleitet.
Russland geht als Konzept zurück auf das 9. Jahrhundert und eine lockere Vereinigung ostslawischer Stämme, die als Kiewer Rus bezeichnet wird und in Kiew und anderen Städten am Dnjepr, also in der heutigen Ukraine, beheimatet war. Die Mongolen griffen während ihres Expansionszuges die Region von Süden und Osten her an und überrannten sie schließlich im 13. Jahrhundert. Das noch unerfahrene Russland ließ sich daraufhin nordöstlich in und um Moskau erneut nieder. Dieses frühe Russland, das als Großfürstentum Moskau bezeichnet wird, war nicht zu verteidigen. Es gab keine Berge, keine Wüsten und nur wenige Flüsse. In jede Himmelsrichtung erstreckte sich Flachland, und jenseits der Steppe im Süden und Osten befanden sich die Mongolen. Invasoren konnten nach Belieben jeden Ort einnehmen, und es existierten kaum natürliche Verteidigungsstellungen, die zu halten waren.
Auftritt Iwan des Schrecklichen, des ersten Zaren. Er setzte das Konzept von Angriff als Verteidigung in die Praxis um – das heißt, seine Expansion mit der Festigung der Stellung zu Hause zu beginnen und dann nach außen vorzustoßen. Dies führte zu Größe. Hier haben wir einen Mann, der die Theorie, dass ein Einzelner die Geschichte verändern kann, untermauert. Ohne seine Charakterzüge, die sowohl äußerste Rücksichtslosigkeit als auch unbedingte Visionen einschlossen, wäre die russische Geschichte ganz anders verlaufen.
Das flügge werdende Russland hatte unter Iwans Großvater, Iwan dem Großen, eine bescheidene Expansion begonnen, die sich erheblich beschleunigte, als sich 1547 der sechzehnjährige Großfürst Iwan IV. zum Zaren krönen ließ. Es drang nach Osten zum Ural vor, nach Süden Richtung Kaspisches Meer und nach Norden zum Polarkreis. Es erlangte Zugang zum Kaspischen und später zum Schwarzen Meer und nutzte so den Kaukasus als partielle Barriere zwischen sich und den Mongolen. In Tschetschenien wurde eine Militärbasis errichtet, um mögliche Angreifer abzuschrecken, seien es die mongolische Goldene Horde, das Osmanische Reich oder die Perser.
Es gab Rückschläge, aber im Lauf des nächsten Jahrhunderts sollte Russland über den Ural hinaus nach Sibirien vorstoßen, wo es schlussendlich das gesamte Land bis an die Pazifikküste weit im Osten einnahm.
Jetzt besaßen die Russen eine partielle Pufferzone und ein Hinterland – strategische Tiefe –, einen Ort, wohin man sich im Fall einer Invasion zurückziehen konnte. Vom Nordpolarmeer her würde sie keiner militärisch angreifen, und niemand würde sich über den Ural kämpfen, um sie anzugehen. Ihr Land wurde zu dem, was wir heute als Russland kennen, und um von Süden oder Südosten her einzudringen, musste man eine riesige Armee und eine sehr lange Nachschublinie haben und sich den Weg vorbei an Verteidigungsposten bahnen.
Im 18. Jahrhundert lenkte Russland – unter Peter dem Großen, der 1721 das Russische Reich gründete, und Zarin Katharina der Großen – den Blick nach Westen und erweiterte das Reich zu einer europäischen Großmacht, die überwiegend durch Handel und Nationalgefühl gespeist wurde. Dieses stabilere und mächtigere Russland konnte jetzt die Ukraine besetzen und zu den Karpaten vordringen. Es unterwarf den Großteil dessen, was wir heute unter den Baltikumstaaten verstehen – Litauen, Lettland und Estland. Somit war es gegen jeglichen Einfall auf dem Landweg oder über die Ostsee geschützt.
Jetzt existierte ein Ring um Moskau, das das Herz des Landes bildete. Von der Arktis erstreckte sich das Reich über das Baltikum, die Ukraine und dann die Karpaten, das Schwarze Meer und den Kaukasus bis an das Kaspische Meer hinunter und schwang sich um den Ural herum wieder hinauf zum Polarkreis.
Im 20. Jahrhundert schuf das kommunistische Russland die Sowjetunion. Hinter dem rhetorischen »Proletarier aller Länder vereinigt euch« der UdSSR kam schlicht das Russische Reich zum Ausdruck. Nach dem Zweiten Weltkrieg reichte es vom Pazifik bis nach Berlin, von der Arktis bis zur Grenze von Afghanistan – eine ökonomische, politische und militärische Supermacht, der nur die USA gleichkamen.
Russland ist das größte Land der Erde, doppelt so groß wie die USA, fünfmal so groß wie Indien, siebzigmal so groß wie das Vereinigte Königreich. Doch seine Bevölkerung ist mit rund 144 Millionen relativ klein, kleiner als die von Nigeria oder Pakistan. Seine landwirtschaftliche Wachstumsperiode ist kurz und es tut sich schwer damit, das, was in den elf Zeitzonen, die Moskau regiert, geerntet wird, gleichmäßig zu verteilen.
Bis zum Ural ist Russland insofern ein europäisches Land, als es an die europäische Landmasse grenzt, doch trotz seiner Grenzen zu Kasachstan, der Mongolei, China und Nordkorea sowie seiner maritimen Grenzen zu mehreren Ländern, darunter Japan und die USA, ist es keine asiatische Macht.
Sarah Palin, die frühere Kandidatin für die Vizepräsidentschaft der USA, erntete Spott, als berichtet wurde, sie habe gesagt: »Hier in Alaska kann man Russland vom Land aus sehen« – ein Ausspruch, der in der Berichterstattung der Medien zu »Von meinem Haus aus kann ich Russland sehen« mutierte. Tatsächlich meinte sie: »Hier in Alaska kann man Russland vom Land aus sehen, von einer Insel in Alaska aus.« Damit hatte sie recht. Eine russische Insel in der Beringstraße ist vier Kilometer von Little Diomede Island, einer amerikanischen Insel in der Beringstraße, entfernt und man kann sie mit bloßem Auge sehen. Von Amerika aus kann man in der Tat Russland sehen.
Oben auf einem Uralgipfel steht ein Kreuz, das die Grenze zwischen Europa und Asien markiert. Bei klarem Wetter ist dies ein wunderschöner Fleck, und man kann durch die Tannen kilometerweit nach Osten schauen. Im Winter liegt hier Schnee, ebenso wie im darunterliegenden Sibirischen Tiefland, das sich weit über die Stadt Jekaterinburg hinaus erstreckt. Touristen kommen gerne her, um mit einem Fuß in Europa und dem anderen in Asien zu stehen. Wenn man bedenkt, dass sich das Kreuz an einer Stelle befindet, an der man erst ein Viertel des Landes durchmessen hat, wird deutlich, wie groß Russland ist. Auf dem Weg von Sankt Petersburg zum Ural hat man bereits 2500 Kilometer durch Westrussland zurückgelegt, aber es liegen noch weitere 7250 Kilometer vor einem, um die Beringstraße zu erreichen, jenseits derer Alaska, die USA (und das Haus von Mrs. Palin) liegen.
Kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion war ich im Ural, an der Stelle, wo Europa zu Asien wird. Ein russisches Kamerateam begleitete mich. Der Kameramann war ein stoischer, wortkarger, angegrauter Veteran des Filmens und der Sohn jenes Kameramanns der Roten Armee, der einen großen Teil der Aufnahmen während der deutschen Belagerung von Stalingrad gemacht hatte. Ich fragte ihn: »Sind Sie eigentlich Europäer oder Asiat?« Er dachte ein paar Sekunden darüber nach und antwortete dann: »Weder noch – ich bin Russe.«
Russland ist aus vielerlei Gründen keine asiatische Macht. 75 Prozent seines Staatsgebiets liegen zwar in Asien, aber es leben dort nur 22 Prozent der Bevölkerung. Sibirien mag zwar die »Schatzkiste Russlands« sein, wo der überwiegende Teil der Bodenschätze und Öl- und Gasvorkommen zu finden sind, aber es ist ein raues Land mit riesigen Wäldern (Taiga), schlechtem Ackerland und endlosen Sümpfen, in dem über viele Monate Frost herrscht. In West-Ost-Richtung verlaufen nur zwei Bahnlinien – die Transsibirische Eisenbahn und die Baikal-Amur-Magistrale. Und einige wenige Transportwege führen von Norden nach Süden. Es ist Russland nicht möglich, Energie nach Süden in die moderne Mongolei oder nach China zu liefern: Es fehlen die Arbeitskräfte und Pipelines dafür.
Es ist gut möglich, dass China auf lange Sicht die Kontrolle über Teile Sibiriens erlangt, allerdings aufgrund sinkender russischer Geburtenraten und chinesischer Emigration Richtung Norden. Chinesische Restaurants sind bereits ein gutes Stück weit westlich vorgedrungen und im sumpfigen Westsibirischen Tiefland zwischen dem Ural und dem 1600 Kilometer östlich gelegenen Fluss Jenissei in den meisten Orten und Städten zu finden. Viele andere Betriebe werden folgen. Noch wahrscheinlicher ist, dass die leeren, sich entvölkernden Landstriche des russischen Fernen Ostens unter eine chinesische kulturelle und schließlich politische Oberherrschaft geraten.
Außerhalb des russischen Kernlands sind große Bevölkerungsteile der Russischen Föderation ethnisch keine Russen und hegen wenig Loyalität Moskau gegenüber – was einen aggressiven Sicherheitsapparat zur Folge hat, der dem in den Sowjettagen ähnelt. In jener Ära war Russland de facto eine Kolonialmacht, die über Länder und Völker herrschte, die keine Gemeinsamkeiten mit ihren Machthabern sahen. Teile der Russischen Föderation – beispielsweise Tschetschenien und Dagestan im Kaukasus– empfinden das immer noch genau so.
Ende des letzten Jahrhunderts führten das Ausgeben von mehr Geld als vorhanden war, marktwirtschaftlicher Irrsinn in einem Land, das nicht für Menschen gemacht ist, und die Niederlage in den afghanischen Bergen zum Zerfall der UdSSR. Das Russische Imperium schrumpfte mehr oder weniger zurück auf die Grenzen der vorkommunistischen Ära, sodass sein europäisches Gebiet an den Grenzen von Estland, Lettland, Weißrussland, der Ukraine, Georgien und Aserbaidschan endete. Beim sowjetischen Einmarsch in Afghanistan 1979, mit dem die kommunistische afghanische Regierung gegen antikommunistische muslimische Rebellen unterstützt werden sollte, ging es nie darum, dem afghanischen Volk die Freuden des Marxismus-Leninismus zu bringen. Vielmehr ging es einzig darum, dass Moskau die Kontrolle in jenem Gebiet behielt und sicherstellte, dass sie niemand sonst bekam.
Entscheidend war, dass die Invasion Afghanistans auch der großrussischen Hoffnung Nahrung gab, russische Soldaten würden »ihre Stiefel noch im Indischen Ozean waschen«, wie es der ultranationalistische Politiker Wladimir Schirinowski formuliert hat, und damit dem Land etwas verschaffen, was es nie besessen hat: einen Hafen, der auch im Winter eisfrei bleibt und freien Zugang zu den wichtigsten Handelsrouten der Welt bietet. Einige der Häfen am Nordpolarmeer sind jedes Jahr mehrere Monate lang zugefroren. Selbst Wladiwostok, der größte russische Pazifikhafen, wird rund vier Monate von Eis blockiert und liegt zudem am eingeschlossenen Japanischen Meer, das von Japan beherrscht wird. Dies verhindert nicht nur, dass die russische Flotte als Global Player agieren kann, sondern behindert auch den Handelsstrom. Hinzu kommt, dass Transporte auf dem Wasser wesentlich billiger sind als jene an Land oder in der Luft.
Allerdings war dank der eindrucksvollen Ebenen von Kandahar und der Berge des Hindukusch keine Besatzungsmacht je erfolgreich in Afghanistan. Das hat dem Land das Prädikat »Friedhof der Weltreiche« eingebracht, und die russische Afghanistanerfahrung wird gelegentlich auch als »Vietnam Russlands« bezeichnet. Moskaus Traum von offenen Seewegen in warmen Gewässern hat sich seither immer mehr verflüchtigt und ist heute vielleicht in weiterer Ferne als je in den letzten zweihundert Jahren.
Das Fehlen eines eisfreien Hafens mit direktem Zugang zu den Weltmeeren, strategisch so bedeutsam wie die nordeuropäische Tiefebene, war immer Russlands Achillesferse. Dieser geographische Nachteil wird nur dank seiner Öl- und Gasvorkommen ausgeglichen. Kein Wunder, dass Peter der Große in seinem Testament 1725 seinen Nachfolgern rät: »Russland muss seine Grenzen so weit als möglich nach Indien und Konstantinopel ausdehnen. Wer im Besitze von Konstantinopel ist, ist Herr der Welt. Russland muss deshalb fortwährend Krieg mit der Türkei und Persien führen … Es muss … bis nach dem persischen Meerbusen … und bis Indien … vordringen.«
Als die Sowjetunion auseinanderbrach, zerfiel sie in 15 Länder. Die Geographie rächte sich an der Sowjetideologie, und auf der Landkarte erschien ein logischeres Bild, eines, auf dem Berge, Flüsse, Seen und Meere aufzeigen, wo die Menschen leben, wo sie voneinander getrennt sind, wieso sie unterschiedliche Sprachen und Kulturen entwickelten. Die Ausnahme von dieser Regel sind die »Stans«, wie beispielsweise Tadschikistan, deren Grenzen von Stalin bewusst gezogen wurden, um die einzelnen Staaten zu schwächen, indem dafür gesorgt wurde, dass große Minoritäten aus anderen Staaten in ihnen leben.
Betrachtet man die Dinge in historischen Zeiträumen – was die meisten Diplomaten und Militärstrategen tun –, ist für alle Länder, die zur UdSSR gehörten, sowie für einige aus dem Warschauer Pakt immer noch alles offen. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen: die neutrale, die prowestliche und die prorussische Gruppe.
Die neutralen Länder – Usbekistan, Aserbaidschan und Turkmenistan – sind jene, die nicht so viele Gründe haben, sich entweder mit Russland oder mit dem Westen zu verbünden. Das liegt daran, dass alle drei ihre Energie selbst produzieren und es nicht nötig haben, sich aus Handels- oder Sicherheitsgründen einer der Seiten zuzuwenden.
Im prorussischen Lager sind Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Weißrussland und Armenien zu finden. Ihre Volkswirtschaften sind in einer Weise an Russland gebunden, wie das auch ein Großteil der ostukrainischen Wirtschaft ist (ein weiterer Grund für die Aufstände dort). Das größte dieser Länder, Kasachstan, lehnt sich diplomatisch an Russland an und seine große russische Minderheit ist gut integriert. Von den fünf Ländern ist nur Tadschikistan noch kein Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion (einer Art Arme-Leute-EU), die sie im Januar 2015 zusammen mit Russland gegründet haben. Und alle fünf gehören zu einer Militärallianz mit Russland namens Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Die OVKS krankt daran, dass sich ihr Name nicht zu einem Akronym eindampfen lässt und sie ein verwässerter Warschauer Pakt ist. Russland unterhält eine militärische Präsenz in Kirgisistan, Tadschikistan und Armenien.
Dann sind da die prowestlichen Länder, die früher Mitglieder des Warschauer Pakts waren, jetzt aber alle zur NATO und/oder EU gehören: Polen, Lettland, Litauen, Estland, die Tschechische Republik, Bulgarien, Ungarn, die Slowakei, Albanien und Rumänien. Es ist kein Zufall, dass viele davon zu jenen Staaten gehören, die am stärksten unter der sowjetischen Tyrannei gelitten haben. Zu diesen sind Georgien, die Ukraine und Moldawien hinzuzufügen, die sich gern beiden Organisationen anschließen würden, aber auf Abstand gehalten werden, weil sie geographisch zu nah an Russland liegen und sich auf dem Boden aller drei Länder russische Truppen oder prorussische Milizen befinden. Eine NATO-Mitgliedschaft auch nur eines dieser drei Länder könnte einen Krieg auslösen.
All dies erklärt, warum Moskau 2013, als die politische Schlacht um die künftige Richtung der Ukraine hochkochte, scharf reagierte.
Solange in Kiew eine prorussische Regierung an der Macht war, konnten die Russen darauf vertrauen, dass ihre Pufferzone intakt blieb und die nordeuropäische Tiefebene sichern würde. Selbst eine betont neutrale Ukraine, die zusichern würde, weder der EU noch der NATO beizutreten und den Pachtvertrag mit Russland über den Hafen Sewastopol auf der Krim, Russlands einzigem eisfreien Hafen, einzuhalten, wäre akzeptabel. Dass die Ukraine von russischen Energielieferungen abhängig blieb, machte ihre zunehmend neutrale Haltung akzeptabel, auch wenn diese ärgerlich war. Doch eine prowestliche Ukraine mit Ambitionen, den beiden großen westlichen Bündnissen beizutreten, die Russlands Zugang zu dem Schwarzmeerhafen infrage stellen würde? Eine Ukraine, die eines Tages sogar eine NATO-Marinebasis beheimaten könnte? Keine Chance.
Der ukrainische Präsident Wiktor Janukowytsch versuchte, beide Seiten zu bedienen. Er flirtete mit dem Westen, erwies aber Moskau Reverenz – daher tolerierte Putin ihn. Als er kurz davor stand, ein weitreichendes Handelsabkommen mit der EU abzuschließen, eines, das zur Mitgliedschaft führen konnte, begann Putin die Schrauben anzuziehen.
Für die russische außenpolitische Elite ist eine EU-Mitgliedschaft nichts anderes als eine camouflierte NATO-Mitgliedschaft. Und eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine überschreitet für Russland die rote Linie. Putin verstärkte der Druck auf Janukowytsch und machte ihm ein Angebot, das er besser nicht ablehnte. Der ukrainische Präsident stieg aus dem EU-Geschäft aus, schloss einen Pakt mit Moskau und entfachte damit die Proteste, die schließlich zu seinem Sturz führten.
Die Deutschen und die Amerikaner förderten die Oppositionsparteien, wobei Berlin vor allem den früheren Boxweltmeister Vitali Klitschko, der in die Politik gegangen war, als seinen Mann sah. Der Westen zog die Ukraine intellektuell und ökonomisch auf seine Seite, indem man prowestlichen Ukrainern bei dem Schub nach Westen durch Schulungen und Finanzierungen verschiedener demokratischer Oppositionsgruppen Beihilfe leistete.
In Kiew flammten Straßenkämpfe auf und überall im Land nahmen die Demonstrationen zu. Im Osten gingen die Massen auf die Straße, um den Präsidenten zu unterstützen. Im Westen des Landes war man in Städten wie Lwiw (Lemberg), das einst zu Polen gehört hatte, eifrig dabei, jeden prorussischen Einfluss abzuschütteln.
Mitte Februar 2014 hatte die Regierung dann keine Gewalt mehr über Lwiw und andere Städte. Am 22. Februar, nachdem es in Kiew Dutzende von Toten gegeben hatte, floh der Präsident, der um sein Leben fürchtete. Antirussische Gruppierungen, von denen manche prowestlich, andere profaschistisch waren, übernahmen die Regierung. In diesem Moment waren die Würfel gefallen. Präsident Putin hatte eigentlich keine Wahl – er musste die Krim annektieren, auf der nicht nur viele russischsprachige Ukrainer leben, sondern, viel wichtiger, die auch den Schwarzmeerhafen Sewastopol beherbergt.
Dieser geographische Imperativ und die Ostwärtsbewegung der NATO insgesamt, sind genau das, was Putin im Hinterkopf hatte, als er in einer Rede zur Annexion sagte: »Russland fand sich an einem Punkt wieder, an dem es nicht mehr zurück konnte. Wenn man die Feder bis zum Äußersten anspannt, schnappt sie heftig zurück. Das dürfen Sie nie vergessen.«
Sewastopol ist für Russland der einzige bedeutende Hafen, der ganzjährig eisfrei ist. Allerdings ist der Zugang vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer eingeschränkt durch den Vertrag von Montreux von 1936, der der Türkei – heute NATO-Mitglied – die Kontrolle über den Bosporus gewährt. Russische Marineschiffe durchfahren die Meerengen, aber in limitierter Zahl – und im Falle eines Konflikts würden sie keine Erlaubnis mehr dafür bekommen. Und nach der Durchquerung von Bosporus und Dardanellen müssen die Russen noch durch die Ägäis, ehe sie das Mittelmeer erreichen, von wo aus sie entweder die Straße von Gibraltar oder den Suezkanal passieren müssen, um in den Atlantik beziehungsweise den Indischen Ozean zu gelangen.
Die Russen haben auch einen kleinen Marinehafen in Tartus an der syrischen Mittelmeerküste (das erklärt ein Stück weit, warum sie bei Ausbruch der Kämpfe 2011 die syrische Regierung unterstützten), aber es handelt sich trotz der Erweiterung und Modernisierung um eine eingeschränkte Basis für Nachschub und Versorgung, nicht um einen größeren Stützpunkt.
Ein weiteres strategisches Problem ist, dass die russische Marine im Fall eines Krieges wegen der Meerengen rund um Dänemark auch die Ostsee nicht verlassen kann. Diese Straßen Richtung Nordsee werden von den NATO-Mitgliedern Dänemark und Norwegen kontrolliert. Und selbst wenn die Schiffe diese Passage meistern würden, müssten sie auf dem Weg zum Atlantik noch die sogenannte GIUK-Lücke in der Nordsee (den Engpass zwischen Grönland, Island und UK) überwinden – mehr dazu, wenn wir auf Westeuropa blicken.
Seit der Annexion der Krim verlieren die Russen keine Zeit. Nach den 2011 angepassten Pachtbedingungen für den Hafen Sewastopol konnte Kiew die Modernisierung der russischen Schwarzmeerflotte blockieren. Das gilt nicht mehr. Hunderte Millionen Rubel fließen jetzt in die Nachrüstung der Flotte sowie den Ausbau und die Modernisierung des Marinehafens in der russischen Stadt Noworossijsk, der dem Land zusätzliche Kapazitäten verschafft, auch wenn es sich nicht um einen natürlichen Tiefwasserhafen handelt. Es ist zu erwarten, dass bis 2020 achtzehn neue Kriegsschiffe von den beiden Häfen aus operieren und weitere achtzig Schiffe in Auftrag gegeben sind. Die Flotte wird immer noch nicht stark genug sein, um in Kriegszeiten aus dem Schwarzen Meer auszubrechen, aber ihre Kapazitäten nehmen eindeutig zu.
Die zu erwartende Antwort ist, dass die USA in den nächsten zehn Jahren den NATO-Partner Rumänien ermuntern werden, seine Flotte im Schwarzen Meer zu vergrößern, während man sich vor allem darauf verlässt, dass die Türkei den Bosporus hält.
Fast zwei Jahrhunderte lang gehörte die Krim zu Russland, ehe sie 1954 von Präsident Chruschtschow der Sowjetrepublik Ukraine übertragen wurde – zu einer Zeit, in der man davon ausging, dass der Sowjetmensch unsterblich sei und deshalb auf ewig von Moskau kontrolliert würde. Nachdem die Ukraine nicht mehr sowjetisch und nicht einmal mehr prorussisch war, bestand für Putin Handlungsbedarf. Wussten das die westlichen Diplomaten? Falls nicht, kannten sie Regel A, Lektion 1 aus dem Handbuch ›Diplomatie für Anfänger‹ nicht – wenn eine Großmacht mit einer Bedrohung konfrontiert ist, die sie als existenziell betrachtet, wird sie mit Gewalt reagieren. Falls ja, dann müssen sie Putins Annexion der Krim als angemessenen Preis dafür angesehen haben, dass man die Ukraine ins moderne Europa und in den westlichen Einflussbereich holt.
Eine oberflächliche Sichtweise ist, dass die USA und die Europäer sich freuten, die Ukraine als vollwertiges Mitglied in der demokratischen Welt mit ihren liberalen Einrichtungen und ihrer Rechtsstaatlichkeit zu empfangen, und Moskau nicht viel dagegen tun konnte. Das ist eine Perspektive, die den Umstand ignoriert, dass Geopolitik auch im 21. Jahrhundert noch existiert und Russland sich nicht an Rechtsstaatlichkeit hält.
In ihrem Siegestaumel hatte die neue Interimsregierung der Ukraine sofort einige törichte Verlautbarungen gemacht, nicht zuletzt die Ankündigung, man wolle Russisch als zweite Amtssprache in verschiedenen Regionen abschaffen. Da es sich hierbei um die Regionen mit den höchsten Anteilen an russischen Muttersprachlern und prorussischen Empfindungen handelte, wozu eben auch die Krim gehörte, löste das zwangsläufig eine Gegenreaktion aus. Und die lieferte Präsident Putin auch die Propaganda, die er benötigte, um zu behaupten, ethnische Russen in der Ukraine müssten geschützt werden.
Der Kreml hat ein Gesetz verabschiedet, das die Regierung verpflichtet, »ethnische Russen« zu schützen. Was unter dieser Bezeichnung zu verstehen ist, lässt sich per se schwer fassen, denn Russland kann diese in jeder potenziellen Krise, die in der früheren Sowjetunion entstehen mag, nach Wunsch definieren. Wenn es dem Kreml passt, können ethnische Russen einfach als Menschen definiert werden, deren Muttersprache Russisch ist. Bei anderer Gelegenheit könnte das neue Staatsbürgergesetz zum Einsatz kommen, das bestimmt, dass man die russische Staatsbürgerschaft erhalten kann, wenn die Großeltern in Russland gelebt haben und Russisch die eigene Muttersprache ist. Somit dürften die Menschen geneigt sein, wenn es zur Krise kommt, auf Nummer sicher zu gehen und den russischen Pass anzunehmen. Das wäre dann ein Hebel für Russland, im Konfliktfall zu intervenieren.
Ungefähr 60 Prozent der Krimbevölkerung sind »ethnische Russen«, also rannte der Kreml offene Türen ein. Putin unterstützte die Demonstrationen gegen Kiew und schürte so viel Unruhe, dass er schließlich seine im Marinestützpunkt stationierten Truppen losschicken »musste«, um die Menschen auf der Straße zu schützen. Das ukrainische Militär in diesem Bereich war in keiner Weise vorbereitet, es sowohl mit der Bevölkerung als auch mit der russischen Armee aufzunehmen, und zog sich eilig zurück. Die Krim war de facto wieder Teil Russlands.
Man könnte anführen, dass Putin eine Alternative gehabt hätte: Er hätte die territoriale Einheit der Ukraine respektieren können. Doch bedenkt man, dass er mit den geographischen Karten zu spielen hatte, die Gott Russland zugeteilt hat, war das nie eine echte Option. Putin hat sicher nicht die Absicht, in die Geschichtsbücher als der Mann einzugehen, »der die Krim verloren hat« – und mit ihr den einzigen richtigen eisfreien Hafen, zu dem sein Land Zugang hat.
Niemand sprang der Ukraine bei, als sie ein Gebiet so groß wie Belgien oder der US-amerikanische Bundesstaat Maryland verlor. Die Ukraine und ihre Nachbarländer wussten um eine geographische Wahrheit: Solange man nicht in der NATO ist, ist Moskau nahe und Washington weit weg. Für Russland ging es um eine existenzielle Frage: Es konnte es sich nicht leisten, die Krim zu verlieren, der Westen sehr wohl.
Die EU verhängte halbherzige Sanktionen – halbherzig, weil mehrere europäische Länder, darunter Deutschland, von russischen Energielieferungen abhängen, um ihre Wohnungen im Winter heizen zu können. Die Pipelines verlaufen von Ost nach West, und der Kreml kann die Hähne auf- und zudrehen.
Energie wird in den kommenden Jahren immer wieder als politischer Machtfaktor eingesetzt werden, und das Konzept der »ethnischen Russen« wird benutzt werden, um das jeweilige Vorgehen Russlands zu rechtfertigen.
In einer Rede bezog sich Putin 2014 kurz auf »Noworossija« oder »Neurussland«. Den Kreml-Beobachtern stockte der Atem. Putin hatte die geographische Bezeichnung wiederbelebt, die einst das Gebiet trug, das heute die südliche und östliche Ukraine bildet und das Russland Ende des 18. Jahrhunderts unter der Herrschaft von Katharina der Großen dem Osmanischen Reich abgenommen hatte. Katharina sorgte für die Ansiedlung von Russen dort und verfügte, dass Russisch die Verkehrssprache sei. An die neu gegründete Ukrainische Sowjetrepublik wurde »Noworossija« erst 1922 abgetreten. »Warum?«, fragte Putin rhetorisch. »Überlassen wir Gott die Beurteilung.« In seiner Rede zählte Putin die ukrainischen Regionen Charkiw, Luhansk, Donezk, Cherson, Mikolajiw und Odessa auf, ehe er sagte: »Russland verlor diese Gebiete aus unterschiedlichen Gründen, aber die Menschen sind dortgeblieben.«
Innerhalb der ehemaligen UdSSR, aber außerhalb von Russland leben immer noch mehrere Millionen ethnischer Russen.
Es war keine Überraschung, dass Russland nach der Annexion der Krim die prorussischen Erhebungen im industriellen Kernland der Ostukraine, in Luhansk und Donezk, beförderte. Russland könnte militärisch leicht zum Ostufer des Dnjepr in Kiew vordringen. Aber es braucht die Probleme nicht, die das mit sich brächte. Weit weniger schmerzhaft und billiger ist es, Unruhen an der Ostgrenze der Ukraine zu schüren und Kiew daran zu erinnern, wer die Energieversorgung kontrolliert, um sicherzustellen, dass Kiews Verliebtheit in den flirtbereiten Westen nicht in einer Ehe mündet, die in den Schlafzimmern von EU oder NATO vollzogen wird.
Die verdeckte Unterstützung der Erhebungen in der Ostukraine war auch logistisch einfach und hatte den zusätzlichen Vorteil, dass man sie auf internationalem Parkett leugnen konnte. Im Sitzungssaal des UN-Sicherheitsrats schlichtweg zu lügen ist einfach, wenn mein Gegenüber keinen konkreten Beweis für meine Aktionen hat und, noch wichtiger, gar keinen konkreten Beweis haben will, wenn er dann vielleicht etwas unternehmen müsste. Viele westliche Politiker atmeten erleichtert auf und murmelten leise: »Gott sei Dank ist die Ukraine nicht in der NATO, sonst müssten wir einschreiten.«
Die Annexion der Krim zeigt, dass Russland bereit ist militärisch zu intervenieren, wenn es darum geht, seine Interessen im von ihm so bezeichneten »nahen Ausland« zu verteidigen. Es war ein kalkulierbares Risiko, dass die außenstehenden Mächte nicht eingreifen würden und die Krim »machbar« sei. Sie liegt dicht bei Russland, kann über das Schwarze und das Asowsche Meer versorgt werden und es war mit interner Unterstützung durch große Teile der Bevölkerung auf der Halbinsel zu rechnen.
Russland ist mit der Ukraine und auch anderen Gebieten noch nicht fertig. Die Lage im Donezbecken ist nach wie vor instabil und es kommt weiterhin zu gelegentlichen Kampfhandlungen. Ein Gewaltausbruch im Sommer 2017 kostete mehrere ukrainische Soldaten das Leben und führte dazu, dass die USA über eine Erhöhung ihrer militärischen Unterstützung der Ukraine nachdachten und die Russen massive Militärübungen in der Nähe der ukrainischen Grenze abhielten.
Im November 2018 stoppte die russische Küstenwache einen ukrainischen Schlepper und zwei Patrouillenboote, die aus Odessa kommend zum ukrainischen Stützpunkt in Mariupol am Asowschen Meer fahren wollten. Die ukrainischen Schiffe wurden gerammt und beschossen, drei Matrosen wurden verletzt und schließlich alle drei Schiffe und ihre Mannschaften festgesetzt. Die Zufahrt zum Asowschen Meer wurde durch einen Tanker gesperrt, der unter der Brücke über die Straße von Kertsch quergelegt wurde. Während die ukrainischen Seeleute im September 2019 bei einem Gefangenenaustausch wieder freikamen, blieben ihre Schiffe bis zum November 2019 beschlagnahmt.
All dies wurde von heftigen internationalen Protesten begleitet. Die NATO ließ durchblicken, sie werde schon dafür sorgen, dass die Zufahrt zum Asowschen Meer freibliebe. Im April 2019 erklärte die damalige amerikanische Botschafterin bei der NATO, Kay Bailey Hutchinson, die NATO wolle die Zahl ihrer Schiffe im Schwarzen Meer erhöhen und die Luftüberwachung verstärken, um die freie Durchfahrt zu sichern. Die Antwort kam von Ruslan Balbeck, einem Abgeordneten der Krim im russischen Parlament. »Die NATO«, sagte er, »kann sich mit den Fäusten auf der Brust herumtrommeln, so viel sie will. Die Durchfahrt erfolgt nach den russischen Regeln.«
Solange es nicht bedroht wird, wird Russland seine Truppen wahrscheinlich nicht den weiten Weg in die baltischen Staaten oder noch weiter nach Georgien hinein schicken, als sie jetzt stehen, aber es wird seine Machtposition in Georgien stärken, und weitere militärische Aktionen können in diesen unbeständigen Zeiten nicht ausgeschlossen werden.
Auf alle Fälle war das russische Vorgehen im Georgienkrieg 2008 ebenso eine Warnung an die NATO, nicht näher zu kommen, wie die Botschaft der NATO – »so weit nach Westen und nicht weiter« – im Sommer 2014 eine an Russland war. Eine Handvoll NATO-Flugzeuge wurden in die Baltikumstaaten gebracht, Militärübungen in Polen angekündigt und die Amerikaner begannen mit der Planung, zusätzliches Kampfmaterial so nah wie möglich an Russland »vorzupositionieren«. Gleichzeitig erfolgten zahllose diplomatische Besuche von Verteidigungs- und Außenministern in den baltischen Staaten, Georgien und Moldawien, um diesen Unterstützung zuzusichern.
Einige Kommentatoren hielten ihren Zorn über die Aktionen nicht zurück und ätzten, dass sechs RAF-Eurofighter Typhon, die durch den baltischen Luftraum flogen, wohl kaum geeignet seien, die russischen Horden abzuschrecken. Doch es ging bei der Reaktion um diplomatische Signale, und diese Signale waren deutlich – die NATO ist bereit einzugreifen. Das hätte sie in der Tat tun müssen, denn wenn sie bei einem Angriff auf ein Mitgliedsland nicht reagieren würde, wäre sie auf der Stelle obsolet. Die Amerikaner – die sich bereits in Richtung einer neuen Außenpolitik bewegen, bei der sie sich von bestehenden Strukturen weniger eingeengt fühlen, und bereit sind, je nach ihren Notwendigkeiten neue Strukturen zu schmieden – sind nach wie vor absolut unbeeindruckt von den Verteidigungsausgaben der europäischen Länder.
Als Präsidentschaftskandidat bezeichnete Donald Trump die NATO als »obsolet«, als Präsident ruderte er in dieser Frage im Frühjahr 2017 zurück, aber es ist offensichtlich, dass er die anderen NATO-Länder nervös machen wollte, was auch zu einem geringfügigen Anstieg der Verteidigungsausgaben bei einer Handvoll der Mitglieder geführt hat.
Präsident Trump enthielt sich einer Äußerung, ob die USA einem NATO-Verbündeten automatisch zur Seite stehen würden, doch auch hier, nachdem die Realitäten und Komplexitäten von Verteidigung, Kriegführung, Propaganda und Geopolitik deutlich geworden waren, bestätigte er schließlich im Frühjahr 2017 die Gültigkeit des Artikels 5 der NATO.
Im Fall der drei baltischen Staaten ist die NATO-Position eindeutig. Da sie alle Mitglieder des Bündnisses sind, würde ein bewaffneter Angriff Russlands auf jedes von ihnen den Artikel 5 des Nordatlantikvertrags auf den Plan rufen, der besagt: »Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird.« Weiter heißt es, dass die NATO Beistand leistet, wenn das nötig wird. Der Artikel 5 wurde nach den Terrorangriffen auf die USA am 11. September 2001 herangezogen und ebnete den Weg für den NATO-Einsatz in Afghanistan.
Präsident Putin beschäftigt sich mit Geschichte. Er scheint die Lektionen der Sowjetjahre gelernt zu haben, in denen sich Russland übernommen hat und gezwungen war, zurückzustecken. Mit einem direkten Angriff auf die baltischen Staaten würde es sich ebenso übernehmen, deshalb ist ein solcher unwahrscheinlich, insbesondere, wenn die NATO und ihre politischen Führer dafür sorgen, dass Putin ihre Signale versteht. Anno 2016 schickte der russische Präsident jedoch sein eigenes Signal. Er änderte den Text des Papiers zur militärischen Gesamtstrategie und ging dabei weiter als das Strategiepapier der Marine 2015: Erstmals wurden die USA als »Bedrohung für die nationale Sicherheit« Russlands bezeichnet. Daraufhin wuchsen die Befürchtungen der NATO, und 2019 wurden Verhandlungen über einen dauerhaften amerikanischen Stützpunkt in Polen begonnen, zu dessen Unterhalt Warschau bis zu zwei Milliarden Dollar beitragen will.
Russland muss keine bewaffnete Division nach Lettland, Litauen oder Estland schicken, um Geschehnisse dort zu beeinflussen, aber wenn es das je tun würde, dann würde es das mit der Behauptung rechtfertigen, die großen russischen Gemeinden dort würden diskriminiert. In Estland wie in Lettland sind über ein Viertel der Bevölkerung ethnische Russen und in Litauen sind es 5,8 Prozent. Die russischsprachige Bevölkerung in Estland sagt, dass sie in der Regierung unterrepräsentiert sei, und Tausende besitzen keine Staatsangehörigkeit. Das bedeutet nicht, dass sie zu Russland gehören wollen, aber sie stellen einen der Hebel dar, die Russland einsetzen kann, um die Dinge zu beeinflussen.
Die russischsprachigen Bevölkerungsteile im Baltikum können aufgewiegelt werden, um das Leben dort kompliziert zu machen. Es bestehen bereits politische Parteien, die viele von ihnen repräsentieren. Außerdem kontrolliert Russland die Zentralheizungen in den Wohnungen der Menschen im Baltikum. Es kann bestimmen, wie viel sie jeden Monat dafür bezahlen müssen, oder kann, wenn es will, die Heizung einfach abdrehen.