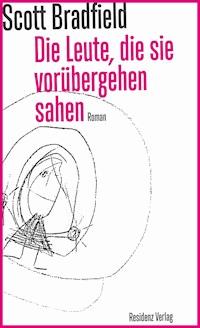11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Für den siebenjährigen Philipp ist die Kindheit eine endlose Autofahrt durch Kalifornien; unterwegs mit seiner Mutter, die ab und an mit einem Liebhaber verschwindet, fühlt er sich geborgen im fließenden Licht der Autoscheinwerfer, im Neon der Motels, in dieser leuchtenden Bewegung, die für ihn eins ist mit seiner wunderbaren Mam. Mit dem Auftauchen von Dad gerät Philipps ödipales Paradies in Gefahr, das er radikal und brutal zu verteidigen sucht. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Ähnliche
Scott Bradfield
Die Geschichte der leuchtenden Bewegung
Roman
Aus dem Amerikanischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Felicia
Das ist die lange, lässige Zeit
Bevor etwas Großes geschieht …
Tom Paulin
Bewegung
1
Mam war eine Welt ganz für sich, voller geheimer Gedanken und Bewegungen, die jedem sonst verborgen blieben. Wenn ich bei Mam war, vergaß ich Dad auf der Stelle, und er war dann kaum mehr als eine Ahnung, eher etwas Seltsames, fern Bedeutungsvolles als ein Mann, so als finde Mams Rache darin ihre Erfüllung, daß sie Dad in die Zukunft verbannte. Mam, das war immer das Jetzt. Mam war die niemals endende Bewegung. Die Welt war bevölkert von Mam und mir und sonst niemandem, und alle paar Tage schien sie mich an neue, jedesmal fremdere Orte zu bringen in unserem zerbeulten und gefährlich klappernden beigen Ford Rambler. Und es war mehr als nur Bewegung. Mam besaß eine gewisse geographische Schwere und Masse. Ihre Bewegung war selbst ein Ort, eine Stimme, ein Ruhezustand. Ganz gleich, wohin wir fuhren, wir schienen zu bleiben, wo wir schon immer gewesen waren. Wir waren mehr als eine Familie. Mam und ich. Wir waren Teil der Landschaft. Wir waren eher der Name der Landkarte als eine verschlüsselte oder strategische Position darauf. Wir waren wie eine MX-Rakete, stets in Bewegung und doch immer genau da, wo wir sein sollten. Es kam oft vor, daß ich mir Mam und mich als eine Art Waffe vorstellte.
»Liebst du deine Mutter?« fragte mich einer von Mams Männern. Wir saßen bei Sambo’s, und ich trank heiße Schokolade. Mam war auf der Damentoilette, um sich frisch zu machen.
Er schien mit dieser Frage eigentlich etwas anderes zu meinen. Etwas von Seßhaftigkeit lag darin, vom Sich-Niederlassen, als sollten es die wackligen Fundamente für ein zukünftiges Heim werden. Auf dem Schoß hatte ich, wie immer, eins meiner Schulbücher liegen. Es hieß Wunderbare Welt der Biologie: 5. Auflage, und ich beschäftigte mich mit den Worterklärungen zum dritten Kapitel. Das Wort »Chemotropismus« gefiel mir: »Bewegung oder Wachstum von Organismen, insbes. Pflanzen, hervorgerufen durch chemische Stimulantien«. Chemotropisch, dachte ich. Chemotropal.
»Sie ist sehr nett, deine Mutter«, fuhr der Mann fort. Er mochte die Stille nicht, wie sie zwischen uns beiden am Tisch hockte. Mir persönlich machte das nichts aus. Er rauchte eine Marlboro nach der anderen und drückte sie in seiner Untertasse aus statt in dem gläsernen Aschenbecher von Sambo’s, den er bequem in Reichweite hatte. Er war nervös und blickte sich dauernd um, ob Mam noch nicht zurückkam. Ich hatte ihm nicht gesagt, daß Mam manchmal stundenlang auf der Damentoilette blieb; die Damentoilette war einer von Mams Lieblingsorten. Ganz gleich, wo wir gerade wohnten und wo wir unterwegs waren, Mam fand immer die gleiche, entspannte Atmosphäre auf der Damentoilette, wohin sie ging, um sich schön zu machen. Manchmal, wenn ich sie dorthin begleitete wie ein privilegierter und vertrauter Berater, saßen wir stundenlang vor dem Spiegel, während sie verschiedene Lippenstifte und Lidschatten ausprobierte, Wimperntuschen und Rouges. Mam fand Stille auf der Damentoilette und in der Schönheit ihres eigenen Gesichts. Es war wie die Stille, die zwischen mir und Mams Männern an den Tischen saß, nur wußten Mam und ich die Stille mehr zu schätzen, und deshalb war sie tiefer.
»Ich liebe meine Mam«, antwortete ich und hielt das Buch auf den Knien weiter aufgeschlagen. Doch Mams Mann sah mich nicht an. Er schien mit seinen Gedanken woanders zu sein. Es war, als sei die Stille tatsächlich auch in ihn hineingekrochen, etwas, das auf ihn übergegangen war aus der noch frischen Erinnerung an Mams Haut und Mams Duft. Ich wandte mich wieder meinem Buch zu, und wir saßen zusammen und tranken Kaffee und heiße Schokolade und warteten, daß Mam kam und die Schranken zwischen uns niederriß, eine Kunst, die sie mit sich trug wie eine leuchtende Fackel oder einen großen Packen Geldscheine. Manchmal kam es mir vor, als ob ich in jenem Sommer eine Million Jahre alt würde und daß Mam und ich für alle Zeiten weiter so unterwegs sein würden, immer zusammen und niemals getrennt. Ich denke daran zurück als an den Sommer im millionsten Jahr meines Lebens, und diesen Sommer werde ich, fürchte ich, wohl niemals vergessen.
Das waren Nächte, in denen wir viel unterwegs waren, die Nächte, in denen Mam ihre Männer fand. Ich lag meistens auf dem Rücksitz unseres Wagens und las in meinen abgewetzten Schulbüchern, zusammengeklaubt aus den vermodernden Zehn-Cent-Kisten in vollgestopften, verstaubten Antiquariaten. Ich las im diffusen Schein der Straßenlampen oder im fließenden Licht der vorbeirasenden Automobile, in seinen Dopplereffekten. Manchmal mußte ich mitten in einem Abschnitt oder in einem Satz innehalten, um auf dies sensible Licht zu warten. Damals glaubte ich, Licht habe Schichten und Texturen wie die Blätter eines Baumes. Es glitt und wirbelte durch den Wagen. Es fühlte sich sanft und unmittelbar an wie Schnee. Am Ende schlief ich dann ein, während das Licht über mich hinwegzog und mich umschwirrte, auf einer dunklen, namenlosen Straße, und ich hörte, wie die Tür geöffnet und wieder zugeschlagen wurde und Mam den Motor startete, und dann waren wir wieder unterwegs, gemeinsam unterwegs im Licht der Städte und der Sterne, und Mam deckte mich mit ihrem Mantel zu und flüsterte: »Irgendwann haben wir unser eigenes Haus, mein Schatz. Unsere eigenen Schlafzimmer, eigene Küche und Fernseher, unsere eigenen Wände und Decken und Türen. Wir kaufen uns einen nagelneuen Kombi mit einer schönen weichen Matratze hintendrin, da kannst du dich hinlegen und ein Nickerchen machen, sobald du Lust dazu hast. Wir werden ein großes Grundstück haben und einen Garten. Vielleicht haben wir sogar ein Wochenendhaus. Irgendwo in den Bergen.«
Morgens erwachte ich in neuen Städten, unter neuen Sternen. Aber irgendwie waren es auch immer dieselben Städte. Und die Sterne waren noch immer dieselben Sterne.
Die Kreditkarten bewahrte Mam in einem Plastik-Karteikasten im Handschuhfach auf, sogar die ganz alten Karten, die wir überhaupt nicht mehr benutzten. Der Kasten enthielt auch ein paar Ringe mit Edelsteinen, ein paar goldene Armreifen, von denen wir manchmal welche bei den Pfandleihern in den Innenstädten verkauften, und ein paar Visitenkarten, mit Telefonnummern und eilig auf die Rückseite gekritzelten Lageplänen. Das waren die Landkarten von Mams Männern, und manchmal sah ich sie mir lieber an als meine Schulbücher. Das waren Namen von Dingen, Leuten und Orten, die Farbe hatten, Spannung, etwas, das sie zusammenhielt, wie ein Globus, auf dem die Bergzüge plastisch hervorgehoben sind. Lompoc, Burlinghame, Half Moon Bay, Buellton, Stockton, Sacramento, Davis, San Luis Obispo. Immobilien, Klempnerei, Feuer–Diebstahl–Auto, Kautionen rund um die Uhr, Gute Gebrauchtwagen, Cala Foods, Daybrite Cleaners. Mams Männer waren Ansammlungen von Worten wie Nägel in einem Stück Holz. Wenn ich den Kasten wieder schloß, schnappte die Plastikklammer des Deckels mit einem hohlen Klacken zu. »Das ist Mams Doomsday Book, das du da hast«, sagte Mam. »Ihre Schriftrollen vom Toten Meer, ihre tabula fabula. Da hast du Mams Vergangenheit, zusammengeborgt und -gekauft, eine ziemlich traurige Angelegenheit, das kann man wohl sagen. Wenn sie deine alte Mutter jemals zu fassen bekommen, dann nimmst du diesen Kasten und wirfst ihn in den Fluß – natürlich nur, wenn du einen Fluß in der Nähe hast. Mach dich auf in die Berge, und in fünf bis zehn Jahren bin ich wieder bei dir – obwohl das nur eine grobe Schätzung ist, fürchte ich. Ich habe schon lange aufgehört, über die Straftaten Buch zu führen. Ich glaube, das ist der Lohn, der einem im Alter winkt – nicht die Weisheit. Man darf aufhören, über seine Straftaten Buch zu führen.« Mam hatte leuchtendroten Lippenstift aufgelegt und trug enge, verwaschene Levi’s und eine gelbe Bluse. Sie trank Budweiser aus einer Dose, die sie zwischen den Knien festgeklemmt hielt. Ich fand ganz und gar nicht, daß Mam alt war. Ich fand sie unglaublich jung und schön.
Vor unseren verstaubten Autofenstern erstreckte sich die platte, pulsierende, rote Ebene des San Fernando Valley. Stumpfgraue blecherne Wassertürme, rot und weiß gestreifte Sendemasten, Küste. »Emily Dickinson«, erklärte Mam mir, »hat gesagt, sie könne das ganze Universum in ihrem Hinterhof finden. Und dies hier, weißt du, das ist unser Hinterhof.« Mam wies auf die Orangenplantagen und die verfallenen, von der Sonne ausgebleichten Obststände und Schnellrestaurants rechts und links des Highway 101. Der Asphalt der Fahrbahn war bleich und zerbröckelt, übersät von Abfall und den zerfetzten Karkassen zu heiß gewordener runderneuerter Reifen. Dann steckte Mam sich immer eine Zigarette an, mit dem Anzünder im Armaturenbrett. Ich mochte es, wie der Anzünder sich eine Weile lang lautlos aufheizte, wie eine Drohung, die sich zusammenbraute, und dann plötzlich mit einem fast tonlosen, klickenden Geräusch heraussprang, Mam hielt schon die Hand bereit, um ihn aufzufangen – sonst flog er auf den Kunstledersitz und fügte den Brandstreifen, die er dort schon hinterlassen hatte, einen weiteren hinzu. Selbst auf Mams ausgewaschener Levi’s, auf der Innenseite der Oberschenkel, gab es einen verräterischen länglichen Flecken. »Jetzt halt die Augen offen nach der Abfahrt Gilroy«, sagte Mam. »Die muß hier irgendwo sein. Erst essen wir einen McDonaldburger, und dann kenne ich da eine Bar, in der ich vielleicht Glück habe. Vielleicht haben wir beide Glück.« Und natürlich hatten wir Glück, immer.
2
Da ich Mam stets mit ihrer Bewegung gleichsetzte, die wie selbstverständlich zu ihr gehörte, kam es mir jedesmal, wenn diese Bewegung nachließ oder zum Erliegen kam, vor, als ob auch Mam nun weniger bedeute. Das erste, was mir auffiel, war immer die Wortlosigkeit, jener Puls und Atem ihrer gleichmäßigen, unermüdlichen Stimme. Sie war tonlos und doch voller Lärm, bedeutungslos und doch voller Worte. Es war wie jene Intensivierung der Sprache, bei der sie selbst ausgelöscht wird, wie wenn jemand tausend Sätze über immer dieselbe Zeile tippt, auf strahlendweißem Briefpapier, bis nichts mehr bleibt als ein schwarzer, marmorierter Kohlestreifen.
»Das ist Pedro«, eröffnete sie mir nach jenem langen, umständlichen Tag in San Luis Obispo. Wir hatten die Woche über in einem TraveLodge am Los Osos Boulevard gewohnt, was wir, auch wenn dieser nichts davon wußte, der Großzügigkeit von Randall T. Philburn verdankten, einem Vertreter für Landmaschinen, den Mam eine Woche zuvor in einem Bingosaal in King City kennengelernt hatte. Randall hatte Diner’s Club und American Express bei sich gehabt. Er hatte mir ein Kunststück mit zwei Seilen beigebracht. Bis zum nächsten Tag hatte ich die Namen und Lebensdaten sämtlicher amerikanischer Präsidenten auswendig lernen sollen.
»Und dies, Pedro«, sprach Mam, »dies ist der einzige Mann, der mir in meinem Leben etwas bedeutet. Mein unauffälliger und schweigsamer Sohn Philipp.«
So fing es also an. Sie sagte mir, er heiße Pedro, als ob alle ihre Männer Namen hätten. Pedro. Als ob der Name eines Mannes etwas wäre, das man ausspricht, und nicht ein geprägtes Stück Plastik, das in die schmutzige beige Schachtel im Durcheinander des Handschuhfaches unseres Rambler gehörte. Pedro. Als ob ich mir das merken sollte. Als ob der Name eines Mannes etwas sei, das man mit dem Munde sagt, damit die Ohren eines anderen es hören können.
Mehr war es nicht, dieses erste, angedeutete Verblassen von Mams Körper und ihrer Stimme. Kaum ein Laut und doch mehr als ein Name. Pedro. Und es war nicht einmal sein richtiger Name.
»Wie geht’s, alter Junge?« begrüßte mich Pedro und ließ mich spüren, was ein fester Händedruck ist. In Wirklichkeit hieß er Bernie Robertson, und Bernie hatte ein rundes und (besonders nach seinem zweiten oder dritten Budweiser) rotes Gesicht, einen Eisenwarenladen in Shell Beach, ein Bäuchlein und ein Haus mit zwei Schlafzimmern im Lakewood-Viertel von San Luis Obispo, wo mir die zweifelhafte Ehre eines eigenen Zimmers zuteil wurde. Nur eine Woche, nachdem wir uns offiziell vorgestellt worden waren, schaffte Pedro unsere wenigen Besitztümer vom TraveLodge in sein Heim, wo einem sein wahrer, niemals ausgesprochener Name überall begegnete. Er stand auf der Post und auf den Wagenpapieren und auf den Handtüchern und dem Kaminvorleger, auf dem Hypothekenbrief und der Besitzurkunde. Er war sogar in eine Eichenholzscheibe eingebrannt, die an Pedros Veranda baumelte: DIE ROBERTSONS. Und dieser Name würde sich, wenn wir nicht sehr vorsichtig waren, bald auch an Mam und mich hängen.
»Mein Haus soll auch euer Haus sein«, sagte Pedro gern, wenn er auf dem Sofa saß, den Arm um Mam gelegt, und seine Dose Bud auf dem rechten Knie balancierte. In Pedros Haus gab es dick gepolsterte viktorianische Zweisitzer, Regale mit Krimskrams, Porzellanstatuen von Damen und Herren der Restaurationszeit, die Rondos tanzten und Handküsse gaben, niemals aufgeschlagene Exemplare von Reader’s Digest und der Saturday Evening Post, Spitzendeckchen unter den Tellern und sogar Sesselschoner. Mam lag mit Pedro auf einem der Sofas, ihren Kopf in seinem Schoß, seinen Arm auf ihrer Brust. Ich saß mit meinem Schulbuch alleine auf dem anderen. Es hieß Wissenschaft und Alltag, und darin war eine Farbfotografie von E. coli. Die meisten Menschen und Tiere, hieß es in der Bildunterschrift, hätten dieses Bakterium in ihrem Darm, und wenn es in der Regel auch gutartig sei, könne es bei Kleinkindern Durchfall und Magenverstimmung hervorrufen. Mam und Pedro schienen sich vor dem Feuer sehr warm und behaglich zu fühlen. Das Fernsehen war eingeschaltet und plapperte leise vor sich hin. Ein Stück vertrockneter Pizza lag noch auf dem beschichteten Karton neben dem prasselnden Kamin, der aus Backsteinen gemauert war, und Heidi, Pedros hochnäsige und gelangweilte Katze, hielt bisweilen in ihren Runden inne und leckte daran. Manchmal las ich einfach im Wörterbuch. Autodafé, Autodidakt, autogam, autoimmun, autözisch. Wörter im Wörterbuch haben einen ganz eigenen Rhythmus, eine nüchterne, einfache Bedeutung, die ich im Kopf zusammensammeln konnte wie ein Lied oder liebkosen wie ein geschnitztes Stück Holz. Autözisch, dachte ich. Autogamie. Autoimmun.
»Gibt es irgendwas, was du gern sehen möchtest, Philipp?« fragte Mam dann vielleicht. »Pedro und ich haben uns gerade etwas angesehen, das wir sehen wollten.«
Ich schlug Mams Angebot aus und ließ mich lieber in den Strömen von Worten und Bildern treiben, die aus der Ungestörtheit meiner eigenen Bücher kamen. Das Fernsehen blieb auf dem Unterhaltungskanal eingeschaltet, den Pedro und Mam eben ausgewählt hatten. Am Ende dieses traurigen Sommers wurde ich ganz nebenbei in der Schule angemeldet.
Ich brauche wohl gar nicht zu sagen, daß meine erste Erfahrung mit dem öffentlichen Schulwesen ebenso qualvoll wie erbärmlich war. Gerade der Umstand, daß es dort im Grunde nichts Schreckliches gab, hatte etwas Alptraumhaftes, und alles kam mir stets wie eine planvolle Übung in – wie soll ich sagen – leerer und ereignisloser Routine vor. Es gab andere Jungs und Mädchen dort, die ebenso alt waren wie ich, und ich wurde gedrängt, mich mit ihnen bekannt zu machen. Wenn ich aufgerufen wurde und nichts sagte, dann hielt man das für Schüchternheit und nicht für Abscheu im Innersten. Uns wurden Märchen und Erzählungen vorgelesen, und wir selbst lasen erbärmliche Geschichten, wie sie das Leben schrieb, aus den dünnen Plastikfibeln des staatlichen Programms zur Leseerziehung. (Ich wurde in das mittlere Niveau Abteilung Rot eingestuft, denn ich war absichtlich bei Konsonantenverbindungen und Diphthongen ins Stocken gekommen. Ich war fest entschlossen, daß keiner dieser Fremden jemals erfahren sollte, wer ich war.) Jeden Tag brachten wir sieben oder acht Stunden dort zu. Spiele, Geschwätz, schwachsinnige Bücher, endlose Pausen, blöde, unablässig fressende Tiere in Käfigen, die mit ihrem eigenen Urin und Sägemehl verschmiert waren, Buntpapier und Leim und Scheren, bei denen uns eingeschärft wurde, daß wir sie zu uns hin halten sollten, wenn wir sie dem Kunstmaterialwart zurückreichten. (Jeder von uns war mit irgendeinem schwachsinnigen Titel dieser Art geschmückt, wie Regierungsmitglieder in einem aufgedonnerten, wichtigtuerischen südamerikanischen Staat. Ich zum Beispiel war Tafelreinigungsinspektor.) Tag für Tag zog es sich endlos hin, sinnlos vertane Kindheit, ohne jemals den Trost auch nur des geringsten sinnvollen Bröckchens Wissen. Die Welt hatte mich in den Würgegriff bekommen und drohte mir nur noch das beizubringen, von dem sie wollte, daß ich es wußte.
»Deine Mam ist eine tolle Frau, wirklich allererste Klasse«, versicherte Pedro mir gern. Nachmittags nach der Schule waren wir beide meistens für eine gute Stunde allein im Haus, denn Mam hatte eine Teilzeitarbeit im örtlichen Lucky Food Store angenommen, wo sie die Lebensmittel verpackte. »Du hast großes Glück, junger Mann, daß du eine Mutter hast, die dich so sehr liebt.« Er sah mich nie richtig an, wenn er mit mir sprach, sondern war damit beschäftigt, Bierdosen aufzureißen, das Bild des Fernsehers zu justieren oder irgend etwas Nützliches im Garten zu basteln. Er sprach eigentlich nicht so sehr, eher brachen die Aphorismen aus ihm hervor. »Irgendwann muß jeder einmal seßhaft werden«, meinte er zum Beispiel, oder: »Auch eine Frau braucht bisweilen jemanden, der für sie sorgen kann. Auch Mütter muß man manchmal ein wenig lieben und ihnen helfen.« Und daraufhin spannte er dann irgend etwas in den Schraubstock oder hobelte die Kanten einer noch unlackierten Tür aus Furnierholz. An sonnigen Tagen trugen wir seine Werkzeuge und Maschinen hinaus in den Garten zur Werkbank aus Kieferbohlen, an der man sich immer Splitter holte, und in jenen endlosen, immergleichen Monaten, in denen Mam sich nicht von der Stelle rührte, schienen die Tage gnadenlos sonnig zu sein. Ich stand dann dabei und sah von weitem aus zu – nicht aus Vorsicht, sondern einfach, weil ich nicht zu sehr mit hineingezogen werden wollte. Pedro bastelte dort draußen mit Begeisterung: eine Pergola, einen Picknicktisch mit Stühlen; er legte eine betonierte Terrasse an und mauerte einen Kamin aus Backsteinen. Wär seiner Welt und Zeit genug, so hätte Pedro, dessen bin ich gewiß, dort draußen Landebahnen für Flugzeuge gebaut, gigantische Mausoleen aus Elfenbein, Pyramiden und Wolkenkratzer und Raumschiffe und Planeten. Mit der Eisensäge, die ich ihn immer so sorgfältig in seinen makellosen und geölten Werkzeugkasten zurückstecken sah. Mit der Kneifzange. Mit der scharfen Stahlfeile. Mit dem Schlosserhammer. Mit all diesen massiven und unglaublich nützlichen Werkzeugen, die er in dem großen schimmernden Werkzeugkasten aus Stahl aufbewahrte, den er unter dem Bett verstaute, in dem er und Mam jede Nacht schliefen. Dort war genau der richtige Platz für sie, fand ich. Sie brauten sich dort zusammen wie Wetter; man konnte ihren Druck in anderen Zimmern und anderen Häusern spüren. Mit diesen Werkzeugen hatte Pedro auch an Mams Verstand etwas gebastelt, spät in der Nacht arbeitete er daran, wenn sie schlief. Für mich steckte eine Wahrheit in diesem Bild, wörtlich oder übertragen, und in jenen sich entsetzlich hinziehenden Tagen des häuslichen Lebens war es mir gleich, welches von beiden eher zutraf. Ob es wörtlich war oder übertragen.
Nachdem wir in Pedros Haus gezogen waren, begann Mam mit seltsamen Dingen. Manchmal pfiff sie, oder sie nähte Vorhänge. Sie stopfte Socken. Sogar beim Sticken sah ich sie. Ich weiß noch, wie ich neben ihr auf dem Sofa saß und ihre Hände betrachtete, wie sie mit einem spitzenbesetzten Stück Stoff und einer dünnen, schimmernden Nadel hantierte. Diese Nadel war das einzige an der ganzen Prozedur, was mir einigermaßen sinnvoll vorkam. Die Nadel war kurz und bündig. Sie hatte ihre eigene, eindeutige Logik. Eines Tages war es soweit, und die neuen Vorhänge wurden im Wohnzimmer aufgehängt, Mam stemmte die Arme in die Hüften und lächelte. Ich nehme an, man erwartete, daß ich ebenfalls lächelte, doch ich lächelte nicht. Die dünnen Vorhänge besah ich mir allerdings. Sie schienen mir genau das richtige zu sein für Pedros dünnes Haus.
»Bist du glücklich?« fragte sie mich, wenn wir uns spätabends allein unterhielten; denn Pedro ging früh zu Bett und stand früh auf.
»Glaub schon.«
»Freundest du dich in der Schule mit anderen Kindern an?«
»Glaub schon.«
»Laden sie dich auch zu sich nach Hause ein? Haben sie nette Familien, nehmen sie dich bei sich auf?«
»Manchmal«, antwortete ich, und nun geriet ich allmählich ins Schwimmen. Ich wußte nicht, was Mam von mir erwartete. »Na ja, manchmal schon. Wir gehen nicht gemeinsam irgendwo hin. Wir sitzen einfach beisammen, weißt du.«
»Haben sie hübsche Höfe und Gärten?«
»Manche schon, glaub ich.«
»Haben sie hübsche Zimmer voll mit hübschen Spielsachen?«
»Sicher, manchmal.«
Mam strahlte, doch sie sah mich nicht an. Sie drückte ihre Marlboro aus, und ihre Augen blickten in die Ferne, hinüber zu den prächtigen Zimmern und Gärten meiner imaginären Freunde.
»Es ist für dich so besser«, sagte sie. »Du hast eine normale Kindheit verdient, ein geordnetes Leben, wo du weißt, woran du bist. Das ist das einzige Mal im Leben, daß man weiß, woran man ist, Schatz. Wenn man ein Kind ist. Wenn du erwachsen wirst, hat nichts mehr einen Sinn, ganz gleich, wie du’s auch ansiehst. Möchtest du irgendwann einen deiner neuen Freunde zum Abendessen mitbringen?«
»Ich glaube nicht.«
»Magst du dein neues Zuhause? Magst du Pedro?«
Ich dachte einen Moment lang nach. Ich spürte, wie ein heißes, prasselndes Feuer in meinem Herzen aufflammte, in meinem Gesicht, vor meinen Augen. Die Kehle schnürte sich mir zusammen. Plötzlich war mir schwindelig, und alles war verschwommen. Mit heiserer Stimme antwortete ich: »Er ist in Ordnung, denke ich.«
»Da hast du recht«, bestätigte Mam. »Er ist schwer in Ordnung.«
Eines unverzeihlichen Tages nahm Mam mich sogar mit zu Penney’s, um mir, wie sie sich ausdrückte, »Schulsachen« zu kaufen, und einen mörderischen, katastrophalen Augenblick lang zerrte sie mich vor die Regale mit den Pfadfinderuniformen und -ausrüstungen. Kompasse und Klappmesser und Halstücher und Verdienstorden und Handbücher und Zelte. Am Ende kaufte sie mir weiße Wollsocken, Baumwollunterwäsche und eine Karte des Sonnensystems, die sie an die Wand meines Zimmers heftete, damit ich, wie sie sagte, »anständig was zum Nachdenken« hatte, so wie stolze Mütter überall funkelnde Mobiles über die Bettchen ihrer blöde vor sich hinglotzenden Babys hängen. Ich dachte immer noch, alles würde besser. In Wirklichkeit wurde es schlimmer und immer schlimmer.
Es war die Rede von einer Geburtstagsparty, die es im November geben sollte, und den ganzen Sommer über war ich unruhig und machte mir Sorgen, was mir da an Monstrositäten drohte, Kuchen, Kerzen, andere Kinder mit Papphüten, Lotterien, Geschenke in buntem Packpapier mit gekräuselten Schleifchen. Man würde Partyspiele veranstalten auf dieser »Geburtstagsparty«. Mam würde kleine Preise aussetzen, und sie würde sorgsam darauf achten, daß kein Kind leer ausginge. Ich würde die Augen schließen und mir etwas wünschen. Ich würde meine sämtlichen, mit Schleifchen in der Hand eintreffenden Freunde mit einschmeichelnder Miene an der Haustür willkommen heißen. Schließlich würde ich, während Pedro sein Bier trank und sich allmählich sein übliches rotbackiges Lächeln einstellte, feierlich aufgefordert werden, die Geschenke auszupacken. Neue Hemden, Modellflugzeuge, Transistorradios, Bücher für »junge Erwachsene«, Schallplatten, vielleicht sogar einen eigenen tragbaren Plattenspieler oder Kassettenrecorder. Brettspiele, Schreibtischlampen, Zeitschriftenabonnements, Boote und T-Shirts und Socken. Immer mehr Dinge würden sich in meinem Schoß ansammeln, das Gewicht würde an meinem Unterleib zerren und Mam und mich näher an den harten Fußboden ziehen, tiefer in die undurchdringliche Erde. Nichts als Gewicht und Gravität und Masse, unbewegliche Masse. Und dieser Ausdruck von Bewegungslosigkeit in Mams einst so schönen Augen. »An deinem nächsten Geburtstag, da veranstalten wir eine Party im Park«, würde sie mir dann sagen, gerade wenn ich im Glauben war, die Qual sei vorüber, und noch damit beschäftigt, mir die ein wenig hysterischen Tränen aus den Augen zu wischen. »Da kannst du noch mehr Freunde einladen. Und du wirst noch mehr Geschenke bekommen.«
Bei diesen Worten pflegte ich dann aus meinem schweißnassen Bett hochzufahren, wo ich, in die zerwühlten Laken verstrickt, lag, umgeben vom bleiernen Mondlicht, eingeschlossen in den wirbelnden Staub. Die Karte des Sonnensystems hing mir gegenüber, ein zweifelhaftes Vergnügen mit ihren Bilderbuchfarben und den unmöglich säuberlichen Abgrenzungen. Monde und Planeten und Sonnen, eingefangen von Schwerkraft und Fliehkraft und chemischer Dichte. Sonnennähe und Erdferne. Jupiter und Mars. Ich wäre froh gewesen, wenn ich in einem von ihnen hätte aufgehen können. Mit Freuden wäre ich auf dem Merkur zerkocht, mit meinem eigenen, sich ausdehnenden gefrierenden Atem auf Pluto zerstoben. Ich spürte, wie alle Bewegung in meinem Inneren zum Halten kam, so wie die Atmosphäre erstarrt, wenn ein Planet entsteht. Irgendwann würde es auch mit Jupiter geschehen, eine Kugel aus zusammengedrücktem Dreck, gefühllose starre Städte, bösartige Kinder, die sich um einen ominösen Geburtstagskuchen versammeln, mit ihren Rasseln und ihren Papphüten. Mit jedem Tag wurde ich massiger und fester. Womöglich würden die Leute mir bald noch einen Spitznamen geben. Buster oder Chipper oder Mac. Ich konnte mir gut vorstellen, daß Pedro sich angewöhnen würde, mich Mac zu nennen. Ich sah das Wort sogar vor mir, wie er es mit seinen fetten, fleischigen Lippen aussprach, als ob er mit der dicken, hellroten Zunge einen weichen Gummiball herausschieben wolle. Wie geht’s, Mac? Wie wär’s, Mac, wollen wir Ball spielen?
Ich fand keinen Schlaf mehr. Ich warf mich in meinem Bett hin und her. Bevor ich eine echte Geburtstagsparty über mich ergehen ließe, würde ich mich lieber umbringen; allesamt würden sie ihre Gemeinheit und Rücksichtslosigkeit bedauern, gelobte ich ihnen, und mit einer gewissen Genugtuung stellte ich mir, wenn es auch egoistisch war, meine eigene Leichenrede und mein Begräbnis vor. Es würde ein trüber, regnerischer Tag sein, an dem sie meinen einsamen kleinen Sarg in die Grube senkten. Mam würde sich die Augen ausweinen, aber es gäbe niemanden mehr, der sie so in die Arme nähme, wie ich es konnte. Das würde Mam dann begreifen. Sie würde begreifen, welchem Entsetzen und welcher Einsamkeit sie mich ausgesetzt hatte. Pedro würde ihr beherzt zur Seite stehen, doch er würde nichts tun können, um ihre Tränen zu stillen. Sie würde sich winden, sie würde schluchzen, sie würde mich anflehen zurückzukommen. Uranus, Neptun, Pluto, Transpluto. Während ich allmählich in Mams Universum verlosch, konnte sie nur hilflos dabeistehen und zusehen, wie ich verschwand. Wenn ich nicht mehr in Mams Universum leben konnte, dann sollte sie sehen, was sie davon hatte. Ich würde mir mein eigenes Universum suchen. Das waren Nächte, in denen ich meine Mutter tatsächlich und aufrichtig haßte. Ich werde es mir vielleicht niemals verzeihen, aber damals habe ich sie wirklich gehaßt.
Dann und wann war ihre Schlafzimmertür nachts verschlossen, doch meistens ließen sie sie weit offen stehen, ich nehme an, um eine idyllische, vertraute Familienatmosphäre aufkommen zu lassen. Wenn ich nachts nicht schlafen konnte, konnte ich hinübergehen und die beiden betrachten, wie sie da lagen, eingewickelt in ihre gebleichten, verräterischen weißen Laken. Mam schlief stets auf ihrer rechten Seite, am Rande der übergroßen Stayrest-Matratze. Pedro grunzte und schnaufte im Schlaf wie ein Schwein. Wenn er auf dem Rücken lag, den Mund offen, sein fleckiges Gesicht ausdruckslos und dumm, sah sein Bauch sogar noch dicker aus. Wenn ich Pedro so im Schlaf sah, spürte ich etwas Hartes in mir wachsen, eine Pflanze. Sie raschelte mit verstrickten Wurzeln, schnarrende Laute mit webenden, faserigen Fingern. Sie regte sich nur nachts. Sie versuchte mir etwas über mich selbst zu sagen, was niemand mir zuvor gesagt hatte. Sie reichte durch alles hindurch. Sie hatte es beinahe geschafft.
3
Es war einfach nur eine Phase, die sie durchmachte, hatte ich mir eingeredet. Wie die Menstruation oder wie eine Pechsträhne. Immer, wenn Mam melancholisch und verschlossen wurde, bettete ich einfach meinen Kopf in ihren Schoß, legte die Arme um sie und hörte geduldig zu, ohne ein einziges Wort des Tadels. »Du verdienst ein besseres Leben, als ich dir jemals gegeben habe«, flüsterte Mam dann vielleicht, die Hand mit dem eiskalten Drink an meinem Ohr, während sie ziellos ihr verzerrtes Bild im Taschenspiegel betrachtete. »Du verdienst ein Zuhause, Schatz. Du verdienst Menschen, auf die du dich verlassen kannst, und einen Platz, an den du gehörst.« Ich sagte bei solchen Gelegenheiten gar nichts zu Mam. Etwas dazu zu sagen, bedeutete nur, ihr in ihren abwegigen Selbstvorwürfen recht zu geben. Ich hatte niemals Zweifel, daß wir jeden Moment wieder aufbrechen würden. Mam ruhte sich nur aus. Mam lud nur ihre Batterien auf. Bald würde Mam ohne großes Aufhebens wieder sie selber sein.
Da war ich nun also, eingemauert in Pedros muffigem Sanktum, und im Grunde war es mein eigener Fehler. Ich hatte die Zeichen niemals richtig gedeutet; ich hatte es versäumt, jede Biegung und Windung auf unserer zerfetzten Landkarte vorauszusehen. Jedesmal, wenn Mam ihre Selbstzweifel überkamen, hätte ich mit ihr darüber reden sollen. Ich hätte zulassen sollen, daß diese Zweifel Gestalt annahmen und damit zu etwas wurden, das wir bearbeiten und verändern konnten, wie jede Realität. Ich hätte sie an ihre eigenen Worte erinnern sollen. »Zuversicht, das ist der Trick, der Zivilisation erst möglich macht. Die Welt, die wir zu fassen bekommen wollen, greift sich oft uns selbst.« Aber ich hatte es versäumt. Im Grunde glaubte ich, daß die Welt voller eindeutiger und offensichtlicher Wahrheiten sei, so wie jene in der Unabhängigkeitserklärung, und wie alle Menschen, die sehend waren, würden Mam und ich diese Wahrheiten stets teilen, würden wir stets wissen, wo sie zu finden waren. In diesem Glauben hatte ich zugelassen, daß meine Mam davonglitt und sich zusehends in endlosen Dialogen zwischen sich selbst und ihrem Spiegelbild verlor, denn ich glaubte, daß die Festigkeit der Welt sie immer zu mir zurückführen würde. Ich verdiente also nichts anderes, als meine Tage in jener schwachsinnigen Schule zu vergeuden, ziellos um die verrosteten Klettergerüste des Spielplatzes zu streichen, beschäftigt mit meinem ganz persönlichen heulenden Elend. Ich fühlte mich allmählich nicht mehr nur niedergeschlagen, sondern gar nicht mehr real. Die Welt füllte sich immer mehr mit scharfkantigen Dingen, Dingen, die scheppernd gegen mich schlugen und an mir entlangstreiften, Dingen, die mich bedrängten und mir den Platz wegnahmen. Ich selbst verlor währenddessen immer mehr an Substanz.
»Philipp«, pflegte meine Lehrerin zu fragen, »möchtest du gern der nächste sein, der laut vorliest?«
»Glaub schon.«
»Soll ich dir beibringen, wie man eine Eisensäge hält?« Pedro hatte mich an der Schulter gefaßt, und es war ihm ein ehrliches Anliegen, ein Anliegen, durch das irgendwie meine Schulter zu seinem Eigentum zu werden drohte. »Soll ich dir beibringen, wie man Metall lötet?«
»Glaub schon.«
»Willst du mir helfen, das Abendessen zu machen?« fragte Mam. »Oder möchtest du lieber nach draußen gehen und mit deinen Freunden spielen?«
Sie schlossen mich ein in diese unmöglichen Fragen, die im Raume stehenblieben, Fragen, die nicht zu beantworten waren, nur mit Kompromissen.
»Soll ich dir irgendwas aus dem Laden mitbringen?«
»Weißt du eigentlich, was du werden willst, wenn du groß bist?«
»Kannst du uns die Hauptstadt von Delaware nennen? Süd-Dakota? Spanien?«
»Welchen Filmstar magst du am liebsten? Was ist dein Lieblingsbuch, dein Lieblings-Fernsehprogramm?«
Stürme von Fragen. Fragen, die die Luft durchschwirrten wie flatternde Motten, die gegen Dinge schlugen, die einsam in glitzernden gläsernen Lampenschirmen starben, in der Gluthitze und zwischen ihren eigenen abgestoßenen Larven.
Sie konnten mich vielleicht nicht unter ihre Kontrolle bringen, aber sie konnten meine Fähigkeit schwächen, mich selbst unter Kontrolle zu halten. Es mochte meinen Lehrern vielleicht nicht gelingen, mich in einen plappernden Fernsehmonitor zu verwandeln, zufrieden mit Buntpapier und Leim. Vielleicht konnte Pedro mich nicht mit Maßbohrern, Hochgeschwindigkeits-Drehbänken und mit seinen Hämmern indoktrinieren. Vielleicht konnte Mam bei dem Versuch, ihrem eigenen erbärmlichen und naiven Kompromiß mit der Welt Pedros zu entgehen, mich mit Vorhängen und frischer Baumwollunterwäsche und der strahlenden Wärme meines eigenen Fernsehportables einwickeln. Meine geheime innere Bewegung hingegen ließ sich nicht so leicht bezwingen. Das jedenfalls war der Mythos, den ich um mich zu spinnen versuchte wie einen Schutzmantel oder einen Wunschtraum. Zuerst würden sie meinen Atem bezwingen müssen, mein Herz, den Ton meiner Stimme. Manchmal legte Mam sich abends zu mir ins Bett, damit ich einschlafen konnte, und ich blieb dann steif und eisern wach in ihren kühlen Armen. Ich konnte sie nicht mehr atmen hören. Wenn sie sprach, tat ich, als ob ich nicht zuhörte. Wenn ich träumte, tat sie, als merke sie es nicht.
»Wenn du dich dann besser fühlst, Schatz – ich tue all das hier nicht für dich. Ich wäre nicht so herablassend. Und es ist schwer zu erklären, wonach ich selbst hier suche, aber ich glaube, ich habe es gefunden. Pedro ist ein lieber, einfältiger Mann, der mich niemals bedrängt, wenn ich es nicht will. Er verspricht mir Sicherheit, Schatz, und dazu mein ganz eigenes Leben.« Als sie mir die feuchte Stirn streichelte, spürte ich, wie sich das ganze Universum um mich zusammenzog. Mams Lügen waren Bestandteil irgendeines größeren Gespinstes. Größere Betrügereien wurden im Universum angezettelt als Mams leidenschaftsloses Lager mit Pedro. »Aber wenn du irgendwann über etwas reden willst, dann weißt du, daß du es mir sagen kannst, Schatz. Das mag zwar nichts an den Dingen ändern, aber vielleicht fühlst du dich danach besser. Manchmal hilft es, wenn man einfach nur über Dinge redet. Und ein anderes Mal hilft es auch wieder überhaupt nicht.«
Aber natürlich konnte ich kein Wort hervorbringen. Das hätte mich nur an die hirnlosen, verstiegenen Gemeinplätze von Mams abwegiger Illusion verraten. Ich konnte nur, was leicht zu durchschauen war, den Schläfrigen mimen und so tun, als ob auch ich mich in Pedros dubiosem Heim warm und sicher fühlte. Ich glaube, das war es, wofür ich Mam am meisten haßte, für meine eigene furchtsame und widerwillige Heuchelei. Ich fühlte mich wie ein Einbrecher oder Ganove, der vor der Welt davonlaufen mußte, statt, wie Mam und ich es einst getan hatten, mit Macht in ihr immer weitläufiger werdendes, elliptisches Herz einzudringen. Die einzige Freiheit, die sie mir zugestanden, war die Freiheit, mich zu verstellen und mich zu widersetzen, jenen raschen, fundamentalen Rhythmus meiner selbst vor jener falschen, rhythmuslosen Welt zu verbergen.
In mich hineingelangen konnten sie also nicht, wohl aber meine Welt so verwandeln und durcheinanderbringen, daß ich womöglich tatsächlich vergaß, wie ich in mich selbst zurückkommen konnte. Es war wie Wittgensteins Allegorie mit den Streichholzschachteln. Obwohl ich jenes besondere und nie gebrochene Geheimnis um mich selbst kannte und vor der leeren Routine der Welt bewahrte, konnte dieses Geheimnis weder atmen, noch sich rühren, wenn es sich erst einmal in seiner unveränderlichen Heimeligkeit bequem gemacht hatte. Es wurde ein Kunstwerk, wie etwas, das in der abgestandenen Luft und den Glaskästen eines heruntergekommenen Museums begraben war, eines voller entfremdeter und verstockter Wächter in blauen Anzügen und mit offiziell aussehenden Kappen, die nicht ganz paßten. Nun war ich nicht mehr Mams Baby. Ich glitt nicht mehr auf Mams unablässiger Bewegung dahin. Ich war einfach nur ein Schulkind wie alle anderen. Ich war nichts als ein Kind, das darauf wartete, daß seine »prägenden Jahre« begannen, in warme Decken gewickelt und mit geschmacklosen, nahrhaften Mahlzeiten aus Wonderbread, Erdnußbutter und Traubengelee gefüttert. Ich war nichts als eine Streichholzschachtel. Ich war einfach nur eine kleine Streichholzschachtel, in der man irgend etwas hin- und herrasseln hören konnte. Einen Penny vielleicht. Oder einen grünen Plastiksoldaten. Stücke von einem abgebrochenen Bleistift oder einen Kieselstein oder einen rostigen Nagel oder ein krabbelndes Insekt. Vielleicht war es auch einfach nur gar nichts. Es war vielleicht überhaupt nichts drin, was zu haben sich lohnte.
Von nun an waren meine Ernährung, meine Erziehung und meine Zerstreuung aufs genaueste reglementiert und überwacht. Ich hatte mir gute Filme anzusehen, gute Bücher zu lesen, nahrhafte Mahlzeiten zu mir zu nehmen, zu festen Zeiten Stuhlgang zu haben und zu schlafen. Jede zweite Woche ging ich zum Friseur. Ich wurde gegen Kinderlähmung geimpft, gegen Tetanus, Pocken und Diphtherie. Ich ließ einen Besuch beim Zahnarzt über mich ergehen, wo eine sadistische Reinlichkeitsfanatikerin mit scharfen, stählernen Instrumenten den Belag von meinen Zähnen schabte. »Du kannst von Glück sagen, daß du keine Löcher hast«, erklärte sie mir, und ich dachte nur: Da, ich hab’s ja gleich gesagt. Ich hätte überhaupt nicht zu kommen brauchen, und dabei spuckte ich Blut in das blau sprudelnde Wasser des weißen Beckens. Ich bekam stapelweise neue Kleider, obwohl die Schubladen in meinem Zimmer schon vor frischgewaschenen und -gebügelten Hemden und Hosen überquollen. Mein alter Freund Levi’s und die Sweatshirts verschwanden, und mein Schrank war statt dessen voll von Spielzeugen in Schachteln, bunten Büchern und Sportausrüstungen, blinkenden elektronischen Spielen und Videokassetten mit Lehrfilmen. »Wißt ihr, ich habe mir da etwas überlegt«, sagte Pedro eines Tages, als er seine Zeitung zusammenfaltete und in den Schoß legte, mit einer energischen Handbewegung nahm er seine glitzernde Zweistärkenbrille ab. Er blickte ausdruckslos zu dem Regal mit orientalischem Krimskrams hin, das er an jenem Abend gebastelt hatte. »Wißt ihr, was Philipp braucht? Philipp braucht einen Hund. Ein hübsches kleines Hündchen, das er hochpäppeln und für das er sorgen kann. Da kann er ein wenig Verantwortung lernen. Und immer wenn er sich einsam und unglücklich fühlt, wird er einen guten Freund haben. Wenn er ihn ordentlich bürstet und pflegt, darf er sogar am Fußende seines Bettes schlafen. Ich weiß gar nicht, warum wir darauf nicht vorher gekommen sind«, schloß Pedro salbungsvoll. »Ein Hund.«
Und dann blieb mir, wie ich wortlos leidend mit meinen Schulbüchern auf dem Teppich kauerte und entgeistert auf den kalt flackernden Fernseher starrte, nichts anderes, als zuzuhören, wie Mam ihm mit einer Begeisterung zustimmte, die mir den Magen umdrehte. Ich spürte ein Herumwühlen und Tritte in meinen Eingeweiden. Das Blut schoß mir in den Kopf, und mir war schwindelig und ein wenig übel, als ob ich plötzlich mit einem Raumschiff in die Höhe schösse. »Dienstag gehen wir zum Tierheim«, sagte Mam. »Nein, Mittwoch, am Dienstag arbeite ich. Wir besorgen uns eine Lizenz. Und Pedro, Liebling, du kannst ihm eine kleine Hundehütte im Garten bauen. Aus alten Lumpen und dergleichen machen wir eine Matratze. Und wenn er stubenrein ist, dann reden wir darüber, ob er am Fußende von Philipps Bett schlafen darf. Wir können Bücher über Hundeaufzucht kaufen, über Hundepflege und Gesundheitsvorsorge, über hündische Hunde und den Hund im Hunde. Blödsinnige kleine Welpen, die man im Arm hält wie ein Päckchen. Sie haben immer große Schlappohren, große melancholische Augen. Immer lieben sie einen, ganz gleich, was man macht. Ganz gleich, was du selber von dir hältst, ein Hund glaubt immer, du bist der Größte. Ganz gleich, wie böse und verlogen die Welt ist, Hunde sind es nie. Hunde lieben dich sogar, wenn du sie trittst, selbst wenn du ihnen nichts zu fressen gibst. Hunde lieben dich noch, wenn du schon die Hände um ihren Hals legst. Hunde lieben lieben lieben dich, wenn sie schon nicht mehr atmen können, wenn ihre melancholischen Augen immer blutunterlaufener werden und wirr vor Furcht, wenn das letzte, galvanische kleine Zucken kommt und wenn sie zu atmen aufhören. Wenn sie steif werden. Wenn ihre Augen glasig werden und spiegeln. Wenn du sie im Garten begräbst und ein winziges Holzkreuz auf ihr Grab setzt und betest, daß Gott ihnen all ihre Sünden vergeben möge.«
4
Mit meinem ganzen verderbten und vereinsamten Herzen betete ich darum, daß Mam mich skrupellos und ohne weitere Umschweife ermorden möge, so wie ich gewiß jedes nur vorstellbare Hündchen ermorden würde, falls sie versuchen sollten, es mir aufzubürden und aufzunötigen. Bring mich um, damit es vorbei ist, betete ich jede Nacht fiebernd in meinem Bett. Bring mich um mit deinen eigenen Händen, damit ich weiß, daß du es bist. Genau wie das Hündchen werde ich dich noch immer lieben; ich werde niemals aufhören, dich zu lieben. Wie das Hündchen werde ich dir immer und für alle Zeiten vertrauen, bis zur letzten Sekunde.
Ich fühlte mich von Tag zu Tag schwächer, lustloser, abwesender, blasser. Mam schien das allerdings überhaupt nicht aufzufallen. Immer verletzlicher und verschüchterter werdend, kleiner und kleiner, trieb ich immer weiter fort von ihr, wie ein aus der Bahn geratener Planet. »Die Zivilisation hat durchaus ihren Sinn«, sagte Mam und saß dabei am Rand meines Bettes, ihre kühle Hand in meinem Schoß, und blickte abwesend zum Fenster hinaus in den roten, apokalyptischen Sonnenuntergang, in Gedanken über die Raffinesse ihrer eigenen Subversion versunken. »Zivilisation ist nichts, wovon wir uns bedroht fühlen müßten. Es gibt nichts außer uns selbst, was wir von der Zivilisation zu befürchten haben.« Manchmal, wenn ich sie anstarrte, schien ihre Stimme schwächer und diffuser zu werden. Ich begriff allmählich, daß Mam nicht den Lügen der Welt erlegen war, sondern eher den plötzlichen Schwankungen und Windungen ihres eigenen abwegigen Verstandes. »Zivilisation ist einfach ein Schema von Regeln und Verhaltensweisen, auf die wir uns alle freiwillig geeinigt haben. Das ist etwas anderes als ein Haufen Klischees, Schatz. Wir unterwerfen uns nicht. Wir lassen uns nicht unterdrücken oder gefangennehmen oder in Ketten legen. Die Zivilisation will immer unser Bestes. Zivilisation, das sind einfach die Mauern eines Hauses. Es ist das Haus, von dem ich dir immer erzählt habe, daß wir darin leben, nur vorher hatte ich nicht begriffen, daß dieses Haus die Zivilisation war.« Mam trug einen etwas zerlumpten und zergangenen weißen Morgenrock, der Pedros verstorbener Frau Marjoree gehört hatte. Mam wurde allmählich etwas dicker; ihr schönes Gesicht war bleicher und teigiger geworden. Ihre Handflächen fühlten sich kalt und trocken an. »Freiheit, das ist ein Ort in deinem eigenen Kopf«, sagte sie. Und nun lebten wir in verschiedenen Galaxien, Mam und ich, und umrundeten ferne bewohnte Planeten und Sonnen. »Zivilisation ist nur eine Reihe von Regeln, die das Leben angenehm machen. Das gibt uns Zeit für die Freiheit, die wir nur in unserem Inneren genießen können.«