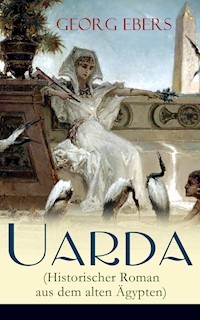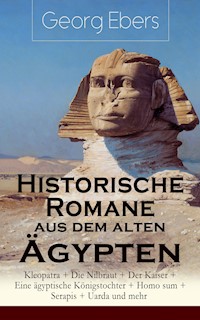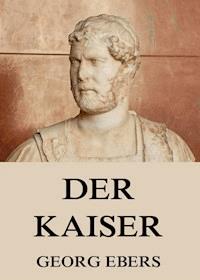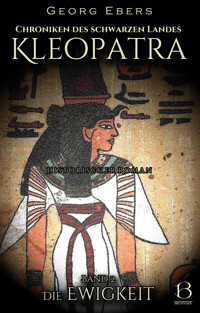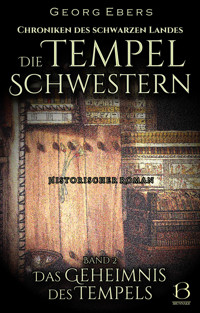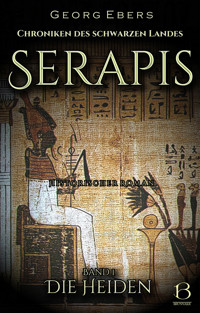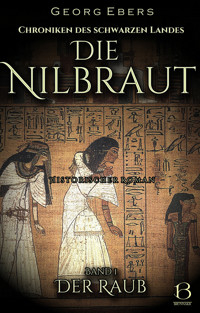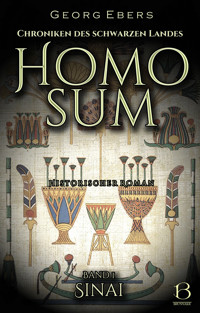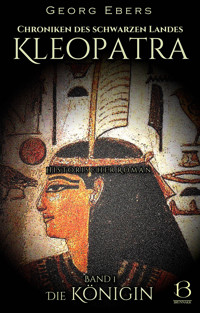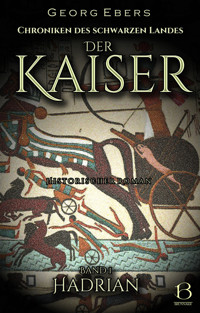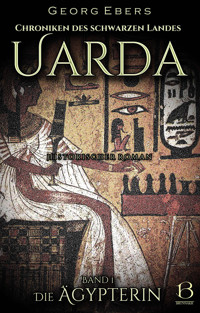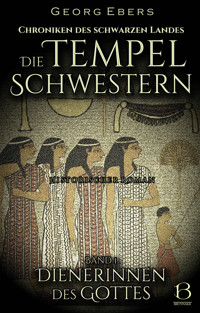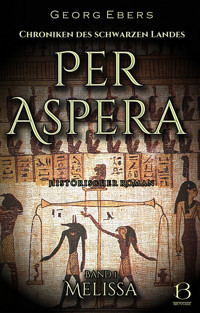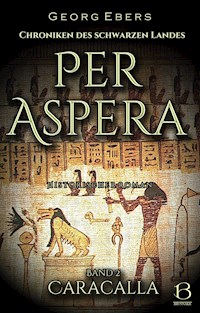Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dies ist der erste Teil der (nie vollendeten) Autobiografie des berühmten Ägyptologen und Schriftstellers, in der er seine Kindheits- und Jugendjahre beschreibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschichte meines Lebens
Vom Kind bis zum Manne
Georg Ebers
Inhalt:
Georg Moritz Ebers – Biografie und Bibliografie
Die Geschichte meines Lebens
An meine Söhne.
Die Kinderjahre bis zur Revolution 1848.
Rückblicke.
Die früheste Kindheit.
Märchen und Wahrheit.
Die Erzieherin. – Der Friedhof.
An den Festen.
Was wir der Mutter sonst noch verdankten, und was während meiner Lebenszeit den Deutschen Neues und Großes zukam.
Die Reise nach Holland zur goldenen Hochzeit.
Die Lennéstraße. – Lenné. – Frühe Eindrücke.
Die erste Lernzeit. – Die Schwestern und ihre Freundinnen.
Erste Begegnung mit der Kunst und große und kleine Bekannte aus der Lennéstraße.
Was dem Berliner Kinde sonst Schönes an der Spree und bei der Großmutter in Dresden zu teil wurde.
Die Revolutionszeit.
Vor der Revolution.
Der 18. März.
Nach der Revolutionsnacht.
In Keilhau.
In die Anstalt.
Eintritt in die Anstalt.
Friedrich Fröbels Erziehungsideale.
Aeußere Lebensformen und Fröbels Kindergarten.
Die Begründer der Heilhauer Anstalt und ein Blick auf die Geschichte des Instituts.
Im Wald und auf der Heide.
Sommerfreuden und Wanderlust.
Herbst, Winter, Ostern und Abgang.
Gymnasium und die erste Universitätszeit.
Von Keilhau auf das Gymnasium zu Kottbus.
Die Gärungszeit und die Mitschüler.
Der neue Direktor und das Artusgedicht.
Der Oberprimaner.
Eine Novelle, die sich wirklich begeben.
Quedlinburg
Auf dem Quedlinburg Gymnasium
Als Jurist in Göttingen
Auf die Universität.
Göttinger Versuche und Fahrten.
Der Schiffbruch.
Die schwerste Zeit in der Schule des Lebens.
Die Lehrzeit.
Die Sommer in der Zeit der Genesung.
Fortschreitende Genesung und der erste Roman.
Atys und Adrast.1
Die Geschichte meines Lebens , G. Ebers
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849611125
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Georg Moritz Ebers – Biografie und Bibliografie
Namhafter Ägyptologe und Romanschriftsteller, geb. 1. März 1837 in Berlin, gest. 7. Aug. 1898 in Tutzing am Starnberger See, studierte in Göttingen 1856 die Rechte, später in Berlin unter Anleitung von Brugsch, Lepsius und Böckh ägyptische Altertumskunde und habilitierte sich für diese 1865 in Jena. Von hier aus unternahm er eine über ein Jahr dauernde Reise nach Ägypten und Nubien (1869–70) und folgte bei seiner Rückreise einem Ruf nach Leipzig. Auf einer zweiten Reise nach Ägypten (1872) erwarb er den jetzt auf der Universitätsbibliothek zu Leipzig befindlichen sogen. Papyrus Ebers (vgl. »Papyrus Ebers, das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter, herausgegeben von G. E., mit hieroglyphisch-lateinischem Glossar von L. Stern«, Leipz. 1875; deutsch von Joachim, Berl. 1890; »Papyrus Ebers. Die Maße und das Kapitel über die Augenkrankheiten«, das. 1889, 2 Bde.). Durch ein langwieriges körperliches Leiden wurde E. 1889 zur Aufgabe seines Lehrberufs gezwungen und lebte seitdem teils in München, teils in Tutzing. Als Romanschriftsteller begründete E. seinen Ruf durch den historischen, mit gelehrten Anmerkungen versehenen Roman »Eine ägyptische Königstochter« (Stuttg. 1864, 13. Aufl. 1889), eine anziehende Darstellung des ägyptischen Volkslebens zur Zeit des persischen Eroberungskriegs (ins Holländische, Englische und in viele andre Sprachen übertragen). Weiterhin veröffentlichte E. die vielgelesenen und ebenfalls in viele Sprachen übersetzten, im alten Ägypten spielenden Romane: »Uarda« (Stuttg. 1877, 3 Bde.), »Homo sum« (1878), »Die Schwestern« (1879), »Der Kaiser« (1880, 2 Bde.), »Serapis« (1885, 2 Bde.), »Die Nilbraut« (1886, 3 Bde.), »Josua« (1889), »Per aspera« (1892), »Kleopatra« (1894), »Arachne« (1897), und die in Versen geschriebene Erzählung »Elisen« (1888), sämtlich in Stuttgart erschienen. Ein andrer Teil seiner Romane: »Die Frau Bürgemeisterin« (Stuttg. 1881), »Ein Wort« (das. 1882), »Die Gred« (das. 1889, 2 Bde.), »Im Schmiedefeuer« (1894), »Im blauen Hecht« (1895), »Barbara Blomberg« (1896), spielt im 16. Jahrh., teils in den Niederlanden, teils in Süddeutschland, während uns das Idyll »Eine Frage« (Stuttg. 1881) in das griechische Altertum versetzt. Rein wissenschaftlich sind seine »Disquisitiones de dynastia vicesima sexta regum aegyptiorum« (Berl. 1865) und »Ägypten und die Bücher Mosis« (Leipz. 1868), »Sinnbildliches. Die koptische Kunst« (das. 1892), »Antike Porträts. Die hellenistischen Bildnisse aus dem Fajjûm untersucht und gewürdigt« (das. 1893) sowie eine Anzahl kleinerer Abhandlungen; populär und gelehrt zugleich seine Schrift »Durch Gosen zum Sinai; aus dem Wanderbuch und der Bibliothek« (das. 1872, 2. Aufl. 1881). Außerdem schrieb er noch: »Drei Märchen« (Stuttg. 1891), »Richard Lepsius, ein Lebensbild« (Leipz. 1885), »Die Geschichte meines Lebens. Vom Kind bis zum Manne« (Stuttg. 1893) und das beschreibende Prachtwerk »Ägypten in Wort und Bild« (2. Aufl., das. 1880, 2 Bde.), dessen textlichen Teil er als »Cicerone durch das alte und neue Ägypten« (das. 1886, 2 Bde.) besonders veröffentlichte; mit H. Guthe gab er heraus: »Palästina in Bild u. Wort« (das. 1886–87, 2 Bde.). Nach seinem Tod erschienen: »Das Wanderbuch. Dramatische Erzählung aus dem Nachlaß und gesammelte kleine Schriften« (2. Aufl., Stuttg. 1899), und »Ägyptische Studien und Verwandtes« (das. 1900). Seine »Gesammelten Werke« umfassen 32 Bände (Stuttg. 1893–97). Vgl. Gosche, G. E., der Forscher und Dichter (2. Aufl., Leipz. 1887).
Die Geschichte meines Lebens
Meinen drei Söhnen gewidmet.
An meine Söhne.
Als ich begann, was aus vergangner Zeit
Die Seele festgehalten, aufzuschreiben,
Da sagt' ich mir: Du wandertest schon weit;
Bald wird den Deinen nur dein Bildnis bleiben.
Und eh' auch dir die letzte Stunde schlägt,
Lies aus die Ernte des vergang'nen Lebens.
Ist nur ein Korn dabei, das Früchte trägt
Für deine Söhne, thust du's nicht vergebens.
Blick auf des eignen Lebens Bahn zurück,
Und wie du dich zum Licht emporgerungen; –
Dein Irrweg, denk' ich, er gedeiht zum Glück,
Warnt er sie zeitig, deine lieben Jungen.
Und wenn den Stern sie schaun, der deine Bahn
Zum Ziel gelenkt und hell mit Licht beschienen,
So steuern sie dir nach des Lebens Kahn;
Und seine Strahlen leuchten dann auch ihnen.
Ja, wenn der Epheu rings mein Grab umflicht,
Glitt mir das Steuer längst schon aus den Händen,
So weist dies Buch sie auf das Doppellicht,
Zu dem ich nie verlernt den Blick zu wenden.
Nach oben zieht das eine mild und hell
Den feuchten Blick, wenn sich die Welt umnachtet,
Und zeigt euch Kindern auch den Wüstenquell,
Wenn ihr verzagend nach Erfrischung schmachtet.
Seit eure Lippe zum Gebet sich regt,
Habt seine Huld ihr tausendfach erfahren.
Auch ich genoß sie; was mir auferlegt,
Euch mag es, fleh' ich heiß, davor bewahren.
Das andre Licht, – ihr kenntet seine Macht,
Auch wenn kein Wort es nennte und beschriebe;
Denn euch wie mir erhellte ja die Nacht,
Verklärte Tag für Tag die Mutterliebe.
Dies Licht, es reiste auch in eurer Brust
Des Guten und des Schönen volle Saaten;
Ich aber hegte sie mit stiller Luft
Und treuem Mühn und sah sie wohl geraten.
So wuchset ihr in wacher Hut heran,
So klimmet aufwärts ihr von Stuf' zu Stufe;
Die edle Heilkunst zog den Aeltsten an,
Der Zweite folgt des deutschen Heerbanns Rufe,
Der Dritte bildet noch den jungen Geist, –
Und nun mich's drängt, euch dieses Buch zu weihen,
Seh' ich, was mein Herzlängst sein Höchstes heißt,
Vereint, verkörpert in euch lieben Dreien.
Wie ich ihm huld'ge, wie's mir heilig ist,
So gebt auch ihr die Ehre allerwegen
Der Menschenliebe, die sich selbst vergißt,
Dem Vaterlande und der Arbeit Segen.
Tußing am Starnberger See, 1. Oktober 1892.
Georg Ebers.
Die Kinderjahre bis zur Revolution 1848.
Rückblicke.
In Berlin bin ich geboren und doch auf dem Lande. Es ist freilich neunundfünfzig Jahre her; denn es geschah am 1. März 1837, und damals gehörte zu dem Anwesen,1 auf dem ich die ersten Kindheitsjahre verschlief und verspielte, außer Feld und Wiese, Obstgarten und dichtem Buschwerk auch ein kleiner Berg und Teich. Im Pferdestalle standen die drei großen Rappen der Wirtin an der Krippe, und das Gebrüll einer Kuh, das den Berliner Kindern sonst lange fremd bleibt, mischte sich in meine frühesten Erinnerungen.
Die Tiergartenstraße, auf der sich schon damals an sonnigen Mittagen eine Menge von Spaziergängern zu Fuß, im Wagen und hoch zu Roß auf und nieder bewegte, begrenzte dies umfangreiche Grundstück an der Vorderseite; nach hinten aber fand es den Abschluß durch ein Wasser, das damals »der Schafgraben« hieß und trotz des Entenlaiches, der es mit dunkelgrünen Pflanzengeweben bedeckte, zu Gondelfahrten auf leichten Booten benützt wurde.
Heute faßt ein sorgfältig gefügtes Gemäuer die Ufer dieses Grabens ein; er selbst aber verwandelte sich in den wasserreichen Kanal, an dem sich die stattliche Häuserreihe der Königin Augustastraße hinzieht, und den zahlreiche schwerbeladene Lastschiffe – »Zillen« nennt sie der Berliner – befahren.
Auf dem Grundstücke, das der Schauplatz meiner Kindheit war, steht schon lange die Matthäikirche, die hübsche Straße, die ihren Namen trägt, und ein Teil der Königin Augustastraße. Trotzdem umgibt das Haus, das wir bewohnten, und seinen größeren Nachbar immer noch ein schöner Garten.
Das war ein Eden für heranwachsende Stadtkinder, und die Mutter hatte es gewählt, weil sie darin ihren Kleinen die Paradiesesströme der Gesundheit und freien Bewegung entgegenfließen sah.
Am 14. Februar 1837 war mein Vater gestorben, und am 1. März des nämlichen Jahres kam ich, vierzehn Tage nach dem Tode des Mannes zur Welt, in dem der Mutter zugleich mit dem Gatten auch der Geliebte entrissen worden war. So bin ich denn, was man einen »Posthumus« oder Nachgeborenen nennt. Das ist sicherlich traurig; aber gab es auch, besonders in späteren Jahren, manche Stunde, in der mich nach dem Vater verlangte, so wollte es mir doch oft schön und dankenswert erscheinen, vom ersten Augenblicke an mit einer der freundlichsten Aufgaben, der des Tröstens und Thränentrocknens, betraut gewesen zu sein.
Einer Mutter Herzeleide war es ja, der ich in der schwersten Zeit des Lebens geschenkt worden war, und trotz meines grauen Haares hab' ich der glückseligen Augenblicke nicht vergessen, in denen die teure Frau den vaterlosen kleinen Nachgeborenen herzte und ihn unter anderen Schmeichelnamen ihr »Trostkind« nannte.
Sie sagte mir auch, daß Nachgeborene Glückskinder wären, und suchte mich früh in ihrer liebreich sinnigen Weise mit dem Gedanken zu befreunden, daß der liebe Gott sich der Kinder ganz besonders annehme, denen er schon vor der Geburt den Vater genommen. Diese Zuversicht begleitete mich dann auch freundlich durch das fernere Leben.
Es ist mir, wie gesagt, erst spät bewußt geworden, daß mir etwas, und noch dazu etwas so Großes mangelte wie die treue Liebe und Sorge eines Vaters, und als das Leben auch mir ein ernstes Gesicht zeigte und Schweres zu überwinden aufgab, stärkte mir die frohe Zuversicht, ein Glückskind zu sein, so kräftig den Mut wie anderen Größeren der zuversichtliche Glaube an ihren »Stern«.
Als endlich die Zeit kam, in der es mich drängte, dem, was mir die Seele bewegte, in Versen Ausdruck zu geben, da faßte ich die mütterliche Verheißung in dem Sprüchlein zusammen:
»Wer nach des Vaters Tod geboren,
Der ist zum Glinkskind auserkoren;
Der Herrgott selbst im Himmel helle
Vertritt bei ihm die Vaterstelle.«
Man sagte mir oft, ich sei als der Jüngste, als das Nesthäkchen, »der Verzug« der Mutter gewesen; doch wenn etwas mich verdorben hat, das war es gewiß nicht! Zu viel Liebe ist ja noch keinem Kinde von seiten einer verständigen Mutter zu teil geworden, und, gottlob, das war die meine! Das Schicksal hatte sie berufen, mir und meinen vier Geschwistern – ein Brüderchen, ihr zweites Kind, war als Säugling gestorben – Vater und Mutter zugleich zu sein, und sie zeigte sich dieser Aufgabe gewachsen. Was etwa Gutes an uns war und ist, das danken wir ihr, und ihr Einfluß auf uns alle und besonders auf mich, dem es auch später vergönnt sein sollte, am längsten in enger Vereinigung mit ihr zu leben, war ein so großer und entscheidender, daß Fernerstehende diese Erzählungen aus meiner Jugendzeit nur halb verstehen würden, wenn ich nicht länger bei ihr verweilte.
Für die Kinder, die Geschwister und die meinem Hause nahestehenden Lieben sind diese Aufzeichnungen zunächst bestimmt, doch sehe ich keinen Grund, sie nicht auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen. An Mahnungen der Freunde, sie niederzuschreiben, fehlte es nicht, und viele von denen, die mir willig zuhören, wenn ich Geschichten erzähle, werden wohl auch gern etwas Näheres über den Lebenslauf des Fabulanten erfahren, der freilich bei diesen Aufzeichnungen der Einbildungskraft Schweigen aufzuerlegen und sich streng an den Wahlspruch seiner späteren Jahre, »wahrhaftig sein in Liebe«, zu halten gedenkt.
Das »Wahrsein« soll sich vorzüglich auf alles beziehen, was das eigene Dasein des Erzählers betrifft, das »in Liebe« den Menschen zu gute kommen, mit denen ihn die weniger an seltsamen Schicksalen als an Erfahrungen, Eindrücken und Begegnungen reiche Bahn seines Lebens zusammenführte.
Das Bildnis der Mutter als junge Frau begleitet diese Blätter und soll mich der Aufgabe entheben, ihr Aussehen zu schildern. Es wurde dem lebensgroßen Schadowschen Porträt nachgebildet, das dieser kurz vor seiner Berufung zum Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie für den jungen Gatten vollendete, und das sich jetzt im Besitz meines ältesten Bruders, Dr. Martin Ebers in Berlin, befindet. Es fehlen unserer Nachbildung leider die Farben, und die Gewandung auf dem Original, das die ganze Figur zeigt, bestätigt die Erfahrung, wie mißlich es ist, auf einem auch für spätere Geschlechter bestimmten Bildnisse die Mode des Tages treu wiederzugeben. Es hat mich nie völlig befriedigt; denn es gibt das, was uns an der Mutter besonders wert war und ihr einen so großen Zauber verlieh, nur ganz ungenügend wieder: die weibliche Anmut und die Seelenwärme, die ihr so freundlich und herzgewinnend aus den milden blauen Augen schaute.
Jeder mußte sie schön nennen; für mich aber war sie die schönste und zugleich die beste der Frauen, und wenn ich den kranken Stephanus in meinem »Homo sum« sagen lasse: »Für jedes Kind ist seine Mutter die beste Mutter,« so war es für mich sicherlich die meine. Es hob mir auch das Herz, wenn ich sah, wie alle Welt diese Wertschätzung teilte. Bei meiner Geburt zählte sie fünfunddreißig Jahre und stand, wie ich von manchen älteren Bekannten hörte, in der Blüte der Schönheit.
Mein Vater hatte zu den Berliner Herren gehört, deren Opferfreudigkeit und Kunstsinn das Königsstädter Theater seine Blüte verdankte, und so war er mit Karl v. Holtei, der für diese Bühne teils als dramatischer Schriftsteller, teils als Schauspieler wirkte, in nahe freundschaftliche Beziehungen getreten. Wie ich dann als junger Gelehrter dem greisen Dichter im Namen der Mutter etwas mitgeteilt hatte, das ihm Vergnügen bereiten mußte, fand ich in seiner Antwort auf meine Frage, ob er, Holtei, sich der Mutter noch erinnere, eine lebhafte Bejahung.
»Wie dankbar bin ich Ihrer vortrefflichen Mutter,« heißt es in diesem Briefe,2 »Sie zum Schreiben angeregt zu haben. Nur der Eingang Ihrer Zeilen, als könnte ich vergessen haben, den muß ich mit Protest von mir weisen. Ich die schöne, milde, kluge, charakterfeste Frau vergessen, die (um Shakespeares Worte zu gebrauchen) damals ankam in Pomp, geschmückt wie der holde Mai und gleich bei ihrem Eintritt ins neue Leben von den härtesten Schlägen getroffen, jede Prüfung des Schicksals glorreich bestand, um aus der lieblichsten Braut die edelste Gattin, die sorgsamste Mutter, die bewunderungswürdigste Witwe und treueste Mutter zu werden? Nein, mein junger unbekannter Freund, ich habe mir viel zu Schulden kommen lassen, habe aus den Kämpfen eines zerrissenen Daseins ein halb zerrissenes Herz gebracht, aber so weit ist es doch nicht mit mir gediehen, daß ich Fanny Ebers aufgehört hätte in diesem Herzen zu tragen, neben den frömmsten und heiligsten Erinnerungen meiner wirren Laufbahn. Wie oft erscheint ihr liebes Bild vor mir, wenn ich in einsamer Dämmerstunde die Vergangenheit an mir vorüberziehen lasse.«
Ja, das Schicksal hatte der Mutter früh Gelegenheit geboten, sich zu bewähren! Die Stadt, wo sie so kurz vor meiner Geburt Witwe wurde, war nicht ihre Heimat. Der Vater hatte sie als Jüngling, dem kaum der Bart keimte, in Holland gefunden. Den Brief, in dem er den Seinen erklärte, daß er entschlossen sei, nicht von der Erwählten seines Herzens zu lassen, meinte man in Berlin nicht ernst nehmen zu sollen; als aber der Liebende mit seltener Festigkeit auf seinem Entschluß beharrte, wurde man besorgt. Der neunzehnjährige älteste Sohn eines der begütertsten Häuser der Stadt wollte sich für das Leben binden und noch dazu mit einer Ausländerin, die man nicht kannte.
Die Mutter erzählte uns oft, daß auch ihr Vater sich geweigert habe, den überjungen Freier sogleich zu erhören, und wie in jener Zeit der Kämpfe, während sie sich mit den Ihren in Scheveningen befand, dort eines Tages ein vierspänniger Reisewagen vor dem einfachen Strandhause ihrer Eltern gehalten habe. Auf dem Dienersitz hatte ein Kurier und eine Zofe gesessen, die einen Käfig mit dem Papagei Koko, dessen Bekanntschaft zu machen mir noch vergönnt war, auf dem Schoße hielt. Endlich war der Kutsche die künftige Schwiegermutter entstiegen. Sie war gekommen, um das Wunder zu sehen, von dem der Sohn so begeistert geschrieben hatte, und sich zu überzeugen, ob es möglich sei, dem Drängen des Knaben nachzugeben, einen eigenen Hausstand zu begründen. Und sie fand es möglich; denn die seltene Schönheit und Anmut des Mädchens gewannen schnell das Herz der besorgten Frau, die eigentlich gekommen war, um die Liebenden zu trennen. Freilich wurde ihnen auferlegt, sich noch mehrere Jahre zu gedulden, um die Festigkeit ihres Liebesbundes zu prüfen. Doch sie hielten stand, und der junge Verlobte, der nach Bordeaux geschickt worden war, um in einem dortigen Handelshause sich die Fähigkeit zu erwerben, das väterliche Bankiergeschäft zu übernehmen, ließ sich keinen Augenblick irre machen, als seine schöne Braut an den Blattern erkrankte und ihm schrieb, daß ihr glattes Gesicht wahrscheinlich von der tückischen Krankheit entstellt werden würde, sondern antwortete, was er an ihr liebe, sei nicht nur ihre Schönheit, sondern weit mehr noch die Reinheit und Güte ihres warmen Herzens.
Das war ein schweres Probestück gewesen, und es sollte belohnt werden; denn auch nicht die kleinste Narbe gab später von der überstanden Krankheit Kunde.
Als der Vater endlich die Mutter zu der Seinen gemacht hatte, sagte ihm der Bürgermeister ihrer Heimatstadt, er übergebe ihm die Perle von Rotterdam. Kurierpferde führten das junge Paar beim schönsten Wetter im offenen Wagen der fernen preußischen Hauptstadt entgegen. Es muß eine wonnige Fahrt gewesen sein; doch als die Pferde in Potsdam gewechselt wurden, empfingen die Neuvermählten die Nachricht, daß der Vater des Gatten gestorben.
So nahm denn ein Trauerhaus die Eltern auf. – Die Mutter war damals des Deutschen nur so weit mächtig, wie sie es dem Bräutigam zu liebe in fleißig benützten Lehrstunden erlernt hatte. Zudem besaß sie in Berlin keinen einzigen Freund oder Verwandten ihres väterlichen Hauses. Dennoch wurde sie bald daselbst heimisch. Sie liebte den Vater, der Himmel schenkte ihr Kinder, und ihre seltene Schönheit, die Anmut und Empfänglichkeit ihres Geistes öffneten ihr schnell alle Herzen weit über den reichen Verwandtenkreis des Gatten hinaus.
Es gehörte zu ihm manches Haus, in dem alles verkehrte, was in dem damaligen Berlin durch wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen oder durch großen Besitz Anspruch auf Bedeutung hatte, und die »schöne Holländerin«, wie die Mutter damals genannt wurde, war eine der am lebhaftesten gefeierten Frauen.
In dieser Zeit hatte Holtei sie kennen gelernt, und es war eine Freude, sie von jenen buntbewegten Tagen erzählen zu hören. Wie oft hatte A. v. Humboldt, hatte Rauch oder Schleiermacher sie zu Tische geführt. Hegel hatte sich ein angeschwärztes Geldstück aufgehoben, das er ihr beim Whist abgewonnen. Wenn er sich von neuem mit ihr zum Kartenspiel setzte, zog er es gern hervor und sagte, indem er es der Partnerin zeigte: »Mein Thaler, schöne Frau.«
Doch dergleichen Begegnungen hörten auch später nicht auf, und während der ganzen Knabenzeit lauschten wir aufmerksam, wenn die Mutter uns von den berühmten Männern erzählte, denen sie in der Gesellschaft begegnet war.
Der Festzeit an der Seite des Vaters hatte die Mutter, gefeiert, bewundert, als gastfreie Wirtin gebend, bei den Freunden empfangend, sich daseinsfroh gefreut, und sie dachte gern an sie.
Kurze Zeit vor meinem Eintritt in die Welt war indes dies glänzende, an Genüssen jeder Art überreiche Leben unterbrochen worden.
Der geliebte Gatte hatte die Augen geschlossen, und der große Reichtum unseres Hauses sich beträchtlich gemindert.
Wohl war nach der Auflösung des großväterlichen und väterlichen Bankiergeschäftes und der vom Vater angelegten Parzellansabrik, deren künstlerische Bestrebungen große Summen verschlungen haben müssen, genug übrig geblieben, um der Mutter zu gestatten, sorglos und bequem weiter zu leben und ihren Kindern die beste Erziehung zu geben; wohl konnte für jeden von uns fünf Unmündigen auf dem Vormundschaftsgericht ein Vermögen niedergelegt werden, das den Knaben ermöglichte, was es auch sei, zu beginnen, und den Mädchen in Aussicht stellte, auch wenn sie unverheiratet blieben, in aller Unabhängigkeit den Lebensgang zu vollenden; wohl hatten wir noch – leider nicht mehr in Berlin, sondern in Dresden – eine begüterte Großmutter; mit dem übergroßen Reichtum der früheren Jahre war es indessen vorbei.
Einen Glückswechsel nennt das Volk solche Aenderung der äußeren Lage, und das Wort ist bezeichnend; denn das Leben gewinnt durch sie eine neue Gestalt. Doch die wahre Glückseligkeit wird durch sie weit häufiger gesteigert als vermindert, wenn sie nur nicht die Sorge um das tägliche Brot in sich schließt. Davon war die äußere Lage meiner Mutter allerdings recht weit entfernt; doch besaß sie Eigenschaften, die sie sicher befähigt hätten, auch in bescheideneren Verhältnissen den Frohmut zu bewahren und sich mit ihren Kindern tapfer durchs Leben zu kämpfen. Das blieb ihr erspart, aber sie hat mir und den Geschwistern bei mehr als einer Gelegenheit bekannt, daß sie bald zur Einsicht gelangt sei, die Verringerung des frühreren großen Ueberflusses würde für unser wahres Wohlergehen eher fördersam als hinderlich sein.
Gleich ihren Brüdern, die fast alle tüchtige Beamte, meist im holländischen Kolonialdienste, geworden waren, stellte die Witwe sich vor, sollten auch ihre Söhne durch eigenen Fleiß vorwärts kommen. Dazu brachten die neuen Verhältnisse die Witwe den Menschen näher, an die sie sich durch Neigung und Wahl vielleicht noch enger geschlossen hatte als an die Familie des Vaters, ich meine den Kreis von Gelehrten und Staatsbeamten, der dann auch das Milieu wurde, in dem wir, ihre Kinder, erwuchsen, und dessen ich zu gedenken habe.
Uebrigens bewahrten die Verwandten auch nach dem Tode des Vaters der Mutter, die auch ihrerseits vielen von ihnen herzlich zugethan war, die alte Liebe und nötigten sie, an der Geselligkeit ihres Hauses teilzunehmen. Auch ich hatte schon als Kind, aber weit mehr noch in späteren Jahren, besonders der Beerschen Familie manche schöne Stunde und unvergeßliche Begegnung zu danken. Von ganzem Herzen lieb blieb uns der Vetter des Vaters, Moritz v. Oppenfeld, dessen Gattin eine geborene Ebers gewesen war. Er bewohnte das heutige Hotel der französischen Gesandtschaft auf dem Pariser Platz, das ihm gehörte, und in seinen weiten Parterreräumen und auch sonst wußte seine Liebe und Herzensgüte ungezählte Freuden in unser ganzes Leben zu flechten. Die Eltern unseres Vetters, des Kriminalisten Karl Ebers, waren schon gestorben, als ich zur Welt kam, und Eduard, der jüngere Bruder unseres Vaters, lebte bald in Dresden, bald in Wien.
Fußnoten
1 Tiergartenstraße Nro. 4.
2 Aufbewahrt in der Autographensammlung meiner ältesten Tochter, der Frau Professor Freifrau v. d. Ropp in Marburg.
Die früheste Kindheit.
In der Leipziger Straße hatte der Vater die Augen geschlossen, war ich zwei Wochen später zur Welt gekommen. Ich soll ein besonders kräftiger und heiterer kleiner Mensch gewesen sein. Eine Verwandte des Vaters, Frau Mosson, eine geborene v. Hochwächter, die bei meiner Geburt zugegen gewesen war und die ich darum oft scherzhaft »die erste Frau« nannte, »die mich gesehen hat«, versicherte, ich hätte schon am dritten Tage meines Lebens ganz richtig gelacht. Auch von anderen Beweisen meines früh erwachten Frohsinns wußte diese ausgezeichnete, keineswegs phantasiereiche Frau zu berichten.
So muß ich wohl glauben, daß ich – weit weniger klug als der Sohn Lessings, der sich das Leben ansah und dabei fand, daß es weise sei, ihm sogleich den Rücken zu kehren – in das Dasein hineingelacht habe, das mir unter schönen Sonnentagen so viele Schmerzensstunden bringen sollte.
Doch ich mag frühreife Kinder nicht leiden, und so nehm' ich dies Zeichen der optimistischen Thorheit, von der ja auch ein guter Teil an mir haften blieb, getrost auf mich.
Der Frühling stand bei meiner Geburt vor der Thür, die Wohnung in der geräuschvollen Leipziger Straße war der Mutter verleidet, ihre Seele lechzte nach Ruhe, und schon damals waren die Grundsätze in ihr zur Reise gelangt, nach denen sie später ihre Knaben zu tüchtigen Männern heranzubilden versuchte. Vor allem lag ihr daran, den kleinen Kindern frische Luft, den größeren freie Bewegung zu schaffen. So suchte sie denn nach einer Wohnung vor dem Thor, und es gelang ihr, das Haus in der Tiergartenstraße Nro. 4, dessen ich schon gedachte, auf einige Jahre zu mieten.
Die Besitzerin, Frau Kommissionsrat Reichert, hatte wie sie vor kurzem den Gatten verloren und war entschlossen gewesen, das Wohnhaus, das sich unweit des von ihr selbst benützten auf dem Grundstücke erhob, lieber leer stehen zu lassen, als eine kinderreiche Familie darin aufzunehmen.
Da sie selbst allein stand,1 scheute sie sich vor dem lauten Wesen heranwachsender Knaben und Mädchen. Aber sie hatte ein warmes, freundliches Herz, und – das erzählte sie mir selbst – der Anblick der schönen jungen Frau in tiefer Trauer ließ sie schnell ihre Vorsätze vergessen. »Wenn sie zehn statt fünf Schreihälse mitgebracht hätte,« sagte sie in ihrer derben und doch liebenswürdigen Weise, »ich hätte dem Engelsgesicht das Haus nicht verweigert.«
Wir denken alle noch gern an die starke, lebhafte Frau mit dem guten runden Gesicht und den lachenden Augen. Bald kam sie der Mutter recht nahe, und meine zweite Schwester Paula wurde ihr besonderer Liebling, dem sie alles durchgehen ließ. Fär sie trug Frau Reichert auch gewöhnlich etwas Süßes in der Tasche, das auch uns anderen mit zu gute kam. Ihre Rappen waren die ersten Pferde, auf die man mich hob. Manchmal nahm sie uns auch mit in ihre Kutsche oder ließ uns in ihr spazieren fahren.
Einzelner Stellen des großen Gartens, der unser Haus umgab, erinnere ich mich sehr wohl, besonders des schattigen Laubganges, der von unserem Balkon im hohen Parterre bis an den Schafgraben führte, des Teiches, der schönen Blumenrabatten vor dem stattlichen Hause der Wirtin, und des Kartoffelfeldes, in dem ich – der Gärtner war der Jäger – das erste Rebhuhn erlegen sah. Das mag ziemlich genau an der Stelle gewesen sein, wo seit vielen Jahren in der Matthäikirche Orgeltöne erschallen und das Wort Gottes einer Gemeinde verkündet wird, deren Wohnhäuser sich zum guten Teil auf den Spielplätzen meiner Kinderzeit erheben.
Das Haus, das uns allein beherbergte, war nur einstöckig, doch hübsch und geräumig; wir bedurften aber auch eines großen Quartiers; denn außer der Mutter, den fünf Kindern und den weiblichen Dienstboten mußte es die Erzieherin und einen Mann beherbergen, der eine Mittelstellung zwischen Hausmann und Diener einnahm und, wenn einer, den Namen eines Faktotums verdiente. Er hieß Kürschner, war ein starkknochiger, untersetzter Dreißiger, der das Bändchen des Ordens, den er als Soldat bei der Belagerung von Antwerpen sich erworben hatte, stets im Knopfloche trug, und der zu unserem Schutze von der Mutter ins Haus genommen worden war; denn im Winter lag unser Heim recht einsam auf dem großen Grundstück.
Dieser Kürschner war ein grundbraver, arbeitsamer und treuer Mensch, der, was man ein »Familienstück« nennt, für uns wurde.
Von seiner Thätigkeit in der Tiergartenstraße ist mir nur noch erinnerlich, daß er am Abend nach gethaner Arbeit die Flöte blies.
Wie sentimental und schmelzend die Lieder waren, mit denen er ich weiß nicht welche Herzenssehnsucht stillte, hab' ich erst als größerer Knabe erfahren, wenn ich mich mit meinem Bruder Ludo in sein Stübchen schlich, um mir von seinen Kriegsthaten erzählen zu lassen.
Die Erzieherin hatte sich natürlich nur mit den älteren Geschwistern zu beschäftigen, für mich genügte einstweilen die Amme, eine Uckermärkerin, die besonders hübsch und heiter gewesen sein soll, doch – vielleicht durch den Tod – außer jeder Verbindung mit der Familie kam, während die Ammen der ältern Geschwister bis an ihr Ende in der Mutter eine hilfreiche Gönnerin besaßen.
Von Frau Großmann, die meine Schwester Martha genährt hatte, hab' ich noch zu reden; Frau Zimmer in Luckenwalde, die Amme meines Bruders Martin, erhielt jährlich zu Weihnachten eine Kiste mit Geschenken. Als diese brave Frau zur Greisin geworden war und über Schwäche klagte, ließ die Mutter sie mehrere Sommer hindurch nach Hosterwitz bei Dresden kommen und sich dort in ihrem Landhause stärken.
Was uns fünf Kinder angeht, so standen an unserer Spitze die beiden großen: jetzt als Gattin des Oberstlieutenants Freiherrn Kurt von Brandenstein verstorbene Schwester Martha, und mein Bruder Martin, die sieben und fünf Jahre älter waren als ich. – Diese beiden wurden natürlich anders behandelt als wir jüngeren Geschwister.
Paula war mir um drei, Ludwig oder Ludo – er ist heute noch der »Onkel Ludo« seiner Neffen und Nichten – um anderthalb Jahre voran.
Paula,2 ein frischer, hübscher, drolliger und verwegener Uebermut mit blonden, erst später gebräunten Locken, die ihr den ganzen Kopf umgaben, führte oft unsere Spiele an, Ludo, der sich später als preußischer Offizier im Kriege wacker bewährte, war ein sanftes Kind von zarter Gesundheit – man sieht es dem breitschulterigen Landmanne wahrlich nicht mehr an – und der nachgiebigste und liebenswürdigste aller Spielgefährten. Wir beide hielten aufs engste zusammen, und wie oft hat man uns für Zwillinge gehalten.
Als der Unterricht begann, sind wir selten anders als mit dem Arm des einen auf der Schulter des andern in die Schule gegangen.
Wir teilten alles mit einander, und an meinem Geburtstage wurde ihm, an seinem mir mitbeschert.
Die erste Person Singularis des persönlichen Fürwortes hatte jeder vergessen und bediente sich nur seiner Mehrzahl, wenn er von sich selbst oder dem andern sprach.
Erst verhältnismäßig spät lernte ich das »ich« und »mir« an die Stelle des »wir« und »uns« setzen.
In meiner Vorstellung war er und ich ein einziger Begriff, und ähnlich erging es auch der Mutter und den Geschwistern, bis die Streiche des Georg bedenklicher zu werden anfingen als die seines sanfteren und weniger unternehmenden »alter ego«.
Die Folge der Begebenheiten in dem stillen Landhause ist mir natürlich aus dem Gedächtnis geschwunden, und vielleicht hat sich manches, was ich hieher verlege, in der Lennéstraße ereignet, die wir später bezogen; jedenfalls aber gehören die Erinnerungen an die Zeit, die wir im Tiergarten verlebten, in dem ja auch die zweite Wohnung lag, zu den lebhaftesten und schönsten meiner Jugend.
Wie oft taucht vor meinem rückwärtsschauenden Blicke das Bild der hohen Bäume und dichten Laubgruppen unseres eigenen und des herrlichen Berliner Tiergartens auf, sehe ich zwischen ihnen muntere Kinder spielen, höre ich vor dem inneren Ohr ihr fröhliches Lachen.
Fußnoten
1 In zweiter Ehe reichte sie später dem Landrat Ulrici die Hand.
2 Im Herbst 1895 wurde auch sie uns genommen.
Märchen und Wahrheit.
Was damals im Allerheiligsten des Hauses, im Schlafzimmer der Mutter geschah, hat sich mir mit besonders dauerhaften, bis ins einzelne deutlichen Zügen in die Seele gegraben.
Ein Mutterherz ist wie die Sonne, die, so vielen sie auch Licht spendet, doch nicht ärmer wird an Glanz und Wärme, und wenn sich auch ein überreicher Strom von Liebe auf mich ergoß, so sind die anderen Geschwister dadurch nicht benachteiligt worden. Aber ich war das jüngste, das Trostkind, das Nesthäkchen, und zu keiner Zeit ist mir dies so oft zu gute gekommen wie dort und damals.
In dem grünen Schlafzimmer mit dem bunten Teppich stand das Ehebett der Eltern. Es stammte aus Holland und war von einer Größe und Breite, wie man sie jetzt nimmer kennt. Die Mutter hatte es behalten. Es breitete sich eine seidene Steppdecke darüber hin, die sich schön weich anfühlte, und unter der es sich köstlich ruhte. Wenn die Zeit des Aufstehens kam, rief die Mutter mich zu sich. Jubelnd kletterte ich auf das warme Lager, und dort zog sie den Liebling zu sich heran, trieb mit ihm allerlei Kurzweil, und nie und nirgends wurden mir schönere Märchen erzählt als eben dort. Da sind sie mir recht und für immer lebendig geworden; denn die Mutter gab ihnen die Gestalt von Dramen, in denen ich als handelnde Person mitwirken durfte.
Am schönsten war es, wenn wir Rotkäppchen spielten. Ich stellte immer das kleine Mädchen dar, das in den Wald geht, sie aber den Wolf. Wenn sich das böse Tier dann mit der Haube der Großmutter unkenntlich gemacht hatte, richtete ich nicht nur die vorgeschriebenen Fragen: »Großmutter, was hast Du für große Augen?«, »Großmutter, wie rauh ist Dein Fell?« und so weiter an sie, sondern erfand auch neue, um den großen Schlußeffekt hinauszuschieben, und der bestand darin, daß nach der Frage: »Großmutter, was hast Du für große, scharfe Zähne?« und nach der Antwort: »Damit ich Dich gut beißen kann,« der Wolf sich auf mich stürzte, um mich zu fressen. Statt der Bisse gab es dann aber nur Küsse, und statt der Zähne brauchte das Untier, das eine zärtliche Mutter war, nur Lippen und Hände, um mich bald neckisch fortzustoßen, bald an sich zu ziehen.
Ein anderesmal war ich das Schneewittchen, sie die böse königliche Stiefmutter und dazu auch der Jäger und die Zwerge und der schöne Königssohn, der es heimführt.
Wie ist mir bei diesem fröhlichen Spiele die Not der verfolgten Unschuld, das Bangen, die Hoffnung, die Freude und der Dank, wenn das Werk gelungen war, wie sind mir die Schrecknisse und der Zauber des Waldes, die Wonnen und Herrlichkeiten des Feenreiches so lebendig geworden. Wenn die Blumen des Gartens die Stimmen erhoben und Lieder gesungen, wenn die Vögel in den Zweigen mich angerufen und gesprochen hätten, ja wenn sich ein Baum in eine holde Fee und die Kröte auf dem feuchten Wege unseres Laubganges in eine Hexe verwandelt hätte, es wäre mir damals nur natürlich erschienen.
Wie früh ich anfing, mir eine eigene Märchenwelt zu bilden und in Worte zu kleiden, wie ich mir das Reich der Feen, die Burgen der Ritter und die Schachte und Werkstätten der Zwerge und Gnomen vorstellte, davon kann Bruder Ludo Kunde geben, der meine Bilder aus einer erträumten Zauberwelt sinnig zu ergänzen verstand und nicht selten selbst neue Phantasiegemälde erdachte.
Unzähligemale kehrten diese freundlichen Gemälde, die damals meine Einbildungskraft bevölkerten, mir wieder in die Vorstellung zurück, wenn sich die Welt um mich her verfinstert hatte, und in ihrem Gefolge erschien dann auch das Bild der geliebten Frau, von der mir die ersten Märchen erzählt worden waren.
Merkwürdig!
Was sich in jenen frühen Tagen Thatsäckliches um mich her begeben hatte und mir selbst begegnet war, vergaß ich fast alles; die Märchen aber, die ich damals gehört und innerlich mit erlebt hatte, prägten sich mir fest ins Gedächtnis.
Die Schule und das Leben sorgten dafür, daß mir das Wirkliche mit all seinen Härten und Ecken, seinen Flecken und Schäden vertraut genug wurde; wer aber hätte mir in späteren Jahren die Thore des Reiches wieder geöffnet, worin alles schön ist und gut, und wo dem Häßlichen so sicher die Vernichtung bevorsteht wie dem Bösen die Strafe? Selbst die Muse weicht ja in unseren Tagen vom kastalischen Quell, dessen kristallklares Wasser zum unsauberen Pfuhl wurde, und, wenn auch widerstrebend, folgt sie doch dem Zwange, sich im Staub des Wirklichen heimisch zu machen. Deswegen erhebe ich gern in Wort und Schrift die Stimme für das Märchen, darum drängt es mich, den Kindern und Enkeln solche zu erzählen, und ich gab ja auch einige der selbst gedichteten heraus.1
Den Gegnern des Märchens aber lege ich die Frage vor, ob sie sich für berechtigt halten, der Kindheit etwas des Allerherrlichsten zu rauben, wofür es im späteren Leben keinerlei Ersatz gibt, ja, dem der ganze spätere Bildungsgang des einzelnen Menschen feindlich in den Weg tritt?
Nur das Nächste und das Allerfernste ist dem Kinderherzen teuer. Es liebt die, die es auf den Arm nehmen und küssen, es liebt sein Spielzeug, die Blumen im Rasen, den Kiesel auf dem Wege, die Muschel am Strande, den Schmetterling, dem es folgt, den Hund, den es zaust und streichelt, und daneben nur noch die Wunderdinge aus der Märchenwelt, die sich nie und nirgends begaben, und auch die Engel, – in denen es das eigene oder das Ebenbild derer sieht, denen es gut ist.
Das andere, was zwischen der Thür des elterlichen Hauses oder dem Zaun seines Gartens und den äußersten Grenzen des Erdballes liegt, kümmert es nicht. Darum raubt derjenige, welcher dem Kinde das Märchen nimmt, ihm die Hälfte, und zwar die schönere und größere der seiner Neigung und seinem Auffassungsvermögen geöffneten Welt.
Wie verkehrt und ungerecht ist es auch, das Märchen aus dem Leben des Kindes zu verbannen, weil die Hingabe an seinen Zauber ihm als erwachsenem Menschen vielleicht zum Nachteil gereichen könnte! Hat denn nicht jenes die gleiche Rücksicht zu fordern wie dieser? Auch kindliches Spiel steht dem Manne nicht an, und wer möchte es den Kleinen verkümmern oder gar vorenthalten, um den Mann vor Vergeudung der Zeit und den Ernst seiner Lebensführung vor Beeinträchtigung zu bewahren? Der Amerikaner Bellamy führte den Gedanken aus, daß die unsterbliche Seele in mehrfacher, verschiedener Gestalt an den Schauplatz ihres Fortlebens im Jenseits gelange. Dort werde die Seele des abgeschiedenen Greises einem Wesen begegnen, das seine Kinderseele, einem andern, das seine Knaben-, einem dritten, das seine Männerseele gewesen war und so weiter, und in der That sind diese alle Sonderindividuen, die in grundverschiedener Weise denken, empfinden und sich zu den wichtigsten Lebensfragen verhalten. Die Seele des Fünfzigers, der diese Worte an die Seinen richtet, würde die Seele, die ihn als neunzehnjährigen Jüngling so stürmisch bewegte, bei der Begegnung in einer andern Welt fremd genug anmuten.
Jedes Kind ist berechtigt, eine andere Behandlung und Beurteilung zu verlangen, und daß ihm ungeschmälert zukomme, was ihm gebührt. Darum ist es ein Unrecht, das Kind zum Besten des Mannes zu beeinträchtigen und zu berauben. Weiß man denn, ob es dem Knaben bestimmt ist, überhaupt zum zweiten und dritten, zum Jüngling oder Erwachsenen zu werden? Es gibt ja karge Vorsichtsapostel, die sich in guten Jahren jede Freude des Lebens versagen, um mit grauem Haar in einem Ueberflusse zu leben, der doch sehr häufig keinem zu gute kommt als ihren Erben. Was aus dem Menschen wird, dem die Erzieher so wenig als Kind wie in den späteren Stadien der Entwicklung die Wunder der Märchenwelt eröffneten, damit er im Gebiet des Wirklichen sich um so ungestörter heimisch mache, das hat Dickens in seinem Roman »Harte Zeiten« so anschaulich und überzeugend geschildert, daß ich ihm die eingehende Begründung der eigenen Meinung gern überlasse.
In den ersten Jahren fällt es dem Kinde freilich schwer, Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden; ist es doch die Einbildungskraft, auf der sich der größte Teil seines inneren Lebens und ganz gewiß seiner Freuden aufbaut. Der Stock, auf dem es reitet, wird ihm zum Pferde, das Blättchen, das es von einem Fliederzweige abriß, zum Goldstücke, womit es Zahlungen leistet. Einen sehr gutherzigen, doch lebhaften Knaben sah ich sein geliebtes Schwesterchen kratzen und beißen, weil er sich in einen Tiger verwandelt zu haben meinte, und in unserem Bekanntenkreise ereignete sich der niedliche Vorfall, daß ein kleines Mädchen, das einer Besucherin seine Puppe zeigen sollte, an deren Bette es eben saß, in bittere Thränen ausbrach und, von der Mutter deswegen gescholten, schluchzend ausrief: »Meine Nelly hat das Scharlachfieber, und sie war eben etwas eingeschlafen, als ich sie aus dem Bett nehmen sollte.«
Wer von dieser Art der Verwechslung üble Folgen für die Zukunft des Kindes, besonders aber für seine künftige Stellungnahme zu den wirklichen Dingen und die Wahrhaftigkeit fürchtet, der hat sich sicherlich nie die Mühe genommen, das Wesen der sich entfaltenden Menschenknospe näher ins Auge zu fassen.
Wie die unsere, so wird ohnehin jede verständige Mutter Sorge tragen, daß die Kinder die Märchen, die sie ihnen erzählt, nicht für wahre Geschichten halten. Mir fehlt die Erinnerung an die Zeit, in der ich, sobald der Geist aufgerufen wurde, darüber zu entscheiden, selbst Erdichtetes für wirklich Geschehenes gehalten hätte; wohl aber weiß ich noch, daß wir manchmal nicht zu entscheiden vermochten, ob die wahrscheinlich klingende Erzählung eines andern in das Reich der Märchen oder der Wirklichkeit gehöre. Dann aber fragten wir die Mutter, und ihre Antwort machte jedem Zweifel ein Ende; denn wir wähnten, daß sie nie irre, und wußten, daß sie stets die Wahrheit sagte.
Wie mir bei selbsterdachten Erzählungen, sah ich es den meisten phantasiereichen Kindern ergehen. Ich konnte jedem Mitglied des Hauses die wunderbarsten Dinge vorfabuliren, und während des Erzählens, aber nur dann, hielt ich sie oft selbst für wahr; sobald ich aber gefragt wurde, ob das Mitgeteilte sich in der That so verhielte, war es mir, als erwachte ich aus einem Traume. Ich unterschied augenblicklich das Erfundene vom Erlebten, und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, gegen besseres Wissen Auskunft zu erteilen.
So hat die lebhaft erweckte Einbildungskraft weder mich noch meine Geschwister, noch meine Kinder und Enkel zum Lügen verleitet.
Es läßt sich freilich nicht leugnen, daß ein phantasiereiches Kind eher der Gefahr unterliegt, von der Wahrheit abzuweichen, als ein nüchtern angelegtes; doch so wenig wie man die Kraft eines ungewöhnlich starken Knaben ungeübt lassen möchte, um ihn vor Gewaltthätigkeit zu behüten, wird man die Gottesgabe der lebhaften Einbildungskraft bei einem reichlich mit ihr ausgestatteten jungen Geschöpf unterbinden mögen. Und wie viele Kinder, die mit spärlicher oder lahmer Phantasie zur Welt kommen, dürfen fordern, daß man sie zu ihrem Besten übt und kräftigt! Bei solchen realen Naturen gewinnt der Hang zur Unwahrheit die gefährlichsten Formen; denn er bethätigt sich gewöhnlich in dem Bestreben, Vorteile zu erlangen. Ihnen gegenüber führt die Schwäche der Eltern leicht zu Verbrechen, während die zu hoch fliegende oder irregehende Einbildungskraft phantasiereicher Kinder sich leicht genug einschränken läßt.
Dies fand sich bei uns allen bestätigt
Später scheute ich die Lüge nicht nur, weil die Mutter alles andere eher straflos ließ als eine solche, sondern weil es mir früh vergönnt gewesen war, die Häßlichkeit der Lüge zu erkennen. Schon im siebenten oder achten Jahr hatte ich mit angehört, wie ein Knabe – ich weiß noch wie er hieß – die eigene Mutter nach einem Streiche, an dem ich teilgenommen hatte, schamlos belog. – Zwar fiel ich ihm nicht ins Wort, um der Wahrheit die ihr gebührende Geltung zu verschaffen; doch ich erschrak und hatte das Gefühl, einer ruchlosen Unthat beigewohnt zu haben.
Aehnliche Erfahrungen bleiben wenigen erspart, und auf mich hat die freche Lüge des kleinen Kameraden jahrelang abschreckend gewirkt.
Phantasiereiche Kinder, die nicht streng zur Wahrhaftigkeit erzogen wurden, werden sich, um einer Strafe zu entgehen, besser herauszureden verstehen als andere, doch hat dies nichts mit der Wirkung der Märchen zu schaffen, die vielmehr recht gründlich lehren, daß es den Lügnern ergeht wie jenem Schäfer Fritz, dem der Wolf die Schafe auffraß.
Wenn Ludo und ich auch in den mißlichsten Lagen im ganzen strenger bei der Wahrheit blieben als viele andere Knaben, so danken wir »Kleinen« dies besonders unserer Schwester Paula, die von früh an ein Wahrheitsfanatiker war und heute noch manche Verdrießlichkeit auf sich nimmt, weil sie selbst jene kleinen Notlügen, denen die Gesellschaft das Bürgerrecht unter dem Erlaubten zuspricht, verachtet.
Auch ich bin diesem Unkraut, das man im Weizenfelde duldet, nicht hold, und wenn ich mich seiner dennoch gelegentlich bediente, werden der Steine nicht sonderlich viel sein, die Schuldlosere auf mich werfen könnten. Sicherlich sind bei der interessanten Frage über die Berechtigung der Notlüge auch die Kinder mit zu berücksichtigen; doch was wußten wir von Not bei unseren Spielen im Tiergarten? Wovor hätte uns eine Unwahrheit retten können, als vor dem Schlage einer geliebten kleinen Frauenhand, die allerdings, galt es eine besondere Unthat mit einer Ohrfeige zu strafen, wegen der Ringe, die sie zierten, ziemlich weh thun konnte.
Gegen die stille, sittsame und pflichttreue Martha erhob sie sich niemals; auch mit Paula ist sie nur in wenigen, leicht zu zählenden Einzelfällen in Berührung gekommen; doch erzählt die Sage, daß, als sie einmal ihr hübsches Gesichtchen getroffen hatte, dies eigenartige Kind sich die Wange gerieben und mit der drolligen Ruhe, die es selten im Stich ließ, bemerkt habe: »Wenn Du mich wieder schlagen willst, Mutter, so nimm, bitte, zuvor die Ringe ab.«
Fußnoten
1 »Drei Märchen für Alt und Jung« und »Die Unersetzlichen«.
Die Erzieherin. – Der Friedhof.
In der Tiergartenzeit ist die mütterliche Hand kaum je mit meinem Gesicht in andere als zärtliche Berührung gekommen. Jede Erinnerung an sie ist schön und heiter. Wenn mir die Mutter später bekannte, sie habe es sich zur Aufgabe gestellt, uns eine glückliche Kindheit und Jugend zu schaffen, so ist ihr ihre Losung schon dort aufs beste gelungen. Ich weiß noch recht wohl, wie munter sie mit uns zu scherzen und zu spielen verstand, und aus der frühesten Zeit schaut mir ihr liebes Gesicht besonders froh und anmutig entgegen. Und doch war sie mit dem schwersten Kummer im Herzen in die Tiergartenstraße gezogen.
Von derjenigen, die sie als Erzieherin der beiden ältesten Kinder dahin begleitete und ihr eine treue Freundin wurde, weiß ich, wie bedürftig des Trostes sie gewesen war, wie voll und ganz die Stimmung der Seele der tiefen Witwentrauer entsprach, die sie trug, und in der sie einen so rührend schönen Anblick gewährt haben soll.
Bernhardine Kron hieß damals dies seltene Wesen. Sie war eine Mecklenburgerin und vereinte mit einer reichen, tief gehenden Bildung die wackere Gesinnung, das warme Gemüt und die Herzenstreue dieses tüchtigen und sympathischen deutschen Stammes. Wie die Mutter sie, so hatte sie die junge Frau, deren Kindern sie ihre besten Kräfte widmen sollte, schnell lieb gewonnen, und noch in späteren Jahren wurden die Augen ihr feucht, wenn sie von der Zeit erzählte, da sie in unserem stillen Landhause den Kummer der Mutter getragen und ihr bei dem Erziehungswerke geholfen hatte.
Sie ist später die Leiterin der höheren Töchterschule in Stettin und endlich die Gattin des dortigen Konsistorialrats Textor geworden. Nach kaum einjähriger Ehe verlor sie den Gatten und widmete den langen Rest ihres Lebens den Kindern, die sie mit erheiratet hatte, und die unter ihrer wahrhaft mütterlich treuen Sorge zu trefflichen Menschen gediehen.
Uns Kleine zog sie ans Herz. Jede Erinnerung an sie ist wohlthuend und freundlich. Bis zu ihrem späten Heimgang folgte sie dem Lebenswege jedes einzelnen von uns. Meiner Schwester Martha, ihrem ältesten und bevorzugten Zögling, schickte sie zur Hochzeit ein Paar selbstgestrickter Strümpfe, die sie mit der Zahl 100 gezeichnet, weil sie in den Handarbeitstunden den Satz oft wiederholt hatte, daß ein Mädchen, um zum Heiraten berechtigt zu sein, hundert Paar Strümpfe gestrickt haben müsse. Der Brief, den sie mir nach meiner Verlobung schrieb, atmet die treueste Liebe, und ich habe ihn dankbar bewahrt.
Sie und die Mutter erzählten gern von den stillen Abenden, an denen sie, wenn alles andere zur Ruhe gegangen war, ganz allein gelesen oder durchgesprochen hatten, was ihnen das Herz bewegte. Da gab jede der andern, was sie vermochte. Die deutsche Erzieherin ging mit der Patronin unsere Klassiker durch, und die Mutter las ihr die Werke von Racine und Corneille vor und hielt sie an, französisch und englisch mit ihr zu sprechen; denn sie beherrschte, wie so viele Holländerinnen, diese Sprachen, als sei sie in Paris oder London erwachsen. Das Bedürfnis, zu lernen und von dem eigenen reichen geistigen Besitz mitzuteilen, ist der Mutter bis ins späte Greisenalter eigen geblieben, und was hat nicht jedes von uns dem Anteil zu danken, den sie ihm an ihren Kenntnissen und Erfahrungen gewährte!
Auch Fräulein Kron blieb bis ans Ende für die geistige Förderung erkenntlich, die ihr, der Lehrerin, durch die »Prinzipalin« zu teil geworden war, während diese des Trostes und der Erhebung nie vergaß, die ihr das warme Herz der treuen Mecklenburgerin in den schwersten Tagen des Lebens gespendet.
Jene späten einsamen Stunden in rauher Winterszeit nahmen gewöhnlich einen ernsten Verlauf, doch die Mutter wie die Erzieherin lachten noch als Greisinnen herzlich. wenn sie sich eines gewissen Vorgangs von damals erinnerten. An einem sehr kalten Abend war das Kaminfeuer ausgegangen, und die sonst so mäßigen Frauen hatten sich einen Punsch bereitet, um das Buch, das sie zu lesen begonnen, zu Ende zu bringen. Als sie sich um Mitternacht endlich erhoben, sagte die Mutter: »Ich glaube, Fräulein, ich stehe nicht fest auf den Füßen,« und die andere versetzte: »Ich weiß nicht, was das ist, aber es scheint mir, als drehe sich das Zimmer um mich her.«
Dann lachten beide hell auf, und die Mutter rief: »Aber dann haben wir ja gewiß zu viel getrunken!«
»Welche Schande!« lallte die Erzieherin; »wenn uns nur die Kinder nicht sehen!«
Darauf geleitete erst die Patronin die Erzieherin in ihr Schlafgemach, dann diese die Patronin unsicheren Schrittes in das ihre, und beide gedachten bis ans Ende des gemeinsamen ersten und letzten Rausches.
So durfte sich auch Heiteres in diese Tage der Kümmernis mischen. Als ich mit Bewußtsein um mich her schaute, war die schwerste Zeit schon vorüber; wenn ich aber vorhin bemerkte, meine ersten Erinnerungen an die Mutter wären froh und sonnig gewesen, so vergaß ich die dem Andenken an den Vater gewidmeten Stunden. Sie machten sich uns selten bemerkbar; denn eine gewisse Keuschheit verhinderte die teure Frau bis ins späte Alter, gerade den tiefsten Schmerz anderen zu zeigen. Mit dem bittersten Seelenweh versuchte sie stets allein fertig zu werden. Darum sahen wir sie auch nur selten weinen, und sogar als der ihr teuerste Bruder und die Großmutter, die ihr sehr lieb gewesen war, die Augen geschlossen hatten, wurde ihrem Wunsch, allein und ungestört zu bleiben, stillschweigend von uns allen Vorschub geleistet. Ihre sonnige Natur scheute sich wohl auch, Schatten und Dunkel um sich her zu verbreiten.
Die Stunden, auf die ich hinwies, flochten sich nicht nur durch unsere Kindheit, sondern kehrten auch wieder, wenn es uns später vergönnt war, bei der Mutter zu weilen.
Der vierzehnte Februar jedes Jahres, der Sterbetag des Vaters, war es, der sie veranlaßte, sich, wo sie sich auch aufhalten mochte, von den Mitgliedern des Hauses und auch von uns Kindern zurückzuziehen. Während des ganzen Vormittags ließ sie sich von keinem sehen oder sprechen, und bei der Mahlzeit und später zeigte ihr ganzes Wesen eine, ich möchte sagen feierliche Würde und Stille, die uns nötigte, leiser zu sprechen und schweigend zuzuhören, wenn sie uns von dem Vater erzählte.
Eine zweite Gelegenheit, ihre schmerzliche Bewegung zu teilen, wiederholte sich mehrmals in jedem Sommer. Es war der Besuch des Friedhofs, den sie selten allein unternahm.
Uns allen haben sich diese Gänge tief ins Gedächtnis geprägt, und meine erste Erinnerung an einen solchen kann spätestens in mein fünftes Lebensjahr fallen; denn ich erinnere mich noch sehr wohl, daß uns einmal die Rappen der Frau Reichert, unserer Wirtin, nach dem Gottesacker führten.
Der Dreifaltigkeitskirchhof vor dem Hallischen Thore war es, auf dem der Vater ruhte. Ich fand ihn so wenig verändert, als ich ihn vor zwei Jahren wieder betrat, daß ich ohne Führer und Aufenthalt dem Ebersschen Erbbegräbnis sicher entgegenschreiten konnte. Dennoch hatte mein körperliches Befinden mich lange fern von ihm gehalten.
Aber welche Umgestaltung war mit dem Wege zu ihm vorgegangen!
Wenn wir ihn mit der Mutter besuchten, und das geschah immer zu Wagen, denn er lag weit von unserer Wohnung entfernt, ging es schnell genug durch die Stadt, das Thor und etwa bis an die Stelle, wo ich jetzt den stattlichen Ziegelbau der Kreuzkirche fand; dann aber wurde nach rechts umgebogen, und, hatten wir in Droschken gesessen, so stiegen wir Kinder aus; denn es wurde den armen Gäulen so gar sauer, die Wagen durch den tiefsandigen Weg, der auf den Friedhof führte, zu ziehen. Auch die Leichen sind in jener weniger eiligen Zeit langsam zu der Stätte gelangt, wo ewige Ruhe ihrer harrte.
Wir Kinder pflückten während der Wanderung durch den Sand blaue Kornblumen, scharlachrote Mohnblüten und bunte Wicken von den Feldern, und Glocken- und Gänseblumen, Wegerich, Ranunkeln und Löwenmaul von den mageren Rasenstückchen zur Seite der Straße, und banden daraus Sträußchen für die Gräber der Unseren.
Hinter dem Gottesackerthor gab es Aufenthalt bei dem Hause zur Rechten des Weges; denn die Besuche der Mutter hatten sie mit seinen Bewohnern, der Familie des Totengräbers Hesse, bekannt gemacht. Dieser wohlbehaltene Mann, von dem wir auch Kränze und Blumen zu kaufen pflegten, kannte uns bei Namen, und ebenso seine besonders hübschen, sauber gekleideten Töchter, deren starke, um den Kopf gewundene schwarze Zöpfe und lebhafte dunkle Augen ich noch vor mir zu sehen meine.
Die anmutigen Mädchen und die bunten Blumen verliehen für mich. den alles dem Auge Wohlgefällige schon früh anzog, dem Eintritt in den Friedhof einen freundlichen Reiz. Das war es wohl auch, was im Verein mit der Fahrt, mit dem Spaziergang und der Unterbrechung des Alltagslebens für Ludo und mich dem Besuche des väterlichen Grabes etwas Festtägliches verlieh und uns veranlaßte, seine Ankündigung mit stiller Freude zu begrüßen.
Schweigend schritt die Mutter mit uns durch die Reihen der Rasenhügel, Denksteine und Kreuze dahin, während wir die Blumenstöcke und Kränze trugen, die sie, um jedem die Freude zu gönnen, sich dienstlich zu erweisen, schon am Totengräberhause unter uns verteilt hatte.
Auch wir flüsterten uns höchstens eine Wahrnehmung zu; denn wie viel Schmetterlinge wiegten sich hier auf den Blüten, wie viel Insekten, und unter ihnen die rot und schwarzen Totenkäfer, die es anderwärts nicht zu sehen gab, krochen hier umher, und wie bemerkenswert erschien uns jedes neue Denkmal, das man seit dem letzten Besuche errichtet.
Unser Erbbegräbnis – jetzt erhebt sich auch schon das Kreuz der Mutter und Paulas neben dem des Vaters – gehört zu denen, die die Friedhofsmauer nach hinten begrenzt, und eine Marmorplatte, die man in sie einließ, zeigt an, wem es eignet. Es ist geräumig genug, um noch einige von uns aufzunehmen und liegt zur Rechten des Weges zwischen dem gräflich Kalckreuthschen und dem stattlichen Mausoleum, das die irdische Hülle Moritz v. Oppenfelds, der uns unter den väterlichen Verwandten weitaus der liebste war, und der Seinen birgt. Für die Gesinnung dieses trefflichen Mannes legt das kleinere Grab neben seiner hohen, vornehm schlichten Familiengruft, das unsere Ruhestätte von der Oppenfeldschen trennt, Zeugnis ab; denn er erwarb es auf ewige Zeit für den treuen und tüchtigen Lehrer seiner Kinder.
Die Mutter trat uns voran in den mit einem eisernen Gitter umgebenen Raum und betete oder gedachte schweigend der teuren Verstorbenen, die da ruhten.
Das ist ja unseren Grabhügeln eigen, daß sie uns wie mit geheimnisvoller Macht diejenigen gleichsam zurückgeben, die unter ihnen ruhen. Mir wenigstens wird es nirgends leichter, mit den mir teuersten Verstorbenen wie mit Lebenden zu verkehren als an ihren Hügeln. Auf Reisen in weiter Ferne, in der Wüste oder auf dem Meere war es mir ein peinlicher Gedanke, zu sterben, nicht weil ich mich vor dem Tode gefürchtet hätte, der uns ja überall zu finden weiß, sondern weil ich mir sagte, daß es denen, die mich liebten, dann unmöglich gewesen wäre, meiner am Grabe zu gedenken. Es hätte sie auch um die tröstliche Freude der Ueberlebenden gebracht, meinen Hügel mit Blumen zu schmücken.
Steht denn uns Protestanten, wenn die Liebe zu einem teuren Verstorbenen sich in uns nach Bethätigung sehnt, ein anderes Mittel zu Gebote, als die Stätte, die sein irdisches Teil birgt, mit Blumen zu schmücken? Ihre bunten Häupter und ein frohes Kinderantlitz sind auch das einzige, dem der Trauernde, dessen Wunden noch frisch an einem Sarge bluten, ihn heiter anzuschauen gestattet, und ich möchte die Blumen mit dem Klang der Glocken vergleichen. Beide sind auf den Höhepunkten des Lebens, den ernsten wie den frohen, am Platz und willkommen. Wie Engelsgrüße erscheinen beide, diese aus der Tiefe, jene aus der Höhe, dem froh oder schmerzlich bewegten Herzen.
Auch was die Mutter dem Grabe des Vaters zuführte, waren immer, außer einem Herzen voll Liebe, Kinder und Blumen.
Wenn sie dem eigenen Seelenbedürfnis Genüge gethan hatte, wandte sie sich an uns und leitete den Schmuck des Hügels mit freundlicher Gelassenheit. Dann erinnerte sie uns an den Vater, und hatte sich eines eine Strafe zugezogen, so legte sie ihm – ein solcher Fall aus später Zeit prägte sich mir fest ins Gedächtnis – den Arm um die Schultern und bat es leise und nur ihm verständlich, sie nicht wieder so zu betrüben und des Verstorbenen zu gedenken. Solche freundliche Mahnung an dieser Stätte konnte nicht unwirksam bleiben und schloß auch die Vergebung in sich.
Während der Rückkehr war Hand und Herz wieder frei, und wir gebrauchten auch wieder die Zunge.
Bei diesen Gängen erwachte auch mein Interesse für Schleiermacher; denn sein Grab – er war drei Jahre vor meiner Geburt 1834 gestorben – lag in der Nähe unseres Erbbegräbnisses, und wir blieben mehr als einmal vor dem Denksteine stehen, den ihm Freunde, dankbare Schüler und Verehrer errichtet. Er ist mit seinem Bildnisse in Marmor geschmückt, und ihm gegenüber erzählte uns die Mutter, die ihm oft persönlich begegnet war, manchmal von dem feinsinnigen Theologen, Philosophen und Kanzelredner, dessen Lehren auf die bedeutendsten meiner Keilhauer Erzieher, wie ich erst viel später wahrnehmen sollte, den mächtigsten Einfluß geübt. Sie kannte auch die schönsten seiner Rätsel, und das folgende, das von keinem andern an sinnvoller Knappheit übertroffen wird:
»Getrennt mir heilig,
Vereint abscheulich«
hatte sie ihn selbst aufgeben hören. Die Lösung: »Mein Eid« und »Meineid« ist ja jedermann bekannt.
Nichts lag der Mutter ferner, als aus diesen Friedhofsbesuchen Veranstaltungen oder besondere Gedenktage zu machen; sie woben sich vielmehr wie etwas Selbstverständliches in unser Leben und wurden keineswegs in bestimmten Zwischenräumen oder an feststehenden Daten unternommen, sondern wenn das Herz sie dazu drängte und das Wetter ins Freie lud. Sie haben nur in meiner Vorstellung und in der der Geschwister infolge der Gemütserhebung, die sich mit ihnen verband, etwas Festtägliches, Weihevolles gewonnen.
An den Festen.
Die Feier eines Gedenktages auch äußerlich hervorzuheben lag freilich in der Art der Mutter, die, trotz ihrer tiefen Innerlichkeit ziemlichen und ansprechenden Formen hold, den Sinn für sie früh in uns zu erwecken versuchte.
An allen Festen wurden wir Kleinen von Kopf zu Fuß frisch angezogen, an einem jeden bekamen wir, und mit uns die Dienstboten, Kuchen zum Fcühstück und an den größten auch Wein zu Mittag.
An den Geburtstagen wurden die Torten mit so vielen Lichtern umgeben, wie wir Jahre zählten, und es ward immer für den zierlichen Aufbau der Geschenke gesorgt. So lange wir klein waren, zeichnete die Mutter das Geburtstagskind – wohl nach einer heimischen Sitte – durch eine seidene Schärpe aus. Auch den eigenen Geburtstag sah sie gern feiern, und so lange ich denken kann, wurde an ihm – er fiel auf den 25. Juli – eine Landpartie unternommen.
Wir wußten, daß es sie glücklich machte, uns am Geburtstag an ihrem Tische zu sehen, und noch bis in ihr spätestes Alter führte dies Fest jeden von uns zu ihr, dem es der Beruf irgend erlaubte.
Am Sonntag ging sie in die Kirche, und am Karfreitag hielt sie darauf, daß nicht nur während des Gottesdienstes, sondern auch während des übrigen Tages die Schwestern wie sie selbst schwarz gekleidet waren.
Eine schönere Weihnachtsfeier als die unsere wurde wohl wenigen Kindern bereitet; denn unter dem mit besonderer Liebe geschmückten Baume fand jedes seine wärmsten Wünsche befriedigt, und hinter dem Gabentische der Familie stand stets eine andere Tafel, an der mehrere weniger Bemittelte, ich möchte sagen »Klienten« des Hauses, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Bescherung fanden. Unter diesen fehlte, bis ich als Elfjähriger nach Keilhau kam, nie die Amme meiner ältesten Schwester Martha mit ihrem braven und stattlichen Eheherrn, dem Schuhmachermeister Großmann, und ihren wohlgeratenen Kindern.
Bevor der Aufbau bei uns begann, hatte die Mutter die Schwestern zu Armen begleitet oder sie zu ihnen führen lassen, um ihnen in großen Körben allerlei nützliche und den Kindern erfreuliche Dinge zu überbringen.
Auch uns Knaben hielt sie an, von dem Unsern mitzuteilen, und die vielen Almosen, die sie spendete, ließ sie gern durch uns den Bedürftigen geben. Das paradox klingende Wort: »Vom Geben ist noch niemand arm geworden«, hörte ich zuerst von ihr, und sie fand mehr als einmal Gelegenheit, es uns zu wiederholen.