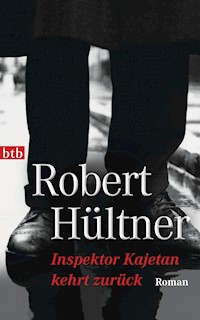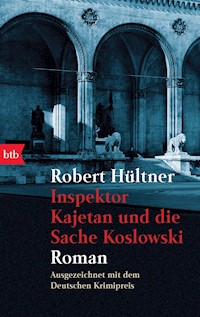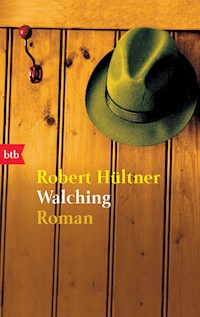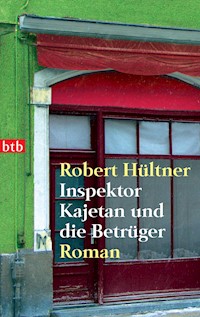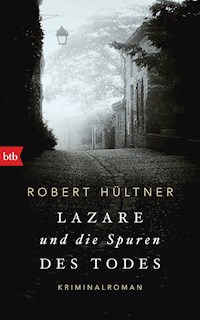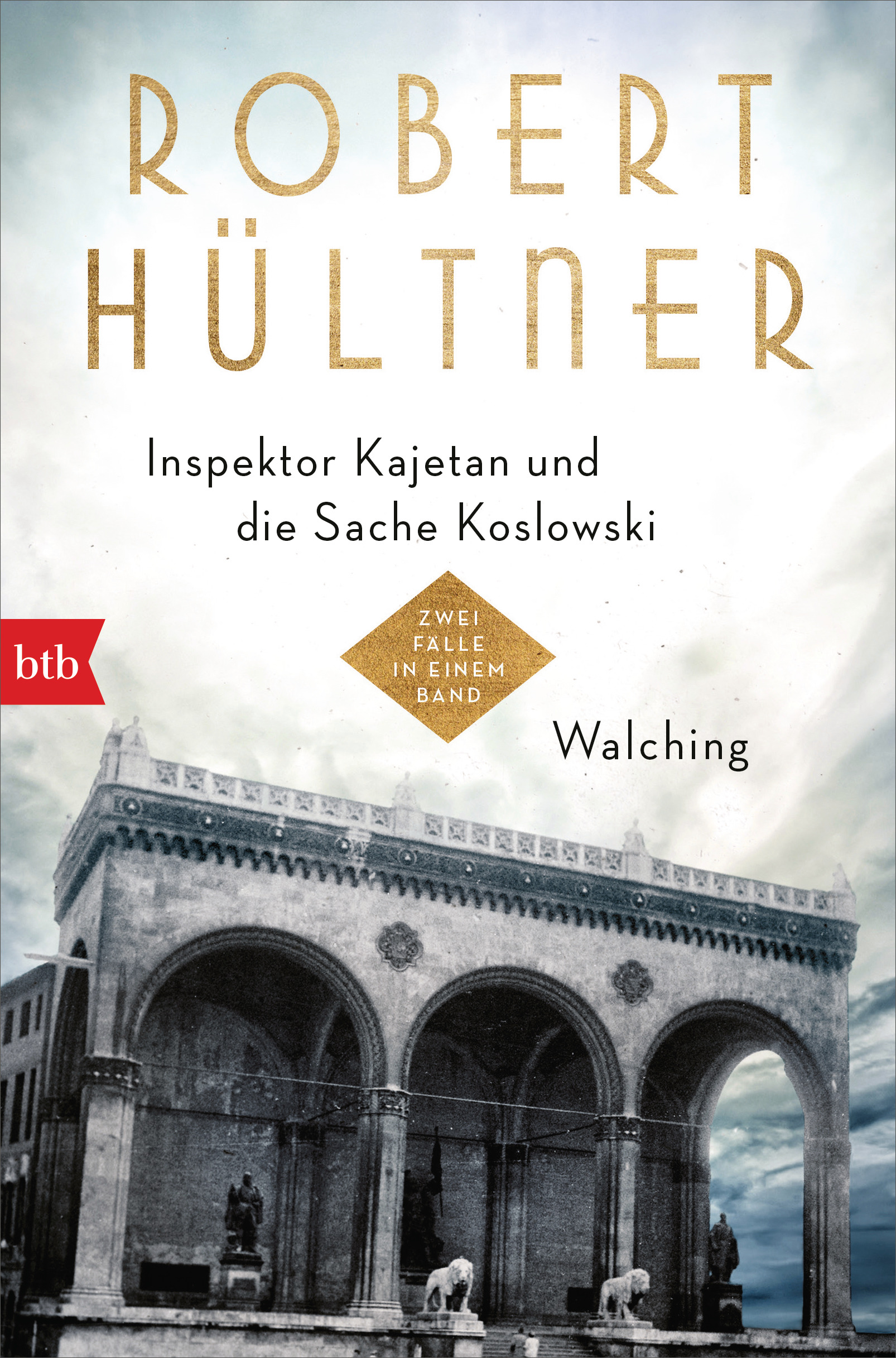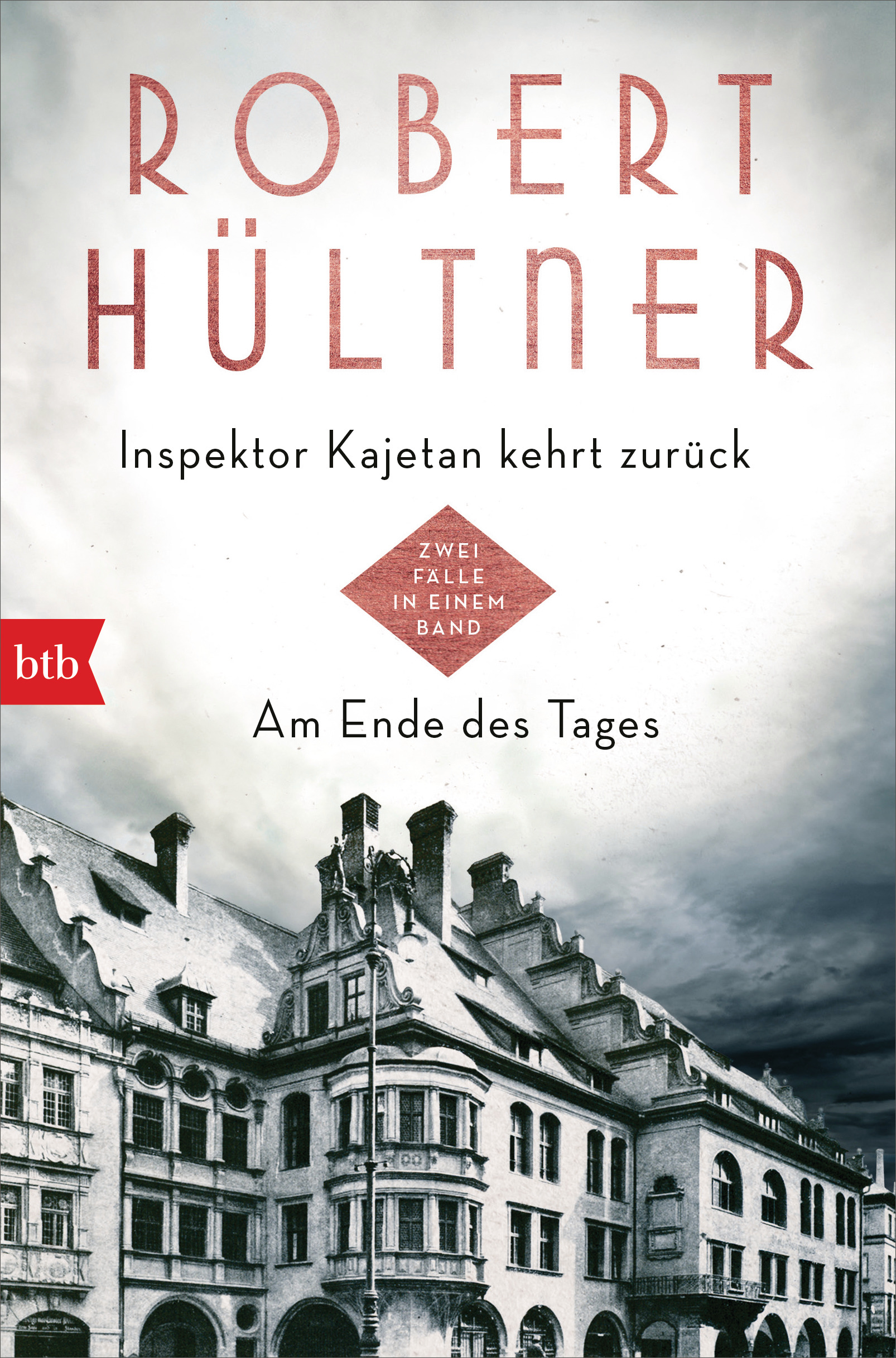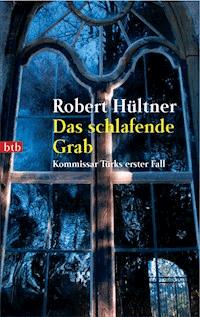10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Kajetan Doppelbände
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Dieser Doppelband enthält die Romane "Die Godin" & "Inspektor Kajetan und die Betrüger"
Die Godin:
München, 1924: Eine Prostituierte wird ermordet aufgefunden. Paul Kajetan, wegen Ungehorsam aus dem Polizeidienst entlassen, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Die Spur führt zunächst zu dem zwielichtigen Varietébesitzer Urban. Bald wird Kajetan in einen gefährlichen Sumpf von Korruption und Waffenschieberei hineingezogen. "Die Godin", ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimipreis 1998 und dem Friedrich-Glauser-Preis.
Inspektor Kajetan und die Betrüger:
München, in den 20er Jahren: Paul Kajetan, der sich seit seiner Entlassung als Detektiv durchs Leben schlägt, gerät in Verdacht, auf seinen Nachfolger in der Münchner Polizeidirektion einen Mordanschlag verübt zu haben. Um seine Unschuld zu beweisen, macht er sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Ein nicht ganz ungefährliches Unternehmen, wie sich bald herausstellt. Kajetans Recherchen führen ihn von der Welt der frühen Alternativen und Landkommunen bis ins Milieu der Spekulanten, Parvenüs und Rechtsradikalen. Stück für Stück setzt er das Puzzle zusammen – und lässt dabei fast sein Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 776
Ähnliche
Zu den Büchern
Die Godin
München, 1924: In einer Sturmnacht flüchtet Paul Kajetan vor dem strömenden Regen in eine Bretterbude am Viktualienmarkt. Drinnen zechen im verborgenen Nachtschwärmer, Gestrandete, Prostituierte, Marktarbeiter. Unter ihnen ist auch die junge Mia, eine Prostituierte, in die er sich Hals über Kopf verliebt. Bald darauf wird die Frau ermordet. Kajetan beschließt auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Rasch stößt er auf die Spur eines Verdächtigen …
Inspektor Kajetan und die Betrüger
Paul Kajetan, der sich seit seiner Entlassung als Detektiv durchs Leben schlägt, gerät in Verdacht, auf seinen Nachfolger in der Münchner Polizeidirektion einen Mordanschlag verübt zu haben. Um seine Unschuld zu beweisen, macht er sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Ein nicht ganz ungefährliches Unternehmen, wie sich bald herausstellt. Denn er hat es mit mächtigen Gegnern zu tun, die vor einem Mord mehr oder weniger nicht zurückschrecken. Kajetans Recherchen führen ihn von der Welt der frühen Alternativen und Landkommunen bis in das Milieu der Spekulanten, Parvenüs und Rechtsradikalen. Stück für Stück setzt er das Puzzle zusammen …
Zum Autor
ROBERT HÜLTNER wurde 1950 in Inzell geboren. Er arbeitete unter anderem als Regieassistent, Dramaturg, Regisseur von Kurzfilmen und Dokumentationen, reiste mit einem Wanderkino durch kinolose Dörfer und restaurierte historische Filme für das Filmmuseum. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören neben historischen Romanen und Krimis auch Drehbücher (u. a. für den Tatort), Theaterstücke und Hörspiele. Sein Roman »Der Sommer der Gaukler« wurde von Marcus H. Rosenmüller verfilmt. Für seine Inspektor-Kajetan-Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem dreimal mit dem Deutschen Krimipreis und mit dem renommierten Glauser-Preis.
Robert Hültner
Die Godin
Inspektor Kajetan und die Betrüger
Zwei Fälle in einem Band
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Sonderausgabe Juni 2020
by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Die Godin © 1997 by Vito von eichborn GmbH & Co. Verlag KG,
Frankfurt am Main
Inspektor Kajetan und die Betrüger © 2004 by btb Verlag
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Bridgeman Images / Look and Learn
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ts · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-27064-3V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Die Godin
Roman
1
Der Wegmacher wollte wieder davon erzählen, wie einmal der Himmel auf Sarzhofen gefallen, der Eglinger Alois dabei zu Tode gekommen sei und das Elend über die Aichingerischen, aber man ließ ihn nicht.
»Es ist doch schon so lang her, Wegmacher«, sagte der Wirt, ohne den alten Mann anzusehen, und hielt einen Bierkrug unter den Zapfhahn.
Der Landthaler spuckte auf den Boden und griff nach den Spielkarten, die der Reither ausgegeben hatte. »Dasselbe mein ich auch«, pflichtete er dem Wirt bei. »Lass uns endlich in Ruh mit der Geschicht. Ein jeder kennt sie.«
Der alte Wegmacher jedoch hörte nicht. Störrisch wiederholte er jene Worte, mit denen alle Geschichten auf dem Land beginnen: »Leut, ich lüg euch nicht an …«
Das Ritual will eigentlich, dass die Zuhörer zunächst lautstarken Zweifel an dieser Behauptung äußern, woraufhin der Erzähler seine Versicherung zu erneuern hat. Doch, wie neugierig man auf das Kommende auch sein mag, so wenig darf auch jener Bekräftigung Glauben geschenkt werden: »Geh zu! Du allerweil mit deiner Fabelei!«
Ein paarmal darf das hin und her gehen. Es hat seine Grenzen aber dann, wenn der Erzählende nicht mehr anders kann, als sich schließlich in die Rolle des gekränkten Wissenden zurückzuziehen, welcher es durchaus nicht nötig hat, seine Weisheiten Unwürdigen mitzuteilen. Doch mit einem gnädigen »Dann red halt, in Gottsnam« wird dies rechtzeitig verhindert.
Die drei Männer dagegen, die sich an diesem Augustabend in der Sarzhofener Gaststätte »Zum Nauferger« zum Kartenspiel getroffen hatten, machten keine Anstalten, ein anderes Spiel zu spielen als jenes, welches der Reither soeben gemischt hatte.
Der Stadler sandte einen geschmerzten Blick zum schwarzgeräucherten Plafond. »Sagt ja auch niemand, dass du lügst, Michl«, stöhnte er, »aber jetzt gibst eine Ruh. Wir spielen Karten.«
»Gewiss wahr, ich lüg euch nicht an …«, wiederholte der Wegmacher Michl. Er knetete seine fleckigen Finger und blickte ins Nichts.
Die Kiefer des Landthaler mahlten. »Streng wird gespielt, habts gehört?« mahnte er die anderen beherrscht. »Einen wenn ich beim Schwindeln erwisch!«
»Freilich.« Der Reither tat unschuldig und gab seinem Nebenmann einen leichten Stoß mit der Fußspitze. »Wer gibt?«
»… es ist gewesen im Vierer Jahr, wie …«
»Deine Goschn, Wegmacher!« fauchte der Landthaler.
»… im Vierer Jahr, wie der Teufelsstein im Schatzberger Wald auf einmal angefangen hat zu schwitzen …«
Zornig wandte sich nun auch der Reither um. »Wir spielen! Hörst nicht? Bring uns nicht draus, sonst werden wir grantig!«
»… auf einmal angefangen hat zu schwitzen, und wie …«
Krachend patschte die geöffnete Hand des Landthalers auf den Tisch. Er stand auf, ging zur Ofenbank und stellte sich breit vor den Alten. Seine zur Faust geballte rechte Hand pendelte drohend. Der Wegmacher duckte sich ängstlich.
Wortlos kehrte der Landthaler an den Tisch zurück.
»Das hat er verstanden«, stellte der Reither befriedigt fest. Der Wirt atmete erleichtert auf, griff nach den gefüllten Krügen und trug sie an den Tisch.
»Wissts ja, wie er ist. Er hört nimmer gut«, versuchte er auszugleichen.
»Der hört ganz gut, da täusch dich nicht«, widersprach der Landthaler ärgerlich.
»Schon«, wusste der Stadler, »aber er kanns nimmer deuten.«
»Was für eine Krankheit das ist«, schüttelte der Wirt den Kopf, »hört und sieht, aber kanns nimmer deuten.«
»Die Krankheit hast du auch hie und da«, stichelte der Stadler boshaft. Der Wirt lachte.
»Aber bloß dann, wenn du ein halbes Jahr bei mir anschreiben lasst, nicht ans Zahlen denkst und allerweil noch eine Halbe willst!«
»Dafür kommst auch in den Himmel, Nauferger. Ist dir das gar nichts wert?«
»Und das verdank ich dann dir, Stadler.«
»So ist es. Selig sind, die die Durstigen tränken, heißts in der Heiligen Schrift.«
»Jetzt spiel!«, unterbrach der Landthaler ungeduldig. Der Stadler überlegte einen Augenblick, zog eine Karte und schlug sie auf die Tischplatte.
»Liegt schon!«
Der Landthaler betrachtete mit zusammengekniffenen Augen sein Spiel und überlegte. Er wirkte angestrengt.
»… ich lüg euch nicht an!«, brabbelte der Alte.
Das Gesicht des Bauern wurde krebsrot. Heftig stand er auf. Sein Stuhl kippte und polterte zu Boden.
»Wegmacher!«, schrie er unbeherrscht. Der Wirt sah alarmiert auf.
»Spinn dich aus, Landthaler«, sagte der Stadler ruhig, »was regst dich denn eigentlich gar so auf?«
»Warum ich mich aufreg?«, japste der Landthaler. »Weil ich dem Wegmacher seine erstunkenen Geschichten nimmer hören kann.«
»Hörst halt nicht hin! Aus! Hast doch sonst nichts gegens Geschichtenerzählen!«
Der Landthaler erstarrte. Sein Blick flirrte. Auf seiner Schläfe bildete sich eine wurmartige Geschwulst. »Was … was willst damit sagen?«, fragte er rau.
Der Stadler tat unschuldig. »Gar nichts. Bloß, dass du doch auch hie und da gern Geschichten erzählst.«
»Landthaler! Stadler!! Aufhören!« Der Wirt hatte das Wischtuch zur Seite geworfen, kam an den Tisch geeilt und versuchte, die beiden Männer auseinanderzuzerren. Ein klobiger Faustschlag, der eigentlich dem Stadler gegolten hatte, traf seine Schulter. Er taumelte zurück.
Die Tür der Gaststube fiel krachend in das Schloss.
»Hörts auf!«, keuchte der Wirt.
»Das mein ich auch.« Wachtmeister Kaneder trat langsam in die Mitte des Raums, schob seine Brille mit der Fingerspitze zurecht und kratzte sich seinen hinter dem Kragen nässend geröteten Hals. Der Landthaler richtete sich mürrisch auf.
Der Ortspolizist musterte ihn streng. »Wegen was wird da schon wieder gerauft?« Der Bauer schniefte verletzt und schwieg. Langsam griff er in seinen schütteren Schopf und schob einige siechfarbige Strähnen, die ihm über die Stirn gefallen waren, zurück. Kaneder wandte sich mit fragendem Blick an den Stadler. Dieser zuckte die Schultern.
»Nichts«, räusperte er sich, »ich … ich hab ihm bloß gesagt, dass es seltsam ist, dass er allerweil, wenn er mit dem Mischen dran ist, hernach den Herzkönig kriegt.«
Der Reither nickte erleichtert.
»Ist überhaupt nicht wahr«, knurrte der Landthaler.
Kaneder verstand. »Dann sag ich euch, dass jetzt gleich Sperrstund ist und ich den Holzköpfen, die ich das nächste Mal wieder beim Raufen erwisch, eine saftige Straf aufbrenn! Haben wir uns?« Er hob die Stimme. »Ob ihr mich verstanden habt?«
Die beiden Streithähne nickten widerwillig. Der Reither griff nach den Karten, stand auf und legte das Päckchen auf eine Ablage neben dem Schanktisch. »Heut war’s wieder gemütlich!«, sagte er ernüchtert und griff nach seiner Jacke.
Auch der Landthaler zog sich an. Der Reither befand sich bereits im Hausgang. Wortlos verließen die Bauern die Stube.
Der Wachtmeister wandte sich an den Wirt.
»Und deine gspaßigen Logiergäst? Sind die eigentlich schon daheim?«
»Den Notari von München, meinens? Der ist schon längst oben in seiner Kammer«, sagte der Wirt. »Ist was mit dem?«
Kaneder schüttelte unwillig den Kopf und drehte sich um.
»Und der Wegmacher?«, sagte er milder. »Mag Er nicht heimgehen? Zeit ists.«
Der alte Bauer regte sich nicht.
»Keine Geschichterl heut, Wegmacher?«
Der Wachtmeister wartete die Antwort des bockig dreinblickenden Alten nicht ab, kratzte sich wieder hinter seinem Kragen und verabschiedete sich.
Der Alte schwieg auch noch, als ihn der Wirt wenig später vor die Tür führte. Mit unsicherem Schritt trat er aus dem Kegel des von Mücken berannten Hauslichts und verschwand in der Finsternis. Vom fernen Altwasser am Flussgrund quakten Frösche.
Der Wirt drehte den Schlüssel und löschte das Licht. Als er kurz darauf die Treppe zu seiner Schlafkammer emporstieg, sich in ihr entkleidete, das Federbett zurückschlug und sich schwer auf sein Lager fallen ließ, dachte er noch einen kurzen Augenblick an die Geschichte, die der Alte hatte erzählen wollen. Dabei schlief er ein.
2
Als die Magd an diesem Spätnachmittag im August des Jahres 1904 mit käsigem Gesicht zur Reitherrin in den Stall trat und ihr stumm den leeren Wassereimer zeigte, wusste die Bäuerin sofort, dass etwas Ernstes geschehen sein musste. Der Hausbrunnen war nun endgültig trocken, und der in die Tiefe gelassene Eimer scheppernd auf Stein gefallen.
Bald darauf versiegten auch die Brunnen von Wengen und Oberroth. Die erst vor wenigen Jahren verlegte Bleirohrleitung, die das Wasser der Elskirchner Quelle zu den Weilern über dem Inn führen sollte und aus der zuletzt nur noch ein rostig braunes Rinnsal geflossen war, gab schon seit Wochen keinen Tropfen mehr ab. Auch der Gruber hatte bereits aufgegeben und die Hunde, die seine Pumpe antrieben, aus dem Geschirr gelassen.
Als vom Grund des Hungerbrunnens im Wolfspeuntner Wald feuchter, von Mückenschwärmen umtoster Morast glitzerte, erschraken die Bauern zutiefst. Von ihren Vorfahren wusste sie, dass Feuchtigkeit in dieser Grube, die in regenreichen Zeiten stets trocken war, eine noch größere Dürre voraussagte.
Schließlich war auch der Burgstaller Bach ausgetrocknet, und die Mühle im Höllgraben musste stillgelegt werden. Die Bauern suchten den Pater Prosper auf und baten ihn um die Abhaltung des Regengebets. Kurz flammte der alte Streit zwischen der »Bruderschaft zum guten Tod« und dem »Jünglingsverein« auf, in welcher Pfarrei dieser Gottesdienst abgehalten werden sollte. Die Auseinandersetzung wurde jedoch sofort erstickt, denn kein vernünftiger Mensch konnte widersprechen, dass allein die heilige Elisabeth und damit das alte Elskirchner Gotteshaus zuständig waren.
Das gotische Kirchenschiff war überfüllt, als der aus dem Kloster Sarzhofen herbeigeeilte Augustinerpater das alte Regengebet vortrug. Doch die Orgel, deren Holzverkleidung in der wochenlangen Trockenheit geschrumpft war, gab keinen Ton mehr von sich. Auf der Heimkehr begegneten die erschöpften Wallfahrer den Fuhrwerken der Wasserträger. Auf ihre keuchenden Rösser einschlagend, bis hoch über den Kutschbock in Staub gehüllt, waren sie nahezu Tag und Nacht unterwegs, um das rettende Nass zu den Höfen zu bringen.
Die Gebete waren vergeblich gewesen. Die einst üppigen Bauerngärten verdursteten, das Blattwerk der Obstbäume verlor seinen Glanz. Die Wiesen brannten aus. Die Grasnarbe wurde rissig, schälte sich, hungriges Federvieh kratzte auf der Suche nach Engerlingen den brockigen Boden auf. Aus einst blühenden Feldern wurden staubgraue Äcker. Um die Augustmitte mussten bereits die Heustöcke angegriffen werden, um das Vieh zu füttern. Doch für den Schäfer von Aschpoint stellte sich die Frage, was im Winter werden würde, nicht mehr. Er bestritt, betrunken gewesen zu sein, und gab statt dessen an, von Erschöpfung überwältigt in seinem Karren eingeschlafen zu sein, als seine Herde in die sumpfigen, von den Mäandern des Höllbachs durchzogenen Nasswiesen ausgebrochen war. Erbärmlich waren die Tiere verendet. Man hatte den Schäfer mit Schlägen vom Hof gejagt.
Die neuen Tage zeigten im ersten, zitronenfahlen Licht, dass wieder kein Regen zu erwarten war. Binnen kurzer Zeit wälzte sich erneut schmutzige Hitze über das Land. Übergossen mit glühender Luft lag es um die Mittagszeit längst benommen unter einer brütenden Sonne. Dann und wann schob sich ein heißer Windstoß durch das papieren wispernde Korn und kippte es, ohne Widerstand zu erfahren, aus der mürben Krume.
Nur der Marktflecken Sarzhofen, auf einer kleinen Erhebung zu Füßen des höheren Klosterhangs gelegen, hatte noch Wasser. Die fetten Gärten am Innhang, geschlämmt von einer Ableitung des Klosterbachs, widerstanden der Hitze.
Doch auch hier litten die Menschen unter der Hitze und dem Staub, den das Umland über den Markt geworfen hatte. Die Alten atmeten schwer durch rissige Lippen.
Es war Mittag. Die Menschen, die den baumlosen Platz in der Ortsmitte überquerten, bewegten sich langsam; kein Luftzug regte sich. Es war still. Rufe versanken taub, das Platzen des Kalkputzes von den Häuserwänden klang wie das Brechen verdorrter Äste. Der Wirt des Gasthofs »Zum Nauferger« riss in einem Moment der Verwirrtheit die Tür der Standuhr auf, dessen Ticken ihn zu schmerzen begonnen hatte, und hielt das Werk an.
Am späten Nachmittag schienen Ort und Hügelland friedlich zu dösen. Die Schatten wuchsen. Kaum war die Nacht zum Sonntag hereingebrochen, begann die Erde zu dampfen. Das Pflaster glänzte bleiern, und um Mitternacht stiegen vom Inn violette Nebelschwaden empor. Es wurde augenblicklich kühler. Als sich die letzten Besucher des »Nauferger« auf den Heimweg machten, in der Mitte des Marktplatzes nach oben sahen und betrunken die schneidende Luft kosteten, stand über ihnen, kaum anders als in den Nächten zuvor, der Nachthimmel wie kalt glimmender Granit. Die Tritte der Heimkehrer verloren sich in der Stille. Grillen zirpten kraftlos. Das Land fiel in Schlaf.
Niemand sah, wie kurze Zeit danach im Norden ein tonloses Leuchten über die Hügelketten eilte. Ein ferner, samtener Donner folgte. Nun herrschte völlige Stille. Wieder flammte das fahle Leuchten auf, und wieder, doch nun in kürzerem Abstand, war ein tastendes, zögerndes Poltern, das wie das Fallen eines Holzstoßes klang, zu vernehmen.
3
Es kam kein Tag. Die Sonne kämpfte irgendwo hinter dem östlichen Horizont, warf ein krankes Gelb und erstickte dämmernd. Entlang der Flusslinie hatten sich Schicht um Schicht die fetten Quader einer Wolkenwand in maßlose Höhen getürmt. Noch immer schien die Wand zu wachsen, noch immer stand sie nahezu unbewegt wie eine erstarrte Flutwelle.
Binnen Sekunden platzte das Gebilde. Eigroße Hagelbrocken explodierten auf Pflaster und Dachpfannen, spratzten knallend ab oder durchschlugen die Dächer. Kräftige Laubbäume bogen sich unter den Sturmstößen und brachen ergeben, die Fichten rissen im Fall ihr flaches Wurzelwerk aus dem Erdreich, Scheunen zerlegten sich Brett um Brett oder purzelten wie Würfel über das Feld. Durch die silbrige Schraffur des zur Erde jagenden Eises waberten die Blitze. Das Wettergeläut der Pfarrkirche winselte gegen den Tumult, bis der Orkan unter die zerschlagene Dachhaut des Turmes fuhr, dessen Spitze abriss und Schindeln, Gebälk und Mauerwerk in die Tiefe prasseln ließ. Bedrohlich ächzte das Bundwerk der Stallungen der freistehenden Gehöfte. Die windig gebaute Stallung des Wegmacher-Gütls krachte zusammen und begrub, was darunter lebte.
4
Fast beiläufig hatte sich das Unwetter gelegt. Ohne große Eile war es nach Nordosten gestapft. Der Wind wurde schwächer, dann legte er sich ganz.
Es war still. Das zerdroschene Land rauchte. Die Luft war kühlfeucht und klar und roch nach Winter. Der Himmel blieb grau, von Westen näherte sich ein sanfter Regen. Bis zum Herbstbeginn sollte er sich nicht mehr verziehen.
Natürlich hätte man die Leiche des Fuhrknechts Alois Eglinger irgendwann entdeckt. Wenn nicht an diesem Tag, dann am nächsten. Sie wurde so früh gefunden, weil sich der Nauferger beim Kirchbäck darüber beschwert hatte, dass das sich sulzig zersetzende Eis auf der Gasse zwischen beiden Gebäuden begann, den Weinkeller des Gasthauses unter Wasser zu setzen. So schickte der Kirchbäck seinen Lehrling, und dieser war es, dem diese eigenartige, blassrot emporgestiegene Fläche aufgefallen war und der, nach wenigen Schaufelstichen, den Körper des Fuhrknechtes entdeckte.
Wachtmeister Sinzinger, den man vom Dach der Ortsgendarmerie holen musste, wo er die zerschlagenen Dachpfannen inspiziert hatte, begann kurz darauf mit seinen Untersuchungen. Er tat es widerwillig. Irgendetwas sagte ihm, dass diese Angelegenheit unangenehm werden würde, obwohl alles, was ihm aufgeregt mitgeteilt wurde, auf einen Wirtshausstreit mit tragischem Ausgang hindeutete. So etwas kam nicht eben häufig, aber doch hin und wieder vor. Der letzte Mord im Gebiet der Sarzhofener Gendarmerie – eine Magd war im Wolfspeuntner Wald erschlagen und ausgeraubt worden – war lange vor Sinzingers Amtsantritt geschehen, und außer der nie ermittelten Todesursache eines Säuglings in der Nachbargemeinde, den die Mutter, eine unverheiratete und offenbar geistig etwas labile Magd, versehentlich im Schlaf erdrückt hatte, konnte er sich an keinen Fall in dieser Gegend erinnern, der nicht binnen weniger Stunden hatte aufgeklärt werden können.
Der Wachtmeister überlegte, wie er seinen Bericht beginnen sollte. Er war, nachdem er die Leute mit einem »Wenn er schon tot ist, pressierts eh nicht mehr« zu beruhigen versucht hatte, in die Amtsstube gegangen, hatte dort seinen Rock angezogen, seinen Säbel umgeschnallt, seinen Helm aufgesetzt und sich auf den Weg gemacht.
Der Schauplatz des Verbrechens, die vom Marktplatz zum Innhang führende Gasse zwischen dem Gasthaus und der Bäckerei, war nur wenige Minuten von der Station entfernt. Nachdem er die Neugierigen zurückgescheucht und sich schnell vergewissert hatte, dass der Fuhrknecht an mehreren Messerstichen in Brust und Hals gestorben sein musste, wurden die Umstehenden von ihm befragt, ob einer von ihnen etwas berichten könne, das mit diesem Vorfall zusammenhinge. Man schüttelte den Kopf. Außer dem Wirt hatte sich keiner der Anwesenden in der vergangenen Nacht im Gasthaus aufgehalten. Der Nauferger gab zögernd an, dass der Ermordete am Abend zuvor einige Halbe Bier getrunken, die Gaststätte jedoch kurz nach Mitternacht verlassen habe.
»Als Letzter?«
»Ja …« Die Erklärungen des Wirts wurden dadurch unterbrochen, dass der Dorfarzt mit offen fliegendem Mantel durch den Eismorast herbeigeeilt kam und sich wortlos der Leiche widmete. Respektvoll wich die Menge zurück.
Der Wirt fügte noch hinzu, dass der Tote als streitsüchtig gegolten habe und dass es beinahe täglich zu kleineren Auseinandersetzungen, die jedoch schnell wieder beigelegt waren, gekommen sei. Der Doktor unterbrach ihn.
»Der Mann ist seit etwa zwölf Stunden tot«, stellte er fest.
»Haben Sie berücksichtigt, dass er unter dem Eis gelegen ist?«
Der Arzt lächelte nachsichtig. »Ich kann durchaus bis drei zählen, Herr Wachtmeister. Aber …«, er war aufgestanden und wischte sich die Eissplitter vom Knie, »… man braucht mich ja hier nicht mehr, nicht wahr?«
»Ist ja nur eine Frag gewesen, Herr Doktor.«
»Schon recht.« Der Arzt knöpfte sich umständlich den Mantel zu.
Der Gendarm dachte nach. Vor zwölf Stunden. Kurz vor Sonnenaufgang. Was suchte der Fuhrknecht um diese Zeit in der Gasse?
Der Mesner hob den Zeigefinger. »Der Eglinger ist ein rechter Weiberer gewesen«, stieß er eifernd hervor. »Es hat so gehn müssen mit ihm.«
»Was du alles weißt …«
»Ich seh halt auch noch was anderes als Teig und versalzenes Mischbrot, Bäck.«
»Mit dir bigottem Hanswursten red ich gar nicht. Aber, Herr Wachtmeister …«
»Was, Bäck?«
»Der Doktor muss sich getäuscht haben.«
»Warum?«
Der Bäcker fühlte den missbilligenden Blick des Arztes. »Weil ich … dann ja was gehört haben müsst. Ich bin jeden Tag schon um halb vier wach, auch wenn ich nicht in die Backstuben muss. Ich hätt was hören müssen – aber ich hab nichts gehört. Bloß, wie auf einmal das Wetter angefangen hat, hab ich gehört.«
»Und das hat angefangen, nachdem du aufgestanden bist?«
»Wenig später.«
»Da ist es also schon hell gewesen?«
Der Bäcker schüttelte den Kopf. »Da wär es hell gewesen!«, berichtigte er. »Wenn es ein normaler Tag gewesen wär. War es aber nicht. Es war stockfinster.«
Sinzinger verzog nachdenklich den Mund und blickte wieder auf das mit schwarzem Blut besudelte, durchweichte Bündel zu seinen Füßen. Der Tote lag mit dem Rücken nach oben. Die klaffenden, wächsern gerandeten Einstiche waren deutlich zu erkennen.
»Der markiert nimmer«, bemerkte der Schmied-Hansl nüchtern. Die Bäckin kicherte hysterisch. Ein Blick des Wachtmeisters brachte sie zum Schweigen.
»Was ist gestern auf Nacht passiert? Hat einer gesehen, mit wem der Eglinger gestritten hat? – Wirt?«
Der Nauferger schüttelte den Kopf. »Nein. Gestern war er sogar recht gut aufgelegt, der Alois. Hab mich schon gewundert.«
Der Landthaler, den in seiner Jugend ein schwerer Unfall mit dem Heuwagen weißhaarig gemacht hatte, schniefte grimassierend durch die Nase und entblößte seine tabakbraunen Zähne. Er schien zu überlegen, wie er beginnen sollte.
Der Arzt trat einen Schritt vor. »Herr Wachtmeister, ich wollte Ihnen nur noch sagen: Wie ich vorhin an der Gendarmeriestation vorbeigekommen bin, hab ich den Aichinger Martl dort stehen sehen. Er möcht eine Angabe machen, hat er gesagt.«
»Wird nicht so pressieren«, gab Sinzinger unwirsch zurück.
Der Arzt, der sich schon zum Gehen gewendet hatte, wiegte den Kopf und strich sich über seinen grauen Bart.
»Es hätte aber mit der Leiche hier zu tun, hat er gemeint.«
5
Kopiermeister Ostler hatte Grund zu guter Laune. Die deutsche Kinoindustrie hatte nach dem Krieg einen ungeheuren Aufschwung genommen; allein im vergangenen Jahr wurden nahezu sechshundert Filme hergestellt, und bereits jetzt, im Frühsommer 1924, konnte jede Wette darauf eingegangen werden, dass sich diese Zahl heuer noch einmal erhöhen würde. Ostlers Zukunft war gesichert. Vor seinem Häuschen in Planegg blühte der Flieder, und im Biergarten der Münchner Kindl-Brauerei, den er aus alter Anhänglichkeit hin und wieder aufsuchte, obwohl er sich längst nicht mehr dem gemeinen Münchner Proletariat zurechnete, rückten die jungen Frauen näher an ihn heran.
Natürlich liebte Ostler auch das Kino. Der Kopiermeister hatte lediglich einen persönlichen Geschmack und war davon überzeugt, dass nur dieser der richtige sei. Er, der seit der Gründung der Filmfirma Arnold & Richter im Werk an der Türkenstraße arbeitete, hatte sie alle kennengelernt, den geschäftstüchtigen Ostermayer, den verrückten Fey, den verträumten Jaffé und viele andere. Erfolge und Katastrophen hatte er beobachten können, auch Jaffés Verzweiflung miterlebt, als diesem mitten in den Aufnahmen zu seinem König-Ludwig-Film, für den der Regisseur sein ganzes Privatvermögen eingesetzt hatte, der Hauptdarsteller verstarb.
Der Kopiermeister, der gerade dieses Werk mit einer gewissen Zuneigung bearbeitete, sich aber ein Mitleiden bei allerlei Katastrophen schon früh abgewöhnt hatte, gab dem jungen Mann einen Tipp, den dieser dankbar annahm. Was er ihm riet, gab er, wenn sich Gelegenheit bot, gern zum Besten. »Gehns, Herr Jaffé«, wollte er gesagt haben, »dann nehmens halt einen anderen und machen mit dem einen zweiten Teil: Der König im Alter!« Mit tränenfeuchten Augen habe ihm der Regisseur gedankt und sei seinem Rat gefolgt. Dass jedoch Publikum und Kritik sich nicht vorstellen konnten, dass der edle König innerhalb weniger Jahre vom jugendlich aufrechten Zwei-Meter-Recken zum kleinwüchsigen und quergesichtigen Vierschröter mutiert sei, erwähnte Ostler, wenn überhaupt, nur ungern.
Ebenso ungern erinnerte er sich auch an den Besuch jenes Frechlings aus Berlin, der sich an einer Bergfilmkomödie versuchen wollte und deutlich zeigte, dass er seine belichteten Rollen nur gezwungenermaßen in München bearbeiten ließ. »Mein Herr«, wollte Ostler ihm gesagt haben, »Sie dürfen uns schon glauben, dass wir uns auskennen, wenn es um Bergsachen geht.« Worauf der aufgeblasene junge Mann geantwortet hätte, dass ihm die Berge schnurz wären, eine verkehrt gesetzte Kreisblende hingegen nicht. Der Kopiermeister hatte später befriedigt feststellen können, dass gerade dieser Film, eine verquere Groteske um die Liebe einer in den Bergen hausenden Räuberin zu einem eitlen Verführer, ein Reinfall wurde, und mit noch größerem Genuss durfte er nach wenigen Monaten verfügen, dass die Kopie dieses Films aus dem überquellenden Filmlager geworfen und auf die Müllhalde gekarrt wurde. Kopiermeister Ostler erinnerte sich ebenso ungern daran, dass der vorlaute Berliner einmal von seiner Hauptdarstellerin begleitet worden war, was die Zurechtweisung wegen der verpatzten Blende umso peinlicher gemacht hatte.
An dieses Erlebnis musste er denken, als er die Viragierung der neuen Filmkopien überprüfte. Eine steile Falte bildete sich zwischen seinen Brauen.
»Wer hat die Negri eingetaucht?«, brüllte der Kopiermeister, »Kajetan?! Warst epper du das?«
Der Angesprochene, eine erst vor wenigen Wochen eingestellte Hilfskraft, antwortete vom anderen Ende der Reihe von Färbebottichen.
»Die wen?«
»Geh her da!«, herrschte der Meister. »Wirds bald?«
Der Gehilfe kam. Ostler hob einen Streifen gegen das Mattlicht, deutete mit dem behandschuhten Finger darauf und sah den Kopierwerkshelfer streng an. Ein grauer Arbeitsmantel umschlotterte den nicht sonderlich großen, ziegenbärtigen Mann.
»Was … was ist damit?« Kajetan verstand nichts.
»Wer die Negri eingetaucht hat, habe ich gefragt! Red ich böhmakisch?«
»Die Negri? Das war ich.«
»Natürlich. Wer denn sonst? Und wieso …« Der Kopiermeister legte die Rolle auf den Tisch und verschränkte die Arme, »… hast die Negri blau gemacht?«
Kajetan ahnte, dass Ostler, dessen Gesicht rot angelaufen war, kurz vor einem cholerischen Ausbruch stand. Aber noch immer begriff er nicht, was den Meister so erregte.
»Aber …«, sagte er unsicher, »so ist es doch draufgestanden in der Färbnotiz vom Teobalt.«
Ostler holte Luft. »Der Herr Teobalt ist nicht der Chef da herinn!«, brüllte er unbeherrscht. »Da herinn ist der Teobalt ein kleines Würsterl und hat da gar nichts zum melden. Teobalt?! Da her!«
Er wandte sich nicht um, als wenig später ein blassgesichtiger, hochgewachsener und hagerer Mann mittleren Alters mit bestürzter Miene an den Tisch trat.
»Herr Teobalt«, in Ostlers Stimme mischten sich Zorn und Hohn, »wie kommt Er drauf, dass die Negri blau werden soll?«
»Ich …«, stotterte der Mann eingeschüchtert, »ich hab’s so übertragen, wie es in den Notizen des Regisseurs steht. Sehns selbst …« Er blätterte aufgeregt in einem Stapel Papier.
Ostler wandte sich ihm zu und kippte seinen Kopf in den Nacken. Streng fixierte er den Blick Teobalts.
»Und was hab ich Ihm gesagt? Ha?«
»Sie sagten: rose. Aber ich dachte, dass das ein Irrtum sein muss, weil …«
»Irrtum?«
»Pardon …, aber …«
»Ist das eine Zimmer-Szene oder nicht?«
»Schon …, aber …«
»Und gehört nicht eine Zimmer-Szene rosé eingetaucht?«
»Schon …«
»Schon was, Teobalt?«
»Es … ist doch aus dem Zusammenhang erkenntlich, dass es sich um ein unbeleuchtetes Zimmer handelt, also …«
Ostlers Augen hatten sich verengt.
»Er verdient bei mir offenbar so gut, dass Er alle daumlang ins Kino rennen kann?«
»Nein«, entgegnete der junge Mann, »alle daumenlang nicht. Aber dieser Film …«
»… ist ein Krampf, nebenbei gesagt!«
Emil Teobalt stand schmal und fest vor Ostler. Nein, meinte er, dieser Film sei ein Meisterwerk. Der Kopiermeister explodierte.
»Weißt du, was dabei ist, wenn ich dich das nächste Mal das Lager ausräumen lass, damits auf den Geraffelhaufen geschmissen wird, wos hingehört? Da ist ›Die Flamme‹ vom Herrn Ludwig dabei, das garantier ich dir! Und noch ein paar andere parfümierte Judensauereien!«
Teobalt schwieg.
»Und was die Färbung betrifft, mein Lieber, da lass Er sich ein für allemal gesagt sein: Der Tag ist gelb, die Nacht ist blau, und ein Weibsbild im Zimmer ist rosé! So war es, so ist es, und so wirds anders nie sein.«
Teobalt hob die Schulter und wich dem Blick des Meisters aus.
»Wir machen das nämlich so, wie wir das allweil machen«, fuhr Ostler fort, »und nicht, wie irgendein Herr Ludwig das meint! Als ob der wüsst, was die Leut wollen.«
»… Lubitsch«, korrigierte Teobalt ergeben.
»Ha?«
»Nicht Ludwig – Lubitsch!«
Auch Kajetan nickte.
»Egal!« Ostler machte eine ärgerliche Handbewegung. »Von dem hört man eh bald nichts mehr, weil die Leut dem seine Krämpf nimmer sehn wollen. Genauso wenig, wie das Zeugs vom Plumpe, vom Reinhardt und wie die geblähten Gackerl noch alle heißen.« Er hob den Zeigefinger. »Das Publikum, das merkens Ihnen, das hat allweil recht!«
Teobalt räusperte sich. »Bitteschön, mir gefällts.«
»Tja«, sagte der Kopiermeister lauernd, »das ist so eine Sach mit dem Gefallen, Herr …«
Teobalt übersah die Signale. »Das ist wahr«, stimmte er zu.
Ostlers Stimme klang nun ruhig. Kajetan, der sich während des Streits wieder zu einem der Färbebottiche zurückgezogen hatte, horchte auf.
»Weißt«, fuhr der Kopiermeister fort, »mir gefallt zum Beispiel nicht, dass Er allerweil grad extra anders tut als wie man Ihm sagt.«
»Aber es ist doch der Wille des Regisseurs …«, beharrte Teobalt ahnungslos.
Ostler holte Luft. »Und mein Wille ist, weißt du, was? Dass du dich schleichst!« Seine Stimme überschlug sich. »Auf der Stell! Sie sind entlassen, Herr! Teobalt! Ihre Papiere liegen bereit! Schon seit einiger Zeit!«
Kajetan erschrak und senkte die Rolle, an der er gerade gearbeitet hatte, in den Bottich zurück. Teobalt löste sich langsam aus seiner Versteinerung und wandte sich um.
»Bleib da, Emil!« Vergeblich versuchte Kajetan seinen Kollegen, der sich bereits zur Tür des Färbesaales begeben hatte, aufzuhalten.
»Das könnens doch nicht tun, Herr Ostler …«, versuchte er zu vermitteln.
Der Kopiermeister kniff die Augen zusammen.
»Ah so?«, sagte er sanft. »Das kann ich nicht?«
6
Seit dem Ende des Frühjahrs hatte es fast ohne Unterbrechung geregnet. Seit Wochen dämmerte die Stadt unter einem dichten Nebeltuch, und die Stadt, längst in stumpfgraue Farben getränkt, hatte zu stinken begonnen. Sie roch nach schimmelndem Mauerwerk, nach Rauchfeuer, Küchengerüchen, dem von Tritten und Wagenrädern zermahlenen Pferdekot und dem von fauligen Abfällen geschwängerten Dampf der Tage. Früh dunkelte es, und nur in den Nächten schien sich der schweißige Brodem der langsam verpilzenden Stadt in das Erdreich zurückzuziehen. Zwar hatte sich hin und wieder ein Morgen strahlend geöffnet; doch spätestens dann, als sich die Straßen mit schlafblindem, unfroh fröstelndem Volk füllten, Trambahnwaggons auf ächzenden Geleisen Tausende an ihre Arbeitsstellen beförderten und die Schutzgitter der Läden keckernd zur Seite geschoben wurden, hatte sich wieder eine regenschwangere, filzig undurchdringliche Wolkenmatte über die Gassen, Straßen und Plätze gesenkt. An manchen Tagen stand die Luft unbewegt; milder Faulgeruch wuchs aus den Pflasterritzen, das Unkraut wucherte. Vor Nässe geschwollen trieben Bäume und Sträucher aus.
Nach regelmäßigen Wolkenbrüchen, in deren Folge die Isar binnen weniger Stunden zum tobenden Wildfluss anschwoll und sich die donnernde, lehmige Flut an den steinernen Brückenpfeilern brach, war die Luft würzig und kühl. Befreiung kündigte sich an; die Wolkendecke hob sich und stellte in den kurz geöffneten hellen Feldern eine Idee der darüber liegenden Bläue aus, fing an ihren zerfetzten Rändern schwefeliges Licht und schien nach Norden zu treiben. Doch kaum waren die dunklen, bauchigen Gebilde zum Horizont gesegelt, hatte der Himmel sich wieder geschlossen.
Der Nieselregen tappte geräuschlos auf Dächer, Hüte, Blattwerk. In den Ausläufen der Regenrohre rauschte es gleichförmig, Abfall und abgefallene Blätter trieben in dünnen Rinnsalen in das Dunkel der Kanalisation. Die Fäule kroch hinter den Stuck der neubarocken Fassaden der Bürgerhäuser, salzige Mineralien sprengten den Verputz von den Hauswänden. Fleckiger Aussatz blühte an den Fundamenten, feuchtschwarzes Moos dehnte sich aus allen Fugen, weitete sich zu flächigen Flechten, zerfraß den Mörtel zu erdiger Konsistenz, bis er dem unablässig rieselndem Regen keinen Widerstand mehr bot. Die unbefestigten Gassen zwischen den ärmlichen Vorstadthütten in Haidhausen und der Au hatten sich längst in schlammige Bahnen gewandelt; erdiger Schmutz und Kot, der aus den überlaufenden Kanälen schwappte, schwemmte über die Dielen in die dämmerigen Wohnhöhlen der Tagelöhner.
Über Wochen hatte sich nichts mehr verändert. Kein Wind war aufgekommen, kein Sturm hatte geklärt. Es regnete. Die Stadt triefte. Alles an ihr rieselte, sickerte, gluckste, und der zementfarbene Himmel erdrückte sie, nahm ihr den Atem. Die Enge der Straßen wurde drängender, die Gemüter trübe. Man hetzte. Es wurde wenig gelacht.
Die Fenster des dichtbesetzten Schwabinger Kaffeehauses waren bedampft. Emil Teobalt starrte auf die blinden Scheiben und nahm die milchigen Umrisse der draußen vorbeieilenden Passanten wahr. Er wandte sich wieder seiner Kaffeetasse zu und rührte gedankenverloren darin.
»Nein«, schüttelte er den Kopf, »das wäre nicht nötig gewesen.«
Kajetan zuckte die Achseln und lehnte sich zurück.
»Geschehen ist geschehen.«
»Was ist schließlich dabei herausgekommen? Ich bin entlassen – und Sie auch. Dabei hab ich neulich noch gelesen, dass sie in Amerika schon einen Farbfilm ausprobieren.«
»Tatsach?«
»Ja. Da wird nichts mehr viragiert werden! Da ist das Bild dann, wie die Welt ist. Das Gras grün, die Haut weiß oder braun oder gelb, das Blut rot und …«
»… die Weiber im Schlafzimmer?«
Teobalt lachte. »Stimmt! Wie sind die eigentlich?«
»Kommt drauf an.« Kajetan schmunzelte und hob vielsagend seine dichten Augenbrauen. Teobalt wurde wieder ernst.
»Hätte ich doch bloß mein Maul gehalten«, sagte er müde.
»Hinterher ist man immer gescheiter.« Kajetan nahm einen Schluck aus seiner Tasse.
»Bei mir scheint ja Hopfen und Malz verloren. Aber Sie! Was geht es Sie eigentlich an, wenn ich mit einem über Kreuz bin?«
»Gebens schon eine Ruh.« Kajetan setzte die Tasse auf. »Ich hab’s halt getan und werd schon wissen, warum.«
»Jetzt reden Sie Blödsinn. Sie wissen es nicht, genauso wenig wie ich.«
Kajetan fingerte nach seinem Kinnbart.
»Stimmt«, gestand er zögernd ein.
Teobalt beugte sich vor. »Der Stolz ist mit Ihnen durchgegangen, nichts weiter. Dass jemand ein wenig arm ist im Hirn und dann noch sein Maul aufreißt, das könnens nicht ertragen. Und deswegen tappens immer wieder rein in die Soße, genau wie ich. Aber wir vergessen dabei, dass man sich das auch leisten können muss.«
Kajetan musste es zugeben. »Aber wer kann raus aus seiner Haut?«
Teobalt schüttelte den Kopf. »Bei mir hab ich den Verdacht«, sagte er nachdenklich, »dass ich es gar nicht möcht.«
»Na sehens. Also Schluss mit der Trübsinnigkeit! Alles ist, wies ist. Und irgendeinen Zweck wirds schon gehabt haben.« Kajetan hatte die Stimme gehoben, als wollte er sich selbst von seiner Rede überzeugen.
Emil Teobalts Miene hellte sich auf.
»Aber das muss man Ihnen lassen«, gluckste er, »ein gutes Mundwerk haben Sie. Das tut mehr weh als manche Ohrfeige.«
Kajetan wehrte gespielt ab.
»Ich hab bloß gesagt, was wahr ist.«
»Aber den Ostler ein … wie haben Sie ihn genannt?«
»Ein blahts Schwundhirn, ein blahts!«
»… zu nennen, das ist …«
»Nichts als die Wahrheit.« Kajetan grinste.
»Schon. Aber wenns statt dessen freundlich gesagt hätten: Herr Kopiermeister, für mich sind Sie ein ausgesprochener Cerebral-Atropist, dann hätt er sich sogar noch was drauf eingebildet!«
Kajetan tat ernst. »Jetzt weiß ich endlich, wozu ihr Bourgeois Latein gelernt habts.«
Teobalt schmunzelte. »Und wozu? Sagen Sie’s mir?«
»Doch bloß dafür, damit man nicht gleich spannt, dass ihr genauso hinterfotzig sein könnts.«
»Allerdings!« Teobalt nickte sarkastisch. »Haben Sie eine Ahnung … Aber sagen Sie, was werden Sie jetzt tun?«
Kajetan hob die Schultern. »Mich nach einer neuen Stell umschauen, was sonst? Die zwiderne Würzen, bei der ich logier, hockt mir schon jetzt im Genick wegen der Miete. Und Sie?«
»Ich muss mir auch auf der Stelle eine neue Unterkunft suchen. Ich kann sie mir ja bereits jetzt nicht mehr leisten. Was Arbeit betrifft: Da werde ich dasselbe tun. Was sonst?«
»Eben.« Kajetan nahm einen Schluck aus seiner Tasse. Dann beugte er sich neugierig vor. »Aber sagens – Sie sind doch eigentlich ein Studierter?«
»Eigentlich schon.«
»Und man hat sich erzählt, dass Sie bei der ›Münchner Zeitung ‹ gearbeitet haben. Wieso fangen Sie statt dessen als Hilfsarbeiter im Kopierwerk an? Und wieso könnens das nicht wieder tun?«
Teobalt zögerte mit seiner Antwort. »Das wär eine längere Geschicht.«
Kajetan nickte ihm aufmunternd zu. »Wir haben ja jetzt Zeit, oder nicht?«
»Na, meinetwegen. Es stimmt. Ich bin, wie Sie sagen, ein Studierter und hab nach meinem Studium bei der Zeitung angefangen. Erst in Berlin, danach in Augsburg, zuletzt in München. Es ist immer ordentlich aufwärts gegangen, und nebenbei hab ich einige Bücher publiziert. Aber nur solange, bis mein letztes Buch – Buch ist übertrieben, es war eher eine dünne Broschüre – erschienen ist.«
»Worum ist es darin gegangen?«
Teobalt tat unschuldig. »Oooch …«
Kajetan grinste zurück. »Weiß schon. Lateinisch verpackte Unverschämtheiten. Hab ich recht?«
Sein Gegenüber wurde ernst. »Nein. Es war eine Broschüre, die ich für die deutsche Sektion der Menschenrechts-Liga verfasst habe.«
»Für wen?«
»Die kennen Sie nicht? Eine Schande – nein, nicht für Sie! Für die Liga! Haben Sie gar nichts mitbekommen von der Kampagne für Sacco und Vanzetti? Wirklich gar nichts?«
»Doch … ich erinnere mich. Waren das nicht … in Italien oder wo …?«
»Anarchisten?« Teobalt schien aufzuleben. »Nein. Es handelt sich um harmlose Gewerkschaftsmitglieder in den Vereinigten Staaten, die man zum Tode verurteilt hat. Sie haben wirklich nie davon gehört?«
Kajetan verneinte.
»Nicola Sacco und Giacomo Vanzetti sind …« Teobalt brach ab. »Lassen wir es. Ich erzähls Ihnen ein andermal. Zurück zu meiner Broschüre. Interessiert Sie es noch?«
»Erzählens schon!«
»In dieser Broschüre – es waren nicht einmal zwanzig Seiten und das Magerste, was je von mir veröffentlicht worden ist –, da habe ich nichts getan als aufzulisten, wie die Justiz des Deutschen Reichs mit linken und rechten Putschisten, also mit den Räteleuten einerseits und den Kapp-Putschisten andererseits umgegangen ist.«
»Öha«, sagte Kajetan ahnungsvoll.
»Sehr richtig. Bei der Aufrechnung der gegen beide Parteien ausgesprochenen Zuchthausstrafen bin ich auf ein leichtes Unverhältnis von 373 zu 0 Jahren gekommen. Welche Zahl zu welcher Seite gehört, überlasse ich Ihrer Phantasie.«
»Dreihundert … zu Null? Aber ist nicht der Eisner-Mörder zu lebenslänglich …?«
Aus Teobalts Stimme tönte leichte Ungeduld, als er Kajetan unterbrach.
»Von Zuchthaus rede ich! Und nicht von einem kommoden Festungsaufenthalt in Landsberg, in dem man sich einen eigenen Koch leisten kann und einen Salon, nobler als zuvor. Nebenbei, weil Sie grad von Lebenslänglich reden – haben Sie nicht mitgekriegt, dass der Graf Arco, der den Ministerpräsidenten erschossen hat, vor gut vier Wochen bereits wieder entlassen worden ist? Zum Ausgleich sitzt der Mühsam, der keinen umgebracht hat, noch immer. – Sie können den Mund wieder zumachen. – Aber wieder zurück: Kaum war das Büchlein veröffentlicht, brach die Hölle los. Private Details erspare ich Ihnen, beispielsweise, dass ich danach nicht mehr allzu lange mit der Tochter einer angesehenen Familie verlobt war, oder, dass ich seither an einer nicht völlig ausgeheilten Kieferfraktur leide.«
»Was ist passiert?«
»Ein Verein, der sich ›Wirtschaftsverein ehemaliger Angehöriger der Reichswehr‹ nannte und den ich der Konspiration gegen die Republik verdächtigt hatte, hat einen unwesentlichen Fehler entdeckt, mich verklagt und, nachdem ein Informant seine Aussage nicht beeiden wollte, diesen Prozess auch gewonnen. Meine Stelle in der ›Münchner Zeitung‹ – Sie wissen, dieses tapfere liberale Blatt – habe ich von einem Tag auf den anderen verloren. Ich hatte zwar ein paar Mark gespart. Danach aber war ich ruiniert. Und weil ich wohl nicht die besten Nerven hab, auch gesundheitlich.«
»Was habens denn?«
»Weiß nicht«, antwortete Teobalt niedergeschlagen. »Da ist … manchmal so eine unendliche Müdheit. Als könnt ich kerzengrad umfallen.«
»Aber …«
»Ich weiß, was Sie fragen wollen. Natürlich fühlte sich die Liga verantwortlich. Aber deren Macht reicht nicht weit. Man hat mir zugesagt, sich um eine Stellung für mich zu bemühen. Das war vor über zwei Jahren. Nichts hat sich getan. Ich …«, er sah aus dem Fenster, »… ich war auch hier wieder zu blöd. Als ich gemerkt habe, dass mich keiner meiner Kollegen bei der ›Münchner Zeitung‹ unterstützte, habe ich einige, sagen wir einmal, ganz und gar nicht-lateinische Worte gebraucht.«
»Was war blöd daran? Ich hätts nicht anders gemacht.«
»Nichts war blöd daran. Ich beklage mich nicht. Ich hab’s gewollt, ich hab’s getan, würds wieder tun. Und zahle dafür, c’est tout.«
Er klatschte mit der flachen Hand auf den Tisch. Das Geschirr klirrte leise. »Ich hab die Nase voll gehabt. Ich wollte nichts mehr mit diesem …«, er unterdrückte einen trockenen Husten, »… diesem Beruf zu tun haben. Nicht allein, weil die Kollegen mich, wie es drauf angekommen ist, im Regen haben stehen lassen. Nein, auch deswegen: Du kannst schreiben, was du willst und wie du willst, kannst es diplomatisch und verbindlich angehen oder so bös und scharf und verächtlich, dass man meint, die Seite, auf die es gedruckt wird, müsste in Rauch aufgehen. Es nutzt nichts, es ist alles Kasperei, und es ändert sich gar nichts. – Im Gegenteil, es scheint alles schlimmer zu werden.«
Kajetan hatte ihn besorgt betrachtet.
»Weiß nicht.« Er zuckte ratlos mit den Schultern. »Vielleicht kommts drauf an, was einer erwartet. Wenn man schon damit zufrieden wär, dass man denen, die der gleichen Meinung sind, das Gefühl gibt, damit nicht allein in der Welt zu sein … verstehens, was ich mein?«
Teobalt presste die Lippen aufeinander und lächelte gequält.
»Ja, ich weiß, was Sie meinen. Vielleicht haben Sie recht, und ich bin tatsächlich etwas größenwahnsinnig.«
»Haben Sie gesagt.«
Teobalt erwiderte nichts. Gedankenverloren rührte er in seiner Tasse, in der sich nur noch ein körniger Bodensatz befand. Die beiden Männer schwiegen.
»Schluss jetzt!«, sagte Teobalt entschlossen. »Ich rede und rede. Was ist eigentlich mit Ihnen? Haben Sie nicht auch früher in einem anderen Beruf gearbeitet? Eigentlich ist es schön, dass man sich endlich etwas mehr kennenlernt. Das Komische ist bloß, dass dafür zuerst was schiefgehen muss.«
Kajetan lachte leise. »Stimmt.«
»Also, was war Ihr früherer Beruf?«
»Polizist.«
»Gehens weiter! Sie?«, fragte Teobalt ungläubig.
»Doch. Zuletzt war ich Kriminalinspektor in Dornstein. Zuvor in München.«
Teobalt wiegte ungläubig den Kopf. Kajetan verzog den Mund zu einem bitteren Grinsen.
»Dann lassens mich raten, Herr … gehens, wir sind doch, die vier oder fünf Jahre, die ich Ihnen voraus hab, fast der gleiche Jahrgang. Sollten wir nicht endlich Du zueinander sagen, Herr Kollege? – Emil.«
Kajetan war damit einverstanden und nannte seinen Vornamen.
»… Ich rat«, fuhr Teobalt fort, »dass du nicht eben freiwillig ausgeschieden bist, Paul.«
»Nicht daneben.«
»Also voll drin. Erzähl, wieso?«
»Hab halt auch mein Maul nicht halten können.«
»Hätt mich auch gewundert. Wird aber wieder nicht vernünftig gewesen sein.«
Nein, das sei es nicht gewesen, bestätigte Kajetan und erzählte, dass er wegen Befehlsverweigerung und verleumderischer Anschuldigung gegen seinen Vorgesetzten entlassen worden war. Emil hörte aufmerksam zu.
»Wo liegt denn der Ort, an den man dich versetzt hat?«
»Dornstein? Das ist eine kleine Stadt im Südosten, in der Nähe der Grenze. Aber – lassen wir die alten Geschichten. Kriegst du eigentlich eine Unterstützung von irgendwo her?«
Teobalt schüttelte den Kopf.
»Du vielleicht?«
»Bei unehrenhafter Entlassung gibt’s nichts.«
»In meinem Beruf erst recht nicht. Außerdem – von den paar Mark, die es bei der Erwerbslosenfürsorge gibt, kann keiner leben.«
»Ein paar müssens scheinbar doch.«
Teobalt stieß den Atem durch die Zähne und nickte ernst.
»Ein paar? Die halbe Stadt muss es. Aber diese entwürdigende Prozedur erspar ich mir, solange es geht. Außerdem …«, wieder hustete er, »… solange einer arbeitsfähig ist, wie ich, gibt’s nichts.«
Kajetan kannte diesen Husten.
Es war dunkel geworden. Emil Teobalt legte einige Münzen auf den Tisch, bat Kajetan, für ihn zu bezahlen, und verabschiedete sich. Man würde sich wiedersehen, irgendwann.
Die Tür fiel zu. Kajetan fühlte sich plötzlich verlassen und versuchte, gegen die Unruhe zu kämpfen, die sich in ihm ausgebreitet hatte.
Seine Ersparnisse waren seit Monaten aufgebraucht, und der Rest des Wochenlohns, der ihm noch ausbezahlt wurde, würde nur noch wenige Tage ausreichen. Er brauchte Arbeit. Bald.
7
Ein seit Tagen anhaltender, kräftiger Südwind hatte den Himmel über dem Inntal geklärt, und schon weit vor Ödstadt, einem weniger als drei Zugstunden von München entfernten, schläfrigen Ort am unteren Inn, strahlte die Sonne. Doch hinter den massigen Mauern des alten Ödstädter Zuchthauses herrschte auch an diesem Morgen noch Dämmerung.
»Sperrens nicht hinter mir ab, Herr Bletz«, hatte der Geistliche auf dem Flur des Ödstädter Gefängnisses gebeten, »und bleibens bitte in der Näh. Wer weiß, wie er es aufnimmt.«
Der Wärter schloss die Zellentür auf und trat zur Seite, um den Gefängnisgeistlichen eintreten zu lassen. Er ließ die Tür einen Spalt offen und blieb davor stehen.
Der Gefangene erhob sich langsam und stierte den Priester fragend an. Seine Arme hingen nach vorne, der Kopf schien tief zwischen den Schultern zu sitzen. Sein ausgemergeltes, stoppelbärtiges Gesicht unter dem kurzgeschnittenen, altersgelben Haar war ausdruckslos. Der Pfarrer sprach leise.
»Mein Sohn«, sagte er salbungsvoll, »du musst jetzt fest an unseren Herrn Jesus denken.«
Der Angesprochene schien nicht zu verstehen und wandte sein Gesicht ab.
»Ich … habe die schmerzliche Pflicht, dich vom Ableben deiner Ehegattin zu unterrichten, mein Sohn.«
Die Lippen des Mannes bewegten sich kaum. »Vronerl …?«
»Ja, mein Sohn.«
Der Gefangene presste die Augenlider zusammen. »… Habs … gespürt …«, flüsterte er.
Der Priester nickte ernst, obwohl er die Worte nicht verstanden hatte.
»Der Herr sei ihrer armen Seele gnädig.«
Der Gefangene blieb in starr gebückter Haltung stehen. Als der Pfarrer seine Hand ausstreckte, um tröstend die Schulter des Mannes zu berühren, krümmte dieser sich jäh. Klatschend fiel er zu Boden.
»Herr Aufseher!«, rief der Geistliche erschrocken. Bletz war mit wenigen Schritten in der Zelle.
»Gehts wieder los«, sagte er ärgerlich.
»Sie sehn doch, dass er ohnmächtig geworden ist. Helfens ihm.«
Bletz packte den Gefangenen, schleifte ihn zu dessen Pritsche und wuchtete ihn schwer atmend hinauf.
»Das hat er früher alle daumlang gehabt«, sagte er ungerührt, »wenns mich fragen, markiert der.«
»Sinds nicht gar so harsch, Herr Bletz. Seine Frau ist gestorben. Hams gar kein Herz? Gehens! Holens den Doktor!«
8
Mit sturem Gleichmut hatte Kajetan seit Tagen versucht, wieder Arbeit zu bekommen. Es gab jedoch keine. Die Zahl der Erwerbslosen nahm zu, obwohl es – glaubte man dem Jubel der bürgerlichen Zeitungen – mit der Wirtschaft bergauf zu gehen schien.
Kajetan fühlte sich hilflos. Seine Wut hatte kein Ziel, sie zerschmolz zur Scham des Verlierers, und jede gutgemeinte, mitfühlende Freundlichkeit, mit der ihm hin und wieder begegnet wurde, verstärkte dieses fremde Gefühl.
Kajetan schlief schon seit Tagen unruhig. An diesem Abend stand er auf, machte mit verkniffenen Lidern Licht, setzte sich ratlos an den Tisch und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Er fühlte nur die Stille, die darauf zu warten schien, welche Idee er als nächste verwerfen würde. Er ging im Raum umher, um sie abzuschütteln, doch als er sich wieder setzte, erhob sie sich erneut und schien höhnisch darauf zu lauern, mit welch vergeblicher Bewegung er ihr Herr zu werden versuchte.
Endlich überwältigte ihn die Müdigkeit.
Es musste weit nach Mitternacht gewesen sein, als er mit einem heftigen Ruck erwachte. Verstört sah er im Dunkeln um sich; sein Puls raste. Er stand auf, zog sich hastig an und verließ seine Kammer. Als er mit eiligen Schritten aus dem Pechdunkel der Sterneckergasse ins Thal trat und die feuchte Nachtluft einatmete, beruhigte er sich ein wenig. Er ging langsamer. Die Turmuhr des Frauendoms schlug zweimal, das Geläute des Alten Peter und der Heiliggeistkirche gaben ein Echo.
Das breite Thal war menschenleer. Kajetan schlug seinen Kragen hoch und kreuzte seine Arme vor der Brust. Eine kalte Bö fegte gegen sein Gesicht.
Die Stadt schlief. Kajetan hörte nichts als das Klicken seiner Schritte. Mit einem Mal wurde der Wind heftiger. Ein taubes Donnern in der Ferne folgte, und ein gleichmäßiges Rauschen näherte sich. Erste Tropfen klatschten auf das Pflaster. Aus dem Himmel über dem Süden der Stadt kroch das weiße Geäst eines Blitzes. Als ihm ein nicht enden wollender Donner folgte, hatte der Wolkenbruch schon begonnen. Kajetan fluchte und begann zu laufen. Der Regen wurde heftiger. Als er die verschlossenen Marktstände am Viktualienmarkt erreicht hatte und unter einem Vordach Schutz fand, war Kajetan bereits völlig durchnässt.
Der Stand hatte einen Anbau, dessen Tür einen Spalt weit geöffnet stand. Ein schmaler Lichtstreifen flirrte über das Kopfsteinpflaster. Für Sekunden gaben Donner und prasselnder Regen Fetzen von Gelächter und Gesang frei. Kajetan trat neugierig näher.
9
Kajetan brauchte einige Zeit, um sich im rauchigen Dunst der Baracke zurechtzufinden. Schwaden verbrauchter Luft zogen an ihm vorbei ins Freie. Ein Mann, der der Türe am nächsten saß, zog die Schultern zusammen. Er wandte sich leicht und musterte den Ankömmling aus den Augenwinkeln.
»Mach die Tür zu, Baraber«, grunzte er, drehte sich wieder zurück, schob den Bügel von der Flasche und nahm einen Schluck.
Niemand schien von Kajetan Notiz zu nehmen. Er sah um sich. Der Raum wurde von einer schwachen Petrollampe beleuchtet, die von der Mitte der niedrigen Decke hing. An den Wänden standen leere Holzkisten. Die Männer, es mochten etwa ein Dutzend sein, hatten ein paar von den Kisten zu Sitzgelegenheiten verwandelt. Einige von ihnen saßen um einen provisorischen Tisch und schlugen ihre Karten auf die Bretter. Die größere Gruppe lagerte auf unterschiedlich hohen Obststeigen und unterhielt sich lautstark. Eine grüne Flasche kreiste.
Mehrere Männer schienen bereits betrunken zu sein. Rauchiger Atem stand vor den Gesichtern. Im Schatten hinter ihnen, abseits an der Rückwand und nahe eines zweiten Ausgangs, schnarchte ein greises, unkenntliches Etwas auf einer Pritsche, die, soweit man es erkennen konnte, aus zusammengestellten Kisten und einem lose darübergeworfenen Lumpenbündel bestand.
Einer der Männer sang. Er wurde von Zwischenrufen und grobem Gelächter unterbrochen. Ein anderer lallte die Worte des Liedes nach. Kajetan verstand wenig; noch immer prasselte der schwere Regen auf das Barackendach. Er setzte sich und schob die nassen Haare aus der Stirn.
Der Sänger, ein rundgesichtiger, gedrungen und kräftig gebauter Mann mit einem eigenartigen, bis unter das Kinn reichenden Halstuch hatte geendet, genoss den grölenden Beifall und nahm zufrieden einen Schluck aus der Weinflasche.
Als er den Kopf nach hinten neigte, fiel sein Blick auf Kajetan, wanderte zur Seite und kehrte zurück. Er setzte die Flasche ab, ohne getrunken zu haben. Das trübe Oberlicht fiel auf eine körnig vernarbte Stirn, wulstige Wangen und den mächtigen Keil der Nase. Seine Augen lagen im Schatten.
»Ah naa!«, sagte er.
Kajetan fror plötzlich. Seine Zähne klapperten. Er sagte sich, dass er sofort fliehen musste, und erkannte gleichzeitig, dass dies nicht mehr gelingen würde. Er senkte ergeben den Kopf. Als er ihn wieder hob, sah ihn der Sänger noch immer an. Der Blick schien ihn abzutasten, maß Kajetans Haltung, wanderte von der durchnässten Kleidung zu den Händen, die noch immer das umgeschlagene Revers des Mantels hielten, und blieb auf seinem Gesicht hängen. Er dachte an etwas, doch seine Miene verriet nichts.
Kropf-Kare war zurückgekehrt.
Der Regen war schwächer geworden; der Wind drückte gegen die Bretterwand. Das Pfostengebälk knarzte.
»Kropf! Verzähl eine Gschicht!«, krächzte der Besoffene.
10
Er steigt an einem Sommernachmittag auf den Wiesenbichl vor dem Hof, streckt dort vor Seligkeit die Arme gegen die Sonne und lässt sich in das Gras fallen. Die weiche Matte ist warm wie seine Wiege. Es ist dunkel geworden. Er steht auf und geht zum Haus zurück, betritt den düsteren Stall. Vorne stehen die Kühe, gleichmütig fühlen sie sein freundliches Tatschen, an der Seite scharren und grunzen die Schweine. Die Schaf- und Ziegenkoben stehen leer. Es riecht herrlich. Er verlässt den Stall, geht an der Seitenwand des Gütls nach vorne, vorbei am vor Nässe tropfenden Bauerngarten. Ein dunkler Gesang fliegt heran; der Wind zieht durch die Dächer.
Er liebt die Stille der Dorfkirche, liebt das Licht, das in gleißenden Stäben durch die bunten Fenster fällt. Seltsam sei er, sagt man, so seltsam. Und dann wandert er einmal, allein und ohne es Vater oder Mutter wissen zu lassen, zum Riesboden, hoch über dem Tal. Er geht auf das von mächtigen Kastanien beschattete Portal der vergessenen Einsiedelei zu. Ein Schatten schiebt sich über sein Gesicht, er betritt klopfenden Herzens den kalten, hohen Raum. Seine Augen weiten sich, glänzen. Er sieht nichts, hört nur noch das hallende, nackte Tappen seiner Sohlen auf den Steinplatten. Ein eigenartiger Zauber umfängt ihn, ihn schwindelt. Er hält den Atem an. Etwas wächst aus seiner Kehle, beginnt in ihm zu tönen.
Es hört erst auf, als er die Stimme eines Mannes vernimmt, der hinter ihm die Kirche betreten hatte. Er erschrickt. Der Mann ringt nach Worten. »Deine Stimme … deine Stimme …«
Wenig später stellt sich der Unbekannte dem verblüfften und misstrauischen Vater als Stellvertreter des Hofkapellmeisters Levi in München vor. Er sei hier zur Sommerfrische, beginnt er. Und, nachdem man dazu nur nickt, sagt er, dass der Junge über eine außergewöhnliche, ja gesegnete Stimme verfüge und er darum bitte, sich seinen Vorschlag anzuhören. Die Eltern überlegen lange, dann stimmen sie zu. Eines Tages, es war nach dieser schlechten Ernte, verlässt der Junge das Dorf. Er lächelt scheu beim Abschied. Bis die lärmende Woge der Stadt über ihm zusammenschlägt, weint er.
Alles um ihn ist jetzt schwarz und ernst. Doch wenn er singt, ist es ihm wie Atmen. Manchmal schließt er die Augen und sieht die Töne. Sie tanzen in der Luft, schwanken, torkeln fröhlich, steigen rasch auf, stehen wieder unbewegt und entfernen sich schwebend.
Erst ist da nichts als ein erbsweicher Knoten am Hals. Dann schwillt die Haut an und treibt die Adern nach außen, als schmatze ein fetter Wurm darunter. Die Ärzte verständigen sich mit mitleidslosen Blicken. Sie urteilen leise. Nichts hilft. Die böse Geschwulst wächst, wuchert, sie dehnt sich bald vom Kinn zum Brustbein. Je schöner der Gesang des Jungen wird, desto hässlicher wird sein Äußeres. Man gibt ihm Tücher, welche die schier platzende Fläche verbergen sollen. Nach Monaten sagt man, er dürfe wieder nach Hause zurückkehren.
Dort kriecht er zwischen die Tiere im Stall. Doch das Gelächter dringt durch alles. Er scheint sich zu ergeben, scheint sich nicht mehr zu wehren und wird älter und seltsam. An einem Tag im Winter starrt man ihn an, weil er zu singen begonnen hat. Er zieht sich an, wickelt sein Tuch und geht. Man will ihn halten, doch er schlägt plötzlich grob zu. Er wird erfrieren, sagen die Leute.
Er erfriert nicht. Er geht ohne Rast. Am Abend ist er in Landshut und betritt eine Gastwirtschaft am Fluss. Er suche Arbeit, er sei kräftig. Wenn du ein gut tust, sagt der Wirt, kannst bleiben. Aber bleib beim Vieh, die Leut erschrecken sich, und schau dich um auf Lichtmess.
Er hat jetzt keine Hand frei, trägt einen schweren Pfosten, den er im Wirtsgarten einrammen soll. Ein betrunkener Fuhrknecht zieht ihm das Tuch vom Hals, reißt die Augen erschrocken auf und bricht in boshaftes Gelächter aus, dem sich alle Gäste anschließen. Er nimmt den Pfosten und erschlägt den Knecht. Zwei Schutzleute werden gerufen. Sie gehen die hölzerne Treppe empor und öffnen die Tür zur Kammer. Er sitzt auf dem Bett. Sein Kopf ist auf die Brust gesunken. Einer der Gendarmen spricht ihn an und möchte von ihm wissen, warum er den Mann erschlagen habe. Könne er nicht hören? Sei er taub? Warum er … ach! Die Gendarmen befehlen ihm zu folgen. Einer der beiden, der jüngere, hält es für unnötig, ihn zu fesseln. Der Täter gehorche ja. Sie führen ihn durch die Gaststube, durch ein Getöse aus Drohungen und Beleidigungen. Sie sind bereits an der Tür des Gasthofs, als einer schreit: »Kopf-ab, Kropf-Kare!« »Maul halten!«, brüllt der junge Gendarm. Aber da ist er erwacht, packt die schwere Tür, drischt sie einem der Gendarmen an den Schädel und stößt den anderen um. Der erste Schutzmann bleibt benommen liegen, der andere verfolgt ihn. Es ist dunkel, rasche Fußtritte dort, ein Schatten hier. Sie sind sich immer nah. Sie rennen zwei Stunden.
Der junge Gendarm gibt auf. Er nimmt seinen Helm ab. Sein Herz rast, er ringt nach Luft, hustet hart. Sein erster Fall. Er hatte versagt.
11
Die Arbeiter sahen verwundert vom einen zum anderen. Die Kartenspieler legten ihr Blatt auf den Tisch.
»Was hast denn auf einmal? Kare?«
Der Sänger schwieg noch immer und hielt die Flasche vor seinen Lippen. Einer der Männer folgte seinem Blick.
»Was ist denn das für einer? Sag – was bist du denn für einer? He? Heda, Baraber?«
Der Betrunkene stieß Kajetan an. »Jetzt seh ichs erst. Der gehört nicht in die Altstadt.«
Ein zweiter war aufgestanden, hatte seinen Hut in den Nacken geschoben und sich hinter ihm aufgebaut.
»Was suchst denn bei uns, mitten in der Nacht? Schon gspaßig!«
Kajetan machte eine erschöpfte Handbewegung nach draußen.
»Was wohl? Ich … ich bin in der Sterneckergassen daheim, ich … hab nicht einschlafen können.«
»Ah geh! Sollen wir ihm dazu helfen?«, höhnte der Angetrunkene. Einer der Kartenspieler erhob sich gemächlich.
»Ich riech da was, und des schmeckt mir gar nicht.«
Kajetan öffnete den Mund.
»Ihr täuschts euch …«, stöhnte er hilflos. Er wollte aufstehen, doch eine schwere Hand drückte ihn nach unten.
Plötzlich schüttelte Kare heftig den Kopf.
»Lassts ihn aus!«, rief er.
Kajetan atmete aus und ließ seine Schultern fallen.
Kare machte eine Handbewegung. »Hockts euch wieder nieder, Manner. Biwi! Spiegel! Lassts den armen Tropf. Gehts wei … Hoj – wer kommt da noch?«
»Das Windradl!«, rief ein anderer. »Und … ja, da schau her!«
Die Tür war aufgeschoben worden. Ein großgewachsener Mann mit bis zu den Schultern reichendem Haar, das aber trotzdem kaum verbergen konnte, welcher körperlichen Eigenschaft er seinen Namen verdankte, trat gebückt unter den Türsturz. Ein junges Mädchen drängte ihm nach, schüttelte fröstelnd die Schultern und sah sich erstaunt um.
»Kropf!«, rief Windradl gut gelaunt. »Was ist los? Wird nicht gefeiert bei euch?«
Kare lachte polternd.
»Wir feiern alle Tag! Hock dich her! Wo kommst denn du her?«
»Vom ›Steyrer‹! Ich wollt doch einmal schauen, wies euch Krauterer geht.«
»Seit wann leits denn dir ein Bier beim ›Steyerer‹?«
»Wenn man sei Geld ned glei versauft, Spiegel«, lachte Windradl, »dann geht des durchaus.«
Kropf sah an ihm vorbei.
»Und des is …?«
»… des wär die Mia«, erklärte Windradl stolz und legte seine Hand um ihre Hüfte. Sie wand sich aus seinem Griff und lachte perlend.
»Sauber! Windradl, sauber!«, lallte der Betrunkene anerkennend.
»Hockts euch nieder!«, wies Kropf auf eine der Obststeigen und hielt dem Ankömmling seine Flasche entgegen. »Trink, Windradl!« Der Großohrige nahm einen tiefen Schluck. Das Mädchen stieß ihn lachend an.
»He! Lass fei no was über!«, tadelte sie.
Windradl hielt betroffen inne und reichte ihr die Flasche. Sie trank. Die Männer lachten anzüglich. Windradl sah drohend um sich.
»Tuts euch fei zusammenreißen!«
Einer der Kartenspieler, die wieder an ihrem Tisch Platz genommen hatten, drehte sich um. »Öha! Jetzt wirds aber nobel, unser Windradl!«
Wieder polterte Gelächter durch den Schuppen. Einer der Männer drehte sich zu Kajetan, der sich aufgerichtet hatte, zögernd an der Tür stehen geblieben war und unschlüssig in den prasselnden Regen geblickt hatte. Er hielt ihm die Flasche entgegen.
»Und du? Magst auch? Wir hätten dir ja fast unrecht tan!«
Kajetan war unschlüssig.
»Geh zu! Wirst doch nicht in das Sauwetter rausgehen!«
Kajetan ging auf ihn zu, setzte sich und nahm einen Schluck.
»Was … was habts denn geglaubt, was ich bin?«
»Nichts, Baraber, denk nicht mehr dran. Ah, wie sagst du dich nachert eigentlich?«
Kajetan nannte seinen Vornamen und wollte den des Fragenden wissen.
»Ich wär der Damerl …«
»Der Dotschn-Damerl!«, ergänzte ein anderer lachend. Die anderen fielen in das Gelächter ein. Damerl kümmerte sich nicht um ihn und beugte sich wieder zu Kajetan.
»Tust du da barabern auf dem Viktualienmarkt, oder was?«
»Nein …«
»Was nachert?«
»Jetzt grad tu ich – nichts.«
»Aha«, Damerl begriff, »nausghaut? Seh ichs recht?«
Kajetan nickte.
»Was solls dir anders gehen«, meinte Damerl achselzuckend und drehte sich wieder zu den anderen. »Sag an, Windradl! Seit wann karessierst du so saubere Weiber? Wo hast denn die aufgegabelt?«
Bevor der Langhaarige antworten konnte, tat es das Mädchen. »Mich gabelt keiner auf, Bursch!«, stellte sie klar, »wenn da wer gabelt, dann bin ich des!«
Spiegel puffte sie an. »Lasst mich einmal rein in deine Gabel?«
»Spiegel! Reiß dich …«, wollte Windradl warnen.
Das Mädchen unterbrach ihn. Sie warf ihr Haar nach hinten. »Da dazu brauchts Mannerleut! Keine Mäus!«
»Haaa!«, krähten die Männer. »Spiegel! Jetzt hat’s sie dir aber sauber eingeschenkt!«
Mia lachte mit. »Sagts, Manner, ihr habts so gspaßige Namen? Wieso heißt denn du ›Spiegel‹?«
Der Wein tat mehr und mehr seine Wirkung. Das Gelächter ließ die Baracke erbeben. »Wenn … haha …«, einer der Kartenspieler, ein untersetzter, bulliger Arbeiter mit narbigen Zügen, rang nach Atem, »wenn der Spiegel sein Hut aufhebt, dann siehst es! ›Haar‹, sagt er allweil, ›Haar brauch ma net!‹«
Mia übertönte das Gebrüll. »Und du? Wie heißt nachert du?«
Der Narbige schwieg betreten.
»Des … des is der Bladern-Biwi!«, lachte Spiegel boshaft. Mia kicherte. Biwi streifte sie mit einem grimmigen Blick.
»Also, bittesehr, gnä’ Fräulein«, fiel Kare dröhnend ein, »wenns gnä’ Fräulein erlauben, tät ich unsere noblige Gsellschaft einmal vorstellen.« Er zeigte auf einen der Kartenspieler. »Der da, des is der Indianer-Sepp, auch der ›Naserte‹ genannt. Warum, das ist ein Geheimnis!« Der Angesprochene grinste säuerlich und hob grüßend einen Finger zur Stirn.
»Was zahlst, Kropf, wenn ich jetzt mein Maul halt?«
»Gar nichts!« Kare lachte dröhnend und setzte die Vorstellungsrunde fort. »Der da, mit seinem gewesenen pechschwarzen Haar, das ist der Weißkraut, auch der ›Held von Ypern‹ geheißen, der daneben is der Moos-Michi.«
»Der Held von was?«