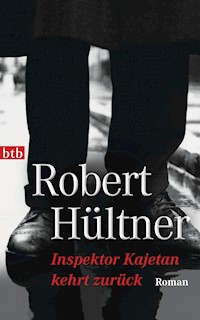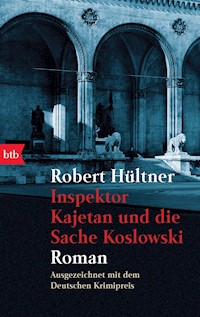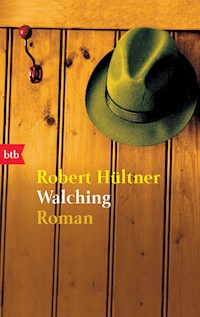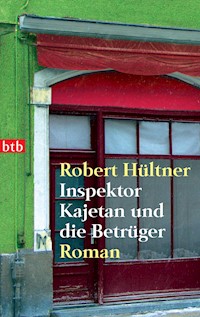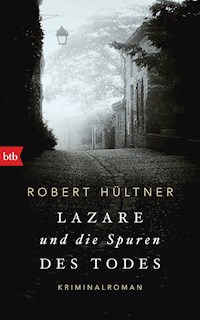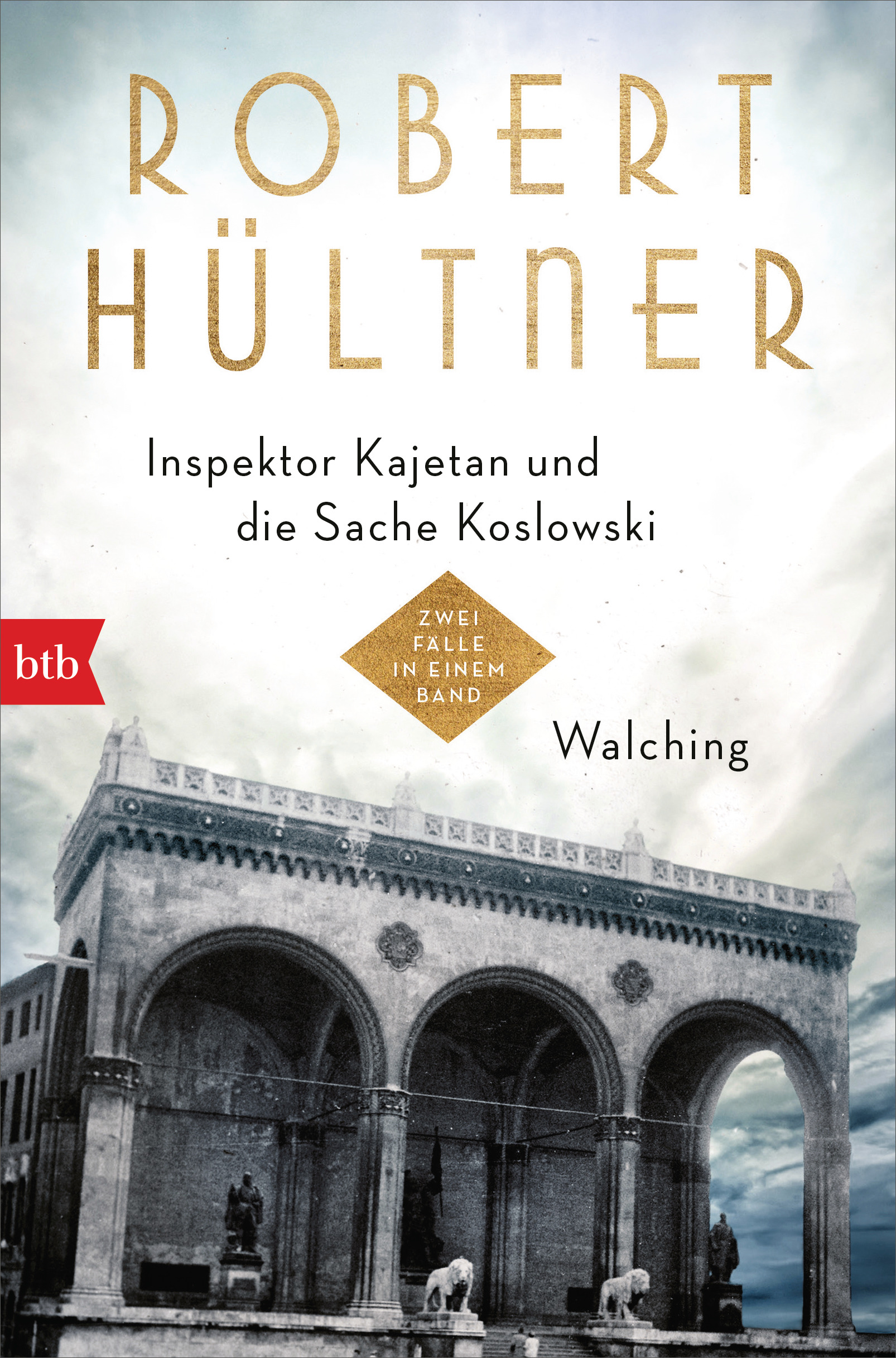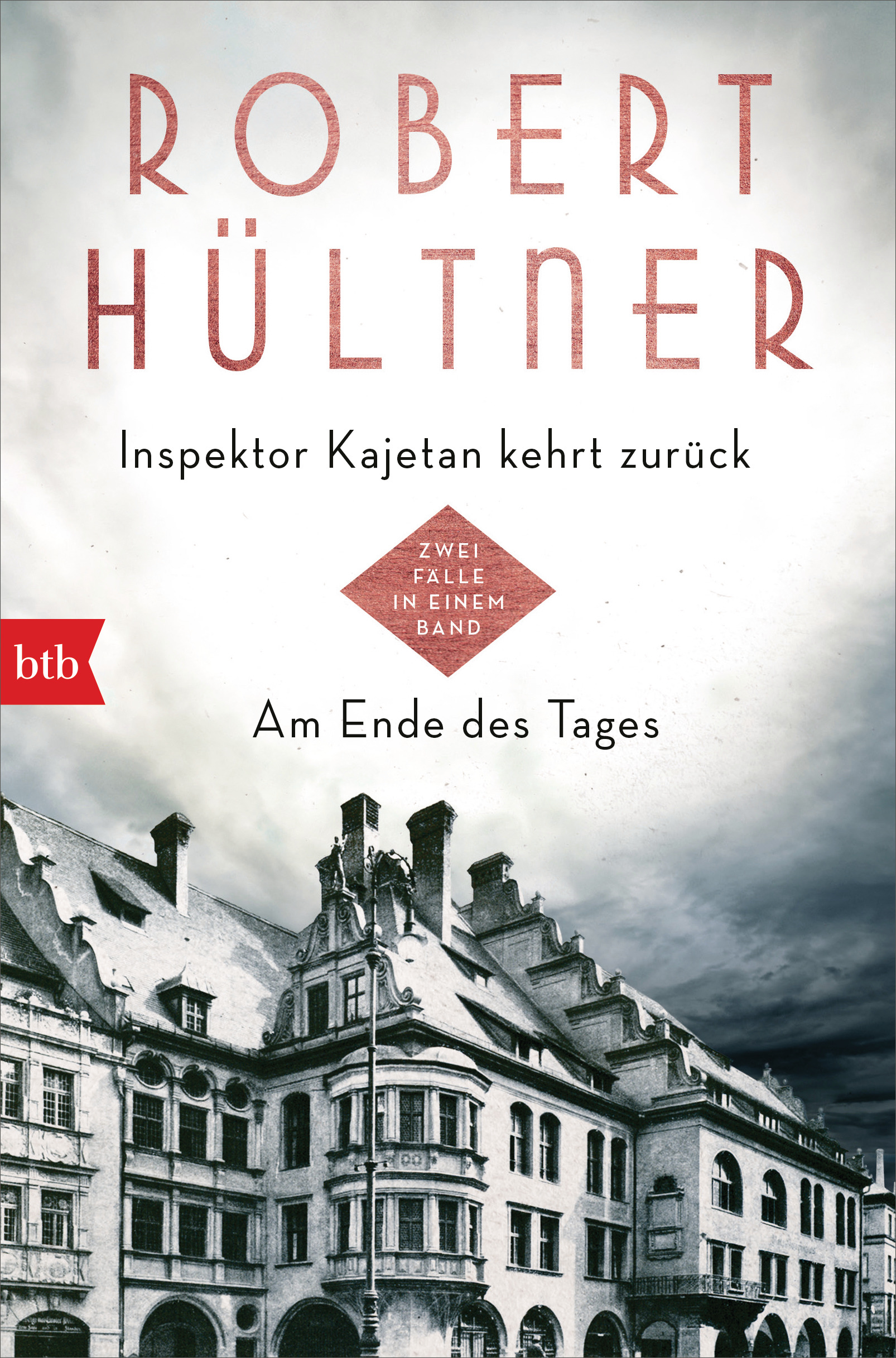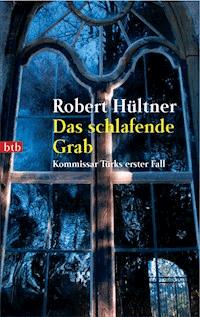5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie in Bayern gemordet wird.
Robert Hültner, vielfach preisgekrönter deutscher Krimiautor, macht sich in seinem ersten Sachbuch auf die Spuren der Wirklichkeit: In akribischen Recherchen hat er acht historische Kriminalfälle aus zwei Jahrhunderten bayerischer Geschichte rekonstruiert und atemberaubend nacherzählt. Die blutrote Spur realer Verbrechen führt von Niederbayern über den Bayerischen Wald bis in die Münchner Maxvorstadt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Robert Hültner
Tödliches Bayern
Kriminalfälle aus zwei Jahrhunderten
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2013 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
SK · Herstellung: hag
ISBN 978-3-641-12426-7V002
www.btb-verlag.de
Vorwort
Die vorliegenden Erzählungen aus der bayerischen Kriminalgeschichte beruhen auf realen Geschehnissen. Aber nur in den wenigsten Fällen lagen mir dafür die vollständigen Ermittlungs- und Verfahrensprotokolle vor; viele der angefragten Archive verwiesen auf Verluste, etwa durch Kriegsfolgen oder politisch motivierte »Bereinigungen«. So waren viele Vorgänge nur noch über ihr Echo in zeitgenössischen Presseberichten, in Tagebüchern und Memoiren einzelner Beteiligter, durch Hinweise in wissenschaftlichen Abhandlungen oder, soweit noch möglich, durch Gespräche mit Zeitgenossen und Experten zu rekonstruieren.
Die Auswahl der Fälle ist keineswegs willkürlich. Was zunächst kaum mehr als eine vage kriminologische Hypothese war, bestätigte sich: Jede politische, wirtschaftliche und kulturelle Umwälzung bewirkt soziale Konflikte und Belastungen, auf die die Betroffenen mit zuweilen fataler Konsequenz reagieren. Tatsächlich bildet sich hinter jedem der geschilderten Fälle der jeweilige historische Hintergrund überdeutlich ab; er erzeugt nicht nur zeitspezifische dramatische Konstellationen, Motivlagen und Methoden sowohl kriminellen wie staatlichen Agierens, sondern zeigt sich auch darin, wie Verbrechen in der jeweiligen Epoche gewertet und geahndet wurden. Es ist dies eine Betrachtungsweise, die auch den Blick dafür schärfen könnte, was Menschen in unserer Zeit dazu bringt, zu Verbrechern zu werden.
Bei der Arbeit an diesen Nacherzählungen zeigte sich erneut, dass das wahre Leben zwar zuweilen in tragischen Bahnen verlaufen mag, es sich aber nicht unbedingt nach den Gesetzen von Spannung und Dramatik richtet. Anders ausgedrückt: Was im wirklichen Leben als »spannend« empfunden wird, ist häufig etwas anderes als das, was die klassische Kriminalerzählung interessant macht. (Falsch wäre allerdings der Umkehrschluss, eine dramatische Erzählung habe mit der Wirklichkeit nichts zu tun.) Um daher den Kern dieser Fälle und der in ihnen enthaltenen Tragödien freilegen zu können, waren Abläufe zu komprimieren, musste die Handlung mit erdachten Szenarien und fiktivem Personal ergänzt werden und war bei so mancher lückenhafter oder widersprüchlicher Quellenlage über die plausibelste Variante zu spekulieren. Besonders bei den Fällen ab der Mitte des 20. Jahrhunderts galt es zudem – aus Gründen der Wahrung der Persönlichkeitsrechte und der Beachtung des Rehabilitierungsinteresses –, die Namen von beteiligten Personen und Orten zu verändern und relevante äußere Umstände deutlich umzugestalten.
Robert Hültner
Die Kriminalfälle
Vorwort
Tartuffe auf dem Land1807
Die Göttliche1867
Krankheit der Jugend1919
Alles, was Recht ist1918–34
Das folgsame Mädchen1920
Don Juan im Gebirg1962
Eine Landidylle1988
Einer von uns2004
Dank
Tartuffe auf dem Land1807
I.
Eine Irre.
Der Adjunkt des Gräflich-Portia’schen Patrimonialgerichts auf Schloss Oberlauterbach ist erschüttert.
Das Mädchen ist nicht bei Trost. Es ist krank.
Oder doch bloß verlogen? Und dreist obendrein?
Der erste Impuls des Beamten ist, die Besucherin mit ein paar Ohrfeigen zur Vernunft zu bringen und anschließend in hohem Bogen aus dem Amtszimmer zu werfen. Hat er nichts anderes zu tun, als sich die infame Denunziation einer 17-Jährigen anzuhören und sich mit ihren Räuberpistolen die Zeit stehlen zu lassen? Für wie dumm hält sie ihn, dass sie glaubt, er würde ihr diese haarsträubende Geschichte abnehmen? Was erlaubt sich dieser verlauste Bauernfratz eigentlich?
Der Adjunkt hebt die Hand. Doch etwas lähmt ihn, der Zorn, den er dafür aufbringen müsste, will sich nicht einstellen. Er lässt die Hand sinken und mustert das Mädchen. Die Schultern an den Oberkörper gezogen steht es vor ihm, spindeldürr, die Wangen vor Aufregung gefleckt, mit geröteten Augenrändern und flatternden Lidern.
Gleich heult sie los, denkt er, hoffentlich dreht sie mir nicht durch, ein hysterischer Anfall hat mir gerade noch gefehlt. Was für ein Elend. Was mag dem armen Geschöpf zugestoßen sein, dass ihr Gehirn eine derart wahnhafte Geschichte ausbrüten konnte? Welcher Dämon träufelt ihr bloß diese krankhaften Einbildungen ein?
Der Adjunkt fühlt sich hilflos. Wie mit durchtriebenen Verleumdern umzugehen wäre, wüsste er. Doch durchtrieben – nein, das ist dieses Kind nicht, so gut kennt er seine Pappenheimer, lange genug ist er auf seinem Posten. Er findet keine andere Erklärung. Dieses Kind ist nicht bei Sinnen.
Was soll er bloß bloß mit ihr machen?
Der Adjunkt fixiert sie noch einmal streng. Sie zuckt fluchtbereit, doch sie hält seinem Blick stand, halb verschüchtert, halb vertrotzt.
Er fasst sich. Jetzt um einen fast väterlichen Ton bemüht, fordert er sie auf, ihre Angaben zu wiederholen, hört geduldig zu, fragt nach, wendet die üblichen Tricks an, verwirrt sie mit Absicht (Habe sie nicht eben eine blaue Schürze erwähnt? Und blonde Haare habe die Fremde gehabt? – Nein? Hellbraune? Habe sie nicht vorhin gesagt, dass –?).
Die Stimme des Mädchens ist brüchig vor Aufregung, doch sie macht keine Fehler, widerspricht sich nicht, korrigiert ihn, wenn er ihr wieder eine falsche Erinnerung unterschieben will. Fahrig eine sumpffarbige Strähne unter ihrem Kopftuch verstauend, dann wieder mit bäuerlich groben, rissigen Fingern den Bund ihrer verwaschenen Schürze befingernd, wiederholt es das Ungeheuerliche, dessen Zeuge es gewesen sein will.
Der Adjunkt macht sich Notizen. Schließlich ermahnt er sie, vorläufig Stillschweigen zu bewahren, und geleitet sie hinaus. Sie würde von ihm hören, verspricht er.
»Bestimmt?«
Er nickt ernst. Bestimmt, denkt er. Was immer du dann zu hören bekommst.
Dann rast er in den oberen Stock, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, und informiert seinen Vorgesetzten.
»Noch einmal in Ruhe«, dämpft der Hofmarksrichter seine Aufgeregtheit. »Frauenknecht, sagten Sie, ist ihr Schreibname? Saß nicht eine Familie dieses Namens auf dem hiesigen Thomashof?«
Der Adjunkt ist noch immer außer Atem. Er schluckt, nickt. »Katharina, so ihr Name, ist die Letzte der Familie. Eltern und Schwester sind bereits verstorben.«
»Der Hof war zuletzt im Besitz von Hochwürden Riembauer, nicht wahr?«
»Nachdem er auf die Pfarrstelle von Nandlstadt berufen wurde, verkaufte er, richtig. Er soll dabei ein gar nicht so schlechtes Geschäft gemacht haben.«
Der Richter winkt unwillig ab. »Es sei ihm vergönnt«, sagt er. Heutzutage schrumpfen die Pfründe der Kirche, denkt er, die Zeit spielt gegen sie, viele ihrer Güter wurden in den vergangenen Jahren verstaatlicht, ihre Macht schwindet. Wer sollte es da einem Landpriester übel nehmen, wenn er zusieht, wo er bleibt? »Wozu überhaupt diese gehässige Anmerkung? Gehört das zur Sache?«
Der Adjunkt schüttelt den Kopf.
»Dann verschonen Sie mich gefälligst«, brummt der Richter. »Aber jetzt sagen Sie mir – damit ich sicher sein kann, mich nicht verhört zu haben –, die kleine Frauenknecht klagt tatsächlich gegen Hochwürden Riembauer? Der in unserer Gemeinde so segensreich gewirkt hat? Und dann auch noch wegen Mordes? Herr im Himmel, was ist das? Wahnsinn? Eine besitzlose Magd hat die Stirn, einen Vertreter der Kirche zu verleumden? Hat sie auch nur den Hauch eines Beweises für ihre Hirngespinste?«
»Sie habe die Tat selbst miterlebt, behauptet sie. Sie soll im Herbst 1807 geschehen sein.«
»Großartig«, belfert der Richter los. »Und schon jetzt, keine fünf Jahre später, macht sie Meldung? Wo mit Sicherheit sämtliche Spuren längst verwischt, wichtige Zeugen möglicherweise verstorben sind, andere vermutlich nur noch verwaschene Erinnerungen haben? Es wird immer absurder.«
»Sie erklärt es damit, dass sie Angst gehabt habe. Sie sei den Kontakt mit hohen Herrschaften nicht gewohnt und habe gefürchtet, als Verleumderin gezüchtigt und verjagt zu werden. Außerdem fürchte sie die Rache dessen, den sie der Tat bezichtigt, wie sie sich auch –«
»Ein Funken Realitätssinn scheint also noch vorhanden zu sein. Ist ja schon fast wieder tröstlich.«
»– wie sie sich auch davor fürchte, den – alles ihre Worte, mit Verlaub! – raffinierten Lügen und Ausreden Hochwürden Riembauers nicht gewachsen zu sein. Er verdrehe alles, seife alle Welt mit seinem frommen Getue ein, wie er es auch schon mit ihren Eltern und ihrer Schwester getan habe. Außerdem habe sie um ihr Leben gefürchtet. Sie sei ja noch nicht volljährig und bis vor kurzem noch gezwungen gewesen, im Haushalt mit ihm zu wohnen. Von Mutter und Schwester hatte sie zu deren Lebzeiten keine Hilfe, sagt sie, diese hätten unter vollständigem Einfluss des Pfarrers gestanden.«
»Ach! Und diese Angst ist mit einem Mal verflogen? Das soll ein Mensch glauben?«
»Nun, dazu erklärt sie: Sie habe sich durchaus schon früher zwei Seelsorgern der Nachbargemeinde anvertraut, diese hätten ihr jedoch geraten zu schweigen. Ich vermute, dass man ihr keinen Glauben schenkte.«
»Nur allzu verständlich! Phantastereien einer Pubertierenden, was sonst!«
»Jedenfalls habe sie das für lange Zeit mutlos gemacht. Aber die Erinnerung habe sie jahrelang gequält.«
»Haben Sie ihr die Schwere der Vorwürfe verdeutlicht? Sie auf die Strafe hingewiesen, die es nach sich zieht, wenn sich die Haltlosigkeit ihrer Anschuldigungen erweist? Hat sie keinerlei Ehrfurcht vor dem heiligen Stand?«
»Auf die Konsequenzen habe ich sie natürlich hingewiesen. Aber sie blieb eisern bei ihrer Aussage.«
»Würde sie diese auch unter Eid wiederholen?«
Der Adjunkt nickt. »Allerdings ist sie erst siebzehn Jahre alt. Und damit noch nicht eidesmündig.«
Der Richter verstummt für einen Augenblick. Die Sache beginnt ihn zu beunruhigen. Er misst seinen Untergebenen mit einem schrägen Blick.
»Haben Sie eigentlich schon erwogen, dass etwas völlig anderes dahinterstecken könnte? Schlichte Bosheit? Rachsucht, weshalb auch immer? Habgier?«
Der Adjunkt wiegt den Kopf. »Berechtigte Frage«, räumt er ein. »Ich habe sie mir natürlich ebenfalls gestellt. Tatsächlich beansprucht sie auch, am Erlös des Verkaufs des elterlichen Anwesens beteiligt zu werden. Sie betrachtet es als ihr Erbteil.«
»Sehen Sie! Und schon haben wir ihn, den wahren Grund! Welche Niedertracht!«
»Jedenfalls behauptet sie, von dieser Summe keinen Kreuzer gesehen zu haben. Hochwürden Riembauer habe ihr dies mit der Begründung vorenthalten, er habe sich schließlich zuvor aufopfernd um ihre Eltern gekümmert. Was sie jedoch bestreitet. Allen Gewinn aus der Ökonomie habe er für sich verwendet, bei den Kosten für Arzt und Arznei für ihre hinfälligen Eltern jedoch geknausert.«
»Natürlich bestreitet sie das! In jeder zweiten Querele in unserem Gerichtssprengel geht es um Schäbigkeiten dieser Art, und nicht zu selten stellt sich heraus, dass die Ansprüche unberechtigt sind! – Nein! Es ist nichts als eine Denunziation der niedrigsten Art! Und darauf fallen Sie herein? Sie, mit Ihrer Erfahrung?«
»Eben.« Der Adjunkt nickt. »Weil ich Erfahrung habe.«
Ein skeptischer Blick. »Das will sagen?«
»Dass ich bei diesem Kind zwar größte Erregung, aber keine eifernde Gehässigkeit verspürt habe. Nur tiefste innere Not. Das Mädchen äußert sich außerdem klar. Sie beschreibt detailliert den Ort auf dem Thomashof, an dem das angebliche Opfer verscharrt worden sein soll. Aufgefordert, die Angaben zu Ort, Zeit, Namen der Beteiligten, Ablauf der Tat zu wiederholen, unterlaufen ihm keine Fehler. Herr Richter dürfen mir glauben, dass ich sämtliche Methoden angewandt habe, um sie ins Wanken zu bringen. Nach dem Lehrsatz: Stelle einem Lügner immer wieder die gleichen Fragen zu seiner Geschichte, und sie wird sich verändern. Aber nichts dergleichen ist geschehen. Hinzu kommt –«
»Was? – Herrgott, so reden Sie!«
»Nun, mir kam in den Sinn, dass es vor etwa fünf Jahren im Bezirk tatsächlich eine gerichtliche Enquete zum Verschwinden einer jungen Frau gab, deren Verbleib niemals aufgeklärt werden konnte.«
»Ich erinnere mich. Die Sache machte einigermaßen Furore. Wie war der Name noch gleich?«
»Anna Eichstätter, gebürtig zu Regensburg, 22 Jahre alt.«
»Eichstätter, richtig. Und diese soll das Opfer von Hochwürden gewesen sein? Aber nein! Die Tat wurde doch dem Raubmörder Gayer zugeschrieben, der in dieser Zeit in unserem Rayon sein Unwesen trieb.«
»Der dies aber noch im Angesicht des Schafotts ableugnete.«
Der Hofmarksrichter schüttelte verdrossen den Kopf. »Nein. Es ist zu unglaublich, was diese Närrin uns da auftischen will. Einen katholischen Priester des Mordes zu beschuldigen, ungeheuerlich! Man muss dieses verwirrte Ding vor sich selber schützen, sie stürzt sich ins Unglück mit ihren Phantastereien. Der Mann, den sie des Mordes bezichtigt, wird sie mit Klagen überhäufen, es wird ihr das Genick brechen, und er wird alles Recht der Welt auf seiner Seite haben. Gibt es denn niemand, der dieser Unglücklichen Sorge und Obhut gibt?«
»Durchaus. Sie gibt an, im festen Dienst in Pfeffenhausen zu stehen und mit ihren Vorgesetzten ein gutes Auskommen zu haben. Ich hatte sogar den Eindruck, dass man sie dort sogar zu ihrem Schritt ermuntert hatte.«
»Unverantwortlich!«
Der Adjunkt nickt unbestimmt. Etwas in ihm wehrt sich mit Macht, weiter zu spekulieren. Darüber, ob das Mädchen unter Einfluss stehen könnte und irgendein Unmensch ihre geistige Verwirrtheit lediglich ausnützt, um dem Pfarrer zu schaden. Himmel. Welcher Abgrund!
Auch der Richter starrt eine Weile finster vor sich hin. Was tun? Die Sache ist heikel. Er weiß, dass sich im Königreich Baiern die Stimmen mehren, die die Existenz der jahrhundertealten, an die Adelsbesitztümer gebundenen Patrimonialgerichte für nicht mehr zeitgemäß halten. Schon jetzt sind diese auf die niedrige Gerichtsbarkeit reduziert, sie dürfen nur noch lokale Bagatellen schlichten, und wenn, so ahnt er, diese erbärmliche Anbetung der Moderne voranschreiten sollte, würden sie irgendwann als unbedeutende Provinz-Notariate enden. Er denkt laut: »Das Klügste wäre, diese Närrin mit allem Nachdruck zu ermahnen und dann die Sache auf sich beruhen zu lassen. Sie muss zum Schweigen gebracht werden, bevor sie noch mehr Unheil anrichtet.« Er seufzt. »Aber als Patrimonialgericht sind wir gehalten zu reagieren. Wir gerieten in Teufels Küche, wenn wir nichts unternähmen.«
»Aber wenn sich die Anwürfe am Ende als haltlos herausstellen?«
»Fragen Sie doch nicht, wenn Sie sich die Antwort denken können«, schnaubt der Richter. »Dann stehen wir ebenfalls im Regen, was sonst?«
»Und wenn … nicht?«
»Sie ziehen es doch nicht etwa in Betracht? Sind Sie verrückt geworden?«
Der Adjunkt winkt hastig ab. »Natürlich nicht. Hochwürden Riembauer ist hoch angesehen, ist weitum als brillanter Prediger geschätzt.« Er macht eine kurze Pause, bevor er zögernd hinzufügt: »Allerdings kann ich mich daran erinnern, dass damals auch einige unschöne Gerüchte über ihn im Umlauf waren.«
»Welcher Art?«
»Nun, Hochwürden Riembauer soll es in Dingen des Zölibats eher, nun, nicht so genau genommen zu haben.«
»Ich bitte Sie! Das ist doch lächerlich. Und außerdem eine Sache des Kirchenrechts, nicht des weltlichen.« Mit wie viel Bigotterie die Kirche zu leben bereit ist, ist ihre Sache, denkt er. Da haben wir uns nicht einzumischen. »Wir leben in modernen Zeiten.«
»Wenn Herr Richter meinen«, sagt der Adjunkt.
»Ich bin momentan absolut nicht in Stimmung für Ihre weltanschaulichen Spekulationen«, blafft der Richter. »Überlegen Sie lieber mit, wie wir diese Sache loswerden.«
»Wie auch immer. Handeln müssen wir.«
Der Richter schießt einen giftigen Blick ab. »Haben Sie irgendwann auch einmal einen eigenen Gedanken?«
Der Adjunkt sieht zu Boden und schweigt. Ich werde dir die Verantwortung nicht abnehmen, denkt er.
»Natürlich müssen wir etwas unternehmen«, fährt der Richter ungehalten fort. »Doch ich möchte mich ungern lächerlich machen, geschweige denn mir die Finger verbrennen. Deshalb wird das Beste sein, dass wir, bevor wir das Gericht in Landshut einschalten, über diese Katharina Frauenknecht in aller Diskretion Erkundigungen einholen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie nicht schon öfters mit derartigen Wahnideen aufgefallen wäre. Wenn sich, wie zu erwarten, das Ganze als Hirngespinst und bösartige Verleumdung herausstellt, müssen wir ernstlich mit ihr sprechen. Möglicherweise ist dann auch die Unterbringung in einer Kretinenanstalt angebracht, bevor sie mit ihren wirren Anschuldigungen noch mehr Unruhe verbreitet.« Davon habe ich in diesen Zeiten schon genug, denkt er. »Zu ihrem Schutz und dem der Umgebung.«
»Und wenn doch etwas an der Sache –?«
»Reden Sie keinen Unsinn. Führen Sie gefälligst meine Anordnungen aus.«
Der Adjunkt verbeugt sich, geht in seine Amtsstube zurück, kramt seine Stutzperücke hervor, wedelt den Staub ab, stülpt sie sich über den Schädel und prüft ihren Sitz. Dass sie nicht mehr in Mode ist, ist ihm egal, man ist hier auf dem Land, da hebt sie ihn noch immer als Amtsperson hervor. Dann bricht er auf.
Katharina erhält überall beste Zeugnisse. Ihre Dienstherrin und Mitmägde mögen sie, beschreiben sie als heiteres Wesen, gottgläubig und wahrheitsliebend und, das andere Geschlecht und zweifelhafte Vergnügungen betreffend, als ehrbar, keinesfalls leichtsinnig. Sie gehe keiner Arbeit aus dem Weg, sei anstellig, umsichtig und zuverlässig. Sie sei klar im Kopf, keiner der dazu Befragten hatte je Anzeichen einer geistigen Zerrüttung bei ihr wahrgenommen. Gelegentlich sei jedoch Merkwürdiges um sie, denn manchmal zeige sie eine rätselhafte Beklommenheit, gebe an, sich davor zu fürchten, allein im Haus bleiben oder im Einzelbett schlafen zu müssen. Sie schrecke auch oft im Schlaf auf und erzähle dann unter Tränen, von furchtbaren Gesichten verfolgt zu werden.
Über den ehemaligen Dorfpriester, Hochwürden Franz Sales Riembauer, ist viel Lobendes, aber auch Kritisches zu vernehmen, wenn auch seltener und erst auf drängende Nachfrage. Einige der dazu befragten Dörfler äußern, sein Benehmen als süßlich und frömmelnd, ja scheinheilig empfunden zu haben. Sie berichten von einem ansonsten gutchristlichen Bauern, der sich bei seinen noch unverheirateten Töchtern zu gewissen Vorkehrungen veranlasst gesehen hatte, wenn der geistliche Herr wieder einmal bei ihm die Nacht verbringen wollte.
Der Hofmarksrichter hört dem Bericht mit wachsender Verdrossenheit zu.
Erst war diese Angelegenheit nur verrückt, denkt er, jetzt wird sie auch noch unappetitlich.
Er bringt seinen Untergebenen mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Genug des Geschwätzes«, sagt er. »Damit haben wir unsere Pflicht getan. Bringen Sie die Aussage der Frauenknecht in Form und senden Sie sie per Boten unverzüglich an das Landgericht in Landshut.«
Dort reagiert man rasch. Noch am selben Tag trifft die dreiköpfige Gerichtskommission auf Schloss Oberlauterbach ein. Der leitende Kommissar lässt sich das Protokoll von Katharinas Aussage vorlegen. Dann machen sich die Männer zum Thomashof auf.
Der junge Bauer ist bestürzt, als der kleine Trupp vor seinem Tor auftaucht. In einer Nebenkammer der Stallung, die Katharina beschrieben hatte, setzen die Beamten die Schaufel an. Die Erde ist locker und nachgiebig. Schon nach wenigen Zentimetern gibt sie einen Frauenschuh frei. Süßlicher Brodem dampft den Männern entgegen. Sie atmen flach. Der Verwesungsgeruch nimmt zu und erfüllt bald die kleine Kammer. Der leitende Kommissar verscheucht das Gesinde, das sich vor der Lattentür angesammelt hatte.
In einer Tiefe von nicht mehr als einem halben Meter stößt die Schaufelspitze auf Widerstand. Der Bauer bekreuzigt sich.
Der leitende Kommissar notiert in Gedanken: Der Mörder hat sich wenig Mühe gegeben, sein Opfer zu verscharren. Er muss sich sehr sicher gewesen sein, dass man ihn nie verdächtigen wird.
»Und wir haben uns schon gewundert, dass der Boden an dieser Stelle immer nachgibt«, stammelt der Bauer. »Wir … wir haben nichts davon gewusst, bitte glauben Sie uns!«
Der Totengräber des Dorfes wird herbeigerufen. Unter den Augen der Ermittler legt er eine skelettierte Leiche frei. Sie wird zum Friedhof transportiert, in einen Nebenraum der Aufbahrungshalle gebracht. Die Ermittler binden sich feuchte Tücher vor Mund und Nase und beginnen mit der Untersuchung. Die Fäulnis ist bereits weit fortgeschritten, Maden und Würmer haben ihr Werk fast vollendet. An den vermoderten Resten der Kleidung ist zu erkennen, dass es sich um die Leiche einer Frau handelt. Dass sie unter der Riegelhaube lange hellbraune Haare trug.
Der leitende Kommissar vergleicht die Angaben, die vor fünf Jahren über die Bekleidung der verschollenen Anna Eichstätter notiert worden waren. Dann damit, wie sie Katharina Frauenknecht beschrieben hatte.
Die Angaben stimmen überein.
Der leitende Kommissar ruft seine Untergebenen zu sich und ordnet die Befragung der Bewohner der umliegenden Gehöfte an. Bei Anbruch der Dämmerung kehren die Rechercheure zurück und erstatten Bericht.
Noch am Abend desselben Tages klopft die Gerichtskommission an die Pforte des Nandlstadter Pfarrhofs. Erst nach geraumer Zeit erscheint die Pfarrersköchin. Die junge Frau ist ungehalten. Die Herren kämen ungelegen, Hochwürden säße gerade beim Abendessen, sie habe strenge Anweisung, ihn nicht zu stören.
Er bedaure zutiefst, entgegnet der leitende Kommissar. Aber sie solle gefälligst die Türe freigeben, man habe eine Amtshandlung vorzunehmen. Sein Befehlston schüchtert die Bedienstete ein. Sie lässt die Beamten passieren. Im Esszimmer sitzt Pfarrer Franz Sales Riembauer vor einem üppig gedeckten Tisch.
Der leitende Kommissar deutet eine Verbeugung an und stellt sich vor.
»Ich bedaure, Hochwürden«, sagt er. »Aber ich habe Sie zu ersuchen, uns zu folgen.«
Der Pfarrer wirkt nicht überrascht. Er nimmt seinen Esslatz ab, wischt sich mit gemessenen Bewegungen über die fettglänzenden Mundwinkel und steht auf. »Ich habe Sie erwartet, meine Herren.« Seine Stimme tönt dunkel, er ist eine stattliche, ehrfurchtgebietende Erscheinung.
Was tue ich da?, denkt der Kommissar. Träume ich, oder verhafte ich wirklich gerade einen Priester?
»Sie haben uns … erwartet?«
»Ja, ich weiß, weshalb Sie hier sind.« Der Pfarrer lächelt traurig. »Obwohl ich bis jetzt hoffte, dass meine Widersacher irgendwann von ihrem sündhaften Tun ablassen würden. Doch es scheint sich zu bewahrheiten, dass Gott den züchtigt, den er liebt. Walten Sie also Ihres Amtes, meine Herren.«
Der leitende Kommissar ist verunsichert. Reagiert so ein ertappter Übeltäter? Was, wenn dieser Mann nur das Opfer einer gemeinen Verleumdung ist? Unwillkürlich schlägt er einen untertänigen Ton an.
Man habe die Pflicht, den Tod einer als vermisst gemeldeten Frau zu untersuchen, erklärt er. Den Unterlagen habe das Gericht entnehmen können, dass diese bis kurz vor ihrem Verschwinden bei ihm als Köchin angestellt gewesen sei, als auch, dass sie vor ihrem Verschwinden in ihrer Umgebung hatte verlauten lassen, ihn, Pfarrer Riembauer, zur Regelung geschäftlicher Dinge aufsuchen zu wollen.
»Das Gericht bedarf dazu Ihrer geschätzten Hilfe, Hochwürden«, endet der Kommissar versöhnlich. »Die Angelegenheit wird sich gewiss in Kürze aufgeklärt haben.«
»Davon bin ich von tiefstem Herzen überzeugt«, sagt Pfarrer Riembauer. »Endlich wird diese schreckliche Last von meiner Seele genommen.«
Der Kommissar stutzt. Was meint er damit?
Der Pfarrer lächelt mild. »Ich kenne die Anschuldigungen natürlich. Schon seit langem. Wie mir auch das bedauernswerte Geschöpf bekannt ist, die sie erhebt. Der Herr möge ihr ihre Verwirrtheit verzeihen.« Der Blick, mit dem er die drei Beamten umfasst, verströmt Güte. »Wie er auch Ihnen verzeihen möge, meine Herren.«
Der Kommissar senkt unwillkürlich den Kopf, als habe er soeben einen priesterlichen Segen empfangen: »Wir tun nur unsere Pflicht, Hochwürden.«
Der Pfarrer nickt verständnisvoll. Er sei bereit, auf alle Fragen zu antworten. Bei allem erschüttere ihn nur, zu welchen Abgefeimtheiten der Teufel greife, um der heiligen Mutter Kirche Schaden zuzufügen. Erst diese unselige Säkularisation, dann diese sündhaften Phantastereien von Liberté und Egalité, mit der Gottes Ordnung auf den Kopf gestellt werde. Da sehe man, welche ketzerische Verwirrung diese sogenannte Aufklärung in die Hirne des einfachen Volkes geträufelt habe.
Der Kommissar räuspert sich. »Ich muss Sie jetzt ersuchen, Ihre Vorbereitungen zu treffen, Hochwürden.«
Im Gerichtsgefängnis von Landshut angekommen, lässt Franz Sales Riembauer das erste Verhör mit Duldermiene über sich ergehen. Er antwortet bereitwillig, formuliert gestochen und wortreich. Die Beamten, die es sonst meist nur mit klobigem Raubgesindel und stumpfen Psychopathen zu tun haben, sind beeindruckt.
Ja, sagt der Pfarrer, natürlich kenne er die Katharina Frauenknecht. Wie allgemein bekannt, sei er ihrer Familie herzlich verbunden gewesen und habe sie in der Sonntagsschule unterrichtet. Kein unbegabtes Kind. Sehr zart, sehr nervös. Dazu käme aber leider eine allzu blühende, zuweilen fast krankhafte Phantasie. Dass sie ihn dieser unvorstellbaren Tat beschuldige, betrübe ihn zutiefst, denn er habe ihr stets Liebe und seelsorgerische Anleitung angedeihen lassen. Darüber, woher ihr besessener Hass rühren könne, zermartere er sich schon seit längerem den Kopf. Gewiss, von unerfüllten Wünschen befeuerte Sinnesreizungen und überhitzte Phantastereien seien heutzutage bei jungen Frauen nicht selten. Möglich sei auch, dass sie unter den Einfluss von Häretikern und gottlosen Umstürzlern, die auch auf dem Lande zunehmend ihr Unwesen treiben, geraten sein könnte. Doch er wisse es nicht, sei ratlos.
Der Ermittler hakt ein. Damit wolle Hochwürden sagen, dass Katharina Frauenknecht alles nur erfunden habe?
Der Pfarrer nickt in tiefster Überzeugung. »Aber ich verzeihe ihr und allen, die versuchen, mich in diesen ungeheuerlichen Verdacht zu stellen. Möge Gott ihr und allen verlorenen Seelen einst gnädig sein. Er in seiner Weisheit wird wissen, warum er mich dieser Prüfung unterzieht.«
Eine Aura von Würde und Edelmut umgibt den Priester. Er zeigt keinen Hass auf das junge Mädchen, das ihn in diese Lage gebracht hat. Dem Mann geschieht entsetzliches Unrecht, denkt der Ermittler. Ich muss dieses unwürdige Schauspiel beenden.
»In Ihrem Hause sprachen Sie von einer schweren Bürde, die auf Ihrer Seele laste, Hochwürden. Wie dürfen wir das verstehen?«
»Ich meinte damit, dass Katharina schon seit längerem bizarre Anschuldigungen gegen meine Person in Umlauf gesetzt hat. Weshalb ich, wie Sie vielleicht festgestellt haben, von Ihrer Ankunft nicht nur nicht überrascht, sondern in gewisser Weise sogar erleichtert war. Es schmerzt mich nur, dass es dieser Verwirrten nun doch gelungen zu sein scheint, meinen guten Ruf und den meines Standes in den Schmutz einer derartigen Verdächtigung zu ziehen. Bitte beziehen Sie das nicht auf sich, Herr Kommissar. Sie tun nur Ihre Pflicht.«
Ein bisschen zu viel Salbe, denkt der Ermittler. Bei allem Respekt.
»Ich verstehe Sie vollkommen, Hochwürden. Wenn Sie jetzt noch dazu beitragen würden, einige verbliebene Ungereimtheiten auszuräumen, könnte Ihr Ansehen umso nachdrücklicher von allen Anwürfen gereinigt werden.« Der Ermittler deutet auf den Aktenstapel auf seinem Tisch. »Als Sie vor fünf Jahren im Zuge der Nachforschungen nach der verschollenen Anna Eichstätter befragt wurden, gaben Sie an, dass diese niemals auf dem Thomashof – wo Sie damals wohnten – erschienen sei.«
»Ja.« Der Priester senkt den Kopf. »Das sagte ich wohl.«
»Leider ist nicht mehr zu widerlegen, dass die Eichstätter dort erschienen sein muss. Zum Ersten, weil man ihren Leichnam dort fand, und zum Zweiten, weil sich auch zwei Nachbarn daran erinnern.«
»Ist kein Irrtum möglich?«
»Leider nein, Herr Pfarrer. Weder, was die Identität der Leiche angeht, noch, was die Glaubwürdigkeit der Zeugen betrifft, deren Angaben bis ins Detail übereinstimmen.«
Riembauer kontert, ohne auch nur eine Sekunde zu grübeln: »Ich will niemand der Lüge bezichtigen. Die braven Leutchen haben sicherlich in bestem Wissen und Gewissen ausgesagt. Und vielleicht verhält es sich tatsächlich so, dass ich das Ankommen der Eichstätter nicht wahrgenommen habe. Sehen Sie, ich stand der Pfarrfiliale vor, viele meiner Schäfchen suchten mich in ihrer Not auf, ich wies niemanden ab. Und auf dem Thomashof war damals ein stetiges Kommen und Gehen von Dienstboten, wandernden Handwerkern, ambulanten Händlerinnen, Bettlern.« Er nickt, sich bestätigend. »Ja, das könnte der Grund sein, weshalb ich sie nicht bemerkt habe.«
»Aber diese Anna Eichstätter hinterließ offensichtlich Eindruck. Sie soll eine ausnehmend schöne Person gewesen sein, und, was in dieser Gegend auffiel, war in städterischer Eleganz gekleidet gewesen sein sowie sich bei den Nachbarn, bei denen sie nach dem Weg fragte, sehr stolz gebärdet haben.«
Der Pfarrer zuckt ergeben die Achseln.
»Ich erinnere mich jedenfalls nicht an sie, ich bedaure, meine Herren, und bitte um Nachsicht. Es ist schließlich viel Zeit vergangen.«
»Auch auf dem Thomashof soll die Eichstätter sehr herrisch aufgetreten sein. Fast, als sei sie hier bereits zu Hause. Was könnte sie dazu veranlasst haben?«
»Ich habe auch dafür keine Erklärung. Gewiss, sie war einst meine Haushälterin in der Filiale Hirnheim, wo ich vor Jahren als Kaplan tätig war. Ich erinnere mich, dass sie ein ausnehmend tüchtiges Wesen war, aber leider auch daran, dass sie manchmal zu viel, nun, Nachgiebigkeit gegenüber dem anderen Geschlecht walten ließ. Dennoch, das arme Kind … welch tragisches Ende! Gibt es wirklich keinen Zweifel, dass es sich bei diesem Leichnam um den ihren handelt?«
Wir sind keine Anfänger, will der Kommissar entgegnen, doch er begnügt sich mit einem Kopfschütteln.
»Mehrere Zeugen erinnerten sich außerdem daran, dass es an diesem Tag einen ungewöhnlichen Tumult gegeben haben soll, eine große Unruhe, lautes Geschrei.«
Der Ermittler bemerkt, dass sein Gegenüber seinem Blick ausweicht. Er beugt sich vor. »Sie sagten damals aus, dass Sie sich an diesem Tag nicht im Haus aufhielten, sondern auf dem Acker zu tun hatten, Herr Pfarrer.«
Der Priester nickt bestätigend. »Es fällt Ihnen vielleicht schwer, sich einen Priester bei der Arbeit auf einem Acker vorzustellen, und damit sind Sie nicht alleine. Doch, sehen Sie – die Menschen auf dem Thomashof waren in tiefster Not. Die Bauersleute waren alt und gebrechlich, ihre beiden Kinder noch nicht imstande, die täglichen Arbeiten zu bewältigen. Katharinchen war dreizehn und noch sehr unverständig, ihre Schwester – Magdalena, glaube ich, war ihr Name – noch keine siebzehn und sehr unbeholfen. Die Familie stand vor dem sicheren Ruin. Ich sah es als meine Christenpflicht an, ihnen nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat beizustehen. Dass dies von einigen meiner Amtskollegen als der priesterlichen Würde abträglich bekrittelt wurde, kam mir zwar zu Ohren, ließ ich aber nicht gelten. Ich konnte auf den heiligen Benedikt von Nursia verweisen, der darin kein Hindernis für ein gottgefälliges Leben sah.«
»Gewiss«, kürzt der Ermittler den Sermon ab. »Aber wann trafen Sie nun am fraglichen Tag auf dem Thomashof ein?«
»Lassen Sie mich überlegen. Es muss … ja, kurz vor Einbruch der Dämmerung muss es gewesen sein, denn ich bereitete mich daraufhin unverzüglich auf meine Andacht vor. Was gewiss von den vielen Gläubigen bestätigt werden kann, die anschließend an ihr teilnahmen.«
»Dass Sie diese Andacht abhielten, steht außer Frage, Hochwürden«, räumt der Ermittler ein. »Was jedoch von mehreren Zeugen angezweifelt wurde, ist der Zeitpunkt Ihrer Rückkehr. Mehrmals wurde nicht die beginnende Dämmerung, sondern ein deutlich früherer Zeitpunkt genannt. Sie sollen schon gegen drei Uhr nachmittags auf dem Thomashof eingetroffen sein.« Einer Erwiderung zuvorkommend, hebt er die Hand. »Sie mögen jetzt wieder einwenden, dass nach fünf Jahren keine verlässliche Erinnerung mehr gegeben ist.«
Der Pfarrer nickt bedrückt. »Sie erraten es, Herr Kommissar. Und wenn sich lückenhafte Erinnerung auch noch mit abgrundtiefer Bosheit paart, dann …« Er brach ab, um in leidendem Ton fortzufahren: »Es betrübt mich zu erkennen, dass sich einige meiner Pfarrkinder trotz meiner unermüdlichen seelsorgerischen Bemühungen nicht von ihren niederen Leidenschaften abbringen ließen. Ich habe mir wohl auch Feinde gemacht, wenn ich unchristlichen Lebenswandel und Sittenlosigkeit geißelte. Vielleicht war es auch Sünde, wenn ich im Überschwang meines vollen Herzens manchmal zu wenig Milde walten ließ.«
Den Ermittler überfällt eine leichte Gereiztheit. Diesen Einwand kann er nicht gelten lassen. »Selbstverständlich haben wir uns dessen in aller gebotenen Gründlichkeit versichert und mehrfach nachgefragt. Die Zeugen waren sich sicher. Sie erinnerten sich übereinstimmend an das tägliche Drei-Uhr-Geläute der Pfarrkirche, und zwar deshalb, weil es vom Lärm aus dem Innern des Thomashofs beinahe übertönt worden sei. Alle Zeugen sind sich darin einig, dass Sie, Hochwürden, zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Hof anwesend waren.«
»Gott sei mir gnädig«, flüstert der Priester. »Soll dieser Kelch nie an mir vorübergehen?«
Der Ermittler kämpft gegen ein aufkommendes Entsetzen.
»Ich muss auf einer Erklärung bestehen, Hochwürden.«
Pfarrer Riembauer stöhnt auf und senkt den Kopf.
»Die Wahrheit ist demzufolge, Hochwürden, dass Sie die Anna Eichstätter sehr wohl angetroffen haben, nicht wahr?«
»Nein! Nein … so war es nicht.«
»Sondern?«
»Verzeihen Sie … es ist schon so viel Zeit vergangen.« Der Blick des Pfarrers wandert hilfesuchend im Verhörzimmer umher. »Vielleicht … ja, vielleicht bin ich doch schon ein wenig früher eingetroffen … Ich entsinne mich nicht mehr. Und vielleicht bin ich gleich in meine Schlafkammer gegangen, ohne dass es dafür Zeugen gäbe …«
Der Ermittler bohrt weiter: »Da die Plafonds des Thomashofs zum ersten Stock hin nicht isoliert sind, müssen Sie aber doch auch in Ihrer Kammer den erwähnten Tumult bemerkt haben. Und auch wenn nicht – Sie mussten Ihr Zimmer doch kurz vor Ihrer Andacht wieder verlassen, um sich zur Kirche zu begeben. Sollten Ihnen die Eheleute Frauenknecht und die beiden Kinder verschwiegen haben, dass die Eichstätter auf dem Hof erschienen und es zum Streit mit ihr gekommen ist? Verzeihen Sie, wenn ich das jetzt sagen muss, Hochwürden – aber das klingt leider nicht sehr glaubwürdig.« Der Kommissar beugt sich vor und fügt eindringlich hinzu: »Ich muss Sie nicht darauf hinweisen, dass auch die Gebote Gottes fordern, kein falsches Zeugnis zu geben.«
Pfarrer Riembauer schlägt die Hände vor sein Gesicht. Langsam lässt er sie sinken. Das Herz des Ermittlers macht einen Ruck.
»Ja«, sagt der Pfarrer. »Die Wahrheit ist, dass ich die Anna Eichstätter noch gesehen habe.« Nach einer kurzen Pause fährt er fort, von einem schweren Seufzer begleitet: »Die Zeit ist nun wohl gekommen, das Schweigen zu beenden.« Er sieht dem Kommissar ins Gesicht. »Ja, ich wurde Zeuge einer Tragödie. Doch ich bin daran unschuldig. Meine Schuld besteht allein darin, all die Jahre geschwiegen zu haben. Möge der höchste Richter aber entscheiden, ob ich gefehlt habe, weil ich mir Anbefohlene schützen wollte. Doch jetzt begebe ich mich vertrauensvoll in die Hände des Allmächtigen und der weltlichen Macht.«
Der Ermittler lässt sich seine Erregung nicht anmerken. »Erzählen Sie.« Er nickt aufmunternd. »Ich bin fest davon überzeugt, dass Hochwürden alles aufklären wird. Diese Angelegenheit ist gewiss bald beigelegt.«
Der Pfarrer setzt sich aufrecht. Davon sei auch er überzeugt, sagt er.
»Aber nun, Hochwürden – was trug sich an diesem Tag zu?«, sagt der Ermittler. Er gibt dem Gerichtsschreiber ein Zeichen. Dieser notiert die Worte des Pfarrers, die er gegen Ende des Tages in diese Reinschrift bringen wird: »Als ich nach meiner Tagesarbeit auf dem Hof ankam, ging ich sogleich auf mein Zimmer und fand die Tür offen. Ich sah auf dem Boden eine Person liegen. Ich meinte, es wäre jemand von den Hausleuten, und rief daher laut: ›Was ist das? Was gibts?‹ Ich erhielt keine Antwort; so befühlte ich nun die auf dem Boden liegende Person und fand zu meinem unaussprechlichen Schrecken, dass sie ohne Leben sei. Voll Entsetzen lief ich in die untere Stube, wo ich die Bäuerinmutter mit ihrer Tochter Magdalena traf. Sie hielten sich aneinander und zitterten wie Espenlaub. Auf meine erste Frage: ›Was ist da oben geschehen?‹, ergriffen mich Mutter und Tochter unter Weinen und Schreien bei meinen beiden Händen und baten mich, von allem zu schweigen. Dann erfuhr ich zu meinem größten Erstaunen, dass die Weibsperson, Anna Eichstätter, die mich schon während meines Aufenthalts in München hatte besuchen wollen, diesen Nachmittag wieder auf den Thomashof gekommen war und verlangte, auf mein Zimmer gelassen zu werden. Mutter und Tochter sind mit derselben in einen Streit geraten, der so weit führte, dass, nachdem zuerst jene Weibsperson zugestochen oder habe zustechen wollen, Magdalena mein Rasiermesser ergriffen und der Eichstätter in den Hals geschnitten hat. Die Ursache, dass der erbitterte Streit zu solchem Ausbruche gedieh, ist gewesen, dass die Eichstätter geäußert hatte, sie wolle Köchin bei mir werden. Sie hätte hierauf mein Versprechen erhalten, und sie forderte, Mutter und Tochter Frauenknecht müssten jetzt aus dem Hause ziehen. Später zündete ich ein Licht an und erkannte wirklich in der auf meinem Zimmer liegenden Person die Eichstätter. Ich wollte sogleich fort aus dem Thomashof. Ich könnte, sagte ich den Frauenknechtischen, nach einem solchen Auftritte nicht mehr bei ihnen bleiben. Sie aber hielten mich an beiden Händen und baten unter Weinen und Jammern, ich möge um alles in der Welt nur bleiben, sie wollten mir geben, was ich verlange. Von dem noch nicht bezahlten Kaufschilling für den Thomashof würden sie so viel herablassen, als ich wollte. Durch alles das ließ ich mich denn auch endlich halten. Ich schaffte mein in dem oberen Zimmer stehendes Bett in den Hausflur und übernachtete unten. Des anderen Morgens ging ich früh von zu Haus weg. Der Leichnam blieb indessen in meinem Zimmer. Als ich gegen Abend wieder auf meine Stube kam, sah ich hier die tote Eichstätter schon auf einer Misttrage liegen. Mutter und Tochter sagten mir, sie wollten sie in der Seitenkammer des Stadels vergraben. Ich erwiderte, sie möchten sie hintun, wo sie wollten. Ich könne ihnen nicht helfen. Zwischen 8 und 9 Uhr abends trugen nun Mutter und Tochter den Leichnam auf einer Misttrage in das Stadelkämmerchen und bedeckten ihn mit Erde. – Das ist die traurige Wahrheit.« Der Pfarrer atmet hörbar aus. »Nun ist mir leichter. Ich erkenne mit Bedauern, dass ich mich schon früher hätte offenbaren sollen.« Er sah den Ermittler bittend an. »Aber ist mir mehr vorzuwerfen als ein Irrtum meines Verstandes, entstanden in einem Moment des Erschreckens? Und zu dem mich meine Christenliebe und, wie ich glaubte, meine Priesterpflicht verleitete, weil ich nicht dazu beitragen wollte, diese bedauernswerte Familie noch tiefer ins Unglück zu stürzen?«
»Nun, bei einer gerichtlichen Enquete eine falsche oder unvollständige Aussage zu machen ist kein geringes Vergehen, Hochwürden. Aber ich bin mir sicher, dass das Gericht Ihre seelische Not anerkennen wird.« Und es wird sich hüten, einen Mann der Kirche deswegen ins Zuchthaus zu werfen, denkt er.
Der Pfarrer lächelt väterlich. »Dann kann ich jetzt zu meinen Pfarrkindern zurückkehren? Sie erwarten mich, und ich möchte sie nicht so lange ohne geistlichen Beistand lassen.«
Der Kommissar bittet um ein wenig Geduld. Er lässt Riembauer in seine Zelle zurückbringen, geht zu seinem Vorgesetzten und bespricht sich mit ihm. Dann lässt er den Häftling wieder holen.
Er bedauere, aber die Haft müsse noch einige Tage aufrechterhalten bleiben. Wie Hochwürden sicher einsähe, erfordere seine Aussage noch einige Nachermittlungen. Zur Dauer könne er keine Versprechungen machen. Doch mehr als eine Woche, schätzt er, nähmen die erneuten Vernehmungen gewiss nicht in Anspruch.
Pfarrer Riembauer senkt demütig den Kopf. »Ich muss wohl Verständnis dafür haben.«
Na ja, vielleicht werden es doch ein paar Tage mehr, denkt der Kommissar.
II.
Mit der Festnahme Franz Sales Riembauers beginnt eines der längsten und bizarrsten Verfahren der bayerischen Kriminalgeschichte. In seinem wechselvollen Verlauf wird Zug um Zug eine Reihe von Verbrechen aufgedeckt, wie sie kaum jemand für vorstellbar gehalten hatte. Fast fünf Jahre vergehen, bis endlich das Urteil gesprochen wird. Die Ermittlungsprotokolle – über hundert Verhöre und Gutachten – sind auf fast 30 Foliobände angewachsen. Sie enthalten die Geschichte eines entgleisten Lebens.
Als Franz Sales Riembauer in Haft genommen wird, ist er 43 Jahre alt. Sein Geburtsort Langquaid ist ein kleiner, aber lebhafter Marktflecken im Hopfenland. Die Ernten dieses fruchtbaren Landstrichs südlich Regensburgs geben gute Erträge, der Handel floriert. Doch Riembauers Eltern sind bitterarme Kleinhäusler, die sich als Tagelöhner auf den Höfen durchs Leben schlagen und deren Kinder sich für einen Bettellohn als Viehhirten bei den begüterten Bauern verdingen müssen.
Aber während die anderen Familienmitglieder ihr Schicksal hinnehmen, spürt der kleine Franz Sales schon früh, dass er Not und Enge seiner Herkunft überwinden muss, um nicht unterzugehen. Ein glühender Lebenswille treibt ihn. Dass er ein wacher Kopf ist, fällt dem Pfarrherrn auf. Dieser weiß nur zu gut, dass das herrschende Erbprinzip eine Heerschar junger Leute hervorbringt, deren Zukunftsaussichten düster sind. Denjenigen unter ihnen, die es nicht als Handwerker oder – solange es ihre Körperkraft zulässt und wenn die Herrscher wieder einmal Bedarf an Kanonenfutter haben – als Soldaten zu bescheidener Existenz bringen, bleibt nichts als ein tristes Schicksal. Ehelos, nicht sonderlich geachtet, oft schutzlos Not und Krankheit ausgesetzt, fristen sie ihr Dasein.
Aus ihnen rekrutiert der Klerus seit Jahrhunderten seinen Nachwuchs. Ein geniales Konzept, denn diese mittellosen Bauernkinder sind ohne Anhang und familiäre Verpflichtung, ihre Familien sind froh, die überzähligen Esser los zu sein.
Und es finden sich darunter immer wieder hochbegabte Geister, die nun der Kirche auf Gedeih und Verderben verbunden sind. Was diese sich durchaus etwas kosten lässt. Sie nimmt die hoffnungsvollsten Talente in fürsorgliche Obhut, finanziert ihnen die Ausbildung, versorgt sie zuletzt mit komfortablen, lebenslang sicheren Stellungen.
Der kleine Franz Sales wiederum begreift schnell, dass dies seine einzige Chance ist. Er will Priester werden, bekniet den Pfarrer unterwürfig, ihn zu unterrichten. Dieser nimmt den Jungen schließlich unter seine Fittiche. Es ist ein hartes Regiment, schon kleinste Verfehlungen werden unnachsichtig geahndet, wo Worte nicht zum Ziel führen, hilft der Rohrstock nach. Doch Franz Sales gibt nicht auf. Wie ein Erstickender nach Luft ringt, saugt er alles Wissen an, dessen er habhaft werden kann. Die strenge Führung durch seinen Mentor zeigt Wirkung. Der Junge erfüllt alle Erwartungen, die an ihn gerichtet waren, er lernt eifrig, kann mühelos folgen.
Schließlich wird er zum Theologiestudium in Regensburg zugelassen. Er wird ein Musterstudent. Sein Betragen ist vorbildlich, er ist bedingungslos gehorsam, beeindruckt seine Professoren mit geistiger Wendigkeit. Er wühlt sich durch die Kirchengeschichte, sein unerschöpfliches Gedächtnis erlaubt ihm bald, aus jeder Epoche der abendländischen Geistesgeschichte fehlerlos zu zitieren.
Er entdeckt die Macht der Worte, besäuft sich an Rhetorik, ist fasziniert von Kasuistik und Sophistik, mit denen sich begriffliche Schimären und verführerische Scheinlogik zu überzeugenden Wahrheiten deuteln lassen. Von unersättlicher Wissensgier getrieben, öffnet er sich der geistigen Moderne jener Zeit. Er beginnt, die hergebrachten metaphysischen Denkgebäude mit Vernünftelei und Clarté abzugleichen, die sich, vom revolutionären Frankreich ausgehend, über Europa verbreiteten. Brillant denkend, seziert er nun alle Dogmen, die man ihm eingebleut hatte, reflektiert ihre Widersprüche und logischen Schwächen.
Von seinen kühl exerzierten geistigen Expeditionen erhitzt und berauscht, übersieht er, dass er den Boden unter den Füßen zu verlieren beginnt. Das Leben war ihm zum unterkühlten Laboratorium geworden. Freundschaft, Liebe, Zärtlichkeit – all das hatte er bisher nicht erfahren. Wenn ihn, der längst zum jungen Mann gereift ist, nun immer häufiger die Hitze des Lebens anstrahlt, bemerkt er zu seinem Entsetzen, dass er sehr wohl straucheln könnte. Taugten alle moralischen Konstrukte nichts? War sie nur ein vergeblicher Versuch, die Natur des Menschen zu bändigen? Was ist gut, was ist verwerflich? Wenn etwas existiert, muss es doch Gottes Werk sein! Ist es nicht eine entsetzliche Anmaßung, die körperliche Lust, diese wilde, süße, so grenzenlos seligmachende Empfindung zu verteufeln? Ihr göttlicher Zweck ist doch, Leben zu spenden! Und wenn dem so ist – kann diese Einsicht nicht nur erlauben, sondern sogar erfordern, kleingeistige moralische Gebote zu übertreten?
Je mehr ihm theologische und moralische Gewissheiten abhandenkommen, desto mehr klammert er sich mit fanatischer Unbedingtheit an jene, die er selbst als Wahrheit zu erkennen glaubt. Seine Kommilitonen meiden ihn, werfen ihm übertriebenen Ehrgeiz und Berechnung vor. Er wird bitter, Schübe rasenden Hasses und sadistischer Phantasien quälen ihn. Verzweifelt sucht er nach einem Ausweg. An Flucht ist längst nicht mehr zu denken, seine Laufbahn als Priester ist sein einziger Halt. Alles abzubrechen würde ihn ins Bodenlose stürzen lassen. Er würde wieder zum Nichts.
Und jetzt aufgeben, was er schon erreicht hat? Längst steht er über all jenen, unter denen er früher der Letzte war. Ihm, der zuvor Weidevieh hütete, wird jetzt Ehrfurcht entgegengebracht. Die ihn früher verprügelten, ducken sich bei seinem Erscheinen verschüchtert weg oder buhlen um seine Zuwendung.
Nein, zur Kapitulation ist es zu spät. Immer rücksichtsloser verfolgt er sein Ziel. Erbarmungslos schlägt er um sich, wenn ihm Neider Hindernisse in den Weg legen wollen, er denunziert sie, lässt sie in Fallen tappen, vernichtet sie. Keiner von ihnen ist seinem rasenden Aufstiegswillen gewachsen.
Seine Zeugnisse bestätigen ihn. Sie sind glänzend.
Mit fünfundzwanzig empfängt er die Priesterweihe. Bevor ihm eine Pfarrstelle zugeteilt wird, hat er sich in mehreren Gemeinden als Kaplan zu bewähren. Schon bald erwirbt er sich den Ruf eines flammenden Predigers, der leidenschaftlich die Sittenverderbnis der Welt anprangert, die Schrecken des Fegefeuers und der Hölle schildert und zur Bußfertigkeit mahnt. Seine donnernden Worte fahren den Gläubigen durch Mark und Bein. Doch so unnachsichtig er sich auf der Kanzel gibt, so sehr gewinnt er außerhalb der Kirchenmauern die Herzen des Volks mit überströmender Güte. Stets ein mildes, gnadenvolles Lächeln auf den Lippen, das ein wenig im Widerspruch zu seiner athletischen, vor Virilität dampfenden Erscheinung steht, erteilt er seinen Schäfchen Absolution.
Er hat bemerkt, dass sich die Dörfler nicht allein deshalb in seine Hände begeben und von ihm lenken lassen, weil sie von der Autorität seines Standes und seiner Bildung beeindruckt sind. Sondern vor allem deshalb, weil sie ihm eine Nähe zu den überirdischen Mächten zuschreiben.
So umgibt ihn auch bald die Aura eines Mystikers. Man zweifelt nicht mehr daran, dass er ein Auserwählter ist, der mit göttlichen Geheimnissen vertraut ist und mit der Seelenwelt in Verbindung steht. Er verrät den ihm erschauernd Lauschenden mit feierlich gesenkter Stimme, dass ihn immer wieder die Geister der Verstorbenen aus dem Fegefeuer um Hilfe und Erlösung bäten. Wenn er nachts über die Felder zu Kranken oder Sterbenden eile, so näherten sich ihm oft die armen Seelen in Gestalt von kleinen Flämmchen. Wenn er diese dann segne, so bewegten sie sich vor ihm nach rechts oder nach links, je nachdem, wohin er seine geweihten Finger führe. Prompt verschwanden die Erscheinungen, wenn die Familienangehörigen ihre Börse gezückt und eine Messe für ihre verstorbenen Altvorderden hatten lesen lassen.
Doch es gibt erste Irritationen. Die Pfarrersköchin, ein gutherziges junges Ding, wird schwanger. Die Gläubigen hätten wenig Aufhebens darum gemacht, da sie ihren Pfarrherrn schätzten. Für Verwunderung sorgt nur, dass dieser bereits hoch in den Achtzigern steht. Und das Mädchen, nach dem Vater eindringlich befragt, schweigt eisern. Doch die Unruhe ebbt ab, die Sache kann schicklich gelöst werden: Das Mädchen wird unauffällig ins nahe Landshut verfrachtet, wo es das Kind zur Welt bringt. Kurz danach – war es ein weiser Ratschluss des Allerhöchsten, wie verstohlen gemutmaßt wurde? – stirbt das Neugeborene.
Auch in anderen Stationen seiner Kaplanskarriere, die Franz Sales Riembauer in Erwartung einer Pfarrstelle durchläuft, in Pfarrkofen, Oberglein und Sollach gibt es jeweils Kinder, deren Mütter jede Auskunft über ihre Erzeuger verweigern.
(Während des späteren Verfahrens wird man ihm das Ausmaß seiner Zügellosigkeit vorhalten. Seine Verfehlungen überstiegen jedes Maß und seien auch bei größter Nachsicht nicht mehr hinzunehmen, als gewissenloser Manipulateur und vor Geilheit triefender Verführer habe er sich erwiesen.
Doch Riembauer knickt nicht etwa schuldbewusst ein, sondern gibt sich als leidenschaftlicher Modernist: Nicht er sei es, der sich sündig verhalten habe! Der Zölibat sei es, der eine Sünde gegen den Plan Gottes darstelle! Das Gerichtsprotokoll hat Riembauers säuberlich nummerierte Rechtfertigung festgehalten: »Ich überlegte, erstens, dass es nach der Vernunft nicht unerlaubt sein könne, ein Kind zu erzeugen; denn eine vernünftige Kreatur hervorzubringen ist etwas Gutes. Zweitens, auch wider Gottes Anordnung kann es nicht sein, weil dadurch die Zahl der Auserwählten einen Zuwachs erhält. Drittens, auch wider die Kirche nicht, wenn dieser Mensch zu einem rechtschaffenen Christen gebildet wird. Viertens, auch wider den Staat nicht, wenn ein solches Mitglied sittlichen und bürgerlichen Unterricht bekommt und so zu einem guten Staatsbürger und treuen Untertan erzogen und die beteiligte Mutter nicht verlassen wird.«
»Gut und schön«, wird der Ermittler bemerken. »Aber Sie übersehen dabei, dass es nichts als Ihre hohe Stellung gewesen ist, die Ihnen Ihr schändliches Treiben erlaubt hat. Nur sie hat Ihnen ermöglicht, Ihre Lust an anderen zu befriedigen, weil Sie sie mit der Macht und dem Ansehen Ihres Standes überwältigen konnten.«)
Riembauer scheint es durchaus ernst mit seinen väterlichen Pflichten zu sein. Die Ermittler müssen anerkennen, dass der Pfarrer sich nachweislich bemühte, seine Kinderschar zu ernähren, wie auch, die Mütter finanziell einigermaßen zufriedenzustellen. Das jedoch fällt ihm zunehmend schwerer. Immer häufiger bleibt er Rechnungen schuldig, muss er Amtsbrüder um Geld anpumpen.
Doch seine Gier fegt alles beiseite, immer wieder. In der Pfarrei Hirnheim ist es die hübsche und selbstbewusste Küchenhilfe Anna Eichstätter, die seine Begierde anstachelt. Auch sie wird kurz nach seiner Ankunft von ihm schwanger. Wie seine anderen Geliebten lässt auch sie sich auf ein Arrangement ein, sie zieht erst einmal nach Regensburg, wo sie ihr Kind zur Welt bringt. Er kann einen Kollegen beschwatzen, sie als Köchin einzustellen.
Anna jedoch lässt sich nicht so leicht abspeisen. Sie verlangt nicht nur regelmäßigen Unterhalt, sondern auch einen angemessenen Ausgleich für die fehlende Erbberechtigung für sie und ihr Kind. Und Geld für schöne Kleidung, sie will sich als elegante Madame präsentieren, niemand sollte auch nur auf die Idee kommen, auf sie als eine Schlampe mit Bankert mit Fingern zu zeigen. Riembauer zeigt Verständnis, kann sie aber vorerst davon überzeugen, dass er als Kaplan dafür zu wenig verdient. Er könne ihr aber versprechen, sie als seine Haushälterin zu sich zu nehmen, wenn er demnächst Pfarrer werde und eine eigene Pfarrstelle erhielte. Damit stünde sie im Dienst der Kirche, wären sie und ihr Kind abgesichert. Anna willigt ein. Und hat jetzt auch nichts mehr dagegen, den Abschluss ihrer Vereinbarung im Bett zu feiern.
Doch die Einlösung dieses Versprechens zieht sich hin.
Riembauer wird erst einmal auf eine weitere Kaplansstelle versetzt. Hier, im Dörfchen Pondorf, kommt es zu einem ersten Eklat. Es ist Riembauer selbst, der in einem empörten Schreiben an das Ordinariat um Versetzung ansucht. Als Grund für seinen Wunsch nennt er »Ärger über den Sittenverfall der Welt und die Verderbtheit der jungen Geistlichkeit«. Man geht der Sache nach und findet heraus, dass tatsächlich einige andere Kapläne die reizende Nichte des Pfarrers umworben hatten, offenkundig mit Erfolg.
Ein Rüffel an die Adresse der Nebenbuhler folgt, begleitet vom Lob für das vorbildliche Verhalten des Antragstellers. Dessen Ersuchen wird stattgegeben, er wird nach Oberlauterbach versetzt, eine zur Pfarrei Pirkwang gehörende Filiale. Kaplan Riembauer nimmt die Nachricht mit Genugtuung entgegen.
Auch die Oberlauterbacher Gläubigen zieht er mit seinen wortgewaltigen Predigten umgehend in seinen Bann. Längst beherrscht er die Rolle des erfahrenen Seelsorgers, die Dörfler sind hingerissen von seiner Jovialität, seiner Belesenheit, seiner augenscheinlich tiefen Frömmigkeit – und seiner tatkräftigen Barmherzigkeit, mit er sich um die Armen des Ortes bemüht.
Das triste Schicksal der Familie Frauenknecht, die den am Dorfrand gelegenen Thomashof bewirtschaftet, liegt ihm besonders am Herzen. Der alte, von einer verzehrenden Krankheit geschwächte Vater, seine abgearbeitete und ebenfalls bereits hinfällige Ehefrau und ihre beiden noch nicht volljährigen Töchter können sich nur noch mühsam über Wasser halten.
Kaplan Riembauer, vom Los der tiefgläubigen und bescheidenen Leute sichtlich betroffen, legt die Soutane ab, krempelt die Ärmel hoch und packt beherzt mit an. Er hilft bei der Heuernte, schuftet und schwitzt beim Pflügen und Säen, ist sich nicht einmal zu schade dafür, den Stall zu säubern und Mist auszubringen. Ist die Arbeit getan, versammelt er die Familie zum Gebet.
Im Dorf reibt man sich die Augen. Das hatte es noch nie gegeben. Doch niemand wagt, ihn darauf anzusprechen. Und so flicht er selbst eines Tages in eine seiner Predigten ein: Dies sei nun einmal sein Verständnis von gelebter christlicher Liebe, und er könne sich dabei nicht nur auf das Karthagische Konzil, sondern auch auf das Beispiel vieler Bischöfe und Priester beziehen, welche wie er der Überzeugung seien, dass es gerade einem Diener Gottes gut anstehe, die körperliche Arbeit nicht zu verschmähen. Nein, damit vergebe er keinesfalls die Würde seines Amtes. Die Zeiten seien außerdem im Wandel. Ein moderner Priester müsse ein offenes Auge für die Nöte seiner Gläubigen haben.
Die Leute auf dem Thomashof können kaum glauben, wie ihnen geschieht. Dass sich ein Geistlicher Herr dazu herabließ, mit ihnen diesen nahen Umgang zu haben? Womit haben sie verdient, von ihm erwählt worden zu sein? Sie sind vor ehrfürchtiger Scheu wie gelähmt, beten ihn wie einen Heilsbringer an.
Unbeholfen zeigen sie ihm ihre Dankbarkeit. Kaplan Riembauer wehrt bescheiden ab. Noch sei der Hof nicht über den Berg, gibt er zu bedenken. Noch stehe eine Menge Arbeit an. Am besten sei, er ziehe ganz bei ihnen ein. Die einfachste Kammer reiche ihm völlig aus – man habe doch nichts dagegen?
Die Frauenknechtischen nicken mit offenen Mündern. »Diese Ehre, Hochwürden … diese Ehre …«, stammelt die Mutter.
Einige Tage später nimmt er mit wohlwollendem Lächeln zur Kenntnis, dass man ihm selbstverständlich die schönste und größte Kammer des Thomashofs zur Verfügung stellt. Er widersetzt sich nicht.
Mit der einfältigen und gehorsamen Magdalena hat er ein leichtes Spiel. Kleinere Vertrautheiten hatte er bereits zuvor eingefädelt, wenige Tage später macht er die Siebzehnjährige zu seiner Geliebten.
Er lädt sie zum gemeinsamen Gebet in seine Kammer, in der er mit geweihten Kerzen eine feierliche Atmosphäre geschaffen hat. Ihre schwächliche Abwehr kann er mit einem selbst erfundenen Ritus beiseitewischen, die sich bei seinen anderen Liebschaften bereits bewährt hat. Es ist eine Art priesterliches Konkubinat, das er mit raunend vorgetragenen lateinischen Formeln, dem Umschlingen der Hände der zu Verbindenden mit der priesterlichen Stola, einer Segnung und gemeinsamem Gebet besiegelt. Diese geheime Zeremonie werde nur Auserwählten zuteil, erklärt er Magdalena wie vielen Frauen zuvor, und da sie nun als seine Priestergattin Mitglied einer weitverbreiteten, doch im Verborgenen wirkenden Elite wahrer Gottgläubiger sei, müsse sie schwören, keinen Menschen darüber ins Vertrauen zu ziehen. Es sei allein der widernatürliche, gegen den göttlichen Plan gerichtete Zölibat, der zur Geheimhaltung zwinge.
Bebend vor Ehrfurcht lässt sie alles über sich ergehen. Dann wirft er sich beglückt auf sie. Der Priester ist ihr erster Mann. Sie ist ihm bald verfallen. Und wird kurz darauf schwanger.
Der Vater, bereits schwer krank, scheint es nicht mehr zu registrieren. Die Mutter ahnt etwas, verschließt aber die Augen. Kann wirklich Sünde sein, was ein Gottgeweihter gutheißt? Sie und ihre älteste Tochter leben längst in der traumhaft entwirklichten Welt, die Kaplan Riembauer mit Weihrauchschwaden, inbrünstigen Gebeten, von Geheimnissen durchwobenen religiösen Verrichtungen und seiner unwiderstehlichen Autorität errichtet hat.
Ein Jahr später stirbt der Alte. Riembauer, nun einziger Mann und damit Regent auf dem Thomashof, macht der Mutter das Angebot, den Hof zu kaufen. Er taxiert den Wert niedrig. Er begründet es damit, dass er ihnen bis an ihr Lebensende ein Wohnrecht gewähren wird.
Die Mutter ist einverstanden, alleine könnte sie den Hof nicht halten. Sie unterzeichnet arglos eine Urkunde. Und eine Quittung für eine Summe, die sie nie erhalten wird. Kaplan Riembauer wird ihr, als sie sich später unterwürfig danach erkundigt, trickreiche Verrechnungen präsentieren.
Nach wenigen Monaten ist Magdalenas Schwangerschaft nicht mehr zu übersehen. Riembauer kann nicht riskieren, dass es im Dorf und Bezirk zu Geschwätz kommt, es könnte seine Karriere gefährden. Auch jetzt findet er eine Lösung. Er schickt Magdalena nach München, im Haushalt eines entfernten Bekannten solle sie kochen lernen, erklärt er in der Gemeinde. Er vergisst nicht, darauf hinzuweisen, dass er großzügigerweise die Ausbildungskosten übernimmt.
Niemand in seiner Pfarrei bekommt mit, dass Magdalena im fernen München ein Kind zur Welt bringt. Ganz fürsorglicher Kindsvater besucht er sie immer wieder. Er überzeugt sie davon, den Säugling zunächst einer Amme anzuvertrauen.
Auch seine anderen Kinder wachsen heran, ihre Mütter werden fordernder. Die meisten seiner ehemaligen Geliebten kann er immer wieder begütigen, doch sein kärgliches Kaplansgehalt und der Ertrag seines Hofes reichen nicht aus, um die Alimente aufzubringen. Immer häufiger bleibt er sie schuldig, muss er beschwichtigen oder, wo nötig, drohen. Führt auch das nicht zum Erfolg, schlägt er zu. Er ist groß und kräftig, allein seine drohend erhobene Faust lässt die Frauen einlenken.
Im Sommer 1807 wird es wieder einmal eng für Riembauer. Noch ist die Ernte nicht eingefahren, in diesem Jahr wird sie außerdem schlecht sein und kaum etwas erlösen. Doch es gibt einen Lichtblick. Er hat die Ladung zur Pfarramtsprüfung in Händen. Er ist glänzend vorbereitet, hat sich einflussreicher Fürsprecher versichert und hat keine Zweifel, diese Hürde zu nehmen. Als Pfarrer kann er mit einem deutlich höheren Gehalt rechnen – eine Entlastung, die er dringend benötigt.
Doch ausgerechnet jetzt holt ihn seine Vergangenheit ein. Anna Eichstätter ist seiner Vertröstungen leid, er hat ihr schon seit Monaten kein Kostgeld mehr zukommen lassen. Als ihr zu Ohren kommt, dass er bereits einer Filialpfarrei vorsteht, wird sie hellhörig. Da hatte er doch bereits Anrecht auf eine Haushälterin? Sie beschließt, ihn zur Rede zu stellen.
Die kleine Katharina ist allein auf dem Thomashof, als Anna Eichstätter eintrifft. Sie gibt zu Protokoll: »Als im Sommer 1807 meine Schwester Magdalena zum Kochenlernen und der geistliche Herr Riembauer, um sein Pfarramtsexamen zu machen, sich in München aufhielten, kam eine Weibsperson von zweiundzwanzig Jahren, großer Statur, sehr hübsch, länglichen Gesichts, mit hellbraunen langen Haaren, bürgerlich schön gekleidet, mit einer Riegelhaube auf dem Kopf, in unsere Wohnung, als eben meine Mutter auf dem Feld sich befand. Sie gab sich für die Base des Herrn Riembauer aus und verlangte, als ich ihr sagte, dass der bei dem Kurse in München sei, die Zimmerschlüssel von mir, die ich ihr, als einer fremden Person, verweigerte. Sie erhielt sie aber von meiner Mutter, nachdem diese nach Hause gekommen war. Sie ging damit auf das Zimmer des Geistlichen und suchte darin herum, als wäre sie in ihrer eigenen Wohnung.«
Riembauer besteht die Prüfung mit Auszeichnung. Nun darf er sich Pfarrer nennen. Voller Tatendrang kehrt er auf den Thomashof zurück. Dort jedoch findet er einen geharnischten Brief vor. Anna Eichstätter rechnet ihm das ausstehende Kostgeld vor, die Schulden sind zu einer enormen Summe angewachsen. Und sie hat den Braten gerochen und pocht auf die Einlösung des Versprechens, sie als Haushälterin zu sich zu nehmen. Andernfalls sähe sie keine andere Möglichkeit mehr, als sich an seine Vorgesetzten zu wenden.