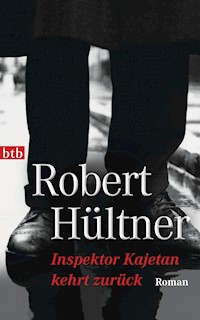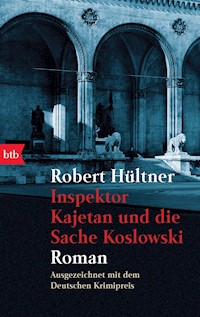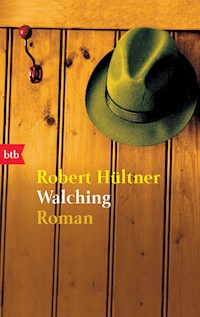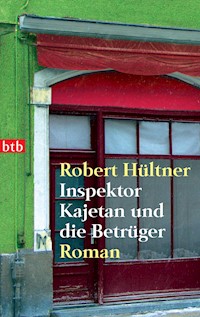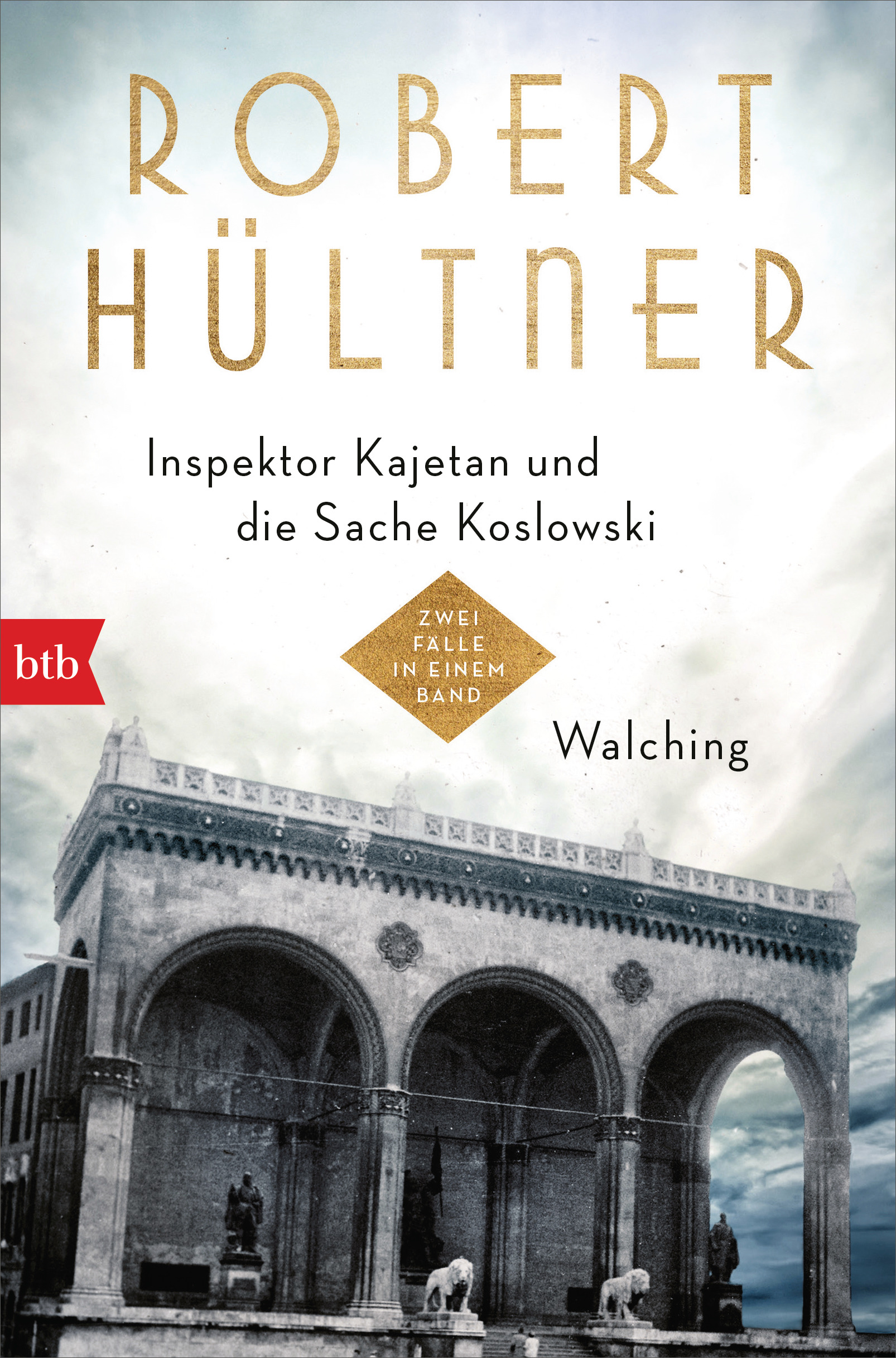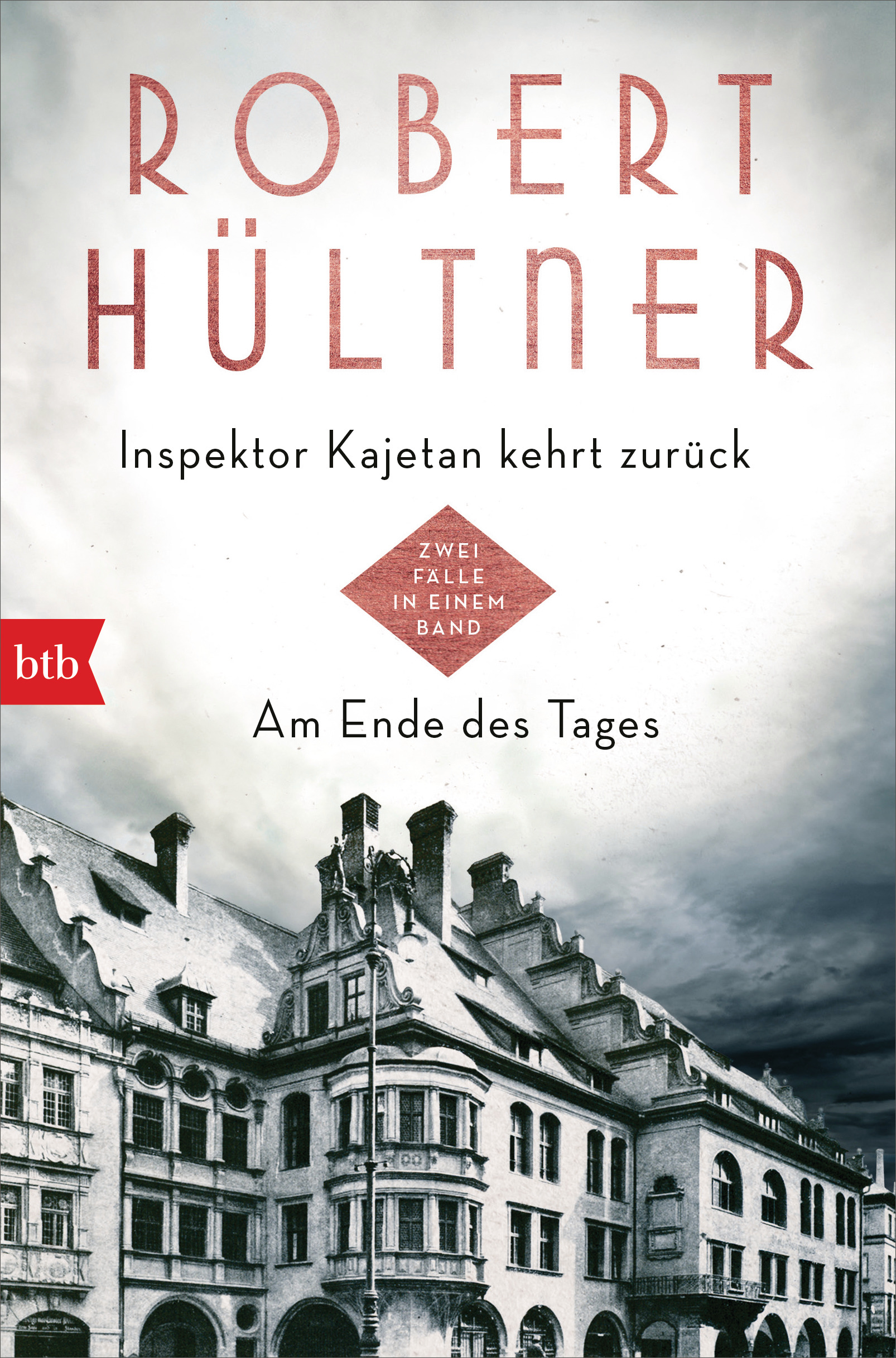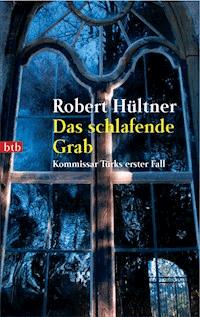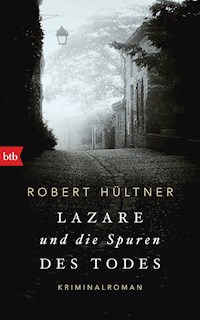
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Lazare
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Politisch aktuell und vielschichtig
Kommissar Lazare wird ins südfranzösische Sète gerufen, denn ein junges muslimisches Mädchen wird vermisst. Während die ersten Ermittlungen in Richtung Radikalisierung gehen und man davon ausgeht, Nadia könne sich nach Syrien abgesetzt haben, findet sich Lazare plötzlich in einem Strudel gesellschaftlicher Abgründe wieder. Verbindungen in den katalanischen Untergrund werden immer deutlicher, ein ganzer Landstrich wird verdächtigt, radioaktiv verseucht zu sein, und plötzlich kreuzen zwei Tote die Ermittlungen. Lazare fällt es in seiner bekannten Art nicht leicht, sich doch noch mit der hiesigen Polizei zusammenzuraufen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Ähnliche
Zum Buch
Kommissar Lazare wird ins südfranzösische Sète gerufen, denn ein junges muslimisches Mädchen wird vermisst. Während die ersten Ermittlungen in Richtung Radikalisierung gehen und man davon ausgeht, Nadia könne sich nach Syrien abgesetzt haben, findet sich Lazare plötzlich in einem Strudel gesellschaftlicher Abgründe wieder. Verbindungen in den katalanischen Untergrund werden immer deutlicher, ein ganzer Landstrich ist gefährdet, radioaktiv verseucht zu werden, und plötzlich kreuzen zwei Tote die Ermittlungen. Lazare fällt es in seiner bekannten Art nicht leicht, sich doch noch mit der hiesigen Polizei zusammenzuraufen.
Zum Autor
ROBERT HÜLTNER wurde 1950 in Inzell geboren. Er arbeitete unter anderem als Regieassistent, Dramaturg, Regisseur von Kurzfilmen und Dokumentationen, reiste mit einem Wanderkino durch kinolose Dörfer und restaurierte historische Filme für das Filmmuseum. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören neben historischen Romanen und Krimis auch Drehbücher (u. a. für den Tatort), Theaterstücke und Hörspiele. Sein Roman »Der Sommer der Gaukler« wurde von Marcus H. Rosenmüller verfilmt. Für seine Inspektor-Kajetan-Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem dreimal mit dem Deutschen Krimipreis und mit dem renommierten Glauser-Preis.
Robert Hültner
Lazare und die Spuren des Todes
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Juni 2021
Copyright © 2021 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Arcangel Images/Ebru Sidar
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17900-7V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Wir träumen manchmal diesen rührend großen Traum
Einfach zu leben, glühend, ohne üble Worte.
Arthur Rimbaud (1854–1891)
»Denn politische Polizei heißt: eine Einrichtung hervorgerufen durch den Wunsch, sich auf Kosten des Staates zu bereichern, dessen Unruhe man beständig künstlich in Atem hält.«
Eugène François Vidocq (1775–1857), Gründer der Sûreté und »Vater der modernen Kriminalistik«
1.
»Bevor Sie loslegen, hören Sie mir gefälligst zu, Commandant«, sagte Direktor Gridoux. »Ich weiß, womit Sie vermutlich gleich meine Nerven und meine Laune zu strapazieren gedenken. Nach ungefähr einem halben Jahrzehnt in dieser Dienststelle dürften Sie aber mitbekommen haben, dass ich es weder schätze, wenn meine Entscheidungen infrage gestellt werden, noch, wenn mir mit unnötigen Einwänden Zeit gestohlen wird. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
Siso Lazare wechselte das Standbein. »Durchaus«, sagte er. »Aber –«
Gridoux’ Stirn runzelte sich. »Was aber?«
»Warum ausgerechnet ich?« Lazare hielt kurz den Atem an. Es hatte heftiger als beabsichtigt geklungen. Dabei hatte er auf dem Weg zum Büro seines Vorgesetzten kurz innegehalten und durchgeatmet, um seine Aufregung und seinen Ärger unter Kontrolle zu bekommen. Er hatte sich vorgenommen, Gridoux ruhig und beherrscht gegenüberzutreten. Und ihn aufzufordern, seine Entscheidung zu korrigieren.
»Darauf gibt es eine einfache Antwort, Commandant Lazare. Erstens, weil ich es für richtig halte. Zweitens, weil ich Ihr Vorgesetzter bin. Woraus folgt, dass Sie meine Anordnungen auszuführen haben. Damit dürfte sich jede weitere Diskussion erübrigt haben.«
Lazare spürte, wie Blut in seine Wangen schoss. »Noch nicht«, beharrte er.
Gridoux musterte sein Gegenüber einige Sekunden ärgerlich. Er schlug die vor ihm liegende Dokumentenmappe zu und schob sie mit einem Seufzen beiseite. »Verdammt noch mal, Kollege. Ich muss Sie doch nicht über unsere miserable Personalsituation aufklären. Außerdem ist dieser Fall auch deshalb bei Ihnen gut aufgehoben, weil Sie nicht nur Erfahrung in diesem Einsatzgebiet haben, sondern weil die Beteiligten einer arabischen Familie angehören. Sie sollen passabel Arabisch sprechen, habe ich mir sagen lassen.«
Lazare winkte ab. »Ein paar Floskeln, mehr nicht.«
»Ihre Bescheidenheit nimmt Ihnen hier niemand mehr ab, Commandant«, bemerkte Gridoux. »Sollte Ihnen das entgangen sein?«
»Entgangen ist mir höchstens, dass man mich neuerdings nicht mehr für voll nimmt«, erwiderte Lazare hitzig. »So viel Kollegialität darf ich erwarten, dass man es mir ins Gesicht sagt, falls ich jemandem auf die Zehen getreten sein sollte.«
»Überschätzen Sie sich nicht. Über Sie erreicht mich nicht mehr Geschwätz als über andere Untergebene. Also beruhigen Sie sich gefälligst.«
Lazare blieb störrisch. »Aber die Kollegen in Sète werden es als absoluten Affront auffassen, wenn wir uns bei einer derart banalen Angelegenheit einmischen!«
»Woher wollen Sie schon jetzt wissen, dass sie banal ist?«, fuhr Gridoux auf. »Sind Sie Hellseher?«
»Aber in diesem Fall scheint es doch lediglich darum zu gehen, dass eine fast Achtzehnjährige nicht pünktlich nach Hause gekommen ist. Kein Kind, wohlgemerkt. Sondern eine bereits berufstätige junge Frau –«
Der Direktor unterbrach mit einer ungeduldigen Handbewegung: »– die möglicherweise schlicht mit ihrem Geliebten durchgebrannt ist, mag sein. Aber das Besondere an diesem Fall ist unter anderem, dass es sich, wie schon erwähnt, um ein Mädchen aus einer arabischen Familie handelt. Das Gesetz in diesen Kreisen lautet bekanntlich, dass ein unverheiratetes Mädchen gefälligst bei Sonnenuntergang zu Hause zu sein hat, sonst krachts, und das gewaltig. Erst recht, wenn das Gör länger ausbleibt.« Er stöhnte gespielt. »Sitten wie diese sind es, die mich manchmal daran denken lassen, ob ich nicht doch konvertieren sollte.«
Lazare war nicht nach müden Scherzen zumute. »Bisher war mit keinem Wort die Rede davon, dass das Mädchen in Gefahr sein könnte«, maulte er. »Oder dass gar jemand aus ihrer Familie verdächtig ist, ihr etwas angetan zu haben.«
»Nun, dieser und anderen Fragen nachzugehen beschreibt exakt Ihre Aufgabe«, beschied Gridoux kühl. »Wobei bei Letzterem, wenn überhaupt, meines Wissens nur der Vater infrage käme. Bei dem Mann handelt es sich jedoch nach Ansicht der Kollegen in Sète um einen eher schlicht gestrickten Zeitgenossen, der seit Tagen im dortigen Kommissariat auf der Matte steht und Lyrisches absondert. Über das Licht seines Alters, das seine geliebte Tochter für ihn sei, und dergleichen. Vor allem treibt er ihnen mit seinem Vertrauen in die Effizienz der französischen Polizei Tränen der Rührung in die Augen.« Der Direktor sah wie beiläufig auf seine Armbanduhr.
Lazare machte einen letzten Anlauf. »Ein derart läppischer Fall kann von den Kollegen in Sète doch zwischen Vor- und Hauptspeise erledigt werden!«, platzte er heraus.
Gridoux’ Gesicht wurde dunkel. »Ein Urteil darüber, ob ein Fall läppisch ist oder nicht, liegt nicht in Ihrem Ermessen, Commandant, sondern in meinem und dem des Gerichts«, konterte er schneidend. »Ich veranstalte kein Wunschkonzert. Wenn Sie einen Beruf suchen, der Ihnen erlaubt, sich nur die Rosinen herauszupicken, sind Sie bei der Polizei am falschen Platz. Sie befolgen meine Anweisung! Und damit Ende der Diskussion!« Er machte eine kurze Pause, um in einlenkendem Ton fortzufahren: »Sie werden übrigens mit Richter Simoneau zusammenarbeiten.« Er bemerkte Lazares Verblüffung und nickte nachdrücklich. »Hören Sie also auf, den Gekränkten zu geben. Nichts liegt mir ferner, als Sie zu unterfordern. Dass ein Beamter mit Ihrer Erfahrung nicht mit Fällen behelligt werden sollte, die schon bei einem Polizeischüler ein Gähnen hervorrufen würden, darüber herrscht zwischen Richter Simoneau und mir Konsens. Aber vielleicht sollten Sie sich einen Reim darauf machen, dass der Richter keinerlei Einwände gegen meinen Vorschlag vorbrachte, ausgerechnet Sie damit zu betrauen. Im Gegenteil. Und nachdem von Richter Simoneau noch keine schwülen Gerüchte über etwaige masochistische Neigungen im Umlauf sind, die auf die heiße Sehnsucht deuten könnten, wieder mit einem, sagen wir, nicht immer einfachen Charakter wie Ihnen arbeiten zu dürfen, könnte daraus wohl welcher Schluss gezogen werden?« Er ließ Lazare keine Zeit für eine Antwort. »Nichts anderes, als dass Simoneau in voller Absicht einen erfahrenen Ermittler anfordert. Was wiederum die Vermutung nahelegt, dass er diesen Fall als keineswegs läppisch einschätzt.« Einen Zug der Herablassung um die Lippen, ergänzte er: »Ein weiterer Beleg dafür, dass die Chose möglicherweise doch nicht ganz unbedeutend sein könnte, ist, dass man Richter Simoneau nachsagt, noch etwas werden zu wollen. Mit einem Fall, bei dem er sich nicht profilieren kann, würde er sich nicht abgeben.«
Lazare pflichtete ihm widerwillig bei. Was Gridoux andeutete, war nicht von der Hand zu weisen. Seit den letzten Wahlen wurden in Behörden und Politik die Karten neu gemischt. Auch waren kürzlich in der gesamten Republik neue Großregionen geschaffen worden. Neue politische Allianzen hatten sich gebildet, über Generationen wirksame Einflussbereiche und Zuständigkeiten zersetzt. Wie viele andere Beamte musste sich auch Richter Simoneau darum bemühen, den Anschluss nicht zu verlieren und seine Position abzusichern. In den Fluren des Gerichts in Montpellier und in der Polizeizentrale raunte man sich außerdem zu, dass er mit Bernard de Soto, dem nicht minder ehrgeizigen Chef der Kripo-Staatsschutzabteilung, um eine neu geschaffene Stelle als Leiter der Justizverwaltung der Regionalregierung rivalisiere.
Gridoux ergänzte süffisant: »Weshalb Richter Simoneau der Angelegenheit größere Bedeutung beimisst, darüber wird er uns sicher umgehend und in aller notwendigen Ausführlichkeit in Kenntnis setzen. Sie teilen doch diese Hoffnung, Commandant?«
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich Lust auf derlei Spielchen habe, Monsieur le directeur.«
»Ich habe es befürchtet«, seufzte Gridoux. Er senkte die Stimme. »Dann will ich Ihnen jetzt etwas verraten. Etwas, von dem ich erwarte, dass es strikt unter uns bleibt. Wenn nicht, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass Sie in dieser Abteilung bis ans Ende Ihrer Dienstzeit keine glückliche Stunde mehr haben werden. Haben Sie das kapiert?«
»Ich höre«, sagte Lazare.
Der Direktor beugte sich vor, seine Ellbogen auf die Schreibtischplatte gestützt. »Wir kennen Richter Simoneau mittlerweile. Er will sich immer wieder auf unsere Kosten in Szene setzen, holt sich aber in schöner Regelmäßigkeit eine blutige Nase. Mit welchem grandiosen Plan er gerade schwanger geht, kann ich noch nicht einschätzen, bin mir aber sicher, dass er sich auch dieses Mal wieder verrennt. Daraus ergibt sich, was ich von Ihnen erwarte, Commandant Lazare. Nämlich, dass Sie ihm seine Flausen austreiben. Wie, das überlasse ich Ihnen. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass sich seine nervigen Interventionen in die Arbeit unserer Abteilung künftig auf ein erträgliches Maß reduzieren.« Er hob die Brauen. »Was glotzen Sie mich an? Ist Ihnen das zu hoch?«
»Nein.«
»Gut«, schnaubte Gridoux. »Dann wissen Sie auch, dass es meine Art ist zu zeigen, dass ich sowohl Ihrer Loyalität als auch Ihrer Intelligenz einigermaßen vertraue, wenn ich Sie in meine Absichten einweihe. Geht das in Ihren verdammten Dickschädel, Sie Nervensäge?« Befriedigt registrierte er Lazares Nicken. »Und nun wüsste ich nicht, was Sie hier noch zu suchen haben.« Die Kopfbewegung in Richtung der Türe war unmissverständlich. »Oder benötigen Sie eine Belehrung darüber, dass die Zeit der größte Feind jeden Ermittlers ist?«
»Ich habe davon gehört«, sagte Lazare.
»Dann bin ich beruhigt«, sagte Gridoux herablassend. »Und jetzt machen Sie sich vom Acker, sonst muss ich ungemütlich werden. Was ich an Ihrer Stelle nicht riskieren würde.«
2.
Seit dem frühen Morgen hatte Corentin Arnal vergeblich versucht, die Motorsäge in Gang zu bringen. Er hatte die Abdeckung abgenommen, Ölstand, Benzinfilter und Zündkerze überprüft und gesäubert, das Gerät wieder verschraubt, den Anlasser gezogen, wieder und wieder. Ein Brennen durchzuckte seine Oberschenkel, als er sich jetzt aus der Hocke löste und streckte. Es war heiß, sein Hemd klebte ihm am Leib. Er wischte sich mit dem Hemdzipfel über seine schweißnasse Stirn und die Augen. Er kippte seinen Kopf in den Nacken und kniff die Lider zusammen. Dichte Wolken hatten begonnen, sich von Westen vor das milchige Blau des Himmels zu schieben, Wind war aufgekommen.
Wieder griff das Gefühl einer unbestimmten Bedrohung nach Corentin. Sein Blick fiel auf den wenige Schritte entfernten, turmhohen Kastanienbaum, dessen totes Geäst wie Finger eines Skeletts in den Himmel griff. Ein klaffender Riss spaltete den wettergrauen Stamm; Faulholz leuchtete in der Tiefe des Spalts, dunkelrot und glimmend wie eine frische Wunde. Die Baumruine konnte noch weitere fünfzig Jahre überstehen oder schon im nächsten Winter, von Nässe und Schnee beschwert, von einem Sturm gefällt werden. Oder, nach einem kaum spürbaren Windhauch, bereits in der nächsten Minute. Ihr tonnenschweres Gewicht würde alles unter sich zermalmen. Nicht nur das Dach der seit langem verlassenen Bahnstation daneben, sondern auch den klapperigen Wohnwagen, in dem Corentin seit einigen Monaten hauste. Und ihn selbst. Vielleicht, wenn er gerade auf dem Klapptisch davor sein Abendessen zu sich nahm. Oder schon schlief.
Corentin holte Luft. Ein letzter Versuch. Er stemmte seinen rechten Fuß auf die Motorsäge, beugte sich hinab, griff nach dem Anlasser, spannte seine Muskeln und zog an der Leine.
Ungläubig hörte er, wie der Motor aufröhrte und in ein gleichmäßiges Tuckern überging. Er packte die Säge und ging auf die Leiter zu, die er an den Stamm gelehnt hatte. Er musste bei den oberen Partien des Stammes beginnen. Einen derartigen Baumriesen in Bodennähe zu durchsägen konnte er nicht riskieren, nie hätte er dessen Fallrichtung abschätzen und kontrollieren können. Er betrat die erste Sprosse, als er eine Bewegung unter sich wahrnahm. Auf der mit Schlaglöchern übersäten Zufahrtsstraße, die von der Gemeindestraße auf den Vorplatz des ehemaligen Bahnhofs führte, mühte sich ein beigefarbener Nissan empor.
Der Wagen des Gerichtsboten. Corentin stellte die Säge ab und ging ihm entgegen. Er bemühte sich um Gelassenheit, als er den Brief in Empfang nahm und den Erhalt mit seiner Unterschrift bestätigte.
»Schön haben Sie’s hier«, bemerkte der Bote, während er wieder in den Wagen stieg. »Aber dieser Baum da, da möchte man lieber nicht drunter stehen, wenn der einkracht, was?«
Auf dem Weg zum Wohnwagen hatte sich Corentin gezwungen, seine Neugier zu zügeln. Doch noch im Gehen riss er den Brief auf und entfaltete mit zitternden Fingern das Schreiben des Berufungsgerichts. Er überflog die Zeilen.
Einen Atemzug lang setzte sein Herzschlag aus. Sein Gehirn weigerte sich, das Gelesene aufzunehmen. Er stakste wie ein Roboter in den Wagen, sank auf die Kante seiner Schlafstelle. Erneut, und Buchstabe für Buchstabe, versuchte er, den Text des Gerichtsbescheids zu entziffern.
Seine Rechte, die den Brief hielt, sank auf seinen Schoß. In der lauernden Stille um ihn vermeinte er eine höhnende Stimme zu hören: Du bist am Ende, Corentin. Ruiniert. Du bist ein erbärmlicher Versager. Der größte Narr unter der Sonne.
Er schoss mit einem Ruck hoch. Er taumelte, fühlte sich von einer erbarmungslosen Macht gepackt und in eine andere Wirklichkeit geschleudert. Ein haltloses Zittern überkam ihn, Tränen schossen in seine Augen, dröhnend hämmerte sein Herz gegen seine Rippen, in seinen Ohren rauschte es.
Verwirrt nahm er wahr, wie ihm der mit Flecken übersäte Fußboden entgegenflog.
3.
Auf dem Flur der Polizeizentrale wechselte Lazare noch einige Worte mit Jaques Bruant. Er schob Geschäftigkeit vor und antwortete kurz angebunden. Das einst gute Verhältnis zu seinem Kollegen hatte sich in den letzten Jahren schleichend abgekühlt. Commandant Bruant, Ende dreißig und damit fast vier Jahre jünger als Lazare, hatte Fett an Körper und Geist angesetzt und sich jener Fraktion in der police nationale angeschlossen, deren Mitglieder sich darin suhlten, von ihrem Beruf zunehmend angewidert zu sein. Hinter vorgehaltener Hand beschwerten sie sich über mangelnde Anerkennung seitens ihrer Vorgesetzten, nölten über wachsenden Arbeitsdruck und schwindenden Respekt in der Bevölkerung. Immer unverblümter wurde sich auch über das als anmaßend empfundene Auftreten meist jüngerer Einwanderer empört. Bruant, selbst auf einem ärmlichen Hof im Departement Aveyron aufgewachsen, litt zusätzlich darunter, dass ausgerechnet ihm immer wieder Ermittlungen auf dem Land übertragen wurden. Fälle, bei denen er sich mit verstockten Beteiligten herumzuschlagen hatte, und von denen höchstens eine unbedeutende Land-Gazette in ungelenk formulierten Berichten Notiz nahm, meist in der Spalte Verschiedenes. Bruant hatte noch nie verhehlt, dass ihn die Provinz anwiderte. Im Kollegenkreis gab er seine Erfahrungen zum Besten, die ihn in seiner Einschätzung bestätigten. Doch in einer weinseligen Stunde war es einmal aus ihm herausgebrochen, dass seine Abneigung auch darin begründet war, dass er sich bei von ihm umschwärmten Dorfschönheiten des Öfteren eine Abfuhr eingehandelt hatte.
Auch jetzt wich Lazare seinem Kollegen aus, als dieser, ihm nachtapernd, wieder zu einem grämlichen Lamento ansetzen wollte. Nachdem er sein Postfach kontrolliert hatte, verabschiedete er sich mit dem Hinweis auf die Dringlichkeit seines Auftrags, holte den Dienstwagen ab und steuerte ihn durch den lärmenden Verkehr in Richtung der südwestlichen Autobahnzufahrt. Kurz vor elf Uhr präsentierte er an der Pforte des Kommissariats am Quai de Bosc in Sète seinen Dienstausweis.
Commandant Ventura, seit einigen Monaten Leiter der Kripo im Kommissariat von Sète, klemmte sich eine Mappe unter den Arm und geleitete ihn in ein winziges Besprechungszimmer neben seinem Büro. »Für die bisherigen Ermittlungen war Capitaine Lenoir verantwortlich. Sie hatte heute Morgen einen Gerichtstermin, müsste aber jeden Moment hier eintreffen.«
Lazare horchte auf. Er hatte eine Kommissaranwärterin dieses Namens bei einer früheren Ermittlung in Sète kennengelernt. Ihr Engagement und ihre wache Intelligenz hatten damals Eindruck bei ihm hinterlassen. »Capucine Lenoir? Sie hat die Prüfungen bestanden?«
»Mit Bravour, wie man wohl sagt.« Der Kripoleiter musterte ihn von der Seite. »Sie kennen sich?«
»Eine gute Polizistin«, meinte Lazare.
Ventura nickte selbstgefällig. »Eine taube Nuss würde bei mir auch nicht alt werden.« Er schmunzelte karg. »Dass sie noch zu oft mit dem Kopf durch die Wand möchte, wird sich legen.« Er legte die Mappe auf den Tisch, wies mit einladender Geste auf einen der Stühle und setzte sich. »Richter Simoneau lässt übrigens ausrichten, dass er am späten Nachmittag in Sète eintreffen wird.« Er zog sein Handy aus der Brusttasche und legte es vor sich auf den Tisch. »Wenn ich Ihnen vorläufig behilflich sein kann –?«
Lazare griff sich einen Stuhl. »Als Erstes würde mich interessieren, ob man hier überhaupt von einem Gewaltverbrechen ausgeht.«
Der Anflug eines unfrohen Lächelns. »Weil Sie sich – wie wir alle hier – fragen, weshalb man Sie hierher beordert hat, richtig?«
Lazare bestätigte es.
»So wie sich die Sache für uns darstellt, hat sich das Mädchen einfach abgeseilt«, erklärte Ventura. »Warum und mit wem auch immer.«
»Also kein Verdacht gegen Personen aus dem familiären Umfeld?«
»Definitiv nicht. Sie ist Halbwaise. Das Umfeld ihres Vaters aber bestätigt ausnahmslos, dass er seine Tochter fast abgöttisch liebt. Wenn es kritische Anmerkungen gab, dann waren es die, dass er ihr eher zu viel als zu wenig durchgehen lässt. Außerdem ist er nachweislich seit längerem gesundheitlich angeschlagen. Hinzu kommt, dass nicht der Anflug eines Zeitfensters existiert, in dem er ihr etwas antun, geschweige denn sie unbemerkt hätte verschwinden lassen können. Unser Register gibt ebenfalls nichts über ihn her, was auf einen Hang zur Gewalttätigkeit schließen ließe.«
Ventura warf einen Blick auf sein Handy, bevor er sich wieder Lazare zuwandte. »Das alles haben wir übrigens schon der Zentrale mitgeteilt.«
Lazare richtete sich auf. »Was aber immer noch nicht erklärt, aus welchem Grund man mich wegen eines Falles, den Sie und Ihre Leute problemlos bearbeiten können, zu Ihnen schickt.«
Ventura hob die Hände zu einer ratlosen Geste. »Ich kann nur wiederholen: Es gibt bisher keinerlei Anhaltspunkte für ein Verbrechen. Geschweige denn eine Leiche. Wir haben die Anzeige auch nur deshalb zu Protokoll genommen, weil das Mädchen erst in ein, zwei Wochen achtzehn wird. Und auch, weil ihr Vater die Nerven der Kollegen auf der Wache mit filmreifen Auftritten strapaziert hat.« Er seufzte. »Aber die Entscheidungen der Zentrale sind ja zuweilen, nun, wie soll man es nennen –?«
»Unerforschlich?«, half Lazare.
»Sie sind jedenfalls manchmal schwer nachzuvollziehen.« Die Andeutung eines spöttischen Lächelns auf den Lippen, fügte Ventura hinzu: »Aber man bemüht sich.« Er griff nach der Mappe und schob sie über den Tisch. »Details zu diesem Fall in den Protokollen. Schon einen Plan, wie Sie vorgehen wollen?«
»Kann ich sagen, wenn ich weiß, was bereits unternommen wurde.«
»Das, was wir in solchen Fällen als angemessen erachten. Wir sind mit derartigen Angelegenheiten nicht übertrieben oft, aber doch hin und wieder befasst. Zuletzt vor einigen Monaten. Zwei Brüder, beide noch keine achtzehn, sind über Nacht verschwunden. Sie nahmen nur mit, was sie am Leib trugen. Und natürlich ihre Mobiltelefone.«
Lazare zog die Brauen hoch. »Was haben Sie herausgefunden?«
»Eine Weile stocherten wir im Nebel. Bis wir nach ungefähr zwei Wochen im Netz ein erstes Lebenszeichen der beiden abfangen konnten. Die Kollegen vom Staatsschutz, die wir daraufhin einschalteten, meinten aus Details des Posts folgern zu können, dass sich die beiden bereits irgendwo im syrisch-türkischen Grenzgebiet aufhalten mussten. Es folgten eine Reihe geradezu schmerzhaft infantiler Einträge, in denen sie davon schwärmten, bald in ihren heiligen Krieg ziehen zu dürfen. Einige Tage später rissen die Einträge unvermittelt ab. Den letzten konnten die Spezialisten in einem Gebiet verorten, aus dem zu dieser Zeit Gefechte zwischen kurdischen und islamistischen Einheiten gemeldet wurden.« Ventura machte eine Pause. »Die Familie mauert zwar, legt aber ein Verhalten an den Tag, als wüsste sie, dass die beiden nicht mehr am Leben sind. Zumindest gibt es dazu in ihrem Umfeld entsprechende Gerüchte.«
»Hat Capitaine Lenoir auch im Fall unserer Vermissten in diese Richtung ermittelt?«
Der Kripoleiter grinste karg. »Wenn Sie nachher mit ihr sprechen, sollten Sie sich nicht danach erkundigen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie auf bestimmte Fragen noch sehr dünnhäutig reagieren kann«, sagte Ventura und fügte hinzu: »Nicht immer zu Unrecht, wie ich finde.«
Lazare schluckte eine ärgerliche Entgegnung hinunter. »Man dankt für den Rat, Commandant.«
»Keine Ursache.« Ventura wurde wieder sachlich. »Selbstverständlich ist diese Möglichkeit erwogen worden. Aber für eine Reise des Mädchens in die Kriegsgebiete gibt es ebenfalls nicht den geringsten Anhaltspunkt. Außerdem haben wir, wie Sie ja mitbekommen haben werden, vor über einem Jahr eine der Moscheen hier dichtgemacht, in der einige fanatisierte Hohlköpfe allzu unverfroren für eine Karriere als Märtyrer geworben hatten. Und kein einziger der Bekannten und Freunde des Mädchens zog auch nur annähernd in Betracht, dass sie sich derart verstellt haben könnte.« Ventura stand auf und schob den Stuhl an den Tisch. »Aber all das wird Ihnen Capitaine Lenoir in erforderlicher Ausführlichkeit erläutern.« Ein Hüsteln verriet Anspannung. »Wir sind übrigens davon ausgegangen, dass Sie kein eigenes Büro benötigen. Damit sieht es nämlich im Augenblick schlecht aus. Unsere Stadt erwartet in Kürze hochrangige auswärtige Gäste. Einige von ihnen bringen ihr eigenes Sicherheitspersonal mit. Wir wurden von höchster Stelle angewiesen, für einige Tage Räume zur Verfügung zu stellen.«
»Was steht an? Eine Konferenz?«
»Eine Gedenkfeier.« Der Dienststellenleiter wies mit einer Kopfbewegung in Richtung des Hafens. »Wie Sie vielleicht wissen, ist vor gut siebzig Jahren die Exodus von Sète in Richtung Palästina ausgelaufen. Geplant sind die Enthüllung einer Art Denkmal und die üblichen Ansprachen, das ganze umdudelt von einem angeblich weltbekannten Musiker aus den Staaten.«
Nachdem Ventura die Türe hinter sich geschlossen hatte, zog Lazare die Mappe heran und schlug das Deckblatt zurück.
Das erste Protokoll enthielt die Stellungnahme eines Thierry Benoît, capitaine de police. Lazare erinnerte sich an den etwas pedantischen Beamten, der kurz vor der Pensionierung stand.
Mouhamad Yassin erschien um 23:40 auf der Wache des Kommissariats und meldete seine Tochter Nadia Yassin als vermisst. Wie in der internen Anweisung geregelt und angesichts des Alters der als vermisst gemeldeten Person sowie des Umstands, dass keinerlei Hilfsbedürftigkeit durch ein körperliches Gebrechen, eine psychische Erkrankung, Trunkenheit oder Verdacht auf Drogenmissbrauch vorlag, wurde der Anzeigenerstatter zunächst beruhigt. Es bestehe noch kein Anlass zur Sorge, seine Tochter sei gewiss mit Bekannten unterwegs, habe die Zeit vergessen oder war aus irgendwelchen Gründen (Handy kaputt, verlegt oder verloren?) nicht in der Lage, dem Vater Bescheid zu geben. Der Anzeigenerstatter bestritt dies mit Bestimmtheit. Seine Tochter sei äußerst zuverlässig, ihr Handy zudem fast neu. Der Anzeigenerstatter gab weiterhin an, bereits seit mehreren Stunden bei befreundeten Familien und allen ihm bekannten Freundinnen und Kolleginnen nach seiner Tochter gesucht zu haben. Woraus er schloss, dass ihr etwas zugestoßen sein musste. In zunehmender Lautstärke forderte er von Capitaine Benoît, dass augenblicklich etwas unternommen werden müsse. Da er sich nicht abweisen ließ, wurde ihm zuletzt eindrücklich empfohlen, das Kommissariat zu verlassen, sich nach Hause zu begeben und den morgigen Tag abzuwarten. Worauf der Anzeigenerstatter mit Zeichen größter Erregung reagierte, was den Wachhabenden befürchten ließ, der Besucher könnte vor seinen Augen kollabieren. Er alarmierte den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Von diesem wurde dem Anzeigenerstatter ein Beruhigungsmittel verabreicht. Anschließend wurde er mit dem Krankenwagen in seine Wohnung transportiert. Noch im Beisein des Sanitäters begab er sich zu Bett und schlief sofort ein.
Lazare blätterte weiter. Das nächste Protokoll trug bereits die Signatur von Capucine Lenoir, capitaine de police. Eineinhalb Tage nach Eingang der Vermisstenmeldung hatte sie ihre Arbeit als Sachbearbeiterin aufgenommen.
Mouhamad Yassin, leiblicher Vater der als vermisst gemeldeten Nadia Yassin, kam am 12. Januar 1963 im Flüchtlingslager Rivesaltes zur Welt. Sein Vater Hamid, zuvor in einer Kaserne der französischen Armee nahe Algier als Flugzeugmechaniker beschäftigt, hatte mit seiner damals schwangeren Frau nach Kriegsende flüchten müssen. Nach Auflösung des Lagers war er mit anderen Flüchtlingen zu staatlichen Wiederaufforstungsarbeiten verpflichtet worden. Fast zwei Jahre verbrachten er, seine Frau und der kleine Mouhamad in primitiven Notunterkünften, bis sie nach Sète übersiedeln konnten. Dort hatte Hamid Yassin durch Vermittlung eines Verwandten im Hafen eine Stelle als Hilfsarbeiter gefunden.
Mouhamad Yassin war siebzehn, als sein Vater starb, und Mitte zwanzig, als die Mutter ihrem Gatten ins Grab folgte. Im selben Jahr heiratete er die gleichaltrige Meryem, wie er in den Baracken von Rivesaltes geboren. Ihr erstes Kind starb noch als Säugling, auch ihr zweites Kind wurde nur wenige Monate alt. Nur Nadia, viele Jahre später geboren, überlebte. Sie war etwa 13 Jahre alt, als ihre Mutter binnen weniger Wochen einer rätselhaften Krankheit erlag. (Vermutet, aber nie bestätigt wurde eine Lebensmittelvergiftung oder das Resultat ihres Umgangs mit scharfen Chemikalien bei ihrer Putzarbeit in der Markthalle von Sète.)
Kaum mit vierzehn aus der Schule entlassen, hatte Mouhamad Yassin zu arbeiten begonnen. Obwohl als zuverlässiger und kraftvoll zupackender Mitarbeiter von seinen Vorgesetzten geschätzt, kam er nie über den Status des Hilfsarbeiters hinaus. Nach vielen Jahren als Straßenarbeiter im Bauamt von Sète hatte man ihn nach einem Arbeitsunfall zur Müllabfuhr versetzt. Dort stand er zuletzt am Sortierband. Die Charakterbeschreibung von Kollegen und Nachbarn: bescheiden, etwas schwerblütig, manchmal rührselig, besonders wenn es um seine Tochter geht. Eher konfliktscheu, übervorsichtig. Niemand aus seinem Umfeld konnte sich daran erinnern, ihn jemals zornig oder laut erlebt zu haben. Wirkt in letzter Zeit unerklärlich angstbesessen. Lenoir hatte händisch an den Rand notiert: Folgen des Arbeitsunfalls? Psych. Erkrankung?
Das Farbfoto der Vermissten war angeheftet. Ein schmales, bronzefarbenes Gesicht. Unter kräftigen Brauen dunkle, von einem dezenten schwarzen Lidstrich gerahmte Augen. Pechschwarzes Haar, eine Kurzhaarfrisur, deren Strähnen in die Stirn fielen. Das Foto war kein unbemerkt aufgenommener Schnappschuss. Nadia Yassin schaute lächelnd, mit offenem, fast herausforderndem Blick direkt in das Objektiv.
4.
Mehrere Taleinschnitte liefen auf den Gebirgskessel im waldreichen Norden des Departements zu, in dessen Mitte sich das Dorf St. Pierre d’Elze ausdehnte. Die fast fünfhundert Einwohner zählende Gemeinde war Hauptort des gleichnamigen Kantons, der aus einer Handvoll kleinerer Bergdörfer bestand. Das Ortszentrum und eine Bogenbrücke aus dem späten Mittelalter querend, wand sich die Dorfstraße auf die Ebene im Süden zu. An der nördlichen, zunehmend spärlicher besiedelten Gemeindegrenze endete sie vor dem bewaldeten Ausläufer des Zentralmassivs. Außerhalb des Ortskerns zweigten schmale, doch immerhin geteerte Straßen ab, hinauf zu den Bergnestern St. Esprit und Tormes.
Eine dreiviertel Gehstunde auf steil ansteigendem Weg von Tormes entfernt, inmitten verfallender, von Trockensteinmauern gefasster und von Ginster und Dornengestrüpp überwucherter Terrassen döste der Hof La Farette in der milden Herbstsonne des späten Vormittags. Am Tisch der niedrigen Wohnküche kauerte ein magerer Alter. Er hatte eine Zeitung vor sich ausgebreitet, über die er mit zusammengekniffenen Augen eine handtellergroße Lupe führte.
Am Herd hantierte Mathilda Bouffier, seine Nachbarin und Haushälterin. Streit lag schon seit den Morgenstunden in der Luft.
»Nichts funktioniert in dieser Baracke, Siset. Es ist eine Zumutung, hier arbeiten zu müssen.«
Der Alte schmatzte mit den Zähnen. »Ruhe!«, knurrte er, ohne sie eines Blickes zu würdigen.
Sie bückte sich schwer atmend, öffnete die Feuerkammer des Herdes und legte ein Holzstück hinein. »Bald packe ich meine Sachen und verschwinde. Aber dann für immer.«
Der Alte wandte sich halb zu ihr um. »Mach mir keine Hoffnung, dass ich das noch erleben darf.«
»Verhungern wirst du. Verfaulen. Vermodern in deinem Saustall.« Die alte Haushälterin hob den Deckel eines Topfes. Dampf brühte über ihr schönes altes Gesicht.
Der Alte ließ die Lupe sinken und brauste auf: »Kannst du eigentlich nichts anderes, als einem den Tag mit deiner ewigen Nörgelei zu vermiesen, du alter Drachen?«
»Das mache ich nicht zum Spaß, du Dickkopf«, schleuderte sie ihm in gleicher Lautstärke entgegen. »Sondern weil endlich etwas passieren muss!« Sie wandte sich wieder ihrer Suppe zu, tauchte einen Löffel hinein und kostete. Sie nickte sich befriedigt zu, verschloss den Topf und verschob ihn an den Rand der Herdplatte. »Monsieur Lazare soll sich gefälligst drum kümmern, hörst du? Er ist schließlich der Besitzer.«
»Wann kapierst du endlich, dass der Junge einen Beruf hat? Er wird sich bedanken, wenn man ihn andauernd mit Lächerlichkeiten belästigt.«
Sie prustete empört. »Lächerlich, sagst du? Die Wasserleitung hat überhaupt keinen Druck mehr! Wahrscheinlich ist die Quelle kurz vor dem Versiegen.«
»Was für ein Schwachsinn! Hör mal, du bist doch hier in den Bergen geboren. Gerade du müsstest wissen, wie das hier immer ist. Mal schüttet es, wie die Kuh pisst, und dann fällt über Wochen wieder kein einziger Tropfen. Aber immer ist es irgendwie weitergegangen.«
»Fragt sich bloß, wie. Und dann immer wieder diese komische Färbung. Einmal ist das Wasser klar, dann kommt wieder eine Brühe. Wie Erde, wie Dreck. Damit soll man noch kochen?«
»Vielleicht habt ihr ja bei euch drüben die Latrine gleich neben die Quelle gesetzt. Aber mein Wasser ist in Ordnung, kapiert?«
Sie drehte sich um und stemmte ihre Fäuste in die Hüfte. »Die Leitung wird repariert! Wenn du nicht auf der Stelle zustimmst, gehe ich. Jetzt gleich. Dann kannst du sehen, wie du zu deinem Essen kommst.«
»Was?!« Siset schoss hoch. »Wo heute mein Besuch kommt?«
»Wenn ich sage ›jetzt gleich‹, dann meine ich das auch so.«
»Bist du noch bei Trost?« Er drosch mit der Faust auf den Tisch. »Erpressung ist das! Pure Erpressung!« Der Hund zu seinen Füßen gab ein verhaltenes wuff von sich und döste weiter.
»Etwas anderes fruchtet ja nicht mehr bei dir«, zeterte sie zurück. »Also? Wird etwas unternommen? Oder –?«
»Das kannst du nicht machen!«, krächzte er.
Sie begann, die Schlaufe ihrer Schürze zu lösen. »Du müsstest langsam wissen, wann ich scherze. Und wann nicht.«
Der Alte funkelte sie wütend an. Dann sank er auf die Bank zurück und brummte geschlagen: »Meinetwegen.«
Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. »Dein Wort darauf?«
Er wich ihrem Blick aus und nickte. »Ja … Ruf ihn an.«
Sie zog die Schlaufe wieder fest. »Ich? Bin ich deine Telefonistin?«
»Dieser Mistapparat nervt einfach«, verteidigte er sich kläglich. »Andauernd will mir irgendein Gauner etwas andrehen. Und beim kleinsten Unwetter ist die Leitung wieder tagelang gestört.«
»Dann leg dir endlich ein tragbares Ding zu«, beschied sie resolut. »Jeder Idiot hat heute so etwas.«
»Da triffst du den Punkt«, giftete er zurück. »Jeder Idiot. Richtig. Da muss ich mich ja wohl nicht unbedingt einreihen, oder?«
»Gib einfach zu, dass du damit nicht umgehen kannst, alter Narr.«
Er hob belehrend den gichtig gekrümmten Zeigefinger. »Dann schalte ausnahmsweise mal dein Gehirn ein, du Klugscheißerin: Haben die Kerle, die einst die Bastille gestürmt haben, so etwas gebraucht? Nein, wie man hört, kamen sie auch so ganz gut zu Rande!« Verächtlich schloss er: »Also bleib mir vom Hals mit diesem neumodischen Mumpitz.«
»Hoffnungslos.« Mathilda wandte sich wieder dem Herd zu, griff nach einer der Pfannen, die an der Wand neben dem Herd hingen. »Wann kommt dein Besuch, sagtest du? Dieser famose Monsieur Quintana, dein alter Kamerad?«, fragte sie über die Schulter.
»Gegen zwölf Uhr wollte Lluis hier sein. Habs dir schon tausendmal gesagt. Du wirst wirklich immer seniler.«
»Wie kommt er eigentlich hier herauf? Mit seinem Auto etwa? Das willst du dem alten Mann antun?«
»Er hat einen Chauffeur.«
»Einen eigenen Chauffeur?« Sie streifte ihn mit einem spöttischen Blick. »Du und so noble Freunde?«
Siset gab ein verächtliches Grunzen von sich. »Ist ein Kumpel von ihm, der in der Nähe zu tun hat.«
Mathilda hob einen Herdring und zog eine gusseiserne Kasserolle über das Feuer. Sie maß einen Löffel Salz ab und gab ihn in das Wasser.
»Gibts eigentlich einen Anlass für den Besuch? Ihr habt euch doch angeblich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen? Zu deinem Geburtstag ist es auch noch eine Weile hin.«
»Er will mich einfach wieder mal sehen, kapiert? Kameraden brauchen keinen Anlass. Und jetzt hör endlich auf, mich zu löchern.« Er beugte sich wieder über die Zeitung. Knurrend fügte er hinzu: »Außerdem geht dich das nichts an. Hinterher machst du dich wieder mit irgendwelchen Märchen im Dorf wichtig.«
»Das sagt der Richtige.« Sie legte ein Scheit nach, watschelte zur Anrichte, griff sich eine Schüssel mit grünen Bohnen und kehrte zum Herd zurück. »Dass du dich eigentlich nicht schämst, jemanden in so einer heruntergekommenen Baracke zu empfangen«, sagte sie im Gehen.
»Klar! Mit dem, was du unter Haushaltshilfe verstehst, wird es hier auch nicht ordentlicher!«
»Nur zu, Freundchen«, warnte sie.
»Außerdem kann ich dich beruhigen. Wegen Lluis brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Mit ihm habe ich schon tagelang in Erdlöchern gehaust, als wir uns vor der guardia civil verstecken mussten.«
»Schon gut, mein Held. General Franco wird vor Angst in die Hose gepisst haben, wenn er nur deinen Namen gehört hat.«
»Quatsch nicht von etwas, wovon du keinen Schimmer hast. Sieh lieber zu, dass du mit dem Kochen fertig wirst. Lluis wird einen Bärenhunger mitbringen, wie ich ihn kenne. Er mochte es übrigens immer scharf, also würze ordentlich. Man kommt nicht in die Hölle, wenn etwas gut schmeckt, wie ihr Protestanten immer meint. Wehe, du blamierst mich wieder.«
»Keine Sorge, altes Ekel.« Sie goss Öl in die Pfanne und ließ es verlaufen. »Für dich habe ich mir sogar eine besondere Zutat überlegt.«
Erfreut hob er seine drahtigen Brauen. »Was soll das sein?«
»Ach.« Sie zuckte leichthin die Schultern. »Nur eine Prise Strychnin.«
»Verbrecherin!«, tobte Siset. Brüsk drehte er ihr den Rücken zu.
Wieder durchströmte ihn ein Schauder. Er lächelte beseelt.
Was für ein Weib!, dachte er.
5.
Kurz nach elf Uhr kam Capitaine Capucine Lenoir vom Gericht zurück. Einen Zug der Angewidertheit um die Lippen und als presse sie ein zentnerschweres Gewicht nieder, ließ sie sich auf den Stuhl fallen. Sie hatte in einem Prozess gegen ein junges Ehepaar ausgesagt. Der Mann hatte ihr Kind, einen fünf Jahre alten Jungen, zu Tode geprügelt. Und ihrem zweiten, noch kein halbes Jahr alt, mit Schlägen und Tritten so schwere Verletzungen zugefügt, dass es für sein Leben gezeichnet sein würde.
»Der Mann war einfach ein verkommener Junkie. Blödgefixt, faul, kaputt. Was mich fertiggemacht hat, war die Frau. Sie muss alles mitbekommen haben, was dieses Schwein mit ihren Kindern gemacht hat. Aber sie hängt an diesem Typen wie eine Ertrinkende an einem Rettungsring. Verteidigt ihn, sagt, dass sie ihn über alles liebt, fleht das Gericht an, ihn zu schonen. Manchmal kann man einfach nur noch an der Menschheit verzweifeln.« Sie fasste sich und deutete auf das Dossier. »Sie sind schon durch?«
Lazare verneinte. »Nur mit den ersten Seiten. Ich bevorzuge außerdem mündliche Zusammenfassungen. Was wissen wir über das Mädchen?«
Capucine atmete durch und setzte sich aufrecht hin. »Sie wohnte bis zu ihrem Verschwinden bei ihrem Vater, Monsieur Yassin. Er ist Mitte fünfzig, aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie ihm auf den ersten Blick zwanzig Jahre mehr geben. Die Familie ist schon seit den Siebzigern in der Rue de la Perade gemeldet.« Sie machte eine kurze Pause, bevor sie hinzufügte: »Nicht unbedingt ein Nobelviertel. Entsprechend muffig ist die Wohnung. Dass man es da als junger Mensch nicht mehr aushält, ist fast nachzuvollziehen.«
»Wie sind Sie vorgegangen?«
»Monsieur Yassin hatte schon am Abend ihres Verschwindens ihr Umfeld abgeklappert, Nachbarsfamilien, Freundinnen, Kolleginnen. Wir haben seine Angaben auf Plausibilität überprüft und uns einige der von ihm Befragten noch mal vorgenommen. Das Mädchen wurde dabei übereinstimmend positiv beschrieben. Liebenswürdig, hilfsbereit, intelligent und wissensdurstig. Zuvor haben wir natürlich in der Wohnung des Vaters nach Hinweisen gesucht. Was aber nichts brachte. Außer der Erkenntnis, dass nichts von ihren Sachen fehlte, was auf eine längere Reise hätte schließen lassen können. Dass ihr Handy, ihr Ausweis und ihre Bankkarte weg waren, muss ja nichts heißen. Ohne so etwas geht man ja heutzutage nicht mehr aus dem Haus.«
Lazare pflichtete ihr bei. Was sei mit Abschiedsbrief, Korrespondenz überhaupt? Computer? Präsenz im Netz? Bücher, Zeitschriften?
»Kein Abschiedsbrief, kaum schriftliche Korrespondenz, und wenn, dann unergiebig. Briefe einer Freundin, die nach Belgien gezogen ist, ein Heftchen mit abgeschriebenen Gedichten. Und diverser Behördenkram, darunter Zeugnisse. Sehr ordentliche übrigens. Sie hat wohl gerade versucht, eine Ausbildungsstelle als Schneiderin zu ergattern. Dementsprechend gab es auch einige Modejournale, ziemlich zerlesen, aber durchaus der hochwertigeren Kategorie. An Büchern nichts Relevantes, nur ein knappes Dutzend Taschenbücher mit populärer Unterhaltung. Nichts jedenfalls, was auf ein spezielles Interesse hingewiesen hätte. Auch kein Facebook-Account, zumindest nicht unter ihrem Klarnamen, aber die Auswertung wie auch die ihrer Telefonate ist noch nicht abgeschlossen. Dass eine Handyortung nichts ergab, brauche ich nicht zu erwähnen, das Gerät ist abgeschaltet. Der Vater konnte zudem nicht genau sagen, was seine Tochter außer ihrem Handy noch an Kommunikationsmitteln benutzte. Sie dürfte aber ein Smartphone besessen haben, eine entsprechende Rechnung gab es jedenfalls. Aber auch da liegen noch keine Ergebnisse vor. Die Kollegen geben Überlastung vor. Ich vermute, dass man derzeit andere Prioritäten setzt.«
»Gab es Hinweise aus der Öffentlichkeit?«
»Was Presse und Medien betrifft, so haben wir uns entschieden, alles erst einmal auf kleiner Flamme zu kommunizieren. In der nordafrikanischen Gemeinde hat es sich natürlich sowieso wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Eingegangen sind aber nur eine Handvoll Hinweise, meist von uns bereits bekannten Schwätzern, einer davon anonym. Nichts davon brachte uns auch nur einen Millimeter weiter. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die zumindest eine Idee haben, was da geschehen ist. Die aber halten dicht.«
Hast Du Anderes erwartet?, dachte Lazare. Das Misstrauen gegenüber der Polizei hat besonders im Süden Tradition. Davon, dass sie sich, ob hier in Sète oder im ganzen Land, über die Maßen bemüht, dies zu ändern, war ebenfalls nicht viel wahrzunehmen.
Er schlug die Beine übereinander. »Was wissen wir über die Umstände ihres Verschwindens?«
»Nadia kam an diesem Tag gegen neunzehn Uhr in die Wohnung. Dem Vater kündigte sie an, den Abend zu Hause verbringen zu wollen, sie fühle sich in letzter Zeit etwas – ja, abgekämpft, das sollen ihre Worte gewesen sein. Zuvor müsse sie nur noch einer Freundin ein Glätteisen oder etwas Ähnliches, vielleicht auch ein Epiliergerät, der Vater kannte sich damit nicht aus, zurückbringen. Sie verließ die Wohnung kurz danach. Dabei ging sie zu Fuß, die Freundin wohnt in der Nähe des Fußballstadions. Für diese Strecke hätte sie – einfach – höchstenfalls fünfzehn Minuten gebraucht. Keine ihrer Freundinnen aber konnte sich daran erinnern, mit ihr verabredet gewesen zu sein. Danach wurde sie nicht mehr gesehen. Gegen halb zehn, die Sonne war bereits untergegangen, wurde der Vater unruhig.« Sie ergänzte: »Glätteisen und Epiliergerät haben wir übrigens im Schränkchen ihres Schlafzimmers gefunden. Und bekleidet war sie mit einem kurzen, schwarz-weiß quer gestreiften Rock, weißer Bluse und Jeansjacke, schwarzen Leggins oder Strumpfhose und roten Sneakers. Sie trug angeblich immer ein kleines Amulett in Form eines Auges um den Hals. Eine Art Abwehrzauber gegen den sogenannten Bösen Blick. Von weiterem Körperschmuck wie Ringen, Armbändern, Tattoos oder Ähnlichem ist nichts bekannt. Sie schminkte sich. Nicht gerade dezent, aber auch nicht ordinär.«
»Hört sich alles an, als hätte Religion keine besondere Bedeutung für sie gehabt.«
Capucine stimmte mit einem Nicken zu. »Wobei die erwähnten Geräte und ihre Kleidung kein Beleg dafür sein müssen, täuschen Sie sich nur nicht. Aber Ihre Folgerung ist richtig. Sie lehnte es beispielsweise ab, ein Kopftuch zu tragen. Das tat sie offenbar nur, wenn sie sich an Aktivitäten der Moscheegemeinde beteiligte. Was aber selten geschah und vermutlich nur deshalb, weil sie ein sehr inniges Verhältnis zu ihrem Vater haben muss, der dort Mitglied ist. Die entsprechende Gemeinde ist eher liberal ausgerichtet. Um jene Moschee jedenfalls, die kürzlich wegen ihrer fanatischen Predigten geschlossen wurde, machten ihre Mitglieder immer einen Bogen. Aber auch Monsieur Yassin selbst dürfte in Glaubensdingen nicht das sein, was man als strenggläubig bezeichnet. Er raucht wie ein Fabrikschlot, noch dazu Caporal, und in seiner Küche fand sich eine Konserve mit Schweinefleisch-Paté. Aber um Ihre Frage vorwegzunehmen: Kein einziger und keine einzige der Befragten konnte sich vorstellen, dass sie etwa nach Syrien oder in den Irak verduftet sein könnte. Und nach allem, was ich bisher über sie mitbekommen habe, würde eine derartige Aktion auch nicht zu ihr passen.«
»Das Verhältnis zu ihrem Vater ist gut, sagten Sie.«
»Ich könnte mir vorstellen, dass ein offenherziges und temperamentvolles Mädchen wie Nadia von der übervorsichtigen Lebensart ihres Vaters manchmal genervt war. Von einem dramatischen Konflikt ist aber nicht auszugehen. Und dass Mouhamad Yassin seine Tochter liebt – ich meine damit: wirklich liebt und nicht nur als ein gefügiges Objekt, womit sich in seinem Umfeld als stolzes Familienoberhaupt renommieren lässt –, steht außer Zweifel.« Sie schürzte die Lippen. »Und, um die romantischen Geigenklänge ein wenig zurückzufahren: Er ist seit einiger Zeit gesundheitlich angeschlagen. Sie macht ihm den Haushalt.«
»Sie ist fast achtzehn …«, überlegte Lazare laut.
Sie begriff sofort, worauf er hinauswollte. »Was eventuelle Liebschaften betrifft, sind wir natürlich erst einmal an die sprichwörtliche Mauer des Schweigens geprallt. Eine Ausnahme gab es jedoch, ein Kellner in einem Café in der Nähe der Moschee, nur einen Block weiter. Er war deshalb etwas gesprächiger, weil er sich mir gegenüber – nun, wie soll ich es ausdrücken –«
»Verpflichtet fühlte«, half Lazare.
»Er ist mir mal in die Finger geraten, als er einen seiner heimlichen Ausflüge ans andere Ufer machte. Zu einer gewissen Sorte allein reisender und gut betuchter Touristen.«
Lazare nickte anerkennend. Du hast schnell gelernt, dachte er. Es ist der übliche Weg, sich Informanten im Milieu zuzulegen: Wir drücken ein Auge zu, wenn du uns gelegentlich ein paar Fragen beantwortest. Nicht ganz koscher, dieses Vorgehen. Aber effizient.
Sie erwiderte sein Schmunzeln, wurde aber sofort wieder ernst. »Kurz, Nadia Yassin war offenbar seit einigen Monaten mit einem gewissen Driss Akibi liiert. Mitte zwanzig, nicht der Hellste unter der Sonne, aber ein Frauentyp, charmant, gewandt bis gerissen. Schlug sich bisher als Dealer durch, wenn auch nicht in großem Maßstab. Die Kollegen hatten ihn bei einigen Einbrüchen im Visier, konnten ihm aber nur einmal Hehlerei nachweisen. In einem älteren Fall tauchte sein Name ebenfalls auf. Damals stand er wohl in Kontakt mit einer Clique, die bei ihren Überfällen eine Pistole der Marke Astra benutzte.«
»Nicht gerade auf der Höhe der Zeit, diese Waffe«, warf Lazare ein.
Sie nickte. »Was den Kollegen damals ebenfalls eigenartig vorkam. Es stellte sich nämlich heraus, dass diese Pistole von einem Überfall auf eine Kaserne der guardia civil im katalanischen Sitges Anfang der Siebziger stammte, der einer anarchistischen Widerstandsgruppe zugeschrieben wurde. Die Sache wurde damals aber nicht mehr weiterverfolgt; bei den Bürschchen, die damals festgenommen wurden, handelte es sich um völlig unpolitische Nachwuchsganoven. Für Akibi, damals eh noch keine vierzehn, hatte der Fall keine gravierenderen Konsequenzen. Die Kollegen kamen zu der Erkenntnis, dass er bestenfalls als eine Art Laufbursche für einen der Kerle fungiert hatte.«
»Was nicht selten der Einstieg in eine entsprechende Karriere ist«, warf Lazare ein.
»Und sicher auch für ihn gegolten hat. Allerdings scheint er sich in letzter Zeit verändert zu haben. Er ist seit etwa einem Jahr in der Moscheegemeinde aktiv, betet regelmäßig und zu den vorgeschriebenen Zeiten, hilft bei Veranstaltungen. Der neue Imam – Monsieur Abashi, ein angesehener Geistlicher, mit dem wir bisher noch nie Probleme hatten – ist jedenfalls voll des Lobes über ihn. Akibi habe sogar eine Art Gebetskreis gegründet. Der Imam versicherte uns, dass es dort harmlos zuginge. Ziel sei, so etwas wie einen interreligiösen Dialog zu installieren.«
»Unter dem Einfluss von Nadia möglicherweise?«
Sie verneinte. »Es muss schon begonnen haben, bevor er mit ihr zusammenkam. Mir war der Kerl trotzdem nicht sympathisch. Er hatte etwas Herablassendes, zumindest mir gegenüber, wogegen ich ein wenig allergisch bin. Dass er versuchte, die Beziehung zu Nadia Yassin auf eine Art unverbindliche Bekanntschaft herunterzuspielen, hat uns aber nicht weiter verwundert. Wir haben es uns mit seiner religiösen Erweckung erklärt, vor allem damit, dass auch ihr Vater in diesen Dingen dann doch eher konservativ sein dürfte. Voreheliche Beziehungen werden in diesen Kreisen ja nicht toleriert.« Sie verzog den Mund. »Nach außen hin zumindest. Bigotterie haben die Christen nicht allein gepachtet.«
»Was sagte dieser –«
»Driss Akibi.«
»– was sagt er zu ihrem Verschwinden?«
»Er reagierte darauf nicht unbedingt gleichgültig, aber auch nicht betroffener, als wenn einem entfernten Bekannten ein Unglück zugestoßen wäre. Von uns damit konfrontiert, dass er mit ihr liiert war, reagierte er aufgebracht. Es sei nichts als das Geschwätz von Wichtigtuern oder Lügnern. Und für den Zeitraum von Nadias Verschwinden gab er uns ein Alibi. Es wurde uns von mehreren Personen bestätigt, nicht zuletzt von Monsieur Abashi, der uns zudem versicherte, nie etwas von einem Verhältnis zwischen Akibi und Nadia wahrgenommen zu haben, das über das Erlaubte hinausgegangen wäre. Es blieb uns daher erst einmal nichts anderes übrig, als ihn ziehen zu lassen. Dann kam auch schon die Ansage, dass die Zentrale die Ermittlungen an sich zieht.«
»Was nicht auf meinem Mist gewachsen ist«, stellte Lazare klar.
»Davon müssen Sie mich nicht überzeugen. Man kennt Richter Simoneau.«
Lazare musste schmunzeln, wurde aber sofort wieder sachlich. »Ich entnehme Ihrem Bericht jedenfalls, dass wir eher nicht etwas befürchten müssen, was in Richtung Ehrenmord oder ähnlichem geht. Richtig?«
Capucine bejahte mit Bestimmtheit. »Es gibt dafür keinen einzigen verwertbaren Hinweis. Nicht einmal für ein ordinäres Beziehungsdrama. Wirklich, wir haben jede Möglichkeit abgeklärt.« Sie konnte ein Gähnen nicht mehr unterdrücken. »Und jetzt – wenn Sie verzeihen, Commandant, und wenn Sie keine weiteren Fragen haben …? Ich habe heute noch keine Zeit gehabt, etwas zu essen.«
»Ich ebenfalls.« Lazare stand auf und schob den Stuhl an den Tisch. »Was halten Sie von Chez Raymond?«
In ihre Augen kam wieder Leben. »Wie immer sind Ihre Vorschläge nicht die schlechtesten, Commandant.«