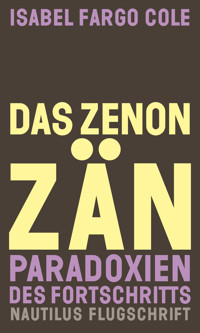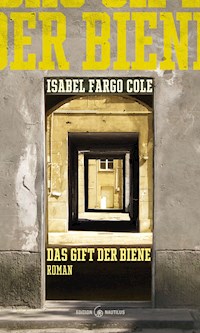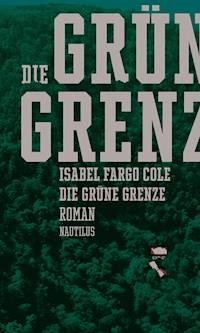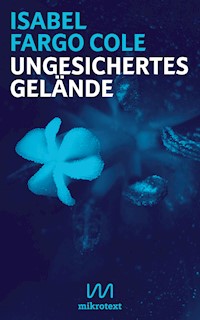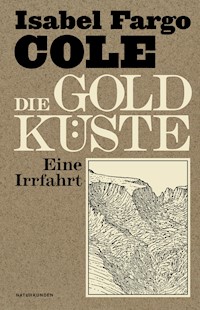
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Mein Ururopa Arva Fargo war zur Goldsuche nach Alaska abgehauen. He ran off to the Yukon. He ran off to the Klondike. Eine Geschichtsscherbe, hervorgekramt, ratlos zurückgelegt.« Mehr als hundert Jahre nach ihrem Vorfahr macht sich Isabel Fargo Cole von Deutschland auf nach Alaska, von dort über Seattle Richtung Kalifornien, auf den Spuren Arva Fargos und dessen fieberhafter Suche nach dem Gold – Fluch und Segen so vieler Biografien des ›vergoldeten Zeitalters‹ Ende des 19. Jahrhunderts. Die ›Geschichtsscherben‹, die sie nicht nur in den verlassenen Claims findet, fügt sie zu einem vielstimmigen Recherche- und Reisetagebuch in ein fremdes, scheinbar unermessliches Land zwischen Ost und West, zwischen Ausbeutung und Bewahrung. Denn die größte Exklave der Welt ist zwar dünn besiedelt, doch wie kaum ein anderer Landstrich von Fantasien ursprünglicher Wildnis und verborgener Reichtümer besetzt. Coles Expedition führt tief in die Schürf- und Abgründe des amerikanischen Traums, der mit seinen wirkmächtigen Versprechen bis heute Menschenmassen anzieht und wieder ausspuckt: abenteuerliche Glücksritter, Vagabunden und Helden verblasster Zeitungsmeldungen. Was sie dabei zu Tage fördert, ist wertvoller als Gold: ein erzählerisch-essayistisches Schürffeld voller Geschichten und Reflexionen über ein Grenzland fremder Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel Fargo Cole
DIEGOLDKÜSTE
Eine Irrfahrt
NATURKUNDEN No 88
herausgegeben von Judith Schalansky
bei Matthes & Seitz Berlin
Inhalt
Prolog
Northern Passage
Inside Passage
Golden Coast
Epilog
Danksagung
Zitatnachweise
Weitere Quellen
Abbildungsverzeichnis
Prolog
Der Goldrausch, 1925
Charlie Chaplins Goldrausch – mein erstes Alaska-Bild, zugleich früheste Filmerinnerung. Ich war fünf oder sechs Jahre alt, meine Eltern gingen mehrmals die Woche ins Studentenkino der Cornell University und nahmen mich einfach mit. Wir hatten keinen Fernseher – meine ersten bewegten Bilder überhaupt waren diese stummen Anfänge des Kinos.
Der Film war damals 54, inzwischen ist er 98 Jahre alt. Als Chaplin ihn 1924 drehte, lag der Anfang des Klondike-Goldrauschs erst 28, das Ende des Nome-Goldrauschs knapp fünfzehn Jahre zurück. Chaplins Filmbilder, so nah am Geschehen, nahm ich als Kind für bare Münze. Die Goldfelder als Ort der Entbehrung, der Rausch des Goldes als Hungerdelirium. Der Zottelbär Mack Swain reibt sich die Augen: Sein Kumpel Charlie stakst als Huhn, ein Braten auf Beinen, durchs kahle Zimmer. Der Wind pfeift durch die Bretterkulisse. Nichts im Haus als Menschenfleisch. Charlie tischt seinen Schuh auf, goutiert Schnürsenkel und Sohle. Man beißt ins Leder und tut so als ob. Der Fußboden kippt, die Bruchbude baumelt über der Gebirgsschlucht. Solange sie nichts ahnen, schweben die Männer im häuslichen Glück – erst der Blick in den Abgrund bringt sie ins Rutschen. Sich gegenseitig auf die Schultern kletternd, den jeweils anderen in die Tiefe tretend, kraxeln sie sich in Sicherheit. Wieder einmal die Naturgesetze besiegt. Weiter spinnen, weiter fiebern, Wahnbilder des Reizentzugs. Silvester 1900: Die drei hübschen Frauen am festlich gedeckten Tisch sind nur im Traum anwesend. Auch das Happy End – die triumphale Fahrt in den heimatlichen Hafen (Seattle? San Francisco?) – gleicht einem Traum kurz vor dem Erfrieren. Die grausame Vergangenheit löst sich flimmernd auf. Ich lache mich jedes Mal tot: Der Film ist so unglaublich, und ich weiß, dass er wahr ist.
Mein Ururopa Arva Fargo war zur Goldsuche nach Alaska abgehauen. He ran off to the Yukon. He ran off to the Klondike. Eine Geschichtsscherbe, hervorgekramt, ratlos zurückgelegt.
2018 feierten meine Eltern ihre Goldene Hochzeit mit einer Reise nach Alaska, dem einzigen Bundesstaat, den sie noch nicht besucht hatten. Fünfzig Ehejahre, fünfzig Bundesstaaten. Diesmal kein Roadtrip – Alaska hat kaum roads –, sondern ausnahmsweise all-inclusive. Eine Woche in einer Lodge im Denali National Park, zehn Tage auf Tierbeobachtungsfahrt in den südlichen Fjorden der Inside Passage. Arva Fargo beschäftigte meine Mutter nur am Rande. Für die Familiengeschichte war meine Tante Chris zuständig, die bis vor wenigen Jahren unweit ihrer beider Geburtsstadt Sacramento in Kalifornien lebte.
Kathy, meine Mutter, wurde 1944 als Erste geboren. Nachdem mein Opa John Arva ein Jahr später aus dem Krieg zurückgekehrt war, der ihn als Pionier quer durch Frankreich und Belgien bis nach Bremen geführt hatte, verließ er Kalifornien kaum jemals wieder. Mit meiner Oma Betty fuhr er sechzig Jahre lang nur noch nach Lake Tahoe oder zum Angeln ins Sierra-Vorgebirge. Aber meine Mutter lernte an der Stanford University meinen Vater, den Wissenschaftshistoriker aus Massachusetts, kennen, die Westküstlerin und der Ostküstler heirateten 1968 und zogen als academic nomads umher. 1973 kam ich zwischen den zwei Küsten in Illinois zur Welt, künftige Begleiterin ihrer Roadtrips. Seit meiner Umsiedlung nach Berlin 1995 bin ich nur mehr ein, zwei Mal im Jahr dabei – während sie 2000 von New York nach Silver City in New Mexico zogen und inzwischen um die 750 000 Kilometer zurückgelegt haben. »Dir juckt’s in den Füßen«, sagt mein Vater zu meiner Mutter, »von wem hast du das denn?«
Im Amerikanischen gibt es kein Wort für »Heimat« – und selbst wenn, würden meine Eltern es nicht verwenden. Es sei denn, Heimat hieße Bewegung. Nicht: Dort, wo man herkommt, sondern: Dort, wo man überall hindarf. Diesmal waren wir am Flughafen in Anchorage verabredet und unser erstes Ziel war der höchste Berg des Kontinents. In meinen Schulbüchern noch hieß er Mount McKinley. Obama gab ihm offiziell seinen alten Namen zurück: Denali.
Ende Juni 2018, E-Mail-Wechsel mit einem Bekannten, R.
Ich: Gleich geht’s nach Alaska.
R.: Grüß die Gletscher von mir, solange es sie noch gibt.
Ich: Die Reiseveranstalter arbeiten ökologisch bewusst, und ich kompensiere meinen Flug mit einer Spende an die Alaska Conservancy.
R.: Ich glaube sowieso nicht an voluntaristische Lösungen – die notwendigen ökonomischen, gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen müssen auf einer übergeordneten Ebene stattfinden, unser individuelles Verhalten fällt da kaum ins Gewicht. Insofern: Lass es dir einfach gutgehen.
Der schroff-väterliche R. ist Physiker, Mitgründer eines Umwelt-Think-Tanks in Boston (mein Vater ist ausgebildeter Chemiker), Anhänger von Bernie Sanders und Elizabeth Warren (mein Vater auch) und versteht sich als Democratic Socialist (bei solchen Etiketten steigt mein Vater aus). Mit seiner Frau verbringt R. das halbe Jahr in Berlin und besucht denselben Stammtisch politisch interessierter US-Bürger wie ich. Jedes Jahr hält er dort einen Vortrag über den Klimawandel, umreißt die mit jedem Jahr wachsenden Dimensionen der Katastrophe und die technokratischen Lösungen, die sofort flächendeckend umzusetzen wären, um ihr auch nur ansatzweise beizukommen: etwa sämtliche Häuser innerhalb von fünf Jahren wärmezudämmen oder sämtliche Flugzeuge auf Biotreibstoff umzustellen. Geht das überhaupt? fragen wir ihn dann. Reicht der Isolierstoff, der Raps, der Boden für den Raps? Gute Frage, räumt er barsch ein. Seine Aufgabe, die physikalischen Formeln auszuarbeiten, hat er erledigt. Ob aber die große Rechnung aufgeht, weiß er so wenig wie wir.
Oder: Er weiß besser als wir, wie wenig sie aufgeht. Deshalb blitzen seine Augen so gereizt, wenn wir seine theoretischen Konstrukte bloßstellen. Im Abstrakten so klar und naheliegend. In der Praxis dagegen –
Was können wir als Einzelne tun?
Die Frage bleibt nicht aus. Sie beweist, wie wenig wir verstanden haben. Er zuckt ungeduldig mit den Schultern, seine Stimme wird noch sarkastischer. Unsere Ahnungslosigkeit rührt an seinen aufgegebenen Hoffnungen. Er forscht stur weiter, erarbeitet Strategiepapiere, betreibt Lobbyarbeit. Was wir tun können – da ist er überfragt. Es ist nicht seine Aufgabe, Tatsachen so zu vermitteln, dass wir mit ihnen klarkommen.
Weil er nicht anders kann, ist er mir sympathisch. Weil er seine Ratlosigkeit zeigt und nicht sehen will, was sie in uns auslöst. Nach seinen Vorträgen scheint die einzig logische Handlung Selbstmord zu sein. Oder: ein großes Steak zu bestellen, in ein Flugzeug zu steigen, Whisky zu trinken, viele kleine Flugzeugfläschchen, um einzuschlafen, den Traum vergangener Jahrzehnte weiter zu träumen.
Wasser und Eis, Schnee und Stein
Great circle route – seit über zwanzig Jahren führt der Weg zu meinen Eltern über den Polarkreis.
(Führt? Führte? Wird führen? 2020 wird jede Zeitform gespenstisch. Reisen fallen aus, mein Guthaben bei den Fluglinien wächst. Aufgrund der Grenzschließung vertagen wir den Sommer-Roadtrip zu Tante Chris nach Kanada. Zu meinen Eltern hätte ich noch fliegen können, aber aus Rücksichtnahme und Verzagtheit verzichten wir.)
Das Fliegen war mir schon immer unheimlich. Trotz meiner Höhenangst blicke ich im Flugzeug unberührt hinab. Bin ich betäubt? frage ich mich. Die Erde liegt mir zu Füßen, ein Anblick, wie sich ihn die Menschen jahrtausendelang herbeisehnten. Mir fallen die Augen dabei zu.
Northern Passage
30. Juni 2018
Beim Flug nach Anchorage blieb es draußen hell, der Bildschirm mit der moving map dagegen schwarz – er war abgestürzt. Die Route musste ich in Gedanken nachzeichnen, das half, um wach zu bleiben, bis ich so weit im Norden war wie noch nie. Die Flugbahn führte längs über die Landmasse, die sie sonst nur streift: Greenland, grün im Ohr und weiß vor Augen. Nebel, ein kreisrunder Regenbogen fiel mit jedem Lidschlag zusammen, bis das feste Weiß des Bodens durchschimmerte. Ein kurzes Wegnicken, und das Eisschild lag unterm blauen Himmel bloß. Es schien sich am Horizont zu wölben, oder war das die Erdkrümmung? Ich kannte mich nicht mehr aus. Dunkle Flecken ließen die gleißende Fläche verschwimmen. Wolken, Wolkenschatten? Wolken auf dünngesäten Gipfelketten. Schon übernächtigt, verstand ich die Formen nicht. Was waren das für Felsspitzen, so archipelartig ausgestreut? Sie gingen unter oder tauchten empor.
Die Fläche, die sie durchbrechen, ist in Wirklichkeit Tiefe, die Tiefe ist Zeit: der Schnee von 100 000 Wintern.
Wir verbrennen im Flug einen 100 000 000 Jahre alten Stoff, um den unter uns liegenden 100 000 Jahre alten Stoff um einen Faktor von X aufzulösen. Als bestünde unser Zweck darin, zwischen diesen zwei Substanzen ebendiese Reaktion herbeizuführen.
Den Flug habe ich »kompensiert«: Mit 82 Euro werden durch die Pflanzung von 53 Bäumen 3,5 Tonnen CO2 gebunden. 82 Euro, eine Kleinigkeit. Denkbar, jede Woche einmal zu fliegen – nur 4264 Euro würde ich dazuzahlen, das entspräche 2756 Bäumen oder 2,5 Hektar. Die noch aufforstbare Erdoberfläche beträgt eine Milliarde Hektar. So könnten eine Million Vielflieger noch 25 Jahre lang ihre Flüge kompensieren.
Eine American-Airlines-Serviette, vollgekritzelt mit Rechnungen, die nicht aufgehen.
Ich komme mit dem Maßstab durcheinander. Ich kann die Dinge in kein angemessenes Verhältnis setzen. Die Reise zu den Eltern. Die Reise mit ihnen, in einer endlichen Reihe von gemeinsamen Wegen. X Tonnen CO2, Y Kubikmeter Eisschmelze. Ein Anstieg des Meeresspiegels um Z Millimeter. Ein Küstendorf, irgendwo. Einen Zusammenhang zwischen all dem zu sehen mutet wie egozentrischer Wahn an.
Meereseis, ungebrochen. Baffin Bay? Türkisblau zwischen Schneeflächen – Eis, Wasserlachen?
Die kanadische Küste, rötlich-kahle Berge im Wolkenmeer.
Gletscher, die dem Flugzeug entgegenströmen.
Felsen, zugeweht.
Meereseis mit Spalten.
Lange, nackte Bergmassive, so schneefrei wie in der Wüste New Mexicos. Faltengürtel, Riftsysteme, von oben erkennbar, als Kraft des Stoffes spürbar, der sich zusammenpresst und aufwirft.
(Immer wieder falle ich ins Präsens – bei einer Landschaftsbeschreibung fühlt sich das richtig an. Richtig bei den Bergen, falsch bei den Gletschern. Ausweichmanöver: Listen anlegen. Von Zeitwörtern zu Dingwörtern flüchten.)
Wasser und Eis, Schnee und Stein, Land und Meer fließen ineinander. Lange weiße Gründe: Täler oder Buchten. Weiß, ungebrochen. Weiß, übersät mit türkisblauen Pfühlen.
Spalten im Eis.
Packeis: Ein Mosaik, Türkis mit weißen Fugen.
Blaues Eis der Fjorde. Eisflüsse zerfallen in Segmente. Aufgrund der Strömung, der Gezeiten, des Windes?
Sah das schon immer so aus? Oder müsste alles weiß sein, ohne Spalt und Fuge?
»Am nördlichsten Punkt unseres Fluges befinden wir uns auf 80 Grad nördlicher Breite, nur 500 Kilometer vom Nordpol entfernt.«
Die Durchsage des Piloten schreckt mich auf. Machen Sie sich gefasst, scheint er zu sagen. Auf das große Nichts, wo Etwas sein sollte. Offenes Wasser, wo Robert Peary 1909 seine Fahnenstange aufstellte. Im September 2012 erreichte die arktische Meereseisausdehnung das tiefste Minimum seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen 1979. Selbst wenn die Klimaerwärmung auf zwei Grad begrenzt wird, wird der Nordpol noch vor 2050 öfter eisfrei sein.
Ich weiß Bescheid, doch wie unter Vorbehalt. Es ist, als müsste ich die Dinge erst mit eigenen Augen erblicken.
Die Eisdecke wird wieder dichter, blaugefugtes Weiß. Erleichtert schließe ich die Augen. Alles ist wie immer.
Der vertraute Weg dorthin, wo ich nicht mehr zu Hause bin: Wildnis, die ich niemals betreten werde. Ich will, dass die Menschenleere so weit wie möglich um sich greift. Zugleich halte ich nach der ersten Straße, der ersten kleinen Siedlung Ausschau. Der schwarze Faden, der sich am kargen Ufer entlangschlängelt, die paar glänzenden Dächer an der zugefrorenen Bucht stören nicht, sondern bieten einen Unterschlupf in der Landschaft. Ein, zwei Stunden noch – weiß ich sonst immer auf der Flugbahn des südlicheren Großkreises – werde ich der Straße folgen, bis eine zweite Straße hinzustößt, nach und nach sich ein Netz flicht, das Glitzern der Orte sich verdichtet, das Gewebe sich ausbreitet. Ich werde mit ihm einverstanden sein, weil es sich so beharrlich knüpft, weil ich müde bin und es in diesem Augenblick doch mein Zuhause ist.
Diesmal blieben die Straßen aus. Das Durcheinander aus Felsen und Eis wich einer langen flachen Küste, dem Grünbraun der Tundra, dann einem Bergzug, dann einer Ebene, übersät mit runden schwarzen Seen wie die Schatten der Wolken. Augen zu, Augen auf. Braune Bögen überschrieben sich auf der Ebene, ein Gewirr aus toten Flussarmen, irgendwohin hatte sich der Strom verzogen: Da, der Hauptlauf füllte das Fenster aus, die Nebenläufe verloren sich am Rande des Gesichtsfelds. Das konnte nur der Yukon sein.
Arva Fargo
He ran off to the Yukon to look for gold – lapidare Familienlegende, Witz ohne Pointe. Vielleicht finden wir eines Tages einen Scheck im Briefkasten, weil er wirklich Gold gefunden hat und wir die einzigen Erben sind!
Väterlicherseits feilten die Coles in Neuengland an einem Stammbaum, der bis zu den Pilgervätern zurückreichte. Den kalifornischen Fargos hingegen ging der Sinn für Ahnenforschung ab, obwohl sie die besten Geschichten besaßen: Arva Alphonso Fargo oder Ann Haigh Green, mutmaßliche Puffmutter in San Francisco vor dem Erdbeben 1906. Gern erzählt hat nur meine Großtante Esther. Wir fragen Esther, wenn wir das nächste Mal zu Besuch sind, hieß es immer, aber Kalifornien war weit. Wir schafften es selten nach Sacramento, als sie noch lebte, dabei starb sie erst 2007, 95-jährig. Zum Fragen waren wir dann doch nicht gekommen. Genealogische Gleichgültigkeit herrschte: Was verbindet uns mit den Vorfahren mehr als mit irgendwelchen anderen Toten?
Die Kalifornier seien sowieso wahrscheinlich alles Pferdediebe gewesen – an die Westküste habe es diejenigen gezogen, die ihre Geschichte hinter sich lassen wollten. Solche Ahnen würdigt man am besten, indem man weiterschweigt. Schuld am Abbruch der Überlieferung – da klang doch ein gewisser Unmut durch – sei vor allem Arva, denn er hatte seine Familie sitzen lassen. In Livermore, Kalifornien, soll er mit seiner Frau Mary ein Weingut besessen haben; als er 1900 nach Alaska aufbrach, ließ er Mary mit einem Haufen Schulden zurück. Sie musste das Weingut verkaufen und starb wenig später; der Sohn, Elmore Arva, ging mit 15 arbeiten, um die Familie zu ernähren und seinen Schwestern (Edna, Lola, Amal) die Ausbildung zu finanzieren. Elmore, mein Uropa, der 1954 starb, weigerte sich Zeit seines Lebens, über seinen Vater zu reden.
Hatte Elmores Tochter Esther bei ihm nachgehakt? Tante Chris immerhin bat sie wiederholt, ihre Geschichten aufzuschreiben oder auf Band zu sprechen. Daraus ist nichts geworden. Aber nach Esthers Tod wandte sich Chris, Bibliothekarin an der University of California in Davis, den Archiven und den digitalen Stammbäumen zu.
Wir wussten nicht einmal, woher der Name Fargo stammte. Mein Opa John Arva erhielt jahrelang Werbepost von italienischen Einwanderervereinen, die vermutlich jeden anschrieben, dessen Nachname mit einem Vokal endete. Er sah sich dadurch nicht etwa veranlasst, sich mit seiner Herkunft zu beschäftigen, saß lieber Pfeife rauchend im Fernsehsessel und las Westernromane. Wir rätselten sporadisch – kamen wir vielleicht aus dem Languedoc? Fargo bedeutet dort Schmiede, hatten wir während eines Frankreich-Urlaubs erfahren.
Oder wir spannen eine Verbindung hin zu einer legendären Bank: Wells Fargo, gegründet 1852 in San Francisco. Das Postkutschenunternehmen stellte nicht nur Briefe zu, es beförderte Gold – bewachte und verwahrte Gold, kaufte es gegen Bankwechsel, verlagerte sich ganz auf Finanzdienstleistungen. Meine Eltern führen seit Jahrzehnten ein Konto bei Wells Fargo, nicht etwa aus Familiensinn; die Bank gehört schlicht zu den Marktführern. 2016 flogen dort systematische Betrügereien auf: Um strenge Vertriebsziele zu erreichen, hatten Mitarbeiter über Jahre hinweg Millionen von ahnungslosen Kunden fiktive Konten untergeschoben und dafür Gebühren eingestrichen. Skandal, Sammelklage, gigantische Geldstrafen – Wells Fargo hat alles überstanden. Meine Eltern sind weiterhin Kunden geblieben. Woanders hinzugehen, sei sinnlos, denn die Geschäftspraktiken seien überall gleich. Bitter, den Familiennamen so beschmutzt zu sehen – der Bankgründer William Fargo erwies sich tatsächlich als Cousin zigten Grades. Chris konnte die Familie auf die hugenottischen Fargeaux zurückführen, die im 17. Jahrhundert über Wales nach Amerika auswanderten. Eine Linie brachte William hervor, eine andere Linie in der nächsten Generation: Arva.
In ihrer knappen Freizeit forschte Chris weiter, schickte alle paar Monate Mails mit Stammbaumzweigen, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Je weiter sich das genealogische Netz spannte, desto nichtiger schienen die paar Fakten. Sogar dann, als Chris auf einen alten Zeitungsbericht stieß, demzufolge Arva tatsächlich fündig geworden sei. Sie wollte ausführlicher berichten, aber dazwischen kamen der Job, die Familienverpflichtungen, all die Katzen und Hunde im Haus. Arvas Goldfund schwebte wenig sagend im Raum, ein Fakt, der auf gar nichts hinauslief, am wenigsten auf einen Scheck im Briefkasten. Die Geschichte blieb ein bloßer Scherz.
Erst im Dezember 2015 breitete Chris ihr Material vor mir und meiner Mutter auf dem Küchentisch in Dixon aus. Ich hatte mich mit den Eltern in San Francisco getroffen, danach durchfuhren wir das Central Valley, die weite, verschachtelte Fläche – Straßenraster, Felder, Bewässerungsgräben –, auf der sich drei Generationen Familiengeschichte abgespielt hatten. Dixon liegt kurz vor Sacramento inmitten von nüchternen Mandelplantagen. Wir fuhren zum allerletzten Mal dorthin, denn Chris und Onkel Nate waren in Rente gegangen und im Aufbruch begriffen. Nachdem sie Kalifornien jahrzehntelang kaum verlassen hatten, wollten sie nun nach Edmonton ziehen, meiner Cousine hinterher, die einen Kanadier geheiratet hatte. Wir feierten Weihnachten vor, tauschten Geschenke aus, schimpften auf die Republikaner, die Obamas Politik auf Schritt und Tritt blockierten. Chris mischte Gin Tonics und holte drei grüne Plastikkästen voller Fotos aus dem Schrank. »Ach ja, hier ist das Buch mit den Zeitungsartikeln.«
The Klondike News. The Adventures of Livermore Area Residents from 1897 to 1906 during the Alaska Gold Rush. Livermore, zwanzig Kilometer östlich der San Francisco Bay, ist noch von Ranches und Weingütern geprägt, doch mit seinen inzwischen 90 000 Einwohnern längst ins Ballungsgebiet der Bay Area hineingewachsen. Um 1900 zählte die Ortschaft 1493 Seelen, fünfzig von ihnen zog es in die Goldfelder. The Klondike News versammelt deren Briefe und Berichte an die Lokalzeitung; von »A. A. Fargo« findet sich dort sogar ein Gedicht, »On the Way to Nome«. Schließlich die Schlagzeile vom 7. Dezember 1901:
A. A. Fargo zieht das große LosFrüherer Livermorer macht ein Vermögen im Nordwesten
In Seattle sei ein gewisser E. G. Gould aufgetaucht mit einem Beutel voller Goldklumpen vom Claim seines Freundes A. A. Fargo am Buck Creek, einem Abzweig des Grouse River … bei den vielen Details, die der fachsimpelnde Herr Gould hinterherschickte, kam ich nicht mit, ich blätterte weiter, aber von A. A. Fargo brachte der Livermore Herald keine Meldung mehr.
Chris war schon bei anderen Zweigen der Familie angelangt, packte immer mehr Fotos aus. Schwarz-Weiß-Bilder, Bungalows im harten Licht des Valleys, Schlagschatten auf Rasen, aber auch ein Hauch Weichheit, Staub vielleicht, damals, bevor alles zugepflastert wurde. Nicht Arva war wichtig, sondern die zu Hause Gebliebenen, Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins, die meine Mutter und Tante noch gekannt hatten. Aber ich kannte sie kaum – zu selten war die Familie zusammengekommen. Wir hatten uns immer mehr verstreut, oder kam es mir nur so vor, weil ich mich am weitesten entfernt hatte?
Wäre uns nur das Weingut – das »Valley View« – geblieben! Unser Blick auf das Valley wäre dichterischer, umrankt von Reben wie das Bild auf dem Etikett einer Flasche Zinfandels, mit jenen inzwischen alten Reben wären wir im Tal verwurzelt. Zwar wären wir kaum reich geworden, müssten hart ackern, wären Risiken ausgeliefert, Wetter und Waldbränden, aber so wären wir zu echten Kaliforniern geworden. Hätte Arva nur nicht das Weite gesucht.
Von ihm war nur das Foto überliefert, das Chris auf dem Blog einer wildfremden Genealogin entdeckt hatte. Diesen A. A. Fargo, so die Unbekannte, hatte es in den Bundesstaat Washington verschlagen, wo er 1904 mit ihrer bereits 42 Jahre alten Urgroßtante eine kinderlose Ehe einging. Sonst hatte die Genealogin nur ermitteln können, dass er zur Zeit der Volkszählung 1900 bereits eine Frau und drei Kinder in Kalifornien gehabt hatte – seine erste Frau müsse kurz danach gestorben sein. Sie habe nach deren Nachkommen geforscht, um ihnen dieses wunderbare Foto zeigen zu können.
Das Porträt stammt aus einem Atelier in Chico, Kalifornien, zeigt Arva also in seiner alten Heimat – mit gehetztem Blick, als wollte er gleich davonstürzen. Er ist kein junger Mann mehr. Das dunkle Haar ist zurückgekämmt, gescheitelt, der Schnurrbart überwuchert den Mund und geht in einen Vollbart über. Eine stur vorgeschobene Lippe zeichnet sich darunter ab. Der Abtrünnige in spe, zwischen Schäbigkeit und Abenteuer. Hatte er das Abenteuer für sich behalten? Denn in der neuen Familie waren keine Geschichten überliefert worden, im Blog stand kein Wort von Alaska. Und keines von dem Gold – wo war bloß das Gold geblieben?
Nach dem Besuch in Dixon postete ich Arvas Gedicht zusammen mit seinem Foto auf Facebook, großspurige Ankündigung einer Geschichte, die ich nicht kannte. Die verbissene Miene konnte ich mit dem Elan des Gedichtes in keinen Zusammenhang bringen.
One hundred and eighty miners bold
Left San Francisco in search of gold.
Rash deeds had they done, but none were rasher
Than when they boarded the steamer, Thrasher. …
Unterm Flugzeug verschwand der Yukon hinter einer Wolkendecke. Vielleicht würde es durchregnen – wir würden den Denali gar nicht erst erblicken. Mit über 6000 Metern der höchste Berg des Kontinents. Solche Sätze hatte ich mir eingeprägt; sie erweckten Gefühle von Kühnheit und Ehrgeiz, als wollte ich den Berg erobern. Aber schon die imaginierte Besteigung machte schwindelig. Einen Berggipfel will ich nur sehen – vom festen Boden aus, als etwas Unberührtes, was ich keinesfalls betreten könnte.
Unterm Flügel hervor glitt eine immense Störung des Wolkenfelds, ein Schaumkamm erhob sich, türmte sich an beiden Enden auf. Weiß auf Weiß, ein Ding von zarter Symmetrie: eine Schale, eine Muschel, oder ein Fingerabdruck, der den Wolkenstoff zu beiden Seiten aufwölben ließ. Ich sah den Berg von oben.
Anflug entlang eines inselreichen Flusses, grün, braun, Bäume, Sumpf, Strom wirbelten ineinander, bis der Fluss in Schlickwatt mündete, blaubraunes Wasser verflocht blaubraunes Land, das schon Meer war, hundert Meter unter mir, oder zu meinen Füßen: flache Rinnen und Sandbänke, barfuß zu erkunden, mit flüchtigen Fußabdrücken zu verunstalten, ich kam an.
1. Juli 2018
Wir trafen uns im kleinen Terminal vor den ausgestopften Grizzlybären, nahmen ein Taxi zum Hotel, machten uns frisch. Wie immer ging mein Vater gleich ins Internet, um laut aus der New York Times vorzulesen.
Es ist, als hätten wir mit meinem Vater einen Nachrichtendienst abonniert. Um sechs Uhr früh schaltet sich sein Mac ein, wenig später beginnt er mit der Berichterstattung aus dem Netz, um mir und meiner Mutter mit unserem Nachrichtenkonsum zuvorzukommen. Am schlimmsten sind die Umweltmeldungen, die er – gern beim Abendbrot – mit distanzierter Dringlichkeit vorträgt. »Machen sich die Europäer schon Sorgen«, fragt er mich etwa, »weil der Golfstrom abschwächt? Damit wird Europa bald so kalt wie Kanada«.
Irgendwann ruft meine Mutter: »Und was soll ich jetzt dagegen tun?«
Weil sie bei solchen Unterhaltungen bald aussteigt, wendet er sich umso erwartungsvoller an mich. Schließlich beschäftige ich mich ausdrücklich mit Umweltthemen. Wenn ich zu Besuch bin, platzt er dauernd bei mir herein, um Tatsachen mitzuteilen, die mich interessieren könnten: etwa wann der Nordpol eisfrei wird, oder dass große Waldbrände eigene Gewitterwolken erzeugen, Pyrocumulonimbus. Aber ich weiß so wenig wie meine Mutter, wie ich darauf reagieren soll. Er eröffnet das Gespräch wie mit einem Schwall kalten Wassers. Ich stehe begossen da. Er spielt mir Fakten zu (das ist seine Stärke), als sollte ich daraus ein Gespräch knüpfen. Soll das etwa meine Stärke sein? Jedes Mal muss ich ihn enttäuschen. Es ist nie der richtige Moment für ein Gespräch über den Klimawandel.
Gemeinsam politischen Dampf ablassen, ist dagegen ein vertrautes Familienritual. Vor zwei Wochen hatten meine Eltern ihre Goldene Hochzeit zu zweit in einem Restaurant gefeiert. Ihr Gespräch drehte sich um die Frage, welches Jahr schlimmer gewesen sei – 1968 oder 2018. Einige Nachrichten des Junis 2018: Innerhalb von sechs Wochen wurden 2000 Kinder an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt; die USA zogen sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurück; im russischen Staatsfernsehen verkündete eine Moderatorin: »Die Krim gehört uns, Trump gehört uns!«
(2016: Wir haben die Krim zurückgeholt, ihr müsst Alaska zurückholen, ein Mem erstarrte zur schwarzen Marmortafel mit goldener Schrift, russischtatarisch, in der Stadt Jewpatorija auf der Krim. Juni 2022: Alaska gehört uns, Werbetafel eines Krasnojarsker Anhängerherstellers, die eine Stichelei des Staatsduma-Vorsitzenden Wjetscheslaw Wolodins aufgriff: Sollten die USA wie angedroht russisches Auslandsvermögen einfrieren, sei darauf hingewiesen, dass auch Russland etwas »zurückzufordern« habe. Augenzwinkernd spielte Wolodin auf die Möglichkeit einer Volksabstimmung in Alaska zwecks Wiederanschlusses an Russland an.)
Wir brachen zum Spaziergang auf. Die Langsamkeit, mit der die Sonne weiterrückte, linderte Weltuntergangsgedanken. Schon am nördlichen Licht spürte ich, dass Anchorage jenseits von allem mir Bekannten lag. Zugleich kam ich an wie immer: verwundert, dass die Heimat so freundlich und unschuldig wirkt. Monatelang verfolge ich die politischen Turbulenzen im Netz, die, wie es heißt, schon überall in den realen Raum übergreifen. Aber einmal angekommen, muss ich lange nach eindeutigen Zeichen suchen. (Juli 2021: Wer trägt brav eine Maske, wer ist Maskenmuffel?)
70er-Jahre-Bauten, flache Ladenzeilen, dazwischen ein paar Hotel- oder Bürotürme – Anchorage glich einer Ladung Container, abgestellt zwischen Bucht, Flussmündung und zwei Gebirgsketten. Die Straßen, breit und wenig befahren, gaben die Sicht auf die Berge frei. Motorengeknatter, ein Flieger drehte Schleifen, zeichnete einen Smiley am blauen Himmel. Am Watt des Cook Inlet warnten Schilder vor Treibsand. Glitzernde Rinnen durchbrachen den Schlick, eine Erosionslandschaft vorm blauen Meeresarm. Am fernen Ufer ging die Alaska Range in die Alaska Peninsula über, die in den 3000 Kilometer langen Inselbogen der Aleutenkette ausläuft.
Durch den Strandhafer staksten zwei große Vögel, rotmaskiert, rostbraun – Kanadakraniche, die wir graugefiedert aus New Mexico kannten. Wenn wir in den Winterfeiertagen zu meinem Onkel Greg, dem Bruder meines Vaters, nach Santa Fe fuhren, machten wir oft Zwischenhalt in der Auenlandschaft des Rio Grande, Bosque del Apache, wo die Kraniche überwintern. Manche kommen sogar aus Sibirien angeflogen, sie versammeln sich zu Tausenden, tanzen und stoßen ihre trillernden Rufe aus.
Vor Kurzem, auf der Hinfahrt zum Flughafen in Denver, hatten meine Eltern Greg besucht: Alzheimer-Symptome seien bei ihm inzwischen unübersehbar. Und sein Kater Timothy sei gestorben.
Wir liefen landeinwärts an einem Bach und einem Teich mit Wasservögeln entlang, durch Waldstücke, in denen großblättrige Stauden wucherten. Mitte Mai war ich in Bayern gewesen, und der Flieder hatte zu blühen begonnen; wenig später blühte er in Brandenburg, nun blühte er in Anchorage.
Zurück im Hotel, breitete ich die tagsüber besorgte Alaska-Karte aus, um mir die morgige Route einzuprägen, die zwölfstündige Fahrt über Talkeetna und Denali Park nach Camp Denali. Bei noch strahlend hellem Abendlicht fielen mir die Augen zu, der Weg spulte sich weiter im Schlaf ab. Nach Talkeetna führt die Route 3, der westliche Schenkel des Fernstraßendreiecks im Bauch der Landmasse zwischen Anchorage, Fairbanks und Tok. Dieses Filetstück wirkt gegenüber den nördlichen Weiten geradezu zersiedelt: Auf der großen Karte rücken Anchorage und Fairbanks wie Nachbarorte zusammen, dazwischen der Gebirgszug der Alaska Range mit dem Denali als Hausberg beider Städte. Dabei liegen Fairbanks und Anchorage 576 Kilometer auseinander. Die Dichte des Dreiecks ist nur relativ; außerhalb von ihm gibt es kaum Straßen. Von Fairbanks zweigt Route 6 nach Circle am Yukon ab, 190 Kilometer weiter östlich. Eine dünnere Linie, eine other road, führt nach Norden, 800 Kilometer entlang der Trans-Alaska Pipeline bis Deadhorse am Beaufort-Meer. Drei kurze other roads zweigen von der Küstenstadt Nome ab, und hier und da verbinden braune Linien zwei, drei schwarze Punkte, die Ruby und Long heißen oder Dillingham und Aleknagik. Das war’s dann schon. Hier sind die Gewässer die Wege, die Karte bildet ihre Fließrichtung nach Norden, Süden und Westen ab. Und neben jedem noch so kleinen Ort ist ein Flugplatz eingezeichnet, schwarze Flugzeugschatten, nach Nordwesten ausgerichtet, wie um über die Tschuktschensee abzuheben, zur Wrangel-Insel oder nach Sewernaja Semlja.
Route 3, Alaska
Alaska strebt nach Westen in den Osten. Zwischen zwei der Aleuten, der Großen und der Kleinen Diomedes-Insel, die vier Kilometer auseinanderliegen, verläuft die internationale Datumsgrenze. Mit der Großen Diomedes-Insel fängt der morgige Tag und der Dalnewostotschny okrug, der Ferne Osten Russlands, an.
Ich bin nach Berlin gegangen, weil es mich in den Osten zog: Ostberlin, Russland. 1996 fuhr ich mit einer Freundin bis nach Wladiwostok. Die hügelige Hafenstadt am Goldenen Horn erinnerte an San Francisco, und weit hinterm Horizont lag die heimatliche West Coast. Es war, als stünde ich vor der Rückkehr nach Hause, die schon immer im Osten zu liegen schien.
Road trip, Arizona
Als ich klein war, lebten wir back East und fuhren out West in den Urlaub. Out East, back West sagt niemand. Das Amerikanische geht vom Osten aus und peilt den Westen an.
Als meine Eltern Doktoranden an der Cornell University in Ithaca im Norden des Bundesstaats New York waren, fuhren wir in den Sommerferien zwei, drei Tage lang durch den maroden Industriegürtel und die Ebenen des Mittleren Westens. Untilgbare Highway-Bilder: Wegweiser schweben auf torartigen Gerüsten heran und über das Autodach hinweg. Ihr Dunkelgrün ist ein offizielles Durchwinken. Braune Schilder locken, Recreational Areas, National Forests, National Monuments, National Parks, die Möglichkeit, anzuhalten, die Erde unter den Füßen zu spüren. Aber es geht immer den geraden Pfeilen nach. Ausfahrtsschilder ziehen vorüber, Ortsnamen machen neugierig, die Orte selbst sieht man nicht. Sie behalten ihre main streets für sich, errichten neue Fassaden entlang der frontage roads, die parallel zum Highway verlaufen. Fress- und Schlafmeilen bilden über all die Kilometer hinweg eine einzige, eindimensionale Stadt, zum Glitzerfaden aufgedröselt. Auf dem Rücksitz eingenickt, wache ich auf, weil das Auto abbiegt und langsamer fährt. Pawlowsche Reflexe, Hunger und Schlafbedürfnis. Der Reiz, diese Bedürfnisse in einer fadenscheinigen Theaterkulisse zu befriedigen.
Kleine Familienbetriebe überbieten sich mit dem Kitsch der 1940er-, 50er-, 60er-Jahre, aber meine Eltern bevorzugen die sterilen Kettenmotels. Mit den Mom & Pop Motels haben sie schlechte Erfahrungen gemacht. Flöhe, durchgelegene Matratzen, dünne Wände, Streit nebenan, finster dreinblickende Gäste, wie flüchtige Bankräuber.
Aber ein Kettenmotel ist noch unheimlicher, mit all den Verpackungsschichten – die laminierten Pappbecher, einzeln in Folie eingeschweißt, die Kaffeetüten in ihren Plastikhaltern, einzeln in Plastik eingeschweißt, die Shampoo-Fläschchen, winzig und unhandlich. Das Zimmer ist luft- und lichtdicht, die Klimaanlage rattert, was für ein Aufwand, um atmen zu können. Sinnlos, das Fenster aufzumachen, es geht zum Außengang hin, der einen Hof, einen Pool, einen Steingarten umkreist – auch das ist Verpackung. Oder nach außen zum Parkplatz, umgeben von einer Betonmauer, hinter der du den freeway ahnst, die strip malls, all die austauschbaren Module, du gleitest im Auto von einem zum anderen. Alles so reibungslos, nirgends bleibt man hängen. Woher kommt denn das Gefühl, niemals ins Freie gelangen zu können? Nur daher, dass du keinen Führerschein hast? Und wenn du durch die Landschaft gleitest, ist es undenkbar, wieder hineinzufinden in die fensterlosen Schachteln, in die Geschäfte der strip malls, die sich vom Highway abkapseln. Ihr Blick geht nach innen in grelle Fantasien. Eine mexikanische Fischgaststätte mitten in der Sonoran Desert: Der Golf von Kalifornien überspült die Wände, die Küste dehnt sich in blaue Fernen, ein Thunfisch springt von der Wand, grober Gips und Farbe. Vom Parkplatz aus wären die Berge der Wüste zu sehen, und würdet ihr durchfahren, wäret ihr dreieinhalb Stunden später am Golf von Kalifornien.
1984 zogen wir nach New York City, mitten in die Megalopolis der Tri-State Area, die von Boston bis nach Washington, D. C., reicht. Um den Ballungsraum zu verlassen, fährt man mindestens einen Tag. Endlose Ausdehnung des Gewebes, das sich am Highway verknotet. Asphaltierte oder zugemüllte Zwischenräume lassen die Bauten einsam und störend wirken, auch die Natur wird an den Rand gedrängt. Die Hügel Pennsylvanias wirken wie Kulissen, der dunkle Wald ist zerstückelt und von Straßenlärm durchdrungen. In New York City hatte ich das Vertrauen in die Natur verlernen müssen: jedes Waldstück eine Müllkippe, ein Versteck für Perverse.
Ein weiterer Tag, und die Hügel rücken in die Ferne, vom flachen Midwest siehst du nichts als zwei geschlossene Reihen Maisstängel. Die Landschaft findet im Himmel darüber statt. Zum ersten Mal sah ich Ambosswolken, nahm Gewittergeruch wahr, er war fast unangenehm, wie Dosentomaten, dachte ich, schwer und fruchtfleischig drang er in unsere Blechbüchse.
Später siehst du nur noch Weideland, kärgerer Boden, der zu wogen beginnt, sodass in der Ferne etwas zu sehen ist, wenn auch immer dasselbe, das Auf und Ab, das du im Auto spürst. Und die dunklen Flecken der Rinder, selbstverständlich zu den Weiten gehörend. Abwegig der Gedanke an ihre Zerstückelung, an die Fleischpackungen im Kühlregal bei Walmart, an den zischenden Diner-Grill.
Wann ist man denn im Westen? Wenn man die erste Elster sieht, meint mein Vater, der Ostküstler. Spätestens dann, wenn eine harte Kante entlang des ganzen Horizonts heranrückt. Die Rocky Mountains, das Rückgrat des Kontinents, schälen sich heraus, die 5000 Kilometer lange Kontinentale Wasserscheide, zu beiden Seiten fließt es auseinander.
Im Auto wird es still, wenn die Straße sich ins Gebirge hinaufwindet. Umsichtig fährt mein Vater Serpentinen. Wir scheinen uns einer Entdeckung zu nähern – einer Schanze, einem Ausguck, einer Zuflucht? Diesem Panoramablick, dieser Passhöhe, diesem Schild, das die Continental Divide markiert? Aber ich halte es an den Aussichtspunkten nur wenige Minuten aus. Die Ohren schmerzen im Wind, die Stimmen verlieren sich, die dünne Luft lässt mich spüren, dass ich hier nichts zu suchen habe. Zivilisationsspuren wirken illusorisch, nostalgisch – die Infoschilder der Nationalparks, die Zeltplätze, die hübsch hergerichteten Bergbaustädtchen. Nostalgie heißt: Sehnsucht nach den heimatlichen Bergen.
Mit acht oder neun verschlang ich die Narnia-Bücher von C. S. Lewis, dann Der Herr der Ringe. Der größte Reiz der Lektüre war die Entdeckung von Landschaften voller Geschichten. Kulissen im Superlativ – möglichst steile Berge, möglichst satte Wiesen, möglichst wüste Wüsten. Festeste Festungen, filigranste Paläste. Die Gipfel und Täler der Rockies suchte ich nach strategischen Standorten ab: Auf diesem Felsvorsprung könnte eine uneinnehmbare Burg stehen, in jenem hohen Tal ein Elfenrefugium. Das war mein Versuch, hier Fuß zu fassen. Fantasy-Romane beschwören Kulturlandschaften herauf, von der Historie durchdrungen, alles aus einem Guss, als könnte man sich eine Welt im Ganzen aneignen. Der Traum vom alten Europa, von Bergen wie den Alpen, zu Reduits ausgehöhlt, durchschallt von Ziegenglocken, durchzogen von Wegen, die in die Steinzeit zurückreichen, auf denen man in Berghütten einkehrt und wie einst die Vorfahren Brot und Käse isst. Die Überlieferung ist ungebrochen und jedes Volk hat seinen Platz im Ökosystem. Bis manche unruhig werden, gen Westen segeln, zum verheißenen Land jenseits der Landkarte.
Uropa Loddick, Oma Betty, Großtante Julia, Kalifornien, ca. 1926
Wo am westlichsten Zipfel des Kontinents die roads in Flüsse und Tundra auslaufen, dort ist Schluss mit road trips. Alaska rühmt sich, die last frontier zu sein – die letzte Grenze, so die gängige Übersetzung. Aber »Grenze« und »Frontier« sind zugleich synonym und antonym. An einer Grenze ist etwas zu Ende, kommt zum Abschluss, zum Stillstand. An der Frontier fängt etwas an: Vorstoß, Dynamik, Erschließung.
1893 schied das Wort frontier aus dem offiziellen Gebrauch aus. Angeregt durch diese Mitteilung des US-Statistikamts, griff der Historiker Frederick Jackson Turner den ausrangierten Begriff auf und ließ ihn in seiner frontier thesis weiterleben. Die Siedlungswelle war in alle Ecken und Enden des Landes ausgelaufen, und damit, so Turner, versiegte die vitale Kraft Amerikas: die Vorstellung grenzenloser Vorwärtsbewegung.
Diese ständige Wiedergeburt, dieser fluide Charakter des amerikanischen Lebens, diese Westexpansion mit ihren sich neu eröffnenden Möglichkeiten, ihrer ständigen Berührung mit der Einfachheit einer primitiven Gesellschaft, liefern die Kräfte, die den amerikanischen Nationalcharakter, die amerikanische Kultur, dominieren. […] Bei diesem Vorrücken bildet die Frontier den äußersten Rand der Welle – die Schnittstelle zwischen Wildnis und Zivilisation. […] Das Bedeutsamste an der amerikanischen Frontier besteht darin, dass sie am diesseitigen Rand freien Landes liegt.
Free land – eine Fiktion und ein Paradoxon. Die Freiheit, in der man leben will, ist immer dort, wo niemand wohnt. Aber in Wirklichkeit war das Land längst bewohnt und von eigenen Gesetzen geprägt:
Die Wildnis triumphiert über den Kolonisten. […] Sie versetzt ihn ins Blockhaus der Cherokee und Irokesen und zieht eine indianische Palisade um ihn herum. […] [S]o passt er sich an die indianischen Lichtungen an und folgt den indianischen Pfaden.
Was das begehrte »freie Land« ausmacht, ist das Wesen seiner verdrängten Ureinwohner. Sie stehen für die Freiheit und gehen in ihr auf. Man tritt, so der Traum, in ihre Fußstapfen, tritt ihr Freiheitserbe an, das sich im selben Moment entzieht – so der Alptraum. Sie wurden umsonst geopfert.
Turners Unbehagen betrifft vielmehr die Erlahmung eigener Vitalkraft, das Ende einer großen historischen Bewegung. Entscheidend bei jener Bewegung waren die Homesteads, die staatlichen Landzuteilungen an den kleinen Mann. Den Homestead Act unterzeichnete Abraham Lincoln 1862 als offizielle Absegnung der Lebensform des settlers. Ein schizophrener Archetyp: Vater Staat verjagt die Ureinwohner, verteilt das Land, schützt die Siedler – die sich trotzdem als autarke Eroberer der Wildnis verstehen. Man zieht weiter, sobald man auch nur den Rauch aus einem nachbarlichen Schornstein aufsteigen sieht, heißt es in Unsere kleine Farm von Laura Ingalls Wilder.
Mein Uropa Loddick mütterlicherseits versuchte sich noch in den 1920ern als Homesteader in der trockenen Steppe Montanas. Besseres Land war nicht mehr zu haben. Nach wenigen Jahren warf er das Handtuch, packte die Familie ins Auto und brach nach Kalifornien auf. Ein Foto zeigt ihn mit den Mädchen Betty und Julia zwischen Ford Modell T und Yucca-Palme. Stolz blickt er in die Kamera: Die Familie war im Goldenen Westen angekommen.
1934, Uropa Loddick war längst Bauunternehmer in der kalifornischen Hauptstadt, wurde das Homestead-Programm ad acta gelegt. In Alaska galt es aber bis 1986 – die Frontier, die das Modell T noch ansteuern konnte (wenn auch nur mehr als Fata Morgana), war in den Hohen Norden zurückgewichen. Heute noch vergibt Alaskas Landesregierung Parzellen, etwa durch ein »Homesite«-Programm – jedem steht weiterhin eine Waldhütte zu.
In Turners Betrachtungen blieb Alaska zunächst außen vor. Erst 1914 würdigte er die Fortschreibung der historischen Fiktion im fernsten Westen, die an ein altes Märchen anknüpft: den Weg in den Orient.
Schon winkt im Norden Alaska und fragt die Nation mit Hinweis auf seinen Reichtum an Bodenschätzen, welche veränderten Bedingungen die neue Zeit für es bereithalten wird. Jenseits des Pazifiks zeichnet sich Asien ab, nicht länger ferne Vision und Symbol des Unveränderlichen, sondern getragen wie von einer Luftspiegelung nahe unseren Küsten, und wirft ernste Fragen nach Alltag und Schicksal der mit dem Meer lebenden Menschen auf. Die Träume Bentons und Sewards von einem zu neuem Leben erwachten Orient, sobald der lange Marsch der Zivilisation gen Westen den Kreis erst geschlossen hat, scheinen drauf und dran, in Erfüllung zu gehen. Das Zeitalter des Pazifischen Ozeans beginnt, geheimnisvoll und unergründlich in seiner Bedeutung für unsere eigene Zukunft.
William Seward, den Abraham Lincoln zum Außenminister ernannt hatte, verhandelte 1867 den Abkauf Alaskas von Russland. Er tat dies mit frischen Narben im Gesicht, denn am selben Abend, an dem Lincoln zwei Jahre zuvor ermordet worden war, hatten die Verschwörer auch ihn, den ebenso leidenschaftlichen Sklavereigegner, überfallen. Jahrzehntelang hatte sich Seward gegen Expansionspolitik gestellt, weil aus neuen Territorien Sklavenstaaten werden konnten. Nach der Abschaffung der Sklaverei bekannte er sich aber zur Vision des Imperiums, wollte sogar Grönland und Island für die USA erwerben. Stattdessen ging er dann auf das Angebot Russlands ein, das – infolge des verlorenen Krimkriegs in eine Krise gestürzt – die abgelegene Kolonie Alaska loswerden wollte. Der vereinbarte Kaufpreis betrug sieben Millionen Dollar, in den Augen vieler eine maßlos übertriebene Summe. Alaska sei eine gefrorene Einöde, selbst die Pelztiere hätten die Russen so gut wie ausgerottet: Russland hat uns eine ausgelutschte Orange verkauft.
Über mehrere tausend Kilometer hinweg wurde Seward’s Folly – Sewards Reinfall – den Vereinigten Staaten angegliedert, zunächst als department, dann als district, dann als territory, erst 1959 als Bundesstaat. Selbst dann ging Alaska eigene Wege. Nicht nur, dass die Tradition der Homesteads fortgeführt wurde – auch andere Dinge wurden und werden eigensinnig geregelt. Nach der Entdeckung sagenhafter Ölvorkommen am Beaufort-Meer 1968 mussten die Verhältnisse im neuen Bundesstaat rasch geklärt werden, vor allem die Gebietsansprüche der Ureinwohner. Mit dem Alaska Native Claims Settlement Act 1971 wurden sie mit Land und Geld abgefunden, das Reservatsystem wurde aufgelöst. Die Stämme gründeten regionale Körperschaften, um die Ausgleichszahlungen und die Bodenschätze ihrer Ländereien zu verwalten. Damit wurde jedes Stammesmitglied zum Gesellschafter einer immens profitablen Native Corporation. Der Spagat zwischen Marktwirtschaft und Tradition war und bleibt umstritten – sichert allerdings, so seine Befürworter, die Autonomie der Stämme und deren althergebrachte Subsistenzwirtschaft.
Auch Alaskas Erdöleinnahmen werden genossenschaftlich verwaltet. 1976 wurde der Alaska Permanent Fund eingerichtet, ein staatlicher Fonds, in den ein Viertel des Gewinns fließt und aus dem eine jährliche Dividende an jeden Einwohner ausgeschüttet wird. Ein Teil des Profits wird erklärtermaßen angelegt, damit für künftige Generationen noch Geld da ist, wenn der letzte Tropfen Öl aus der Prudhoe Bay oder dem Arctic National Wildlife Refuge abtransportiert und verbrannt worden ist.
So machten sich die Gründer des Fonds durchaus Gedanken um die Endlichkeit der Ressourcen, war doch Die Grenzen des Wachstums erst vier Jahre zuvor erschienen. Sie sahen eine Welt ohne Öl voraus – doch so, als würde sich der Brennstoff einfach in sauberes Geld verwandeln. Als blieben keine folgenreichen Abgase zurück, sondern lediglich eine Wertanlage, mit der ihre Enkel und Urenkel genauso klug würden wirtschaften können. Das Anwachsen einer Hypothek war nicht einkalkuliert worden. Alaska galt weiterhin als Frontier, als unerschöpfliches Füllhorn künftiger Generationen.
2. Juli 2018
Früh um sieben fuhr der Reisebus ab. Komfortsitze, gedämpfte Stimmen im unverfänglichen Gespräch. Keine politischen Diskussionen würden mehr geführt werden – nicht, wenn Unbekannte beieinandersitzen. Mein Vater hatte es nicht geschafft, die Nachrichten zu lesen. Niemand surfte mit seinem Smartphone, denn mit dem Hotel hatten wir das Internet hinter uns gelassen. Facebook schwand als bläuliches Fensterlicht am Straßenrand dahin – ich war erst einmal draußen. Um die Flucht zu rechtfertigen, sagte ich mir selbst, dass ich Abstand gewinnen, über alles nachdenken musste. Alles: der Internet-Kasten, der alles beinhaltet.
(Zum Beispiel: der »Asylstreit«, Seehofers angedrohter Rücktritt, sein Rücktritt vom Rücktritt. Um nichts anderes kreiste gerade das deutsche Feuilleton. Abstand gewinnen, mit diesem Gedanken war ich schon in Berlin losgeflogen.)
Nördlich von Anchorage breitet sich das Zivilisationsgeflecht noch aus. Agrarflächen bedecken das Schwemmland des Matanuska Valleys, das in den wenigen, aber schier endlosen Sommertagen Gemüse von ungeheurer Größe hervorbringt, Brokkoli mit siebzehn Kilo, Kürbisse mit fast 700 Kilo – von solchen Weltrekorden berichtete der Busfahrer, bevor er eine DVD einlegte und sich auf die Straße konzentrierte. Alone in the Wilderness, Aufnahmen des Aussteigers Richard Proenneke, der 1968 an einem einsamen See mit eigenen Händen ein Blockhaus baute. Proennekes Arbeitsabläufe lenkten von der Landschaft ab. Fichten fällen, schälen, zersägen, ein Jahr lang trocknen lassen. Holzhammer, Werkzeuggriffe schnitzen. Kies vom Seeufer holen, im Rechteck ausbreiten, darauf die Stämme schichten. Kerben ansägen, aushacken, glattmeißeln. Das saubere Einrasten der Bohlen verbreitete Ruhe und Zuversicht. Der Film war wie eine Vorbereitung auf ein endgültiges Aussteigen, eine Unterweisung in die Wildnis, die wir inzwischen durchfuhren.
Route 3 führt nach Norden am Susitna River entlang, in dessen breitem Tal die Wasserläufe zweier Gebirgszüge zusammenfließen – links heranrückend die 3000er der südlichen Alaska Range, rechts die Talkeetna Mountains, niedriger, beinah schneefrei. Dazwischen bahnt sich der braune Fluss den Weg durch den Fichtenwald, verleibt ihn sich als Inseln ein und häuft den Stoff der Gebirge als Kiesbänke auf. Sah so vor tausend Jahren der Rhein oder die Donau aus, unbegradigt, kaum schiff bar? Wenn die Bäume den Blick freigaben, schielte ich nach der Alaska Range, besorgt, den Denali zu verpassen oder mit einem anderen Berg zu verwechseln. Ich suchte ihn zwischen Gipfeln, zwischen Wolken, so angestrengt, dass ich übersah, was weit oben über der Wolkenschicht schwebte: ein weißer Keil, noch einmal so hoch wie das vorgelagerte Gebirge.
Wenig später hielt der Bus an der Talkeetna Alaskan Lodge und wir stürzten durchs Foyer zur Aussichtsplattform, als könnte sich der Berg auf und davonmachen. Aber er war noch da, verschleiert und dennoch auf einen Blick in voller Höhe zu ermessen. In der geomorphometrischen Fachsprache: Unter allen Bergen der Welt hat der Denali das welthöchste Relief, die drittgrößte Schartenhöhe und die drittgrößte Dominanz. Der Blick vom Tal aus, knapp über dem Meeresspiegel, geht auf einen alpenhohen Gebirgszug, überragt von einem breiten weißen Massiv und dieses wiederum von einer weißen Kuppel. Alles läuft zu ihr herauf und in ihr zusammen. Sie macht aus der Alaska Range ein einziges Massiv, einen einzigen Berg.
Wohin nur mit dem Schwindel? Der kitschige Innenraum lockte. Ein Atrium mit einem Spitzdach, gestützt von glattgeschälten Bohlen, in der Mitte ein bis an die Decke reichender Kamin, gemauert aus Flusssteinen. Weiche Ledersofas vorm prasselnden Feuer, der Duft von Kaffee und Sandwiches an der Mitnahmetheke. Du bist eingeladen zu verweilen, auch wenn du dir kein Zimmer und kein candlelight dinner in dem nach Rindersteaks duftenden Restaurant leisten kannst. Weil eine Lodge jeden beeindrucken will, darf sich jeder willkommen fühlen. Sie ist ein Ziel für sich, zugleich Grand Hotel, Theaterkulisse und Museum, das die Naturwunder in Fenstern einrahmt und in Vitrinen aufbewahrt. Zwischen Kamin und Panoramafenster stand auf den Hinterbeinen in einem Glaskasten ein 1000 Kilo schwerer Grizzly, den ein zehnjähriges Mädchen mit einem Remington-Gewehr erlegt hatte.
Gefühle, die nur in einem solchen Raum zusammenpassen, sich über die Jahre hinweg überlagern: Geborgenheit, Abenteuerlust, Nostalgie, Klaustrophobie. Kindliche Gier, ausgelöst von den Gerüchen – Pommes, Kaffee, Zimt, Holzrauch –, von der Naturpracht, von dem Dollar in meiner Hand, mit dem ich ein Stückchen davon erwerben will, eine Postkarte oder einen Stein in einer Schachtel. Später pubertäre Wut, weil ich die Pracht mit lauter auf Snacks und Souvenirs erpichten Kindern und dicken Erwachsenen teilen muss. Noch später erwachsene Rührung und Skepsis. Was macht einen solchen Ort aus? Was macht er mit mir, mit welcher Absicht?
Wenige Stunden später: Denali Park, die künstliche Siedlung am Eingang des Nationalparks. Bahnhof, Flugplatz, Parkplätze, Zeltplätze, Lodge, Visitor Center, Park Headquarters, Souvenir- und Lebensmittelläden, Aussichtspunkte, Wegweiser zu den Wanderwegen. Eine Stunde Aufenthalt, bevor es mit dem Kleinbus weiterging. Im Visitor Center fanden wir abgebildet, was uns draußen erwartete: die Alaska Range als Modell auf einem Tisch. An einer Zeitleiste lief ich 400 Millionen Jahre Erdgeschichte ab. Schummriges Licht, Vogelrufe, Wasserrauschen, sonore Stimmen, die alles erklärten. Draußen, durch Anlagen aus beschilderten Pflanzen, führten rollstuhlfreundliche Betonwege, so verschlungen, dass wir uns jetzt schon verlaufen konnten. Rustikale Bauten fügten sich elegant in die Landschaft ein. Solche Dinge fielen auf, weil sie nicht mehr selbstverständlich waren. Die Nationalparks befanden sich im Belagerungszustand.
Fast dreißig Prozent der USA sind öffentliches Land. In den 1960ern trafen meine Eltern auf einer Wüstenwanderung einen Touristen aus der DDR, der aus dem Staunen nicht herauskam: So viel Land im volkseigenen Besitz! Im Namen des Volkes waltet darüber eine Reihe von Behörden – der National Park Service, das Bureau of Land Management, der U. S. Fish and Wildlife Service – unter dem Dach des Department of the Interior, ein »Innenministerium«, das sich weder um die innere Politik noch um die innere Sicherheit kümmert, sondern – Aufgabe genug – lediglich den Grund und Boden verwaltet. Donald Trumps Secretary of the Interior war Ryan Zinke, der zur Amtseinführung 2017 auf seinem Pferd Tonto zum Ministerium angeritten kam. Dann legte er los mit der Abwicklung der ihm unterstellten Ämter und Ländereien, ließ National Monuments zugunsten der Rohstoffgewinnung schrumpfen, forderte Kürzungen bei seiner eigenen Behörde, gönnte sich selbst teure Dienstflüge. Währenddessen wurde die Environmental Protection Agency dem Klimawandelleugner Scott Pruitt anvertraut, der sie als Generalstaatsanwalt von Oklahoma bereits ein Dutzend Mal verklagt hatte. Gegen Zinke und Pruitt liefen inzwischen etliche Verfahren wegen Amtsvergehen und Missbrauch von Steuergeldern.
All das hatte ich von Deutschland aus verfolgt. Vor Ort war nichts davon zu merken; die Abläufe in der Wildnis funktionierten reibungslos. Zwei Kleinbusse fuhren uns mit vierzig anderen in unsere Lodge, Camp Denali in Kantishna am westlichen Ende der 150 Kilometer langen Park Road. Ab dem 25. Kilometer ist die Straße unbefestigt und für Privatfahrzeuge gesperrt, Parkbusse pendeln zwischen Kantishna, dem Eielson Visitor Center bei Kilometer 106 und den wenigen Zeltplätzen. Rucksackreisende – es sind nur wenige – dürfen querfeldein wandern und überall ihr Zelt aufschlagen. Ansonsten muss man Monate im Voraus Plätze, die nicht gerade billig sind, in einer der beiden Lodges reservieren. Drei dieser Plätze hatten wir.
Alles war viel zu bequem. Die sportlichen Passagiere wirkten unruhig im erzwungenen Kollektiv. (Eine Enge, die 2020 so nicht denkbar wäre. Man säße mit Abstand, schweigend, maskiert. Das Unbehagen wäre gesteigert und zwiegespalten: Die einen würden am Gefühl der Bevormundung leiden, die anderen unter der Nähe.) Es war ungewohnt, nicht das eigene Auto zu steuern, sondern wie Kinder zusammen auf den Rücksitzen zu hocken. So konnte mein Vater immerhin ohne Unterbrechung fotografieren, während ein junger Mann am Steuer saß und die Landschaft erläuterte, die uns stumm machte. Es war, als stießen wir dorthin vor, wohin alle Bergstraßen aller road trips schon immer hätten führen müssen. Die Park Road wand sich über die Südhänge der rundgeschliffenen Outer Range. Linkerhand, über breite Täler hinweg, lag die Alaska Range, schroff und schneegestreift, unter einer Wolkendecke. Unvorstellbar, dass dahinter noch ein Berg sein könnte. Statistisch betrachtet, so der Fahrer, zeige sich der Denali nur alle drei Tage. Kurzes Nachrechnen: Unser Glück hatten wir schon zur Hälfte aufgebraucht.
Durch das Tal linkerhand wälzten sich Steinströme, durchflochten von Flussläufen, die von fern wie versickernde Rinnsale wirkten. Von rechts stieß das Tal des Teklanika River hinzu – ein Name, der bekannt klang. Zwanzig Kilometer weiter nördlich, erzählte der Fahrer, lebte und starb Chris McCandless. 1992 war der 24-jährige Südstaatler nahe dem Ort Healy auf dem Stampede Trail aufgebrochen, einer stillgelegten, damals selten erwanderten Bergbaustraße. Er durchwatete den im winterlichen April noch wenig Wasser führenden Teklanika und fand nach dreißig Kilometern einen alten Bus. Dort verbrachte er den Sommer, ernährte sich von einem Sack Reis, Beeren, einem erlegten Elch, las Thoreau und Tolstoi und führte Tagebuch. Als er im Juli nach Healy zurückkehren wollte, war die Schneeschmelze längst im Gang, der Teklanika führte Hochwasser. Er ging zum Bus zurück und verhungerte.
Into the Wild heißt die Geschichte, jeder von uns kannte sie. Ratloses Schweigen – dass wir so knapp an seiner Wildnis vorbeifuhren. Dass er mit seinen vier Tagesmärschen kaum einmal in sie eingedrungen war. Auf der großen Übersichtskarte sieht es aus, als hätte er nur wenig abseits der Route 3, quasi am Straßenrand in Rufweite von Healy ausgeharrt. Selbst hatte er keine bessere Wanderkarte – sonst hätte er gewusst, dass 400 Meter stromabwärts eine Schwebefähre den Teklanika überquerte. Aber er wollte seinen eigenen Weg finden.
Der Bus fuhr im Schritttempo, wir sollten still sein, Ausschau halten, Wildtiere nach dem Prinzip der Uhrzeiger-Positionen melden: geradeaus hieß zwölf Uhr, halbrechts ein oder zwei Uhr, hart rechts drei Uhr, hinter uns sechs Uhr. Über die Landschaft legte sich das Ziffernblatt, das Zeit in der Runde zählt, 360 Sekunden gleich 360 Grad teilten den Raum auf, den ganzen endlosen Tag lang. Wolken trieben, die Sonne verteilte sich durch ihre Lücken, Stunde für Stunde, ohne weniger zu werden. Mittag, kein flüchtiger Punkt, sondern eine große Mitte.
Der Fahrer ging zur Geologie über, unterbrach sich bei Tiersichtungen. Weiße Tupfer im Felsspalt: Dall-Schafe. Ein Karibu stürzte über die Straße, ein Karibukadaver am Fluss zog Raben an. Selbst Rotfüchse lösten Aufregung aus. Schließlich: Grizzlies at 2 o’clock! Luftwaffenpräzision, als ginge es um feindliche Düsenjäger. Aber die Jäger waren wir, der Bus pirschte sich heran. Atem anhalten, Friedfertigkeit ausstrahlen. Auch die Bären waren friedlich, ästen am Hang in hundert Metern Entfernung. Grizzled: hell angehaucht, ein feines Gleißen, das ihre Größe spüren ließ. Das blonde Fell wogte wie das Gras, das sie durchstreiften.
Sie schwanden im Rückspiegel, der Fahrer beschleunigte und nahm den Faden der Erdgeschichte wieder auf. Neben uns her, zu Füßen der Alaska Range, zogen sich breite Gründe hin – Wald, Tundra oder das graue Geröll der Flussbetten – und verengten sich immer wieder zu sanft ansteigenden Pässen. Ein einziges, locker geknüpftes Tal zwischen der Alaska Range und der Outer Range, spürbar als zusammenhängendes Ganzes, weil die Park Road ihn nachzeichnet. Längs dieses Tals verläuft die Plattengrenze, die bis nach Kalifornien reicht. Hier, in der Alaska-Subduktionszone, taucht die Pazifische Platte unter die Nordamerikanische und streift Massen von Gestein ab. Die alten, abgeschliffenen Berge der Outer Range seien, so der Fahrer, einst beachfront property, Strandgrundstücke, gewesen, aber seit Jahrmillionen werde Welle für Welle Land angetragen. Irgendwann werde auch Los Angeles hier landen. Und der Denali steige immer weiter in die Höhe, einen Kilometer alle zwei Millionen Jahre.
Zu sehen war nur die Bergbrandung vor ihm, Polychrome Pass mit Blick auf einen Kamm, dessen Hänge und Kuppen wie glattgeleckt waren. Schneezungen ließen das Gestein rot-ocker-gelb-grau leuchten, letzte Reste der Eiszeit-Gletscher, deren zermalmende Fließrichtung den Furchen abzulesen war. Über ihre Endmoränen stieg die Straße auf und ab. Dass jemand erklärte, was ich sah, schmälerte das Gesehene nicht. Es war, als würde ich es nebenher abtasten, gleichzeitig sehen und abstrahieren, wo ich doch durch den Jetlag schon neben mir stand. Flüchtige Klarheit: Das hier ist die Zukunft Grönlands. Unter dessen Eisschild bereitet sich eine Landschaft wie diese vor. Grönlands Gletscher weichen aus ergrünenden Tälern, werden schmelzend zu vielsträhnig verflochtenen Flüssen, die Abermillionen Steine zusammentragen und durch sie hindurch immer neue Mäander ziehen.
Von menschlichen Spuren erzählte der Fahrer, die zu den ältesten des Kontinents gehören. Die Park Road folgt einer jahrtausendealten Wanderroute, dem vielleicht allerersten Weg am Nordrand des Inlandeisschildes. Eine einzige Steppe zog sich von Kanada über die Beringia-Landbrücke durch ganz Eurasien. Alaska gehörte zu Asien, durch das Inlandeis vom Süden Amerikas abgeschnitten, durch Beringia an Sibirien festgewachsen. Hier begannen die großen Migrationen. Einwanderungswellen, ein Bild, das hier nichts Menschenfeindliches meint, wenn es aus Menschen eine abstrakt sich bewegende Masse macht, wie die Berge, die hier an Land gespült werden.
Der Fahrer unterbrach sich: »Denali is out.« So nebenbei sprach er vom Berg als von einem Himmelskörper, der »rauskommt«. Die Wolkenwand lockerte sich, Licht drang durch Spalten. Die Suche nach der Lücke, der Blick durch sie hindurch, die Schauer, weil hinter der Wolke ein anderes Weiß zum Vorschein kommt, hart und aufwärtsstrebend. Eine Wand. Fragmente miteinander in Verbindung bringen, raten, wie hoch die Hänge noch emporragen, wo sie zur Spitze zusammenlaufen. Sich in das Spiel der Wolkenfenster versenken, um endlich den Gipfel auszumachen, weiter oben, als möglich scheint. (Monate später fiel mir an meinem Foto auf: Auch das war nur eine vorgelagerte Pyramide gewesen, an deren Symmetrie mein Auge hängen blieb. Der wahre Gipfel stieg von deren Spitze auf wie eine Schneefahne.)
Der Denali
Um halb zehn, als ich in meiner Ferienhütte schlafen ging, stand die ganze Kuppel strahlend weiß vorm tiefblauen Himmel. Sie war genauso hell und klar, als ich um zwei Uhr wieder aufwachte, und um fünf, als ich aufstand.
3. Juli 2018
Camp Denali liegt auf einer Anhöhe, Ausläufer der Kantishna Hills, die vom Norden her zur Outer Range stoßen. Dunkelrote Hütten stehen am Hang zwischen Gesträuch und kleinen Fichten, eine Schotterstraße führt hinauf zur Lodge, ein giebelüberdachter Saal mit Panoramafenstern.
Meine eigene Hütte hatte ein schmales Bett mit einer Flickendecke, eine Gaslampe als Leselicht. Der sanfte Knall beim Zünden des Glühstrumpfs, der Geruch und das leise Zischen des Benzins erinnerten an die Coleman-Laterne der Eltern auf dem Picknick-Tisch beim Zelten. (Und an die Motten, die gegen das Glas prallten – so viele Insekten damals.) Zum Heizen ein Kamin, am Fenster ein Holzgestell mit Gaskochfeld und Abflussbecken, einem Fach mit Kaffee, Tee, Geschirr. Ein Teekessel, ein roter Emaille-Krug, um Wasser vom Hahn vor der Tür zu holen. Hinter dem Hahn, zwischen zwei Fichten, der Denali.
Richard Proenneke in seiner Hütte
Der große Traum: einschlafen und als Thoreau aufwachen. Die Hütte ist schon fertig, als hätte ich sie selbst gebaut. Als Kind, aus Möbelstücken oder Ästen. Alles, was im Wald wächst, hat eine Verwendung und ich weiß Bescheid. Als Kind, als Vorform Thoreaus, kam ich ohne Geld und Rechnen aus. Der erwachsene Henry David rechnete vor: Der Bau seiner Hütte hatte ihn nur 28,12 Dollar gekostet. Als ich ihn zum ersten Mal las, fand ich ihn unerträglich selbstgefällig. Self-reliant, herabschauend auf handwerklich Unbegabte. (Oder – wie die Pascal-Zitierenden des Lockdowns – auf Menschen, die es in der Isolation nicht aushalten.) Später verstand ich, dass er sich damit selbst Mut macht. Es ist ein Pfeifen im Walde. Das überbordende Ego gehört einem Mann, der für die Schublade schreibt. So konnte er anderen nach ihm Mut machen. Ob Richard Proenneke Walden schon vorher kannte, oder erst nachdem er selbst als »moderner Thoreau« galt?
Proenneke wurde 1916 in Iowa geboren, war also so alt wie meine Oma Fargo. Im Zweiten Weltkrieg war er Schiffszimmerer, danach Mechaniker, zuletzt für den Fish and Wildlife Service in Alaska. 1968 zog er an einen Bergsee 225 Kilometer westlich von Anchorage, lebte dreißig Jahre lang allein in seiner Blockhütte, filmte und führte Tagebuch. Aus seinen Notizen wurde 1973 das Buch One Man’s Wilderness, das ihn bekannt machte. Manchmal zog es Neugierige zu seiner Hütte, wo sie einen freundlichen Menschen antrafen – denn zu seinen Lebzeiten überstieg sein Ruhm nicht das für ihn erträgliche Maß. Mit 82 Jahren zog er zu seinem Bruder nach Kalifornien, mit 86 starb er. Seine Hütte vermachte er dem National Park Service. Sie zieht immer mehr Abenteuertouristen an, seit der Dokumentarfilm Alone in the Wilderness 2004 aus seinen Aufnahmen entstand.
Seine Analog-Filme sind Artefakte, die Lebensweise, die er vorführt, war es bereits 1968. Ein Artefakt ist das, was überlebt, dessen Nutzen, wenn auch nicht gleich entzifferbar, so doch greifbar ist. Auf mich wirken Proennekes Bilder vertraut, die nüchterne Helle des Sechziger-Jahre-Films. Wie in einem Film aus meiner Kindheit, My Side of the Mountain, 1969, über einen in Thoreau vernarrten Jungen, der von zu Hause wegläuft und sich in einem hohlen Baum im Gebirge einrichtet. Der Wald war wie der Wald bei Ithaca, die Handlung verweilte bei praktischen Details, blieb in Erinnerung als eine Anleitung, auf die ich zurückgreifen könnte, sollte es mich eines Tages in die Wildnis verschlagen.
Proenneke geht es allein um die Anleitung, er hat nicht den Anspruch, eine Geschichte zu erzählen. Seine Kamera nimmt alles auf, Berge, See, Wetter, Tiere, ihn selbst, wie er seine Hütte, Werkzeuge und häuslichen Gerätschaften aus den Stoffen der Landschaft – Bäume, Kies, Moos – zusammenbaut. Er setzt sich nur rudimentär in Szene, nur das Nötigste, um sein Tun festzuhalten. Sein Tun hält er fest, weil es nötig ist, aus demselben Grund, weshalb du Tagebuch führst: um überhaupt erst zu verstehen, was du denkst und tust. Durchaus mit dem Hintergedanken, dies könnte irgendwem, irgendwann nützlich sein. Irgendwer, irgendwann – eine andere Öffentlichkeit als das Jeder, Jetzt des Netzes.
Er wendet sich an eine Kamera, die, Auge mit Beinen, für ihn selbst steht, oder für einen Freund, oder ein Kind, das sich heranpirscht. (Er hatte keine Kinder.) Ein paar imaginäre Gegenüber, ein Spiel mit dem eigenen Bewusstsein, mit den wenigen Menschen, die ein Bewusstsein überhaupt erfassen kann. Kein Massenpublikum versammelt sich vor der Landschaft. Aber wie schon Thoreau lebt Proenneke in einem Widerspruch. Wie ein Goldsucher zieht er andere Goldsucher nach sich. Will er letztlich doch Gesellschaft? Oder glaubt er, dass die Einsamkeit für alle reicht?
Im einsamen Tod des Chris McCandless verschärften sich die Widersprüche. Er wurde zum Stoff eines Buches, eines Films, immer mehr Menschen brachen nach Healy auf, pilgerten auf dem alten Stampede Trail zum Bus, in dem McCandless starb und der inzwischen zum Schrein geworden war. Immer wieder gerieten sie dabei in Todesgefahr. Manche konnten von der Nationalgarde gerettet werden, manche ertranken, weil sie die Strömung des Teklanikas unterschätzt hatten. Erbittert wurde darüber gestritten, ob McCandless ein tragischer Held oder nur ein Idiot gewesen war, der andere Idioten mit ins Verderben stürzte. Vieles hing dabei an einer technischen Frage: War ihm die Nahrungssuche nicht gelungen, oder hatte er sich vielmehr eine seltene pflanzliche Vergiftung zugezogen? Kurzum: War ihm mit seinem Tod ein Anfängerfehler unterlaufen oder war er an einer Übung für Fortgeschrittene gescheitert? Derweil wucherten die Fotos der Pilger im Netz, neue Pilger brachen zum Schrein auf. Und wenn sie starben, pilgerten ihre Angehörigen ebenfalls zum Bus und hinterließen neue Gedenkschreine.