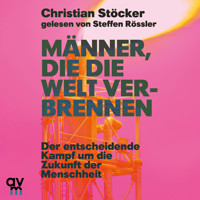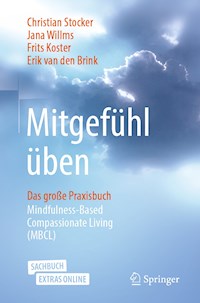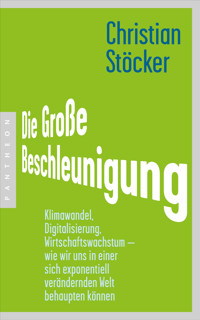
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
»Ein Sprengsatz von einem Buch. Nach der Lektüre sehen Sie die Welt von Morgen mit völlig anderen Augen.« Tom Hillenbrand
An drei entscheidenen Punkten entscheidet sich im 21. Jahrhundert unsere Zukunft: Weltbevölkerung, Klimawandel und Digitalisierung. Gemeinsam ist ihnen: Sie sind Phänomene des exponentiellen Wachstums und der Großen Beschleunigung. Schon immer haben wir Menschen uns schwer damit getan, solche Entwicklungen zu Ende zu denken. Aber: Wir sind eine lernfähige Spezies ...
Wird es uns also gelingen, die mächtigen technologischen Entwicklungen so einzusetzen, dass sie uns und die Erde retten? Was wir brauchen, sind neue Instrumente im Werkzeugkasten unseres Denkens, die von neuen Technologien bis zu einer anderen Haltung gegenüber Wachstum und einer neuen Definition von Fortschritt reichen. Christian Stöckers Buch ist eine panikfreie und präzise Analyse des großen Experiments Menschheit und ein Aufruf, jetzt neues Wissen zu erschließen und die Große Beschleunigung zu lenken. Mit einem aktuellen Vorwort des Autors.
Dieses Buch ist zuvor unter der dem Titel »Das Experiment sind wir« erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Drei der entscheidenden Entwicklungen, die unsere Zukunft im 21. Jahrhundert bestimmen werden – Klimawandel, Digitalisierung, Wirtschaftswachstum – haben etwas gemeinsam: Sie sind Phänomene des exponentiellen Wachstums und der sogenannten Großen Beschleunigung. Schon immer haben wir Menschen uns schwer damit getan, solche Entwicklungen zu Ende zu denken. Aber: Wir sind eine lernfähige Spezies.
Tatsächlich hat die Beschleunigung der letzten siebzig Jahre große Verbesserungen gebracht: steigende Lebenserwartung, mehr Bildung, bessere medizinische Versorgung. Aber sie hat die Menschheit auch in eine sehr gefährliche Lage manövriert. Wird es uns gelingen, die mächtigen technologischen Entwicklungen so einzusetzen, dass sie uns und die Erde retten?
Was wir brauchen, sind neue Instrumente im Werkzeugkasten unseres Denkens. Christian Stöckers Buch ist eine panikfreie und präzise Analyse des großen Experiments Menschheit – ein Aufruf, jetzt neues Wissen zu erschließen und die Große Beschleunigung zu unserem Vorteil zu lenken.
Christian Stöcker, geboren 1973, ist Kognitionspsychologe und Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW), wo er den Studiengang »Digitale Kommunikation« leitet. Als Experte für digitale Öffentlichkeit beriet er den Bundestag und die Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz. 2010 erhielt er den Preis für Wissenschaftspublizistik der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. 2011 erschien sein Buch Nerd Attack!, das in die Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen wurde. Stöcker lebt in Hamburg.
Christian Stöcker
Die Große Beschleunigung
Klimawandel, Digitalisierung, Wirtschaftswachstum – wie wir uns in einer sich exponentiell verändernden Welt behaupten können
Pantheon
Die Originalausgabe erschien 2020
unter dem Titel Das Experiment sind wir
im Karl Blessing Verlag, München.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Christian Stöcker
Copyright © 2022 by Pantheon Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2020 der Originalausgabe by Karl Blessing Verlag, München
Grafik Vor- u. Nachsatz: Angaben: Steffen, W., W. Broadgate, L. Deutsch,
O. Gaffney, C. Ludwig. 2015. The trajectory of the Anthropocene:
The great acceleration. The Anthropocene Review.
Karte [>>] u. Design: Félix Pharand-Deschênes/Globaïa
Umschlaggestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31303-6V001
www.pantheon-verlag.de
Für Anna, Clara und Lisa
INHALT
VORWORT
1 DASEXPERIMENTSINDWIR
Exkurs: Was ist ein Experiment?
2 ERWACHENDEGÖTTER
Exkurs: Go auf einen Blick
Exkurs: Wie funktionieren neuronale Netze?
3 DIEZWEIKULTUREN
4 WASWOLLEN, WASSOLLTENWIRWISSEN?
5 MOORE’S LAWISTEINELAHMEENTE
Exkurs: Was ist Digitalisierung?
Exkurs: Was ist Information?
6 DNADATENDNA
Exkurs: Was ist DNA?
Exkurs: Was ist CRISPR/Cas9?
7 EINGEHIRN, ZWEISYSTEME
Exkurs: Was ist eine Skinner-Box?
Exkurs: Kognitive Verzerrungen
8 WASLERNENDEMASCHINENSCHONJETZTMITUNSMACHEN
Exkurs: Wie legt man sich Resilienz gegen digitale Ablenkung zu?
Exkurs: Was ist Relevanz?
Exkurs: Was sind Influencer?
9 DIENEUEDATENWISSENSCHAFT
10 DIENEUEDATENHERRSCHAFT
11 WASWIRDEMPLANETEN (UNDUNSSELBST) ANTUN (NICHTERSTSEITGESTERN)
Exkurs: Was ist das Anthropozän?
Exkurs: Permafrost und andere Kippelemente
Exkurs: Gibt es eine Bevölkerungsexplosion?
12 NURDIEEXPONENTIALFUNKTIONKANNUNSRETTEN
Exkurs: Woher kommt das CO2?
Exkurs: Woher kommt in Zukunft die Energie?
NACHWORT
DANK
ANMERKUNGEN
VORWORT
Dieses Buch handelt von beschleunigten Entwicklungen, und man könnte ja meinen, dass so ein Text schlecht altert. Die erste Ausgabe erschien im Jahr 2020 unter dem Titel Das Experiment sind wir, mitten in der Corona-Pandemie. Seitdem ist, wie es das Buch prognostiziert, eine Menge passiert. Manches davon war nicht vorherzusehen – mit einem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Beispiel haben 2020 wohl nur Wenige gerechnet. Anderes war durchaus zu erwarten – und diejenigen, die dieses Buch damals schon gelesen haben, waren von der einen oder anderen Entwicklung vermutlich weit weniger überrascht als andere.
Ständiges Überraschtwerden ist etwas, an das wir alle uns werden gewöhnen müssen. Wir alle leben in einem Zeitalter, in dem ständige Beschleunigung ein zentrales Merkmal sehr vieler, auf den ersten Blick voneinander unabhängiger Entwicklungen ist. Beschleunigung aber erzeugt ab einem bestimmten Punkt Veränderungen, die so schnell passieren, dass sie wie Sprünge wirken. Leben in beschleunigten Zeiten heißt also: leben mit ständigen Überraschungen.
Eine dieser Überraschungen fiel in die Entstehungsphase dieses Buchs: Als das Konzept und die ersten Kapitel entstanden, war noch keine globale Viruspandemie in Sicht. Die Vorstellung, dass mitten in Europa viele Menschen maskiert durch ihren Alltag gehen würden, um die Ausbreitung einer unsichtbaren Bedrohung zu bremsen, erschien abwegig. Der Grund für die Bedrohlichkeit von Covid-19 war, neben der Gefährlichkeit des Virus selbst, sein Tempo, seine Beschleunigung.
Erfolgreiche Viren verbreiten sich, wenn sie nicht aufgehalten werden, in einer befallenen Population exponentiell. Und exponentiell heißt, sehr kurz gefasst: immer schneller. Vor der Pandemie waren Exponentialfunktionen ein Thema für Wissenschaftlerinnen und Wagniskapitalfirmen, nicht für die Hauptnachrichten im Fernsehen und die Bundeskanzlerin.
Exponentialfunktionen sind ein zentrales Thema dieses Buches, aber es geht darin nicht in erster Linie um die rapide Ausbreitung von Covid-19. Die Corona-Pandemie hat das Konzept des exponentiellen Wachstums ins Blickfeld einer weit größeren Anzahl von Menschen als je zuvor gerückt. Wie sehr die Exponentialfunktion mittlerweile aber auch sonst die Geschicke der Menschheit bestimmt, scheint mir noch nicht im öffentlichen Bewusstsein angekommen zu sein.
Eine ganze Reihe von Kennzahlen und Messwerten verändert sich seit vielen Jahrzehnten exponentiell. Das betrifft technologische Entwicklungen genauso wie ökologische, wirtschaftliche ebenso wie gesellschaftliche. Ein Zusammenschluss Tausender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das sogenannte International Geosphere-Biosphere Programme, hat für diesen historisch einmaligen Vorgang den Begriff »Die Große Beschleunigung«1 geprägt.
Diese Große Beschleunigung ist das zentrale Thema dieses Buches. Sie beeinflusst heute das Leben jedes einzelnen Menschen – und auch aller Tiere und Pflanzen – auf diesem Planeten. Sie könnte die Menschheit in den Abgrund reißen oder uns dabei helfen, den Planeten und uns selbst doch noch zu retten vor Klimakatastrophe, Umweltzerstörung und Massenaussterben.
Die Große Beschleunigung ist im Alltag oft kaum erkennbar, weil sie unser Leben zwar atemberaubend schnell verändert, aber eben doch langsamer, als unsere Alltagswahrnehmung das erfassen kann. Gleichzeitig sind in uns allen psychologische Mechanismen am Werk, die die Wahrnehmung dieser Entwicklung dämpfen: Zum Beispiel gewöhnen wir uns an völlig neue Aspekte unseres Lebens, so wie die jetzt allgegenwärtigen Smartphones, so rasch, dass in kurzer Zeit aus dem Blick gerät, wie schnell und nachhaltig die Veränderungen sind, die sie mit sich bringen. Wir leiden an den Anpassungsschwierigkeiten – ständige Ablenkung, mangelnde Smartphone-Etikette, Desinformation, Propaganda, Mobbing, Konformitätsdruck, überhitzte, überhastete Debatten und so weiter – und bringen sie doch nicht mit ihrer eigentlichen Ursache in Verbindung: dem irrwitzigen Veränderungstempo, das uns alle oft genug überfordert. Menschen sind einzigartig anpassungsfähig, aber nicht unbegrenzt schnell.
Gleichzeitig haben wir einen eingebauten Sinn für Nostalgie: Die meisten Menschen verklären die Vergangenheit auf die eine oder andere Weise, ganz automatisch. Das Gefühl, dass früher alles besser war, gehört zu den angeborenen Grundkonstanten der menschlichen Psyche, es schützt uns nämlich im Idealfall vor nachhaltiger Traumatisierung. Das aber macht den konstruktiven Umgang mit einer sich exponentiell verändernden Welt besonders schwierig.
Es gibt Menschen, die das vage Gefühl der unkontrollierbaren Beschleunigung in eine Art apokalyptisches politisches Programm umgedeutet haben: Sogenannte Akzelerationisten glauben daran, dass die Zivilisation demnächst zusammenbrechen wird, ja, sie sehnen diesen Zusammenbruch herbei und wollen ihn sogar vorantreiben. Sie glauben, dass sie und ihresgleichen dabei einen Sieg davontragen werden. Meist ist diese Ideologie mit Menschenverachtung, Rassismus und Gewaltbereitschaft gepaart – zu ihren Anhängern gehörte beispielsweise der rechtsextreme Terrorist, der 2019 im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen erschoss2. Auch der Deutsche, der in Halle im Jahr 2019 eine Synagoge angriff und dann zwei Menschen tötete, glaubte an akzelerationistische Ideen, ebenso wie bewaffnete Bürgerkriegsfans und Neonazis3 in den USA und anderswo.
Um diese Strömungen geht es in diesem Buch aber nicht. Es handelt nicht von Untergangslust und Menschenverachtung. Es ist auch keine apokalyptische Warnung – obwohl es durchaus vieles gibt, wovor dringend und noch weit lauter zu warnen ist.
Das Buch behandelt die Frage, wie wir die Große Beschleunigung so verstehen, lenken und formen können, dass sie die Menschheit nicht nur nicht in den Abgrund führt, sondern möglichst allen Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Es enthält keine Patentrezepte, aber Ansätze, Ideen und Denkrichtungen. Tatsächlich hat die Beschleunigung der vergangenen etwa 70 Jahre vielen Menschen weltweit große Verbesserungen gebracht: eine immer weiter steigende Lebenserwartung, mehr Bildung, weit weniger extreme Armut, dramatisch gesunkene Kindersterblichkeit, bessere medizinische Versorgung. Aber sie hat die Menschheit auch in eine sehr gefährliche Lage gebracht.
Es ist schwierig, da den Überblick zu behalten. Die Große Beschleunigung kann einen schwindelig machen, verwirren, verängstigen, zur Verzweiflung treiben. Sie kann uns aber durchaus auch nützen. Und dieses Buch kann beim Umgang mit dem wachsenden Tempo helfen.
Weil die Große Beschleunigung so viele Aspekte unseres Zusammenlebens und unserer Umwelt gleichzeitig betrifft, geht es in diesem Buch auch um eine auf den ersten Blick womöglich verwirrende Vielfalt von Themen: lernende Maschinen und unsere Vorstellung von Bildung, Biotechnologie und das Weltklima, Suchmaschinen, soziale Netzwerke und Grundlagen der Psychologie, Informationstheorie und Achtsamkeit, Science-Fiction und das jahrtausendealte Brettspiel Go.
Es enthält dazu unter anderem siebzehn Exkurse zu Fragen, die von »Was ist ein Experiment?« über »Wie legt man sich Resilienz gegen digitale Ablenkung zu?« bis hin zu »Woher kommt in Zukunft die Energie?« reichen. Es ist damit auch eine Art Nachschlagewerk für Zukunftsthemen. Die Antworten auf diese Fragen sind im Jahr 2023 und darüber hinaus unverändert aktuell. Eilige Leserinnen und Leser, die das Gefühl haben, über einzelne Themen schon gut informiert zu sein, können diese Exkurse jederzeit überspringen. Der übrige Text funktioniert im Zweifelsfall auch ohne diese erklärenden Abschnitte. Dennoch sind sie ein zentrales Element des Buches: Allgemeinbildung für die neue Zeit, in der wir jetzt schon leben. All die vielen Themen hängen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, durchaus zusammen. Spätestens beim Lesen des Nachworts werden hoffentlich auch Sie dieses Gefühl haben.
Kapitel zwei zum Beispiel wird Ihnen ermöglichen, die mittlerweile im Alltag angekommene rapide Verbesserung lernender Maschinen wie ChatGPT zu verstehen, die oft als »künstliche Intelligenz« bezeichnet werden. Das Kapitel erklärt die Grundlagen und die jüngere Geschichte dieser Technologie, die unser aller Alltagsleben in den kommenden Jahren massiv beeinflussen wird. Kapitel acht, neun und zehn helfen dabei, die umfassenden Auswirkungen zu verstehen und zu beurteilen, die diese Technologie schon jetzt hat – aber auch die Gefahren, die mit ihr verbunden sind.
Wenn Sie Kapitel sechs gelesen haben, werden Sie verstehen, wie es gelingen konnte, in so kurzer Zeit Covid-19-Impfstoffe mit einer bis dahin nie genutzten Impfstofftechnologie herzustellen. Die Antwort hat mit der Verzahnung von maschinellem Lernen und Biotechnologie zu tun, und mit der Verwandtschaft von DNA und digitalen Daten.
Kapitel sieben und elf werden Ihnen ein neues Verständnis dafür eröffnen, was wir psychologisch heute schon über uns selbst wissen – und inwiefern das einerseits mit Desinformation im Internet, andererseits mit unserem Umgang mit Klimakrise und Artensterben zusammenhängt.
Kapitel zwölf schließlich enthält eine Hoffnung machende, auf Daten, Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Botschaft: Wir haben sowohl das Potenzial als auch die Möglichkeiten und Werkzeuge, die schlimmsten Auswirkungen menschlichen Fehlverhaltens noch rechtzeitig zu korrigieren. Das Kapitel wird ihnen außerdem verständlich machen, worüber nicht nur Fachleute mittlerweile erbittert streiten: Welche Veränderungen unsere Wirtschaftssysteme brauchen, um uns nicht allesamt in den Abgrund zu reißen. Kapitel zwölf gibt auch eine Antwort auf die Frage, warum der pauschal benutzte Begriff »Wachstum« heute eher irreführend ist.
In diesem letzten Kapitel geht es darüber hinaus um den schon 2020 exponentiellen Ausbau erneuerbarer Energien in China. Im Jahr 2022 hat die Regierung von Joe Biden in den USA ein Gesetzespaket verabschiedet, das auch dort zu einem rasanten Ausbau von Wind- und Solarenergie, Speichertechnologie und Elektromobilität führen wird, Europa wird zweifellos nachziehen. Einige der positiven, wünschenswerten Exponentialfunktionen, um die es in diesem Buch auch geht, nehmen gerade Fahrt auf – zum Glück.
Die Beschleunigung wird weitergehen. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, sind Sie dafür besser gerüstet.
Christian Stöcker, Hamburg, im Februar 2023
1 DAS EXPERIMENT SIND WIR
»Die größte Schwäche der Menschheit ist ihre Unfähigkeit, die Exponentialfunktion zu verstehen.«
Der Physiker Al Bartlett in The Essential Exponential!
»Bemühen wir uns nicht, in die Zukunft zu spähen, um die dort lauernden Gefahren zu erkennen, so dass wir unseren Kurs ändern können, um sie zu umschiffen?«
Elizabeth Kolbert, Das sechste Sterben
Lassen Sie sich bitte auf folgendes gedankliche Experiment ein: Zwei Personen gehen jeweils 30 Schritte. Die erste macht normale Schritte, eins plus eins plus eins plus eins, und ist anschließend 30 Schritte weit weg. Die zweite hat Supersiebenmeilenstiefel an und macht exponentielle Schritte: Jeder Schritt ist doppelt so lang wie der vorangegangene. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 und so weiter.
Wie weit kommt die zweite Person in 30 Schritten? Schätzen Sie mal, schnell, ohne Nachdenken oder Hilfsmittel.
Die richtige Antwort lautet: Person zwei hat nach 30 Schritten nasse Füße, denn sie hat den Erdball fast 30 Mal umrundet.
Wir Menschen, das haben Sie gerade selbst erlebt, sind sensationell schlecht darin, exponentielle Entwicklungen kognitiv zu erfassen. Wir können das einfach nicht. Wir haben uns Werkzeuge gebaut – zuallererst natürlich die Mathematik –, um damit umzugehen, dass es Exponentialfunktionen wirklich gibt.
Wir haben grafische Darstellungen entwickelt, die das Verrückte, Explosive dieser Art von Funktion in ordentliche, scheinbar übersichtliche Diagramme pressen: Die Kurve wird nach rechts immer steiler, irgendwann sieht sie fast senkrecht aus. Aber was das wirklich bedeutet, geht nicht in unsere Köpfe.
Persönlich, als Sinneseindruck vertraut sind uns exponentielle Entwicklungen vor allem aus Hollywood-Filmen: Explosionen verlaufen nämlich – vorübergehend – exponentiell. Allerdings geht dabei in der Regel etwas kaputt. Im Pandemiejahr 2020 ist die Exponentialfunktion vermutlich mehr Menschen ins Bewusstsein gedrungen als je zuvor, aber auch da zeigte sich wieder: Selbst Regierungen, die es besser wissen sollten, gut beraten von Epidemiologen, deren Beruf die Beschäftigung mit Exponentialfunktionen ist, scheiterten zunächst. Die exponentielle Ausbreitung des Covid-19-Virus stellte Gesundheitssysteme auf die Probe und illustrierte einmal mehr unsere Unfähigkeit, uns vorzustellen, wie es wirklich aussieht, wenn die Fallzahl von heute sich morgen verdoppelt, übermorgen vervierfacht und noch einen Tag später verachtfacht hat.
Es gibt eine berühmte Geschichte, die diese Unfähigkeit illustriert: die vom Erfinder des Schachspiels, der von einem indischen König zur Belohnung angeblich bescheiden erbat, für jedes weitere Feld auf dem Brett jeweils doppelt so viele Reiskörner zu bekommen. Die Zahl, die dabei auf Feld Nummer 64 herauskommt, hat 21 Stellen. Der nötige Reis hätte damit ein Gesamtgewicht von vielen Billionen Tonnen. Angeblich verlor der oberschlaue Spielerfinder seinen Kopf, als der König das endlich begriffen hatte.
Wir alle sind im Moment ein bisschen wie der König in der Geschichte. Wir stecken mitten in einer exponentiellen Entwicklung, eigentlich sogar einem ganzen Bündel davon, schon seit Jahrzehnten, die wir aber nach wie vor nicht wirklich begreifen. In manchen Bereichen sind wir gerade irgendwo im Knie der Exponentialkurve, in anderen sind wir schon da angekommen, wo die Kurve fast senkrecht aussieht. Wir sind das größte Experiment der Menschheitsgeschichte, allerdings eines ohne Kontrollgruppe: Können acht Milliarden Menschen, die wenig mit Exponentialfunktionen anfangen können, mit einer sich exponentiell verändernden Welt umgehen oder nicht? Zumal wir es eben nicht mit einer, sondern gleich mit mehreren Entwicklungen zu tun haben, die das Leben auf der ganzen Welt zwangsläufig radikal verändern werden. Und wir haben sie alle selbst verursacht. Das gilt in gewisser Weise auch für das Coronavirus.
Exkurs: Was ist ein Experiment?
Ein Experiment ist, im Kern: ausprobieren, was passiert, wenn man etwas verändert. Die größte Schwierigkeit dabei ist, wenn man es richtig machen will, am Ende mit Sicherheit sagen zu können, dass das, was passiert, auch tatsächlich auf das zurückzuführen ist, was man verändert hat. In der Wissenschaft versucht man, diesem Problem mit dem Prinzip der isolierenden Variation zu begegnen: Es wird, unter kontrollierten Bedingungen, genau eine Sache verändert, alles andere hält man konstant. Das, was man verändert, wird unabhängige Variable genannt. Das, was man misst, nennt man abhängige Variable. Verändert sich die abhängige Variable, je nachdem, wie die unabhängige Variable aussieht? Wird das Schnitzel wirklich zarter, wenn man es vorher kräftig platt geklopft hat? Dazu muss man ein geklopftes und ein nicht geklopftes Schnitzel parallel und ansonsten völlig gleich zubereiten. Ein echtes Experiment hat man nur dann gemacht, wenn es wirklich möglich ist, die unabhängige Variable selbst aktiv zu verändern. Die Fragestellung »Verdienen ältere Leute mehr als jüngere?« kann man deshalb nicht experimentell beantworten: Das Alter der Probanden lässt sich nicht aktiv variieren. Zwar gibt es einen Zusammenhang zwischen Lebensalter und Durchschnittsverdienst – aber der basiert nicht auf einer Kausalbeziehung, sondern auf einer Korrelation. Ob die Veränderung der einen Variable wirklich die Ursache für die Ausprägung der zweiten, der abhängigen Variable ist, kann man ausschließlich mit einem kontrollierten Experiment klären. Kausale Aussagen darüber, was das Alter, das Geschlecht oder andere nicht aktiv und kontrolliert veränderbare Variablen angeblich für Auswirkungen haben, sind deshalb prinzipiell unzulässig. Solche Variablen korrelieren allenfalls mit anderen. Ältere Menschen verdienen oft mehr als jüngere, aber beileibe nicht immer.
Selbstverständlich kann man kontrollierte Experimente auch mit Menschen durchführen, und das passiert auch schon seit vielen Jahrzehnten in großem Stil. Die gängigste Methode ist die sogenannte randomisierte kontrollierte Studie, im Englischen randomized controlled trial genannt und deshalb meist mit RCT abgekürzt: Versuchspersonen werden zufällig einer von zwei Bedingungen zugeordnet, der Experimental- oder der Kontrollgruppe. Alle anderen möglichen Einflüsse werden kontrolliert. Zumindest sollten sie in beiden Versuchsgruppen jeweils zufällig verteilt sein, sodass sie sich auf den Unterschied zwischen den Gruppen nicht auswirken können. Mit solchen Studien werden zum Beispiel Medikamente auf ihre Wirksamkeit getestet, die Hälfte der Versuchspersonen bekommt dann keinen Wirkstoff, sondern ein Placebo. Aber auch weite Teile des psychologischen Wissens über die Menschheit entstammen solchen kontrollierten Experimenten mit Menschen. Heutzutage werden RCTs oft schlicht A/B-Tests genannt und mit riesigen Versuchspersonengruppen durchgeführt, die vonihrer Teilnahme oft gar nichts wissen, etwa von Internetfirmen wie Google oder Facebook.
Das rasante Wachstum der Gegenwart ist nicht das erste der Geschichte. Noch Anfang 1915 verfügte das britische Militär zum Beispiel über nicht mehr als 250 Flugzeuge. Am Ende des Ersten Weltkrieges hatte die neue Industrie 55 000 Stück hergestellt. Kriege sind schon häufiger gewaltige Beschleuniger technologischer Entwicklungen gewesen.4 Aber auch die Verbreitung des Automobils oder die Ölförderung folgten zeitweilig Exponentialkurven.
Die Spätfolgen dieser Entwicklung nennen wir heute Klimakrise. Das Gleiche gilt für das Wachstum der Weltbevölkerung: Bis zum Beginn der 1960er-Jahre schrumpfte die Anzahl der Jahre, die es dauerte, bis sich die Weltbevölkerung einmal mehr verdoppelt hatte, dramatisch immer weiter. Die Verdoppelung von etwa einer Viertelmilliarde Menschen im Jahr 837 nach Christus auf eine halbe Milliarde dauerte noch fast 700 Jahre, bis 1543. Die Verdoppelung von 2,5 auf 5 Milliarden dauerte nur von 1950 bis 1987, also lediglich 37 Jahre.
Aber das Ende ist in Sicht, auch wenn viele fälschlicherweise heute noch von einer andauernden »Bevölkerungsexplosion« reden. Die Explosion ist schon vorbei. Ganz konkret heißt das: Die Zeitspanne zwischen fünf und zehn Milliarden auf der Erde lebenden Menschen wird wohl wieder länger sein als die 37 Jahre, die die letzte Verdoppelung dauerte. Nach aktuellen Prognosen wird die 10-Milliarden-Marke erst etwas nach dem Jahr 2050 überschritten werden. Das sind dann mehr als 63 Jahre nach der letzten Verdoppelung im Jahr 1987. Grafisch ausgedrückt: Die Wachstumskurve flacht nach rechts jetzt wieder ab, statt weiter immer steiler zu werden.
Das liegt daran, dass die Anzahl der lebenden Menschen zwar weiter wächst, das Wachstum an sich aber zurückgeht. 1963 wuchs die Weltbevölkerung noch um 2,2 Prozent. Solange so eine Wachstumsrate prozentual mindestens konstant bleibt, spricht man von einer exponentiellen Entwicklung. Dazu ist auch gar keine ständige Verdoppelung notwendig, nur ein Zuwachs, der selbst, in absoluten Zahlen, immer größer wird. Zwei Prozent von 2,5 Milliarden sind 50 Millionen, zwei Prozent von fünf Milliarden aber eben schon 100 Millionen. Deshalb reicht ein konstantes prozentuales Wachstum für eine exponentielle Entwicklung. Der Zuwachs an sich wächst, in absoluten Zahlen, immer weiter.
Seit den frühen Sechzigern hat sich die Wachstumsrate der Weltbevölkerung aber halbiert. Die Bevölkerung wächst nun also nicht mehr exponentiell. Trotzdem: Wir durchleben immer noch die Spätfolgen des Wachstumssprints zwischen dem Beginn des 18. und dem Ende des 20. Jahrhunderts. Und die Weltbevölkerung wächst weiter, wenn auch langsamer.
Eine zweite exponentielle Veränderung, die unsere Welt spürbar umkrempelt, ist die technologische Entwicklung. Die Digitalisierung, sprich: Moores Gesetz – auch wenn es sich im Moment seinem physikalischen Ende zu nähern scheint –, verändert unseren Alltag schneller als jede vorangegangene Technologie einschließlich der Dampfmaschine und des Flugzeugs.
Parallel dazu verändern wir mit unseren CO2- und Methanemissionen, mit der dadurch verursachten Aufheizung der Atmosphäre und der Ozeane das gesamte Erdsystem. Noch immer steigen die CO2-Emissionen, die wir vor allem durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe erzeugen, exponentiell an. Um genau zu sein: Selbst wenn man die CO2-Wachstumskurve auf einer logarithmischen Skala darstellt, erscheint die so geglättete Kurve immer noch nach oben verbogen.5 Trotz aller Klimaabkommen.
Die globale Durchschnittstemperatur steigt glücklicherweise wenigstens nicht exponentiell, sondern nur linear. Was daran liegt, dass CO2 mit anwachsender Konzentration in der Atmosphäre gewissermaßen immer schwächer als Treibhausgas wirkt. Das ist aber absolut kein Grund zur Entwarnung: Die Auswirkungen dieser Veränderungen werden, wenn wir diese Entwicklung nicht aufhalten, extrem gravierend sein: Sie werden die Lebensmittelversorgung gefährden, ganze Regionen unbewohnbar machen und Küstengebiete in Inselgruppen verwandeln. Tropische Krankheiten werden sich in ehemals gemäßigten Zonen ausbreiten, Ökosysteme kollabieren, Korallenriffe absterben. Das Artensterben, längst in vollem Gange, wird sich weiter beschleunigen. Wenn bestimmte Punkte überschritten werden sollten, besteht die reale Möglichkeit, dass die Veränderungen so schnell passieren, dass die globale menschliche Zivilisation dem nicht mehr gewachsen ist.
Diese drei Entwicklungen – also die der Weltbevölkerung, die der Durchschnittstemperatur des Erdsystems und die von digitaler Hardware – werden das 21. Jahrhundert entscheidend prägen. Drei weitere Entwicklungen werden derzeit noch unterschätzte Rollen spielen: die Entwicklung maschinellen Lernens, die von Biotechnologie und Bioinformatik und die erwähnte Ausrottung von Tausenden von Tier- und Pflanzenarten, die Fachleute schon jetzt das »sechste Massenaussterben« in der Erdgeschichte nennen. Tatsächlich gibt es noch Dutzende weitere Indikatoren, die bestimmte Details dieser Entwicklungen abbilden oder mit ihnen zusammenhängen und die alle zeitweilig oder nach wie vor exponentiellen Entwicklungen folgen. Wissenschaftler, die solche Indikatoren beobachten, sprechen deshalb von der Großen Beschleunigung.
Die siebte Veränderungsmacht, die mit all den genannten Entwicklungen eng verbunden ist, ist das weltweite Wirtschaftswachstum. Insbesondere ab Mitte der Fünfzigerjahre des 20. Jahrhunderts hat sich die wirtschaftliche Lage von Menschen fast überall auf der Welt dramatisch verbessert, auch das wieder in überwiegend exponentiellem Tempo. Auch hier gilt: Ein konstantes prozentuales Wachstum ergibt eine exponentielle Entwicklung. Die Wirtschaft der USA beispielsweise wuchs, zweier Weltkriege, der großen Depression und diversen Wirtschaftskrisen zum Trotz, über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg im Durchschnitt um zwei Prozent pro Jahr.6 Mal etwas mehr, mal etwas weniger, aber im Schnitt immer um die zwei Prozent. Seit der Jahrtausendwende scheint sich das Wachstum der USA und anderer weit entwickelter Volkswirtschaften allerdings zu verlangsamen.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der meisten Länder und Regionen auf dem Planeten ist in den letzten Jahrzehnten in der Regel jedenfalls gewachsen, mancherorts schneller, anderswo, etwa in vielen afrikanischen Ländern, etwas langsamer. Dieses rasante Wirtschaftswachstum hat sehr viele Menschen aus extremer Armut befreit. Die globale durchschnittliche Lebenserwartung ist erstaunlich schnell gestiegen, die Kindersterblichkeit gesunken, basale Bildung wie etwa Lesefähigkeit ist auch in Regionen auf dem Vormarsch, in denen man sie nicht vermuten würde. Die Exponentialkurve hat der Menschheit viel Gutes beschert – und uns gleichzeitig an den Rand einer globalen Katastrophe befördert.
Digitalisierung, maschinelles Lernen und Biotechnologie, Klimakrise und Artensterben, Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum: Gemeinsam werden diese sieben Veränderungsmächte dafür sorgen, dass das Leben auf der Erde schon in wenigen Jahrzehnten ein völlig anderes sein wird. Es ist an uns zu gestalten, wie es dann aussehen wird.
Kann eine Menschheit, die schon mit einer einzelnen exponentiellen Entwicklung überfordert scheint, mit dieser transformativen Wucht umgehen? Wo wird die Menschheit, die dann vermutlich zwischen neun und elf Milliarden zählen wird, im Jahr 2100 stehen? Wird es uns gelingen, die mächtigen technologischen Entwicklungen, die sich parallel zur Zerstörung unseres Lebensraums vollziehen, so einzusetzen, dass sie uns retten und das Erdsystem in einem für Menschen lebenswerten Zustand erhalten? Oder machen wir unseren Planeten für uns selbst weitgehend unbewohnbar?
Schaffen wir es, uns an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen? Oder manövrieren wir uns, all unseren erstaunlichen Leistungen zum Trotz, in den Untergang hinein?
Das Experiment sind wir. Nur scheinen wir das noch nicht so richtig verstanden zu haben. Der erste Schritt ist deshalb: sich dieses Verständnis endlich zu verschaffen. Die Mittel und Werkzeuge dazu haben wir allemal. Nur ist der Abstand zwischen Erkenntnis und Umsetzung in politisches und individuelles Handeln, in Strukturen und Institutionen manchmal noch deutlich zu groß.
Moores Vorhersage
»Die Vorteile der Integration werden eine weite Verbreitung von Elektronik mit sich bringen und diese Wissenschaft in neue Bereiche vordringen lassen. Integrierte Schaltkreise werden solche Wunder wie Heimcomputer hervorbringen, oder zumindest Terminals, die mit einem Zentralcomputer verbunden sind, automatische Steuerung für Automobile und tragbare, persönliche Kommunikationsgeräte.«
Gordon E. Moore, damals Direktor der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Fairchild Semiconductor, in der Fachzeitschrift Electronics (1965)
Das Moore’sche Gesetz, formuliert erstmals im oben zitierten, streckenweise erstaunlich prophetischen Fachartikel aus dem Jahr 1965, lautet in Kurzform in etwa so: Die Komplexität von integrierten Schaltkreisen, also der Basis dessen, was wir heute Computerchips nennen, verdoppelt sich bei gleichbleibendem Preis etwa jedes Jahr. Später wurde das Gesetz angepasst, tatsächlich passiert die Verdoppelung eher alle zwei Jahre. Gordon Moore selbst hatte das Ganze auch gar nicht als »Gesetz« formuliert, er erklärte in dem Artikel lediglich, eine solche Entwicklung zeichne sich derzeit ab und werde wohl für »mindestens zehn Jahre« andauern. Das ist weit über 50 Jahre her.
Die Verdopplerei hat in all den Jahrzehnten nicht aufgehört, noch immer werden Rechner immer schneller, wird Speicherplatz immer billiger, werden noch mehr Schaltkreise auf dieselbe Fläche gequetscht. So kommt es, dass ein Smartphone von der Größe eines Adressbüchleins heute mehrere zehntausend Mal leistungsfähiger ist als die Rechner, die Apollo 11 auf seiner Reise zum Mond dirigierten.
Das mobile Internet hat das Leben auf der Welt wohl schneller verändert als jedes Massenprodukt zuvor. Vergleichen Sie mal die Zeitspanne zwischen der Erfindung des Autos im Jahr 1879 und seiner Allgegenwart im Alltag mit der Einführung des iPhones – das war 2007 – und der Allgegenwart des Smartphones im öffentlichen Raum. Letzteres hat nicht einmal zehn Jahre gedauert, von der Markteinführung von Autos für Konsumenten und der fast vollständigen Marktsättigung bei ungefähr 90 Prozent aller Haushalte vergingen noch fast 75 Jahre.7 All das sind Folgen der ständigen Verdopplerei und anderer Faktoren, die mit ihr in Wechselwirkung treten, dazu gleich. Tatsächlich neigt sich Moores Gesetz mittlerweile seinem Ende zu. Die Ära des exponentiellen Wachstums in diesem Bereich ist vermutlich bald vorbei, zumindest, solange sich bei der Konstruktion von Mikrochips nicht etwas Grundlegendes ändert. Doch jetzt kommt der nächste Exponentialturbo hinzu, und der ist vielleicht sogar noch mächtiger.
Die Gegenwart liefert, jenseits von immer schnelleren Smartphones und Computern, mittlerweile eine Vielzahl von Beispielen für die weiterhin exponentielle Entwicklung, die Digitalisierung und Kapitalismus gemeinsam hervorbringen. Man könnte sagen, der technisch-wissenschaftliche Fortschritt und der globalisierte Kapitalismus sind ungleiche Brüder, die einander nützen, aber nicht dieselben Ziele verfolgen. Beide haben Großes geschaffen und furchtbare Gräuel auf dem Gewissen. Der eine allerdings weit mehr Gräuel als der andere. Gemeinsam sind sie sehr mächtig. Und bislang oft sehr kurzsichtig.
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt sorgt fürs Exponentielle. Und der Markt sorgt für Geld und Strukturen, die nötig sind, um diese Veränderungsmacht in atemberaubendem Tempo in den Alltag hineinwirken zu lassen. Oft schneller, als die Regulierung oder die Bewertung der Folgen nachkommt. »Skalieren« heißt das jetzt.
»Skalieren« im Business-Kontext ist: Dinge bauen, die exponentielles Potential haben, dann mit Geld bewerfen und sehen, ob die Kurve wirklich immer steiler wird. Ein nicht unwesentlicher Anteil der internationalen Finanzbranche setzt permanent Geld auf Exponentialfunktionen. Das hat Konsequenzen. Und zwar so extreme, dass wir, obwohl wir Moores Gesetz doch nun schon seit über 50 Jahren kennen, immer noch davon überrascht werden.
Ein Beispiel. Noch im Jahr 2004 war im SPIEGEL in einem Artikel über selbstfahrende Autos zu lesen: »Millionen hat das Pentagon schon für die Technik ausgegeben. Aber was die Ingenieure von Firmen wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman in fast 15 Jahren Arbeit vorführten, war kläglich: Die Computer-Vehikel krochen so langsam, dass Jogger sie überholen konnten, und waren deshalb kaum kriegstauglicher als die fragilen Mars-Rover.« Über die Teilnehmer am Darpa-Wettbewerb für selbstfahrende Autos in der Mojave-Wüste wird im Tonfall des Respekts vor den Tüftlern, aber auch mit großer Skepsis hinsichtlich ihrer Erfolgsaussichten berichtet. Klar wird aus dem Text jedoch: Das hier hat mit unserer unmittelbaren Zukunft wenig zu tun. Das ist eher ist eine Veranstaltung für weltfremde Tüftler und Fantasten, fernab jeder praktischen Anwendbarkeit.
Vierzehn Jahre später bekam Google/Alphabet als erster Anbieter die Genehmigung, die selbstfahrenden Autos seiner Tochterfirma Waymo ohne menschliche Fahrer als Absicherung in den kalifornischen Straßenverkehr zu schicken.
Die Berliner Autorin Kathrin Passig hat vor Jahren einen grandiosen Aufsatz über die »Standardsituationen der Technologiekritik« geschrieben,8 in dem dieser Blick auf technische Entwicklungen als immer wiederkehrendes Stadium entlarvt wird. Bei der Berichterstattung über selbstfahrende Autos haben wir es bis heute oft mit Situation Nummer sechs zu tun: »Im Prinzip ganz gut, aber nicht gut genug«.
Die Phase »nicht gut genug« ist aber in einem real existierenden exponentiellen Entwicklungsprozess ein menschheitsgeschichtlicher Wimpernschlag. Ich halte es zum Beispiel für sehr wahrscheinlich, dass selbstfahrende Autos eines nicht sehr fernen Tages so gut sein werden, dass man Menschen lieber nicht mehr ans Steuer lässt. Exponentiell besser werden aber auch maschinelle Übersetzungen, Spracherkennung und vieles andere.
Jemand aus dem Jahr 1988 würde, zu uns gebeamt, die Welt von 2018 als Science-Fiction-Welt erleben. Aber selbst das wirklich zu begreifen fällt uns heute schwer, fühlt es sich doch an, als gäbe es Smartphones schon ewig. In der Psychologie nennt man dieses Phänomen hindsight bias, Rückschaufehler.9 Diese kognitive Verzerrung, die in den menschlichen Denkapparat fest eingebaut zu sein scheint, sorgt dafür, dass wir im Rückblick meist das Gefühl haben, wir hätten eine Entwicklung vorhersehen können oder sogar müssen. Ein schönes Beispiel sind Schätzungen über künftige Wahlergebnisse: Lässt man Versuchspersonen vorhersagen, wie viel Prozent der Wählerstimmen einzelne Parteien bei einer bevorstehenden Wahl bekommen werden, und fragt sie dann, Monate später, was sie damals vorhergesagt haben, ändern sie ihre Urteile: Die vermeintlich erinnerten Schätzungen liegen immer näher am tatsächlichen Ergebnis als die Originale.10 Der hindsight bias hat in der Psychologie auch den hübschen Spitznamen »Ich habe es schon immer gewusst«-Effekt.
Es handelt sich aber eben um einen Irrtum: Wir bilden uns nur ein, wir hätten es damals besser gewusst. Und was passiert in den nächsten 30 Jahren?
Das Dumme ist, dass all die exponentiellen technischen Entwicklungen neben viel Geld (und für manche viel Reichtum) diverse schwer vorhersagbare Nebenwirkungen produzieren. Globale Erwärmung, Löcher in der Ozonschicht, sauren Regen. Riesige Abfallinseln im Ozean, Bodenerosion, verseuchtes Grundwasser. Artensterben, an Land, im Wasser und in der Luft. Oder auch Möglichkeiten, Demokratien zu manipulieren. Auch von den jüngsten unter den Exponentialfürsten hört man im Moment deshalb auffallend häufig die Ausrede: »Die Maschine war’s!«
Wer hätte ahnen können, dass Suchmaschinen oder Videoplattformen versehentlich Biotope für Rechtsextremisten und Islamisten schaffen würden? Wer hätte gedacht, dass Algorithmen Menschen diskriminieren würden?
Auch wenn Moore’s Law sich möglicherweise seinem vorläufigen Ende zuneigt: Die Exponentialfunktion hat uns weiter fest im Griff. Wir, die wir in dieser menschheitsgeschichtlich einmaligen Versuchsanordnung leben, täten gut daran, uns endlich eine Strategie für den Umgang damit zu überlegen.
Was aber ist dieser zweite digitaltechnologische Exponentialturbo, der das Moore’sche Gesetz schon jetzt ziemlich alt aussehen lässt? Am besten lässt sich das wiederum mithilfe eines Brettspiels illustrieren, das Tausende von Jahren alt ist. Diesmal aber geht es nicht um Schach, sondern um Go.