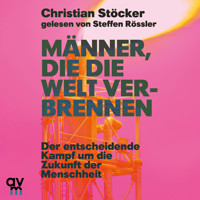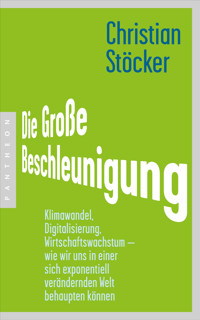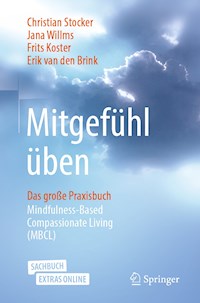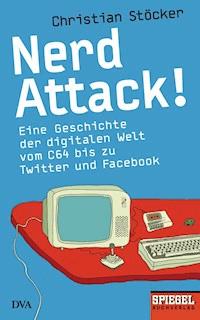
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Reise zu den Schauplätzen der digitalen Revolution
Die Revolution begann in Kinderzimmern: Mit dem C64, dem ersten millionenfach verbreiteten Heimcomputer, eroberten sich Kinder und Jugendliche in den achtziger Jahren die digitale Welt und trieben die Entwicklung mit voran, als Hacker, Cracker, Nerds, Bastler und neugierige User. Christian Stöcker, Ressortleiter Netzwelt bei SPIEGEL ONLINE und mit dem Computer aufgewachsen, beschreibt in seiner persönlich gefärbten Geschichte der Netzkultur die Akteure der digitalen Szene und ihr Selbstverständnis, die Einflüsse von Film und fantastischer Literatur, die Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft und Wirtschaft sowie die Auseinandersetzungen über den viel beschworenen digitalen Graben hinweg. Sein Buch ist nicht nur ein unterhaltsamer Streifzug durch die digitalen Welten, sondern auch ein Appell, die Möglichkeiten zu nutzen, die digitale Medien und Technologien bieten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Für Dinny
Vorwort
Im Sommer 2011 scheint das Internet endgültig seine historische Bedeutung beweisen zu wollen, und sei es mit schierer Nachrichtenpräsenz. Die Despoten in Tunesien und Ägypten sind verjagt, in Libyen tobt ein Krieg zwischen Regierung und Rebellen. Die Regime in Syrien und im Jemen wackeln. All das nahm seinen Anfang, als sich am 17. Dezember 2010 ein junger Tunesier namens Mohammed Bouazizi in seinem Heimatort Sidi Bouzid öffentlich selbst verbrannte, um gegen Ungerechtigkeit und Perspektivlosigkeit in seinem Land zu protestieren. Die Protestbewegung, die daraufhin entstand und sich nicht zuletzt über Facebook und Twitter sammelte, hat mittlerweile weite Teile der arabischen Welt erfasst. Auch in Spanien und der Türkei gehen Zehntausende junge Menschen auf die Straße, aus anderen Gründen, aber in expliziter Solidarität mit der arabischen Jugend. Viele von ihnen tragen seltsame weiße Masken und bekennen sich zu einer gesichtsund führerlosen Gruppierung namens »Anonymous«.
Anderswo entwenden Hacker aus dem Spielkonsolen-Netzwerk des japanischen Konzerns Sony etwa 100 Millionen Datensätze mit Namen, Adressen, Altersangaben und womöglich Kreditkartendaten der Nutzer. Cyber-Guerilleros mit merkwürdigen Namen wie LulzSec machen durch Einbrüche in Firmennetze, aber auch durch direkte Angriffe auf FBI, CIA, den US-Senat und andere Ziele von sich reden.
Westliche Unternehmen und Sicherheitsbehörden sind alarmiert, nicht nur durch die Aktionen solcher Spaß-Hacker. Professionelle Angreifer nutzen Sicherheitslücken in Firmenrechnern aus, verschaffen sich mit den Mitteln des digitalen Trickbetrugs Passwörter oder andere Zugangsmöglichkeiten zu eigentlich strengstens gesicherten Daten. Zu den Opfern gehören Berater aus dem Umfeld von US-Präsident Barack Obama ebenso wie das Rüstungsunternehmen Lockheed-Martin und mehrere Giganten der Öl- und Gasbranche. Die deutsche Bundesregierung reagiert, indem sie ein »Cyber-Abwehrzentrum« gründet, besetzt mit vorerst zehn Beamten.
Seit Jahren verändert das Netz die private und die öffentliche Kommunikation, Mobiltelefone machen es zum selbstverständlichen Alltagsaccessoire. Unterhaltung, Information, Kommunikation, Protest und Propaganda: Alles hat neue Regeln, wird schneller, unübersichtlicher, unberechenbarer. Nerds, die Pioniere der Digitalisierung, sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, beeinflussen längst nicht mehr nur Technologie, sondern Kultur, gesellschaftliches Zusammenleben, Weltanschauungen. Zugleich hat sich für viele Ältere ein Graben aufgetan.
Wo setzt der Bruch ein? Woher stammen die Zutaten der Netzkultur? Warum sind Raubkopien scheinbar untrennbar mit der digitalen Welt verbunden? Was haben die Commodore-Kids der achtziger Jahre mit Napster, iTunes und den Nöten der Filmindustrie zu tun? Mit den Netzanarchisten von heute? Was verbindet den KGB-Hacker Karl Koch, der 1989 starb, mit dem WikiLeaks-Gründer Julian Assange? Noch immer wird das Internet ebenso wie der Diskurs darüber massiv von den USA dominiert, während sich deutsche Politiker auch 2011 noch unendlich schwer damit tun – warum dieses Gefälle?
»Nerd-Attack!« ist eine Reise zu den Schauplätzen der digitalen Revolution, zu Bastlern und Programmierern, die die Welt verändert haben, zu Hackern und Crackern, einfachen Usern und politisch ambitionierten Piraten. Es handelt nicht in erster Linie von technologischen Entwicklungen, sondern von ihren gesellschaftlichen und kulturellen Folgen, von unstillbarer Neugier und unaufhörlichem Wandel. Angefangen hat all das für viele Menschen – auch für mich – mit dem C64, der in Millionen Kinderzimmern eine Tür öffnete. Einen Zugang zur digitalen Welt.
Kapitel 1
Computer und Kalte Krieger
Back in the Ronald Reagan daysWhen we put satellites in spaceWhen boys wore skinny leather ties,Like Don Johnson from Miami Vice
When Eminem was just a snackAnd Michael Jackson’s skin was blackBack when the coolest thing in store,Was a Commodore 64 . . .*
»Back to the 80s« von der dänischen Popband Aqua
Wer hätte damals gedacht, dass die frühen Achtziger im Rückblick betrachtet wie eine heile Welt erscheinen würden? Der Globus schien ständig am Abgrund entlangzukullern, und der nukleare Holocaust wurde zum beliebten Gegenstand popkultureller Betrachtungen. Popsongs reflektierten die unmittelbar bevorstehende ökologische Katastrophe.
Wer einen Teil seiner Kindheit in dieser Zeit verbracht hat, wuchs in dem Bewusstsein auf, dass das Ende jederzeit kommen konnte. Und dennoch, oder gerade deswegen, war die Welt nie wieder so einfach wie damals.
* Damals zur Zeit von Ronald Reagan als wir Satelliten ins All schossen als Jungs schmale Lederschlipse trugen wie Don Johnson in Miami Vice
Als Eminem (M&M) nur ein Snack war als Michael Jacksons Haut noch schwarz war als das Coolste überhaupt ein Commodore 64 war
Die Sowjets hatten mit ihren Panzern Afghanistan besetzt, das wussten auch wir Kinder, aus der Tagesschau. Der Westen hatte so viel Mitleid mit den unterdrückten muslimischen Traditionalisten im Land, dass er sie nach und nach mit Geld und Unterstützung zu der schlagkräftigen Terrorgruppe machte, die im dritten Jahrtausend den Ersatz für die Bedrohung aus dem kommunistischen Block abgeben würde. Das wussten wir natürlich noch nicht, nicht einmal die Erwachsenen begriffen das. Ein weltumspannender Konflikt auf einmal reicht ja auch.
Es waren genügend Atomsprengköpfe vorhanden dies- und jenseits des Atlantiks, um den ganzen Planeten in eine verseuchte Wüste zu verwandeln, durchwandert von vom Krebs zerfressenen lebenden Toten, den letzten Resten der Menschheit. Das wussten wir aus »The Day After«.
Dass diese Arsenale jederzeit abgefeuert werden könnten, von einem durchgedrehten Zentralcomputer etwa, das wussten wir aus »War Games«.
Und wenn uns der atomare Holocaust erspart bleiben sollte, steuerten wir in jedem Fall auf eine Zukunft zu, in der die Flüsse vergiftet, die Wälder tot, die Luft verpestet und die Meere mit einem Ölteppich bedeckt sein würden. Das wussten wir von den Grünen.
Die frühen Achtziger waren eine Zeit, in der die Apokalypse eine permanente, reale Möglichkeit war. Gleichzeitig und paradoxerweise herrschte damals die unbedingte Überzeugung, wenigstens in den Kinderzimmern der westdeutschen Mittelschicht, dass der Fortschritt nicht aufzuhalten sein würde. Dass auch wir eines Tages all das Spielzeug aus den James-Bond-Filmen würden benutzen können (abgesehen von Maschinengewehren unter der Stoßstange vielleicht), dass es irgendwann, vermutlich in unserer Lebenszeit, fliegende Autos geben würde, Laserpistolen, Raumschiffe, die fernste Planeten ansteuern. Und, auch wenn dieser Gedanke so niemals ausformuliert wurde: dass Computer unser aller Leben verändern würden. Und sei es nur, indem sie uns einen ständigen, kostenlosen Strom immer besserer, immer ausgefeilterer Spiele bescherten. Von all den Versprechungen, die uns über die Zukunft immerfort gemacht wurden, waren Computer die einzigen, die es tatsächlich in unsere Kinderzimmer schafften.
Sie schufen Möglichkeiten, die es bislang nicht gegeben hatte – einschließlich derer, mit rudimentären Programmierkenntnissen, die man am Heimcomputer erworben hatte, beinahe einen Atomkrieg auszulösen, wie Matthew Broderick das in »War Games« (1983) getan hatte – und die Welt dann selbstredend in letzter Minute zu retten.
Heimcomputer und ihre auch für Kinder unter 14 wahrnehmbare rapide Entwicklung waren die real vorhandenen, berühr- und benutzbaren Vorboten einer sich immer schneller nähernden, verheißungsvollen Zukunft. Oder, wie es Thomas und Zini aus der Vorabend-Pflichtprogrammserie »Spaß am Dienstag« ausgedrückt hätten: Sie waren ein Vorgucker. Ein Vorgeschmack auf eine Welt, in der all das möglich sein würde, was bis dahin nur in Science-Fiction-Filmen vorkam.
Die Geräte, die uns die Zukunft in die Kinderzimmer bringen sollten, sahen allerdings erst mal so gar nicht nach Science-Fiction aus: braun eingefärbte, geschrumpfte Schreibmaschinen, die an einen herkömmlichen Fernseher angeschlossen wurden und denen jeder Hauch von Futurismus vollständig abging. Von außen betrachtet. Denn futuristisch war, was sie konnten. Mehr als je ein Gerät aus der Sparte Unterhaltungselektronik zuvor nämlich. Musik machen, Bilder zeigen (auch solche pornografischer Natur, wie wir irgendwann lernten), eine Verbindung zur Welt herstellen, bei den Hausaufgaben helfen (was wir gern den Eltern gegenüber hervorhoben, wovon wir jedoch eher selten Gebrauch machten) und vor allem eines: Spiele bereitstellen. Immer wieder neue, immer bessere, komplexere, grafisch aufwändigere, spannende, herausfordernde, clevere, brutale, elegante, Gemeinschaft bildende Spiele. Und zwar in der Regel kostenlos.
Die Vorstellung, dass ein einzelnes Gerät scheinbar unendliche Möglichkeiten eröffnet, hat das Bewusstsein dieser Generation geprägt – auch wenn das vielen ihrer Mitglieder kaum klar sein dürfte. Der Commodore 64, der erfolgreichste Computer aller Zeiten, der sich allein in Deutschland drei Millionen Mal verkaufte, weltweit vermutlich zehnmal so oft, leitete in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen eine Veränderung ein, die bis heute nachwirkt – und diese Generation von allen vorangegangenen unterscheidet.
Der C64 und das um ihn herum wuchernde Ökosystem installierten in unseren Köpfen ein Gefühl von nahezu unbegrenzter Machbarkeit, der Kalte Krieg, die drohende Umweltkatastrophe eines von nahezu absoluter Ohnmacht. Vieles von dem, was den heute 30- bis 40-Jährigen von den Älteren vorgeworfen wird – politische Apathie, ein Mangel an gesellschaftspolitischen Visionen, eine laxe Einstellung zum Urheberrecht und nicht zuletzt die Bereitschaft, sich technologischen Wandel ohne Rücksicht auf Geschäftsmodelle, gesellschaftliche Konventionen oder rechtliche Fragen zunutze zu machen – sind mittelbare oder unmittelbare Folgen dieser paradoxen Kombination aus Ohnmacht und grenzenlosen Möglichkeiten.
Die Generation C64 ist die erste, die nicht mit einem oder zwei fundamentalen technologischen Fortschritten zurechtkommen musste. Sie lebt seit ihrer Kindheit in einer Welt, zu der permanenter, sich unentwegt beschleunigender technischer Wandel in einem nie gekannten Ausmaß gehört. Diese Generation erlebte schon in jungen Jahren nicht nur die Einführung des Farbfernsehens, des Videorekorders, der CD und des Computers, sondern auch den Siegeszug des Handys und den des Internets. Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben sich in so schneller Abfolge so viele so tief greifende technische Veränderungen ereignet, die unmittelbar den Alltag jedes Einzelnen betreffen. Nicht alle können dieses Tempo mitgehen.
Unsere digitale Gegenwart begann 1982, als der Commodore 64 seinen Weg in deutsche Kinderzimmer antrat. Die meisten Deutschen unter vierzig leben in ihr. Die meisten derer, die hierzulande bis heute politische oder ökonomische Entscheidungen treffen, gesellschaftliche Diskurse dominieren, sind in dieser Gegenwart bis heute Zaungäste. Es geht eine Kluft durch dieses Land – und wenn es uns nicht gelingt, sie zu schließen oder wenigstens zu überbrücken, wird das nicht nur für das gesellschaftliche Zusammenleben, sondern auch für unsere ökonomische Zukunft gefährliche Folgen haben. Dieses Buch handelt von dieser ersten Generation, die in einer digital geprägten Welt aufwuchs, meiner Generation, von denen, die danach kamen – und von ihrem bis heute schwierigem Verhältnis zu denen, die in einer anderen, einer vergangenen Epoche erwachsen geworden sind.
Kalter Kinderzimmerkrieg
Natürlich lebte man als Kind in der ersten Hälfte der Achtziger trotz drohender nuklearer und ökologischer Apokalypse nicht in ständiger Angst. Schon allein deshalb, weil das gar nicht durchzustehen gewesen wäre. Und weil unsere Eltern, in Zusammenarbeit mit Unterhaltungs- und Spielzeugindustrie viel unternahmen, um die bedrohliche Realität ein bisschen zu relativieren. Aber die Vorstellung, »Wetten, dass ..?«, »Star Trek«, Playmobil und Carrera-Rennbahnen hätten all das so weit aus unserem Bewusstsein verdrängt, dass es keine Rolle spielte, ist absurd. Und leicht zu widerlegen.
Als ich meine Eltern Anfang 1980, mit sieben oder acht Jahren, fragte, was das Wort »Boykott« bedeute, das damals ständig in den Nachrichten vorkam, erklärten sie mir, dass das große Russland das kleine, wehrlose Afghanistan einfach so besetzt habe und dass nun darüber gestritten werde, ob man an den Olympischen Sommerspielen in Russlands Hauptstadt Moskau teilnehmen oder aus Protest fernbleiben solle. Das verstand ich sofort. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das intensive Gefühl, politisch aktiv werden zu müssen.
Dass die Russen böse waren und uns irgendwie bedrohten, dass sie die Leute in ihrem Land einsperrten und eine Mauer durch Deutschland gebaut hatten, das hatte man uns schon erklärt. Aber dass ein so großes Land ein kleines einfach überfiel, war viel leichter zu verstehen und zu verdammen. Als habe ein Schulhofschläger, den man schon die ganze Zeit argwöhnisch beobachtet hatte, einen kleinen Brillenträger, wie man selbst einer war, attackiert. Zur Geburtstagsfeier von so einem wäre man nicht hingegangen, auch wenn man eingeladen worden wäre.
Es scheint mir ein enormes Anliegen gewesen zu sein, meinem Abscheu über den Einmarsch in Afghanistan öffentlich Ausdruck zu verleihen. Ich nahm die Papprückseite eines karierten Schulblocks, malte darauf mit Buntstiften einen Soldaten mit grüner Uniform und rotem Hammer-und-Sichel-Signet auf dem Helm und strich den Soldaten mit rotem Buntstift durch. Dann versah ich den Pappdeckel mit einem Slogan und stellte ihn, nach außen zeigend, zwischen den inneren und äußeren Flügel unseres Kinderzimmerfensters. Jeder, der auf dem Bürgersteig vor unserer Hochparterrewohnung vorbeiging, konnte nun lesen: »Russen nein – Boykott ja!«
Der Kalte Krieg besaß eine ständige, unterschwellige Präsenz in dieser Zeit. Er war aber für uns Mittelschichtkinder stets eingebettet in ein familiäres Gefühl der Sicherheit. Abends, auf dem Sofa im Wohnzimmer, wenn der Kalte Krieg wieder einmal die für uns so langweiligen Nachrichten dominierte, saß Papa vor dem Grundig-Fernseher in Holzimitatoptik, aß belegte Brote und trank Bier. Meistens erschien der Ost-West-Konflikt ohnehin in Form von Unterhaltung. Er spielte eine Rolle in Filmen mit John Wayne oder James Bond, die am Samstagabend nach 23.00 Uhr im Fernsehen liefen und die wir manchmal mit ansehen durften. Er hatte Gastauftritte in den Vorabendfernsehserien, die wir auf keinen Fall verpassten: »Ein Colt für alle Fälle« oder »Trio mit vier Fäusten«. Und er wurde gespielt.
Die Kinder, die zu dieser Zeit noch Spielzeugpanzer und Plastiksoldaten besitzen durften, die mit den weniger politisch korrekten Eltern, ließen im Sandkasten, am Strand und am Bach natürlich gute Amerikaner gegen böse Russen antreten. Die Helden in den Filmen, die wir nicht sehen durften, kämpften auch immer gegen die Kommunisten. Rambo zum Beispiel oder Chuck Norris. Männer, die auf den Filmplakaten riesige Waffen in den Händen hielten, die wir auch unbedingt haben wollten.
Am intensivsten aber wurde der Kalte Krieg in den Kinderzimmern jener Tage am Computer nachgespielt. Der Commodore 64 war neben vielen anderen Dingen eines der erfolgreichsten Propagandavehikel seiner Zeit.
Die Elf-, Zwölf-, Dreizehnjährigen, die mit ihm spielten, besorgten sich ihre Propagandamittel sogar selbst, in der Regel auf illegalem Weg. Auch, aber nicht nur, weil viele der plumpsten, brutalsten und deshalb beliebtesten antirussischen Spiele in Deutschland auf dem Index standen: »Raid over Moscow«, »Beach Head«, »Green Beret«. Wir hatten sie alle. Jeder von uns. Der Jugendschutz stand damals vor einem ähnlichen Dilemma wie heute: Wie soll man in einer Umgebung, in der Spiele ohnehin vor allem auf illegalem Weg verbreitet werden, für die Durchsetzung von Altersfreigaben sorgen? Der C64 und die Raubkopie gingen sehr früh eine unheilige Symbiose miteinander ein, die sich allerdings letztlich als immens fruchtbar erweisen sollte. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die verlustfreie, kinderleicht anzufertigende Digitalkopie zum Motor einer neuen Entwicklung und gleichzeitig zur fundamentalen Bedrohung für eine ganze Branche. Ganz ohne Internet.
Im Kleinraumbüro
Ich bekam meinen Commodore 64, kurz C64, zu meinem elften Geburtstag, am 1. Februar 1984. Er erhielt einen Ehrenplatz in der Ecke zwischen einem von oben bis unten mit Werbeaufklebern verzierten Buchenkleiderschrank und der Gasheizung auf unserem alten Kinderzimmertisch mit seiner zerkratzten und bemalten Kiefernholzplatte. Meine Computerecke sah aus wie eine knallbunte Kinderzimmerversion eines jener Cubicles, in denen moderne Großraumbüroarbeiter ihre Arbeitstage verbringen. Über dem Fernseher hing ein selbst gemaltes Bild vom Räuber Hotzenplotz mit sieben Messern und einer Pistole im Gürtel.
Den Fernseher, das wichtigste Zubehör für meine neue Errungenschaft, hatten meine beiden Schwestern und ich gemeinsam zu Weihnachten bekommen. Ohne den Fernseher ging es nicht. Der C64 wurde mit einem normalen TV-Antennenkabel daran angeschlossen. Einen speziellen Computermonitor brauchte man nicht, was ein echter Vorteil war: TV-Geräte waren in den frühen Achtzigern in der Regel Farbfernseher, während Computermonitore weiße, orangefarbene oder grüne Schrift auf schwarzem Untergrund boten. Gut zum Arbeiten, gar nicht gut zum Spielen. Zumal der C64 stolze 16 Farben darstellen konnte.
Vermutlich war der dringliche Wunsch nach einem eigenen Fernseher an den langen Sonntagnachmittagen entstanden, wenn im ZDF Kinderserien liefen, unser Vater aber das in unseren Augen langweiligste und quälendste Fernsehprogramm von allen sehen wollte: seltsame Autos mit nur einem Sitzplatz, die mit monotonem Heulen stundenlang im Kreis herumfuhren. Nach konzertiertem Quengeln wurde unser Wunsch irgendwann erfüllt, wir bekamen ein kleines Gerät mit acht Programmwahltasten im silbergrauen Gehäuse.
Ich kann mich aus meiner Kindheit nur noch an drei Dinge erinnern, die ich außer dem Fernseher unbedingt besitzen wollte: ein ferngesteuertes Auto, ein BMX-Rad und einen Commodore 64. Das Einzige, was ich mir im Rückblick nicht mehr richtig erklären kann, ist der Wunsch nach dem Computer. Wie gerade dieses Gerät die Sehnsucht einer ganzen Generation von Jungs – seltener Mädchen – beflügelte, ist ein Rätsel, das mancher Vermarkter bestimmt noch heute gern lösen möchte. Die Sehnsucht all jener Jungs in der westlichen Welt (ein paar 64er schafften es in den Achtzigern auch in den Ostblock, aber nicht sehr viele) machte den C64 jedenfalls zum bis heute meistverkauften Computer der Geschichte. Rein rechnerisch stand im Jahr 1994, dem letzten, in dem der C64 noch hergestellt wurde, in mehr als jedem zehnten deutschen Haushalt einer. De facto dürfte die Dichte in Westdeutschland ungleich höher, in den damals tatsächlich noch neuen Bundesländern im Osten dafür ungleich niedriger gewesen sein – obwohl Ramschverkäufe bei Aldi und anderen Discountern Anfang der Neunziger sicherstellten, dass auch die Kinder der ehemaligen DDR noch einen C64 bekommen konnten, wenn sie wollten. Karstadt verkaufte eine »Terminater 2 Edition«, samt Joystick, Laufwerk, Spiel zum Film und Bild von Arnold Schwarzenegger auf dem Karton für 600 D-Mark. Und die »Action Box« von Quelle warb mehr oder minder explizit mit den Möglichkeiten, sich durch Raubkopien schnell eine Spielesammlung zuzulegen. Neben dem Laufwerk und ein paar Spielen lagen ihr zehn Leerdisketten bei – und ein abschließbarer Diskettenkasten mit Platz für hundert Stück.
Der C64 war ein hässliches bräunliches Gerät mit noch brauneren Tasten, von manchen halb zärtlich, halb spöttisch »Brotkasten« genannt. Beim Einschalten begrüßte es einen mit einem in zwei unterschiedlichen Blautönen gehaltenen Bildschirm – hellblau der Rahmen, dunkelblau das Bearbeitungsfeld – und der Überschrift **** Commodore 64 BASIC V2 **** 64 K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE. Darunter folgte ein erwartungsvoll oder, je nach Betrachtungsweise, stoisch und indifferent blinkender Cursor. Dazwischen die Verheißung »READY«. Der Startbildschirm des 64ers war eine Tabula rasa, ein leeres Spielfeld, das befüllt, beackert, bezwungen werden wollte.
Ich kann mich nicht erinnern, dass einer meiner Freunde zu dieser Zeit schon einen Computer besessen hätte. Selbst die Schmitts, ein Brüderpaar, das immer alles hatte, was wir anderen unbedingt haben wollten – Bonanza-Räder, Silvesterknaller mitten im Jahr, einen Hobbyraum mit Tischtennisplatte –, besaßen keinen C64. Das Gerät kostete bei seiner Markteinführung in Deutschland fast 1500 D-Mark, das Diskettenlaufwerk VC 1541, schlicht »Floppy« genannt, weil es mit biegsamen Disketten, Floppy Discs, gefüttert wurde, noch einmal 850 D-Mark. Das war weit jenseits der Budgets für ein übliches Weihnachts-oder Geburtstagsgeschenk. Die Preise fielen jedoch rapide. Es gehörte in der Schule zum guten Ton zu wissen, was der »64er« aktuell kostete.
Der Rechner besaß eine so große Anziehungskraft, dass Kinder und Jugendliche in Kaufhäuser und Elektronikfachgeschäfte pilgerten, um dort damit zu spielen. Gegenüber dem Zuhause der Schmitt-Brüder zum Beispiel gab es einen Elektromarkt, in dem auch ein 64er samt Floppy stand, der an einen Fernseher angeschlossen war. Die beiden Brüder hatten sich eigens einen Joystick zugelegt und machten sich mit Disketten voller raubkopierter Spiele regelmäßig auf den Weg über die Straße, um in dem wochentags meist schlecht besuchten Laden stundenlang zu spielen, vom Verkaufspersonal unbehelligt.
Ich erinnere mich an Nachmittage auf dem Teppichboden des Ladens, umgeben von Röhrenfernsehern, Kühlschränken und Waschmaschinen, in ungeduldiger Erwartung des Zeitpunkts, da ich auch einmal den Joystick in die Hand nehmen und eine Runde spielen durfte.
Unsere Ausflüge in den Elektromarkt waren nichts Außergewöhnliches. Ein Bekannter, der heute in leitender Position für einen deutschen Zeitschriftenverlag arbeitet, erinnert sich, zahllose Nachmittage im örtlichen Quelle-Kaufhaus verbracht zu haben, um dort, unter den Augen des Personals, Raubkopien zu machen, eine nach der anderen. Weil die Kinder, die sich damals an den Geräten zu schaffen machten, längst viel versierter waren als jeder Fachverkäufer, war es für sie kein Problem, von einer mitgebrachten Diskette ein Kopierprogramm in den Speicher des Rechners zu laden und dann vom Kopierschutz befreite, »gecrackte« Spielversionen von einer Diskette auf die andere zu kopieren. Dazu mussten Vorlage und Leerdiskette immer wieder abwechselnd ins Laufwerk geschoben werden, außerdem ratterte und brummte die 1541 deutlich hörbar. Die Verkäufer begriffen aber entweder nicht, was da vor sich ging – oder es war ihnen egal.
Ersteres ist wahrscheinlicher, denn die illegale Subkultur der Cracker und Kopierer, die sich innerhalb kürzester Zeit im Umfeld des C64 entwickelte, fand fast vollständig unter Ausschluss einer erwachsenen Öffentlichkeit statt. Weder Eltern noch Verkäufer konnten sich wirklich vorstellen, was diese elf-oder dreizehnjährigen Jungs da tatsächlich anstellten – und dass sie dabei manchmal an einem einzigen Nachmittag Spiele im Verkaufswert von mehreren 100 D-Mark kopierten.
Als ich endlich meinen eigenen 64er hatte – der Preis war zu diesem Zeitpunkt schon drastisch gefallen –, war es selbstverständlich vorbei mit den Pilgerzügen in den Elektromarkt. Die Ecke zwischen Schrank und Heizung wurde zu meinem neuen Lieblingsplatz, zu einem Ort, an dem ich ständig Gäste empfing und endlose Nachmittage verbrachte. Wer einen 64er zu Hause hatte, konnte sicher sein, regelmäßig Besuch zu bekommen.
Ich hatte meinen Eltern offenbar davon überzeugen können, dass ein eigener Computer immens wichtig für meine weitere Entwicklung sein würde. Eine Argumentation, die bis heute verfängt: In Deutschland ist der PC vermutlich nicht zuletzt deshalb eine so beliebte Spieleplattform, weil man Mama und Papa glaubhaft versichern kann, dass man einen Computer für die Hausaufgaben benötigt. Bei einer Spielkonsole zieht dieses Argument nicht – ein Atari-Telespiel hätten mir meine Eltern damals nicht geschenkt.
Bei Commodore setzte man diese Argumentationslinie explizit als Teil des Marketings ein. Der Ingenieur Bob Yannes, der für den C64 den bis heute legendären Musikchip SID entwickelte, erinnert sich: »Ein Teil des Marketingprogramms von Commodore war, ›wollen Sie Ihrem Kind wirklich ein Computerspiel kaufen, das sein Hirn verkümmern lassen wird, oder einen Computer, mit dem man eben auch Videospiele spielen kann?‹ Das war eine erfolgreiche Kampagne.«
Ich hatte meine Eltern offensichtlich auch davon überzeugt, dass dieser Computer nur dann wirklich sinnvoll eingesetzt werden konnte, wenn man dazu ein Diskettenlaufwerk besaß. Damit hatte ich mich gewissermaßen aus dem Stand in die Oberliga der 64er-Besitzer katapultiert. Tatsächlich wäre der Rechner ohne irgendeine Art von externem Speicher so gut wie nutzlos gewesen: Der Arbeitsspeicher leerte sich zwangsläufig vollständig, wenn man den Rechner ausschaltete. Programmieren oder irgendeine andere sinnvolle Beschäftigung wäre ohne zusätzliche Speichermöglichkeit eine immer wieder neu zu beginnende Sisyphus-Arbeit gewesen. Das leuchtete auch meinen Eltern ein.
Die Alternative zur Floppy 1541 wäre eine sogenannte Datasette gewesen, im Prinzip nichts anderes als ein herkömmlicher Kassettenrekorder, der auf normale Audiokassetten Daten statt Töne aufzeichnen konnte. Die Datasette zeichnete sich einerseits dadurch aus, dass sie deutlich billiger war als das Diskettenlaufwerk, und andererseits dadurch, dass sie mit majestätischer Langsamkeit arbeitete. Hatte man die entsprechenden Befehle eingegeben, um ein Programm in den 64 Kilobyte kleinen Arbeitsspeicher des C64 zu laden, erschien auf dem Bildschirm die Anweisung »press play on tape« – Deutsch konnte der Commodore 64 nicht. Heute kann man T-Shirts, Umhängetaschen und Jacken mit dieser Aufschrift kaufen, und es gibt eine dänische Rockband, die »Press Play On Tape« heißt. Sie spielt ausschließlich Soundtrack-Stücke aus Spielen für den C64 nach. Die musikalischen Qualitäten des Rechners sicherten ihm eine weltweite, bis heute höchst aktive Fangemeinde.
Nachdem man die Play-Taste gedrückt hatte, konnte man sich eine Fanta aus dem Kühlschrank holen, ein bisschen plaudern oder sich sonst irgendwie die Zeit vertreiben, denn das Laden eines Spiels konnte viele Minuten dauern, obwohl der 64-Kilobyte-Arbeisspeicher gerade einmal dieselbe Datenmenge fassen konnte, die heute ein kurzes Dokument aus einem Standard-Textverarbeitungsprogramm in Anspruch nimmt.
Mit der Floppy 1541 ging das Laden deutlich flotter vonstatten – zumal es nach einer Weile sogenannte Schnellladeprogramme gab, die den Vorgang erheblich verkürzten. Ein gut organisierter C64-Besitzer hielt auf jeder Diskette mit raubkopierten Spielen einen Schnelllader vor. Der wurde dann in den Speicher gepackt, bevor man das eigentliche Spiel aufrief.
Die Datasette hatte einen Vorteil, den die 1541 nicht bieten konnte. Weil die Daten auf den Magnetbändern nichts anderes waren als Klänge, konnte man sich Software anhören – was allerdings kein großes Vergnügen war. In Töne gegossene Software klingt in etwa so wie Modems in den neunziger Jahren: eine Kombination aus Fiepen, Rauschen und Rattern, wie eine Mischung aus zu schnell gespielter Zwölftonmusik und Schrottpresse. Umgekehrt war es jedoch auch möglich, ein leeres Band mit Tönen zu bespielen, die der Computer dann wiederum als Software erkannte. So kam es, dass das deutsche Fernsehen einige Jahre lang Computerprogramme ausstrahlte: Im legendären WDR Computerclub gab es am Ende der Sendung Bilder vom sich leerenden Studio und dazu Fiep- und Pfeifgeräusche zum Mitschneiden – in jeder Sendung wurde die akustische Version simpler Programme ausgestrahlt, die man zu Hause, Mikrofon am Fernsehlautsprecher, aufzeichnen konnte, um damit dann den eigenen Computer zu füttern.
Diese Möglichkeit, an Programme zu kommen, die auch heute noch wie Science-Fiction anmutet, ging damals völlig an mir vorbei. Den WDR Computerclub habe ich nie gesehen (bis auf ein paar Ausschnitte, die man sich heute bei YouTube ansehen kann). Ich lebte in Nordbayern, und da gab es in den Achtzigern nur das dritte Programm des Bayerischen Fernsehens.
Dafür hatte ich von Anfang an das Werkzeug zur Verfügung, das den C64 bis zum Ende seiner Produktkarriere im Jahr 1994 begleiten sollte. Ein Diskettenlaufwerk mit eigenem, eingebautem Computer. Ein mächtiges Werkzeug, das eine Subkultur hervorbrachte, deren Ausläufer bis heute spürbar sind: Die Raubkopiererszene der achtziger Jahre ist einerseits die Blaupause für all das, was heute nicht nur der Spiele-, sondern in viel größerem Maß der Musik- und Filmbranche Kopfzerbrechen und schmerzliche Einbußen bereitet. Mit der 1541 und dem C64 zog die verlustfreie Digitalkopie in deutsche Kinderzimmer ein, das Gefühl, mit geringem Aufwand umsonst an modernste, aktuellste Produkte einer internationalen High-techbranche herankommen zu können.
Andererseits bildeten die Cracker und Kopierer auch die Keimzelle einer bis heute einflussreichen und immer noch höchst aktiven Computerkunstbewegung: die sogenannte Demoscene, die in winzigen Dateien riesige computeranimierte Kunstwerke versteckt, deren Programmier- und Gestaltungskünste bis heute auch internationalen Branchengrößen uneingeschränkte Bewunderung abringen.
Kapitel 2
Kopierer und Künstler
Am 10. Januar 1984 verkündete Commodore bei der Consumer Electronics Show in Las Vegas Rekordergebnisse. Das Unternehmen hatte im Vorjahr drei Millionen Computer verkauft und über eine Milliarde Dollar umgesetzt. Der Marktanteil des C64 allein war fast dreimal so groß wie der des Apple II. Drei Tage später gab es im Konzernvorstand Krach. Noch vor dem Ende der Sitzung verließ Jack Tramiel, Gründer, Chefcholeriker und Gallionsfigur des Unternehmens, den Raum und kehrte nie zurück. Der Vater des erfolgreichsten Heimcomputers aller Zeiten wurde aus seinem eigenen Unternehmen geworfen. Zwölf Jahre später lief in den USA die große TV-Dokumentation »Triumph of the Nerds« über die Geschichte der PC-Industrie. Darin werden die Apple-Gründer Steve Jobs und Steve Wozniak als Erfinder und Gründer der gesamten Branche dargestellt. Commodore und Tramiel werden nicht einmal erwähnt.
Das erste Spiel, das mir mein C64 bescherte, war »Frogger«. Es war auf einer dem Floppy-Laufwerk zur Demonstration beiligenden Diskette zu finden. Es verlangte, einen aus grünen Pixelklötzchen zusammengesetzten Frosch zuerst einen Fluss und dann eine stark befahrene Straße überqueren zu lassen, ohne dass er versank oder platt gewalzt wurde. Das machte zwar eine Zeitlang Spaß – dann aber musste Nachschub her. Meine Eltern um Spiele für den eben erst für vergleichsweise viel Geld angeschafften Computer zu bitten, wäre keine gute Idee gewesen. Mir war jedoch ohnehin klar, dass es andere, effektivere Wege gab, sich neue Software zu beschaffen. Ich war im Begriff, auf die Produkte einer neuen, internationalen Szene zuzugreifen, die unfassbar produktiv und einfallsreich war, sich im Hinblick auf Urheberrechte völlig rücksichtslos verhielt und zum überwiegenden Teil aus Teenagern bestand.
Die Idee des Kopierschutzes war zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung. Sie entstand erst in den späten siebziger Jahren, als die Beschäftigung mit Rechnern von einer Aktivität für Ingenieure und Wissenschaftler nach und nach zu einem Hobby für einen größeren Kreis wurde. Die frühen Computerenthusiasten, die in den USA damals meist »Hobbyisten«, seltener auch schon »Hacker« genannt wurden, fanden den Gedanken zunächst vollkommen abwegig, dass jemand für Software überhaupt Geld verlangen könnte. Dafür gab es auch keine Tradition: Die Großrechner der Sechziger und Siebziger wurden von den Herstellern wie DEC und IBM mit Software bestückt und gewartet, bezahlt wurde allein für die Hardware.
Weil sie das Programmieren als eine sportliche Herausforderung betrachteten, tauschten die ersten Hacker, die Programme für Großrechner in Universitäten und dann für die allerersten Heimcomputer wie den Altair 8800, den ersten Apple-Computer oder Commodores PET schrieben, ihre Werke gern und bereitwillig untereinander aus. Es ging schließlich um das Lösen von Problemen und darum, andere an den eigenen Leistungen teilhaben zu lassen und Anerkennung zu erlangen. Diese Haltung existiert bis heute, sie ist die Grundlage der Open-Source-Szene, der die Menschheit Entwicklungen wie das freie Betriebssystem Linux, den kostenlosen Webbrowser Firefox und eine Vielzahl anderer Software-Entwicklungen verdankt. Im weiteren Sinne liegt das Credo der Open-Source-Gemeinde auch dem vielleicht Eindrucksvollsten zugrunde, was das Internet bis heute hervorgebracht hat: der Online-Enzyklopädie Wikipedia.
Im Februar 1976 stellte ein gewisser William Henry Gates III. den freien Austausch der Programmierideen erstmals vehement infrage. Gemeinsam mit Paul Allen hatte der junge Bill Gates ein Unternehmen gegründet und es Micro-Soft (sic) genannt. Eines der ersten Produkte der Zweimannfirma war eine Weiterentwicklung der Programmiersprache BASIC für den Baukastenrechner Altair 8800, den ersten kommerziell erhältlichen Heimcomputer überhaupt. Die beiden wollten an ihrer Schöpfung Geld verdienen, mussten aber feststellen, dass das deutlich schwieriger war, als sie angenommen hatten. Und das, obwohl das Gates-BASIC durchaus eine Menge Anwender fand: Die Software wurde von den »Hobbyisten« jener Tage, die vielfach Kinder der Hippiebewegung waren, schlicht kopiert statt gekauft. Ironischerweise trugen Gates und Allen mit ihrer Basic-Version auch zum späteren Siegeszug der Firma Commodore bei: In den späten Siebzigern erwarb der als in geschäftlichen Dingen gnadenlos berüchtigte Commodore-Chef Jack Tramiel von den beiden eine Dauerlizenz zur Nutzung der Programmiersprache in den Computern seines Hauses – dem Sachbuchautor Brian Bagnall zufolge für eine einmalige Zahlung von 10 000 Dollar. Bis weit in die achtziger Jahre hinein belastete dieser Spottpreis für eine Software, die schließlich in Dutzenden Millionen Computern zum Einsatz kam, die Beziehungen zwischen Commodore und Microsoft nachhaltig.
In besagtem Jahr 1976 also schrieb Gates einen heute legendären offenen Brief an die Zeitschrift »Computer Notes« und den »Homebrew Computer Club«, die damals wichtigste und größte Vereinigung von Rechnerenthusiasten in den USA. Mit der Laissez-faire-Einstellung der frühen Hacker ging Gates darin hart ins Gericht: Wer sich kostenlose Kopien verschaffe, »verhindert, dass gute Software geschrieben wird«, schrieb Gates. »Um es klar zu sagen, was ihr tut, ist Diebstahl.«
Der Ausbruch des Jungunternehmers, der später mit dem Verkauf von Software dann doch noch zum reichsten Mann der Welt werden sollte, markiert den Beginn einer Auseinandersetzung, die bis in die Gegenwart hinein andauert. Die gleiche Debatte wird heute aber nicht nur über Programme geführt, sondern über jede denkbare Art von Inhalt. Weil auch Filme, Musik, Fernsehserien, Hörspiele und Bücher heute in digitaler Form vorliegen, lassen sie sich ebenso einfach und perfekt kopieren wie Software schon damals. Gates’ zentrales Argument – wenn niemand bezahlt, können die Schöpfer nicht überleben – wird heute auch von Musikern und der Filmindustrie ins Feld geführt. Nicht immer mit Erfolg.
In den frühen achtziger Jahren war Kopierschutz noch ein Thema, das sich auf sehr teure Programme etwa für den Einsatz in Unternehmen beschränkte. Die ersten Computerspiele waren frei kopierbar. »Wenn jemand ein Spiel auf Floppy Disc oder Kassette gekauft hatte, kopierte er es für seine Freunde wie eine normale Audiokassette«, heißt es in »Freax«, einem Buch über die Geschichte dieser Szene. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die Kopien für den Computer waren digital, und damit im Idealfall verlustfrei, perfekt.
Schnell begann die Branche, Mechanismen zu entwickeln, die das verhindern sollten. Der Begriff Cracker (von »to crack«, knacken) entstand zu Beginn der Achtziger, um jemanden zu bezeichnen, der so gut mit Computern umgehen konnte, dass er auch Software kopieren konnte, die nicht zum Kopieren freigegeben war.
Es begann ein dauerhafter Kleinkrieg zwischen Crackern und den Kopierschutzentwicklern der Software-Branche. Die Fachzeitschrift »64’er« sprach in einem Artikel im September 1986 von einem »ewigen Wettlauf«: »Sie laufen schon um die Wette, seit es Heimcomputer gibt, und werden wohl auch bis in alle Zeiten weiterlaufen: die Kopierer und die Kopierschützer. « Die einen entwickelten immer komplexere Schutzmechanismen, die anderen wurden immer besser darin, diese zu umgehen. Im Rückblick ist der 64’er-Artikel prophetisch: Tatsächlich dauert der Wettlauf zwischen den Kopierschützern und den Kopierschutzbrechern bis heute an – nur hat sich die Rennbahn enorm vergrößert. Auch DVDs, CDs, Musikdateien und digitale Bücher sind nun meist mit einem aufwändigen Kopierschutz versehen. Sogar Fernsehsendungen werden inzwischen zum Teil verschlüsselt ausgestrahlt, so dass sie sich nicht digital aufzeichnen lassen. Aber auch das gilt noch: Jeder Kopierschutzmechanismus wird irgendwann geknackt.
Die Spielebranche hatte den »ewigen Wettlauf« bereits damals verloren – auch wenn die Geschichte mancher Branchenriesen von heute in jener Zeit ihren Anfang nahm, all die Raubkopien also durchaus nicht jedes Unternehmen zum Untergang verurteilten, das Computerspiele herstellte. Electronic Arts (EA), heute zweitgrößter Spielehersteller der Welt mit einem Jahresumsatz von knapp 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2008, stellte auch schon Spiele für den Commodore 64 her, ebenso wie Activision, heute der Gigant der Branche, das größte Videospiel-Unternehmen der Welt (Konzernumsatz 2008: rund 2,2 Milliarden Euro), zu dessen Produkt-Portfolio etwa das mit 12 Millionen zahlenden Abonnenten weltgrößte Online-Rollenspiel »World of Warcraft« gehört. Yves Guillemot, mit seinem Unternehmen Ubisoft (Jahresumsatz 2008: gut 1 Milliarde Euro) selbst seit den Achtzigern in der Branche aktiv und heute auf Platz drei der größten Spielehersteller hinter Activision und EA, sagte mir in einem Interview im Jahr 2010: »Es ist ein ständiger Kampf, und es hat Zeiten gegeben, in denen wir nicht so gut waren wie die Leute, die unsere Spiele raubkopieren, und andere Zeiten, in denen wir besser waren. Es ist ein guter Kampf.«
Kopien anzufertigen und dabei keinen Gedanken an mögliche Urheberrechtsverletzungen zu veschwenden war in meiner Kindheit nicht ungewöhnlich. Alle kopierten schließlich Audiokassetten und übertrugen Vinyl-Schallplatten auf Band. In der Regel war das legal, weil das Urheberrecht ein Recht auf Privatkopie ausdrücklich vorsieht. Das von Hand beschriftete Tape war die kleinste Einheit der meisten Musiksammlungen in meinem Freundeskreis. Ich selbst besaß noch in den Neunzigern Hunderte von Audiokassetten, die Freunde mir von Platten, später auch von CDs überspielt hatten. Das individuell zusammengestellte Mixtape wurde zum Ausdruck persönlicher Vorlieben, zur vermeintlich subtilen romantischen Botschaft und schließlich zum Klischee.
Das Überspielen war allerdings immer mit einem Qualitätsverlust verbunden, denn man hatte es mit analogen Medien zu tun. Außerdem war die Klangqualität einer Audiokassette von vornherein der einer Platte oder CD unterlegen. Die Bässe auf Band waren nie ganz so satt, der Stereosound nie ganz so glasklar wie der des Originals. Uns Teenager störte das nicht sonderlich, schließlich bekam man auf diese Weise komplette Alben zum Preis einer Leerkassette.
Die Musikbranche hatte das Überspielen auf Kassette schon in den Siebzigern als Bedrohung für ihre zu dieser Zeit astronomischen Gewinnspannen identifiziert. Der britische Branchenverband der Phonoindustrie rief 1980 daher eine Kampagne namens »Home Taping is Killing Music« (Heimaufnahmen töten die Musik) ins Leben. Das Logo der Kampagne war eine stilisierte Audiokassette mit zwei gekreuzten Knochen darunter, im Stil einer Piratenflagge, und dem Zusatz »and it’s illegal« (und es ist illegal). Die britische Rechtslage war eine andere als die in der Bundesrepublik. Die Warnung wurde auf Plattenhüllen und Plakate gedruckt, hatte aber keinen merklichen Effekt. Der Slogan sorgte allenfalls für Heiterkeit, und noch immer kann man T-Shirts mit der Jolly-Roger-Kassette als ironisch-nostalgischem Motiv kaufen.
Leerkassetten waren in jedem Supermarkt und jeder Drogerie erhältlich so wie jetzt CD- und DVD-Rohlinge. Natürlich wusste man bei BASF, TDK, Maxell und Co., was mit all den Bändern geschah. Seit 1965 bereits bezahlten Hersteller, Händler und Importeure die sogenannte Geräte- und Leermedienabgabe, und ein Teil der Verkaufserlöse wurde an Verwertungsgesellschaften wie die GEMA weitergereicht. Heute werden diese Abgaben auch für DVD- und CD-Rohlinge erhoben, jeder Brenner, jeder Computer und jedes Kopiergerät wird damit belegt.
Wer jedoch eine Band wirklich liebte, der wollte das Original besitzen, wegen der Hülle, den »Liner Notes«, des Covers – und weil Originale einfach besser klangen.
Kopien von Computerdisketten dagegen waren, wenn nichts schiefging, immer so gut wie die Vorlage, manchmal sogar besser. Eine schadhafte Kopie lief in der Regel gar nicht oder verursachte im Spielverlauf Macken, die einem den Spaß an der Sache verdarben, die Software im schlimmsten Fall unbenutzbar machten. Ein gutes Kopierprogramm gehörte deshalb schnell zur Grundausstattung eines jeden C64-Besitzers. Die Heimcomputer der frühen Achtziger waren die ersten Geräte, die solche verlustfreien Digitalkopien für den Alltagsgebrauch ermöglichten. Der Sprung zum perfekten Duplikat war ein großer Schritt nach vorn für Jugendliche mit wenig Geld – und ein zum damaligen Zeitpunkt weitgehend unbeachtetes Menetekel für viele andere Branchen.
In den Chefetagen der Spiele-, der Musik- und Filmindustrie sitzen heutzutage viele Menschen, die wünschen, der Schritt von analog zu digital wäre nie vollzogen worden. Internettauschbörsen, selbst gebrannte CDs und kostenlose, aber illegale Film-Downloads richten, glaubt man den Zahlen der Branchenverbände, jährlich Milliardenschäden an – trotz der Geräte- und Leermedienabgabe.
Kopieren ist langweilig
Für mich als frischgebackenen Besitzer des C64 war die Frage nicht, ob es in Ordnung war, sich raubkopierte Spiele zu verschaffen, sondern nur, wo ich sie herbekam. Kopierte Spiele hatte ich schon häufig gesehen, ich kannte auch die rätselhaften Cracker-Vorspänne, in denen seltsame Spitznamen und Abkürzungen über den Bildschirm scrollten. Woher die Kopien stammten, war mir nicht klar.
Als Erstes ging ich mit einem Zehnerpack Leerdisketten auf Tour durch meinen Freundeskreis. Irgendjemand kopierte mir ein Kopierprogramm, ein paar Spiele bekam ich von den wenigen Jungs in meinem Bekanntenkreis, die auch schon einen C64 ihr Eigen nannten. Mein Geburtsort Würzburg beherbergt eine Universität, eine Fachhochschule und die Regierung von Unterfranken mit allen zugehörigen Ämtern und Behörden, aber kaum Industrie. Würzburgs Schulen waren deshalb voll mit Akademikerkindern, Arzt-, Lehrer- und Juristensöhnen – ein idealer Heimcomputermarkt. Dennoch dauerte es einige Jahre, bis Rechner in Kinderzimmern wirklich verbreitet waren. Meine ersten und üppigsten Kopierfischzüge machte ich denn auch auf dem Land.
Mein Freund Jan lebte mit seinen Eltern auf einem Dorf, eine halbe Stunde Busfahrt von Würzburg entfernt. Dort wohnte auch ein Junge mit dem Spitznamen Easy, der ein paar Jahre älter war als wir Fünftklässler. Easy, der mein erster und ergiebigster Anschluss an ein weltumspannendes Netz von Computerspielern werden sollte, hat mich damals nachhaltig beeindruckt. Er wohnte im ausgebauten Dachstuhl des Hauses seiner Eltern, in einem großen Zimmer mit braunem Teppichboden, das man nur über eine steile Schiffstreppe erreichen konnte. Easy besaß nicht nur einen C64, eine Floppy 1541 und massenweise Disketten voller Spiele – er konnte auch im Zehnfingersystem blind tippen, weil er auf die Realschule ging und dort Schreibmaschinenkurse angeboten wurden. Das erste Mal, als Jan mich nach Schulschluss und einer endlos langen Busfahrt hinaus aufs Land zu Easy mitnahm, erlebte ich als Ehrfurcht gebietendes Ereignis. Da saß ein schlaksiger, eher schweigsamer Junge mit Stahlgestellbrille und Bauchansatz vor seinem 64er, seine Finger flogen über die Tastatur, und das Diskettenlaufwerk ratterte in einem fort. In den Zimmerecken unter der Dachschräge stapelte sich Exotisches, Faszinierendes: Actionfiguren, Plastikraumschiffe, Brettspiele, ein ferngesteuertes Auto, Science-Fiction- und Fantasy-Romane. An der Wand hing ein Poster, das einen muskelbepackten Donald Duck mit einer Bazooka im Anschlag zeigte, mit der Aufschrift »Rambo Duck«. Easy war schon ein Nerd, bevor das Wort in die deutsche Jugendsprache Eingang fand.
Trotz der Schätze in den Zimmerecken interessierte ich mich fast nur für den braunen Rechner auf der vollgemüllten Spanplatte auf zwei Sägeböcken, die Easy als Schreibtisch diente. Und für die mächtige Diskettenbox, die danebenstand. Wir verbrachten einen langen Nachmittag damit, Spiele ins Laufwerk zu schieben, kurz auszuprobieren und sie danach auf die Liste der zu kopierenden zu setzen oder eben nicht. Dann lauschten wir stundenlang dem Tackern und Stöhnen der 1541. In regelmäßigen Abständen musste der Verschluss des Laufwerks betätigt werden, um Disketten herauszunehmen und andere hineinzuschieben. Eine Diskette für den C64 mithilfe nur eines Laufwerks zu kopieren erforderte es, einen möglichst großen Teil des Inhalts in den 64 Kilobyte kleinen Arbeitsspeicher des Computers zu laden. Weil auf eine Diskette aber etwa 170 Kilobyte an Daten passten, musste der Kopiervorgang auf mehrere Runden verteilt werden. Zum Vergleich: Ein dreißigseitiges Textdokument benötigt im Format eines gängigen Textverarbeitungsprogramms etwa 130 Kilobyte Speicherplatz.
Das ständige Öffnen und Schließen des Laufwerks, das Herausziehen und Einführen von Disketten wurden schnell zu einem geübten, aber auch zunehmend verhassten Handgriff, ebenso wie das elegante einhändige Umdrehen. Die Leerdisketten von Verbatim oder der Luxusmarke »Elephant« waren in der Regel dazu gedacht, einseitig beschrieben zu werden. Man konnte jedoch ihre Kapazität mit einer einfachen Papierschere verdoppeln: Knipste man an der richtigen Stelle im oberen Zehntel des rechten Randes der Plastikhülle, in der sich der eigentliche Datenträger verbarg, ein Loch bestimmter Größe, war die Diskette plötzlich nicht mehr ein-, sondern zweiseitig beschreibbar. Nie wieder in der Geschichte der Computer hat sich Speicherplatz so einfach verdoppeln lassen. C64-Besitzer, die etwas auf sich hielten, besaßen einen eigenen Diskettenlocher, mit dem sich rechteckige Aussparungen von genau der richtigen Größe in die Plastikhüllen stanzen ließen.
Den Nachmittag im Dachzimmer verbrachten Jan und ich zum großen Teil auf dem Teppichboden sitzend, während Easy das Formatieren und Kopieren übernahm. In Wahrheit langweilten wir uns fürchterlich. Gleichzeitig war ich nervös und eingeschüchtert von dem unglaublich cool wirkenden älteren Jungen mit dem lässigen englischen Spitznamen, der so routiniert und selbstverständlich mit Rechner, Laufwerk und Software hantierte. Richtig genießen konnte ich den Raubzug erst, als ich wieder zu Hause in meiner Nische hinter dem Schrank saß und mich nach und nach durch die Schätze arbeiten konnte, die Easy mir einfach so, ohne jede Gegenleistung, überlassen hatte.
Welche Spiele das waren, weiß ich heute nicht mehr. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass »Jumpman Junior« dabei war, aus heutiger Sicht ein echter Klassiker das amerikanischen Software-Hauses Epyx, das später durch »Summer Games« und »Winter Games« weltberühmt wurde. In »Jumpman Junior« musste eine winzige, aus wenigen Pixeln zusammengesetzte Spielfigur vor schwarzem Hintergrund über Leitern und Plattformen gelenkt werden und Pixel-Pillen einsammeln. Gelegentlich schossen von rechts oder links, oben oder unten kleine weiße Projektile durchs Bild. Wenn es dem Spieler nicht gelang, durch Hüpfen oder Rennen auszuweichen, stürzte der Jumpman ab. Der Musik-Chip des C64 spielte dann eine blechern dröhnende Version der ersten Takte von Chopins Trauermarsch. Nach drei Fehlversuchen war Schluss.
Das Spiel war trotz seiner Schlichtheit extrem populär, und zwar sogar innerhalb des Commodore-Konzerns. Brian Bagnall zitiert den C64-Ingenieur Bil (sic) Herd mit den Worten: »Jumpman war wahrscheinlich das dauerhaft populärste Spiel überall in der Entwicklungs- und ich vermute auch einigen anderen Abteilungen.« Später sahen die Spiele besser aus, waren aufwändiger und manchmal auch intelligenter. Aber »Jumpman Junior« machte Spaß – und war kostenlos.
Im Startbildschirm meiner Version des Spiels stand »(C.) BY OLEANDER«. Eigentlich hätte dort »(C.) BY EPYX« stehen müssen, der Copyrightvermerk des Herstellers. Meine Version aber hatte »Oleander« gecrackt und in Umlauf gebracht – und im Programmcode des Spiels den dezenten Hinweis auf sich selbst hinterlassen. »Oleander« war der erste Cracker-Spitzname, den ich je bewusst wahrgenommen habe.
Als Gründungsmitglied der Cracker-Gruppe JEDI 2001 wurde Oleander alias Oliver Eikemeier später zu einer Legende der Szene. Heute arbeitet er als Software-Entwickler und Hochschuldozent. Einen ähnlichen Weg gingen viele der Szenegrößen der Achtziger – die frühe Erfahrung mit dem C64 und anderen Heimcomputern verschaffte ihnen später einen mächtigen Vorsprung innerhalb der gerade entstehenden IT-Branche.
Die uncoole Elite
Die Cracker-Szene rund um den meistverkauften Computer aller Zeiten war die erste internationale Techno-Subkultur, ein komplexes, dezentrales, hocheffizientes System, geformt und unterhalten von weitgehend mittellosen Teenagern. Diese nahmen erstaunlich viel von dem vorweg, was das Internet später in den Mainstream brachte. Sie schufen Begriffe, Kategorien und Zeichensysteme, die noch heute in Gebrauch sind – auch wenn kaum jemand ihren Ursprung kennt. Und sie legten sich nicht mit einer, sondern gleich mit drei mächtigen Branchen an: mit der Computerspielindustrie, den Telefongesellschaften und den Postdienstleistern.
Neben dem Knacken von Kopierschutzmechanismen hatten die Kinderzimmertäter noch eine Reihe anderer illegaler Aktivitäten im Angebot. Sie richteten so große Schäden an, dass in den USA sogar die Bundespolizei FBI hinter ihnen her war. In Deutschland gab es in den späten Achtzigern schon mal Razzien in gepflegten Einfamilienhäusern, weil die dort wohnenden Mittelklasse-Eltern unter ihrem Dach nichtsahnend einen allzu erfolgreichen Cracker oder »Swapper« beherbergten – so nannte man diejenigen, die für das Tauschen und Verbreiten frisch geknackter Spiele per Post zuständig waren.
Wie viele Cracker und Swapper es in Deutschland tatsächlich gab, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Vermutlich waren es nur einige hundert, vielleicht auch ein paar tausend. Von ihrer freiwilligen Arbeit aber profitierten Millionen. Auf nahezu jedem der Millionen von C64 in deutschen Haushalten wurde gespielt. Auf nahezu jedem zumindest gelegentlich eine Schwarzkopie, auf den meisten kaum etwas anderes. Penny Schiffer, heute Chefstrategin bei einem großen Schweizer Unternehmen, programmierte gemeinsam mit ihrem Vater bereits im Alter von elf Jahren Software auf dem C64. Heute erinnert sie sich: »Für unsere Raubkopien hatten wir zwei Diskettenkästen. Die Raubkopien, die wir als besonders teuer einschätzten, Büro-Software etwa, haben wir anderswo versteckt als die übrigen Disketten. Ich glaube nicht, dass wir jemals ein Spiel gekauft haben. Aber ich hätte auch gar nicht gewusst, wo man eigentlich eines kaufen kann.« Sätze wie diesen hört man immer wieder von Menschen, die damals mit dem C64 aufwuchsen. Gerade in ländlicheren Gebieten hätte es tatsächlich gar keine Möglichkeit gegeben, Spiele käuflich zu erwerben. Wie Originale überhaupt aussahen, wusste kaum jemand, echte Cover, Boxen, Anleitungsbücher bekam man so gut wie nie zu Gesicht. Das für die Erwachsenen unsichtbare Vertriebsnetz der Kinder mit ihren immer gleich aussehenden schwarzen Plastikdisketten aber erstreckte sich bis in die hintersten Winkel des Landes. Der Junge, von dem sie ihre Spiele erhielt, habe seine Disketten im Kamin des Elternhauses verborgen, erinnert sich Penny Schiffer. Andere Spielesammler umwickelten ihre Diskettenkästen mit dicken Kupferdrahtspulen, um im Falle eines Falles mit einem Knopfdruck einen mächtigen Elektromagneten einzuschalten, der die sensiblen Disketten und damit alle Beweismittel zerstörte.
Meine Sammlung von schwarz kopierten Spielen umfasst über hundert Disketten, ich besitze sie noch heute. Angetrieben wurden wir Kopierer damals nicht zuletzt von einer intensiven, wachsenden Sammelleidenschaft. So wie man beim Pilzesuchen auch keinen Pfifferling stehen lässt, selbst wenn das Gefundene längst fürs Abendessen reicht, kopierten wir so gut wie jedes Spiel, das auch nur im Entferntesten interessant wirkte. Ein Mechanismus, der mir später im Zusammenhang mit Musiktauschbörsen wieder begegnet ist.
Die meisten meiner alten 5,25-Zoll-Disketten enthalten nicht eines, sondern vier oder fünf Spiele. Ich besaß also Hunderte von Schwarzkopien im Wert von wohl weit über 10 000 D-Mark. Spiele kosteten im Handel in jenen Tagen 40, 50, manchmal auch 150 D-Mark und mehr. Besonders für Importe aus den USA mussten astronomische Summen bezahlt werden.
In meiner gewaltigen Sammlung finden sich nur etwa vier oder fünf Spiele, die ich tatsächlich ordentlich erworben habe, meist weil die Verpackung zusätzliches Material wie Landkarten oder ausführliche Anleitungsbücher enthielt. Ein flaues Gefühl im Magen hatte ich gelegentlich schon, auch weil es immer wieder Gerüchte über Ermittlungen und Razzien bei Spieletauschern gab sowie über ernorme Schadensersatzforderungen der Branche. Im Unrecht aber fühlte ich mich nie – warum viel Geld für Spiele ausgeben, die ich vielleicht nur ein einziges Mal spielte und dann nie wieder?
Nach heute geltendem Recht waren die Cracker-Gruppen organisierte Kriminelle. Das Urheberrecht verbietet inzwischen ausdrücklich das bewusste Aushebeln von technischen Kopierschutzmaßnahmen. In den Achtzigern war die Rechtslage noch weniger eindeutig, und wirklich bedroht fühlte sich kaum einer der Cracker oder der Nutznießer von Cracker-Aktivitäten. Fragt man Teut Weidemann, ein Szenemitglied der ersten Stunde und heute ein gefragter Berater der deutschen Spielebranche, ob er und seine Freunde damals nicht auch ein bisschen Angst hatten, antwortet er: »Nein, wovor denn? Es gab da kein Risiko.«
De facto hatte das, was da geschah, mit organisiertem Verbrechen auch wenig zu tun: Es wurde nämlich kein oder kaum Geld damit verdient. Die meisten Cracker knackten Kopierschutzmechanismen aus rein sportlichen Motiven. »Es gab auch einen Dunstkreis von Leuten, die davon gelebt haben, Software zu verkaufen«, erinnert sich Weidemann, »die haben wir aber eher ein bisschen verachtet.« Ein schwedischer Szeneveteran mit dem Alias »Newscopy« formulierte es 2006 so: »Was diese Gruppen zum Vergnügen aktivitätshungriger Teenager taten, gleicht dem, was [die Internet-Tauschbörse] Napster in den späten Neunzigern für die Musik tat: Sie gaben den Kids unbegrenzten Zugang zu Unterhaltung.«
Mainstream war damals wie heute nur das Kopieren, nicht das Knacken von Kopierschutzmechanismen. Teut Weidemann schätzt, dass »die absolute Spitze der Pyramide, die Leute, die wirklich neue Spiele hatten und in Umlauf brachten, bundesweit maximal 150 bis 200 Leute waren«. Aktiv, wenn auch auf niedrigerem Niveau, waren aber wohl weitaus mehr – allein die heute im Internet zugängliche Szenedatenbank [CSDb] listet weit über 500 deutsche Cracker-Gruppen auf. Sie waren zunächst vor allem regional aktiv, verteilten Raubkopien im eigenen Umfeld. Von dort verbreiteten sich die geknackten Spiele kaskadenartig über informelle Netzwerke auf Schulhöfen,