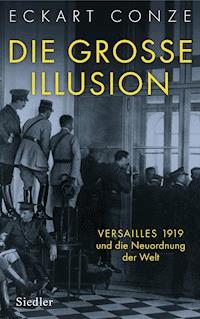
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Frieden, den keiner wollte: Der Versailler Vertrag und seine Folgen
Der Versailler Vertrag hat die Welt geprägt bis heute – alte Reiche versanken, moderne Nationalstaaten erwachten, es entflammten aber auch neue Konflikte, ob auf dem Balkan oder im Nahen Osten. Dabei waren 1919 die Hoffnungen der ganzen Welt darauf gerichtet, dass nach dem Großen Krieg eine stabile Ordnung geschaffen und dauerhafter Friede herrschen würde. Doch wie Eckart Conze in seinem glänzend geschriebenen und minutiös recherchierten Buch zeigt, erwiesen sich alle Hoffnungen als gewaltige Illusion. Denn weder die alliierten Sieger noch das geschlagene Deutschland und die anderen Verlierer waren bereit, wirklich Frieden zu machen. Auf allen Seiten ging auch nach dem Waffenstillstand der Krieg in den Köpfen weiter, mit verheerenden Folgen. Versailles - das war der Frieden, den keiner wollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 918
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Der Frieden, den keiner wollte: Versailles und die Folgen
Versailler Vertrag und Pariser Konferenz haben die Welt geprägt bis heute – alte Reiche versanken, moderne Nationalstaaten erwachten, es entflammten aber auch neue Konflikte, ob auf dem Balkan oder im Nahen Osten. Dabei waren 1919 die Hoffnungen der ganzen Welt darauf gerichtet, dass nach dem Großen Krieg eine stabile Ordnung geschaffen und dauerhafter Friede herrschen würde. Doch wie Eckart Conze in seinem glänzend geschriebenen und minutiös recherchierten Buch zeigt, erwiesen sich alle Hoffnungen als gewaltige Illusion. Denn weder die alliierten Sieger noch das geschlagene Deutschland und die anderen Verlierer waren bereit, wirklich Frieden zu machen. Auf allen Seiten ging auch nach dem Waffenstillstand der Krieg in den Köpfen weiter, mit verheerenden Folgen. Versailles – das war der Frieden, den so keiner wollte.
Zum Autor
Eckart Conze, geboren 1963, ist Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Marburg. Von ihm sind unter anderem erschienen: »Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik von 1949 bis in die Gegenwart« (2009) und »Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik« (mit N. Frei, P. Hayes und M. Zimmermann, 2010).
ECKART CONZE
DIE GROSSE ILLUSION
VERSAILLES 1919
und die Neuordnung der Welt
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Oktober 2018
Copyright © 2018 by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: Unterzeichnung des Friedensvertrages im Spiegelsaal von Versailles, 28. Juni 1919. Offiziere der Alliierten stehen auf Stühlen und Tischen, um in den Spiegelsaal zu schauen, in dem der Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet wird. © Getty Images/Henry Guttmann
Lektorat und Satz: Peter Palm, Berlin
Karten: Peter Palm, Berlin
Reproduktionen: Aigner, Berlin
ISBN 978-3-641-15987-0V003
www.siedler-verlag.de
Inhalt
EinleitungVersailles 1919 – Fragen an einen Frieden
IWEGE AUS DEM GROSSEN KRIEG 1916–1918
Krieg der IllusionenKriegsziele und Friedensinitiativen 1916/17
FRIEDEN NACH TOTALEM KRIEG · »SIEGFRIEDEN« UND »VICTOIRE INTÉGRALE« · »DURCHMARSCHIEREN BIS ZUM SIEG« · »KRIEG, NUR NOCH KRIEG« · »HINDENBURG-FRIEDEN« VERSUS »SCHEIDEMANN-FRIEDEN«
»Safe for Democracy«? Woodrow Wilson und die Vierzehn Punkte
PRÄSIDENT EINER GLOBALEN MACHT · »FRIEDEN OHNE SIEG« · U-BOOT-KRIEG UND KRIEGSEINTRITT · NEUE DIPLOMATIE · VIERZEHN PUNKTE
Ein deutsches DiktatDer Frieden von Brest-Litowsk
NATIONALE SELBSTBESTIMMUNG ALS WAFFE · REVOLUTION IN RUSSLAND · EIN DEUTSCHES OSTIMPERIUM · ENTSCHEIDUNG IM WESTEN
»Schwarze Tage«Deutscher Zusammenbruch und Waffenstillstand 1918
MILITÄRISCHE ERSCHÖPFUNG · WAFFENSTILLSTANDSBEMÜHUNGEN UND REVOLUTION VON OBEN · NOTENWECHSEL MIT WILSON · DIE LANSING-NOTE · COMPIÈGNE · ENDE DES KRIEGES?
IIFRIEDEN SCHLIESSEN 1919/20
Im Traumland der WaffenstillstandsperiodeFriedenserwartungen vor Konferenzbeginn
»VIVE WILSON!« · HOFFNUNG AUF EINEN WILSON-FRIEDEN · FRIEDENSVORBEREITUNGEN · WAHLKÄMPFE UND GESELLSCHAFTLICHE STIMMUNGEN
Paris – Hauptstadt der WeltDie Friedenskonferenz als Ort globaler Politik
MACHTHIERARCHIEN UND KONFERENZORGANISATION · PRÄLIMINARKONFERENZ STATT FRIEDENSKONGRESS · 18. JANUAR 1919, DIE KONFERENZ WIRD ERÖFFNET · DOMINANZ DER GROSSMÄCHTE – PRIMAT DES NORDENS · GLOBALE METROPOLE PARIS
Eine Welt des Friedens?Der Völkerbund und die Kontinuität imperialer Herrschaft
EIN WELTBUND DES FRIEDENS · EMPIRE ALS VÖLKERBUND · FRIEDEN ODER SICHERHEIT? · DIE GEMISCHTE BILANZ DES VÖLKERBUNDS · »A WORLD SAFE FOR EMPIRE« – DIE VÖLKERBUNDSMANDATE · SELBSTBESTIMMUNG VERSUS ZIVILISIERUNGSMISSION · WURZELN DES NAHOSTKONFLIKTS
Frieden mit Deutschland?Die Pariser Verhandlungen und der Vertrag von Versailles
HERAUSFORDERUNGEN UND LESARTEN EINES FRIEDENSSCHLUSSES · TERRITORIALE SICHERHEIT · RUSSLAND UND DAS GESPENST DES BOLSCHEWISMUS · REPARATIONEN UND DIE FRAGE DER KRIEGSSCHULD · FIUME-KRISE UND SHANDONG – MESSEN MIT ZWEIERLEI MASS · EINE FRAGE DER NATIONALEN EHRE: UNTERZEICHNEN IN VERSAILLES? · VERSAILLES, 28. JUNI 1919 · KEIN KARTHAGO-FRIEDEN
Vergeben und vergessen?Die Strafbestimmungen der Friedensverträge
SCHULD UND SÜHNE · DIE LEIPZIGER PROZESSE · »HANG THE KAISER!« · DIE ISTANBULER PROZESSE
Alte Reiche und neue StaatenDie Auflösung des Habsburger und des Osmanischen Reiches
GEWALT UND SELBSTBESTIMMUNG · ÖSTERREICH UND DIE TSCHECHOSLOWAKEI · GEWINNER UND VERLIERER IN SÜDOSTEUROPA · MULTIETHNISCHE STAATEN UND IHRE MINDERHEITEN · »KRANKER MANN AM BOSPORUS« · ALLIIERTE POLITIK UND TÜRKISCHE NATIONALBEWEGUNG · DIE KONFERENZ VON LAUSANNE
IIIVON VERSAILLES ZUM ZWEITEN WELTKRIEG
DER ANTI-VERSAILLES-KONSENS · REVISIONSPOLITIK ALS GEWALTPOLITIK · DIE POLITISCHEN FOLGEN DES JOHN MAYNARD KEYNES · APPEASEMENT · NOCH EINMAL COMPIÈGNE
EpilogNach 100 Jahren
ANHANG
Dank
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Personenregister
Bildnachweis
Einleitung Versailles 1919 – Fragen an einen Frieden
Der Ort war mit Bedacht gewählt. Im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, dort, wo ein halbes Jahrhundert zuvor das Deutsche Reich ausgerufen worden war, mussten die deutschen Minister Hermann Müller und Johannes Bell am 28. Juni 1919 ihre Unterschrift unter den Friedensvertrag mit den Alliierten setzen. In den Augen der Deutschen war die Wahl des Ortes eine weitere Demütigung, von denen sie als Verlierer des Krieges seit dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 und dem Beginn der Friedenskonferenz am 18. Januar 1919 viele über sich hatten ergehen lassen müssen. Die Zeremonie in Versailles war eine hoch symbolische politische Inszenierung, bei der nichts dem Zufall überlassen und den Besiegten nichts erspart blieb. Vor den Augen der Welt – das Ereignis wurde sogar im Film festgehalten – wurde die deutsche Delegation als letzte in den Saal gerufen. Auf ihrem Weg zur Vertragsunterzeichnung musste sie eine Gruppe schwerbeschädigter französischer Soldaten passieren, »gueules cassées«, Gesichtsverletzte, die in einer der Fensternischen platziert waren und mit ihren entstellenden Verletzungen, ihren Schädelbinden und Gesichtsverbänden an die Opfer und das Leid mahnten, das nach Sühne verlangte.1 Georges Clemenceau, der französische Ministerpräsident, hatte die Versehrten stellvertretend für alle verwundeten und gefallenen französischen Soldaten – verletzte Soldaten anderer Länder waren in Versailles nicht zugegen – demonstrativ begrüßt, als er den Saal betrat, und ihnen für ihre Opferbereitschaft gedankt. Dann hatte er auf den Friedensvertrag verwiesen, den die deutschen Vertreter an diesem Tag unterschreiben sollten, und erklärt: »Frankreich, das ich heute repräsentiere, grüßt in Euch die Männer, die mit ihrem Blut für den Sieg bezahlt haben. Die heutige Zeremonie ist der Beginn einer Entschädigung. Das ist nicht alles, es wird noch mehr geben, das versichere ich Euch.«2
Kein Zweifel: Von den verstümmelten Soldaten sollte keine Botschaft des Friedens ausgehen. Sie sollten den Teilnehmern der Zeremonie die Schrecken des modernen technischen Krieges vor Augen führen und in der Stunde des Friedens den Gegner beschämen. Sie sollten das moralische Urteil bekräftigen, das in dem berühmten Artikel 231 des Versailler Vertrags gefällt wurde: Das Deutsche Reich trug die Schuld am Krieg und die Verantwortung für seine Opfer. Die Versehrten waren, wie die Pariser Zeitung Le Petit Journal in ihrem Bericht am folgenden Tag schrieb, »Zeugen des Krieges, Kläger und Richter«.3 Als solche wurden sie auf dem politischen Parkett präsentiert. Die »gueules cassées« standen für einen Frieden, der eine Illusion blieb, weil weder der Vertrag von Versailles noch die anderen Pariser Vorortverträge – die Verträge von St. Germain, Trianon, Neuilly und Sèvres – den »Krieg in den Köpfen« (Gerd Krumeich) beendeten.4 Die Entscheidungen der Pariser Friedenskonferenz von 1919/20 haben nicht nur den Hass und die Gegensätze des Krieges weiter geschürt, gerade zwischen Deutschen und Franzosen, sondern weit über Deutschland und Europa hinaus neues Konfliktpotential und neue Spannungen geschaffen, die bis tief ins 20. Jahrhundert hineinwirkten und zum Teil bis heute spürbar sind.
Die düstere Szene vom Juni 1919 verbindet die Geschichte des Krieges mit der Geschichte des Friedens, der ihm folgte. Sie offenbart, dass der Krieg mit der Pariser Konferenz und dem Friedensschluss von 1919/20 nicht zu Ende ging. Die fünf Friedensverträge von Paris prägten die Welt des 20. Jahrhunderts nicht weniger als der Große Krieg. Zur »Demobilmachung der Geister«, wie es der deutsche Historiker Friedrich Meinecke schon 1917 formulierte, führten sie nicht.5 Die Erfahrungen des Krieges, seine Globalität, das bis dahin nicht gekannte Ausmaß an Gewalthaftigkeit und mobilisierender Kraft wirkten auf den Frieden ein. Die Friedensschlüsse bauten die alten Spannungen nicht ab, sondern verlängerten sie in die Nachkriegszeit und schufen obendrein neue Konflikte. Die Welt kam nicht zur Ruhe.
Die europäischen Imperien, Großbritannien und Frankreich vor allem, die äußerlich betrachtet nach dem Ersten Weltkrieg den Zenit ihrer Macht und ihrer territorialen Ausdehnung erreichten, waren erschüttert. Von Indochina über Indien bis nach Irland nahmen Forderungen nach nationaler Selbstbestimmung an Stärke zu und prallten auf den Selbstbehauptungswillen der imperialen Mächte, die sich an ihren globalen Machtstatus klammerten, um ihre Schwäche in Europa zu kompensieren. In Ostmittel- und Südosteuropa entluden sich die Auflösung des Zarenreichs, des Habsburgerreichs sowie des Osmanischen Reichs und die Nationalisierung der Staatenwelt zwischen Ostsee und Schwarzem Meer in einer Serie von Kriegen und Bürgerkriegen, denen nach dem Ende des Weltkriegs noch einmal Hunderttausende zum Opfer fielen. In vielen der neu gegründeten Staaten tobten ethnische Konflikte, Minderheiten wurden unterdrückt, Diskriminierung und Verfolgung ganzer Bevölkerungsgruppen mit zum Teil brutaler Gewalt waren die Folge. Politische Stabilität konnte so nicht entstehen. Revolutionen, Putsche und Putschversuche waren die Regel, nicht die Ausnahme. Autoritäre, zumeist radikalnationalistische Bewegungen unterhöhlten die jungen Demokratien. Von den nach 1918 gegründeten demokratischen Staaten überdauerte kaum einer.6
Das gilt auch für Deutschland, wo 1933 die Nationalsozialisten an die Macht gelangten. Der Versailler Vertrag sei den Deutschen in einer doppelten Gestalt begegnet, hat Karl Dietrich Bracher einmal geäußert: als reale Belastung und als »psychologische, propagandafähige Potenz«.7 Dass die Weimarer Republik sich nie stabilisieren konnte und in der Bevölkerung nicht die überlebensnotwendige Akzeptanz fand, lag nicht nur daran, dass der Versailler Vertrag mit seinen territorialen, ökonomischen und finanziellen Bestimmungen die junge Demokratie schwer belastete, sondern auch daran, dass die Ablehnung dieses Friedensvertrages wie eine Art zerstörerischer Minimalkonsens nahezu alle politischen Richtungen verband und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Kaiserreich, seinen Eliten und ihrer Verantwortung für den Ersten Weltkrieg verhinderte.
Die Empörung über das Friedensdiktat und insbesondere das Kriegsschuldverdikt, die »Kriegsschuldlüge«, wie es bald hieß, standen einer kritischen, einer selbstkritischen Auseinandersetzung mit der Rolle Deutschlands und seiner politischen und militärischen Führung im Vorfeld und während des Weltkriegs im Wege. Ansätze dazu hatte es durchaus gegeben. So hatte der USPD-Politiker Karl Kautsky, der für den Rat der Volksbeauftragten als Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt tätig war, im Winter 1918/19 aus den deutschen Regierungsakten einen Bericht verfasst, der auf die Mitverantwortung der deutschen Reichsleitung für den Kriegsbeginn 1914 hinwies. Nach der Fertigstellung im Februar 1919 wurde Kautskys Ausarbeitung von der Reichsregierung zurückgehalten, weil man befürchtete, dadurch könne die deutsche Position in den Friedensverhandlungen geschwächt werden. Erst Monate nach Unterzeichnung des Versailler Vertrags erschien der Bericht, konnte aber angesichts der durch die Empörung über den Kriegsschuldartikel genährten Realitätsverweigerung keine Wirkung mehr entfalten.8
Das Ende der Weimarer Republik, der Aufstieg und die Machtübernahme der Nationalsozialisten und schließlich der Zweite Weltkrieg haben nicht allein in Deutschland den Blick auf den Versailler Vertrag und die Friedensschlüsse von 1919 bestimmt und die Versailler Ordnung nachhaltig diskreditiert. Nicht nur die sich aus den Verträgen ergebende Entwicklung in Deutschland und Europa brachte man mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen in Verbindung, sondern auch das Vertragswerk selbst, das in diesem Licht kaum eine Chance auf eine unvoreingenommene Beurteilung hatte. Schon in den 1930er Jahren sahen sich die frühen Kritiker des Vertrags – unter ihnen besonders prominent der Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes, der 1919 zur britischen Delegation gehört hatte – durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten und Hitlers Außenpolitik der Gewalt in ihrer Kritik bestätigt. Noch 1983 meinte Robert Skidelsky, der Biograph des Ökonomen, dass Hitler wahrscheinlich nicht Reichskanzler geworden wäre, wenn man 1919 auf Keynes gehört und Deutschland einen vor allem wirtschaftlich milderen Frieden gewährt hätte.9 Denn nicht wenige Gegner Hitlers und des Nationalsozialismus reagierten zurückhaltend auf die aggressive deutsche Außenpolitik seit 1933, weil sie es für legitim hielten, dass Deutschland sich aus den »Ketten von Versailles« befreite.
Die britische und französische Politik des Appeasement ist auch aus dieser Sicht zu erklären und ebenso aus der Hoffnung, ein moralisch rehabilitiertes Deutschland werde sich in friedenssichernde europäische Kommunikationsstrukturen und Kooperationsmechanismen einbinden lassen. Vom britischen »Trauma des Meaculpismus« hat der deutsche Historiker Hans Rothfels einmal gesprochen.10 Das lässt sich verbinden mit der Neubewertung des Kriegsbeginns 1914, für die der britische Premierminister David Lloyd George, der sein Land 1919 in Paris vertrat, 1933 das Stichwort lieferte, als er in seinen Kriegsmemoiren erklärte, Europa sei in den Krieg »hineingeschlittert«.11 Das war weit entfernt von dem Kriegsschuldverdikt des Jahres 1919, entlastete vielmehr Deutschland und billigte damit die deutsche, auch die nationalsozialistische Revisionspolitik.
Mit dem Zweiten Weltkrieg änderte sich zwar das Urteil über die deutsche Außenpolitik vor 1939, nicht aber das Bild der Versailler Ordnung. 1984, siebzig Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs, schrieb der amerikanische Diplomat und Historiker George F. Kennan in der New York Times, die »Rachsucht der britischen und französischen Friedensbedingungen« habe dem Nationalsozialismus und einem weiteren Krieg den Weg bereitet. Der Zweite Weltkrieg sei das Ergebnis »des dummen und demütigenden Straffriedens« gewesen, der Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auferlegt worden sei.12 1945 hatte der britische Economist angesichts der Herausforderung, nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue europäische Ordnung zu schaffen, gemahnt: »Die unentbehrliche Sicherung einer Friedensordnung ist die Bereitschaft siegreicher Völker, sie aufrechtzuerhalten. An solcher Bereitschaft wird es fehlen, wenn der Vertrag Dinge einschließt, für die man nicht einstehen kann.« 55 Jahre später, in ihrer Millenniumsausgabe 1999/2000, urteilte dieselbe Zeitschrift in einem Artikel über den Ersten Weltkrieg, das letzte Verbrechen in diesem verbrecherischen Krieg sei der Versailler Vertrag gewesen, dessen harte Bedingungen einen weiteren Krieg unausweichlich gemacht hätten.13
In Deutschland ließ das historische und auch geschichtswissenschaftliche Interesse am Versailler Vertrag und den anderen Pariser Vorortverträgen im Schatten des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust zwar nach, Versailles gewann aber nach 1945 Bedeutung als geschichts- und vergangenheitspolitisches Argument. Schon in den 1930er Jahren hatten viele Deutsche die große Zustimmung zum Nationalsozialismus, oftmals auch ihre eigene, mit dem Versailler Vertrag in Verbindung gebracht. Nun erklärte man weithin in apologetischer oder exkulpierender Absicht mit »Versailles« nicht nur den Aufstieg Hitlers, sondern begründete auch, warum man diesen Aufstieg begrüßt hatte, warum man in die NSDAP eingetreten war, warum man sich in den Dienst des Regimes gestellt, in den unterschiedlichsten professionellen Kontexten seine Repressions- und Gewaltpolitik unterstützt hatte und warum man die Augen vor den Verbrechen des Regimes verschlossen hatte, wenn man nicht selbst an ihnen beteiligt gewesen war. Zugleich suchte man sich auf diese Weise von der nationalsozialistischen Ideologie und insbesondere vom Antisemitismus zu distanzieren. Nicht aus ideologischen Gründen habe man sich dem Nationalsozialismus genähert und das Regime unterstützt, sondern weil man das Ziel teilte, den Vertrag von Versailles zu überwinden, und die nationalsozialistische Politik wie die nationalsozialistischen »Erfolge« als Schritte in diese Richtung begrüßte. Erst spät – zu spät – habe man die wahren Absichten Hitlers erkannt. So konnte man argumentieren, weil der Versailler Frieden auch nach 1945 diskreditiert blieb, nicht zuletzt wegen des Kriegsschuldvorwurfs.
Das änderte sich erst in den 1960er Jahren, als Fritz Fischer die Politik des Kaiserreichs vor 1914 neu beleuchtete und den Weg in den Krieg nicht als Verkettung unglücklicher Umstände und Missverständnisse darstellte, sondern als Ergebnis einer planvollen Politik, die den Krieg wollte und suchte, um eine deutsche Hegemonie in Europa zu errichten und einen siegreichen Krieg dafür zu nutzen, das Kaiserreich autoritär zu transformieren und dadurch die traditionellen preußisch-deutschen Machteliten zu stabilisieren.14 Fischers Thesen lösten eine hitzige Debatte über die deutsche Kriegsschuld aus, von der auch die Bewertung des Versailler Vertrags nicht unberührt blieb. Denn wenn das Kaiserreich den Krieg gesucht und herbeigeführt hatte, musste dann nicht der Versailler Vertrag in einem anderen Licht erscheinen? Musste man ihn dann nicht stärker als zuvor als einen Versuch verstehen, einen deutschen »Griff nach der Weltmacht« zu verhindern und damit einen neuen Krieg?
Fünfzig Jahre nach Fritz Fischer hat Christopher Clark in seinem Buch Die Schlafwandler ein Bild des Kriegsbeginns 1914 gezeichnet, das Fischers Thesen deutlich widerspricht. Die Frage nach der Verantwortung für den Krieg und erst recht die Frage nach der Kriegsschuld hält der australische Historiker für nicht weiterführend und problematisch, weil »ein schuldorientiertes Untersuchungsmodell oft mit Vorurteilen einhergeht«.15 Clark kehrt deshalb zurück zu einer Interpretation, die den Beginn des Ersten Weltkriegs als Systemversagen deutet, als Resultat von Veränderungen im internationalen System der europäischen Mächte und einer politischen Komplexität, mit der die handelnden Akteure in der Situation des Juli 1914 überfordert gewesen seien. Was bedeutet eine solche Bewertung, die sich wieder der Einschätzung von David Lloyd George aus dem Jahr 1933 annähert, für unser Urteil über den Vertrag von Versailles? Folgte dem falschen Krieg der falsche Frieden? Tragen dann die Sieger des Weltkriegs, die Deutschland den Friedensvertrag aufzwangen, Verantwortung für die Dauerkrise der Weimarer Demokratie, ja womöglich sogar für den Aufstieg und die Machtübernahme des Nationalsozialismus?
Wer in der Gegenwart für ein neues deutsches Selbstbewusstsein wirbt, der macht nicht selten durch das gesamte 20. Jahrhundert hindurch ein Bestreben anderer Mächte aus, Deutschland in einer Position der Inferiorität zu halten; der erkennt in jedem Hinweis auf die autoritären Strukturen des Kaiserreichs, auf die Interessen seiner Machteliten und auf Deutschlands Rolle im Vorfeld des Ersten Weltkriegs ein historisches Argument, das auf die Gegenwart zielt. Das Kaiserreich werde in ein schlechtes Licht gerückt, als autoritär und aggressiv charakterisiert, ihm werde noch hundert Jahre später die Kriegsschuld zugeschoben, um das Deutschland der Gegenwart davon abzuhalten, eine selbstbewusste, autonome Außenpolitik und seine legitimen Interessen in der Welt zu vertreten. Auch in dieser Perspektive gewinnen der Versailler Vertrag und die Versailler Ordnung Gegenwartsbedeutung. Analytisch freilich führt es kaum weiter, den Versailler Vertrag als falschen Frieden zu bezeichnen und ihn ausschließlich in ein Narrativ der Eindämmung und Kontrolle Deutschlands zu integrieren, das über die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg bis ins 21. Jahrhundert reicht. Das wird der Komplexität des Friedensschlusses und seinen unterschiedlichen Dimensionen nicht gerecht.
Erster Weltkrieg und Versailler Frieden sind untrennbar miteinander verbunden. Das gilt nicht nur für Deutschland und den Versailler Vertrag, sondern für die Pariser Friedenskonferenz und die neue Weltordnung, die sie zu schaffen versuchte, insgesamt. Aus den Erfahrungen des Krieges speiste sich der Frieden von 1919, speisten sich die Bestimmungen der Pariser Vorortverträge, speiste sich aber auch die Wahrnehmung dieser Bestimmungen überall in Europa und weit darüber hinaus. Vor diesem Hintergrund kommen unweigerlich Zweifel auf, ob ein Frieden der Versöhnung und Verständigung überhaupt möglich gewesen wäre. Mehr als vier Jahre lang hatte ein technisch-industrieller Krieg, wie ihn die Menschheit bis dahin nicht erlebt hatte, ganze Gesellschaften erfasst, sie mit Massentöten und Massensterben konfrontiert und unermesslichem Leid ausgesetzt. Über 20 Millionen Tote forderte der Krieg, Soldaten und Zivilisten. Konnte vor solchem Hintergrund das Kriegsende die Stunde der Versöhnung und des Ausgleichs sein? Konnte man in dieser Stunde von den Siegern Mäßigung und Zurückhaltung erwarten und von den Verlierern eine Anerkennung ihrer alleinigen Schuld?16 Und hätte eine solche Anerkennung von Schuld oder Verantwortung zu einem anderen Frieden geführt, zu einem Frieden insbesondere, zu dem Frankreich bereit gewesen und der in Deutschland akzeptiert worden wäre?
Nicht nur die französischen »gueules cassées« lassen daran zweifeln. Als im Mai 1919 die alliierten Friedensbedingungen in Deutschland bekannt wurden, da spiegelte die Reaktion von Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann sowohl die enttäuschten Erwartungen der Deutschen als auch die ebenso verzweifelte wie trotzige Wahrnehmung des sich abzeichnenden Friedensschlusses, der den Krieg nicht beenden, sondern ihn verlängern würde. In der Weimarer Nationalversammlung rief der sozialdemokratische Regierungschef unter Zustimmung aller Fraktionen aus: »Würde dieser Vertrag wirklich unterschrieben, so wäre es nicht Deutschlands Leiche allein, die auf dem Schlachtfelde von Versailles bliebe. (…) Nicht der Krieg, sondern dieser harte, kasteiende Arbeitsfriede wird das Stahlbad für unser aufs tiefste geschwächte Volk sein! Heute sieht es fast so aus, als sei das blutige Schlachtfeld von der Nordsee bis zur Schweizer Grenze noch einmal in Versailles lebendig geworden, als kämpften Gespenster über all den Leichenhügeln noch einen letzten Kampf des Hasses und der Verzweiflung.«17
Von den »Traumatisierungen des Weltkrieges« hat Gerd Krumeich gesprochen, diese Traumatisierungen als eine »verflixte Ausgangsposition« für den Friedensschluss bezeichnet und zugleich beklagt, dass keine einzige Geschichte der Weimarer Republik – und das bezieht ja Versailles mit ein – wirklich vom Krieg her komme.18 In der jüngeren Historiographie ist der Erste Weltkrieg als ein totaler Krieg charakterisiert worden, bezogen vor allem auf die totale Mobilisierung der kriegführenden Gesellschaften und auf die Kriegsdiskurse in allen Ländern, die, einschließlich einer bis dahin beispiellosen Propaganda, den Krieg ideologisierten und moralisierten. Was bedeutete das für den Friedensschluss? Ist es überhaupt möglich, nach einem totalen Krieg einen Frieden zu schließen, den Sieger und Besiegte gleichermaßen als gerecht und akzeptabel anerkennen können? Es war die Totalität des Krieges über mehr als vier Jahre hinweg – der technisch-industriellen Kriegführung genauso wie der gesellschaftlichen Mobilisierung der »Heimatfront« –, die zur Moralisierung des Friedensschlusses beitrug und die Friedensverträge, insbesondere den mit Deutschland, zu moralischen Urteilen machte. Die Moralisierung und Ideologisierung von Krieg und Kriegführung fanden im Frieden und in den Friedensverträgen ihre Fortsetzung. Deswegen gewann gerade im deutschen Fall die Frage der Kriegsschuld eine so enorme Bedeutung, und deswegen war es 1919 nicht möglich, zu vergeben und zu vergessen.
Denn wie hätte ein Frieden aussehen müssen, der nach diesem Krieg nicht nur in Deutschland, nicht nur von den Regierungen, sondern in allen am Krieg beteiligten Gesellschaften als angemessen und gerecht angesehen worden wäre? Anders als nach früheren Kriegen wirkten die Gesellschaften der kriegführenden Staaten, ihre Stimmungen und ihre Erfahrungen auf den Friedensschluss und seine Wahrnehmung und Bewertung ein. Und die handelnden Politiker waren weder willens noch in der Lage, diese gesellschaftlichen Befindlichkeiten und die öffentliche Meinung zu ignorieren. Das war mehr als hundert Jahre zuvor auf dem Wiener Kongress noch anders gewesen. 1814/15 war das besiegte Frankreich an den Verhandlungen beteiligt, und es konnte eine europäische Friedensordnung geschaffen werden, die an politischen Imperativen – Restauration, Gleichgewicht, Solidarität – ausgerichtet war und gesellschaftliche Interessen und Stimmungen nicht einzubeziehen brauchte. Davon war man hundert Jahre später weit entfernt. Der Frieden von 1919 konnte die durch den Krieg entfesselten Dynamiken nicht bändigen. Das war einer der Hauptgründe sowohl für die große und überall greifbare Unzufriedenheit mit der Versailler Ordnung als auch für ihre Instabilität. Die Dynamiken des Krieges wirkten in den Friedensschluss hinein, und zugleich vermischte sich der Friedensschluss mit all jenen Interessen, Hoffnungen und Erwartungen, die über die Beendigung des Krieges weit hinausgingen, aber dennoch von unterschiedlichen Akteuren mit dem Frieden verbunden wurden. Deren tatsächliche oder vermeintliche Nichterfüllung – man kann auch von Desillusionierung sprechen – trug zur Diskreditierung des Friedens entscheidend bei.
Von der »verwundeten Seele der französischen Nation«, die sich in Versailles an einem barocken Symbol habe erholen sollen, was ihr nicht gelungen sei, schrieb der Publizist Klaus Harpprecht 1969. Fünfzig Jahre nach dem Friedensschluss, anlässlich eines »dunklen Jubiläums«, sah er im Rückblick den Versailler Vertrag als die »Paraphierung und Ratifizierung des permanenten Unfriedens in Europa«.19 Das war nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, den, wie gesagt, in jenen Jahren nicht wenige aus dem angeblichen Versagen der Pariser Konferenz und den Bestimmungen des Versailler Vertrags und der anderen Vorortverträge erklärten.
Doch schon in den 1920er Jahren, als die Tinte unter den Friedensverträgen noch nicht getrocknet war, gab es in den Verliererstaaten wie auf Seiten der Siegermächte kaum eine Stimme, die bereit gewesen wäre, das Vertragswerk zu verteidigen. Alliierte Politiker warfen sich gegenseitig vor, für einen schlechten Frieden verantwortlich zu sein, für einen Frieden, der den einen als zu hart, den anderen als zu mild erschien. Zahllose Berater und Experten, die an der Vorbereitung der – alliierten – Verhandlungen mitgewirkt hatten und zum Teil in Paris dabei gewesen waren, empfanden Enttäuschung angesichts der Ergebnisse der Konferenz und machten aus ihrer Enttäuschung auch öffentlich kein Hehl. Aus idealistischen Plänen für eine friedliche Neugestaltung der Welt seien faule Kompromisse geworden. Für den Philosophen und Historiker Arnold Toynbee, der 1919 der britischen Delegation angehörte, war die Pariser Konferenz »eine seelenzerstörende Angelegenheit« (»a soul-destroying affair«). »Man hatte uns während des Kriegs glauben gemacht, wir würden an einem Aufbauwerk mitwirken und nicht zu einer Katastrophe beitragen, und nun verpufft alles, und man erkennt, was der Krieg tatsächlich bewirkt – nichts als Zerstörung.«20 William A. White, ein amerikanischer Journalist und Politiker, der 1919 mit Woodrow Wilson nach Paris gereist war, um über die Friedenskonferenz zu berichten, war enttäuscht und frustriert: »Wir haben so große Hoffnungen auf dieses Unternehmen gesetzt; wir haben geglaubt, Gott selbst habe uns gerufen; und nun, am Ende, müssen wir die schmutzigste Arbeit der Hölle verrichten: Menschen aushungern, Besitz von Gebieten ergreifen – oder unseren Freunden dabei helfen; wir sind dabei, wenn der Geist von Rache und Erniedrigung auch diesen Krieg mit der nicht endenden Kette von Kriegen verbindet, die zurückführt bis zu Kain (und Abel; E. C.).«21
Waren der Versailler Vertrag und das Versailler System von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Waren die Pariser Vorortverträge lediglich ein Waffenstillstand, die Unterbrechung eines Krieges, der zwanzig Jahre später wieder aufflammen sollte? Machte Versailles den neuen Krieg geradezu unvermeidlich? Oder enthielten die Verträge von 1919 auch die Chance auf Frieden? Hätte aus ihnen eine stabile europäische und internationale Ordnung entstehen können? Bis heute bewegt sich die wissenschaftliche und die öffentliche Debatte nicht nur in Deutschland zwischen diesen beiden Polen der Urteilsbildung, die eindeutig und nahezu zwangsläufig durch die Entwicklungen der 1920er und vor allem der 1930er Jahre geprägt ist: durch den Untergang der Weimarer Republik, den Aufstieg und die Herrschaft des Nationalsozialismus sowie den Zweiten Weltkrieg. Es ist schwer, sich dem Sog dieser Entwicklungen zu entziehen, schwer, einen Blick auf Versailles zu richten, der sich von dieser Fixierung löst und in den Ereignissen des Jahres 1919 mehr sieht als nur eine Vorgeschichte. In diesem Buch soll das trotzdem versucht werden.
Denn 1919 waren weder der Untergang der Weimarer Republik noch der Nationalsozialismus, noch der Zweite Weltkrieg unausweichlich. Auch nach dem Ersten Weltkrieg war die Zukunft offen. Alles andere wäre ahistorisch gedacht und würde die Menschen der Zwischenkriegszeit, die freilich erst seit 1939 eine Zwischenkriegszeit war, lediglich als Erfüllungsgehilfen eines vorbestimmten Geschichtsverlaufs betrachten. 1919 ging es darum – das muss man den in Paris versammelten Vertretern der Siegermächte konzedieren –, eine stabile und friedliche internationale Ordnung zu entwerfen, die Kriege verhindern und den Rahmen für eine gewaltfreie Gestaltung internationaler Beziehungen bilden sollte; eine Ordnung zudem, die durch ihre Begründung auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker demokratisierend wirken sollte – und auch diese Demokratisierung sollte dem Frieden dienen.
Diesen Motiven und Absichten gerecht zu werden, darum geht es in diesem Buch. Die Pariser Konferenz von 1919 wird als eine offene historische Situation begriffen. Deswegen wird nach den Entwicklungen und Entscheidungen der Jahre 1919/20 aus den Dynamiken des Ersten Weltkriegs heraus gefragt. Weil Kriegsverlauf und Kriegserfahrungen einerseits und Friedenserwartungen und Friedensregelungen andererseits so eng aufeinander bezogen waren, dass sie letztlich nicht voneinander zu trennen sind. Weder die handelnden Politiker des Jahres 1919 noch all die anderen Akteure, deren Wege sich in Paris kreuzten, waren frei von den Erfahrungen des Krieges. Aber diese Erfahrungen waren extrem heterogen, sie formten sich ganz unterschiedlich aus und führten jenseits eines allgemeinen Friedenswunsches zu ganz unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen und politischen Zielsetzungen. Das erschwerte den Friedensschluss.
Die Ziele, mit denen die Mächte 1914 in den Krieg zogen, waren nicht identisch mit den Friedenszielen des Jahres 1919. Die Friedensziele sowohl der Siegermächte – der alliierten und assoziierten Mächte, die auf der Pariser Konferenz vertreten waren – als auch der Verliererstaaten hatten sich in einem Krieg herausgebildet, der im Herbst 1918 auf den Schlachtfeldern an sein Ende gelangt war, aber in den Köpfen andauerte. Aus Kriegszielen mussten nun Friedensziele werden, die nicht auf die nationale Mobilisierung gerichtet waren, sondern auf eine internationale, stabile politische Ordnung, die gleichwohl den eigenen nationalen Interessen entsprach. In allen Fällen – und eben nicht nur für die Besiegten – bedeutete das eine erhebliche und oftmals äußerst schmerzhafte Reduktion von Ansprüchen, die in den Kriegsjahren entstanden waren, mit denen die Kriegsanstrengungen und immer stärker auch die Zerstörung, das Leid und die Opfer gerechtfertigt worden waren. Zur Geschichte der Friedenskonferenz, auch zu ihrer Wirkungsgeschichte, gehört, dass lange vor ihrem Beginn Erwartungen geweckt worden waren, die nun kaum erfüllt werden konnten. Im Ringen um die neue politische Ordnung prallten zudem nicht allein die unterschiedlichen Friedensvorstellungen von Siegern und Besiegten aufeinander, vielmehr erzwangen auch die divergierenden Friedensziele der Siegermächte Kompromisse, Zugeständnisse und ein Abrücken von Maximalforderungen. Enttäuschungen waren die Folge, und auch das trug dazu bei, dass die Friedensverträge von 1919 und 1920 schon bald nach der Unterzeichnung kaum noch Befürworter hatten. Stattdessen dominierten Unzufriedenheit, Frustration und Kritik nicht nur an den Verträgen und ihren Bestimmungen, sondern auch an denen, die diese Verträge ausgehandelt hatten: der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der britische Premierminister David Lloyd George und der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau, dem man vorwarf, den Krieg zwar gewonnen, den Frieden aber verloren zu haben.
Dass nationale Kriegsziele einen internationalen Frieden bestimmen und in den Friedensverträgen eins zu eins umgesetzt werden könnten, war eine Illusion, die in den Kriegsjahren in allen Kriegsgesellschaften genährt worden war. Nicht nur Politiker, Diplomaten und hohe Militärs erlagen ihr, sondern auch – verstärkt durch Presse und Propaganda – die Bevölkerungen. Diese Illusion war ein Grund dafür, dass nicht allein in Deutschland die internationale Ordnung, die auf den Verträgen beruhte, auf so geringe Akzeptanz stieß und so wenige Fürsprecher fand. Davon profitierten am Ende nicht diejenigen, die diese Ordnung zwar kritisierten, sie aber zu verbessern und zu reformieren suchten, sondern diejenigen, die sie radikal ablehnten, sie bekämpften und zu zerstören trachteten.
Enttäuscht und desillusioniert wurden aber auch jene Kräfte, die weniger auf den Krieg als vielmehr auf den Frieden und die mit dem Friedensschluss verbundene Neuordnung der Welt gesetzt hatten. Das waren vor allem die kolonialen Völker, die das Versprechen nationaler Selbstbestimmung auf sich bezogen und hofften, ja erwarteten, auf der Pariser Konferenz von imperialer, westlich-europäischer Herrschaft befreit zu werden, dieser Befreiung und dem Ziel der Selbstbestimmung zumindest näherzukommen. Zahlreiche Delegationen aus Asien und Afrika reisten 1919 nach Paris, um dieses Interesse dort vorzubringen. Sie stießen auf taube Ohren und mussten sogar erfahren, dass die imperiale Herrschaft in den Verhandlungen nicht geschwächt, sondern bestätigt und gefestigt wurde. So führte die Auflösung des Osmanischen Reiches nicht zur Unabhängigkeit der Völker des Nahen und Mittleren Ostens, sondern zu neuen Formen imperialer Abhängigkeit. Auch die ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika wurden nicht in die Unabhängigkeit entlassen, sondern als Mandate des Völkerbunds de facto dem britischen oder dem französischen Kolonialreich zugeschlagen. Das trug in den folgenden Jahren erheblich zur Verstärkung der Spannungen zwischen imperialer Macht und indigener Bevölkerung sowie zur Intensivierung kolonialer Konflikte bei und belastete den nach 1945 einsetzenden Prozess der Dekolonialisierung nicht zuletzt durch die gewachsenen Gewaltpotentiale und eine zunehmende Gewaltbereitschaft.
»Versailles« steht in diesem Buch nicht allein für den Versailler Vertrag, also für den Frieden mit Deutschland. Es ist vielmehr eine Chiffre für einen Friedensschluss und eine internationale Ordnung, die in Bedeutung und Wirkung räumlich weit über Deutschland und Europa und zeitlich weit über die Zwischenkriegszeit und den Zweiten Weltkrieg hinausreichten. Drei Großreiche waren am Ende des Ersten Weltkriegs zusammengebrochen: das russische Zarenreich bereits mit der Oktoberrevolution 1917, das Habsburgerreich, das sich mit dem Kriegsende 1918 auflöste, und das Osmanische Reich, das den Krieg, in dem es auf der Seite der Verlierer stand, nur um wenige Jahre, bis 1922, überdauerte. Die Pariser Konferenz sah sich also vor der Aufgabe, die Räume und die Bevölkerungen, die von diesen multinationalen Imperien zum Teil über Jahrhunderte beherrscht worden waren, territorial und politisch neu zu ordnen und in die von den Siegermächten gestaltete Nachkriegsordnung einzufügen.
An dieser gewaltigen Aufgabe sind die in Paris versammelten Mächte auch deshalb gescheitert, weil sich die komplexen Strukturen dieser Reiche, die ja nicht nur multinational waren, sondern auch multilingual und multireligiös, nicht einfach in eine neue Ordnung überführen ließen. Alle drei Großreiche hatten in ihrem Herrschaftsbereich zumindest für ein Minimum an Stabilität gesorgt, hatten nationale, ethnische, religiöse sowie kulturelle Spannungen und Konfliktpotentiale eingedämmt. Damit war es nun – gerade in Ostmittel- und Südosteuropa – vorbei, denn die in diesem Raum neu entstehenden beziehungsweise neu geschaffenen Nationalstaaten waren ganz überwiegend weder in der Lage noch politisch willens, die Ordnungs- und Ausgleichsfunktionen der aufgelösten Imperien zu übernehmen und ethnische, kulturelle oder religiöse Spannungs- und Konfliktpotentiale zu kontrollieren, im Gegenteil: Die in der Regel ungefestigten und mit schwachen Institutionen ausgestatteten Nationalstaaten verstanden sich als Repräsentanten bestimmter ethnischer oder kultureller Identitäten, was die innerstaatlichen und die zwischenstaatlichen Spannungen und Konflikte eher verschärfte als eingrenzte, geschweige denn abbaute. So kam es nach 1919 in der Zerfallszone der ehemals mächtigen Reiche – Shatterzone of Empires, wie es Omer Bartov und Eric D. Weitz genannt haben – zu einer Eruption der Gewalt, was sich in Kriegen, Bürgerkriegen und Pogromen äußerte.22 Die ungezügelte Gewalt trug dazu bei, dass aus den jungen, nach 1918 errichteten Demokratien oft innerhalb weniger Jahre autoritäre Regime und Diktaturen wurden, die ihre Herrschaft auf Gewalt und Repression stützten. Die Staatlichkeit, die unter solchen Bedingungen gedieh, blieb prekär und räumlich begrenzt, und es entstanden staatsferne, zum Teil sogar staatsfreie Räume, in denen die Gewalt nicht mehr zu zügeln war. In diesen »Bloodlands«, wie sie der amerikanische Historiker Timothy Snyder genannt hat, kam es schließlich zum Völkermord; hier verbanden sich seit den 1930er Jahren die Gewaltexzesse mit der von der stalinistischen Sowjetunion und dem nationalsozialistischen Deutschland ausgeübten genozidalen Gewalt.23
Der Untergang der drei großen Reiche löste keines der Ordnungsprobleme Ostmittel- und Südosteuropas, sondern verschärfte die vorhandenen Konflikte und fügte ihnen neue hinzu. Die Minderheitenproblematik wurde durch die Idee des ethnisch reinen Nationalstaats, die den Staatsgründungen in diesem Raum weithin zugrunde lag, nun noch in ganz anderer Weise virulent als vor 1914. Denn die auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker gegründete Nationalisierung der Staatenwelt unmittelbar nach dem Ende des Weltkriegs löste eine Reihe von Kriegen aus, in denen es um die Festigung und den Ausbau der neuen Nationalstaatlichkeit ging, um Fragen der Grenzziehung und der territorialen Ausdehnung. Fast keiner der Staaten Ostmittel- und Südosteuropas – allen voran Polen, Ungarn und Griechenland – akzeptierte die in Paris weitgehend ohne ihre Vertreter von den Großmächten festgelegte territoriale Ordnung. Fast könnte man wie für die Frühe Neuzeit von Staatsbildungskriegen sprechen.24 So ging vor allem in diesem Teil Europas – wenngleich man den Kampf um die irische Unabhängigkeit nicht unterschlagen sollte – der Krieg nicht nur in den Köpfen weiter, sondern auch auf den Schlachtfeldern. Nicht wenige Beobachter hatten das schon 1919 befürchtet. Lord Robert Cecil, Angehöriger der britischen Delegation in Paris und einer der Vordenker des Völkerbunds, warnte davor, an »die Nationalität zu glauben, als wäre sie eine Religion«. Er war nicht der Ansicht, »dass ein auf bloße Nationalität gegründeter europäischer Frieden ohne weitere Regelungen wünschenswert oder sogar in jeder Hinsicht vorteilhaft wäre«.25
Bezugnehmend auf das Diktum von Tomáš Masaryk, des ersten Staatspräsidenten der 1918 gegründeten Tschechoslowakei, der Erste Weltkrieg habe Europa in ein »Laboratorium über einem riesigen Friedhof« verwandelt, hat der amerikanische Historiker Mark Mazower die Jahre nach dem Kollaps der alten europäischen Ordnung als eine Zeit ausgedehnter innenpolitischer und außenpolitischer Experimente bezeichnet.26 Für politische – innen- wie außenpolitische – Stabilität war das keine gute Voraussetzung. Dass Demokratisierung und Nationalisierung den Frieden in Europa und der Welt sicherer machen würden, war eine der großen Illusionen von 1919. Nüchtern aus der Retrospektive betrachtet war eher das Gegenteil der Fall. Auf prekären Staaten lässt sich keine stabile internationale Ordnung gründen. Das zeigt auch die Welt der Gegenwart. An der Herausforderung, nationale Selbstbestimmung und regionale Stabilität zu vereinbaren, sind die Siegermächte nach 1919 gescheitert. Sie sind daran auch gescheitert, weil sie in Paris – anders als eine deklaratorische Politik glauben machen wollte – nicht abstrakten Prinzipien wie Nation oder Demokratie zur Durchsetzung verhelfen und eine darauf beruhende neue Weltordnung errichten wollten, sondern weil sie konkreten geostrategischen Interessen und politischen Zielsetzungen folgten. Bestimmend waren dabei mit Blick auf die europäische Nachkriegsordnung der Primat der Sicherheit vor Deutschland, der nicht nur die französische Politik leitete, aber auch der Wunsch, das revolutionäre Russland einzudämmen. Vor diesem Hintergrund war es aus westlicher Sicht zweitrangig, ob Polen und andere Staaten, die ein Bollwerk gegen den revolutionären Bolschewismus bilden sollten, demokratisch oder autoritär verfasst waren.
Die internationale Ordnung, die in Paris 1919 Gestalt annahm, war von den Machtinteressen der Siegermächte bestimmt. Das hatte Folgen weit über Europa hinaus und trug zur Entstehung von Spannungen und globalen Krisenherden bei, die auch hundert Jahre nach der Pariser Konferenz nicht beseitigt sind. Nicht wenige der regionalen Konflikte, die die internationale Politik im beginnenden 21. Jahrhundert beschäftigen, reichen zurück bis in die Jahre der Pariser Verhandlungen und lassen sich – direkt oder indirekt – mit den damals getroffenen Entscheidungen der Großmächte in Verbindung bringen. Dazu zählen etwa die Kriege und Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit brutaler, zum Teil genozidaler Gewalt geführt wurden. Mit Jugoslawien zerfiel nach 1990 ein Staat, der Ende 1918 schon als Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gegründet worden war, in Paris aber offiziell als Staat der Südslawen anerkannt wurde. Auch Bosnier und Montenegriner gehörten zu diesem Staatsverband, der von Anfang an nicht nur durch den serbischen Dominanzanspruch belastet war, sondern überdies von Konflikten zwischen Christen und Muslimen; zwischen katholischen und orthodoxen Christen; zwischen dem schon seit 1878 unabhängigen Serbien und Montenegro und jenen Landesteilen, die bis zum Ersten Weltkrieg zu Österreich-Ungarn oder zum Osmanischen Reich gehörten; zwischen Gebieten, die zum Teil vor Jahrhunderten zum Habsburgerreich gelangt, und jenen, die von Konstantinopel aus beherrscht worden waren. Die Bürger Jugoslawiens hatten im Krieg auf verschiedenen Seiten gestanden und gekämpft, und so waren das Misstrauen und die unterschiedlichen politischen Affinitäten groß. Das zeigte sich in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Nach 1945 hielt nur die autoritäre kommunistische Herrschaft Titos den föderativen Staat zusammen, seit seinem Tod 1980 verstärkten sich die Spannungen zwischen den Teilrepubliken, und nach dem Ende des Kalten Krieges führten die Dynamiken der Renationalisierung zur Auflösung der Republik und den mit ihr verbundenen Zerfallskriegen.
Auch der Nahostkonflikt, in dessen Zentrum die Anerkennung des Staates Israel und die Suche nach einer politischen Ordnung stehen, die israelischen und arabischen Interessen gerecht wird, reicht bis in die Schlussphase des Ersten Weltkriegs und die Zeit der Pariser Konferenz zurück. Zwar wurde der Staat Israel erst 1948 gegründet, doch war die Frage eines jüdischen Staates in Palästina spätestens seit der Balfour-Deklaration von 1917 ein Thema der internationalen Politik, so dass die Neuordnung des Nahen und Mittleren Ostens nach dem Ende der osmanischen Herrschaft auch aus dieser Perspektive betrachtet wurde. Entgegen den Versprechungen und Zusagen aus den Kriegsjahren, als Großbritannien den arabischen Nationalismus und das arabische Unabhängigkeitsstreben in der Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich mobilisierte, brachte die Pariser Konferenz den Arabern nicht die ersehnte Unabhängigkeit, sondern über das Mandatssystem des Völkerbunds eine zumindest indirekte Integration in das britische – und französische – Kolonialreich. Zugleich bestätigten der Friedensvertrag von Sèvres mit der Türkei und die Mandatsbestimmungen des Völkerbunds für Palästina die Balfour-Deklaration, wodurch die Aussicht auf einen jüdischen Staat und die verweigerte arabische Unabhängigkeit in einen Wahrnehmungs- und Wirkungszusammenhang gebracht wurden, der eine Anerkennung des Staates Israel von arabischer Seite nach dem Zweiten Weltkrieg ausschloss und zur Verschärfung des arabisch-israelischen Konflikts entscheidend beitrug. Im Neo-Osmanismus der Gegenwart wiederum begegnen uns türkische Hegemonialambitionen, die sich nicht nur auf den Nahen und Mittleren Osten beziehen, sondern bis ins ehemals sowjetische Zentralasien reichen. Darüber hinaus hat die gegenwärtige Erinnerung an die osmanisch-imperiale Vergangenheit in der heutigen Türkei eine innenpolitische und gesellschaftsstabilisierende Funktion.
Bei der Auflösung des Osmanischen Reiches offenbarte sich über den Nahen und Mittleren Osten hinaus eine tiefe Spannung zwischen dem Prinzip nationaler Selbstbestimmung und den Realitäten imperialer Herrschaft. 1919 bedeutete eben nicht das Ende imperialer Beherrschung, denn die – kolonialen – Imperien der Sieger blieben erhalten und erreichten erst durch die Friedensverträge und das Mandatssystem des Völkerbunds ihre größte Ausdehnung. Die internationale Ordnung, deren Grundlage in Paris geschaffen wurde, war alles andere als antiimperial. Das wird auch durch die Auflösung des deutschen Kolonialreichs bestätigt, dessen Territorien, ob in Afrika oder im asiatisch-pazifischen Raum, keine staatliche Unabhängigkeit erlangten, sondern entweder als Mandatsgebiete de facto dem britischen oder französischen Imperium zufielen oder unter die Kontrolle britischer Dominions wie Australien und Neuseeland kamen. In Ostasien profitierte das imperiale Japan von der Aufteilung des deutschen Kolonialreichs, da es zumindest für einige Jahre die Herrschaft über die auf dem chinesischen Festland gelegene ehemals deutsche Kolonie Kiautschou ausübte. Nicht nur in China erhoben sich daraufhin Proteste gegen die Verlängerung dieser kolonialen Strukturen.
Dass die Pariser Konferenz das System imperialer Herrschaft bestätigte, ja ausbaute, stärkte die antikolonialen Unabhängigkeitsbewegungen, die von den Pariser Entscheidungen bitter enttäuscht wurden, aber aus dieser Enttäuschung neue Kraft schöpften und sich nun erst recht in ihren Zielen und der Legitimität ihres Handelns bestätigt sahen. Antikolonialismus und Antiimperialismus erstarkten vor diesem Hintergrund und reichten bald tief in die kolonialen Metropolgesellschaften hinein. Damit wurde der koloniale Imperialismus im Moment seiner größten Ausdehnung massiver in Frage gestellt als jemals zuvor. Die Unabhängigkeitsbewegungen des globalen Südens, die sich im Umfeld und in der Folge der Pariser Konferenz formierten, trugen dazu bei, dass die Dekolonialisierung seit 1919 nicht mehr von der weltpolitischen Tagesordnung verschwand. Nicht wenige ihrer Führungsfiguren zur Zeit der Pariser Konferenz begegnen uns nach dem Zweiten Weltkrieg wieder, als die letzte Stunde der europäischen Kolonialreiche endgültig geschlagen hatte.
Ohne Zweifel war die Pariser Friedenskonferenz ein globales Ereignis. Sie hatte einen globalen Ordnungsanspruch und globale, bis in die Gegenwart reichende Wirkungen. Aus diesem globalen Ordnungsanspruch und getragen von der Vorstellung kollektiver Sicherheit entstand auch der Völkerbund, dessen Errichtung in Paris vor allem die Vereinigten Staaten und ihr Präsident Woodrow Wilson oberste Priorität beimaßen. Der Völkerbund, über den Historiker bis vor wenigen Jahren kein gutes Urteil gesprochen haben, war der Versuch, die angestrebte multilaterale globale Ordnung institutionell zu rahmen und zu stabilisieren. Die Völkerbundssatzung, im April 1919 verabschiedet, wurde in die Pariser Vorortverträge – auch in den Versailler Vertrag – integriert. Doch erlangte der Völkerbund in den folgenden Jahren nur begrenzten Einfluss, denn die USA traten ihm nicht bei, und die Verliererstaaten des Weltkriegs sowie das bolschewistische Russland blieben zunächst ausgeschlossen. Der Zerstörung der Versailler Ordnung in den 1930er Jahren insbesondere durch das nationalsozialistische Deutschland, das faschistische Italien und das expansionistische Japan hatte die dort versammelte Völkergemeinschaft nichts entgegenzusetzen. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg, den er nicht verhindern konnte, versank der Völkerbund in Bedeutungslosigkeit. Offiziell aufgelöst wurde die Genfer Organisation 1946, als in San Francisco bereits die Vereinten Nationen gegründet waren, der nächste Versuch einer internationalen Staatenorganisation, bei deren Gründung man aus den Fehlern von 1919 Lehren zu ziehen versuchte.
Der Völkerbund entsprang auch dem Wunsch, die internationale Staatengemeinschaft als Rechtsgemeinschaft zu organisieren und Frieden durch Recht zu schaffen.27 Er setzte damit die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen fort, die schon früher eingesetzt hatte, seit dem 19. Jahrhundert aber immer wieder mit der Idee autonomer nationaler Machtstaatlichkeit kollidiert war, für die völkerrechtliche Normen eine Einschränkung nationaler Souveränität bedeuteten. Die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit blieb in diesem Gegensatz gefangen. Die jungen Nationalstaaten im östlichen Europa ebenso wie die alten im Westen zeigten nur wenig Bereitschaft, ihre nationale Souveränität durch eine internationale Institution wie den Völkerbund relativiert oder durch völkerrechtliche Normen begrenzt zu sehen. Das waren höchst ungünstige Voraussetzungen für den Völkerbund.
In den Pariser Vorortverträgen unternahmen die alliierten Siegermächte erstmals den Versuch, Kriegsverbrechen zu verfolgen. Normen des humanitären Völkerrechts hatten sich bereits seit dem 19. Jahrhundert entwickelt, aber die Frage blieb, ob und wie Normverstöße international geahndet werden konnten. Für den internationalen Bedeutungsgewinn des Völkerstrafrechts – so wie es uns heute normativ im Römischen Statut von 1998 und institutionell im 2002 errichteten Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag begegnet – waren die Pariser Friedenskonferenz und ihre Verträge Meilensteine. Die Vorortverträge orientierten sich nicht mehr an der in Europa jahrhundertelang üblichen Amnestiepraxis, die in Friedensverträgen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein mit der »Vergessensklausel« (oblivio perpetua et amnestia) gekoppelt war. An eine solche Praxis war im Zeitalter des »totaler« werdenden Krieges mit seiner Massenpropaganda und Massenmobilisierung nicht mehr zu denken. Aus der während des Krieges in allen kriegführenden Staaten betriebenen öffentlichen Kriminalisierung des Gegners ergab sich nahezu zwangsläufig der Anspruch, den – unterlegenen – Gegner auch strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Vor diesem Hintergrund gewann die Frage nach der Verantwortung für den Krieg, ein Thema seit 1914, noch stärker an Bedeutung. Sie wurde zunächst moralisiert, nicht zuletzt in der Denkfigur der Kriegsschuld, dann auch kriminalisiert. In der Konsequenz sollten die führenden politischen und militärischen Vertreter Deutschlands, bei dem man die Kriegsschuld sah, aber auch die Verantwortung für die Verletzung der belgischen Neutralität (»rape of Belgium«) und die Kriegsgräuel (»German atrocities«) in Belgien und Nordfrankreich, strafrechtlich – völkerstrafrechtlich würde man heute sagen – verfolgt und zur Rechenschaft gezogen werden.
Es lag in der Konsequenz dieses Denkens, dass sich die Siegermächte in Paris gleichsetzten mit »praktisch der gesamten zivilisierten Menschheit« (»practically the whole civilized mankind«) und das Deutsche Reich als einen »verbrecherischen Staat« (»criminal state«) bezeichneten. Den Friedensvertrag betrachteten sie auch als ein Urteil (»judgement«) über Deutschland, das in ihren Augen nicht nur für bestimmte Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden musste, sondern für den Krieg insgesamt, das »größte Verbrechen gegen die Menschheit und gegen die Freiheit der Völker« (»the greatest crime against humanity and the freedom of peoples«). Auf dieser Basis sollten deutsche Soldaten für von ihnen begangene oder verantwortete Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, vor allem aber sollte Kaiser Wilhelm II., ihr Oberster Kriegsherr, als Kriegsverbrecher vor ein alliiertes Tribunal gestellt werden. So sah es Artikel 227 des Versailler Vertrags vor. Zwar kam es nicht dazu, schon weil es den Siegermächten an Geschlossenheit fehlte, doch gibt es eine Verbindung zwischen den Strafbestimmungen im Versailler Vertrag, den völkerstrafrechtlichen Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg – insbesondere den Prozessen von Nürnberg und Tokio – und der weiteren Ausformung des internationalen Strafrechts seither. Umstritten ist freilich bis heute die Frage, ob die Feststellung strafrechtlicher Schuld und der Verzicht auf die Amnestie von Kriegsverbrechern nicht im Widerspruch stehen zu den Zielen einvernehmlicher Kriegsbeendigung und eines stabilen Friedens. Auch das rückt die Pariser Konferenz und den Versailler Vertrag in eine aktuelle Perspektive. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag steht so betrachtet in einer Entwicklungslinie, die 1919 beginnt, während in einer ganzen Reihe jüngerer Friedensabkommen, beispielsweise in den Abkommen von Camp David (1978), Dayton (1995) oder Rambouillet (1999), Schuldfragen ausgeklammert sind.28
Kein Land war 1919 so sehr an der Schaffung internationaler Strukturen und Institutionen interessiert wie die Vereinigten Staaten von Amerika. In der Geschichte des »American Century«, das sich derzeit seinem Ende zuzuneigen scheint, war Paris 1919 ein erster Höhepunkt. Nicht nur mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg 1917, sondern mindestens ebenso sehr mit der Teilnahme an der Friedenskonferenz machten die USA unter ihrem Präsidenten Wilson deutlich, dass sie sich als globale Macht verstanden, dass sie beanspruchten, auf die Neuordnung der Welt bestimmenden Einfluss zu nehmen und diese Neuordnung institutionell und politisch zu garantieren. Dass Wilsons Pläne am Widerstand des amerikanischen Kongresses gegen eine Politik des Internationalismus scheiterten, dass die USA weder dem Völkerbund, dem 1919 die höchste Priorität des Präsidenten galt, beitraten noch die Pariser Friedensverträge unterzeichneten, ändert an diesem Befund nichts. Die USA waren eine globale Macht, und so wurden sie auch wahrgenommen. Viele Beobachter, unter ihnen Carl Schmitt, der sich seit den 1920er Jahren mit dem Versailler System beschäftigte, vertraten die Ansicht, dass die USA in Europa zwar formal und ostentativ abwesend, mittelbar jedoch effektiv und überaus intensiv anwesend gewesen seien.29 Was bedeutete das? Die Vereinigten Staaten standen spätestens seit 1919 für eine neue Form der Hegemonie. Sie lösten nicht einfach Großbritannien als dominierende Weltmacht ab, sondern wurden auf der Grundlage ihres finanziellen Gewichts, ihrer wirtschaftlichen Stärke, aber auch angesichts ihrer »soft power«, ihrer kulturellen Strahlkraft, zu einer Supermacht neuen Typs. Der Erste Weltkrieg hatte darüber hinaus das militärische Potential der USA erkennbar werden lassen. Aus der ökonomischen Dynamik und der politischen Macht dieses mächtigen Landes speisten sich auch die kulturelle Attraktivität und die moralische Autorität Amerikas.
Woodrow Wilson als Präsident der neuen Weltmacht war ohne Zweifel die dominierende Persönlichkeit der Pariser Konferenz. Aber trugen die Friedensverträge deshalb auch seine, eine amerikanische Handschrift? Das wird man bezweifeln können. Und dennoch war die Friedensordnung nach 1919 eine Pax Americana, weil sie als Weltwirtschafts- und Weltfinanzordnung ganz entscheidend von den Interessen Washingtons geprägt war, dessen Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht isolationistisch, sondern internationalistisch war, ökonomisch internationalistisch. Der amerikanische Nationalismus, den Wilson repräsentierte, formte sich im Anspruch auf amerikanische Weltgeltung internationalistisch aus. Nationalismus und Internationalismus widersprachen sich nicht, sondern waren politisch miteinander verflochten. Den Einfluss der USA schmälerte das nicht, er wuchs vielmehr – auch wenn sich das Land dagegen sträubte, seine internationale Führungsrolle anzunehmen –,30 und die kulturelle Wirkungsmacht Amerikas nahm weiter zu. Erst nach 1929, in den Strudeln der Weltwirtschaftskrise, änderte sich das. Denn nun erst begann der Rückzug der USA auf sich selbst. Als kulturelles Modell – Vorbild und Schreckbild – wirkten sie dennoch global weiter. Nach 1945 schlug dann noch einmal – und noch deutlicher als nach 1919 – die Stunde eines liberal-kapitalistischen Internationalismus mit globalem Anspruch unter amerikanischer Führung. Dieser bestimmte die Entwicklung der westlichen Welt in den Jahrzehnten des Kalten Krieges, aus dem weniger der Westen insgesamt als vielmehr die USA 1990 als Sieger hervorgingen. Ungleich stärker als 1945 befanden sich die Vereinigten Staaten als einzig verbliebene Weltmacht mit ihrem politischen Gewicht, ihrer ökonomischen Stärke, ihrer kulturellen Kraft und ihrer enormen militärischen Macht währen der Jahrzehnte nach 1945 in einer Situation, die derjenigen nach 1918 ähnelte. Von einer neuen Weltordnung unter amerikanischer Führung war nach 1990 nicht nur in den USA die Rede. Machtpotential und Dominanzanspruch der USA lassen die Situationen nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ende des Kalten Krieges vergleichbar erscheinen.
Heute spricht kaum noch jemand von einem – neuen – »American Century«. Stattdessen formt sich eine multipolare Ordnung, und wir erleben den Aufstieg Chinas zu einer globalen Macht. Zudem setzte mit der Präsidentschaft Donald Trumps eine zumindest temporäre Abkehr der USA von ihrem Internationalismus ein, eine Politik der Renationalisierung und des Rückzugs auf sich selbst. Dazu gehört über einen neuen Protektionismus hinaus die Abwendung von einem regelbasierten Multilateralismus, ja dessen bewusste Zerstörung. Das lenkt den Blick zurück auf die 1920er und vor allem die 1930er Jahre, auf die Dynamiken eines internationalen Systems, das ausschließlich auf nationalen Eigeninteressen und deren Durchsetzung beruhte. Was waren die Voraussetzungen der sich nach 1918 entfaltenden amerikanischen Hegemonie, was ihre Bedingungen? Gibt es Hegemonie unter den Bedingungen von Isolationismus? Der amerikanische Isolationismus seit 1929 basierte auf der ökonomischen Stärke der USA und auf der ungebrochenen Anziehungskraft ihres liberal-kapitalistischen Gesellschaftsmodells, das in den folgenden Jahren und Jahrzehnten seine Überlegenheit über alternative Modelle bewies. Das Modell des Faschismus beziehungsweise Nationalsozialismus diskreditierte sich selbst und konnte spätestens 1945 als überwunden gelten. Der Kommunismus sowjetischer Prägung überdauerte zwar das Jahr 1945, konnte sich aber in der Systemauseinandersetzung des Kalten Kriegs nicht behaupten. Auch aus dieser Perspektive lohnt – gleichsam vom Ende des »amerikanischen Jahrhunderts« – der Blick zurück auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als dieses Jahrhundert zwar nicht begann, aber in seine formative Phase eintrat.
Im Jahr 1937 – aus der Nachkriegszeit war längst wieder eine Vorkriegszeit geworden – erhielt der Streifen La Grande Illusion (Die große Illusion) auf dem Filmfestival von Venedig den Preis für die beste künstlerische Gesamtleistung. Der Film des französischen Regisseurs Jean Renoir, Sohn des Malers Auguste Renoir, spielt im Ersten Weltkrieg und erzählt die Geschichte des Ausbruchs zweier französischer Soldaten aus deutscher Kriegsgefangenschaft. In dem pazifistischen Werk werden die Gewalterfahrung und der nationale Hass des Krieges dargestellt, und dies ohne eine einzige Schlachtfeldszene. Zugleich zeichnet er in dem Gefangenenlager eine kleine Welt des Friedens und des europäischen Miteinanders. Nicht wenige Interpreten meinen, in dem Film die Geschichte Europas und ganz besonders der deutsch-französischen Beziehungen zu erkennen, eine Geschichte zwischen dem Traum von Gemeinschaft und Versöhnung und dem Alptraum von Krieg und Gewalt. Mitten im Krieg verbindet die Protagonisten des Films die Hoffnung auf Frieden und auf eine Überwindung nationaler Gegensätze. War das – erst recht aus der Perspektive des Jahres 1937 – die große Illusion, die dem Film, der in Deutschland verboten wurde, den Titel gab? Diesen Titel entlieh Jean Renoir vermutlich dem 1910 veröffentlichten Buch The Great Illusion des englischen Publizisten Norman Angell, der für sein Werk 1933 den Friedensnobelpreis erhielt.
Angell, der nach dem Ersten Weltkrieg als Abgeordneter der Labour Party im britischen Unterhaus saß, glaubte nicht daran, dass Rüstung und Krieg zur Steigerung des – nationalen – Wohlstands beitragen würden, sondern betrachtete den Krieg in Zeiten einer immer stärkeren Verflechtung der nationalen Volkswirtschaften als ökonomisch kontraproduktiv. Gegen den sozialdarwinistischen Zeitgeist vertrat er den Standpunkt, »dass die kriegerischen Völker nicht zur Weltherrschaft berufen sind, dass der Krieg das Überleben des Geeignetsten oder Tapferen nicht bewirkt, dass der Kampf unter den Völkern keinen Bestandteil des Entwicklungsgesetzes des menschlichen Fortschritts bildet«. Angell träumte »vom Schwinden der Rivalität unter den Staaten«.31 Von Angells Buch wurden mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft, und es wurde in 25 Sprachen übersetzt. In Deutschland erschien es 1910 unter dem Titel Die große Täuschung und im folgenden Jahr in einer weiteren Übersetzung unter dem Titel Die falsche Rechnung. Was bringt der Krieg ein?.32
Die globale wirtschaftliche Verflechtung hat den Ersten Weltkrieg nicht verhindert, vielmehr hat der Krieg der ersten Phase der Globalisierung ein Ende gesetzt. Dass ein allgemeiner Krieg zwischen den europäischen Mächten undenkbar sei, hat sechzig Jahre nach Norman Angell der amerikanische Historiker Oron Hale in einem Buch, das Angells Titel aufnahm, als die »große Illusion« der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bezeichnet.33 Nationale Machtstaatsambitionen siegten über internationales Wirtschafts- und Handelswachstum und die damit verbundenen Prosperitätsaussichten – für jede einzelne Volkswirtschaft, aber auch für alle zusammen. Woodrow Wilson wollte zurück zu einer globalen Verflechtung, die allen Chancen bot, als er am 8. Januar 1918 vor beiden Häusern des amerikanischen Kongresses seine Vierzehn Punkte vorstellte. In diesen formulierte der Präsident nicht nur die Kriegsziele der Vereinigten Staaten, die am 6. April 1917 in den Krieg eingetreten waren, sondern entwickelte auch die Grundzüge einer neuen Weltordnung, in der – unter amerikanischer Führung und stabilisiert durch ein Netzwerk internationaler Institutionen – weitere Kriege ausgeschlossen sein sollten. Ganz entscheidend war dabei nach seiner Ansicht die immer engere und intensivere wirtschaftliche Verflechtung der Staaten. Insbesondere in Europa sollten die nationalen Volkswirtschaften stärker als je zuvor miteinander verbunden werden, damit Wirtschaftswachstum und Wohlstand gesteigert und Kriege künftig verhindert wurden. Dass von stabilen und miteinander verflochtenen europäischen Märkten auch die USA profitieren würden, gehörte bei der Vorstellung der Vierzehn Punkte zu den unausgesprochenen Grundannahmen Wilsons und seines liberalen Internationalismus.
Ganz im Sinne von Norman Angell, der die Annahme, Kriege würden irgendeiner Seite einen Vorteil bringen, auch rechnerisch für falsch hielt, für eine Illusion und damit für eine Täuschung, hat fast hundert Jahre später der britische Historiker Niall Ferguson in seinem Buch über den Ersten Weltkrieg von einem »falschen Krieg« gesprochen und insbesondere im Hinblick auf die britische Politik und Kriegführung von einem »Krieg der Illusionen«.34 Wie Angell stützte sich Ferguson nicht auf Argumente eines moralisch begründeten Pazifismus, von dem sich Angell expressis verbis distanzierte, sondern auf Kategorien wie nationales Interesse und ökonomischer Nutzen. Im ersten Satz der deutschen Ausgabe von Angells The Great Illusion liest man, sein Buch sei eine »Studie über Realpolitik«.35 Und Ferguson argumentiert – anders als Angell freilich in der Retrospektive: Wäre der Erste Weltkrieg nicht ausgefochten worden, dann wäre die Konsequenz »schlimmstenfalls so etwas wie ein erster kalter Krieg« gewesen, in dem die Großmächte weiterhin große Streitkräfte unterhalten hätten, ohne jedoch ihr eigenes nachhaltiges ökonomisches Wachstum zu gefährden.36
Illusionen indes sind mehr als Täuschungen, mehr als falsche Rechnungen. Illusionen sind auch Vorstellungen – Vorstellungen, die sich zwar nicht realisieren lassen, die aber dennoch handlungsbestimmend sein können; Illusionen sind Hoffnungen – Hoffnungen, die sich zerschlagen, aber dennoch eine historische Bedeutung haben; Illusionen sind Erwartungen – Erwartungen, die sich am Ende nicht erfüllen, aber gleichwohl historisch wirksam sind. Darum hat Fritz Fischer 1969 seinem Buch über die deutsche Politik vor 1914 den Titel Krieg der Illusionen gegeben. Illusionen, das sind bei ihm die Vorstellungen der deutschen Eliten, durch einen Krieg nicht nur zur Weltmacht zu werden – das war das wilhelminische Deutschland längst –, sondern im Kampf mit England die Weltherrschaft zu erlangen und dadurch zugleich das Kaiserreich in eine autoritäre Militärmonarchie zu transformieren.37 Von einer großen Illusion hat fast fünf Jahrzehnte nach Fischer auch der französische Historiker Georges Soutou mit Blick auf die französischen Kriegs- und Friedensziele gesprochen.38 Als Vorstellungen, Hoffnungen und Erwartungen sind Illusionen immer auf die Zukunft gerichtet, gespeist nicht zuletzt von der Überzeugung, der Mensch könne diese selbst gestalten, ja er könne eine bessere Zukunft schaffen. Auch wenn man diese Hoffnungen und Erwartungen als Illusionen betrachtet, sind solche Illusionen doch mächtige Triebkräfte menschlichen Handelns und wirken auf die Wirklichkeit ein, und selbst die Desillusionierung, die Ent-Täuschung, erzeugt neue Wirklichkeit.
Paris war im Jahr 1919 der Ort einer großen Illusion. Es war die Illusion, nach viereinhalb Jahren eines schrecklichen Krieges, in dem Millionen Menschen ihr Leben gelassen hatten und der weitere Millionen verwundet an Leib und Seele zurückließ, endlich Frieden schaffen zu können, dauerhaften Frieden. Warum blieb das eine Illusion? Warum gelang es in Paris nicht, aus Hass, Gewalt und Zerstörung Versöhnung und Frieden zu schaffen?
Eine erste Antwort liegt in der Erfahrung des Krieges selbst. Es war das eine, aus den Grauen des Krieges abstrakt und theoretisch den Imperativ des Friedens zu entwickeln. Kriegsmüdigkeit, Erschöpfung und unermessliches Leid ließen die Menschen, Soldaten wie Zivilisten, je länger der Krieg dauerte, desto stärker sein Ende herbeisehnen. Aber es war etwas anderes, auf diesen Erfahrungen und Sehnsüchten einen Frieden zu errichten, der mehr war als ein Waffenstillstand, mehr als ein Ende der Kampfhandlungen. Wie sollte angesichts dieser Dimensionen von Gewalt und Leid echte Versöhnung möglich sein? Wie sollte man aus dem Krieg herauskommen, nicht nur die Waffen zum Schweigen bringen, sondern den mentalen Kriegszustand beenden? Solche Frageperspektiven weisen weit über 1918/19 hinaus und zielen letztlich auf das universalhistorische Problem des Übergangs vom Krieg zum Frieden.39 Diese Frage stellte sich nicht nur, aber doch in ganz besonderer Weise für Frankreich und Deutschland, für Franzosen und Deutsche.
Die »gueules cassées« im Spiegelsaal von Versailles, sie standen nicht für Versöhnung. Sie sollten es nicht und sie konnten es auch nicht. In den nationalen Gesellschaften, in denen über Jahre hinweg systematisch der Hass auf den Kriegsgegner geschürt worden war, bei den Mittelmächten ebenso wie auf Seiten der Entente, blieb Versöhnung noch über viele Jahre eine Illusion. Nicht die Stunde der Versöhnung war 1918 gekommen, sondern die Stunde der Rache, nach der die aufgepeitschten Öffentlichkeiten in den Siegerstaaten nun verlangten. Und die Besiegten? Sie hätten sich, wären sie die Sieger gewesen, nicht anders verhalten. In den Forderungen der Siegerseite vermochten sie nichts anderes zu erkennen als eine Fortsetzung und Bestätigung hasserfüllter Feindschaft – Erbfeindschaft, wie es im deutsch-französischen Kontext hieß. Vom »Vernichtungsfrieden« sprach 1919 selbst der Pazifist Kurt Tucholsky und warnte vor einem neuen Krieg »nach abermals zwanzig Jahren«.40
Vor diesem Hintergrund sollten 1918, als sich das Ende des Krieges abzeichnete, aus Kriegszielen Friedensziele werden. Auf allen Seiten, bei Siegern und Verlierern gleichermaßen, erwuchsen aus all dem Leid der Kriegsjahre unerfüllbare Hoffnungen und Erwartungen – Illusionen. Auf diese folgten überall – nicht nur auf deutscher Seite – bald Desillusionierungen. So konnte kein Friede entstehen. Die Monate der Pariser Konferenz und der Aushandlung der Friedensverträge waren eine Zeit der Enttäuschungen. Bittere Enttäuschung bestimmte die Wahrnehmung des Friedensschlusses, dem die Verlierer Legitimität und Gerechtigkeit absprachen und der bei den Siegern mehr als nur Unzufriedenheit hervorrief. Dass Paris eine »Tragödie der Enttäuschung« werden könnte, hatte Präsident Wilson schon vor Beginn der Konferenz befürchtet.41
Unzufriedenheit und Enttäuschung über das in Paris Erreichte charakterisierten aber auch die Wahrnehmung der Versailler Ordnung in den 1920er und 1930er Jahren. Der Revisionismus blieb angesichts dessen nicht auf Deutschland und seine ehemaligen Verbündeten beschränkt. Der deutsche Revisionismus wurde geradezu geschürt durch die kaum verhohlene Unzufriedenheit der Alliierten und insbesondere der alliierten Experten, der Pariser Beraterstäbe, die – weit über John Maynard Keynes hinaus – den Friedensschluss kritisierten. Die Kritiker, die bald tonangebend wurden, hielten den Frieden nicht primär für zu hart oder zu mild, sondern schlicht für falsch, weil dieser Frieden den nächsten Krieg nicht verhindern, sondern ihn wahrscheinlicher, wenn nicht unausweichlich werden ließ. Bis ins späte 20. Jahrhundert spiegelt sich diese Unzufriedenheit gerade der Experten und Berater, die in vielen Fällen zu wichtigen Stichwortgebern der Historiker wurden, in der Geschichtsschreibung zu 1919. Einig war man sich in der Einschätzung, dass der Frieden von 1919 entscheidend zum Aufstieg des Nationalsozialismus und zur Entfesselung des Zweiten Weltkriegs beigetragen habe, was die einen eben darauf zurückführten, dass er zu mild, die anderen, dass er zu hart gewesen sei.
Von solchen Interpretationen hat sich die Geschichtsschreibung in jüngerer Zeit gelöst,42





























