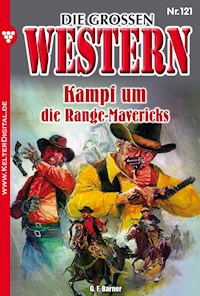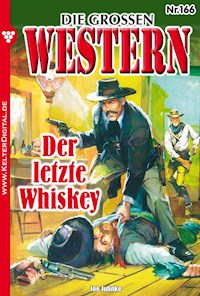Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Eine buntgewürfelte Gesellschaft hockt um das helllodernde Lagerfeuer. McCardey und seine Renegaten. Es sind raue Burschen, die Mac um sich versammelt hat. Männer, die den Tod vom Krieg her gut kannten und mit ihm auf Du und Du standen, Männer, die mit ihrem Blute die Heimat verteidigten. Unbeugsam im Willen und stolz, so wie es nur ein sein Land liebender Texaner sein kann. Sie leben hier freiwillig in der Verbannung, weil ihnen die Freiheit über alles geht, weil sie sich dem siegreichen Yankee nicht beugen wollen. Sie leben als Freiwild in den Bergen, sie hausen wie wilde Tiere in Grotten und Höhlen oder im Freien, und sie holen sich das von ihren Feinden, was eben ihr primitives Leben zur Erhaltung desselben verlangt. Da ist einmal McCardey, ihr Anführer. Ein wahrer Recke von Gestalt, groß und mächtig wie eine Eiche, hart im Nehmen wie im Geben. Da ist weiter Con Brodders. Vierschrötig und stark wie ein Bulle. Noch größer als Mac. Sehnige Strähnen an Hals und Nacken, raue und tellergroße Pranken und gewaltige Bizepse zeigen die Kraft seines Körpers. Con war ein strebsamer und fleißiger Farmer, ehe der Krieg über das Land zog. Er besaß ein kleines Anwesen am Pecos River, doch als er dann endlich wieder nach Hause kam, waren die Weiden leer, das Farmhaus niedergebrannt, sein Weib tot und sein Grund und Boden enteignet. Plündernde Yankees hatten alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war, und das Wenige, das ihm dann noch verblieb, nahm der Staat. Seit dieser Zeit hasst Con Brodders jeden Blaurock, jeden
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 119 –
Wolfszeit
Joe Juhnke
Eine buntgewürfelte Gesellschaft hockt um das helllodernde Lagerfeuer.
McCardey und seine Renegaten.
Es sind raue Burschen, die Mac um sich versammelt hat. Männer, die den Tod vom Krieg her gut kannten und mit ihm auf Du und Du standen, Männer, die mit ihrem Blute die Heimat verteidigten. Unbeugsam im Willen und stolz, so wie es nur ein sein Land liebender Texaner sein kann.
Sie leben hier freiwillig in der Verbannung, weil ihnen die Freiheit über alles geht, weil sie sich dem siegreichen Yankee nicht beugen wollen.
Sie leben als Freiwild in den Bergen, sie hausen wie wilde Tiere in Grotten und Höhlen oder im Freien, und sie holen sich das von ihren Feinden, was eben ihr primitives Leben zur Erhaltung desselben verlangt.
Da ist einmal McCardey, ihr Anführer. Ein wahrer Recke von Gestalt, groß und mächtig wie eine Eiche, hart im Nehmen wie im Geben.
Da ist weiter Con Brodders. Vierschrötig und stark wie ein Bulle. Noch größer als Mac. Sehnige Strähnen an Hals und Nacken, raue und tellergroße Pranken und gewaltige Bizepse zeigen die Kraft seines Körpers. Con war ein strebsamer und fleißiger Farmer, ehe der Krieg über das Land zog. Er besaß ein kleines Anwesen am Pecos River, doch als er dann endlich wieder nach Hause kam, waren die Weiden leer, das Farmhaus niedergebrannt, sein Weib tot und sein Grund und Boden enteignet. Plündernde Yankees hatten alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war, und das Wenige, das ihm dann noch verblieb, nahm der Staat. Seit dieser Zeit hasst Con Brodders jeden Blaurock, jeden Menschen, der aus dem Norden kommt. Er ist blindwütig in seinem Hass, und würde McCardey ihn nicht mitunter zurechtstauchen, er würde zum Verbrecher, wie Hellfots oder Big Grants Horde. Ja, Con ist schon der gefährlichste unter ihnen allen. Sein Schießeisen sitzt locker wie der Yankeedollar in den Spielsälen von El Paso oder Sterling City, und seine Schusshand ist schnell und unberechenbar, genau wie Brodders’ gefürchteter Jähzorn.
Brodders stand lange Jahre unter McCardeys Kommando, und nur diesem Umstand und seiner damaligen guten Führung verdankt er es, dass McCardey ihn nicht schon längst aus dem Lager gewiesen hatte.
Die beiden vertreten ganz verschiedene Ansichten, und ihr unerbittlicher Kampf wird aus verschiedenen Motiven und Idealen geführt.
»Nur ein toter Yankee ist ein guter Yankee«, ist Brodders’ ständiger Leitspruch, doch sein Boss sagt, dass man die Yankees auch treffen kann, ohne sie zu töten.
Dann findet man im Lager noch Terry und Fred Bowie, Zwillingsbrüder, blutjunge Burschen, die der Krieg verrohen ließ, weil sie sich mit sechzehn Jahren bereits als vollwertige Männer fühlten und weil sie nur unter den Großen lebten und von ihnen wohl viel Gutes und Nützliches, aber doch noch mehr Verderbliches und Schlechtes lernten. Sie hält die Abenteuerlust mehr als der Wille, der unterdrückten Heimat nützlich zu sein. Sie haben nicht mehr Verstand als ein Erdfloh, aber große Klappen, genau wie die Alten. Sie hoffen, dass McCardeys strenges Regime sich eines Tages lockern werde, damit auch ihre Taschen sich mit den guten Yankeedollars füllen würden.
Den gleichen Gedanken haben wohl auch Cris Zaragos, Sam Julimes und Horon Juliett. Ihre ursprünglichen Ideale, dem Vaterland zu dienen, sind, wie die Zeit, dahingegangen. Ihre Gedanken wurden von Helliots Mannschaft total verseucht, die zwar unter dem Deckmantel der Vaterlandsliebe die Besatzungsmacht dauernd schädigen und schikanieren, sich aber keinen Deut um die Not der Bevölkerung kümmern, sondern in ihren Verstecken große, ausschweifende Feste feiern, sich im Übrigen aber auch ganz wie ausgesprochene Banditen benehmen.
McCardey sieht Helliots und Grants Leute nicht gerne in seinem Lager, doch kann er ihnen den Zutritt auch nicht verbieten. Und seine Leute sind auch beileibe nicht diejenigen, die sich ihren Verkehr verbieten lassen.
Mac kennt sie doch alle aus den Kriegstagen.
Brodders war ein ordentlicher Mensch, die Brüder Bowie waren zwar leichtsinnige Burschen, doch immer gute Kameraden und mit etwas Geschick leicht zu lenken. In letzter Zeit sind sie aber recht starrköpfig geworden und übergehen einfach seine Befehle. Der einzige, auf den noch unbedingter Verlass ist, dürfte Coro sein. Coro bescherte ihnen der reine Zufall. Er war ein umherziehender Landstreicher, der plötzlich in das Lager schlidderte, dem es dann hier gefiel und den man zum Küchenchef machte, weil man eben einen Koch brauchte.
Coro steht treu zu McCardey, und er hört so manches, was dem Boss verborgen bleibt.
Die Beute des heutigen Tages, Sold für Fort Stockton, liegt McCardey zu Füßen. Es ist ein ganz ansehnlicher Berg in guten amerikanischen Dollars. Sie könnten so manches Männerherz schneller schlagen lassen, well, sie könnten es, wenn nicht gerade der ehemalige Leutnant McCardey sie zwischen seinen Beinen liegen hätte.
Vor Mac haben sie alle immer noch einen Heidenrespekt, doch hat Mac leider eine andere Einstellung wie sie alle. Sie wüssten schon, was sie mit dem Geld anfangen könnten. Mac natürlich auch, nur liegt hier der Unterschied darin, dass sie die schönen Dollars gerne in die eigenen Taschen stecken möchten und Mac sie unter die notleidende Bevölkerung verteilt.
Und ganz augenscheinlich, man sieht es an den ständig finsterer werdenden Mienen der Burschen und dem zusehends abnehmenden Geldberg, kommt es so, dass Mac mal wieder alles aufteilt.
»Brints vierhundert, Gallegos sechshundert, Carizzo tausend. Carizzo mit den Steuern am weitesten zurück. Hast du, Con?« Der Sprecher, es ist McCardey, blickt fragend über das Feuer hinweg zu Brodders hin, der den Schriftführer macht.
Brodders nickt mit finsterer Miene und wiederholt halblaut : »Carizzo siebenhundert …«
»Tausend sagte ich«, korrigiert der Anführer.
»Höre, Mac«, Brodders spricht langsam und bedächtig und legt mit Nachdruck das Buch auf den Boden, »wir holen das verflucht heiße Eisen aus dem Feuer und verschenken es dann mit großzügiger Geste an Carizzo, an Gallegos, an die Brints und an all die vielen anderen. Damned«, seine Stimme steigert sich nun um einige Oktaven, »und wir vergessen uns dabei selber. Warum machen wir nicht mal einen Coup nur für uns? Weshalb immer alles für die anderen? Sind wir vielleicht weniger als sie? Haben wir etwa weniger verloren als sie? Sind wir nur Dreck?«
»Carizzo erhält tausend, ich weiß genau, dass er sie dringend braucht!« McCardeys Augen sinken in die Lichter des anderen. Es ist ein stummes Messen der Kräfte.
»Wir brauchen sie aber auch«, stößt Terry Bowie nach.
»Wofür?«, schießt der ehemalige Leutnant zurück, »damit du dich vielleicht in Longfellow oder Alpine besaufen kannst und man dich anschließend hängt?«
»Ho, so schnell lasse ich mich schon nicht erwischen.«
»Ich dachte immer, du magst kein Yankeegeld?«
»Es stinkt doch nicht«, sagt Terry Bowie patzig, »wenigstens nicht mehr, seit ich weiß, wie Grants Männer davon leben und es sich gut sein lassen.«
McCardey läuft rot an, aber er unterdrückt seinen Zorn und hält mit einer dieser frechen Antwort angepassten Entgegnung mühsam zurück.
»Freunde«, beginnt er, mühsam beherrscht, »als der Krieg zu Ende ging und unser Land von den Yankees überschwemmt wurde, waren wir alle einer Meinung. Wir wollten den verfluchten Nordstaatlern den Geschmack an unserer Heimat verderben, wir wollten ihnen zeigen, dass wir noch lange nicht geschlagen sind. Wir schlossen uns zusammen, um für die Freiheit unseres Landes zu kämpfen. Das war unsere ehrliche Losung. Nun aber bringt ihr hier ein Anliegen vor, das euer unwürdig ist. Wir sind alle verdiente Soldaten, wollen wir uns denn mit Banditen auf dieselbe Stufe stellen?«
»Sind wir denn vielleicht etwas anderes, als Banditengesindel oder Straßenräuber?«, fragt Zaragos, und ein verstecktes Lauern liegt in seinen Augen, »ist es denn nicht bereits heute schon so weit, dass unsere eigenen Landsleute wegen der hundert Dollar Blutgeld, die sie auf unsere Köpfe setzen, uns wie die Karnickel jagen und nach dem Leben trachten?«
»Das sind eben Verräter, und sie betrachte ich auch nicht als Brüder«, erwidert McCardey mit scharfer Stimme. »Wir haben freiwillig und ohne jeden Zwang unsere eigenen Wege bestimmt, und es steht auch jedem frei, diese Gemeinschaft zu verlassen.« McCardeys Augen wandern reihum. Sie ruhen fragend und abschätzend zugleich auf jedem einzelnen Gesicht, so, als wolle er ergründen, welche Gedanken die Kameraden bewegen.
»Du weißt, dass wir nicht zurückkönnen«, knurrt Con Brodders finster, »ebenso wenig wie Grant und Helliot. Wir sind nun einmal von der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen und gelten als Mörder und Banditen. Weshalb lassen wir unsere lächerliche Heldenpose nicht fallen und benehmen uns so wie die, als die man uns gebrandmarkt hat? Wir könnten ja die Siedler ruhig mit kleinen Spenden unterstützen, aber wir brauchten doch nicht gleich die gesamte Beute abzugeben. Grant tut das nicht, und Helliot hält ebenfalls recht wenig davon.«
»Mit diesen Männern stelle ich mich auch nicht auf ein und dieselbe Stufe.«
»Und dennoch nanntest du sie einmal deine Kameraden. Kämpftest du nicht Seite an Seite mit ihnen? Trugen sie nicht die gleichen Auszeichnungen wie du, opferten sie nicht auch ihr Blut für die gleiche Sache wie wir alle? Damned ja, sie taten es, und als sie dann schließlich erkennen mussten, dass es keinen Zweck hatte, schwenkten sie um. Sie schädigen die Yankeearmee, aber sie nützen keinem Südstaatler. Sie leben auf großem Fuß und lassen es sich gut gehen und haben unter unseren Landsleuten nicht mehr Feinde als wir. Ich sehe in unserem ganzen Verhalten keinen Sinn und Zweck mehr, Mac.«
»So sprichst du? Ausgerechnet du, der du Haus, Hof und Weib verloren hast?« Nur ein leichter Vorwurf klingt aus McCardeys Stimme, aber er lässt Brodders doch zusammenzucken. Noch finsterer wird sein Gesicht. Wortlos ergreift er das Buch.
Unhörbar atmet McCardey auf. Er hat wieder einmal einen Sieg über die eigenen Kameraden errungen, aber es befriedigt ihn absolut nicht. Die Wünsche seiner Freunde sind eines ehemaligen Soldaten unwürdig. Er ist nun einmal kein Mörder, kein Plünderer, er kämpft nur für die gute Sache. Doch die Kameraden scheinen sich immer mehr davon zu entfernen.
Mit monotoner Stimme spricht McCardey, während Brodders schweigend die Aufzeichnungen macht. Nach einer halben Stunde endlich erhebt sich der Boss. Er wirft das Geld Brodders vor die Füße. Er will endgültig wissen, woran er mit seinem Vertrauen ist, er will erfahren, wie weit Brodders bereits im Banne des Geldes steht. Es soll eine große Prüfung werden, die einzige und letzte vielleicht.
»Nimm es an dich«, sagt er halblaut, »und hebe es auf, bis Mary kommt«, dann wendet er sich schweigend ab und stampft in die Nacht hinaus.
*
Ein Schatten wächst neben McCardeys Lager auf. Er wirkt groß und übernatürlich verzerrt an der rauen Felswand, er wirkt wie ein fremdes, übernatürliches Wesen in dem schwachen Schein des kleinen Feuers, das der Höhle die Feuchtigkeit nehmen soll. Mac hat die Angewohnheit mit dem Schießeisen sein Bett zu teilen. Dieses liegt nun in seiner Rechten, und der Lauf deutet unter der Decke auf die Gestalt, die sich zur nächtlichen Stunde seinem Lager nähert.
»Mac«, flüstert die Stimme. Sie gehört dem jungen Terry Bowie.
Eine Hand berührt nun seine Schulter. »Was willst du?«, fragt McCardey, ohne sich zu rühren. Auch er spricht ganz unwillkürlich mit gedämpfter Stimme.
»Ich möchte dich gerne sprechen«, sagt Terry, und es liegt Demut und auch leichte Verzweiflung in seiner Stimme, die den Blonden aufmerksam aufhorchen lässt.
McCardey vergisst die kleine Auseinandersetzung vom vergangenen Abend, er vergisst sogar seinen eigenen Trotz. Langsam richtet er sich auf.
»Nun schieß schon los, Kleiner, und sage, wo dich der Schuh drückt.«
»Ich weiß nicht«, flüstert Terry ganz verlegen und setzt sich auf den Rand des Lagers, »ich habe so ein dummes, bedrückendes Gefühl, mein Bruder ist noch nicht zurück.«
»Nicht?«
»Nein, er müsste eigentlich schon längst hier sein, Mac, oder meinst du nicht?«
»Nun, vielleicht hat er etwas Wichtiges entdeckt, was ihn länger aufgehalten hat.«
»Vielleicht haben ihn die Yankees erwischt.« Unruhig rutscht der Jüngling auf den Decken hin und her. Er ist nervös, und sein ganzes Wesen zeigt, dass er beunruhigt ist. Der Blonde nagt überlegend an der Oberlippe. In seine Augen tritt wachsende Besorgnis. Fred Bowie ließ er am vergangenen Nachmittag als Späher im Pleyer hoon Hill Canyon zurück. Seine Aufgabe bestand darin, die Yankeegruppe zu beobachten und dann unverzüglich ins Lager zurückzukehren. Es ist kein allzuweiter Weg von der Überfallstelle bis zum Lager. Der Bursche müsste also schon längst hier sein.
»Wie spät ist es denn eigentlich, Terry?«, fragt McCardey und schält sich dabei vollends aus seinen Decken.
»Der Mond bestrahlt gerade den Gipfel des Hippag Peak. Mitternacht ist also vorüber. Was gedenkst du zu tun?«
»Ich reite zur Schlucht. Sattle mein Pferd.« McCardey ist sehr unruhig geworden, und dieser Unruhe entspringt seine plötzliche Entschlossenheit. Er ist nun einmal der Führer dieser Guerillaeinheit, und ihm obliegt das Wohl und Wehe seiner Untergebenen.
»Du willst allein reiten?«
»Yes!«
»Es ist aber sehr gefährlich, Mac. Sicher wimmelt es draußen voller Yankees.«
»Gerade deshalb reite ich ja auch allein. Sattle schon meinen Braunen.«
*
Sie ist schlank wie eine Tanne, biegsam wie eine Gerte, flink in ihren Bewegungen und hübsch wie eine Frühlingsblume. Sie nennt sich Mary Morton und ist seit drei Jahren McCardeys Braut. Daran ändert weder der Krieg noch die entbehrungsreiche Nachkriegszeit etwas. Sie steht treu zu dem Mann, den sie liebt, sie achtet den Mann, den andere verachten, und sie trägt das Schandmal, das die Yankees Mac anhängten, mit Würde und Stolz.
Es ist schon spat am Mittag, als Mary das Lager in den Pyote Range erreicht. Ein recht beschwerlicher Weg durch die Postenkette und Patrouillen liegt hinter ihr. Und die musste sie alle abschütteln, musste ihre ganze Kraft und weibliche Schläue anwenden, um die Yankees nicht stutzig zu machen und unangefochten das Lager zu erreichen.
Um ihre wunderbaren rehbraunen Augen liegen dunkle Schatten, als sie endlich in das Lager einreitet.
Mary kommt aus Fort Stockton und bringt schlechte Nachrichten. Verdammt schlechte.
Sie findet Mac bei den Pferden, wo er gerade dabei ist, seinen Braunen trockenzureiben.
Sie springt dicht vor ihm aus dem Sattel und fällt ihm zur Begrüßung um den Hals.
»Mary«, sagt McCardey nach der stürmischen Begrüßung vorwurfsvoll, »wie konntest du es denn bloß wagen?«
»Ach, Mac«, lacht die Frau glücklich, und einen Augenblick die brennenden Sorgen vergessend, »für eine Frau ist es doch nicht allzuschwer, die Yankees zu täuschen. Sie sind doch dumm und stupide wie alte Mulis. Ich habe keine Angst vor ihnen.«
»Du hättest aber besser einige Tage warten sollen. In Fort Stockton ist doch sicher der Teufel los. Ich war heute Nacht draußen, um den kleinen Fred Bowie zu suchen.«
»Du hast das Lager verlassen?« Deutlich spiegelt sich die Angst in ihren samtbraunen Augen wider. »Ja, die ganze Garnison ist auf den Beinen. Der Teufel ist los in diesem Bezirk. Als Leutnant Winter mit der Hiobsbotschaft ins Fort einritt, schäumte Oberst Brenden vor Wut. Er alarmierte die ganze Garnison. Es sind über achthundert Mann, die dich und deine Leute suchen.«
»So, also der gute Fred Winter war’s, der das Kommando diesmal führte«, McCardey lacht auf. Diese Botschaft Marys scheint ihn weniger zu berühren. »Ja, ja, der gute Fred«, wiederholt er noch einmal. »Wir trafen uns während des Krieges zweimal. Einmal bei Bell Run und dann in Fredericksburg. Zweimal brachte er mir eine ordentliche Schlappe bei. Hahahaha, und nun, ausgerechnet nach dem Krieg, wo er als Sieger in unserem Land lebt, erleidet er von mir die erste Schlappe.«
»Leutnant Winter ist aber doch kein übler Kerl«, sagt Mary Morton schnell.
»Nanu!« Mac blickt ganz erstaunt zu seiner Braut hin. »Magst du ihn vielleicht?«
»Genau wie jeden Yankee«, erwidert Mary ziemlich patzig, denn ihr ist ein gewisser Unterton in Macs Stimme nicht entgangen, »wie jeder Yankee, mit dem ich notgedrungen verkehren muss.«
McCardey scheint durch diese Antwort beruhigt. Er lächelt wieder und legt Mary die Hand auf die Schulter. »Und Colonel Brenden, dieser Menschenhasser, hat wohl vor Wut geschäumt?«
»Er spuckte Gift und Galle. Er sagte, jeden, den er von euch erwischt, wird er als abschreckendes Beispiel acht Tage an der Eiche auf dem Marktplatz hängen. Mit Fred Bowie will er den Anfang machen.«
Macs Antlitz erstarrt zu einer verzerrten Maske, in der nur die hasserfüllten Augen zu leben scheinen. Seine Faust umschließt wie in einem Krampf Marys Schulter. »Sie haben Fred erwischt?«, flüstert er, nun völlig grau im Gesicht, obwohl er Ähnliches längst vermutet hat.
»Ja, der Trapper Hubalek brachte ihn.
Ich dachte, au, Mac, du tust mir ja weh«, stammelt Mary schmerzvoll und blickt erschreckt in das verzerrte Antlitz des geliebten Mannes.
»Was dachtest du?«, fragt McCardey, und er scheint gar nicht zu bemerken, welchen Schmerz er Mary zufügt, »dass wir vielleicht einen Kameraden im Stich lassen würden? Damned, wir holen Fred, wir holen ihn, und wenn er schon hängen sollte, hängen wir Colonel Brenden neben ihn.«
*
Die Nacht ist aufgezogen und hat allmählich die Zelle mit Finsternis erfüllt.
Schnellgericht der Amerikanischen Union. Fred Bowie lacht hart auf, während er mit kurzen Schritten die Gefängniszelle durchquert.
Ja, es war wirklich ein Schnellgericht, das ihn zum Tode verurteilte.
Ein Mann war Ankläger und Richter zugleich. Durch seine Person wurden die amerikanischen Gesetze vertreten, und es dauerte das Ganze keine zehn Minuten.
»Tod durch den Strang«, sagte der Menschenhasser Colonel Brenden, und in seinen kalten Augen leuchtete begierliche Lust am Töten.
Er wendet sich um, da sieht er einen Mann, der unbemerkt seine Zelle betreten hat und breitbeinig auf seiner Pritsche hockt.
Es ist ein kleiner, drahtiger Bursche mit welker Haut und listigen Augen. Er trägt keine Yankeeuniform und ist doch einer der ihren. Hub nennen sie ihn. Andere sagen wieder Hubalek. Er ist der Mann, der ihn im Pleyer hoon Hill Canyon erwischte, als er sich allzu intensiv mit dem Abmarsch der Soldaten beschäftigte und für einige Zeit seine ganze Umgebung vergaß.
Hubalek schiebt sich ein dollargroßes Stück Priem zwischen die Lippen und hält Bowie mit freundschaftlicher Geste seine Stange hin. »Da, nimm«, sagt er dabei und lächelt freundlich.
»Was willst du denn hier?«, fragt Bowie eiskalt und übersieht dabei ganz offensichtlich den dargebotenen Priem. Er kaut keinen Priem und würde dann selbst nichts nehmen, wenn er darauf versessen wäre. Er hat seinen eigenen Stolz, und der ist nichts mehr als Trotz.
Texanersturheit.
»Vielleicht sind es gute Nachrichten, es kommt ganz darauf an, wie du reagierst«, sagt Hubalek und schiebt achselzuckend die Tabakstange wieder in die Tasche. Dabei grinst er über seine welken Backen.