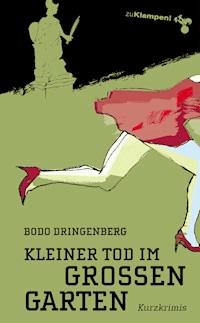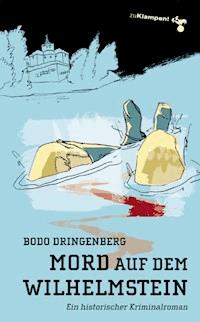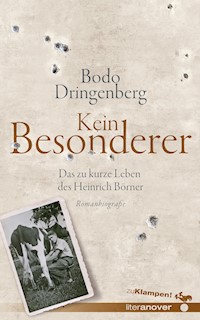Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwischen 1774 und 1777 kommen Graf Wilhelm, seine junge Gemahlin und ihre kleine Tochter in Schaumburg-Lippe zu Tode. Hat ihr Tod wirklich natürliche Ursachen? Immerhin gibt es mächtige Interessen, Schaumburg-Lippe und den als unbezwingbar gebauten Wilhelmstein in die Hand zu bekommen. Soll das gräfliche Geschlecht ausgelöscht werden? Ein rohes Grab tief im Wilhelmstein bietet dafür einen grausigen Hinweis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bodo Dringenberg
Die Gruft im Wilhelmstein
Historischer Kriminalroman
© 2011 zu Klampen Verlag • Röse 21 • D-31832 Springe [email protected] • www.zuklampen.de
1. Digitale Auflage 2012 Zeilenwert GmbH
Titelgestaltung: »In Zeiten wie diesen« – Büro für Kommunikation, Konzept & Kreation, Hannover Konvertierung: Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
ISBN 978-3-86674-114-0
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de›
www.zuklampen.de
Informationen zum Buch
Liebe, Intrige und Mord beim Bau der Festung Wilhelmstein im Steinhuder Meer.
DER AUTOR
Bodo Dringenberg, Jahrgang 1947, lebt seit 1972 in Hannover. Er veröffentlicht literarische Texte und sprachgeschichtliche Untersuchungen, schreibt für diverse Rundfunkanstalten und konzipiert kulturelle Veranstaltungen. Zuletzt erschien von ihm bei zu Klampen die Kurz-Krimisammlung »Kleiner Tod im Großen Garten«.
Inhalt
1761
1762 und 1763
1764-1767
1772-1774
1776
1777
Daten zum realen geschichtlichen Rahmen
Danksagung
Es gibt kein Buch, das die Frommen je so in Wut gebracht hätte wie das vorliegende.
La Mettrie, Vorwort zum »Discours sur le bonheur«
Ich schirme ihn, ich hüte ihn, ich verteidige ihn, wenn es darauf ankommt. Er vertraut mir und ich gebe ihm keinen Anlass, es nicht zu tun. Schutz, absolute Treue und Pflichterfüllung werde ich verkörpern, so dass es alle sehen. Ja, ich bin sein Instrument, auf das er bedingungslos zählen kann. Ich werde in seiner Nähe sein, wenn Gefahr droht. Wenn ich in seiner Nähe bin, droht immer Gefahr. Wenn ich weit weg bin, wird er auch in Gefahr sein. Dafür werde ich sorgen. Die Gefahr bin ich. Die Destruktion, die von innen kommen wird, werde ich leiten, ohne sie vorzunehmen. Mein Ehrenschild wird unbefleckt bleiben. Aus der Deckung heraus werde ich hart und ohne Erbarmen operieren, ihn dort fassen, wo er wehrlos ist, ihn stückweise zermürben. Es bringt mir viel Geld ein und noch mehr Befriedigung, unerkannt seinen Ruin zu betreiben. Was einst das italienische Geschlecht der Borgia oft so diskret vermochte in der Vernichtung seiner Gegner, das werde ich hier anders und gänzlich unerkannt versuchen. Zeit habe ich genug, Gelegenheiten werden sich finden. Und mit einem jungen Spross seines Glücks werde ich bald beginnen. Treue ist meine Tarnung! Es gibt keine bessere.
1761
Die Vernunft spottet ihrer selbst, wenn sie nicht unserer Befriedigung dient und nicht alle ihre Bemühungen darauf richtet, uns zu einem angenehmen Leben zu verhelfen.
Michel Eyquem de Montaigne
Er war schwer, würde auf den Grund sinken, sich in den Schlamm betten und auf ewig dort liegen bleiben. So viel war klar. Das war der Anfang. Endlich! Jetzt stand die fahle Wintersonne im Zenit, und der außerordentlich groß gewachsene Mann in Uniform hielt eine sehr spröde Rede: »Dieser Grundstein, der neue Wilhelmstein und nicht zuletzt die künftige Garnison Steinhude. All diese sollen Steine sein, welche Unsere Grafschaft vor Feinden schützen werden. Steine, die auch Schaumburg-Lippes Wohlfahrt befördern sollen. Möge nie ein Feind dieses Land sein Eigen nennen!«
An diesem 9. Januar 1761, einem klirrend kalten Wintertag, war vier Stunden zuvor vom Ufer aus eine seltsam anmutende Kolonne über das Eis des Steinhuder Meeres aufgebrochen. An der Spitze, etwas abgesetzt von den ihm Folgenden, schritt Graf Wilhelm in der Gala-Uniform eines Generals. Dem regierenden Landesherrn von Schaumburg-Lippe folgten einige Räte, Offiziere, Soldaten und Diener, die verschiedene Behältnisse mit sich schleppten.
Hinter diesen gingen zwei besonders kräftige Fischer, welche abwechselnd eine klobige Schubkarre schoben, auf der ein dicker, behauener Stein lag.
Ganz am Schluss dieser Gruppe kamen dick in einfache Kleider gehüllte Steinhuder mit mehreren schwer beladenen Karren und einigen Schlitten. Nach fast zwei Stunden langsamen Fußmarsches von Steinhude peilte der Graf abwechselnd mit einem Offizier das Westufer an. Sie sahen sich an, schüttelten stumm den Kopf und gingen langsam weiter, gefolgt von den übrigen.
Nach einem weiteren Marsch gen Westen, immer wieder unterbrochen von der Abschätzung der Uferdistanz, hielt Graf Wilhelm inne, ließ haltmachen und ein Loch in das ungewöhnlich dicke Eis schlagen. Als die Öffnung die erforderliche Größe von über fünf Ellen Durchmesser hatte, ließ sich Graf Wilhelm einen kleinen, mit sehr dickflüssigem Lack gefüllten Krug reichen, tunkte einen schmalen Pinsel hinein und schrieb schwungvoll mit diesem auf den Monolith: »Wilhelm Graf zu Schaumburg-Lippe Fundator 9. Januarii 1761«. Die beiden Fischer ließen nun den ersten Felsbrocken für den künftigen Wilhelmstein von der Karre in das Eisloch gleiten. Diese künstlich zu schaffende Insel sollte der unbezwingbare Mittelpunkt einer Festungsanlage im Steinhuder Meer werden.
Nachdem der Grundstein spritzend in das Eisloch geplatscht war, ordnete der Graf an, allen Anwesenden Branntwein auszuschenken und auf das Gelingen zu trinken. So geschah es. Danach entleerten die wenig begeistert wirkenden Steinhuder nacheinander ihr grobes Geröll von den Karren und Schlitten auf den Grund des Sees.
Dass der Graf seinen 27. Geburtstag auf der festen Eisplatte des Steinhuder Sees verbringen wollte, hatte alle in der Armee und am Bückeburger Hof überrascht, die in sein außerordentliches Vorhaben nicht eingeweiht worden waren. Aber der erst schneereiche, dann trockene, kalte Winter, der nun diesen glatt vereisten See geschaffen hatte, war ihm so günstig geworden, wie er es erhofft hatte. Seit dreizehn Jahren war Wilhelm nun Herr in Schaumburg-Lippe, dreizehn Jahre, in dem die kleine Grafschaft ihre Landesgrenzen behauptet hatte. Jetzt war sie stärker denn je und ihre Wirtschaft prosperierte wieder halbwegs. In diesem Jahr würde sich Graf Wilhelm gänzlich aus der alliierten Armee zurückziehen und sich endlich mit ganzer Kraft seiner Grafschaft widmen, ihrer Selbständigkeit, Blüte und militärischen Stärke.
Graf Wilhelm schien nach dem Umtrunk für einige Minuten in seiner Uniform erstarrt zu sein. Das geschah weniger, um der besonderen Zeremonie gerecht zu werden, sondern weil er für Momente in Selbstbefragungen und Erinnerungen versank. Hatte er Wahnvorstellungen?, fragte er sich. Würde man dereinst seinen Wilhelmstein als Erzeugnis und Zeugnis eines seelisch kranken, sich allzeit verfolgt fühlenden Menschen betrachten? Er war sich sicher, nicht an Verfolgungswahn, einer sogenannten Paranoia, zu leiden. Wer die Geschichte seiner Vorfahren, seines Hauses, kannte, würde die Gründe für sein Vorhaben nachvollziehen können. War das Geschlecht derer zu Schaumburg-Lippe nicht immer wieder verschiedenen tückischen Zugriffsversuchen oder tödlichen Attacken ausgesetzt gewesen?
Warum und wie kam vor fast zwanzig Jahren mein von mir so verehrter älterer Bruder Georg zu Tode? Er, der eigentliche Erbe der Grafschaft, soll in einem Duell gestorben sein. Wer hatte für diesen üblen Zweikampf gesorgt, wer sein furchtbares Ende befördert und vollzogen? Nie habe ich erfahren, was der Grund, wer der Gegner in diesem angeblichen Duell gewesen war. Es muss ein sehr mächtiger Gegner gewesen sein, da er nicht genannt werden durfte. Alle Münder blieben bei dieser Frage wie versiegelt oder konnten nichts Erhellendes preisgeben. Selbst mein Vater, der sonst alles mit mir besprach, ohne Umschweife, von Mann zu Mann, hatte sich unnachgiebig ausgeschwiegen. Gerüchte – Gerüchte, ja, die gab es freilich genug. So munkelte man, es sei ein naher Verwandter des Landgrafen von Hessen-Kassel gewesen, der meinen lieben Bruder Georg gefordert und mit dem Degen gefällt habe.
Und dann in Wien – auch schon wieder fünfzehn Jahre her – dieses merkwürdige Attentat. Anscheinend war es gegen meinen späteren Wiener Saufkumpanen Franzl gerichtet, anscheinend war ich nur zufällig in der Nähe. Vier Kerls hatten sich dem angetrunkenen Franz Graf von Harrach in der Morgendämmerung gegenübergestellt, aber sie wandten sich allesamt sofort mir zu, als ich mit blanker Waffe schreiend auf sie zulief. Kurios, in der Tat. Als ob diese Meuchlerbande bloß darauf gewartet hätte, dass ich hinzukomme. Es scheint mir heute so, als wollten sie eigentlich mein Eingreifen, meinen Tod. Wer weiß schon, wie weit der Arm Hessen-Kassels reicht? Wer kann wissen, was die noch alles tun, um sämtliche Bückeburger Erben loszuwerden?
Zwei von den Schurken habe ich mit meinem guten englischen Degen verwundet, einen entwaffnet, dann haben sich die tollwütigen Hunde getrollt. Der Franzl hatte nur blass wie ein frischer Käse an einer Hausmauer gelehnt, seinen unnützen zierlichen Hofdegen in der schlaffen Faust gehalten und zu kotzen begonnen. Er war eben ein lustiger Trunkenbold, der mir als Dank dann die amourösen Gassen Wiens zeigte. Aber sonst taugte er wenig.
Obwohl sich diese kleine Bataille schnell herumsprach, war das meinem Ansehen am kaiserlichen Hof in Wien nicht förderlich gewesen. Graf Franz von Harrach war am Hof nicht eben wohlgelitten wegen seiner Affären, Spielschulden und seiner miserablen soldatischen Fähigkeiten. Außerdem habe er sich nicht nur einmal über die Kaiserin Maria Theresia lustig gemacht – eine Frau könne Österreich niemals führen und derartige Reden. Ein letztlich bornierter, oberflächlicher Mensch, wie mir heute scheint. Vielleicht war er aber nur ein bezahlter Köder gewesen, um mich in ein Scharmützel hineinzuziehen, um mich bei der Verteidigung zu Fall zu bringen? Vielleicht steckte Harrach sogar mit den Mordbuben unter einer Decke?
Wie auch immer – ich habe es mit Bravour überstanden und weiß, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Das große Wien war eben bunt und turbulent, ganz anders als das Bückeburger Leben. So eine köstliche Affäre wie mit der Theaterprinzessin, der hinreißenden, unfasslich schönen und so leidenschaftlichen Elena Barbanti, wäre hierzulande schlicht unmöglich gewesen. Elena – was war sie doch für eine kapriziöse und vollkommene Helena, um die sich jeglicher Krieg zu lohnen schien! Und was hat mich diese Venus nicht alles gelehrt, was mir keine Akademie, kein Gefecht je lehren könnte! Und was hatten ihre gräflichen Verehrer vor Wut gekocht, wie ich später hörte, als ich die Wundervolle bereits nach London entführt hatte. Die fassungslosen Visagen dieser eingebildeten Gecken, dieser Esterhazy und Lobkowicz, hätte ich zu gern gesehen. Es war ein kleines, aber üppiges Paradies zu dritt in London geworden. Jeden freien Moment übte ich mich entweder im Klavierspielen mit Kapellmeister Doménech oder in den Künsten der Liebe mit der schönen Elena. Ich weiß nicht, worin ich es weiter brachte – doch köstlich war beides! Und der Krieg war so fern, fern wie der Mond!
Schon zu dieser Zeit war Kaiserin Maria Theresia über mich empört. Später entzog sie mir mehrfach ihre Gunst für einen erbetenen Offiziersposten und drohte mir sogar mit der Reichsacht, weil ich nicht vom Bündnis mit Preußen lassen wollte. So unerbittlich erbittert war die Kaiserin gegen mich, dass sie meine letzte Verlobte partout nicht in einen mir angemessenen Stand erheben wollte. Das alles kann ich ihr leider nicht einmal verdenken. Als Kaiser in Wien hätte ich doch ebenso gehandelt.
Sechs Jahre nach meinem Bruder starb mein leidender Vater. Der hatte immer wieder vom »Schurken Lehenner« gesprochen und damit immerhin seinen Ersten Regierungsrat gemeint. Ich habe seine schrillen Vorwürfe damals nicht geteilt. Er schien nur ablenken zu wollen von seinen eigenen Verschwendungen, seinem zu üppigen Hofleben mit seiner aktuellen Frau. Doch ging es meinem Vater wirklich bloß um die desolaten Zustände der Verwaltung und Finanzen Schaumburg-Lippes? Hatte der – wie sich später mit aller Wucht zeigte – tatsächliche Schurke Lehenner meinem Vater nach dem Leben getrachtet und war – wie und wodurch auch immer – erfolgreich gewesen?
All diese schwärenden Fragen stiegen wieder mächtig in Graf Wilhelm auf, während weitere Gesteinsbrocken auf den schlammigen Grund des Sees sanken.
Letztlich, sagte er sich, zählt nur, dass ich übrig geblieben bin. Und ich bin gründlich gewarnt und gewitzt durch all diese Kabalen und Anschläge.
Graf Wilhelm bemerkte, dass seine Füße kalt geworden waren, stampfte ein paarmal auf und rief sich wieder in die Gegenwart auf der perforierten Eisfläche zurück. Er nahm Leutnant Praetorius beiseite. Was er ihm nun sage, werde er weder aufschreiben noch skizzieren. Der Leutnant solle sich das Detail aber genau merken und dem künftigen Baumeister mitteilen. Hier, zwölf Schritte westlich vom Zentrum der künftigen Hauptinsel entfernt, soll nur kleinbrockiges Gestein und Geröll, mindestens sieben Ellen tief, drei Ellen breit, aufgebracht und drumherum mit Faschinen umgrenzt werden.
Genau hier, wo Er, Praetorius, es später noch mit Pfählen zu markieren habe, solle eine kleine Kaverne für besondere Zwecke gebaut werden, deren Sohle etwa eine Elle unterhalb des Bodens der Kasematten liegen müsse.
Als noch weitere kleinere Steine herbeigeschafft und in die eisumrandete Öffnung gekippt wurden, entstand im Laufe des klaren Winternachmittags ein kleiner Haufen, dessen stumpfer Gipfel fast die Wasserfläche erreichte. Der Graf ließ sich nun eine mitgeführte, etwa mannslange, zugespitzte Eisenstange reichen und dazu einen dicken Fäustel. Während die kleine Gruppe der umstehenden Soldaten und Steinhuder besorgt war, ob der Eisrand den hochgewachsenen Regenten tragen würde, stocherte dieser mit dem Stab im Geröll herum. Schließlich fand er eine Stelle, an der er die Stange ein Stück in den Steinhaufen hineintreiben konnte. Mit der behandschuhten Linken hielt er sie fest, mit dem schweren Hammer in der unbedeckten Rechten schlug er sie etwas tiefer in das entstehende rohe Fundament hinein. Nach einigen Schlägen bemerkte er, dass es nicht weiter ging. Er gab den Fäustel dem ihm am nächsten Stehenden, hielt aber unverwandt die Eisenstange fest und ordnete an, dicht um sie herum noch weitere Brocken zu häufeln, bis die eiserne Markierung nicht mehr zu bewegen sei und das Fundamentierungsgestein über den Wasser- beziehungsweise Eisspiegel rage. Er persönlich werde diesen Stab noch eine Weile gerade halten, man solle nur zügig weiter armierendes Material um die Eisenstange packen. Dann wies er seinen Adjutanten, den Karabiniers-Leutnant von Schroeder, an, eine kleine Truppenfahne mit der lippeschen Rose und dem Monogramm Graf Wilhelms an zwei Ösen dieser Stange zu befestigen. Während der Graf so stand wie eine altertümliche mit Spieß bewaffnete Schildwache, drifteten seine Gedanken erneut zurück.
1748, nach meines Vaters Tod hatte ich ganz plötzlich die riesige Last gespürt, die mir als legitimen Nachfolger und Regenten in Bückeburg nun auf die Schulter gepackt worden war. Erst einmal war ich unter diesem vorgestellten Gewicht in die Knie gegangen, fast zusammengebrochen.
Das Entsetzen hatte mich gepackt und geschüttelt, nun plötzlich Regent werden zu müssen, ein Landesvater, dem man von innen und von außen ohne Unterlass im Nacken sitzen wird. Ich floh gewissermaßen in eine wochenlange Krankheit und hatte mich gänzlich darin zurückgezogen. Ich fühlte mich in einen gar nicht so goldenen Käfig aus Regeln, Ritualen und Regieren geworfen. Dazu kamen die riesigen Schulden von 400.000 Reichstalern, welche mir mein leichtsinniger und sanftmütiger Vater mit seiner zweiten Frau, meiner falschherzigen, verschwenderischen Stiefmutter, hinterlassen hatte.
Während dieser bedrückenden Zeit gelang es mir aber, in meinem verzweifelten Kopf immer mehr aufzuräumen, mir klare Ziele zu stecken und mich mit wachsender Neugier auf meine Regentschaft vorzubereiten. War ich denn nicht kühn und klug genug für mein Amt? – Doch, ich würde ihm gewachsen sein! Keinesfalls aber war ich willens, mich dem Althergebrachten und Üblichen gänzlich zu unterwerfen. Und die Herren Räte und Ritter, die in Schaumburg-Lippe bei allem und jedem in die Regierungsgeschäfte hineinredeten und dabei ihre Schäfchen ins Trockene brachten, sollten mich kennenlernen. Sie würden in die Schranken verwiesen werden wie nie zuvor! Ich allein, ich werde der Landesherr sein, an dem sich meine inneren wie äußeren Widersacher die Zähne ausbeißen sollten!
Zu meiner Huldigung als neuem Regenten waren die Bürger der Residenzstadt in ihren besten Kleidern vor mir erschienen. Das Folgende dünkte mich zwar eine etwas alberne Zeremonie zu sein, aber sie war in ihrer Symbolkraft sehr wichtig: Die Ratsmitglieder Bückeburgs trugen ihre schwarzen Mäntel, lieferten mir untertänig den Stadtschlüssel aus. Ich bestätigte ihnen ihre Stadtrechte und gab ihnen den Schlüssel zurück, wobei sie mir wiederum eine Kontribution von 400 Reichstalern entrichteten. Einige Ratsherren waren offensichtlich angetrunken und schwankten wie Schilf im Wasser, wenige wichtige Bürger, so wurde mir gesagt, fehlten ganz, die hätten sich in der Apotheke nahe des Schlosses und in einem Keller mit Ausschank festgesoffen. Dass ich nicht bei allen willkommen war, hatte ich vorher gewusst; aber nun war ich offiziell ihr Landesherr, und wer sich von denen mir in den Weg stellte, würde eine harte Hand zu spüren bekommen.
Bei dieser Huldigung trug ich den mit silbernen Nähten bestickten himmelblauen samtenen Oberrock. Auf der hochgeschlagenen Hutkrempe aber prangte noch einmal das Große Kleinod des Hauses Schaumburg-Lippe: eine Agraffe von kostbaren Brillanten. Kurz danach konnte ich diesen Schmuck für 32.000 Reichstaler veräußern, um die titanischen Schulden bei der hannoverschen Kammer zu mildern.
Nach erfolgter Huldigung gab ich mein einziges opulentes Fest am Hof, mit allem, was so an Prunk und Aufwand üblich war, und tat zugleich meinen inneren Schwur, dass damit ein solches Treiben in meinem Schloss ein Ende gefunden habe. Unsummen für die Darstellung von Macht und Souveränität würden künftig nicht mehr ausgegeben, die Hofgesellschaft drastisch reduziert und üppige Festlichkeiten nach Kräften vermieden werden. Und ich habe es durchgesetzt: Bildung und Kunst, insbesondere Musik, sind in Bückeburg heimisch geworden, das Schranzengetümmel ist nüchterner Verwaltung gewichen und die größere Anzahl der hier einquartierten Soldaten fördert letztlich den Wohlstand der Residenzstadt.
Hessen-Kassel erkannte mich als sukzessionsfähig an und händigte mir ein Jahr später ohne Einschränkungen meinen Lehnsbrief aus, so dass meine Regentschaft fast reibungslos begann – wenn nicht die 400.000 Taler Schulden beim Kurfürstentum Hannover aus meines Vaters Zeit gewesen wären! Mit dem Verkauf von Erbstücken, Juwelen, Porzellan und silbernen Services konnte ich sie zu einem Gutteil senken; viele drastische Einsparungen in meiner Residenz kamen hinzu; und dank einer Militärkonvention mit Hannover, die weitere Zehntausende in die Landeskasse brachte, konnte diese Last bis heute zwar nicht getilgt, aber erheblich gemindert werden.
Immerhin bin ich ebenso wie Friedrich II. von Preußen ein Enkel des Königs Georg I. von Großbritannien und Irland, der zugleich Kurfürst von Hannover ist. Und dieser hatte schon vor meiner Geburt immer versichert, Schaumburg-Lippe gegen jeden Angriff zu verteidigen. Großartiges Versprechen, Großvater! Hatte ich doch vor vier Jahren vor den französischen Truppen aus meinem Land fliehen und im Exil leben müssen. Kunststück! – denn wo lag England und wo Schaumburg-Lippe? Der Herzog von Cumberland jedenfalls, diese militärische Niete und strategische Null, hatte mir verboten, mein gerade ausgezeichnet befestigtes Bückeburger Schloss zu verteidigen. Damals reiften in mir erste Pläne für einen uneinnehmbaren Fluchtpunkt in meiner Grafschaft selbst.
Eine bittere Bestätigung dieser Notwendigkeit erfolgte ein Jahr später. Da durfte ich definitiv und unwiderleglich erfahren, dass mein Regierungsrat und Verwaltungsoberhaupt Wolf Carl von Lehenner in Bückeburg ein Hochverräter reinsten Wassers war. Während dieser mir allzeit die Komödie des beflissenen Dieners gespielt hatte, war von Lehenner zugleich für den Landgrafen von Hessen-Kassel emsig tätig gewesen. Nicht allein, dass der Kasseler Regent durch diesen Schurken jeglichen bedeutenden Schriftverkehr in Bückeburg kannte; nein, der Rat hatte dem Landgrafen auch ganz direkt zur Invasion in Schaumburg-Lippe geraten. – »Hüte dich vor dem Landgrafen von Hessen, / wilt du anders nicht werden aufgefressen!«, hieß es schon im Mittelalter, und das war immer noch aktuell.
In meiner Schrift »Contre l’invasion de la Hesse«, verfasst, nachdem der Regierungsrat von Lehenner 1758 endlich enttarnt und verhaftet worden war, hatte ich daraufhin dargelegt, wie man sich insbesondere gegen Hessen-Kassel verteidigen könne. Sich einer Vereinnahmung Schaumburg-Lippes durch den Landgrafen oder andere mächtige Gegner erfolgreich zu widersetzen halte ich für möglich. Neben einer forcierten Verstärkung der Armee rücke ich darin den Festungsbau in den Mittelpunkt meiner strategischen Absichten. Damit galt es mir nun, die Verteidigung meiner Grafschaft so zu forcieren, dass die Unbesiegbarkeit von vornherein so einleuchtend klar ist, dass es gar nicht erst zu einem Krieg gegen sie kommen werde. Den ersten Stein dafür habe ich gerade legen lassen, den Grundstein für meinen neu zu schaffenden und nach mir benannten »Stein«, der allen Angriffen wehren wird. Ich bin sicher, sollte dieser gerade versenkte erste Stein mit den Tausenden anderen für meine Festung einen Krieg nicht verhindern, werde er zumindest dessen Übel vermindern und die gänzliche Einnahme der Grafschaft unmöglich machen.
Praktische Schritte für die Ausführung seines Projekts und seine Überwachung standen an, und der zentrale Posten dafür war noch vakant. Er benötigte unbedingt einen erfahrenen, nüchternen und fähigen Offizier als Baumeister, Leiter und vielleicht späteren Kommandanten, der nach Bedarf mit Praetorius kooperieren würde.
Leutnant Praetorius galt dem Grafen wie dem Offizierskorps seiner Armee als ein genialer Kopf, aber ohne die erforderliche sture Nüchternheit und organisatorische Gabe. Und seine Führungskraft bei komplexen Aufgaben war ebenso wenig erbaulich wie seine Fähigkeit, sich durchzusetzen. Er war ein zu typischer Genie-Offizier: ein Ingenieurhirn, das immer bloß an Zahlenverhältnissen, Erfindungen, Vermessungen, Karten, Plänen und Spekulationen interessiert schien – zu viel Wissenschaftler und Mathematikus, zu wenig Soldat, hatten ihn dessen Vorgesetzte lakonisch beurteilt.
Jacob Chrysostomus Praetorius war vor genau 31 Jahren am 9. Januar als Sohn eines Pastors in der Uckermark geboren worden. Er hatte also mit dem Grafen den gleichen Geburtstag und trat bei diesem 1759 als Ingenieur-Geograph und Leutnant in Dienst. Obwohl sich der nicht mehr ganz junge Leutnant schrecklich nach einer Frau, einem Mädchen, einer Geliebten sehnte, behielt er seine Sehnsuchtsqualen strikt für sich und versah seinen Dienst mit großer Hingabe. Lediglich Graf Wilhelm fiel mehrfach auf, wie sein sonst so tüchtiger und diensteifriger Ingenieur beim Anblick eines jungen Mädchens wie gelähmt wirkte und dessen Bild anscheinend in sich einsog.
Doch »Lieber ohne Glück als ohne Redlichkeit«, war Praetorius’ Wahlspruch gewesen, bis er den Druck eines gewissen La Mettrie bei einem Besuch in Hannover gesehen und erworben hatte. Das schlecht gebundene Werk trug den verheißungsvollen Titel »Das höchste Gut oder des Herrn de La Mettrie philosophische Gedanken über die Glückseligkeit. Aus dem Französischen übersetzt. Frankfurt und Leipzig 1751«.
Er hatte diese Schrift, welche im französischen Original »Discours sur le bonheur« hieß, erst mit Empörung gelesen, die schnell in Verwunderung und endlich Faszination überging, um sich schließlich selbst in erschreckender Zustimmung zum Gelesenen wiederzufinden. Wo ist meine Glückseligkeit? Im Kartenzeichnen, in Konstruktionen, im Vermessen der Welt? Das ist Pflicht, meine Aufgabe. Aber Glück, tief empfundenes Glück? Nur in der Vorstellung meines Kopfes weiß ich darum. Die körperliche Empfindung davon ist mir meistens fremd.
Ich bin in der Tat übel dran. Alle Glut, alles Feuer der Zärtlichkeit muss ich in mir ersticken, nur damit ich nicht unvorsichtig werde. Wie gern würde ich mich einer Jungfer, einem Mädchen erklären; wie gern würde ich ein Herz erobern und mehr als ein Herz, um mein eigen Herz auszuschütten und dem Überfluss meiner heftigen Empfindungen Luft zu machen. Aber meine Klugheit, die despotisch über mich wacht, ruft mir zu: Halte dich zurück! Grausame Forderung. Wie schwer wird es mir, sie zu befolgen!
Graf Wilhelms Gedanken schweiften in ganz anderen Gefilden umher als die seines Offiziers Praetorius. Der Regent war an diesem Wintertag von nichts anderem mehr erfüllt als dem Glücksgefühl, das vom Baubeginn seiner uneinnehmbaren Festungsinsel erzeugt worden war. Er dachte über den geeigneten Mann für die kommende Zeit des Aufbaus der Festung und ihres Kommandos nach.
Ich werde mir diesen Jean Philipp Etienne aus Frankreich holen, den ich nach der Schlacht bei Minden kennengelernt habe. Der ist etwa meines Alters, ein kluger Kopf und ein prächtiges Bündel von praktischen Erfahrungen nach 18 Jahren bei einer vortrefflichen französischen Genietruppe. Seine genauen Zeichnungen, die exakt durchgerechneten statischen Pläne und Entwürfe von verschiedensten Modalitäten der Fortifikation zeugen von umfassenden Kenntnissen im Festungsbau. Anscheinend hat der alles gemacht, was es über und unter dem Erdboden zu bauen gibt. Zudem ist der ein ruhiger, verständiger Mann, der mit Leuten umzugehen weiß, auch wenn diese sich sperren. Diesen Etienne forme ich mir so, dass er wiederum mir Uneinnehmbares und mehr formen kann. Soll dieser reife Leutnant auch in meinem Genie-Korps ruhig so katholisch bleiben wie er will – meinen Fortifikationen wird nicht schaden, woran ihr Ingenieur glaubt.
Vielleicht ist dieser gewaltige Krieg, der nicht nur in Europa wütet, bald vorüber und lässt mir Zeit, mich endlich um eine liebevolle Gattin zu kümmern. Liebesglück habe ich durchaus schon genießen dürfen, und so eine wunderbar tiefe Begegnung wie jene im Ort des Rehburger Brunnens wäre einer Ehe wert gewesen.
Nachdem 1758 die üble Affäre um den Hochverrat von Lehenners im Frühjahr abgeschlossen war und Graf Wilhelm in sein teilweise von Schweizern und Franzosen verwüstetes Land zurückgekommen war, hatte sich ihm nämlich ein kurzer, wunderbarer Lichtblick eröffnet. Dieser Lichtblick war eine Liaison inmitten einiger sommerlicher Junitage im sogenannten Bad oder Brunnen von Rehburg, der zum angrenzenden Kurfürstentum von Hannover gehörte. In diesen Brunnenort, der etwa drei hannoversche Meilen von Schloss Hagenburg entfernt lag, war Graf Wilhelm allein geritten. Er hatte die Landwehr passiert und war ab der Grenze zu Kur-Hannover von einem hannoverschen Leutnant mit vier Kürassieren nach Bad Rehburg eskortiert worden.
Diesen Gesundbrunnen nahe Rehburg gab es schon seit dem letzten Jahrhundert und er war Zug um Zug für die Bedürfnisse seiner Gäste ausgebaut und nutzbar gemacht worden. Seine Behausungen lagen in einem kleinen, fast völlig von bewaldeten Hügeln umschlossenen Tal, so dass Bad Rehburg bei aller Einfachheit ein idyllischer Charakter zu eigen war. Dem leicht salzigen, trüben Wasser, das nicht allzu üppig aus dem Rehburger Bergrücken quoll, wurden allerlei heilsame Wirkungen zugeschrieben. Bei äußerlicher Anwendung habe das erdig-salinische Wasser lange schwärende Wunden geheilt und geschlossen; dann diene es bei Augenleiden sowohl behandelnd als auch prophylaktisch. Der Hauptzweck der Brunnenkur aber war das Trinken der wundertätigen Flüssigkeit, um innere Leiden und Gebresten zu heilen oder zumindest abklingen zu lassen. Nicht nur Magen, Herz und Gelenke hätten durch die Brunnenkur sich wieder zu freundlichen Organen entwickelt, sondern auch über außerordentliche Wirkungen wurde sich gern verbreitet. So ging die Geschichte von einem Patienten von Mund zu Mund, der stumm wie ein Fisch nach Bad Rehburg gekommen wäre, aber nach einigen Tagen und dem Trinken mehrerer wohl verteilter Krüge des Heilwassers wieder zu sprechen begonnen hätte.
Aus dem wenig ausgebauten Wildbad am Berg war vor sechs Jahren das Königlich-Hannoversche Bad Rehburg geworden. Dessen Betreiber hatten große Pläne, wussten sie doch, wie prächtig Bad Pyrmont prosperierte und zum Treffpunkt der feinen und hochgestellten Kreise arriviert war. Mittlerweile war in Bad Rehburg ein Wasserstollen gemauert worden, der das Quellwasser sammelte und zum Brunnenhäuschen leitete, das seit ein paar Jahren zum Mittelpunkt des Bades gemacht worden war. Nahe dieses kleinen, anmutigen Gebäudes waren über 20 Laubhütten aufgebaut worden, in denen man sich der Muße oder kleinen Gesellschaften widmete. Dazu kamen noch ein Bade- und ein Gästehaus, dazu die Brunnenmeisterwohnung und eine im Bau befindliche überdachte Galerie, die als Wandelgang bei Regen vorgesehen war.
Dieser waldumschlossene Ort war schon mehrmals für inoffizielle Treffen von Vertretern verschiedener Staaten genutzt worden. Diesmal sollte Wilhelm ein geheimes Gespräch mit Abgesandten Hannovers und Preußens führen. Das gemeinsame weitere Vorgehen gegen die französischen Truppen werde ebenso Thema sein wie die kaiserlichen Drohungen gegen den Grafen wegen Schaumburg-Lippes eigenmächtiger Bündnispolitik mit Preußen. Kaiserin Maria Theresia hatte mehrfach darauf bestanden, dass Schaumburg-Lippe sich mit der österreichischen Reichsarmee gegen Preußen zu stellen habe. Graf Wilhelm aber war durch einen Truppenvertrag an England-Hannover gebunden, das wiederum mit Preußen verbündet war. Außerdem schätzte er König Friedrich II. als Bündnispartner hoch ein, auch wenn er dessen Angriffskriege nicht billigen konnte. Er wollte sich in jedem Falle noch einmal des völligen Rückhalts durch Hannover und Preußen versichern, falls die Kaiserin in Wien ihn tatsächlich ächten würde.
Graf Wilhelm hatte nur für wenige Tage in Bad Rehburg geweilt, zusammen mit seinem schneidigen und gewandten Adjutanten Leutnant Thilo von Schroeder. Der Karabiniers-Leutnant genoss auch als Verbindungsoffizier zu anderen Mächten sein Vertrauen. Selbiger Adjutant war schon vor Ort, hatte dort Quartier für den Grafen gemacht, ansonsten jedoch keine weiteren Direktiven erhalten.
Bei prächtigem Sommerwetter und einer ausnahmsweise sanft-warmen Brise, die über die Rehburger Berge strich, war der Graf ohne eigene Begleitung, aber eskortiert vom hannoverschen Leutnant mit seinen vier Kürassieren in das kleine Tal des winzigen Ortes geritten. Der Brunnenmeister samt einer Bediensteten und eines Stallknechts hatte ihn dort unterwürfig willkommen geheißen. Nach einem Begrüßungsschluck von ockerbraunem Wasser, der dem Bückeburger in einem Henkelglas gereicht wurde und ihn an eine salzige Socke denken ließ, machte er sich umstandslos allein auf den Weg zum Brunnenhaus.
Graf Wilhelm hatte das überschaubare Ensemble der keineswegs prunkenden Bebauung schnell erfasst und war froh, nicht wegen eines Zipperleins oder Schlimmerem sich hier einquartieren zu müssen. Die drei Dutzend Hütten, meistens aus Brettern gefügt, verstärkten den kargen und etwas provisorischen Eindruck des Badeortes.
Als Graf Wilhelm zum Brunnentempel, wie man das Bauwerk nannte, herankam, erblickte er zu seiner Überraschung seinen schneidigen Leutnant von Schroeder. Der trug seine schwarze Karabiniersuniform mit dem Säbel, aber ohne den pelzbesetzten Helm, ohne den Karabiner am Bandolier, und auch der Kürass panzerte nicht seine breite Brust. Es hatte den Anschein, als ob drei junge Damen sehr von ihm angetan waren und besonders eine mit aufgelösten braunen Locken, die an eine schöne Löwin gemahnte, schmiegte sich beinahe an die Seite des gerade erzählenden Offiziers. Während Graf Wilhelm sich mit seinen ausgreifenden Schritten näherte, konnte sich sein Adjutant gerade noch rechtzeitig von dem amüsierten Damen-Trio lösen.
Leutnant von Schroeder, der schon vor zwei Tagen zwecks Vorbereitung des halb-diplomatischen Treffens in Bad Rehburg angekommen war, trat vor den pavillonähnlichen Bau, nahm Haltung an, salutierte und meldete seinem Dienstherren, dass alles vorbereitet und arrangiert sei. Die drei jungen Frauen am Brunnentempel drehten ihre Köpfe diesem kleinen Schauspiel zu, betrachteten ungeniert die ungewöhnlich hohe Gestalt des berühmten Grafen, steckten die Köpfe zusammen und kicherten ganz gegen die Etikette. Als der Graf die Meldung entgegengenommen hatte, befahl er seinem Adjutanten, sich um die Dienerschaft hinsichtlich der Pferde und des Zimmers zu kümmern. Leutnant von Schroeder bewegte sich zu seinen Aufgaben, wie es schien aber mit verkniffenem Mund. Graf Wilhelm grüßte die Frauengruppe von weitem, nahm seinen Dreispitz ab und verbeugte sich. Die weiblichen Gäste antworteten mit anmutigen tiefen Knicksen, wobei besonders die Braunlockige sich des Kicherns immer noch nicht enthalten konnte.
Dem Grafen gefiel das lockere Gebaren und er bemerkte zum ersten Male, dass das vor Lachen bebende junge Fräulein ihm besonders gefiel. Bevor er aber irgendwelche Kontakte knüpfen oder Komplimente machen wollte, lag ihm daran, erst einmal dieses Bad Rehburg allein zu erkunden. Tatsächlich herrschte in diesem Brunnenort keine ernste, traurige und ruhige Stimmung, sondern eher eine der Art, als ob man schon längst gesundet wäre und nun das Leben freiweg genießen könne. Es war eine betont unzeremonielle Gesellschaft, die hier neben dem Brunnentrinken das Leben nach Kräften genoss. Als er den Berghang hinter dem Brunnen in westlicher Richtung hinaufstieg, konnte er von einem freien Platz aus sogar das Steinhuder Meer erblicken, seinen See, den er in Bälde mit einem besonders exquisiten Stein schmücken würde. Nach diesem Ausblick ging er wieder zu den Badanlagen ins Tal zurück, wo inzwischen etwas mehr Getriebe als bei seiner Ankunft herrschte.
Über vierzig Personen mochten sich an diesem warmen Frühsommertag im Tal und dem angrenzenden Holz eingefunden haben. Vor Beginn des Krieges gegen Frankreich sollen hier manches Mal über hundert Gäste täglich das Brunnenwasser getrunken haben und im Tal herumgestreift sein. So ein großzügiger und schon lange berühmter Badeort wie das belgische Spa konnte Bad Rehburg natürlich nicht sein, aber immerhin ein kleines Abbild davon. Das Wandeln auf der etwa einhundert Schritt langen Lindenallee war eines der sichtbaren Vergnügungen; standen die Gäste aber, unter denen auffallend viele junge Damen, Fräuleins und Mädchen waren, so frönten sie einer anderen Leidenschaft: Es wurden offenbar Unmengen von Kaffee getrunken. Fast überall, wo sich ein Häuflein von Brunnengästen gefunden hatte, roch es nach dem schwarzen Getränk, für das Wilhelm so gar keine Neigung hatte. Aus großen Steinzeug-, ja sogar Porzellankannen wurde fortwährend die bittere Flüssigkeit ausgeschenkt und dann aus unterschiedlichsten Behältnissen getrunken. Manche warfen Zucker und Gewürze in ihr Trinkgefäß, nicht wenige schütteten gar Milch in ihre Tasse, so dass es den Grafen bei der Vorstellung, dies trinken zu müssen, fast schüttelte.
Vielleicht war das die eigentliche Kurierung: Herumstehen, Plaudern, Kaffeesaufen – sehr seltsam! Schwer zu sagen, dachte er, ob mich das Trinken des berühmten Brunnenwassers mehr Überwindung kosten würde als des Kaffees. Gelitten muss eben sein, ob nun im Gefecht oder bei der Brunnenkur, beschied er sich, und immerhin wird hier nicht gestorben. Dennoch bangte er, zu einem grand caffée, also einer förmlichen Kaffeegesellschaft, eingeladen zu werden und dort kulinarischer Pein ausgesetzt zu sein.
Ein hustender hannoverscher Garde-Leutnant kam auf ihn zu und machte dem Grafen seine Reverenz, wobei Ersterer seine Hustenschübe mühsam unterdrückte. Der Graf machte nur ein halbes Kompliment, setzte seinen Dreispitz gleich wieder auf und bedeutete dem Leutnant, kein weiteres Aufhebens zu machen. Gleichwohl entfernte sich der Offizier mit seinem Hut in der Hand, rückwärts schreitend und verhalten hustend. Obwohl Graf Wilhelm einen eher unauffälligen Uniformrock trug, musste er immer wieder ehrerbietige Grüße entgegennehmen, die er allerdings lässig erwiderte – selbst hier in diesem abgelegenen Ort erkannte man ihn also. Andererseits fiel ihm erneut auf, dass es sehr heiter und gelöst unter den Leuten verschiedenen Standes, Alters und Geschlechts zuging. Einfache und Vornehme gingen bunt durcheinander, ob es nun Fräuleins oder Studenten, Offiziere oder Kaufleute und ihre Gattinnen waren.
Eine kleine Gruppe von drei Männern, die sich als ein Amtmann, ein Braumeister und ein Hauptmann der Grenadiere vorstellten, sprachen ihn höflich, aber ohne große Umschweife an. Was er, Durchlaucht, vom Marschieren mit Musik halte? Man habe hier verschiedene Meinungen und würde alleruntertänigst die eines schlachterfahrenen Kommandeurs erbitten. »Gut und lustig zu marschieren nach einem wohl geschlagenen Takt erleichtert die Pein solcher Bewegungen«, gab der Graf zur Antwort. Er bemerkte am Mienenspiel des Hauptmanns, dass dieser unbedingt für einen ernsthaften, strengen Marsch einstand und Musik dabei für verderblich hielt. Keinesfalls wollte sich der Regent hier im Brunnenort kuriosen Problemen stellen und empfahl sich ziemlich abrupt.
Als er nach ein paar Minuten an den Waldrand kam, knallte es einige Male, gefolgt von tumultösem Geschrei. Gefahr im Verzuge, hier draußen im Hannoverschen? – Graf Wilhelm griff unwillkürlich an seinen Degen, löste die Hand aber gleich wieder, als er den Grund des Geknalles sah. Mehrere junge Leute, unter ihnen der hustende Leutnant, schossen mit kleinen Schrotkalibern auf fliegende Schwalben und machten einen Mordslärm, wenn sie so einen Vogel aus der Luft geholt hatten. Draußen wartete der blutige Krieg und hier schoss man zum Vergnügen auf harmlose Vögel – es ekelte ihn.
Am Hang hinter dem Brunnenpavillon hatten sich einige Personen gesammelt, unter ihnen stand auch der Brunnenmeister. Graf Wilhelm trat näher, da er bemerkte, dass sich hier eine übermannshohe Öffnung in dem Berg auftat, in die man gerade mit mehreren Fackeln versehen hineingehen wollte. Er schloss sich ohne zu fragen den Besuchern an, nahm seinen Dreispitz ab und betrat als Letzter einen ausgemauerten Schacht. Der Stollen war so breit, dass er noch bequem hindurchkam, allerdings nicht so hoch, dass er hätte aufrechten Hauptes hindurchgehen können. Als er einige Schritte auf dem nassen und schmutzigen Boden gegangen war, bemerkte er irdene, glasierte Röhren, die anscheinend das Wasser in das Brunnenhaus leiteten. Als er vernahm, dass man noch ungefähr 400 Schritte bis zum Wasserbassin bräuchte, entschloss er sich umzukehren. Dieser Stollen würde bloß seine Uniform ruinieren, er müsste den ganzen unterirdischen Weg in gebückter Haltung gehen und würde wahrscheinlich dennoch dauernd gegen die kleinen spitzen Tropfsteine stoßen, die von der steingefügten Decke herabhingen. Nein, sagte er sich, machte kehrt und tastete sich zum Lichtflecken des Eingangs zurück. Nein, das war nichts für ihn, er genoss lieber die frische Juniluft und die von Licht durchflutete Allee. Aber dennoch verspürte er etwas wie einen inneren Widerhaken, mit denen sich dieser ausgebaute Gang in seinem Hirn festgesetzt hatte.