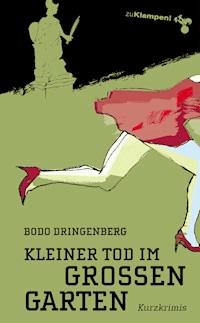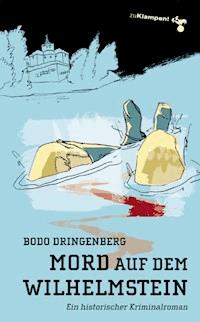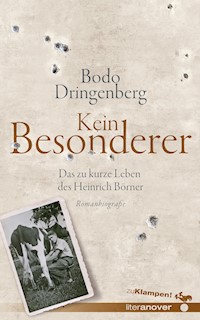
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: zu Klampen
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Heinrich Börner, 1919 unehelich in Linden geboren, verbrachte sein Leben als Melker auf verschiedenen Bauernhöfen Norddeutschlands. Weder war er politisch aktiv noch gar Widerstandskämpfer oder Intellektueller. Er gehörte auch keiner in der Nazizeit verfolgten Gruppierung an – ein sogenannter einfacher Mann, niemand Besonderes. Nach erzwungenem Reichsarbeitsdienst wurde er zu Kriegsbeginn in Hannover zur Wehrmacht eingezogen. Noch bevor er an die Front musste, desertierte er. Kurz nach seiner Fahnenflucht wurde er gefasst, vom Militärgericht zum Tode verurteilt und 1940 in Hannover bei der Kugelfangtrift erschossen. Er wurde nur 21 Jahre alt. Die Romanbiografie »Kein Besonderer« folgt den Stationen des kurzen, gewöhnlichen Lebens von Heinrich Börner und möchte ihn ins öffentliche Gedächtnis bringen. Eine notwendige Ergänzung zu den bekannten Geschichten »großer Helden«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bodo Dringenberg
Kein Besonderer
Das zu kurze Leben des Heinrich BörnerRomanbiografie
© 2023 Literanover by zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
zuklampen.de
Umschlaggestaltung: Stefan Hilden · München · hildendesign.de
unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock
Hinweis: Die Fotografie auf dem Cover zeigt nicht Heinrich Börner.
Satz: Germano Wallmann · Gronau · geisterwort.de
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH · Rudolstadt
ISBN-Printausgabe 978-3-86674-992-4
ISBN E-Book-PDF 978-3-98737-367-1
ISBN E-Book-Epub 978-3-98737-366-4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
meinem Bruder Joachim gewidmet
Inhalt
Salve
Kochstraße
Konstantinstraße
Kirchröderstraße
Alt-Warmbüchen
Dammstraße
Fallingbostel
Dammstraße
Lamspringe
Dammstraße
Helmstedt
Dammstraße
Göttingen
Dammstraße
Reichsarbeitsdienst Braunschweig
Dammstraße
Artilleriekaserne Hannover
Desertion
Nacht
Nachwort des Autors
Quellen
Danksagung
Über den Autor
Salve
Gleich nach dem Wecken in Hannovers Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis am Waterlooplatz 16 wird dem bereits angekleideten Kanonier Heinrich Börner vom Wachhabenden befohlen, die Uniform wieder abzulegen. »Du verdienst es nicht, im Ehrenkleid eines Soldaten zu sterben. Zieh das an, und zwar dalli, dalli!«, bellt der junge Unteroffizier. Heinrich entledigt sich achselzuckend seiner körperwarmen Kleidung bis zur grauen Unterwäsche, zieht stattdessen einen muffigen Drillichanzug an, über den er sich wegen der Morgenkälte einen kragenlosen, abgeschabten Lodenmantel überhängen darf. Gegen sechs Uhr wird er vom Wachhabenden aus der Zelle geholt, an der Schreibstube vorbei in einen kahlen Raum geführt, wo schon ein Major mit aufgeschwemmtem Gesicht und der evangelische Pfarrer auf ihn warten. Es ist der 13. April 1940.
Zwei Soldaten und der Offizier führen ihn zu einem Wehrmachtslastwagen mit teils geschlossener Plane. Ihnen folgt der Pastor, mit dem er bis nach Mitternacht gesprochen und gestritten hat. Er will mitfahren, den Delinquenten nicht allein lassen. Nachdem Heinrich zustimmend genickt hat, wird er an den Füßen locker, an den Händen eng gefesselt und anschließend von Wachsoldaten hoch auf den LKW gehievt. Zwei andere Uniformierte stehen schon oben und packen ihn zwischen sich auf die Pritsche.
Ihm gegenüber nimmt der Geistliche Platz, betet nicht, redet nicht auf ihn ein, schaut ihn nur an und nickt manchmal wie aufmunternd. Diese Zurückhaltung erleichtert Heinrich ein wenig. Als der Motor anspringt, wird eilig noch etwas Verhülltes auf die Lastwagenplattform geschoben. Als dabei die darüber liegende Decke verrutscht, kommt die Ecke eines roh gezimmerten Kastens zum Vorschein. Hastig ziehen die beiden Wachen den Stoff wieder über das Holz, setzen sich dann sofort wieder neben Heinrich. Sie sagen nichts, aber wenden die Köpfe von ihm ab. Einer schaut stur nach vorn in Richtung Fahrerkabine, der andere wie abwesend nach oben, während der Pastor die Stirne kraust und missbilligend den Kopf schüttelt. Trotz der nächtlichen Mahlzeit bekommt Heinrich einen hohlen Bauch.
Nach einer knappen Viertelstunde rollen sie mit dem LKW durch die Vahrenwalder Straße und kommen an der Kriegsschule Hannover vorbei. Durch einen Schlitz in der flatternden Plane über der Ladefläche sieht Heinrich für einen Moment die beiden den Kaserneneingang flankierenden Vierkantsäulen, auf denen wie für ewig je ein steinerner Adler thront. Vorbei, gleich sind sie am Ziel. Am Rand des Brachgeländes der Kugelfangtrift in der Garnisonsschießanlage Vahrenwald, Maschinengewehrstand 8, finden die Hinrichtungen statt. Da das vor den Soldaten nicht ganz geheim zu halten ist, kursiert der Ort auch als Teil scherzhaft gemeinter Drohungen untereinander.
Der LKW hält an. Sie haben den Schießstand erreicht. Vier Soldaten holen den Gefesselten von der Ladefläche des Fahrzeugs herunter und tragen ihn einige Meter. Von Nordosten vernimmt Heinrich ein fernes Muhen, in der nahen Kugelfangtrift keckert aufgeregt eine Amsel. Heinrich erblickt vor sich einen dicken, dunkelbraunen Pfahl, etwa einen halben Kopf größer als er, der in den Erdboden eingelassen ist. Der Pfahl sieht frisch gestrichen aus und riecht nach Holzschutzmittel.
Am Pfahl werden ihm kurz die Handfesseln gelöst, doch sofort seine Hände hinter das Holz gedrückt und dort erneut gebunden. Jetzt wird es schlagartig hell, die Sonne schiebt sich zwischen zwei Wolkenhaufen hindurch. Heinrich dreht den Kopf nach links unten, bemerkt aus dem Augenwinkel die Stirnseite des abseits stehenden Holzsargs.
Als er den Kopf hebt und die Augen nach vorn richtet, sieht er, dass ihm schon zehn Soldaten gegenüberstehen, ganz feierlich im Dienstanzug mit Koppel, Stiefel, Stahlhelm und geschultertem Gewehr.
Nur einige Schritte weiter rechts bemerkt er noch weitere Soldaten, ebenfalls in Linie angetreten, aber ohne Schusswaffen. Es sind die hinzu kommandierten Zuschauer, weiß er, damit sie davon abgeschreckt werden, sich ihrem Dienst zu entziehen.
Die Zehn vor ihm mit den Karabinern stehen näher, als er sich das gedacht hat. Das sind nicht einmal fünf Meter. Da schießt wohl keiner vorbei. Auch gut. Geht schnell.
Der Major liest ihm mit tonloser, fast gelangweilter, aber etwas lispelnder Stimme noch einmal laut das Urteil vor. Auf das »Augen verbinden?« des Majors nickt Heinrich nur. Es geschieht und ihm wird dunkel. Plötzlich steht der Geistliche neben ihm und raunt etwas von Gottes Gnade in Heinrichs Schwärze hinein. »Still gestanden!«, bellt der Major. Kurze Pause, bis: »Gewehr ab!« Nach den typischen leisen Klappergeräuschen herrscht drei Atemzüge lang fast Stille, nur ferne Krähenrufe und leises Rascheln des zur Seite eilenden Pfarrers nimmt Heinrich noch wahr.
Während er noch hört: »Entsichern – anlegen – Feuer!«, gleiten Stines leicht geöffnete Lippen, der sommerliche Leinekanal, seine lächelnde Mutter in seiner Erinnerung übereinander. Es schlägt mehrfach hart in seine Brust ein, er krümmt sich, keucht, schmeckt Blut, riecht Modriges, fühlt brüllenden Schmerz. Dass sein Kopf auf die Brust sinkt, merkt er nicht mehr.
Kochstraße
Heinrich Friedrich Wilhelm Engelhardt wurde am 1. März 1919 in der Entbindungsanstalt in Linden bei Hannover zur Welt gebracht. Im Sternzeichen Fische, betonte seine Mutter scherzend gegenüber anderen, denen auffiel, dass Heinrich geradezu vernarrt war, sich im und am Wasser zu bewegen. Seine Mutter war die Magd Erna Frida Lina Engelhardt, geboren am 18. Dezember 1896 in Linden bei Hannover. Nach der Volksschule war sie als Magd zu einem Bauernhof in Everloh hinter dem Benther Berg geschickt worden, weil ihre besorgten Eltern nicht wollten, dass ihre ansehnliche Tochter im aufstrebenden Industrieort in schlechte, proletarische Gesellschaft kam.
Bei der Geburt ihres Sohns, sie war 23 Jahre alt, hatte ihr Dr. Liepmann geholfen, der ihr auch später bei Heinrichs Kinderkrankheiten jederzeit zur Seite stand. Vielleicht war er auch ein bisschen verliebt in die hübsche junge Mutter, der er berufsbedingt so nahe gekommen war. Heinrich kam als uneheliches Kind auf die Welt, daher trug er den Nachnamen der Mutter, Engelhardt. Den Namen seines leiblichen Vaters, des verheirateten Bauern aus Everloh, gab seine Mutter nie öffentlich preis. Vor ihrer sichtbaren Schwangerschaft hatte Lina, wie seine Mutter allgemein genannt wurde, mit Einwilligung des Bauern gekündigt und war zurück nach Linden zu ihren Eltern gezogen. Ebenso wie ihre Eltern, die sie mit Geld und bei der Wohnungssuche unterstützten, bestand der von ihr verheimlichte Vater darauf, dass Heinrich gemäß der lutherischen Konfession getauft wurde. Lina, die zwar offiziell evangelisch war, aber sich nach ihrer Konfirmation dem religiösen Leben entzogen hatte, fügte sich, zumal ihr der nach wie vor verheiratete, nun ehemalige Liebhaber unauffällige Unterstützung zugesichert hatte, bis Heinrich beruflich auf eigenen Füßen stehen würde.
Ab Mitte März 1919 wohnte sie mit ihrem Sohn in der Kochstraße, im nördlichen Teil der backsteinroten Stadt Linden, links der Ihme und Leine gelegen. Von deren rechten Ufern weitete sich das nahe fachwerkhohe Hannover nach Osten, Norden und Süden aus. Die Häuser in der Kochstraße wurden von älteren Leuten, die ihre Kindheit noch im bäuerlich geprägten Calenberger Land verbracht hatten, schon mal abfällig Mietskasernen genannt. Diese vierstöckigen Backsteinhäuser sahen tatsächlich alle gleich aus, hatten etwa die gleiche Raumaufteilung. Jüngere, die als Soldaten den Weltkrieg überlebt hatten, verwendeten die Bezeichnung Kaserne ebenfalls, aber weniger abwertend.
Im zweiten Stock bewohnten sie eine Küche, eine kleine Wohnstube, eine Kammer für seine Mutter, und eine zweite für Heinrich. Im Vergleich zu den meisten Gleichaltrigen genoss er eine sehr großzügige Wohnsituation, denn die mussten in ebensolchen vier Räume meistens zu viert, manchmal bis zu sechst oder gar acht leben. Ledige Personen, auch solche mit Kind, kamen als Untermieter oder Schlaf- oder Kostgänger oft nur mit einem Raum für sich zurecht, in welchem sich außer Bett, Stuhl, Waschschüssel und einem Schrank für das Nötigste nichts befand. Eine Schlafstätte mit einer Schwester oder einem Bruder zu teilen, war nichts Außergewöhnliches für Jungen seines Alters. Eine weitere Bequemlichkeit in der Kochstraße war das Klo auf halber Treppe, denn in vielen anderen Lindener Häusern war der Abtritt noch unten im Hof. Zu jeder Jahres-, Tagesund Nachtzeit musste dort die Stufen hinunter und aus dem Haus gegangen werden, um sich zu erleichtern. Wem das zu mühselig war, der blieb in der Wohnung und behalf sich zeitweise mit einem Nachttopf. Schon der kleine Heinrich mochte dieses Nachtgeschirr nicht und lief auch in eisigen Winternächten lieber die halbe Etage hinunter, um abgeschieden in der Toilette seine Notdurft zu verrichten.
Eigentlich stand ihnen dieser vergleichsweise große Wohnraum nicht zu, vermutete Heinrichs Mutter. Und sie war sich sicher, dass der wohlhabende Bauer aus Everloh dahinterstecke, der vieles im Verborgenen bewirkte. Insgesamt, sagte sie sich, habe ich trotz meiner ungewollten Schwangerschaft einfach Glück gehabt, danach noch mehr mit meinem lieben und von Beginn an sehr umgänglichen Sohn.
Als der kleine Heinrich drei Jahre alt war und die Inflation besonders zu wüten begann, waren die ihr von Heinrichs Vater unter der Hand zugeschobenen Scheine immer weniger wert, egal wie groß die Zahlen auf ihnen wurden. Andererseits verlor sie auch nichts an Vermögen, da sie, im Unterschied zu einigen ihrer Nachbarn, kein Geld auf einer Sparkasse hatte. Jammern hatte sie sich schon als Kind abgewöhnt, als sie noch bei ihren Eltern in einem buckligen Fachwerkhaus in der Weberstraße gewohnt hatte.
Der nach außen biedere und treue Gemahl der Bäuerin ließ ihr nun an Markttagen in Linden über einen vertrauten Knecht Naturalien zukommen, Butter, Milch, Gemüse, Eier und Fleisch. Teils verzehrte sie diese mit ihrem Sohn, teils tauschte sie die Lebensmittel gegen einfache Kosmetika und Kleidung ein, wobei ihr ihre Aushilfstätigkeit im Kolonialwarenladen zahlreiche Kontakte zu Frauen verschaffte, die Lebensmittel benötigten.
So lange die Ehefrau mit dem Bauern zusammenlebte, würde er seine ehemalige Geliebte mit seinem Sohn nicht fallenlassen, da war sich Lina sicher, und so lange war sie vor Verelendung gefeit. Zwar hatten auch ihre Eltern ihr manchmal Lebensmittel zukommen lassen, nach 1923 mussten die sich aber am Rande der Existenz durchschlagen.
In der Kochstraße wuchs Heinrich nicht nur mit Kindern jeglichen Alters auf, sondern auch mit Geräuschen und Gerüchen verschiedenster Art, die er bald den sie verursachenden Lebewesen oder Geräten zuordnen konnte. Im Hof hinter dem Haus befand sich in einem einstöckigen Gebäude eine Schneiderwerkstatt, wo es meistens ruhig zuging, bei offenem Fenster nur Scheren leise klapperten und warmer Bügeleisengeruch herausdrang. Aus einem benachbarten Haus, näher an der Limmerstraße, quiekte mittags öfter ein Schwein, ein paar Häuser weiter wurden sogar zwei Schweine im Hinterhof gehalten. Ihre Gerüche drangen bei Südwind in Heinrichs Nase, das Quieken und manche Schimpfereien der Tierhalter gehörten dazu.
Etwas weiter weg, an der Ecke zur Limmerstraße, wurde in einer Stellmacherei gearbeitet. Als Heinrich schon etwas lesen konnte, erfuhr er von einem großen Schild an dem Firmengebäude, dass dort Luxus-, Geschäfts- und Lastwagen angefertigt wurden. Hölzerne Wagen mit langen Deichseln zum Anschirren von Pferden hatte er bis dahin im Werkstatthof gesehen, aber was ein Luxuswagen sein soll, konnte er sich nicht vorstellen.
Das Klopfen beim Einhauen der Holzspeichen, die zum Ofenanmachen begehrten Holzspäne und natürlich der Geruch nach den Hölzern, den er einsog, wenn er auf die Limmerstraße ging, mochte er. Nichts war dabei, was seine empfindliche Nase verärgerte, seine Ohren mit schepperndem Krach belästigte, ganz anders als es die zunehmende Zahl der Kraftfahrzeuge tat.
Es wurden Wagenräder, Leiterwagen für kräftige Gäule hergestellt, manchmal ein Einspänner, eine Kutsche, an der nach Fertigstellung ein schlankes Pferd angespannt wurde. Diese Fahrzeuge, erklärte ihm seine Mutter, als sie mit Heinrich ein zweirädriges mit einer eleganten Sitzbank vom Werkstatthof fahren sah, das sind die Luxuswagen, so etwas kaufen sich reiche Leute, für uns wird so etwas nicht gebaut.
»Wir sind doch alle gute Sozialdemokraten«, hörte Heinrich öfter in der Kochstraße, auch dass man eine bessere Welt als diese mit Not und Plage wolle und niemand sehr reich oder sehr arm sein müsse. Uniformierte mit Schirmmützen und Lederstiefeln, die keine Polizisten, sondern Nazis waren, durften sich hier nicht blicken lassen. Wobei die Polizei auch nicht gern gesehen war.
Zu Essen bekam Heinrich reichlich und wurde immer satt. Schmackhafte Suppen, Eintöpfe, Pellkartoffeln mit Quark gab es oft, auch mal Milchreis mit Pflaumenkompott, seltener einen Vanille- oder gar Schokoladenpudding.
Im Unterschied zu vielen anderen Familien hatten Heinrich und seine Mutter meistens genug Kuhmilch zur Verfügung, als in der Zeit der Geldentwertung viele Frauen vor den Geschäften Schlange standen, um letztendlich oft nur mit Wasser gestreckte Milch kaufen zu können. Angeblich gab es sowieso zu wenig von diesem wichtigen Lebensmittel und zudem, so ging das Gerücht, machten die Bauern lieber Butter aus dem Gemolkenen, da sich die besser und länger hielt und vor allem mehr Geld einbrachte. Ob sich das mit ihrem Ehemaligen auch so verhielt, erfuhr Lina nicht. Ihre Zweiliterkanne, die sie von einem Everloher Knecht auf dem Lindener Marktplatz bekam, war immer einwandfrei gefüllt. Wenn die junge Mutter nicht alles für ihren Sohn und sich verbrauchte, tauschte sie schon mal eine kleine Kanne Milch gegen Kartoffeln, Sauerkraut oder Gemüse ein. Lina hatte nie gekochte, gebratene, gebackene Steckrüben als Hauptnahrungsmittel zu sich nehmen müssen, wie es in Linden im Jahr vor Heinrichs Geburt gewesen sein soll – so wurde ihr jedenfalls in den Zwanzigern erzählt. Als Magd auf dem großen Hof in Everloh hatte sie im letzten Kriegsjahr ganz nahrhaft essen können, bevor sie schwanger wurde. Dafür hatte der Bauer gesorgt, der seiner Geliebten in ihrer kleinen separaten Kammer neben der Küche ausgesuchte Köstlichkeiten mitbrachte, wenn seine Gemahlin mal wieder mit dem Einspänner nach Hannover gerollt war und für einige Nächte bei ihrer Schwester in der Oststadt wohnte.
Bloß Fleisch gab es bei Heinrichs Mutter nie, aber Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Gewürzgurken dazu schon. Der würzige Zwiebelduft machte ihn manchmal neugierig auf gebratenes Fleisch, das aus anderen umliegenden Küchen duftend lockte, von dem seine Mutter aber sagte, dass dafür lebendige Tiere umgebracht würden. Draußen zeigte sie auf Kaninchen hinter Maschendrahtkästen oder die Schweine nebenan: »Um die zu essen, muss man sie vorher töten.« Das zu hören, behagte ihm gar nicht, aber seine Neugier, das mal zu probieren, was so appetitlich roch, verschwand damit nicht. Seine Mutter sagte ihm immer wieder, Fleisch sei schädlich und mache die Jungs später, wenn sie Männer würden, übellaunig und böse. Er solle sich an Milch und Käse halten, Eier seien auch bekömmlich, Brot und Gemüse sowieso.
Auf sorgfältiges Putzen und Flicken legte seine Mutter großen Wert, wobei die wie aus dem Nichts kommenden, dreckigen Fusselgebilde auf dem Fußboden sie manchmal fast rasend machten. Im steten Kampf gegen diese Staubmäuse schimpfte sie schon mal so erbittert, wie es Heinrich von ihr sonst nicht kannte. Sie fegte und wischte die Holzbohlenböden, rieb sie manchmal mit Bohnerwachs ein, aber der sich ballende Dreck kam bald wieder wie aus den Dielenritzen herausgepresst.
Zu Beginn der Zeit in der Kochstraße miefte es meistens etwas schwefelig, weil seine Mutter nur minderwertige Kohlen bekommen hatte. Später, als sie mehr Geld hatte, war es im Winter nicht bloß wärmer, sondern es roch auch besser. An den Wochenenden kamen zum Essensduft noch zwei weitere Aromen hinzu. Sie badete am Samstagabend zuerst ihren Sohn, dann sich in der ovalen Zinkwanne, sodass es nach guter Seife und Haarwaschmittel duftete. Meistens weichte sie anschließend, noch mit dem dicken Handtuch um ihr langes Haar, die schmutzige Wäsche in der gleichen Wanne mit Schmierseife ein, ließ sie in der scharf riechenden Lauge über Nacht stehen und wusch sie am Sonntagvormittag.
Einen Teil ihres Unterhalts verdiente sich Heinrichs Mutter mit Aushilfsarbeiten in einem Kolonialwarenladen. Dieses Geschäft, zu dem auch eine Sauerkrautfabrik und Gurkeneinlegerei gehörte, befand sich nicht weit entfernt in der Viktoriastraße. Wenn Heinrich von seiner Mutter mal mitgenommen wurde, sog er kräftig den Geruch gärenden Krauts ein, der je nach Zustand seiner Reife vom würzigeren Essigaroma frisch eingelegter Gurken überlagert wurde. Innen im Ladengeschäft beschäftigten Heinrich zarte Geruchsspuren von Dingen und Lebensmitteln, die er nicht kannte, aber von seiner Mutter beim Namen genannt wurden. Sie hatte sich während ihrer Stunden als Verkäuferin im Kolonialwarenladen mit einer Kundin, einer etwas älteren Witwe, angefreundet, die bequeme Reformkleidung trug, von vegetarischer Ernährung sprach und der Unnatürlichkeit strenger und religiöser Erziehung. Ihr freundlicher und gelassener Umgang mit sich und anderen beeinflusste Lina. Sie begann, von dieser Frau zu lernen und sich noch weiter von ihren anerzogenen Lebensvorstellungen zu lösen, als sie es ohnehin schon mit dem heimlichen Liebesverhältnis in Everloh ohne Reue praktiziert hatte.
Heinrichs leiblicher Vater, der Bauer aus Everloh, direkt hinter dem Benther Berg, hatte ihr diese Arbeit vermittelt. Heinrichs Mutter wusste, dass ihr einstiger Liebhaber eine Mordsfurcht vor seiner Frau hatte und ihr um fast jeden Preis seinen Ehebruch verheimlichen musste. Da seine ehemalige Magd mit ihren dunkelblonden Locken und der Stupsnase nicht nur hübsch aussah, sondern auch sehr energisch sein konnte, lag ihm sehr daran, sie bei guter Laune zu halten. Von seiner kränkelnden Angetrauten hatte er bisher keine Kinder bekommen, wusste Lina. Wenn das so bliebe, so hoffte sie, käme sein einziger Sohn später als Erbe infrage. Erst einmal zahlte er ihr, die den leiblichen Vater vor der Behörde als unbekannt angegeben hatte, im Gegenzug so etwas wie ein Schweigegeld, das so gerade zum Leben von Lina und Heinrich reichte. Einmal im Monat kam ein schlichter Brief an sie, der einige Scheine enthielt.
Über den Lebenswandel ihrer Tochter waren ihre Eltern anfangs mehr erschrocken als entsetzt gewesen. Da Lina sich vor ihnen nicht klein machte und liebevoll für ihren eher stillen Sohn sorgte, die Großeltern schon den kleinen Heinrich als freundlichen Enkel mochten, hatte sich ihr Verhältnis zur Tochter und jungen Mutter jedoch in kurzer Zeit entspannt.
Heinrich war schüchterner als andere Kinder in der Straße und später als seine Mitschüler. Doch das bedeutete nicht, dass er sich nicht durchsetzen konnte, wenn er es für nötig hielt. Sein Spielzeuglastwagen aus Holz lieh er auf Bitten bereitwillig aus, bestand aber nach einigen Minuten so lange energisch auf dessen Rückgabe, bis er ihn wieder in den Händen hielt. Bevor er sich auf andere Kinder einließ, blieb er eine Weile abseits stehen, beobachtete sie, bis er sich mit ihnen abgab. Passten ihm ihre Spiele nicht, weil es um Kriege gegen andere Länder, Marterpfähle oder Kolonialkämpfe ging, ließ er es bleiben. Verstecken, Fangen, Ballabwerfen oder Glasmurmelspiele machte er mit, wenn ihm die Beteiligten gefielen.
In einem Sandhaufen konnte er ganz für sich kleine Häuser, Mauern und Wege anlegen, wobei er ganz zufrieden wirkte und niemanden zu vermissen schien. Manche Kinderbücher mit gemalten Bildern von Bauernhöfen, Ritterburgen und fremden Tieren ließen ihn offenbar in anderen Welten leben. Allein spielend, ob mit Sand, Zweigen oder den hölzernen Figuren, Häusern und Fuhrwerken eines Baukastens, schien er mit dem Kopf weit fort von seiner sonstigen Umgebung zu sein.
Wenn er plötzlich aus dem Spielen oder Betrachten durch seine Mutter oder andere Kinder herausgerissen wurde, zeigte sich seine Empfindlichkeit. Der sonst eher ruhige und freundliche Junge reagierte mit stummem Unmut. Oft sogar versuchte er sich trotzig weiter allein zu beschäftigen, tat, als ob er nichts vernommen hätte, ignorierte die Störung, aber wurde nie laut. Meistens ließen ihn die anderen nach einer Weile in Ruhe, zeigten ihm lediglich einen Vogel, winkten ab und meinten: »Lass ihn, den Eigenbrötler.« Wenn seine Mutter ihn in die Arme nahm, über seine dunkelbraunen Locken strich und ihm kopfschüttelnd sagte: »Nun lass mal gut sein, mein kleiner Trotzkopf«, dann widerstrebte er nicht mehr, sich aus seiner Versunkenheit zu lösen und genoss die körperliche Nähe seiner Mutter.
Bei Regen, wenn Luft und Straßenboden noch nicht zu kalt waren, ließ Heinrich durch die Bordsteinrinnen Schiffe gleiten, aus Zeitungspapier gefaltet, die außen ganz dünn mit Schmalz oder Fett eingeschmiert wurden, damit sie im Regenwasser nicht so schnell aufweichen und sinken konnten. Das konnte ihn stundenlang beschäftigen, allein oder mit anderen Kindern in der Straße, auch wenn seine Hände beim Bauen kleiner Häfen aus Steinen und Grassoden vor Kälte manchmal wachsfarben wurden.
Lina kam mittlerweile gut zurecht, hatte aber nicht nur während der sechs Werktage genug zu tun mit dem Haushalt, der Versorgung ihres Sohns und der manchmal noch am Samstag nötigen Arbeit im Kolonialwarenladen, sodass ihr wenig freie Zeit blieb. Dennoch kam das Lesen von Büchern, Broschüren und einer Tageszeitung – aus der sie manchmal auf sein Bitten hin ihrem Sohn vorlas – bei ihr nicht zu kurz. Besonders solche Druckwerke interessierten sie, in denen neuartige Vorschläge zum Essen und sich zu kleiden standen, ja sogar die wie selbstverständlichen männlichen Vorrechte infrage gestellt wurden. Abends, wenn Heinrich schlief, nahm sie auch mal einen Roman zur Hand, las aber nie lange, weil es sie schon vor zehn Uhr ermüdet ins Bett zog. Manchmal durfte Heinrich das Bett »vorwärmen«, wie sie sagte. Kam sie, wurde er kurz wach und schmiegte sich an seine Mutter, schlief, seinen Kopf an ihren weichen Arm gedrückt, schnell und ruhig ein, während sie noch über den vergangenen und kommenden Tag sinnierte.
Besonders an späteren Samstagabenden, wenn sie noch einmal vor die Tür ging, musste sich Lina öfter der Belästigung durch einige angeheiterte oder betrunkene Ehemänner erwehren, denen sie als Ledige wie Freiwild erschien. Fasste sie einer an, schlug sie ihm kommentarlos die Hand weg und ging weiter. Selbst die Ehefrauen, die Lina manchmal unterstützte, wenn sie schwanger oder krank waren, musterten sie manchmal misstrauisch, auch wenn Lina keinen aus der Kochstraße an sich heranließ.