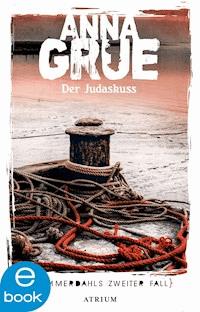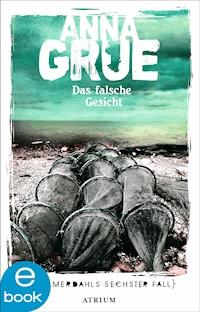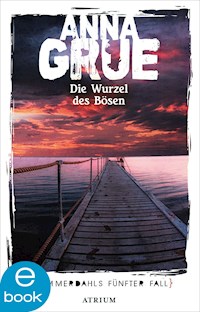Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atrium Zürich
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dan Sommerdahl
- Sprache: Deutsch
Mit ihren Krimis um den kahlköpfigen Detektiv Dan Sommerdahl führt Anna Grue Dänemarks Bestsellerlisten an. Raffinierte Fälle, Biss und Witz sind die Markenzeichen dieser Serie, bei der es um die Menschen, die Liebe und das Leben geht - das hin und wieder ein gewaltsames Ende findet. In der beschaulichen Kleinstadt Christianssund, malerisch an einem Fjord gelegen, gibt es einen kleinen Hafen, ein schickes Villenviertel, eine hässliche Fußgängerzone - und seit Neuestem eine Leiche. In einer Werbeagentur ist die Putzfrau ermordet worden. Bei den Ermittlungen stößt Kommissar Flemming Torp sofort auf Schwierigkeiten: Keiner kennt den Nachnamen der Frau, die seit Jahren ebenso effektiv wie unbemerkt hinter den Werbern aufgeräumt hat. Torp zieht widerwillig seinen Jugendfreund, den Werbefachmann Dan Sommerdahl hinzu, der Torp vor Jahren die Freundin ausgespannt und sie geheiratet hat. Nach einem Burn-out wollte Sommerdahl seiner Branche eigentlich den Rücken kehren; nun steckt er plötzlich wieder mittendrin. Und während er gemeinsam mit Torp den Mörder jagt, muss Sommerdahl feststellen, dass seine Frau und der Kommissar sich noch immer viel zu erzählen haben ... Mit Leseproben zu weiteren spannenden Fällen von Dan Sommerdahl.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Rune
– meinen Erstgeborenen
In ein paar Stunden werde ich ein Mörder sein. Eigentlich müsste mich der Gedanke zu Tode erschrecken, doch wenn ich ganz ehrlich sein soll, beschäftigt mich im Augenblick mehr mein rechtes Bein, das eingeschlafen ist. Vor einigen Minuten fing ich an, das Gefühl darin zu verlieren, und kurz darauf kribbelte es, als würde ich von Tausenden winzig kleiner Nadeln gestochen. Das Problem ist die Wartezeit, die ich in einem Schrank verbringe, der so eng ist, dass ich mich buchstäblich nicht bewegen kann, ohne an etwas zu stoßen. Das Risiko, dass mich jemand hören könnte, ist also verhältnismäßig groß. Und irgendjemand befindet sich noch im Gebäude, da bin ich ziemlich sicher. Jedenfalls höre ich von irgendwoher Musik. Vermutlich hätte ich mehr Platz, wenn ich den Schrank mit den Putzmitteln gewählt hätte, nur konnte ich mich aus verständlichen Gründen dort nicht verstecken. Ich versuche, ein wenig mit dem Fuß zu wippen, um die Muskeln des Knöchels zu strecken und zu dehnen, habe aber das Gefühl, als würden sich die Nadeln nur noch tiefer ins Fleisch bohren. In ein paar Sekunden werde ich mir die Hand auf die Lippen legen müssen, um ein Jammern zu unterdrücken. Lautlos verfluche ich mich selbst. An so etwas hätte ich vorher denken müssen. Allerdings wäre ich überhaupt nicht in diese Situation geraten, wenn ich mir das vorher so genau überlegt hätte. Dann würde ich heute Abend ins Bett gehen können, ohne das Leben eines anderen Menschen auf dem Gewissen zu haben, und Lilliana würde weiterleben, ohne auch nur zu ahnen, wie erleichtert sie sein müsste.
Mir kommen beinahe die Tränen. Es ist zehn nach sechs. Wollen die Letzten denn nicht bald mal nach Hause? Möglicherweise ist es hier längst menschenleer? Vielleicht hat nur einer der Grafiker vergessen, sein Radio auszuschalten? Soll ich es wagen? Wenn mich jemand in dieser Situation erwischt, ist das Spiel aus. Dann muss ich von vorn anfangen, einen anderen Zeitpunkt finden, eine andere Methode, ein neues Alibi … Vorsichtig winkele ich den Arm an. Der Plastikoverall knattert wie ein Festzelt im Sturm, und die blauen Plastikhüllen, die ich über die Schuhe gezogen habe, sind auch nicht gerade geräuschlos. Das Haarnetz und die Gummihandschuhe kann man nicht hören – aber ich wünschte, ich hätte sie nicht angezogen! Klebrige Tropfen aus Schweiß sammeln sich am Haaransatz, unter den Achseln und auf dem Rücken. Und ich muss hier noch mindestens drei Stunden ausharren.
Noch einmal versuche ich, mich anders hinzustellen; vorsichtig lehne ich mich an den Rand einer Pappkiste und bemühe mich, ruhig zu atmen. Die Minuten schleppen sich dahin. Plötzlich kommt jemand in die Küche und bleibt ein paar Meter von meinem Versteck entfernt stehen. Ich habe das Gefühl, als würde mein Herz im Hals schlagen oder direkt unter dem Kehlkopf festsitzen. Ich atme so lautlos wie möglich und richte mich vorsichtig auf. Durch einen Spalt der Lamellentür sehe ich, dass Anders K. dort draußen rumort. Er pfeift leise und unmelodisch, während er den Kühlschrank untersucht. Er nimmt sich eine Scheibe Graubrot und ein paar Schokoladenplättchen, dann geht er. Nicht mal die Brottüte hat er wieder verschlossen. Das überlässt er vermutlich Lilliana – als hätte sie nicht genug zu tun. Typisch für dieses aufgeblasene Arschloch! Ich will mich gerade richtig aufregen, als mir einfällt, dass das, was ich Lilliana bald antun werde, sehr viel schlimmer ist, als sie eine Tüte aufräumen zu lassen. Ich lehne mich zurück und versuche, mich zu entspannen. Glücklicherweise spüre ich wieder etwas im Bein; ich verlagere das Gewicht von einem Fuß auf den anderen, wippe mit den Füßen und bleibe ständig in Bewegung, damit das Bein nicht noch einmal einschläft.
Eine Stunde später hört die Musik auf. Schnelle, feste Schritte nähern sich. Wieder ist es Anders K., jetzt trägt er seine Skaterjacke. Sie ist viel zu jugendlich und zu lang für ihn. Wie alt ist er? Vielleicht achtunddreißig oder neununddreißig. Und latscht noch immer in Klamotten für Teenager rum. Werd endlich erwachsen, Mann! Er füllt ein großes Bierglas mit Wasser aus dem Automaten, leert es in wenigen Zügen, stellt es auf den Küchentisch und verschwindet. Einen Augenblick später ist er am Empfang und legt den Hauptschalter um. Sämtliche Lampen auf der Etage verlöschen, um mich herum wird es stockfinster. Die Eingangstür fällt zu. Er hat vergessen, den Alarm zu aktivieren. Und noch immer dauert es mehr als eine Stunde, bis um neun die Putzkolonne kommt … Jemand sollte dem Personal morgen die Vorschriften in Erinnerung rufen, wenn … Aber nein. Mir geht durch den Kopf, dass morgen kein ganz gewöhnlicher Tag sein wird. Das morgendliche Meeting wird auf jeden Fall abgesagt. Und viel gearbeitet wird sicherlich auch nicht. Die meisten Mitarbeiter werden für den Rest der Woche vermutlich massive psychologische Unterstützung brauchen und in den nächsten Monaten in irgendeiner Gruppentherapie Socken stricken, denn der Schock über Lillianas Tod wird traumatisch für sie sein. Weicheier. Als ob auch nur einer von ihnen sonst je einen Gedanken an das Reinigungspersonal verschwendet hätte. Nur die wenigsten von ihnen wissen überhaupt, wie Benjamin und Lilliana aussehen, geschweige denn, wie sie heißen. Und nur eine Handvoll von ihnen hat je bis 9.00 Uhr abends bleiben müssen, obwohl der ganze Verein unablässig stöhnt, dass so viel zu tun sei, und … Ich spüre, wie mein Blutdruck steigt, besser, ich halte meine Gedanken im Zaum. So geht das nicht. Ich muss in der Lage sein, meine Aufgabe zu erledigen, ich muss mich zwingen, ruhig zu bleiben. Die meisten Fehler werden im Affekt begangen. Du weißt, dass du es kannst, sage ich mir immer wieder. Eiskalt bleiben. Immer ruhig Blut.
Ich zwinge meine Atmung in einen gleichmäßigen Rhythmus, atme durch die Nase ein und durch den Mund aus, langsam ein und aus, langsam … Mir geht es bereits besser. Vorsichtig öffne ich die Schranktür und gehe in der stockfinsteren Küche ein wenig auf und ab, strecke die Arme über den Kopf, beuge mich vornüber und berühre mit den Fingerspitzen den Fußboden, richte mich auf, beuge mich mehrmals nach links und nach rechts, nach vorn und zurück. Der Zeltwand-Overall knistert. Ich spüre, wie mein Kreislauf langsam wieder in Schwung kommt, wie die Steifheit in den Gliedern nachlässt. Ich nutze mein Handy als Taschenlampe und finde ein Einwegglas in einem Unterschrank, fülle es am Wasserhahn mehrmals bis zum Rand und trinke es gierig ein ums andere Mal aus. Nachdem ich meinen Durst gelöscht habe, stecke ich das Glas in die Plastiktüte, die ich auf dem Schrankboden bereitgelegt habe. Hier kommen auch die Handschuhe, das Haarnetz, der Plastikoverall und die Schuhhüllen hinein, wenn alles überstanden ist. Und die Mordwaffe, selbstverständlich. Das Ganze will ich heute Nacht auf dem Heimweg loswerden, vielleicht in einem der großen Container bei den Baugerüsten in der Østergade.
Um 20.52 Uhr höre ich, wie jemand den Code eingibt und die Eingangstür sich öffnet. Ich verschwinde in dem Moment wieder im Schrank, als im ganzen Gebäude Licht aufflammt. So, jetzt ist es so weit. Benjamin kommt zuerst in die Küche. Ich ziehe mich ein paar Zentimeter zurück, damit man mich nicht durch die Ritzen sehen kann. Seine lange, hagere Gestalt erscheint in einem schwarzen T-Shirt, abgetragenen Jeans und nagelneuen weißen Sneakers. Das schulterlange dunkle Haar ist zu fettigen Dreadlocks verfilzt, die ihm jedes Mal ins Gesicht fallen, wenn er den Kopf bewegt. Seine Haut ist blass und unrein, die Nase voller großer schwarzer Mitesser. Ein Piercing in der Augenbraue vollendet das unappetitliche Bild. Ich schüttele mich. Gut, dass man seinen Anblick nicht bei Tage ertragen muss! Er öffnet den Kühlschrank und schnappt sich mit einer routinierten Bewegung eine Halbliterflasche Cola. Das macht er jeden Abend. Ich rechne aus, was das die Firma kostet, im Monat, im Jahr – eine Menge Geld. Von meinem Versteck aus sehe ich ihn die Hälfte der Cola trinken. Er rülpst lauthals, lehnt sich, den Hintern halb auf der Tischkante, an den Küchentisch, lässt sich hängen. Was für ein durch und durch abstoßendes Wesen. Der Gedanke ist geradezu erfrischend, dass er höchstwahrscheinlich von Anfang an der Hauptverdächtige der Polizei sein wird.
Als Lilliana zur Tür hereinkommt, rülpst Benjamin noch einmal. Sie runzelt nur die Brauen, sagt aber nichts, während sie sich an ihrem Kollegen vorbeidrückt und direkt zu der Schublade geht, in der die schwarzen Abfallsäcke liegen. Sie reißt zwei Säcke ab und verlässt die Küche wieder. Es ist sein Job, die Papierkörbe zu leeren, und wenn er damit fertig ist, holt er das benutzte Geschirr und die leeren Limonadenflaschen aus den Büros. Später bringt er dann den Müll zum Schuppen, auch das gehört zu seinen Aufgaben. Ich kenne ihre Arbeitsabläufe so gut wie sie selbst. Ich habe sie ja beobachtet. Abend für Abend. Nein, ich habe natürlich nicht in diesem lächerlichen Schrank gestanden und sie ausspioniert. Dazu ist meine Zeit dann doch zu kostbar. Aber eine oder drei kleine versteckte Kameras können Wunder vollbringen. Nanny Cam nennen sie so etwas in den USA. Unglaublich, was man alles im Netz kaufen kann. Ich habe ausgezeichnete Aufnahmen, stundenlang, man kann die Zeit für bestimmte Abläufe stoppen und in eine Tabelle übertragen. Ich bin ein guter Planer, denke ich und lächele vor mich hin. Ich bin gut. Es wird zweifellos alles klappen.
Lilliana hat ihr geblümtes Kopftuch wie eine Melkerin stramm um den Kopf gebunden. Eine einzelne Strähne hängt heraus und beschreibt einen sanften Bogen auf ihrer glatten, hellen Stirn. Hinten quillt ihr Haar unter dem bunten Dreieck des Kopftuchs hervor. Ihre Wangenknochen sind hoch und markant, sie lassen ihre Augen ein wenig schräg aussehen. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen, vermutlich kann sie nachts nicht schlafen, weil sie an so vieles denken muss. Schon in anderthalb Stunden werde ich dich von alldem befreien, Lilliana, und ich wünschte, ich könnte es schon ein wenig früher beenden, dann müsstest du nämlich nicht mehr putzen. Aber ich bedauere, du musst dich noch etwas gedulden. Sie verschwindet aus meinem Blickfeld, ich höre, wie sie den großen Industriestaubsauger über die Schwelle des Putzraums bugsiert. Kurz darauf beginnt sie zu saugen, und ich lehne mich zurück und warte. Jetzt, wo der Zeitpunkt des Mordens näher rückt, merke ich, wie meine Bewegungen präzise und kontrolliert werden, wie sich meine Sinne schärfen; ich höre jedes noch so kleine Geräusch, spüre, wie jeder einzelne Muskel bereit ist. Die Schweißperlen sind verschwunden, genau wie die Steifheit in den Gliedern, das eingeschlafene Bein. Es gibt nur noch einen gut funktionierenden Körper, der weiß, was ich von ihm erwarte. Als ob die Alarmbereitschaft den Körper veranlasst hätte, bestimmte Nervenbahnen zu schließen, damit er sich auf andere konzentrieren kann.
Wenn alles so abläuft wie immer, bleiben noch genau fünfundfünfzig Minuten. Ich strecke und biege die Finger, überprüfe noch einmal meine selbst gebastelte Mordwaffe. Es ist eine Garotte, gefertigt aus einem Stück kräftiger, mit Plastik überzogener Wäscheleine, circa einen halben Meter lang, mit einer Schlinge an beiden Enden. Die Länge der Schnur habe ich exakt berechnet: der vermutliche Umfang des Halses plus einige Zentimeter, um die Schnur mithilfe eines Metallkugelschreibers zusammenzudrehen. Nach zahlreichen Experimenten erscheint mir der Kugelschreiber für dieses Vorhaben am besten geeignet zu sein. Ich habe zu Hause an einem zusammengerollten Sofakissen geübt, bis das Ganze optimal funktionierte – und zur Sicherheit habe ich zwei Exemplare mitgenommen. Allein die Vorstellung, nur einen Kugelschreiber dabeizuhaben und der dann eventuell mittendrin bricht … Ich höre dem Brummen des Staubsaugers zu. Es entfernt und nähert sich, je nachdem, wo Lilliana sich in der Bürolandschaft gerade befindet. Benjamin kommt in die Küche, er kratzt Essensreste und zusammengeknüllte Servietten von den Tellern, die er auf den Schreibtischen eingesammelt hat, und verschwindet dann wieder.
Lilliana hat jetzt die Küche erreicht, ich beobachte, wie sie die Staubsaugerbürste systematisch über den Boden gleiten lässt. Hin und her, bis in die Ecken. Der Jogginganzug lässt sie unförmig erscheinen, er verbreitert ihre Taille, sie wirkt älter. Dann verschwindet sie auf dem Flur, der Staubsauger bleibt stumm, sie stellt ihn an seinen Platz im Putzraum. Ich höre Benjamin, aber ich sehe ihn nicht. Er wischt den Boden des Büros, das laut Arbeitsplan heute an der Reihe ist. Alle Böden werden turnusmäßig einmal in der Woche geputzt, wie ich herausgefunden habe. Abgesehen von der Küche und den Toiletten natürlich. Dort wird jeden Tag gewischt.
Noch achtundzwanzig Minuten. Lilliana kommt noch einmal in die Küche. Sie füllt einen der viereckigen blauen Eimer mit Seifenlauge und geht wieder hinaus. Jetzt wischt sie über die Schreibtische und Regale. Nicht alle Schreibtische und nicht alle Regale, aber hier und da, wo sie es gerade für notwendig hält. Es wird nicht unbedingt tipptopp geputzt, aber vermutlich so sorgfältig wie in den meisten anderen Büros auch. Benjamin wischt den Küchenboden mit dem großen Mikrofasermopp. Sjup-sjup-sjup. Es geht blitzschnell. Jetzt kippt er das schmutzige Wasser in die Toilette. Das ist mein Signal. In den nächsten zehn Minuten wird er die Müllsäcke einsammeln und in den Schuppen bringen. Für den Weg braucht er nur eine Minute, aber auf dem Rückweg wird er wie immer eine Zigarette rauchen. Das verschafft mir mindestens sieben Minuten, und wenn Lilliana sich dort befindet, wo sie sich normalerweise zu diesem Zeitpunkt aufhält, habe ich Zeit genug.
Jetzt kommt sie in die Küche, gießt den Inhalt des blauen Eimers in die Spüle, stellt ihn an seinen Platz und fängt mit der letzten Reinigungsphase an. Sie fährt mit einem blauen Lappen über den Küchentisch, die Mikrowelle, die Kaffeemaschine. Es sind deine letzten Handlungen in diesem Leben, Lilliana, ich hoffe, du denkst dabei an etwas Schönes. Jeder Muskel in meinem Körper ist gespannt, ich horche wie ein Wahnsinniger, und dann ist es so weit: Die Abfallsäcke knistern irgendwo außerhalb der Büros, Benjamins Schritte verhallen jenseits der Eingangstür. Ich höre, wie die Tür hinter ihm zufällt, gerade als Lilliana sich über die offene Spülmaschine beugt, um Wasserenthärter und Spülmittel in die kleinen Kammern zu füllen. Ich greife die Garotte mit beiden Händen und schiebe die Schranktür mit der Schulter auf. Lilliana dreht mir den Rücken zu, den Kopf hat sie gesenkt. Noch hat sie mich nicht gehört. Die marineblaue Jogginghose spannt über ihrem Hinterteil, der Pferdeschwanz ist nach vorn gefallen.
Als ich den ersten Schritt auf sie zugehe, lärmt mein Overall mehr als je zuvor. Sie richtet sich auf und dreht sich um. In den folgenden Sekunden lösen sich eine Serie von Ausdrücken in ihrem Gesicht ab: aufgerissene Augen, als sie entdeckt, dass jemand hinter ihr steht; der Ansatz eines vorsichtigen Lächelns, als sie mich erkennt; eine Falte zwischen den Augenbrauen zeigt ihre Verwunderung, als sie das Haarnetz, die Latexhandschuhe und das kleine Stück Wäscheleine registriert. In ihren Augen sehe ich, wie sich diese Puzzleteilchen plötzlich zu einem klaren Bild zusammensetzen. Sie dreht sich um und will zur Küchentür laufen. Sie ist schnell, aber glücklicherweise nicht schnell genug. Noch bevor sie den ersten Schritt getan hat, habe ich ihr die Garotte um den Hals geschlungen, und von diesem Augenblick an geschieht allein, was ich will. Ich ziehe die beiden Schlingen zusammen und verdrehe sie mit ein paar raschen Bewegungen. Lilliana zappelt mit Armen und Beinen, versucht verzweifelt, meine Hände zu erreichen, ihren Körper zu mir zu drehen, doch mich kümmert ihre Panik überhaupt nicht, ich konzentriere mich hundertprozentig auf mein Vorhaben. Nachdem ich den Kugelschreiber durch die beiden Schlingen gesteckt habe, ist es verhältnismäßig einfach. Ich halte das zusammengezwirbelte Stück mit der einen Hand, während die andere Hand den Kugelschreiber immer wieder herumdreht und die Schnur sich mehr und mehr strafft. Ich spüre, wie die Leine sich durch ihre Haut arbeitet, in ihr Fleisch schneidet. Ihre Bewegungen werden langsamer und kraftloser, als würde sie versuchen, in dickflüssigem Wasser an die Oberfläche zu schwimmen. Schließlich hängen ihre Arme schlaff herab, ich habe nicht die Kraft, sie aufrecht zu halten. Vor der Spülmaschine lasse ich ihren Körper langsam zu Boden gleiten. Ihre tiefbraunen Augen sind offen und bereits glasig. Sie ist ganz sicher tot, aber ich halte meine Waffe noch ein, zwei Minuten fest. Als ich die Garotte abziehe, hinterlässt sie eine tiefe, knallrote Furche, als hätte jemand versucht, sich durch die Haut zu sägen. An mehreren Stellen ist die Haut aufgeplatzt, es blutet ein wenig. Ich lasse Lilliana fallen, stopfe meine Waffe in die Plastiktüte und laufe ins große Sitzungszimmer. Mit einem Satz bin ich aus der Terrassentür und renne die knapp einhundert Meter hinüber zum Kai 11, wo ich mein Fahrrad versteckt habe. Hinter dem vordersten Container bleibe ich stehen und ringe um Atem. Mein Herz hämmert dermaßen laut, dass ich mir sicher bin, andere würden es hören können – vorausgesetzt, dass irgendwer in der Nähe wäre. Glücklicherweise ist das nicht so. Ich schäle mich aus der Schutzkleidung. Auf dem Overall und den Handschuhen sind Blutflecken. Alles kommt in die Plastiktüte, und alles muss verbrannt werden. Ich kann das Zeug doch nicht einfach in einen Container werfen und die Entsorgung dem Zufall überlassen. Ich zwinge mich, ruhig zu bleiben, umsichtig; ich atme so langsam wie möglich.
Als ich zwei Minuten später mit dem Fahrrad am Kai entlang in die Stadt fahre, ist mein Puls beinahe wieder normal.
Montag
Dänische Provinzstädte einer gewissen Größe wurden häufig in der Nähe eines Fjords gegründet: dicht am Wasser, aber geschützt vor den heftigen Stürmen, die an den eigentlichen Meeresküsten die Oberhand haben. Fjordstädte sind oft recht wohlhabend, mit gut erhaltenen Häusern, breiten Straßen und einem lebhaften Geschäftsleben. Und heutzutage explodieren in genau diesen Städten die Immobilienpreise. Denn die Dänen wollen nicht einfach nur Wasser. Die Dänen wollen Wasser und einen Ort, an dem sie vor dem Wind geschützt sind!
Die Fjordstadt Christianssund ist so ein kleines Paradies. Nur vierzig Autominuten von Kopenhagen entfernt, hätte der Ort durchaus das Potenzial gehabt, als hundertprozentiges Pendlerreservat zu enden, doch dieses Schicksal ist der Stadt zum Glück erspart geblieben. Die Kommunalverwaltung hat dafür gesorgt, dass es für junge Unternehmen ausgesprochen attraktiv ist, sich hier niederzulassen. Ein gutes Beispiel ist die alte Schiffswerft der Stadt: Nach ihrer Schließung in den Neunzigerjahren wurde sie von der Gemeinde aufgekauft und in neue, attraktive Büroräume umgestaltet. Und bei Weitem nicht jeder kann sich im Sundværket, so der jetzige Name, einmieten. Ein eigener Planungsausschuss sortiert sehr gewissenhaft die Bewerber, und nur Firmen mit dem richtigen Profil bekommen den Zuschlag. Von Anfang an haben Werbeagenturen, Architekten, IT-Firmen und ein Radiosender in den frisch renovierten Räumen gearbeitet.
Gleichzeitig begann die Gemeinde mit einem ambitionierten Wohnungsbauprojekt, das aus Eigentumswohnungen, Reihenhäusern auf genossenschaftlicher Basis und Wohnungen für Jugendliche bestand. Das neue Viertel, über das bereits beim Richtfest sämtliche überregionalen Zeitungen berichteten, wurde direkt am Sund errichtet. Der Erfolg war überwältigend, und im Kielwasser der neuen, trendigen Christianssundbürger, von denen viele aus den überteuerten Vierteln der Hauptstadt hierhergezogen sind, eröffneten Cafés, Modeboutiquen und Sushi-Bars am Kai und in den engen, gewundenen Straßen der Stadt. Den Mitgliedern der Gemeindeverwaltung steht vor Begeisterung bis heute der Mund offen.
Aufgrund dieser vorausschauenden Politik ist Arbeitslosigkeit für die vierunddreißigtausend Bürger der Stadt auch längst kein so großes Problem wie in anderen alten Werftstädten. Natürlich handelt es sich bei den neuen Arbeitsplätzen in erster Linie um hoch spezialisierte Bürojobs, die den arbeitslosen Werftarbeitern nicht angeboten werden konnten, aber aus der Ferne betrachtet hat sich doch alles zur Zufriedenheit geregelt. Den meisten Bürgern von Christianssund ist es allerdings vollkommen egal, wer im Sundværket arbeitet und in dem neuen Viertel wohnt, um die Wahrheit zu sagen. Der größte Teil der Arbeitsplätze in der Stadt hat sich ja auch nicht verändert. Für die Lehrer an den Schulen, das Pflegepersonal im örtlichen Krankenhaus, für die Verkäuferinnen in den Geschäften an der Algade, das Personal im Finanzamt und die Beamten des Polizeipräsidiums, für sie alle ist Christianssund nichts Besonderes. Es ist lediglich der Ort, in dem man lebt und arbeitet. Einige Jugendliche zieht es nach der Schule in Richtung Kopenhagen, doch die meisten bleiben in ihrer Heimatstadt oder kehren irgendwann zurück, ohne sich weiter zu fragen, ob die Stadt nun wirklich der beste – oder der schlimmste – Ort auf der Welt ist.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!