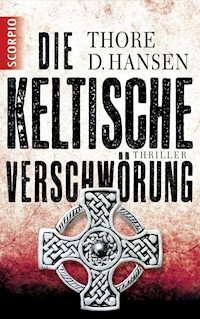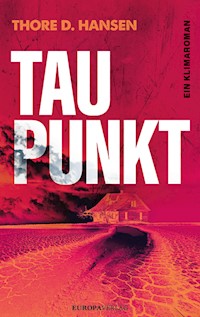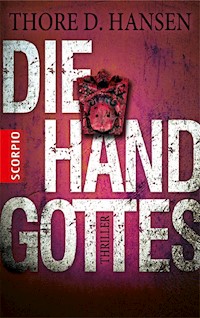
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Am Supreme Court in Washington steht der größte Prozess aller Zeiten vor der Tür. Auf der Anklagebank: der Papst und der Vatikan. Die Anklage lautet auf Diebstahl geistigen Eigentums vor rund 1700 Jahren – an einem Wissen, das den Menschen einst ein Leben im Einklang mit der Natur ermöglichte. Welche Geheimnisse sind es, die der Vatikan mit allen Mitteln versucht, unter Verschluss zu halten? Der amerikanische Richter Ronald MacClary ist einem ungeheuren Verbrechen auf der Spur: Er glaubt zu wissen, dass die katholische Kirche vor fast 1700 Jahren die keltischen Druiden nicht nur brutal ausgerottet, sondern auch deren Wissen geraubt hat. Gemeinsam mit dem Heiler Adam Shane, der Sprachwissenschaftlerin Deborah Walker und dem Druiden Thomas Ryan beginnt er zu recherchieren. Es kommt zu einem spektakulären Prozess, in dem der Vatikan und der Papst an ihre letzte Grenze stoßen werden. Doch die Mächtigen im Vatikan setzen alle Hebel in Bewegung, um den Prozess zu verhindern. Thore D. Hansens Thriller ist von einer spannungsgeladenen Wucht, der sich kaum ein Leser entziehen kann. Der Autor schickt seine Protagonisten quer durch Irland, Österreich, Italien und die USA, um eines der letzten Tabus unserer Zeit zu lüften – die Verbrechen, die der Vatikan an der keltischen Elite beging, um ihre eigene Macht zu sichern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. eBook-Ausgabe
©2011 Scorpio Verlag GmbH & Co. KG, Berlin · München
Umschlaggestaltung: David Hauptmann,
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Brockhaus/Commission
ePub-ISBN: 978-3-942166-56-0
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
www.scorpio-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
PROLOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
EPILOG
DANKSAGUNGEN
PERSONENLISTE
Gewidmet allen Menschen, die ihr Leben oder ihre Freiheit durch die katholische Kirche verloren haben. Und jenen, die erkennen wollen, dass historische Wahrheit und spirituelle Selbstbestimmung das Recht jedes Menschen ist.
Kein Verbrechen lässt sich ewig verbergen.
Keine Kultur ewig verbannen.
Jede Wahrheit findet ihren Weg ans Licht.
Wenn Recht zu Gerechtigkeit wird,
kann eine göttliche Kultur zurückkehren.
PROLOG
Seit unserer frühesten Jugend sind wir daran gewöhnt, verfälschte Berichte zu hören, und unser Geist ist seit Jahrhunderten so sehr von Vorurteilen durchtränkt, dass er die fantastischen Lügen wie einen Schatz hütet, sodass uns schließlich Wahrheit unglaubwürdig und die Fälschung wahr erscheint.
Sanchunniathon, vor 4000 Jahren
2. Mai 1945
Magdalensberg, kurz vor Klagenfurt in Österreich
Es war ein Schrei wie in Träumen. Wenn man in ein schwarzes Loch fällt, sich nicht halten kann, stürzt und stürzt, sich erst auf die Zunge beißt und dann doch schreit.
Dieser Schrei war echt! Kein Traum. Das war sofort an den Augen der anderen zu sehen. Das war auch kein Granateinschlag, kein zerfetzter Freund oder Schmerz, wie sie es alle schon erlebt hatten. Das war anders.
Ein junger Soldat kam den Abhang heruntergerannt und machte Meldung. »Major, Sir, ein Rekrut ist in eine Höhle gestürzt.« Er schrie laut genug. Major Sean MacClary hörte unwillkürlich mit und trat aus dem Zelt. Manchmal, wie jetzt, gab er sich sehr britisch.
»Brillant, meine Herren. Ich hatte befürchtet, meine Männer im Kampf zu verlieren. Stattdessen fallen sie in Löcher.« Aber dann war der Spaß auch sofort wieder vorbei, und es folgten schnelle, präzise Befehle, die jeder verstand. Angesichts letzter verstreuter deutscher Kampftruppen in dieser Region Kärntens war es zu gefährlich, Licht zu nutzen, um das unbekannte Gelände sicherer zu erkunden.
Auf halber Höhe des Magdalensberges hatte die Truppe in der Nacht Stellung bezogen und wartete auf weitere Befehle vom britischen Oberkommando. Das ferne Granatfeuer war inzwischen so selbstverständlich geworden wie Kindergeschrei für eine Hebamme. Man gewöhnte sich an alles. Dieser Schrei hatte sich jedoch wie ein Dolch in die Seele der Männer gebohrt.
MacClary nahm zwei Soldaten und Sanitäter mit, um die Stelle zu finden, wo der Soldat in die Tiefe gestürzt war. Sein linkes Auge begann nervös zu vibrieren, eine Eigenart, die er schon als Kind entwickelt hatte, wenn er von seinen Lehrern unter Druck gesetzt wurde. Seit er aktiv im Krieg eingesetzt war, und nach mehreren Verwundungen überkam ihn diese Reaktion immer häufiger. Es war ein merkwürdiges Bild, wenn dieser Mann – groß, kräftig und mit mächtigem Charisma – plötzlich eine solche Schwäche zeigte.
Er hielt kurz inne, nahm dem Helm ab und griff sich an die verschmutzte Stirn, um sich zu beruhigen. Seine dunklen Augen suchten einen Fixpunkt im Gelände. Nur langsam wich das Zucken; mit einer Hand strich er durch seine kurzen grauen Haare, mit der anderen setzte er den Helm auf und folgte wieder seinen Soldaten.
Am Abgrund angelangt, wagte es MacClary, mit einer kleinen Taschenlampe in die Tiefe zu leuchten, und erkannte einige Meter tiefer den reglosen Soldaten.
»Soldat, können Sie mich hören?«
Nur ein leises Stöhnen verriet, dass da unten noch jemand am Leben war.
»Smith und Rudy, Sie seilen sich ab«, befahl MacClary.
Als die Soldaten ihren Kameraden erreichten, hörte er ein Raunen, das kaum dem Verletzten gelten konnte.
»Was ist denn los? Sie sollen den Mann bergen und keine Höhlenforschung betreiben«, schrie MacClary energisch hinunter.
»Aber Major, das müssen Sie sich ansehen! Hier ist ein Eingang zu einem Raum voll mit alten Figuren, Schmuck und irgendwelchen Papierrollen.«
»Was sagen Sie da? Warten Sie, ich komme runter.«
MacClary seilte sich ab, und unten angekommen, traute er seinen Augen kaum. Im ersten Moment dachte er an einen geheimen Bunker, aber dann begriff er, dass es sich hier um uralte Hinterlassenschaften handeln musste.
Doch dafür war jetzt keine Zeit. Der junge Soldat krümmte sich vor Schmerzen und bekam kaum Luft. Einer der Sanitäter beugte sich über ihn. »Soldat, können Sie aufstehen?«
»Ja, aber ich denke, ein paar Rippen sind nicht mehr dort, wo sie hingehören. Gott verdammt, ich kriege keine Luft.«
»Sie müssen trotzdem aufstehen, sonst ersticken Sie mir.« MacClary half dem Sanitäter, den Soldaten hochzuheben, was dieser mit einigen unterdrückten Schreien quittierte.
»Okay, Smith zieht ihn hoch. Sie schaffen das, oder?«, fragte MacClary und sah den Sanitäter mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Danke, Major, ja, es wird schon irgendwie gehen.«
Der Verletzte wurde für den Transport nach oben vorbereitet, und MacClary riskierte einen Blick in die Kammer, die durch den Sturz des Soldaten freigelegt worden war.
Sean MacClary hatte vor dem Krieg als ordentlicher Professor für Archäologie gearbeitet. Beim Anblick dieser Artefakte wurde er schwach in den Knien.
»Was kann das sein?«, fragte Rudy und versuchte mit wedelnden Händen den Staub aus seinem Sichtfeld zu entfernen.
MacClary wusste, dass er die Deutschen vor sich und die Truppen Titos hinter sich hatte. Es blieb nur wenig Zeit, diese Artefakte zu bergen oder besser: verschwinden zu lassen, denn von einer Bergung konnte eigentlich keine Rede sein.
»Ich kann selbst kaum etwas erkennen, Rudy, aber es muss sich um eine Art Bibliothek oder eine besondere Grabkammer handeln. Diejenigen, die diese Kammer angelegt haben können, lassen sich an einer Hand abzählen«, sagte MacClary, während er sich abermals an die Stirn fasste, um sein Auge zu beruhigen. Schon der erste Eindruck von der Beschaffenheit der Steine, der Figuren und der wenigen Schriftzeichen, die er in der staubgeschwängerten Luft erkannte, deutete auf keltische, aber auch römische Herkunft.
»Das ist eigentlich nicht möglich«, murmelte MacClary weiter. Die Verschmelzung von Kelten, Germanen und anderen Stämmen Europas mit der römischen Kultur hatte sich über Jahrhunderte vollzogen. War diese Höhle ein Zufluchtsort? Ein Ort, um Wissen und Kultur zu bewahren? Wer waren die Baumeister? MacClary schossen Fragen wie Maschinengewehrsalven durch den Kopf, doch Antworten würde er unter diesen erbärmlichen Umständen nicht finden.
»Wie auch immer, Rudy. Hier und jetzt bleibt uns – verdammt noch mal – keine Zeit für größere Forschungsarbeiten. Holen Sie mir ein paar Planen zum Abdichten«, befahl MacClary. Er suchte fieberhaft weiter nach einem Hinweis, der ihm eine Deutung erlauben würde. Schwer atmend und behindert von der Finsternis und dem Staub, die in der Höhle herrschten, musterte er die Fundstücke mechanisch von rechts nach links. Er sah Schriftrollen, die in dieser Region eigentlich keine hundert Jahre hätten überdauern können, die aber eindeutig aus der Frühzeit stammten. Die Schöpfer mussten lange nach dieser ungewöhnlich trockenen und warmen Höhle gesucht haben. Dafür konnte es nur eine Erklärung geben: Sie hatten unbedingt sicherstellen wollen, dass die hier versammelten Zeugnisse der Vergangenheit lange überlebten, damit in Zukunft jemand sie entdeckte und der Welt zugänglich machte. Was für ein Plan mochte dahinterstecken?
Plötzlich stoppte seine Hand und richtete den Lichtstrahl auf eine Kiste, die – voller Staub und fast vermodert – seinen Blick erstarren ließ. Es war die einzige Kiste inmitten all der unzähligen Steintafeln, Figuren, Schriftrollen, Schmuckstücke und anderer Dinge. Doch was MacClary in den Bann zog, war ein Schriftzug, den er durch den Dreck hindurch sehen konnte.
DISTURBATIO FONTIS
»Die Vernichtung der Quelle«. Konnte das möglich sein? Stand er womöglich vor Aufzeichnungen der verfolgten Heiden?
»Verdammt! Warum ausgerechnet jetzt? Was soll ich tun, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt?«
Das war Sean MacClary in Höchstform. Wenn er an seine Grenzen stieß, klammerte er sich an diese für ihn geradezu beschwörende Formel, die ihm half, seine Gefühle in den Griff zu bekommen, um sachlich, stark, souverän und unangreifbar zu bleiben.
Ganz kurz fühlte er sich, als wäre er wieder in seinem Lehrsaal, umgeben von wissbegierigen Studenten, die seine Geschichten aus der Archäologie wie Märchen verschlangen. Keiner verstand es wie er, diese Wissenschaft und ihre teils trockenen theoretischen und technischen Inhalte in so faszinierende Bilder zu verpacken. Er brachte in seinen Vorlesungen nicht einfach nur blanke Neugier hervor, sondern eine rasende Ungeduld. Dieses Feuer selbst in solchen Studenten zu entzünden, die nur an diesem Platz saßen, weil sie von Standes wegen zu studieren hatten, gelang MacClary aus einem ganz einfachen Grund: Er war echt und glaubwürdig; seiner Leidenschaft, gepaart mit seiner eindrucksvollen Gestik und einer sonoren Stimme, die jeden Säugling zu beruhigen vermochte, konnte sich niemand entziehen.
»Major?«
MacClary erschrak. Für einen Moment war er so vertieft und fasziniert gewesen, dass er selbst diesen elenden Krieg vergaß. »Danke, Rudy. Holen Sie mit Smith noch ein paar Munitionskisten. Ich denke, wir sollten wenigstens ein paar von diesen Dingen mitnehmen.«
MacClary suchte nach einer Lösung, nach einem sicheren Transportweg, um die Kisten unauffällig nach England zu bringen. Allein die Masse an unschätzbaren Kulturwerten stellte ihn vor eine kaum lösbare Aufgabe. In ihm kam das Gefühl auf, vor einer Gruppe Verletzter zu stehen und entscheiden zu müssen, wen er operieren und wen er sterben lassen würde – eine grauenhafte Situation, die Ärzte und Sanitäter in den letzten Jahren nur allzu oft kennengelernt hatten.
Hinzu kam, dass es unter diesen Umständen kaum möglich war, die Funde einigermaßen sicher zu transportieren. Insbesondere die Pergamentrollen, deren Erhaltungszustand ohnehin schon ein Wunder war. Wenn durch den Einsturz der Höhle mehr Sauerstoff an die Artefakte gelangte, konnte es höchstens ein paar Wochen, vielleicht sogar nur Tage dauern, bis alles in sich zusammenfiel.
»Was in Gottes Namen ist das?«, stöhnte MacClary. Pergament war seit Beginn des 4. Jahrhunderts in Europa verwendet worden, seit der Zeit, als die katholische Kirche zur Weltmacht emporstieg. Wäre dieser Fund ein Zeugnis jener Epoche, sein Wert wäre unschätzbar für die Forschung. Abermals vergaß MacClary fast, unter welchen Bedingungen er sich an diesem Ort befand – Bedingungen, die es kaum sinnvoll erscheinen ließen, auch nur eine Sekunde an die Zukunft zu denken.
Wie auch immer. Der Schaden wäre größer, wenn dieser rätselhafte Fund so kurz vor dem Ende noch den Deutschen in die Hände fiel. Es blieben wahrscheinlich nur wenige Stunden, bis ihn der Befehl zum Einmarsch nach Klagenfurt erreichen würde. Vielleicht könnte er den Fundort verbergen und nach dem Krieg erforschen, wenn er wieder als Archäologe arbeiten durfte. Doch würde er Zugang zu diesem Fund bekommen? Welche Regierung, welche Autorität würde es ihm ermöglichen, überhaupt wieder an diesen Ort zurückzukehren?
Im fahlen Licht seiner Taschenlampe suchte er neben der Kiste nach weiteren Stücken, die sich in ein oder zwei großen Kisten transportieren ließen.
Als Major und Freund von General Brown hatte er die Möglichkeit, als geheim deklariertes Gepäck, Dokumente oder Ähnliches ohne Kontrolle bis nach England bringen zu lassen, auch für den persönlichen Gebrauch. Also würde er in aller Eile einige Stücke auswählen und den Eingang zur Höhle danach so verschließen lassen, dass es niemandem auffiel. Und dann musste er hoffen, dass sich das trockene Klima wieder einstellen und der Schaden gering bleiben würde. Eine unvorbereitete Bergung wäre ein wissenschaftliches Verbrechen.
»Ein Krater! Ich brauche hier den Einschlag einer Granate oder einer Bombe, oder wenigstens etwas, das so aussieht.«
MacClary sah in die Augen seiner Männer, die schon alle möglichen Sprengungen gelegt hatten. »Rudy, können Sie die Höhle mit einer sanften Sprengung versiegeln, sodass keine Luft mehr eindringt, aber die Räume und diese Schätze nicht zerstört werden?«
»Ja, Sir, aber wir brauchen nach innen mindestens zehn Meter Platz für die Druckwelle und das Geröll, auf keinen Fall weniger«, erwiderte der sichtlich bemühte Soldat.
MacClary leuchtete den Raum aus und entdeckte weitere Höhlenabschnitte. Vielleicht würde sein Fund die Explosion wirklich überstehen, wenn man alles weiter nach hinten transportierte.
»In Ordnung. Männer, bringt alles so weit wie möglich in die hinteren Räume – und dann nichts wie weg hier«, befahl MacClary und verpackte einige Schriftrollen und Schmuckstücke mit Hemden, Hosen und Decken, um sie noch im Schutz der Dunkelheit zu verladen.
Langsam brach die Dämmerung herein. Wenn auch die Sprengung den Höhleneingang verbergen würde, standen die Männer doch vor dem Problem, wie sie eine noch so kleine Sprengung überhaupt durchführen sollten, ohne auf sich aufmerksam zu machen.
Da kam ihnen der Zufall zu Hilfe.
Vom britischen Hauptquartier erreichte sie der Marschbefehl, der 78. Infanteriedivision zu folgen, die in den Morgenstunden Klagenfurt erreichen sollte. Bei den dann einsetzenden Gefechten würde eine gezielte Sprengung des Höhleneingangs kaum auffallen.
Und so geschah es. MacClary quälte die Ungewissheit, ob er diesen Ort je wieder betreten könnte, um die historischen Schätze einer längst vergangenen Kultur weiter zu erforschen. Doch es half alles nichts, im Augenblick war dies wohl die beste Lösung. Wenn auch wenige, würde er doch einige Stücke sicher nach Hause bringen können. Und sofern er die letzten Kriegstage überlebte, würde er nach seiner Heimkehr hoffentlich beginnen zu verstehen, was er in dieser Nacht gefunden hatte.
Nur wenige Stunden später marschierten die britischen Truppen ohne große Verluste in Klagenfurt ein. Die Nachricht von der Kapitulation der Deutschen machte MacClary neue Hoffnung, trotz einiger Verletzungen wieder an seine Arbeit gehen zu können.
Nur eine einzige Kiste der Fundstücke konnte er sicher nach Hause bringen. Hätte er gewusst, welche Wahrheit dieser Fund enthielt und welche Dramatik er weltweit auslösen würde – keinen Schritt wäre er aus dieser Höhle gegangen.
1
Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden; und er soll sie weiden mit einem eisernen Stabe, und wie eines Töpfers Gefäß soll er sie zerschmeißen.
Die Offenbarung des Johannes 2,26 f.
Niederösterreich – 13. März
Adam Shane saß blass und schweißgebadet auf dem Bett. Seine langen blonden Haare klebten in seinem Gesicht, seine Hände suchten nach Halt an der Bettkante, und er atmete einmal sehr tief durch, als ob er, kurz vor dem Ertrinken nach Luft ringend, aus dem Meer emporkäme. Es war gerade sechs Uhr in der Früh, und jeden Moment müsste ihn sein Wecker endgültig in die vertraute Welt zurückholen.
Stattdessen verlor er plötzlich das Augenlicht.
»O mein Gott, was geschieht hier?«
Bei dem Versuch, sich vom Bett zu erheben, fiel er sofort wieder um. Er hatte kein Gefühl mehr für sein Gleichgewicht, und als er die Augen wieder öffnete, konnte er seine vertraute Umgebung nur noch in unterschiedlichen Lichtkonturen sehen. Jede Zelle seines Körpers löste sich fühlbar auf und verband sich mit der Umgebung; es gab keine Trennung mehr zwischen seinem Körper, der Umwelt und der Materie an sich. Als er gerade dachte, es würde sich wieder legen, rasten Bilder durch seinen Geist, die ihm die Jahrhunderte wie eine Collage der Menschheitsgeschichte vorführten. Und als es über die Gegenwart hinaus in die Zukunft gehen sollte, brach alles plötzlich ab. Er kam wieder zu sich, seine Augen erfassten wieder das ihm vertraute Schlafzimmer, und sein Körper bemächtigte sich wieder seines Geistes.
Oder war es umgekehrt?
»Verdammt, verdammt, was war das?«, murmelte Shane vor sich hin und strich seine Haare durch die verschwitzte Stirn. »Ich pack das nicht!«
So muss es sich anfühlen, wenn man aus einem Schock heraus zum Autisten wird, dachte Shane. In diesem elenden Zustand hätte ihn kaum jemand wiedererkannt, denn seine äußere Erscheinung glich eher der eines Hünen. Seine große Gestalt überragte alles, seine Augen, eng beieinander, verliehen seinem Gesicht den Ausdruck eines Adlers, und seine Hände waren durch die Arbeit breit und grob geworden, so dass man ihnen die Heilkunst nicht ansah. Insgesamt hätte man ihn eher als einen Landwirt oder Bauarbeiter eingeordnet, der nach getaner Arbeit seine Zeit gern in einem Wirtshaus verbrachte. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass Adam Shane, Sohn eines österreichischen Hufschmieds irischer Herkunft, ein sanfter Heiler, ein Wünschelrutengänger und Kräuterexperte war. Seit Jahren wurde er von Menschen aufgesucht, die in der modernen Medizin keine Hoffnung mehr fanden. Seine Widersacher sahen in ihm natürlich einen Scharlatan, aber seine Erfolge sprachen für sich.
Entdeckt hatte er seine Gabe, als seine Frau an Krebs erkrankt war und sich weigerte, die üblichen, oft qualvollen Therapien über sich ergehen zu lassen.
Tatsächlich hatte er ihr helfen können. Doch seine besondere Sensibilität schien zugleich auch sein Verhängnis. War dieser Traum die Quittung für seine verzweifelte Suche nach einer Erklärung, warum die Menschen das zerstörten, was sie eigentlich nährte? Seit seiner Jugend gab es diesen Drang, Antworten zu finden, eine Erklärung für seine Traurigkeit und das Gefühl der Sinnlosigkeit zu entdecken. Während seine Schulfreunde ihre Zeit mit Sport, Motorrädern, Musik oder Strategien für die erste Liebesnacht verbrachten, sorgte er sich um die Welt und wie man sie retten könnte. Fast schon manisch hatte er mit vierzehn Jahren Bücher gelesen, die andere bestenfalls im Studium in die Hand bekamen, und sich in seinen Fragen und Gedanken vergraben. So war er die meiste Zeit von einer melancholischen Einsamkeit umgeben. Die Enge des Dorfes, in dem er aufwuchs und in dem kaum jemand seine Neugier, sein Talent, aber auch seine Rastlosigkeit erkannte, war eine zusätzliche Hürde. Dieser Enge war Shane durch sein Studium der Politikwissenschaft und Soziologie zwar äußerlich entflohen, aber innerlich hatte er ihr nie entrinnen können.
Er musste mit jemandem sprechen. Kurz zögerte er, dann griff er nach dem Telefon und wählte hektisch Victorias Nummer.
»Ja?«
»Victoria!«
»Adam, was in Gottes Namen willst du so früh?«
»Es tut mir leid, aber es geht mir nicht gut. Ich hatte wieder so einen intensiven Traum.«
Eine heiße Welle der Scham und Unsicherheit überflutete ihn.
»Adam, du musst endlich etwas für dich tun. Ich habe Angst, dass du irgendwann durchdrehst, so kann es doch nicht weitergehen!«
Victoria hatte gute Gründe für ihre Angst. Vor einem halben Jahr war sie mit dem gemeinsamen Sohn Jarod zu ihrer Mutter nach London gezogen, da sie Shanes Verzweiflung darüber, was er das komplette Versagen der Menschheit nannte, nicht mehr ertrug. Zwar hatte er mit vielem, was er sagte, recht, aber wie sollte sie ihrem Kind eine Zukunft schenken, wenn der Vater so an der Gegenwart verzweifelte, dass es kaum noch unbeschwerte Augenblicke gab?
»Nun erzähl schon, was war das mit dem Traum?«, fragte Victoria mit einer deutlich wärmeren Stimme.
»Ich weiß nicht, wo ich gewesen bin, aber mir war kalt, es war in einem Wald, und es war sehr windig und irrsinnig laut. Ich hatte das Gefühl, auf weichem Herbstlaub zu stehen. Dann erkannte ich alte, sehr große Bäume, die ihre Äste nach mir reckten.
Wie durch eine Nebelwand sah ich auf einer entfernten Lichtung Gestalten in weiten hellen Gewändern, die sich wie in Trance oder in einer Zeremonie bewegten und immer wieder ihre Blicke zum Himmel wandten. Meiner Angst folgte plötzlich eine Ruhe, eine Verbundenheit und Wärme, als ob mich jemand beschützen würde. So habe ich mich nur als Kind gefühlt, weißt du, wenn ich allein auf einer Waldlichtung lag, umgeben von Bäumen, Gräsern und dem Himmel. Dieses Wechselspiel von Wolken und Sonne, das mich nährte wie eine Mutter …
Was ich sah, wirkte friedlich und tief mit der Natur verbunden, in großer Liebe. Ich ging näher heran und erkannte, dass es ausschließlich Männer waren, alte Männer, die sich anscheinend berieten. Ihre Gesten waren zwar schnell, schienen aber aus großer innerer Ruhe zu kommen, und ihre im Wind wallende Kleidung beeindruckte mich ebenso tief wie ihre Ausstrahlung. Es war wunderschön anzusehen, und ich hatte das Gefühl, diese Lichtung musste etwas ganz Besonderes sein.
Als ich mich dem Platz weiter nähern wollte, erschien plötzlich eine Horde von reitenden Männern, die auf die Lichtung zuritten. Bevor jemand fliehen konnte, waren die alten Männer schon umzingelt. Die Rüstungen der Reiter sahen aus wie von römischen Legionären. Sie sprangen vom Pferd, und obwohl die alten Männer unbewaffnet waren, rammte einer der Soldaten dem ersten Mann ein Schwert durch den Magen, bis es blutverschmiert durch den Rücken wieder herauskam. Mit hasserfülltem Gesicht trat der Krieger gegen die Brust des alten Mannes und zog das Schwert langsam wieder heraus. Es sah wirklich so aus, als würde er genießen, was er tat. Mit einem ächzenden Schrei sank der alte Mann zusammen und schrie etwas in einer Sprache, die ich nicht verstand, bevor das Leben ihn verließ. Ich war fassungslos, wie gelähmt, und fühlte mich leer und resigniert. Binnen Sekunden wurden meine Faszination und Freude durch Schrecken und Angst abgelöst. Ich musste mit ansehen, wie auch die anderen mit dem Schwert niedergestreckt wurden. Es war wie ein Blutrausch und ging rasend schnell.
Die Soldaten stiegen wieder auf ihre Pferde und ritten davon in Richtung eines kleinen Dorfes, das ich in der Ferne sehen konnte. Ich rannte hinterher und sah eine ganze Horde dieser Männer, die Frauen und Kinder auf bestialische Art ermordeten.
Es war ein furchtbares Bild der Zerstörung einer kleinen, friedlichen Lebensgemeinschaft. Einer der Legionäre hatte einen abgeschlagenen Kopf als Trophäe auf eine Lanze gesteckt und ritt in die Mitte des Dorfes, das bereits lichterloh brannte und im Chaos versank: Er schrie: »Unterwerft euch, eure Götter haben euch verlassen, nur unser Gott wird euch schützen!«
Bevor die Meute verschwand, sah ich einen Legionär mit einem Fisch, dem Zeichen der Christen, auf dem Schild an mir vorbeireiten, und ein verächtliches Lächeln überzog sein Gesicht.
Victoria, es war, als ob ich wirklich dabei wäre; es war viel mehr als nur ein Albtraum … tut mir leid, aber es erstaunt mich ja selbst.«
»Adam, was du da beschreibst, kommt mir fast vor wie eine Botschaft, der du nachgehen solltest. Für mich ist es wie eine Parallele zu deinem Leben. Diese ewige Frustration über die Welt«, sagte Victoria, die zu seiner großen Freude nun wirklich Anteil nahm. Es war das erste normale Gespräch seit ihrer Trennung, ein Gespräch voll von echtem Mitgefühl.
»Kann sein. Ich weiß, dass es mir schwerfällt, einfach Freude zu finden. Aber lass uns nicht wieder darüber reden, es ist einfach beruhigend, mit dir zu sprechen.«
»Du weißt, ich bin für dich da. Wenn du magst, kann Jarod übrigens in drei Wochen zu dir kommen. Ich muss nach New York, und er sehnt sich so nach dir. Ich rufe dich Freitag noch mal an.«
»In Ordnung, Freitag ist gut. Danke für dein offenes Ohr zu dieser frühen Stunde«, seufzte Shane.
»Schon gut, aber bitte geh dem endlich auf den Grund«, sagte Victoria mit so viel Intensität in ihrer Stimme, dass Shane kurz dachte, dieser Wunsch sei ein Signal. Würde sie zu ihm zurückkehren?
Er sammelte sich wieder, und plötzlich fiel ihm ein, dass er das Dorf schon vor dem Angriff im Traum besucht hatte. Es war ihm fast unheimlich, wie sehr er sich dort zu Hause gefühlt hatte. Das Dorf bestand aus gut vierzig Häusern, die von einem Wall aus Holz und Sandaufschüttungen umgeben waren. Durchschritt man das schwere Holztor, das den Eingang bildete, dann konnte man auf einem gut hundert Meter entfernten Platz einen Brunnen sehen. Kreisrund angeordnet, befanden sich dort am Platz die Häuser eines Schmieds, eine Art Markthalle und ein Haus – das Haus eines Häuptlings. Er konnte zahlreiche Menschen sehen, die bei schönstem Sonnenschein ihren Geschäften nachgingen. Die Bauart der Häuser und auch die unterschiedlich edle Kleidung zeigten zwar soziale Unterschiede, aber keiner wirkte unglücklich oder elend. Im Gegenteil, diese Gemeinschaft schien in ihrer Überschaubarkeit gut zu funktionieren. Er konnte sich in dem Traum mit niemandem verständigen, er war da und irgendwie auch nicht, verstand aber sehr viel von dem, was dieses Dorf ihm widerspiegelte: sein eigenes Bedürfnis nach Geborgenheit.
Bevor der Schrecken begonnen hatte, wäre er am liebsten dort geblieben, um ganz in diese Welt einzutauchen. Doch er hatte auch ihre Zerstörung mit ansehen müssen.
2
Dublin – 13. März
Padre Luca Morati zog seine Stirnfalten wie eine Ziehharmonika zusammen. Seine Hände, die gerade zitternd zum Telefonhörer griffen, waren übersät von Altersflecken, jede Ader war durch seine blasse, dünne Haut zu sehen. In seinem Fall konnte man wirklich von einem biblischen Alter sprechen – mit seinen vierundneunzig Jahren gehörte der Greis mit den besten Verbindungen in den Vatikan und zur Kurie zu den ältesten und einflussreichsten Geistlichen.
»Ach, gütiger Herr, ich habe versagt«, seufzte er mit einem Ausdruck von Trauer im Gesicht, während er sich langsam wie in Zeitlupe in seinem uralten Lederstuhl zurücklehnte und versuchte, den Blick seiner schwachen Augen irgendwo im Raum zu fixieren. Jeder Zentimeter der Wände war mit Büchern gefüllt. Am Fenster, von wo er den Eingang zum Trinity College im Auge hatte, stand ein Tisch aus der Kolonialzeit, beladen mit Papieren und Büchern und beleuchtet vom Licht einer typischen Bibliothekslampe, das den antiken Mahagonimöbeln einen unvergleichlich warmen und typisch irischen Charakter verlieh.
Die Sonne strahlte wie eine Taschenlampe direkt in sein zerfurchtes Gesicht. Er zuckte zusammen, als endlich auf der anderen Seite eine Stimme ertönte.
»Si?«
»Stellen Sie mich durch … es ist dringend«, hauchte er ins Telefon. »Hier ist Padre Morati.«
Ein kurzer Moment der Stille, in dessen Verlauf das Aufsetzen einer Fliege einem Erdbeben geglichen hätte … Er wurde verbunden.
»Sie wünschen?«
»Salvoni, ich fürchte … der Fall, vor dem wir uns immer gefürchtet haben, rückt näher, der Sohn folgt seinem Vater«, stotterte Morati, während ihn plötzlich ein Unbehagen im Magen plagte, eine Mischung aus Unsicherheit und schlechtem Gewissen. Nie hatte er den Mut besessen, dem Ursprung dieses Gefühls wirklich auf den Grund zu gehen.
»Was ist passiert?«
Für einen Augenblick herrschte wieder dieses Schweigen. Dem Padre stand der Atem still, Angst kroch vom Magen über das Zwerchfell in sein schwaches Herz und ließ seine Stimme gefrieren.
»Padre, sind Sie noch da? Antworten Sie mir, was ist geschehen?«
Nervosität machte sich am anderen Ende der Leitung breit, bevor Morati kaum hörbar in den Hörer stöhnte.
»Ich glaube, dass Ronald MacClary einen Hinweis gefunden hat. Er hält am kommenden Wochenende am Trinity einen Vortrag, dessen blasphemischer Inhalt sicher durch neues Wissen genährt wurde.«
»Aber Padre, nur weil er einen Vortrag hält, um unsere Kirche zu diskreditieren, bedeutet das noch lange nicht, dass er etwas vom Erbe seines Vaters gefunden, geschweige denn verstanden hat.«
»Aber es ist der Inhalt, Salvoni, er zieht Schlüsse, die eben jene Beweise fordern würden…«
»Wann hält er den Vortrag?«, unterbrach ihn der nun doch hörbar nervöse Salvoni, der kaum glauben konnte, dass MacClary in seiner Position auch nur im Ansatz die Kirche öffentlich kritisieren würde.
»Kommenden Freitag, um zwanzig Uhr in der alten Prüfungshalle.«
»Gut, Padre, wir werden sicherheitshalber jemanden schicken, der ihm genau zuhört. Danke für Ihre unerbittliche Wachsamkeit, möge der Herr es Ihnen lohnen und seine schützende Hand dafür sorgen, dass Sie noch lange unter uns weilen«, tönte es am anderen Ende, und nach einem Knacken hörte Morati nur noch den Freiton.
Er sank in seinem Stuhl zusammen, sein Körper rollte sich förmlich in den massiven Sessel, und seine Hände verbargen sein Gesicht. Ein Schluchzen durchdrang den Raum.
Über vierzig Jahre lang war Morati als Vizepräfekt des Vatikanischen Archivs einer der wenigen gewesen, die Zugang hatten zu den unschätzbaren Kulturwerten, den Überlieferungen und Zeugnissen all jener Epochen, in denen eifrige Missionare raubten, was ihnen auf ihrem Feldzug gegen alles Andersgläubige in die Hände fiel. Darüber hinaus hatte er Zugang zu einer Bibliothek gehabt, die außerhalb des Vatikanstaates ungleich brisanteres Material hütete. Wissen und Zeugnisse, die weitaus früher zu datieren waren als das Ende des 8. Jahrhunderts. Das wirkliche Geheimarchiv des Vatikans war in der Tat einer der bestgehüteten Orte und nur ausgewählten Personen der römischen Kurie bekannt. Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter, die sich mit der Konservierung und Forschung befassten, weder etwas stehlen noch zerstören konnten, mussten sie sich vor jedem Arbeitstag einer umständlichen Prozedur unterziehen. Nachdem überprüft worden war, dass man weder Kameras, Tonbänder, Funkgeräte noch Messer, Feuer oder andere Dinge bei sich hatte, wurde man von der Sixtinischen Kapelle in Bussen mit verdunkelten Scheiben an einen Ort außerhalb Roms gefahren. Erst in einer dunklen Garage durfte man aussteigen und wurde an seinen Arbeitsplatz geführt. Dort ging man unter ständiger Beobachtung, in vor Licht und Keimen geschützten Räumen, seiner zuvor genau definierten Tätigkeit nach, bis man am Abend unter Wiederholung der ganzen Prozedur wieder nach Rom eskortiert wurde.
Was Morati in diesem Archiv zu Gesicht bekommen hatte, war zum Teil von unglaublicher Schönheit und Weisheit, und er wusste, dass nur die Gewalt und Macht, mit der die Christen ihre Mission betrieben hatten, diese friedfertigen, spirituell hoch entwickelten Kulturen hatte verdrängen können. Allzu häufig ertappte sich der Gelehrte bei der Frage, welche Selbstsucht und welcher Herrschaftsanspruch die Kirche dazu brachte, das Wissen um die wirkliche Quelle der Schöpfung zu verbergen. Denn genau darum ging es an diesem Ort. Hier lagen die Schriften der Propheten und spirituellen Führer, die eine ganz andere Lehre verbreiteten als die Kirche: eine Lehre, die der unverfälschten Lehre des Jesus von Nazareth in nichts nachstand und deren Wirkung die Macht der Kirche so bedrohte, dass man einen großen Teil bereits für immer zerstört hatte. Wenn man der Menschheit diese Lehren zugänglich machte, wäre das Schicksal der Kirche besiegelt. Sie würde wegen des größten Verbrechens der Menschheitsgeschichte auf der Anklagebank landen. Nachdem Morati selbst sein halbes Leben damit verbracht hatte, die Zeugnisse der keltischen Druiden und anderer heidnischer Gelehrter zu rekonstruieren, hatte er um Versetzung nach Dublin gebeten und war inzwischen seit rund zwanzig Jahren im Ruhestand. Das hinderte ihn freilich nicht daran, die Familie MacClary, insbesondere Ronald, im Auge zu behalten. Zu viele Schwierigkeiten hatte schon der Vater bereitet, und in Rom fürchtete man, Ronald MacClary könnte etwas entdecken, das die Aufmerksamkeit der immer kritischer werdenden Christenheit weckte.
Im Zimmer war es still geworden bis auf ein leises Schnarchen. Morati war erschöpft in seinem Sessel eingeschlafen.
3
Dublin – 13. März
Ronald MacClary starrte regungslos aus seinem Arbeitszimmer in die grelle Morgensonne. Dublin war im Frühling die typische Mischung aus Sonne, Wolken und Regen, die jedem Wunsch nach Berechenbarkeit einen Streich spielte. Seine dunkelbraunen Augen wurden von der Sonne wie ein Bernstein durchleuchtet, und mit seinem Dreitagebart und den grau melierten Haaren hatte er auch das attraktive Aussehen seines Vaters geerbt. Sie waren sich in ihrer Hartnäckigkeit weitaus ähnlicher, als es Ronald lieb war. Aber zum Glück betraf die Familienähnlichkeit auch das Altern: Kaum jemand, der die siebzig überschritten hatte, konnte auf so viele Reserven zurückgreifen.
Ronald MacClary hatte es weit gebracht. Er war kurz nach Ausbruch des Krieges in Boston geboren; Anfang der Dreißigerjahre hatte sein Vater seine Mutter bei einer Reise in New York kennengelernt und wenig später geheiratet. Erst nach dem Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg waren sie nach Dublin gezogen, und Sean MacClary hatte kurze Zeit später seine Funktion als Major in der 8. britischen Armee übernommen. Sein Sohn Ronald hatte nach einem abgebrochenen Studium der Archäologie in Rekordzeit sein Jurastudium in Boston absolviert und war jahrelang Richter am Bezirksgericht in Boston gewesen, bevor er an den Supreme Court berufen wurde, dessen Vorsitzender Richter er nun seit drei Jahren war. Und dennoch zog es ihn, wann immer er Zeit hatte, zurück in das ehrwürdige Elternhaus in Dublin an der Arbour Hill, direkt gegenüber dem Nationalmuseum. Dort vergrub er sich in den Forschungen seines Vaters.
Ronald stöberte gerade in einer der unzähligen Aufzeichnungen, die alle in großen Ledermappen aufbewahrt wurden, als sein Blick sich der Vitrine zuwandte, in der das Erbe seines Vaters schon so lange lagerte. Dieses tonnenschwere Marschgepäck auf seinen Schultern … Nur zu gerne wäre er den Fußstapfen seines Vaters gefolgt, um als Archäologe sein Werk zu vollenden, obwohl er ihn kaum gekannt hatte.
Wie so oft in letzter Zeit erinnerte sich Ronald an den plötzlichen Tod seines Vaters. Nachdem Sean mit einer schweren Verwundung aus Österreich zurückgekehrt war, hatten alle gedacht, dass er die Folgen eines Granatsplitters in der Lunge und in der Wirbelsäule überstanden hätte.
Doch als Ronald mit seiner Mutter Lisa einige Tage vor Seans Entlassung zu Besuch ins Lazarett kam, lag sein Vater im Sterben. Er konnte es nicht verstehen; noch gestern war er drauf und dran gewesen, das Lazarett zu verlassen – und nun das. Seine Mutter schrie das Lazarettpersonal herbei, sie war fassungslos und wurde fast ohnmächtig.
Der junge Ronald war schockiert, welch erbärmlichen Eindruck das sonst so stolze Gesicht seines Vaters nun machte. Der Raum roch nach Angst, von allen Seiten hörte er das Stöhnen der Verletzten, der Geruch wechselte zwischen Minze und Fäkalien. Die letzten Worte, die er von seinem Vater hörte, gaben ihm ein bis heute ungelöstes Rätsel auf.
»Ihr müsst den Hinweisen meiner Funde nachgehen…«
Der drängende Ausdruck im Gesicht seines Vaters brannte sich wie eine Wunde in sein Gedächtnis. Es musste alles mit diesem Pergament zu tun haben, das er mitgebracht hatte. Er hatte keine Ahnung, was sein Vater meinte, als er sagte, dass es von großer Bedeutung sei, den Fundort nicht in falsche Hände geraten zu lassen. Dort liege der Schlüssel zum Verständnis unserer Kultur verborgen, die Wiege all dessen, was uns ausmacht. »Und alles hat mit einem abscheulichen Verbrechen begonnen. Wir sind um ein enormes Wissen betrogen worden – und um unsere Freiheit. Du wirst es eines Tages verstehen, mein Sohn. Schau in die…« Sein Atem wich, nur noch ein angestrengtes Röcheln durchdrang den Raum, bevor sein Herz versagte.
Ronald stand mit versteinerter Miene vor dem Bett, während seine Mutter die Hände vors Gesicht schlug und bitterlich weinte.
Immer wieder spielte sich die Szene vor seinem inneren Auge wie eine Zeitschleife ab, immer wieder versuchte er, aus den letzten Worten seines Vaters den einen Zusammenhang, den einen Hinweis zu ziehen. Bis zu ihrem Tod hatte Lisa MacClary Ronald die Suche verboten.
»Wohin soll ich schauen, Vater? Wohin? Ich weiß, dass du etwas ganz Besonderes entdeckt hast, aber wo soll ich es finden?«
Ronald hatte in den letzten Jahrzehnten jeden Quadratzentimeter in den Archiven seines Vaters durchsucht und war doch nie fündig geworden. Auch die Schriftrolle in der Vitrine hatte bis heute ihr Geheimnis nicht preisgegeben. Eines war klar: Der Vater musste auf etwas aus der Frühzeit gestoßen sein, denn nur dafür brannte sein archäologisches Herz. Kaum einer war in der Lage gewesen, so detailliert Auskunft über die Zeit unmittelbar nach Christus und bis ins Mittelalter zu geben – die sogenannten Dark Ages, das dunkle Zeitalter, für ihn die schwärzeste Epoche der menschlichen Zivilisation. Die Inquisition, die beiden Weltkriege und all die anderen Konflikte waren für ihn nur die Folgen jener zivilisatorischen Epoche in der Frühzeit gewesen, die den Weg dafür ebnete. Doch er wurde nie konkret. »Ich muss erst alle Beweise haben, nur dann kann ich etwas damit bewirken, nur dann wird es akzeptiert. Solange Beweise unterwandert und mit Propaganda zunichte gemacht werden können, kann ich nicht ernsthaft versuchen, es zu veröffentlichen.«
Das Vermächtnis seines Vaters war für Ronald mehr als ein historisches oder archäologisches Rätsel. Es war, als ob er eine Rechtfertigung dafür, einen Sinn darin suchte, dass sein Vater weder Zeit noch Liebe für ihn in ausreichendem Maße übrig gehabt hatte. Wie oft hatte Ronalds Mutter unter Tränen und voller Zorn darüber geklagt, wie allein und verlassen sie sich fühlte.
Schon als Junge hatte er all das als ungerecht empfunden, und obwohl er sich in den wenigen Augenblicken, die ihm mit seinem Vater blieben, für die Suche nach der Vergangenheit hatte begeistern können, war es die Frage nach der Gerechtigkeit gewesen, die ihn später das archäologische Studium abbrechen und das juristische Studium beginnen ließ. Doch die Jahre in der Bibliothek seines Vaters hatten auch ihn zu einem kritischen Gelehrten der Religionsgeschichte gemacht.
Ronald konnte seine Wurzeln nicht verleugnen und hütete das Haus seiner Eltern und die Bibliothek seines Vaters seit Jahrzehnten wie einen Schatz. Er scheute jede Veränderung, als würde er damit die Chance, das Rätsel doch noch zu lösen, für immer verspielen.
Seine Augen wirkten müde, und mit einer resignierten Geste murmelte er: »Und Gott ist an allem schuld«, bevor er sich mit einem ironischen Lächeln wieder dem Computer zuwandte, um noch ein wenig an seinem Vortrag am Trinity College zu arbeiten.
4
Niederösterreich – 13. März
»Wirklich merkwürdig«, murmelte Shane. Er konnte sich nicht daran erinnern, je so intensive Träume gehabt zu haben.
»Nun gut, sei’s drum«, stöhnte er und quälte sich aus dem Bett. Er war spät dran. In spätestens einer halben Stunde würde wieder ein Dutzend kranke Menschen seine Praxis füllen.
Er öffnete die Tür und ging in Richtung Bad. Bevor er die Tür erreichte, fiel ihm ein, dass ja alle seine Sachen noch im Koffer in der Praxis standen. Er war erst spät in der Nacht von einem Seminar über alternative Heilmethoden und Kräuterkunde aus Paris zurückgekehrt.
Mit einer für ihn ungewöhnlich eleganten Drehung steuerte er zielstrebig das Sprechzimmer an, öffnete die Tür und griff nach seinem Koffer neben dem Schreibtisch.
In diesem Moment stellte er bestürzt fest, dass Patricia schon da war. »Guten Morgen, Adam, einen Kaffee?«, sagte sie mit einem Lächeln im Gesicht, das er nicht recht deuten konnte.
Da stand er nun, gerade mal mit einer Unterhose bekleidet, einer fünfundzwanzigjährigen, schlanken Schönheit gegenüber, die ihn mit ihren knusperbraunen Augen, ihrem kessen Gesicht und ihrer ansehnlichen Oberweite schon öfter in Verlegenheit gebracht hatte.
Patricia lieferte jeden Mittwoch Kräuter und Salben in die Praxis, die ihr Vater, ein pflanzenkundiger Bauer, sammelte, um sich neben der wenig einträglichen Landwirtschaft etwas hinzuzuverdienen.
Shane griff hektisch um die Ecke, um sich wenigstens seinen Bademantel überzuziehen. »So früh habe ich Sie hier nicht erwartet, Patricia, äh was ist denn das da?«, fragte er und deutete auf einen ziemlich großen Beutel.
»Das sind die fünf Kilo Schachtelhalmkraut, die Sie bestellt haben.«
»Fünf Kilo? Damit könnte ich fünfzig Patienten gleichzeitig entgiften, außerdem habe ich noch genug Vorrat. Tut mir leid, aber da müssen Sie etwas falsch verstanden haben. Ich hoffe, Sie können das rückgängig machen«, murmelte Shane mit seinem typischen Lächeln, mit dem er Frauen normalerweise entweder in Verlegenheit oder in Zorn versetzte.
»Ja, sicher, der Rest sollte aber stimmen. Soll ich es wie immer am Ende des Monats abrechnen?«
»Ja, gerne – und vielen Dank!«
»In Ordnung, bis zum nächsten Mal.« Mit einem wohlwollenden Blick drehte sich Patricia um und ging.
Nach dieser fast intimen Begegnung erinnerte er sich ganz kurz an ein fast vergessenes Gefühl: verliebt sein, sich angenommen und attraktiv fühlen … wann hatte er all das zuletzt gespürt?
Als er sich umdrehte, entdeckte er auf seinem Tisch die Post. Zwischen den üblichen Rechnungen, Dankesbriefen und Werbesendungen stach ein Umschlag aus edlem Büttenpapier hervor wie eine einzelne Rose inmitten einer Graslandschaft. Er zupfte den Brief aus dem Stapel heraus, setzte sich kurz hin und schaltete nebenbei den Fernseher ein, um die Nachrichten zu sehen.
… vor allem die kommenden Generationen wird der Klimawandel betreffen. Pachauri, Chef des UNO-Weltklimarates IPCC, der den schlechten Zustand der Erde in Zahlen und Statistiken auszudrücken weiß, warnte die Staatslenker nach dem Scheitern der Verhandlungen ausdrücklich davor, den Klimawandel als Zukunftsproblem abzutun: »Die Auswirkungen werden sie noch in ihrer eigenen Amtszeit zu spüren bekommen«, sagte er gegenüber der BBC in Kopenhagen. Nach seiner…
Entnervt schaltete Shane den Fernseher wieder aus und murmelte: »Ihr habt jeden Bezug zur Natur verloren, wie sollte es euch da möglich sein, eine Vision zu finden.« Umständlich öffnete er den Umschlag.
Vor einem Jahr hatte er bei einem Treffen von alternativen Heilern in Wien Thomas Ryan kennengelernt. In seinen Augen war dieser Ire eine ziemlich radikale Persönlichkeit. Er lebte in der Nähe von Dublin in einer Gemeinschaft, die sich komplett der Rückbesinnung auf ein Leben im Einklang mit der Natur verschrieben hatte. Ryan hatte versprochen, sich zu melden, da Shane mehr über das Projekt erfahren wollte.
Neben einer Einladung zu einem Treffen von Heilern und Kräuterexperten fand er eine weitere in dem Umschlag, die seine besondere Aufmerksamkeit erregte:
Die systematische Vernichtung keltischer Kultur und europäischer Naturvölker sowie deren kulturelle, politische und ökonomische Auswirkungen für die Welt – Ein Vortrag von Ronald MacClary
Thomas Ryan hatte Wort gehalten. Sie hatten seinerzeit einen ganzen Abend über die Kelten, die Ureinwohner Europas gesprochen, und dabei war Shane besonders in Erinnerung geblieben, dass Ryan sich über die Neodruiden lustig gemacht hatte, die, wie er sagte, die wahren Botschaften der Gelehrten, der Stammesführer und der Druiden nie verstanden hätten. Bei diesem ersten Zusammentreffen war nicht genug Zeit gewesen, um mehr zu erfahren. Doch klar war: Die aktuellen Ausgrabungen zeigten ein ganz anderes Bild von den Kelten als das der menschenopfernden Barbaren.
Shane stand da und fühlte, wie sich eine innere Angst seiner bemächtigte. Gerade noch hatte er diesen Traum gehabt, der ihm scheinbar einen Ausschnitt aus genau dieser Zeit vorspiegelte, und nun kamen diese Einladungen. Es kann kein Zufall sein, dachte er und setzte sich zitternd an seinen Tisch. Er kombinierte sein Wissen, seine Fragen – all seine Gedankengebäude schienen sich plötzlich wie ein Magnet auf einen Punkt, einen Grund, eine Ursache zu fixieren, ohne dass er in der Lage gewesen wäre, diesen Punkt in Worte zu fassen. Nervös wie ein gejagtes Pferd auf der Flucht kramte er seinen Kalender hervor, wild entschlossen, der Einladung zu folgen.
»Was, schon morgen? Muss das sein?«
Ohne lange zu zögern, nahm er Zettel und Stift zur Hand und notierte: »Die Praxis ist vorübergehend geschlossen.«
Er hatte höchstens noch ein Stunde Zeit, bevor die ersten Patienten vor seiner Tür stehen würden. Sie abweisen zu müssen war ihm unangenehm, und er wollte möglichst schnell sein Haus verlassen. Er stand auf, ging zielstrebig zu seinem Koffer und packte einfach ein paar frische Sachen dazu, nahm seinen Ausweis, seine Geldbörse und zog sich hektisch an. Während er noch auf einem Bein stehend seine Hose hochzog und gleichzeitig mit dem Handy versuchte, den Flughafen zu erreichen, kehrte plötzlich doch wieder so etwas wie Ruhe ein. Er legte das Handy beiseite und setzte sich, immer noch mit nur halb hochgezogener Hose, in seinen Schreibtischsessel.
»Langsam, Adam, langsam, was passiert hier eigentlich? Du solltest erst mal deinem Verstand folgen und nicht irgendwelchen Hirngespinsten.«
Konnte es sein? Stand hinter dem Untergang der Kelten mehr, als der Öffentlichkeit bewusst war? Ryan hatte ihm noch nicht plausibel machen können, was an der Kultur, den Gesetzen und dem Lebensentwurf der Druiden besser gewesen sein sollte, aber er hatte ihm auch bei Weitem nicht alles erzählt. Wieder erinnerte Shane sich an ein Detail aus dem Gespräch mit Ryan. Er hatte davon gesprochen, dass die fragwürdige Kultur des westlichen Wohlstandsdiktats, das nur auf Kosten der Natur oder anderer Völker und Menschen funktionierte, nicht zwingend notwendig sei. Vielleicht war nur ein kleiner, aber wirkmächtiger Zufall der Grund – oder ein Ereignis, das Europa auf den bis heute beschrittenen Weg gebracht hatte. Wenn man diesen Punkt fand und die Alternative, die Gegenrichtung aufzeigen konnte, dann war es der Menschheit möglich, einen neuen Weg einzuschlagen. Und Ryan war sich erstaunlich sicher gewesen, dass die Menschheit sich bewusst von einem Weg abwenden würde, der sie völlig denaturalisiert hatte, der sie apathisch und stumm gemacht hatte wie eine Herde Schafe – wenn sie nur endlich verstehen würde, was wirklich die Ursache dafür war. Es musste doch ein größeres Ziel geben als die ewige Wiederholung des Wachstums, der Konkurrenz und eines Wohlstandes, der den folgenden Generationen ein gesundes Leben, wahrscheinlich sogar ein Überleben unmöglich machte.
»Warum komme ich immer wieder an diesen Punkt?«, stöhnte Shane. Ryan hatte ihm versprochen, dass er mehr über das Geheimnis der Druiden und Kelten erfahren würde, sobald sie sich wiedersehen würden. Vielleicht war sein Traum wirklich kein Zufall. Nebenbei schaute er in eines seiner unzähligen Bücher, die überall herumlagen, mal geschlossen, mal geöffnet.
Man sieht die Katastrophe vor Augen, will helfen durch Einsicht, Erziehung, Reform. Man will planend den Gang der Ereignisse in die Hand nehmen, man will die rechten Zustände wiederherstellen oder erstmalig neu hervorbringen.
Shane fing an zu lachen und murmelte: »Mein Lieber, du endest auch noch mit einem Jesuskomplex.« Kurz konnte er von seiner Rastlosigkeit loslassen, weil er in den Zeilen seine eigene Anmaßung, seinen allzu hohen Anspruch wiedererkannte. Schließlich legte er das Buch zur Seite, packte in Ruhe seine Sachen und machte sich auf den Weg zum Wiener Flughafen. Er hatte keine Ahnung, auf welche dramatische Weise die erneute Begegnung mit Thomas Ryan nicht nur sein eigenes Leben verändern würde.
5
Doch auch euch, allerheiligste Kaiser, wird der Zwang zu züchtigen und zu strafen aufgenötigt, und es wird euch durch das Gesetz des höchsten Gottes geboten, dass eure Strenge die Untat des Götzendienstes in jeder Weise verfolge.
Kirchenvater Firmicus Maternus
Rom, Vatikanstadt – 13. März, früher Abend
Thomas Lambert legte entnervt den Hörer auf das Telefon. Sein Büro lag nicht weit entfernt von den Privatgemächern des Papstes im vatikanischen Regierungsgebäude, dem wahren Machtzentrum des kleinen Staates mit seinem äußerst ungewöhnlichen Status in der Völkergemeinschaft.
Es war ein langer Arbeitstag gewesen. Mit seinen stahlblauen Augen blickte Lambert aus dem Regierungsgebäude in den Hof. Auch außerhalb des Vatikans war Lambert stets in Schwarz gekleidet und hetzte von einem Termin zum anderen, um die weltweiten Angelegenheiten der Kirche zu lenken. Fast zwei Meter groß, was gerade in Italien immer einen ziemlichen Eindruck hinterließ, flößte er mit seinem kantigen Gesicht und seiner blassen, für sein Alter ungewöhnlich jungen Haut seinem Umfeld Respekt und zuweilen auch Angst ein. Kaum einer hatte so viel Einfluss und Handlungsgewalt im Staate Gottes wie Lambert.
Doch nach sechzehn Stunden war auch dieser christliche Hüne des Opus Dei reif für etwas Ruhe. Der Kardinalstaatssekretär war seit seinem sechzehnten Lebensjahr im Vatikanstaat zu Hause und konnte dank seiner diplomatischen Fähigkeiten auf eine der längsten und einflussreichsten Karrieren in der katholischen Kirche zurückblicken. Und gerade jetzt, da die Kirche weltweit durch ihre Skandale wegen Geldwäsche und Kindesmissbrauchs unter Druck stand, mochte niemand auf seine Fähigkeiten und seine gewachsenen Beziehungen bis in die UNO hinein verzichten. Diesen Vorteil wusste der gewichtige Brite ebenso zu nutzen wie seine körperliche und geistige Präsenz.
Schon unter Monsignore Giovanni Montini, dem späteren Papst Paul VI., der ursprünglich keine kirchliche, sondern eine politische Karriere im Sinn gehabt hatte, war Lambert ungehindert zum mächtigsten Mann im Vatikan aufgestiegen. Montini hatte einen interessanten Werdegang gehabt, hatte für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet und war nebenbei Mitglied einer Freimaurerloge gewesen. Für Lambert war er ein bequemer Vorgesetzter gewesen, der es ihm möglich gemacht hatte, das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende zu führen, um die Modernisten innerhalb der Kirche und die Öffentlichkeit für eine ganze Weile zufriedenzustellen.
Inzwischen führte Lambert sein Werk in aller Ruhe weiter. Es war ihm zwar nicht mehr möglich, die Ketzer auf den Scheiterhaufen zu schicken, aber es gab auch andere Methoden, die reine Lehre durchzusetzen. Eines der dazu eingesetzten Mittel war ein über Jahrhunderte aufgebautes Netz von Agenten und Spitzeln, mit dem Zweck, die Modernisten innerhalb der Kirche aufzuspüren und wenigstens mundtot zu machen. Lambert beherrschte sein Handwerk so gut, dass selbst Johannes Paul II. seine Position kaum mehr hatte antasten können. Es wurde nur hinter vorgehaltener Hand darüber geredet, aber ohne Lambert wäre er nicht einmal zum Papst gewählt worden.
Und wieder klingelte das Telefon.
»Lambert!«, bellte er in den Hörer.
»Hier ist Salvoni, wir sollten uns kurz zusammensetzen«, tönte es sehr bestimmt.
»Kann das nicht bis morgen warten? Ich bin lange genug im Dienst.«
»Es gibt Dinge unter Gottes Sonne, die können nicht warten. Wir haben beunruhigende Nachrichten aus Dublin von einem gewissen Ronald MacClary.«
»Bitte verschonen Sie mich mit den Sorgen von Padre Morati, das habe ich schon persönlich von ihm vernommen. Wir haben weiß Gott andere Probleme in Dublin als diesen Mann, der einer untergegangenen Kultur auf Kosten der Kirche wieder zur Bedeutung verhelfen will. Wäre er nicht in solch exponierter Position, hätten wir ihn längst der Lächerlichkeit preisgegeben«, präzisierte Lambert seinen Wunsch nach Ruhe.
»Ich respektiere selbstverständlich Ihre Auffassung, aber in diesem Fall bin ich mir nicht sicher, ob Morati Ihnen alles erzählt hat.«
»In Gottes Namen, dann kommen Sie hoch.«
Lambert ließ sich gerade erschöpft in seinen Sessel fallen, als sich die Tür zu seinem bescheidenen Büro öffnete und eine nervöse Gestalt den Raum betrat.
»Also, Salvoni, was kann ich für Sie tun?«
Salvoni kümmerte sich seit gut zehn Jahren als Leiter des ältesten Geheimdienstes der Welt um jene Belange, die nie das Ohr der Öffentlichkeit erreichen sollten. Tatsächlich war er zuständig für alle Angelegenheiten in Europa. Aber nachdem bereits seit mehr als zehn Jahren immer mehr unangenehme Fakten über die weltweiten Machenschaften und Verfehlungen der Kirche diskutiert wurden und ihr Einfluss in Europa zusehends dahinschmolz, war sein Stand alles andere als leicht.
Er war klein, schmächtig, sportlich, und sein kleiner Schnauzbart verlieh ihm mit seiner braun gebrannten und von Akne gezeichneten Haut ein wenig die Ausstrahlung einer Schlange. Genau diese Ausstrahlung hatte ihm in den vergangenen Jahren seinen Posten gesichert, und selbst Lambert war sich seiner nie ganz sicher, so sehr er seine Qualitäten schätzte.
»Machen wir es uns einfach, wir müssen ohnehin mit einigen Mitarbeitern nach Dublin, um das Ausmaß und den Nachrichtenfluss dieser schrecklichen Missbrauchsvorwürfe steuern zu können. Da kann es nicht schaden, sich zumindest den Vortrag und vielleicht auch etwas mehr genauer anzusehen«, erwiderte Victor Salvoni in aller Ruhe.
»Was versprechen Sie sich davon?«
»Gewissheit, nur Gewissheit.«
»Nein, ich brauche Sie an anderer Stelle, schicken Sie Caloni, er soll ausschließlich MacClary beobachten, und zwar indem er sich auf den Vortrag konzentriert und nichts weiter. Ich will keinen Zwischenfall mit einem Mann, der zu den wichtigsten Richtern in Amerika gehört. Offen gestanden, kann ich Ihre Sorge nicht teilen, sosehr ich Ihre Vorsicht zu schätzen weiß. Haben wir uns verstanden?«
Mit einem kalten Lächeln nickte Victor Salvoni und verneigte sich vor Lambert.
»Ich rate Ihnen, mir etwas mehr freie Hand zu geben. Bruder Morati glaubt felsenfest, dass MacClary uns gefährlich werden könnte. Und ich muss Ihnen nicht erklären, dass nicht wenige unserer Brüder und Schwestern in den USA zwar fromm im Glauben sind, aber nicht immer loyal zum Vatikan stehen.«
Lambert wurde langsam wütend und musste sich angesichts seiner Müdigkeit beherrschen, Salvoni nicht schärfer anzugehen.
»Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, könnte das die Stimmung erst recht gefährlich werden lassen. Glauben Sie im Ernst, dass es das wert ist?«
»Nun, nach meiner bescheidenen Erfahrung, ja«, erwiderte Salvoni.
»Schon gut, schon gut, ich weiß, dass der Herrgott Ihre Ambitionen immer geschützt hat. Also gut. Und Salvoni, da ich nicht damit rechne, dass Sie irgendetwas in Sachen MacClary unternehmen müssen, was nicht auch unsere Presseabteilung erledigen kann, erwarte ich bis Montag Vorschläge, wie wir die verlorenen Brüder in Irland auffangen können.«
»Geht in Ordnung«, klang es reserviert zurück, und Salvoni schlug die Tür fest hinter sich zu, um seinem Unmut Ausdruck zu verleihen.
6
Wien-Schwechat – Dublin
Shane war es gewohnt, dass es in Irland nur selten einen wolkenfreien und sommerlichen Tag gab, aber heute ließ der Himmel über Dublin so viel Wasser niederprasseln, dass die Landung sicher kein Vergnügen werden würde.
Für ihn war das der pure Horror. Er hasste es, zu fliegen, da er vor gut zwanzig Jahren fast mit einem kleinem Flugzeug abgestürzt war; nur die Künste eines begnadeten Piloten hatten ihm und den anderen Passagieren das Leben gerettet. Nach gut 3000 Fuß Sturzflug hatte der Pilot die Maschine abgefangen, doch Shanes Trommelfelle waren geplatzt wie eine Seifenblase. Seither war jeder Flug eine Qual, eine Herausforderung gegen alle seine Instinkte.
Als ob seine Angst sich materialisiert hätte, schlingerte das Flugzeug in der Tat relativ unsanft über die Landebahn und kam erst kurz vor dem Ende der Rollbahn zum Stehen.
»Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Geduld und hoffe, dass Ihnen die leichten Turbulenzen nicht allzu sehr zugesetzt haben«, war aus dem Lautsprecher zu hören.
Mit blassem Gesicht und wackeligen Beinen stand Shane auf.
»Geht es Ihnen nicht gut?«
Shane drehte sich um und sah in die Augen eines alten Mannes, sicher über siebzig, der wie ein Jüngling sein Handgepäck über die Schulter schwang und dabei lächelte, als wüsste er genau, was in Shane vorging.
Shane hatte den gesamten Flug neben ihm gesessen, aber er war so sehr mit seiner Angst und den Gedanken an das Treffen der Heiler beschäftigt gewesen, dass er nichts um sich herum wahrgenommen hatte.
»Danke, es geht gleich wieder, ich fliege einfach nicht besonders gern«, erwiderte er mit einem verkrampften Ausdruck, der sein ganzes Gesicht durchzog.
»Guter Mann, wenn Gott es will, holt er Sie, ob nun durch einen Absturz des Flugzeugs oder mit einer Bananenschale, auf der Sie ausrutschen und sich das Genick brechen. Das spielt keine Rolle, darauf haben Sie keinen Einfluss, also wozu sich Sorgen machen?«
»Ich weiß nicht, ob ich einem Gott mein Schicksal überlassen möchte«, entgegnete Shane prompt mit einer sichtlichen Entspannung, die seinen Körper durchdrang. »Aber wahrscheinlich haben Sie recht – wobei sich die Frage stellt, von welchem Gott Sie eigentlich sprechen. Etwa von dem ergrauten Schöpfer, der vom Himmel herabschauend wohlwollend die Geschicke seiner Schäfchen lenkt?«
Mit einem vergnügten Lächeln stellte sich der äußerst agile vermeintliche Rentner vor: »Eric Fink, ich bin vom Standard in Wien, und ich werde sicher nicht mit einem Flugangstpatienten eine theologische Grundsatzdebatte anfangen. Es sei denn, es hilft Ihnen, sich aus diesem jämmerlichen Zustand zu befreien.«
Shane verzog das Gesicht, stellte sich gerade hin und versuchte krampfhaft, seine hochkommende Angst zu unterdrücken. »Wahrscheinlich wäre es schon eine hilfreiche Ablenkung. Was treibt Sie nach Dublin?«
»Ich schreibe eine Reportage über den Segen, den das katholische Bistum über Dublins Kinder gebracht hat«, gab der ergraute Journalist mit maliziösem Lächeln zur Antwort. »Womit auch geklärt wäre, was ich von Ihrem Gottesbild halte.«
»Oh, Vorsicht, das ist sicher nicht mein Bild«, grinste Shane. »Wenn Sie darüber mehr erfahren wollen, würde ich Ihnen raten, sich diesen Vortrag anzuhören.«
Der Österreicher schaute skeptisch auf die Einladung, riss dann aber erstaunt die Augen auf. »Das sollte sich machen lassen«, bemerkte er und bewegte sich dann wie alle anderen Richtung Ausgang.
Shane hatte noch nicht wirklich die Gewalt über seinen Körper wieder und verabschiedete sich. Am Ausgang angelangt, schnappte er nach Luft und war froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. In der Ankunftshalle ließ er sich erschöpft auf eine Bank fallen.
Er dachte an die Worte des alten Mannes, was die Art unseres Todes angeht, und an Victoria. Der Zynismus, mit dem der Journalist den Skandalen über den Missbrauch von Kindern begegnete, war keine Lösung. Was hatte das alles überhaupt mit der Frage nach Gott zu tun, dessen Absolutheit die Kirche für sich beanspruchte? Obwohl sie doch nur aus fehlbaren Menschen bestand und genauso hilflos ihren Schwächen und Nöten ausgesetzt war wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. »Jeder? Ja, jeder«, fasste Shane seine eigene Schwarzmalerei zusammen.
Schlimmer noch, dachte er sich. Mit seiner eigenen Resignation wurde aus ihm ein ebensolcher Zyniker und Schwarzmaler, der glaubte, über alles seine Urteile fällen zu können – ohne Rücksicht auf das, was er damit anrichtete, und zwar mit sich selbst und mit seiner Umgebung. Er müsste erst einmal selbst verkörpern, was er einforderte. »Solange ich gegen etwas kämpfe, erzeuge ich es im Grunde genommen ständig selbst oder helfe, es aufrechtzuhalten«, seufzte Shane, ohne zu wissen, was diese Erkenntnis schon bald für ihn bedeuten würde.
»Ich möchte meinen Frieden«, stöhnte er leise. »Einfach nur meinen Frieden…«
7
Dubliner Innenstadt
Thomas Ryan saß – oder besser gesagt lag – mit ausgebreiteten Armen auf einem Tisch im Porterhouse, einem der größten Pubs mit eigener Brauerei im Herzen Dublins, in der Nassau Street, ganz nahe dem Trinity College. Neben ihm, in weitaus besserer Verfassung, saß Deborah Walker, die er meistens Deb nannte, und redete auf ihn ein.
»Du siehst nicht so aus, als ob du heute Abend wirklich noch was zustande bringst. Menschenskind, Thomas, du hast in zwei Stunden deine Diskussion mit Ellison und bist breit wie der letzte Kelte.«
Ryan musste plötzlich herzlich lachen und spritzte einen Schluck Guinness aus seinem Mund gute zwei Meter über den Tisch. »Ja, genau, wie der letzte Kelte, du hast völlig recht, meine Liebe. Mir ist klar geworden, was für ein Narrenfest das hier jedes Jahr ist, und es ist mir scheißegal, ob Ellison mich versucht zu verarschen, wenn ich dabei bin oder alleine. Wo ist der Unterschied? Ich sag dir, wo der Unterschied ist: Vor dreihundert Jahren hätte ich diesem Möchtegern-Druiden einfach den Kopf abgeschlagen.« Er stemmte seinen kräftigen Körper nach oben und strich sich die blonden Haare zurück. Sein Gesicht war von den Jahren harter Arbeit als Landwirt gezeichnet, dennoch strahlte er Lebenslust, Kraft und Gesundheit aus. Er wirkte nur auf den ersten Blick schroff, und seine blauen Augen sprachen eher von Sanftmut und Weisheit. Betrunken und hart hatte ihn Deborah jedenfalls noch nie erlebt. In den letzten Jahren hatte sich Ryan, veranlasst durch die Aufzeichnungen seiner Großmutter, immer mehr vom Landwirt zum Kräuterexperten gewandelt und sich in den Hinterstuben einiger Pubs seiner Patienten angenommen. Deborah schlug sich in Dublin als Lektorin für irische Literatur durchs Leben. Mit ihren mahagoniroten Locken und der altmodischen Nickelbrille wirkte sie immer noch wie eine Studentin oder Stipendiatin aus Oxford. Doch die kleine, kräftige Frau hatte es eigentlich faustdick hinter den Ohren, wie Ryan immer sagte, zumindest wenn es um die Deutung der alten Sprachen ging. Ärgerlich nur, dass sich kaum noch jemand für Walisisch oder/und andere urkeltische Dialekte interessierte.
»Warte hier, ich hol mir einen Kaffee.«
Ryan stand auf und ging in Richtung Tresen am Eingang vorbei.
Shane hatte sich mit einem Taxi zum Porterhouse bringen lassen und war froh, aus der klammen Nässe Dublins in den belebten und warmen Pub zu kommen. Die kupferfarbenen Braukessel und Zapfanlagen, die dunkle Tönung des uralten Überseeholzes, der Duft von Rauch und Bier – und überall diese Kunst, Licht und Werbung so zu platzieren, dass man sich sogleich wohlfühlen musste: Dieser Ort war einfach traumhaft.
Als er in Richtung des Tresens schaute, sah er Thomas Ryan. Er ging langsam auf ihn zu, und als Ryan sich umdrehte, hätte er beinahe seinen Kaffee verschüttet.
»Langsam, junger Mann«, lallte Ryan ihm entgegen. »Oder wollen Sie unbedingt die nächste Runde zahlen?« Dann stutzte er und sah Shane genauer an.
»Ah, na, wenn das nicht mein suchender Freund aus Österreich ist. Großartig! Wie ich sehe, bist du meiner Einladung also gefolgt.«
»Ja, gerne sogar.«
Mit einem herzlichen Lachen deutete Ryan auf einen der hinteren Tische.
»Da hinten, bei der Hexe mit dem runden Sehglas und dem bösartigen Ausdruck im Gesicht, setzen wir uns.«
»Sag, sehe ich das richtig, hier findet ein Treffen von Druiden statt?«, sagte Shane.
»Klar, und ich bin Thomas Ryan, Großmeister des letzten Ordens der wahren Druiden«, sagte sein Gegenüber mit einem boshaften Lächeln – laut genug, dass Deborah die Hände über dem Kopf zusammenschlug und in ihrem Pullover versank.
»Klingt, als ob du nicht sonderlich begeistert wärst, dabei zu sein.«
Ryan wirkte plötzlich wieder ganz klar und schaute Shane tief in die Augen.
»Richtig, und es war auch sicher das letzte Mal.«
Shane stand noch etwas ratlos im Raum und fühlte sich unbehaglich, als er sah, dass ihn einige Leute nach Ryans Auftritt skeptisch anschauten. Trotzdem nahm er seine Tasche und ging hinüber zu Deborah Walker.
»Hallo, ich bin Debbie. Ich muss mich für Thomas’ Auftritt entschuldigen, das ist heute nicht sein Tag«, begrüßte sie ihn freundlich und einladend. »Setz dich, was magst du trinken?«
»Hallo. Ich bin Adam. Na, was trinkt man hier schon, ein Guinness natürlich.«
»Du kommst aus Deutschland?«
»Nein, aus Österreich. Mein Vater stammt allerdings aus Dublin; er ist nach dem Krieg nach Österreich ausgewandert«, erklärte Shane mit Stolz in den Augen.
»Und was treibt dich hierher?«
»Sagen wir mal, ein merkwürdiger Traum und diese Einladung.«
Shane zog die durch den Regen in Mitleidenschaft gezogene Einladung von Thomas heraus und sah in Deborahs grinsendes Gesicht.