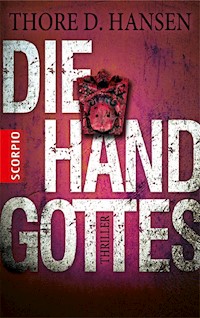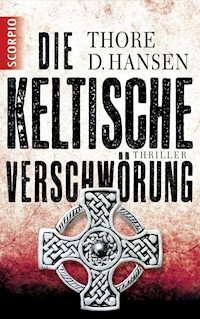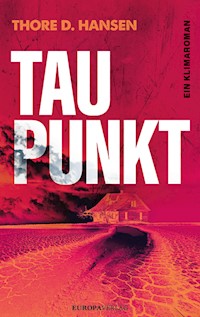Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In Ein deutsches Leben erzählt Brunhilde Pomsel, die frühere Sekretärin von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels, über ihr Desinteresse angesichts des Aufstiegs der Nationalsozialisten, ihr Streben nach dem eigenen Fortkommen in Zeiten des gesellschaftlichen und moralischen Verfalls – und nicht zuletzt ihre Arbeit in einer der Schaltstellen der Nazi-Herrschaft. Der Politikwissenschaftler Thore D. Hansen nimmt die politische Einordnung ihrer Erinnerungen vor und stellt frappierende Parallelen zwischen damals und heute fest. Und so ist Ein deutsches Leben ein Weckruf an die heutige Generation. Denn am Beispiel von Brunhilde Pomsel wird sichtbar, wohin Gleichgültigkeit, Ignoranz und politisches Desinteresse führen können. Brunhilde Pomsel diente einem der größten Verbrecher der Geschichte. Von 1942 bis 1945 war sie Stenotypistin im Propagandaministerium von Joseph Goebbels. In ihren Erinnerungen gibt sie einen Einblick in die Banalität des Schreckens. Pomsel war eine unpolitische Mitläuferin, und das bestreitet sie auch nicht. Ihr gingen der Job, ihr Pflichtgefühl und das Bedürfnis dazuzugehören vor. Erst nach Kriegsende sei ihr das ganze Ausmaß der Geschehnisse bewusst geworden. Ihre Lebensgeschichte und ihre bestechende Ehrlichkeit konfrontieren uns mit der hochaktuellen Frage nach der persönlichen Verantwortung für das politische Zeitgeschehen und den Konsequenzen eines wiedererstarkten Nationalismus und Populismus. Werden wir später auch wie Brunhilde Pomsel sagen: "Wir wollten es ja auch nicht wissen"?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von den Regisseuren des Filmes
EIN DEUTSCHES LEBEN
Christian Krönes
Olaf S. Müller
Roland Schrotthofer
Florian Weigensamer
1. eBook-Ausgabe 2017
© 2017 Europa Verlag GmbH & Co. KG,
Berlin · München · Zürich · Wien
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung zweier Fotos von © Blackbox Film & Medienproduktion GmbH / Micha Müller und © Blackbox Film & Medienproduktion GmbH / Brunhilde Pomsel Privataufnahme
Lektorat: Ilka Heinemann, Köln
Layout & Satz: Danai Afrati & Robert Gigler, München
Konvertierung: Brockhaus/Commission
ePub-ISBN: 978-3-95890-141-4
ePDF-ISBN: 978-3-95890-142-1
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
Vorwortvon Thore D. Hansen
Die nachfolgenden Kapitel wurden aufgezeichnet von C. Krönes, O. Müller, R. Schrotthofer, F. Weigensamer; überarbeitet von Thore D. Hansen
»Politik hat uns nicht interessiert«Eine Jugend im Berlin der Dreißigerjahre
»Hitler war einfach nur ein neuer Mann«Einstieg in den Reichsrundfunk
»Es war ein bisschen Elite«Aufstieg ins Propagandaministerium
»Treue bis zum Untergang«Die letzten Tage im Propagandaministerium
»Nichts haben wir gewusst«Inhaftierung und Neuanfang
»Schuldig war ich nicht«Das Resümee einer Hundertdreijährigen
Was uns die Geschichte von Goebbels’ Sekretärin für die Gegenwart lehrtVon Thore D. Hansen
Danksagung
Anmerkungen
»Ist es denn schlecht, ist es denn Egoismus, wenn die Menschen versuchen, an dem Platz, an den sie gestellt wurden, etwas zu tun, was für sie gut ist, und sie wissen, damit schade ich einem anderen? Aber wer tut denn das? So weit denkt doch niemand. Kurzsichtig und gleichgültig waren wir.«
BRUNHILDE POMSEL, MÜNCHEN 2013
»Ein deutsches Leben ist nicht nur einer der wichtigsten Beiträge zur Aufarbeitung des Holocaust, sondern angesichts der aktuellen politischen Situation eine längst fällig, zeitlose Mahnung an heutige und künftige Generationen.«
DANIEL CHANOCH, HOLOCAUST-ÜBERLEBENDER
VORWORT
Von Thore D. Hansen
Brunhilde Pomsel kam einem der größten Verbrecher der Geschichte so nah wie nur wenige Menschen ihrer Zeit. Sie war im Propagandaministerium unter Joseph Goebbels Stenotypistin und Sekretärin. Kurz nach der Machtübernahme Adolf Hitlers trat sie zunächst in die NSDAP ein, um sich eine Stelle beim Reichsrundfunk zu sichern. 1942 wechselte sie in das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda und geriet so bis zur Kapitulation Berlins im Mai 1945 ins Vorzimmer von Hitlers Propagandaminister und mitten in die Führungselite des Nationalsozialismus. Noch in den letzten Kriegstagen, als die sowjetischen Truppen bereits in den Straßen Berlins standen, tippte sie im Bunker Schriftsätze und nähte sogar die Fahne der offiziellen Kapitulation Berlins, anstatt eine Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen. Über sieben Jahrzehnte hat sie geschwiegen.
In ihrem Dokumentarfilm Ein deutsches Leben haben die Filmemacher Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer und Florian Weigensamer Brunhilde Pomsel vor die Kamera geholt und sie in eindrucksvoll ausgeleuchteten Schwarz-Weiß-Bildern aus ihrem Leben erzählen lassen. Ihre späte Erzählung wirkt befremdlich und faszinierend zugleich. Auf diesen 2013 aufgezeichneten Erinnerungen fußt dieses Buch. Sie wurden hierfür vom Autor chronologisch geordnet und behutsam dort korrigiert, wo es gesprochene Sprache und Grammatik erforderlich machten.
Brunhilde Pomsels Erzählungen beginnen mit ihrer Kindheit in Berlin, wo sie 1911 geboren wurde. Sie handeln vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges und dem wortkargen Vater, der 1918 unverletzt aus Russland zurückkehrt, der strengen Erziehung, die sie als ältere Schwester von vier Brüdern erlebt hat und die sie nachhaltig prägte. Der Vater war ein verschlossener Mann, über Politik wurde zu Hause nicht gesprochen. Brunhilde Pomsel wuchs in einem der bessergestellten Stadtteile Berlins auf. Die Familie konnte sich vergleichsweise gut ernähren, während im Rest Berlins, wie in ganz Deutschland, die materielle Lage breiter Bevölkerungsschichten äußerst prekär war. Unruhen durchzogen das Land, die politisch extremen Gegensätze von protestierenden Kommunisten und Nationalsozialisten bestimmten das Straßenbild, es kam zu immer mehr gewalttätigen Auseinandersetzungen. Doch im Berliner Stadtteil Südende, einem Viertel mit vielen Villen, war davon relativ wenig zu spüren.
Ihre gleichgültige Haltung gegenüber der neuen Bewegung der NSDAP erscheint Brunhilde Pomsel in der Nachbetrachtung als ausschlaggebend für ihre Karriere. Ihre Sommerliebe Heinz machte sie Ende 1932 mit einem verdienten Offizier des Ersten Weltkrieges bekannt. Diese Begegnung entpuppte sich als schicksalhaft für die junge Frau. Es ist Wulf Bley, späterer Rundfunkreporter und Parteimitglied der ersten Stunde, der sie unter seine Fittiche nimmt – ausgerechnet der Mann, der als Reporter unter schwülstigen Worten nach dem Sieg der NSDAP im März 1933 den Fackelzug im Beisein der gesamten Elite der Nazis kommentieren wird. Kurz nach Hitlers Machtergreifung holte er Brunhilde Pomsel ans Deutsche Theater, wo der verhinderte Schriftsteller Bley als Dramaturg kläglich versagte. Schließlich bekam er als NSDAP-Mitglied die nächste Gelegenheit, einen Posten einzunehmen, und forderte Pomsel auf, in die Partei einzutreten, damit er sie als seine Sekretärin mit in den Reichsrundfunk nehmen könne. Der Rundfunk war von den Nazis längst gesäubert worden, sämtliche jüdischen Direktoren waren entlassen und mit Berufsverbot belegt worden.
Nur kurze Zeit später wurde Wulf Bley abermals versetzt, aber für Brunhilde Pomsel war die Begegnung mit diesem Mann der Beginn eines Aufstiegs, der sie in den inneren Zirkel der Macht bringen sollte – der Beginn einer außergewöhnlichen Biografie, die sie erst im biblischen Alter erzählen mag.
Während ihr in den vergangenen 70 Jahren viele Erinnerungen abhandengekommen sind, bleiben ihr zentrale Ereignisse und Wendepunkte bildhaft im Gedächtnis. Diese Ausschnitte eines bewegten Lebens, aber auch die Art und Weise, wie Brunhilde Pomsel mit ihren Erfahrungen im Rundfunk und später im Propagandaministerium umgeht, sind nicht frei von erheblichen Widersprüchen. Immer wieder erreicht man Stellen, an denen sie einem etwas vorenthält, um es andernorts doch einzugestehen – und genau darin liegt der Reiz, ihrer Erzählung zu folgen.
Die Geschichte von Brunhilde Pomsel dient nicht dazu, neue historische Erkenntnisse zu gewinnen. Sie gibt vielmehr einen offenen Einblick in die Eigenschaften einer damaligen Mitläuferin und ist damit zwangsläufig auch eine Warnung an die Menschen unserer Zeit – an uns alle. Es ist kaum noch zu bestreiten, dass wir uns jetzt – wie damals – mitten in einer Situation befinden, in der antidemokratische Tendenzen und rechter Populismus dort angekommen sind, wo sie für eine Gesellschaft und ein demokratisches System gefährlich werden: nämlich in der Mitte der Bevölkerung.
Die politisch-soziologischen Analysen widmen sich spätestens seit 2015 aufgeregt der Frage, wie es sein kann, dass es in Europa und auch in den USA wieder salonfähig geworden ist, rechtes Gedankengut von sich zu geben, pauschal Gruppen als Sündenböcke zu diskriminieren und Übergriffe gegen Minderheiten wie Kriegsflüchtlinge zu dulden. Mit der Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist ein Mann an die Spitze gelangt, der den Populisten in Europa weiteren Auftrieb gibt, da er mit ähnlichen Parolen und vereinfachenden Lösungen in einer hochkomplexen Welt seine Wähler mobilisieren konnte, während über 40 Prozent der US-Bevölkerung erst gar nicht zur Wahl gingen.
In zahlreichen westlichen Staaten wird wieder nach einer starken »Führung« gerufen, ohne einem breiten Protest zu begegnen. Bedienen sich Populisten und Faschisten abermals der Mitläufer, der schweigenden Masse, um die Demokratie zu verdrängen?
Brunhilde Pomsel interessierte sich nicht für Politik. Ihr ging der Job vor, ihre materielle Sicherheit, ihr Pflichtgefühl gegenüber den Vorgesetzten, das Bedürfnis dazuzugehören. Bildhaft und intim beschreibt sie ihren Werdegang. Eine persönliche Schuld an den Verbrechen des nationalsozialistischen Systems weist sie von sich.
Nur selten waren nach den Premieren von Ein deutsches Leben in Israel und San Francisco jedoch verächtliche Stimmen oder Schuldzuweisungen zu hören. »Hut ab vor dem, der von sich mit Sicherheit behaupten kann, er hätte nicht mitgemacht«, so die Feststellung einer Korrespondentin der Frankfurter Rundschau.
Anstatt eine Verurteilung von Brunhilde Pomsels Leben hervorzurufen, löste der Dokumentarfilm bei den Zuschauern überwiegend Fragen über unsere Zeit aus. Wiederholen sich die dunklen Dreißigerjahre? Sind unsere Angst, Ignoranz und Passivität am Ende für das Erstarken der neuen Rechten verantwortlich? Einige Jahrzehnte nahmen wir an, dass das Gespenst des Faschismus überwunden sei. Aber Brunhilde Pomsel macht uns klar: Das ist nicht der Fall. Pomsels erstaunlich klar gefassten Beschreibungen des harmlosen Alltags inmitten der Kriegszeit, ihrem Aufstieg als »unpolitisches Mädchen«, ihrer emotionalen Distanz zur Realität werden im Film Goebbels-Zitate, Leichenberge, Skelettgestalten von befreiten Juden aus den Konzentrationslagern, Propagandamaterial und andere entlarvende Aspekte des Nazireichs kommentarlos gegenübergestellt, als harter Kontrast zu Pomsels Wahrnehmungen und Erinnerungen.
Die Assoziationen der Zuschauer, das unweigerlich einsetzende Vergleichen mit heute gaben den Anlass, in diesem Buch Pomsels Erfahrungen den Entwicklungen der Gegenwart gegenüberzustellen und zum Thema zu machen. Sind die Befürchtungen übertrieben, dass sich die Geschichte wiederholen könnte? Oder sind wir längst an einem Punkt angekommen, an dem eine neue Epoche des Faschismus oder Autoritarismus nicht mehr aufzuhalten ist? Kann uns die Geschichte von Brunhilde Pomsel Hinweise darauf geben, inwieweit die Suche nach dem persönlichen Vorteil uns ignorant werden lässt gegenüber gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen?
Um sich über Brunhilde Pomsels Biografie der Gegenwart zu nähern, muss auch der Frage nachgegangen werden, welche Verantwortung die demokratischen Eliten an der aktuellen Entwicklung tragen und ob es auch hier Parallelen zu den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts gibt.
Die Herausforderungen der Moderne in Form von Digitalisierung, Finanzkrisen, Flüchtlingswellen, Klimawandel, den sozialen Rahmenbedingungen einer vernetzten Welt und die daraus resultierenden Ängste vor Abstieg und Überfremdung führen bei Teilen der Bevölkerung zu einem Rückzug ins Private bis hin zur Radikalisierung. Auf den ersten Blick lebte Brunhilde Pomsel vor gut 70 Jahren in einer völlig anderen Zeit als wir. Sie erzählt uns von all ihren kleinen Entscheidungen, die für den Zuhörer auf den ersten Blick scheinbar logisch, vernünftig und nachvollziehbar sind – bis zu dem Punkt in ihrer Geschichte, bei dem jeder Einzelne sich fragen kann: Ja, hätte ich dann nicht auch plötzlich selbst bei Goebbels im Vorzimmer gesessen? Wie viel von Brunhilde Pomsel steckt in jedem von uns? Oder wie ein Redakteur kurz nach der Premiere des Films provozierend fragte: »Sind wir nicht alle ein wenig Pomsel?«
Und Millionen Pomsels, die stets nur an ihr eigenes Fortkommen, ihre materielle Sicherheit denken und dabei Ungerechtigkeit in der Gesellschaft und Diskriminierung von anderen billigend in Kauf nehmen, sind ein solides Fundament für jedes manipulative, autoritäre System. Und damit gefährlicher als die radikale Stammwählerschaft von extremen Parteien. Brunhilde Pomsel musste am Ende mit ansehen, wie ihr Land einen ganzen Kontinent in den Abgrund stürzte.
Bevor sich die Geschichte wiederholt, bietet die Auseinandersetzung mit den Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart uns die Gelegenheit, unseren eigenen moralischen Kompass so fein zu justieren, dass wir bemerken, wann der Punkt gekommen ist, Stellung zu beziehen, aufzustehen und der Radikalisierung klar und offen entgegenzutreten. Wie leichtsinnig gehen wir alle mit unserem inneren moralischen Messinstrument um? Für welche primitiven, kurzfristigen, banalen und oberflächlichen Ziele oder scheinbaren Erfolge opfern wir dieses innere Maß? Fragen, auf die uns die Geschichte von Brunhilde Pomsel keine allgemeingültige Antwort geben kann und wird. Nur die jeweils individuelle Bereitschaft zur Reflexion vermag dies zu leisten.
In zahlreichen Ländern Europas und zuletzt in einem der mächtigsten Länder der Welt, den USA, steigen Populisten auf. Einige Führungen mitteleuropäischer Länder wie in Polen und Ungarn bauen demokratische Systeme bereits nachhaltig ab. Ganz zu schweigen von der Türkei, wo die Prinzipien von Rechtsstaat und Meinungsfreiheit keine Gültigkeit mehr haben und wo Massenverhaftungen und Säuberungswellen gegen Zehntausende vermeintlicher Kritiker zum Paradebeispiel für die Mechanismen einer entstehenden Diktatur werden. Und es könnte nicht die letzte sein.
Und dann gibt es auch noch das Phänomen Donald Trump in den Vereinigten Staaten, mit dem schmutzigsten Wahlkampf in der US-Geschichte gegen Minderheiten und Migranten, gegen das Establishment. Ein Wahlkampf, der unter Zuhilfenahme von Lügen und rassistischen Parolen geführt wurde und der dem Immobilienguru so das Amt des Präsidenten gesichert hat.
Dies und die zunehmend schrillen Töne auch in Europa sind die Vorboten einer neuen Epoche von autoritären Strömungen, die die Freiheit und Demokratie in ihren Grundfesten bedrohen. Vor diesem Hintergrund dient Brunhilde Pomsels Geschichte als emotionale Matrix, die den Leser mit der hochaktuellen Frage nach der jeweils eigenen Verantwortung für das politische Zeitgeschehen konfrontiert – als Warnung, nicht länger wegzusehen. Eine Standortvermessung dessen, wo wir als Gesellschaft und jeder für sich stehen.
Brunhilde Pomsel erzählt uns auf den folgenden Seiten von ihrer Kindheit, ihrer Arbeit für einen jüdischen Rechtsanwalt, ihrem Eintritt in die Partei, dem Zugang zum Reichsrundfunk, dem Übergang in das Propagandaministerium, bis hin zum Kriegsende und ihrer darauf folgenden Internierung in einem sowjetischen Speziallager und ihrer Rückkehr in die Freiheit. Durch ihre Biografie zieht sich auch das Schicksal ihrer jüdischen Freundin Eva Löwenthal, die sich in Berlin zunächst noch als Feuilletonistin gerade über Wasser halten konnte und schließlich 1943 von Berlin in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde.
Das mangelnde Interesse breiter Bevölkerungsschichten an Politik, einhergehend mit einem Verlust von Empathie und Solidarität, erscheint durch Pomsels Erzählung als eine der Ursachen für den Aufstieg und Erfolg der Nationalsozialisten, auch wenn sie dies selbst nicht frei von Widersprüchen betrachtet oder betrachten kann.
Brunhilde Pomsels Geschichte erlaubt uns eine Inneneinsicht, angesichts derer jeder für sich unausweichlich klären kann, wo er selbst steht. Oder um es mit den Worten des polnischen Schriftstellers Andrzej Stasiuk zu sagen: »Je mehr Angst wir Wähler haben, desto größere Feiglinge wählen wir. Und diese Angstverwalter opfern dann alles, um an der Macht zu bleiben: uns, unser Land, unseren Kontinent Europa.«
Gehen wir feige in Deckung oder treten wir dem entgegen?
Thore D. Hansen,
Januar 2017
»Vor 1933 hatte ohnehin kein Mensch über die Juden nachgedacht, reine Erfindungen der späteren Nazis. Es ist uns erst durch den Nationalsozialismus bewusst gemacht worden, dass das andere Menschen sind.Das gehörte später alles in das geplante Judenvernichtungsprogramm.Wir hatten nichts gegen Juden.«
BRUNHILDE POMSEL
»POLITIK HAT UNS NICHT INTERESSIERT«
Eine Jugend im Berlin der Dreißigerjahre
Brunhilde Pomsels Erinnerungen beginnen vage mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914, da ist sie drei Jahre alt. Die Mutter erhält unerwartet ein Telegramm, der Vater soll als einer der Ersten für den Kriegseinsatz eingezogen werden. Hals über Kopf fahren sie mit einer Kutsche nach Berlin zum Potsdamer Bahnhof, um den Vater zu verabschieden. Nach vier Jahren Krieg kehrt der Vater im November 1918 unversehrt zurück.
Meine Erinnerungen sind mir sehr wichtig. Sie verfolgen mich auch. Sie lassen mich nicht los. Ich vergesse zwar Namen und bestimmte Ereignisse, die ich schon gar nicht mehr mit Worten beschreiben kann. Aber sonst ist alles da, wie in einem großen Lexikon oder Bilderbuch. Ich denke zurück, wie ich so ein kleines Mädchen war. Und ich weiß auch, dass ich in meinem Leben vielen Menschen allein durch mein Dasein Freude gemacht habe. Das ist ja auch schon ein ganz schöner Gedanke.
Als mein Vater aus dem Krieg zurückkehrte, weiß ich noch genau, dass wir unsere Mutti gefragt haben: »Mutti, was macht der fremde Mann in unserer Wohnung?« Und dann begann eine schwierige Zeit. Es war ein Hungerleben damals. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges wurden Volksküchen eingerichtet. Obwohl meine Mutter immer alles für uns gekocht und zubereitet hat, sagte sie irgendwann: »Wir wollen das doch mal ausprobieren«, und ist mit uns Kindern in so eine Volksküche gegangen, da haben wir Mittagessen genommen. Und als wir gingen, hat sie gesagt: »Das mach ich nie wieder.«
Auf dem Rückweg lag ich meiner Mutter in den Ohren: »Ich möchte dem Hindenburg einen Nagel einschlagen.1 Da stand eine riesige Holzfigur am Königsplatz, die stellte unfertig den Reichsfeldmarschall Hindenburg dar. Und für fünf Pfennig – ein Sechser, der Berliner sagte zu einem Fünferstück Sechser –, für einen Sechser kriegte man einen Hammer und einen Nagel in die Hand gedrückt und durfte irgendwo, an eine bestimmte Stelle das einschlagen. Das war … das musste man tun. Dafür Geld auszugeben, das hat sie sich geleistet, um mir eine Freude zu bereiten.
Mein Vater hatte Glück gehabt. Er war in Russland, immer in Russland, trotzdem wurde er nicht verletzt oder gar getötet. Aber der Krieg hatte andere Spuren hinterlassen. Er war ein noch stillerer Mann geworden, und vielleicht war Politik auch deshalb zu Hause nie ein Thema. Bis dann die Nazis kamen, da wurde es dann eins, aber auch da nur an der Oberfläche.
Eine kinderreiche Familie hatte es zu der Zeit nicht leicht. Wir waren fünf Kinder. Dann sollte noch ein Mädchen kommen, aber es kamen immer noch Jungs. Damals konnte man ja diese Dinge noch nicht kontrollieren. Es wurde also immer dem Zufall überlassen. Ich war ein bisschen überfordert als die Älteste und auch noch als einziges Mädchen. Ich war für alles verantwortlich, was die Jungs machten. Immer hieß es: »Du hättest aufpassen müssen!« Für meine heutigen Begriffe wurden damals die Kinder nicht gut erzogen. Kinder waren da, und sie wurden auch versorgt, und sie wurden auch gesättigt, und sie kriegten auch in einem gewissen Ausmaß Spielsachen, einen Ball oder eine Puppe, mehr aber auch nicht. Wir mussten nach allem fragen und wurden sehr streng erzogen. Es gab auch ab und zu eine Ohrfeige. Es passierte ja auch dauernd irgendwas. Wir waren so eine richtig normale deutsche Familie.
Also, ich trug als Älteste so manche Last mit mir herum. Und auch, als man später größer wurde und irgendwelche Wünsche hatte oder Vorstellungen, da war auch immer so ein bisschen Häme dabei, im Sinne von: Ja, ja, was du nicht alles willst. Man wurde nicht so ernst genommen.
Wir lebten sehr bescheiden, aber wir wurden immer satt. An Hunger oder so kann ich mich aber nicht erinnern, und das war nicht selbstverständlich unter der Heerschar von Arbeitslosen und armen Menschen.
Unser Vater beherrschte alles, wurde nach vielem gefragt, was wir oft vergeblich bei Mama versuchten durchzudrücken, aber darauf fiel sie nicht rein. Aber meistens hieß es: »Frag Papa!« Später wurde er ein guter Kumpel, aber als wir klein waren, hatten wir zu parieren.
Man lernte, was man darf und was man nicht darf. Und man lernte, dass man für Dinge, die man nicht tun darf, bestraft wird. Und es gab eine ganze Menge Dinge. Zum Beispiel wurden hier und da kostbare Äpfel gekauft. Dann lagen die abgezählt auf dem Buffet in einer Obstschale. Plötzlich fehlte ein Apfel. »Wer war’s, wer hat den Apfel genommen? Niemand? Alle antreten! Du, du?« Jeder wurde einzeln befragt, ich nicht. »Ja, also wenn es niemand war, dann gibt es überhaupt keine Äpfel mehr.« Dann konnte man ja sagen: »Ich hab gesehen, wie der Gerhard an der Schale rumgespielt hat.« So wurden wir Kinder gegeneinander ausgespielt.
Oder meine Mutter hatte die Angewohnheit, Kleingeld im Küchenschrank in eine Tasse zu tun. Sehr verlockend, da mal reinzugreifen und sich einen Groschen oder 20 Pfennig herauszunehmen. Irgendjemand machte das mal und hat sich dadurch verraten, dass er plötzlich mit einer Riesenbonbonstange herumlief. Die Kinder sind ja auch dumm. Diese Dinge wurden schon aus exemplarischen Gründen bestraft. Und dann kriegten wir mal so alle drei mit dem Teppichklopfer eins auf den Hintern gezogen. Ganz schön weh tat das. Und damit war wieder Frieden in der Familie, mein Vater war glücklich, dass er seine Pflicht getan hatte, und wir Kinder fanden es nicht so schlimm, als dass wir es nicht eventuell wieder tun würden.
Das Gehorchen hatte sich eingespielt im Familienleben, mit Liebe und Verständnis, damit kam man nicht weit. Gehorchen und ein bisschen Schwindeln dabei, Lügen oder die Schuld auf jemand anders schieben, das gehörte dazu. Also, es wurden dadurch Eigenschaften in den Kindern wach, die eigentlich nicht in ihnen waren.
Jedenfalls herrschte nicht immer nur Liebe unter den vielen Menschen, die da in einer Wohnung zusammenhausten. Wir kriegten alle unser Fett ab. Ich als Mädchen etwas weniger. Aber es wurde viel öfter gesagt: »Gerade du als Große hättest es wissen müssen.« Also, mir wurde die Verachtung schon auch immer wieder unter die Nase gerieben. Ich war immer für alles verantwortlich, was die Jungs machten.
Als wir dann so zehn, elf Jahre alt waren, wollten wir immer wissen, was unsere Eltern denn gewählt haben. Das haben die uns nie gesagt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Das war ein Geheimnis. Politik war überhaupt kein Thema zu Hause. Das interessierte uns nicht. Mein Vater war ohnehin schon sehr verschwiegen, auch über seine Jugend. Auch er stammte aus einer kinderreichen Familie. Und ich habe sehr viel später, als er schon längst tot war, erfahren, dass sein Vater sich das Leben genommen hatte. Und dass mein Vater in Dresden mit seinen Brüdern und seiner einzigen Schwester im Waisenhaus aufgewachsen war. Das hab ich durch einen Zufall erst vor ungefähr 40 Jahren erfahren. Meine Mutter lebte da noch. Ich hab meine Mutter dann gefragt: »Mama, hast du das gewusst?« Da sagte sie: »Ja.« »Und warum hast du uns das nie gesagt?« »Papa wollte es nicht.« Papa wollte es nicht, und sie hat sich daran gehalten.
Sein Vater ist am Königlich-Sächsischen Hof Hofgärtner gewesen, sogar einen Titel hat er gehabt. Er hatte eine Erdbeere gezüchtet und dafür ein Diplom bekommen und wohl auch ein stattliches Vermögen gehabt. Jedenfalls hat er dann an der Amsterdamer Blumenbörse spekuliert und sein gesamtes Anwesen, ein sehr schönes Haus mit Garten, verloren und dann die Frau und fünf Kinder mit einem Sturz von der Brücke vor einen einfahrenden Zug in Dresden im Stich gelassen. Auch die Mutter ist kurz danach gestorben. Eine Tragödie, für die sich mein Vater sehr geniert hat. Wir sollten das nie erfahren, aber von einer Cousine hab ich’s dann nach vielen, vielen Jahren doch erfahren.
Ich weiß noch, dass es bei uns dauernd hieß, wir haben kein Geld. Papa war Dekorateur und hatte Arbeit, das alleine war ja schon ein Luxus zu der Zeit. So hat es dann doch immer gereicht. Wir haben so gut wie nie gehungert, wie viele andere Menschen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Es gab immer was zu essen. Es war einfach und schlicht, aber zum Sattessen. Viel Gemüse. Meine Mutter konnte wunderbare Gemüseeintöpfe machen, danach sehne ich mich heute noch manchmal. Ob das jetzt Wirsingkohl war oder Weißkohl mit Kümmel oder grüne Bohnen mit Tomaten, mit Tomaten war es schon echter Luxus. Ohne Tomaten schmeckten sie auch noch gut. Und für eine Gans an Weihnachten hat es auch noch immer gereicht, das musste einfach sein. Und Papas Bierchen musste auch immer sein. Und Mama kriegte noch irgendwas Schönes zu Ostern zum Anziehen.
Als ich so 14 Jahre alt war, kriegten meine Freundinnen schon mal ein Kostüm oder einen Mantel. Ich nicht. Ich kriegte abgelegte Sachen, die wurden geändert für mich. Es wurde passend gemacht, da wurde ich nicht sehr verwöhnt. Ich wusste, wir haben nicht so viel Geld, und wenn einer was will, dann wollen es die anderen auch, da hat man sich schon ein bisschen danach gerichtet. Es wurde dauernd darüber gesprochen, dass kein Geld da war, aber wir konnten immer unsere Miete zahlen, und als es dann bei mir nach der Volksschule von der Lehrerin aus hieß: »Das Kind muss unbedingt an eine höhere Schule, die ist begabt«, dann wurde dafür auch noch Geld ausgegeben. Also mit Mühe und Not hat meine Mutter meinem Vater das Geld für die Mittelschule abgeknöpft. Ich glaube, es waren fünf Mark im Monat, die er lockermachen musste. Also kam ich in die Mittelschule. Und da blieb ich dann auch bis zum Einjährigen. Das war ja für die Mittelschule ein Abschluss. Wer Abitur machen wollte, der musste aufs Lyzeum.2
Das kam überhaupt nicht infrage. Ein Studium? Wer hat denn damals studiert vor 90 Jahren? Das waren wirklich nur Ausgesuchte. Wir jedenfalls nicht.
Als ich noch in der Schule war, wollte ich Opernsängerin oder Lehrerin werden. Ich war so gut in der Schule, dass eine reiche Dame meine Mutter fragte: »Frau Pomsel, könnte nicht Ihre Tochter ihre Schularbeiten immer bei uns machen, mit meiner Ilse? Ich kann das nicht, und das Mädchen, das kommt nicht weiter, die braucht eine Unterstützung.«
Die Ilse war eine Freundin von mir, und ich machte das gern. Ich machte mit ihr gemeinsam Schularbeiten, das heißt nicht, dass ich sie abschreiben ließ, ich hab ihr wirklich geholfen und erklärt. Sie hat sich wesentlich verbessert, nur weil ich Geduld mit ihr hatte, und ich ging gern da hin. Das war eine sehr reiche Familie, da kriegte ich gleich einen Kaffee oder einen Tee und natürlich was Süßes dazu, und die Mutter war eine Italienerin, eine frühere Opernsängerin. Dann hatten sie ein wunderbares Klavier, und da sang sie dann immer, sie sang uns die Opernarien vor, und wir saßen gebannt und hörten zu. Das war eine schöne Zeit, und für mich war’s auch besser, denn in unserer Wohnung war’s immer laut und lebendig. Ich konnte nie in Ruhe Schularbeiten machen. Und da wollte ich dann Opernsängerin werden, aber es reichte dann wohl doch nicht dazu.
Und dann konnte man an unserer Mittelschule auch noch eine Haushaltsschule besuchen. Aber da sagte mein Vater: »Nun ist es genug. Das bezahle ich nicht auch noch. Haushalt lernt die zu Hause, nicht in der Schule. Aus mit der Schule.« Also bin ich mit dem einjährigen Abschluss von der Mittelschule abgehauen.
Zuerst blieb ich bei meiner Mutter als Haushaltshilfe. Aber das konnte nicht gut gehen. Das war furchtbar. Ich fand Küchenarbeit schrecklich, und Mama war froh, wenn sie mich zum Staubwischen durch die Wohnung schickte, denn in der Küche machte ich sowieso alles falsch, also, das war alles sehr unerfreulich. Meine Mutter wollte immer, dass ich eine richtige Lehre mache. Aber ich wollte damals so schnell wie möglich einfach in einem Büro arbeiten, egal wo, Hauptsache Büro.
Für mich waren die Damen, die ins Büro gingen, also Sekretärinnen, Büroangestellte oder kaufmännische Angestellte bei einer Versicherungsgesellschaft, sehr anziehend, das erschien mir äußerst erstrebenswert.
Und dann habe ich mir selber eine Stelle gesucht aus der Berliner Morgenpost, die gab es damals schon. »Junge fleißige Volontärin für zwei Jahre gesucht.« Da habe ich geschaut: Hausvogteiplatz. Das war damals eine sehr schicke Gegend. Ich wusste, da war die obere Schicht des Landes zu Hause, eine noble Gegend. Vorstellen konnte ich mich bis 13 Uhr. Ich habe mich sofort in die S-Bahn gesetzt und bin zur Firma Kurt Gläsinger und Co. geeilt. Das war in der Mohrenstraße. Sehr schick alles, tolles Haus, mit roten Teppichen und einem Lift. Ich bin aber die Treppen über die weichen Teppiche raufgegangen. Ich betrat ein sehr schönes großes Büro, und da saß der Herr Bernblum, ein jüdischer Prokurist, streng, aber eine echte Persönlichkeit. Und dann saßen da noch drei, vier Damen. Eine davon sollte wohl abgelöst werden. Jedenfalls hat er mich erst mal in die Zange genommen. Er fragte dies und jenes, und plötzlich sagte er: »Ja, in Ordnung, hier haben Sie einen Volontärsvertrag, da muss nur noch ein Elternteil mit unterschreiben, da Sie ja noch nicht mündig sind. Können Sie mit Ihrem Vater oder Ihrer Mutter noch mal herkommen?«
Ich fuhr aufgeregt nach Hause und habe erst einmal die Familie informiert. Da bekam ich erst mal furchtbar was zu hören: »Unverschämt, ohne zu fragen, und wer hat dir denn das Fahrgeld gegeben?« Aber dann ist Mama mitgefahren und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Für das fürstliche Volontärsgehalt von monatlich 25 Mark.
Dann habe ich dort bei Kurt Gläsinger und Co. alles gemacht, was anlag, Stenografie, Schreibmaschine, und abends hab ich noch Kurse in der höheren Handelsschule besucht und die Grundzüge der Buchhaltung gelernt. Nur ausgerechnet meine Stenografiekenntnisse, die mir später den Eintritt in den Rundfunk und in das Propagandaministerium ermöglichten, brauchten sie dort nicht. Ich konnte schon vor dem Volontariat toll stenografieren, war immer als Erste fertig, und das nur, weil ich in der Schulzeit unsterblich in meinen Lehrer verliebt war. Er aber nicht in mich.
Dann habe ich dort zwei Jahre gearbeitet. Das Schönste war immer der Weg zur Arbeit. Mit der S-Bahn von Südende bis Potsdamer Ringbahnhof. Dann musste ich bis zum Leipziger Platz laufen. Das war jedes Mal ein Spaziergang von einer halben Stunde. Und wenn ich statt der Mohrenstraße die Leipziger Straße langging, passierte ich viele schöne Geschäfte. Herrliche Modegeschäfte mit unerreichbar schönen Dingen, von denen ich dachte, die würde ich mir nie kaufen können. Trotzdem war es immer schön, die Kleider zu sehen und zu träumen.
Und der Betrieb, also die tägliche Arbeit selber, war auch ganz lustig. Ansonsten habe ich brav alles gelernt und wahrscheinlich auch ganz anständig. Am Ende durfte ich auch den Telefondienst übernehmen. Wir hatten seit einiger Zeit sogar zu Hause ein Telefon – für uns Kinder strengstens verboten. Wir durften nicht ran. Wen sollten wir auch anrufen? Wir wussten gar nicht, wen man anrufen sollte. Wer hatte denn schon ein Telefon zu der Zeit? Nun sagte der Herr Bernblum zu mir: »Fräulein Pomsel, machen Sie mir eine Verbindung mit der Firma Schulze und Menge.« Dann musste ich erst mal nachgucken unter seinen Augen, bis ich die Nummer hatte, mit zitternden Händen, dann meldete sich: »Hier Amt Südring.« Dann sagte ich: »Ich möchte das Amt Nordring, bitte schön.« Und dann meldete sich wieder jemand: »Welche Nummer?« Dann habe ich die Nummer gesagt, und irgendwann meldete sich die Firma. Und dann musste ich noch mal sagen: »Ich möchte den Herrn Sowieso sprechen, für Herrn Sowieso.« Das war schwer für jemanden, der noch nie mit so etwas zu tun gehabt hatte. Man kann es sich kaum noch vorstellen. Jetzt fällt es mir schwer, mit dem Handy fertigzuwerden.
Aber ich war sehr fleißig damals. Das war ich immer. Das ist in mir geblieben. Dieses etwas Preußische, dieses Pflichtbewusste. Ein bisschen auch dieses Sich-Unterordnen. Es begann schon in der Familie, da hat man sich schon einfügen müssen, sonst wär’s nicht gegangen. Es ging wirklich damals nur mit einer gewissen Strenge. Dass man auch fragen musste nach allem, man hatte auch kein Geld zur Verfügung. Es gab damals noch kein Taschengeld, so wie heute, dass Kinder von einem gewissen Alter an Taschengeld bekommen. Wir kriegten schon mal was. Also, ich bekam nur etwas, weil ich jeden Tag am Mittag das Geschirr abgewaschen habe und das von der großen Familie. Das war früher nicht so einfach, dass man das Wasser aufdrehte und das Geschirr abspülte. Ich musste schwere Wasserkessel erhitzen, und dann hatte man zwei Becken. Eines, in dem man mit Sodawasser abgewaschen hat, und ein Spülbecken und dann noch eine Abstelle. Es war schon mit viel Arbeit verbunden. Und dafür bekam ich dann auch ein Taschengeld. Ich glaube sogar, es waren zwei Mark im Monat. Deswegen war der Übergang zum Volontariat und dem ersten Geld sehr wichtig für mich.
Bei Herrn Bernblum blieb ich dann zwei Jahre. Danach boten sie mir an zu bleiben. Für ein Gehalt von 90 Mark im Monat. Auch das musste ich noch mit meinen Eltern besprechen, weil ich immer noch nicht 21 Jahre alt war. Und mein Vater sagte: »90 – nein, das ist zu wenig. Du musst 100 verlangen!«
Und am anderen Tag hab ich dem Herrn Bernblum berichtet, dass mein Vater auf 100 bestand. Ja, tut uns leid, dann müssen wir kündigen. Und dann haben die mich gekündigt. Papa hat gesagt: »Richtig so, sie sucht sich was Neues.«
Da musste ich zum ersten Mal zum Arbeitsamt, wurde als Arbeitslose registriert und erhielt Adressen in die Hand gedrückt, wo ich mich vorstellen sollte. Für eine kurze Zeit landete ich dann in einem Buchhandel. Lesen tat ich ja furchtbar gern. Ich hatte zwar noch nicht viel gelesen, aber Lesen war furchtbar schön. Und die zahlten auch anstandslos ihre 100 Mark. Es war dieser bitterkalte Winter 1929, da war ich inzwischen 18 Jahre alt. Es war eine furchtbare Stelle. In den Räumen war es kalt. Erst sehr spät wurde eingeheizt, und die Mitarbeiter waren einfach gestrickt und sehr unfreundlich. Da war ich todunglücklich.
Doch dann traf mein Vater auf der Straße einen Nachbarn. Herrn Dr. jur. Hugo Goldberg, ein jüdischer Versicherungsmakler, und der sprach mit meinem Vater, wie geht es, was macht das Geschäft, was machen die Kinder. Und irgendwie sagte mein Vater: »Ja, die Hilde, die ist jetzt schon groß, die arbeitet jetzt schon.« »Ja, was macht sie denn?« Da sagte der Herr Goldberg: »Wissen Sie was? Meine Sekretärin heiratet ja demnächst, da muss sie sowieso aufhören. Schicken Sie mir doch mal Ihre Tochter, das war doch ein ganz aufgewecktes Mädchen.«
Jetzt bin ich gleich am nächsten Tag zu Herrn Dr. jur. Goldberg ins Nebenhaus und habe mich ihm als Erwachsene vorgestellt. Habe den sonst nie gesehen, und wenn, mit Knicks gegrüßt und so. Wusste gar nicht, dass der mich noch kannte. Ja, da sagt er: »Wir können es ja mal versuchen. Das Versicherungswesen ist sehr interessant. Können Sie gar nicht alles wissen«, sagte er, »aber Sie werden viel erfahren.« Und dann fing ich Mitte 1929 bei ihm an. Bei Herrn Dr. Goldberg.