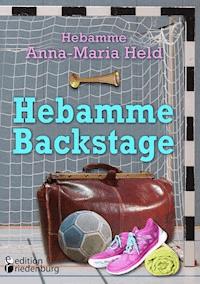Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geschafft! Als zweifache Mutter darf Anna-Maria wieder die Schulbank drücken. Doch die theoretische Ausbildung an der Hebammenschule ist nur die halbe Miete. Denn jetzt heißt es, im Kreißsaal werdenden Müttern Mut zu machen und sich gegen internes Gezicke durchzusetzen. Hebamme zu werden ist Anna-Marias Herzenswunsch - wären da nicht die vorgeschriebenen Praktika im OP und andere Hürden ... "Die Untersuchung erwies sich als sehr mühsam, weil der Muttermund Richtung Rücken lag, ich aber seine Länge abschätzen musste. Das war natürlich recht unangenehm für die Frau, jedoch unumgänglich. 'Der Muttermund liegt bestimmt in der Nähe vom G-Punkt, oder?', fragte mich der Mann. 'Ich muss den nämlich auch (!) immer sehr suchen, das dauert oft ewig! Ist immer ein ziemliches Gewühle!' Der Frau war das ziemlich peinlich. Ich schämte mich fremd. Dann sammelte ich mich kurz, bevor ich meinen Untersuchungsbefund präsentieren konnte." Anna-Maria Held wurde 1980 geboren. Sie arbeitet als freiberufliche Hebamme und wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Norddeutschland. Mit ihrem Buch "Die Hebammenschülerin" gewährt sie tiefe Einblicke in den Kreißsaal-Alltag und lässt auch andere an Presswehen, Stillbrüsten und Co teilhaben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Der Einführungsblock
Das Kinderzimmer
Veronika und ich
Hepatitis und Verbrecher
Leben und Tod
Die Innere
Komplette Isolation
Keine Happy Ends
Der Kreißsaal
Alte Besen kehren ... beängstigend
Yvette 21
Wie lange kann das dauern?
Kaiserschneiderei
„Sei mal kurz leise, das Kind kommt“
Mutterliebe auf den zweiten Blick
Der Reihe nach
Muslimische Frauen und der feste Griff
Geburt und drumherum
Fifty Shades of Waldemar
In der Schule
Stellungswechsel im Kreißsaal
Die Sache mit dem CTG
Ohne Rauch geht’s auch. Oder?
Go Mutter go!
Muttermund und PDA
Geschenk aus dem Wasser
Thai und deutsch – das geht nie!
Das Denkarium
Abschiednehmen
Der abgesagte Wunschkaiserschnitt
Unerfüllte Hoffnung
Geburt online –„Gefällt mir“
Pretty Woman mit Ausfluss
Der Kreißsaalknast
Kommt ein Mann zur Geburt
Pretty Woman stinkt zum Himmel
Eigene Wege
Das dritte Ausbildungsjahr
We are the champions!
Ein Mann in den Wehen
Wehnen und Orgien
Tripper? Woher denn!
Don Juan mit Zahnlücke
Im OP
Unverfilmtes Soapmaterial
Der OP – wahrlich nichts für mich
Der OP – noch immer wahrlich nichts für mich
Und noch immer: Der OP – nichts für mich
OP und NZO – beide nichts für mich
Noch 179 Tage bis zur Hebamme
Eva – Genie und Wahnsinn
Examensluft
Narkosefrösche und Geburt für Kinder
Das Examen rückt noch näher
Ey Alter, ich will ne PDA!
Mein erster Dammschnitt
Weihnachten ohne Gänsebraten
Maria und Mutterkuchen zum Examen
Endlich Hebamme!
Der Einführungsblock
Ich ging wieder zur Schule, war das nicht schön?
Seit dem 1. April lautete meine offizielle Berufsbezeichnung nun „Hebammenschülerin“.
Wem immer ich das auch erzählte, der fragte nicht mehr wie früher bei „Bankkauffrau“:„Aha, und was macht man da? Banken kaufen?“, sondern wusste Bescheid. Es kam entweder ein:„Oh, ist DAS ein toller Beruf!“, oder ein „Hast Du Dir das gut überlegt? Du weißt, dass man als Hebamme nicht immer nur schöne Dinge erlebt, oder?“
Letztere war übrigens meine „Lieblingsreaktion“: Mein Gott, manche Menschen dachten, ich wäre blöd und naiv!
Oder aber es kam ein:„So was könnte ich nicht, ist das nicht manchmal ziemlich eklig?“
Ablage und Tabellenkalkulation fand ich auch manchmal ziemlich eklig, von daher ...
Als ich meinen Eltern davon erzählte, sagte mein Vater voller Optimismus:„Also, wenn du uns jetzt erzählt hättest, dass du ins Kloster gehen möchtest, hätte uns das weniger überrascht.“
Bereits nach zwei Tagen hatte mich mein Sohn hochinteressiert gefragt, ob ich denn schon Freunde in meiner Schule gefunden hätte oder ob ich allein in der Pause spielen müsste. Das musste ich nicht, wenngleich meine Mitschülerinnen völlig unterschiedlich waren und es auf Anhieb gar nicht so einfach war, die passende Pausenfreundin zu finden.
In unserer Klasse hatten wir beispielsweise eine Hebammenschülerin, die Michaela hieß. Leider ergab es sich selten, dass wir uns unterhalten konnten, denn sie hatte schrecklichen Mundgeruch. Bei geschätzten fünf Hektolitern Kaffee und zwölf Raummetern Zigaretten, die sie täglich konsumierte, war das kein Wunder. Und das, wo sie eigentlich sehr nett war.
Aufregenderweise trampte Michaela wöchentlich zur Schule und von dort aus zurück nach Stuttgart. Dementsprechend „flexibel“ waren ihre Ankunftszeiten zum Unterricht.
Als weiteres Highlight hatten wir drei Mädels in der Klasse, bei de-nen ich nicht verstehen konnte, wieso sie sich für diesen Ausbildungsgang interessierten – und zum anderen, wer sie als Hebammenschülerinnen akzeptiert hatte.
Das Erste der besagten Mädchen hieß Heidrun, 18, ein Topmodelwürdiges Mäuschen, aber ständig nur am Rummotzen. Jede Antwort, die sie im Unterricht gab, kam in einem „Eigentlich hab ich keinen Bock, hier irgendwas zu sagen, aber ich lasse mich für euch Idioten einfach mal herab und mach es trotzdem“-Ton.
Die Zweite in dieser „Clique“ war Veronika. Sie war 19 und befand sich, glaube ich, schon damals in einer Art Midlife-Crisis – hatte keine Kinder, wollte auch keine Kinder, weil „es blöd war, in diese beschissene Welt noch Kinder zu setzen“. Dafür hatte sie eine Katze und einen merkwürdigen Kleidungsstil. Sie lachte und ging wie ein Mann, und fand es total blöd, dass wir Klausuren schrieben, die auch noch eingesammelt und benotet werden wurden. Sie fühlte sich „total kontrolliert“ und „nicht frei“. Dass wir theoretisch alle Klausuren mit einer Sechs schreiben und die Prüfung trotzdem mit einer Eins bestehen konnten, hatte sie anscheinend nicht verstanden.
Veronika hatte ein eher derbes Vokabular. Eines Tages unterhielten wir uns im Unterricht über Mitgefühl, Empathie und Mitleid. Dies war Veronikas Beitrag: „Wenn’s mir richtig scheiße geht, und mir mein Kumpel auch noch sagt, ‚Mann siehst du scheiße aus, geht’s dir scheiße?‘, dann fühle ich mich erst recht scheiße. Also Mitleid an sich ist echt scheiße.“
Die Dritte im Bunde war Christel. Ich kannte sie aus dem Assessment-Center. Und da war sie noch Christel gewesen. Jetzt war sie Veronika zwei. Mit 21 hatte sie ihren ureigenen Charakter noch nicht gefunden. Daher lachte und ging sie wie Veronika und fühlte sich ebenfalls unfrei und kontrolliert.
Ich verbrachte die meiste Zeit mit Michelle. Sie sah aus wie eine irische Elfe: rote, feine Haare, heller Teint, Sommersprossen, sehr grazil. Der Schein sollte trügen. Wann immer wir gemeinsam für Klausuren lernten, entpuppte sie sich als knallharte Sklaventreiberin. Was ich übrigens sehr brauchte. Ohne Michelle kam ich einfach nicht klar. Sie wurde meine Freundin. Der Rest unserer Klasse war „unauffällig“.
Unsere Lehrer waren ebenfalls sehr unterschiedlich. Unsere Klassenlehrerin, Frau Müller, war 65 und der Inbegriff einer Hebamme. Sie war ein wenig schrumpelig und hatte knubbelige Füße. Meist war sie unglaublich lustig und hatte gleichzeitig eine total ruhige Ausstrahlung. Jede Aufregung war sofort vorbei, wenn sie nur einmal ihren„Ist das wirklich so schlimm?“-Blick aufsetzte.
Emanzipiert war sie auch, glaube ich.
„Sie sind hier 20 Frauen! Seien Sie stolz drauf! Machen Sie was draus! WIR SIND KEINE PASSIVEN FRAUEN!“
Bestimmt hatte sie wichtige Feministinnen zur Freundin.
Die anderen Lehrhebammen waren etwas jünger. Eine war etwas energischer und geradliniger, eine etwas verwirrter, eine etwas modemutiger (rote Haare, orangefarbener Pulli, lila Strickjacke), und eine etwas hyperaktiver. Letztere begattete die Tafel förmlich, weil sie beim Schreiben vor der Tafel rauf und runter sprang wie ein aufgezogenes Männchen. Außerdem drückte sie die Kreide beim Schreiben fast in die Tafel rein, aus Angst, es könnte nicht deutlich genug sein.
Eines hatten sie jedoch gemeinsam: Alle waren ein wenig schwerhörig. Wenn sie im Kreißsaal nur mit Frauen wie mir zu tun gehabt hätten, wären sie vermutlich sogar taub gewesen.
Zweimal die Woche hatten wir Arztunterricht. Meist von Assistenzärzten. Die kamen alle im weißen Kittel an, damit gleich mal klar war, welche Stellung die hatten. Aber unter dem Kittel waren sie auch wieder völlig unterschiedlich.
Einmal hatten wir Unterricht beim Narkosearzt Dr. Schönewald. Sein Unterricht in einem Kurs, wo fast nur 20-jährige, hormongeplagte Mädels saßen, war wenig effektiv. Weil er nämlich ein Hübscher war. Als er den Raum betrat, machten die „Zwannis“ alle „Ooooooch ...“ und schmolzen dahin. Als er seine eheberingte Hand auf den Tisch legte, machte es laut „krackkrackkrackkrack“, das waren die Herzen der Zwannis.
Dr. Schönewalds Unterricht war ganz gut strukturiert, auch wenn er am Schluss des Themas „Entzündungen“ sagte: „Ach, wisst ihr, vergesst die Stunde, ich glaube, das müsst ihr alles gar nicht wissen.“ (Erstaunlicherweise sagten uns alle Ärzte dann und wann, dass sie sich sehr wunderten, dass WIR„so was“ lernen mussten. Frau Müller meinte, das sei Hochmut. Ich glaube das auch. Hebammen und Ärzte sind sich ja meist nicht so ganz einig ...)
Davon abgesehen schrie Dr. Schönewald eines Tages nach einer von ihm ruhig gestellten Frage: „WER WEISS ES? NA? NA? NA? DU? ODER DU? NA? WER?!“, trommelte wie wild mit seinen Fingern auf dem Tisch herum und beruhigte sich nur schwer wieder. Ich glaube ja, dass er täglich an seinen Narkosemitteln schnüffelte und an diesem Tag kräftig auf Entzug war.
Und dann hatten wir noch Hygieneunterricht bei Mr. Hygieneman himself: Herrn Meyerhoff. Er sah Bakterien und Viren und Keime ÜBERALL. Seine Haare hatte er sich vorsorglich abrasiert. Die hätten sonst eine Ansammlungsstelle für Keime darstellen können. Und eine durchgestrichene Hand auf einer Brosche trug er auch. Zumindest sah es so aus. Man hätte denken können, er wolle keinem die Hand geben. Das störte ihn nicht, er fand das ganz gut.
Ob er sich abends, wenn er nach Hause kam, in ein Desinfektionsbad legte zur Entkontamination? Ich konnte es mir ernsthaft vorstellen. Kuschelig war er bestimmt nicht. Deswegen war er vermutlich auch Single.
Die Hebammenschulzeit war nicht wirklich viel anders als die „normale“ Schulzeit. Man begegnete lustigen, kuriosen, verrückten, anstrengenden Leuten, da starb keine Spezies aus. Zickenkriege gab‘s auch unter „Älteren“, und das teils so offensiv, dass ich mich jedes Mal, wenn ich es mitbekam, fremdschämte.
Und dann die ewige Meckerei! In unserer Klasse hätte ich das anders erwartet. Wenn ich daran dachte, dass wir am Anfang – beziehungsweise während des Assessment-Centers, wo noch keiner wusste, ob man genommen werden würde – wirklich ALLES für den Platz getan hätten (und WAS sie alles dafür gegeben hätten ...), war ich sehr verwundert darüber, dass sich wenig später einige am laufenden Band beschwerten. Selbst solche, die erst nach Jahren einen Platz ergattert hatten.
„Um 8 Uhr fängt der Unterricht an? Immer?“
„Wir lernen nicht nur alles über den Uterus, sondern müssen uns auch mit Magen, Darm und Nieren beschäftigen?“
„Wir kriegen HAUSAUFGABEN auf?“
„Wir schreiben Klausuren?“
„Wir müssen mitschreiben?“
„Wir haben FRONTALUNTERRICHT?“
Erwachsene Frauen! War es zu fassen?
Unglaublich, wie schnell man vergessen konnte, mit welcher Einstellung man ursprünglich rangegangen war.
Das Kinderzimmer
Veronika und ich
Frau Müller hatte uns vor unserem ersten Einsatz detailgenau eingenordet, wie wir uns auf Station zu verhalten hatten: Pünktlich sein, Haare zusammenbinden und hochstecken (ab gewisser Länge), höchstens dezent schminken, Fingernägel kurz und unlackiert, Schmuck ab, nichts Privates erzählen, immer Einsatz zeigen und nicht blöd rumkichern. Nicht verwahrlost aussehen und nicht nach Schweiß oder Sonstigem stinken.
Wenn sie vor allem die letzten beiden Punkte so explizit erwähnt hatte, musste es tatsächlich einen Anlass dazu gegeben haben.
Ich hoffte, ich machte alles richtig.
Der Frühdienst begann um halb sechs morgens. Wobei wir mindestens zehn Minuten vorher gestriegelt und umgezogen im Stationszimmer antanzen mussten, um uns bis zum Schichtbeginn komplett gesammelt zu haben. Für mich hieß das: Aufstehen um kurz nach vier.
Wenn man dann im Klinikum angekommen war, schliefen die Patienten meist noch. In das in sanftes Dämmerlicht getauchte Kinderzimmer kam dann und wann mal eine übernächtigte Mutter. Es war eine von denen, die ihr endlich schlafendes Kind, das zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens putzmunter gewesen war, bei uns lassen wollte, um zumindest noch bis zum Frühstück zu schlafen. Eine andere benötigte vielleicht Hilfe beim Wickeln und eine ganz andere brauchte ein Ohr, weil sie gerade der Babyblues heimtückisch erwischt hatte und sie glaubte, vor lauter Kummer auf der Stelle sterben zu müssen.
Für mich war dieser Einsatz ein Eintauchen in alte Zeiten. Auch ich hatte nach den Geburten von Alexander und Selma auf einer Wochenstation gelegen und war überwältigt gewesen von all dem Neuen.
Ein Baby, ein duftendes Baby, das neun Monate in einem geschlummert hatte, das bebrütet worden war, von dem man schon viele Ideen und Vorstellungen und Träume gehabt hatte und das trotzdem ein zauberhaftes Wunderwerk an Überraschungen beinhaltet hatte. Nach Monaten des Wartens war das Baby endlich zur Welt gekommen und nach Stunden der Schmerzen mit all ihren akustischen Untermalungen mütterlicherseits breitete sich dann eine Stille aus, die so magisch war, dass man sie förmlich hören konnte.
Mutter geworden ... Eltern geworden ... Das Leben hatte sich auf einmal völlig geändert und das war so unglaublich schön!
Egal, wie schlaflos hier die erste Nacht auf der Wochenstation war, es war eine magische Nacht, in der Mutter und Kind sich von Angesicht zu Angesicht kennenlernen konnten. In der die Mutter langsam begreifen konnte:„Das ist mein Kind! Meins!“ Nicht nur gedanklich, sondern auch mit ihren Händen und in ihren Armen, mit denen sie ihr, ihr, IHR Baby nun vor allem beschützend halten und spüren konnte. Was für ein Geschenk das war.
Das erste Mal Stillen, das erste Mal Wickeln, das erste Mal Anziehen ... Sich mit Leib und Seele um ein kleines schutzbedürftiges Geschöpf kümmern dürfen und müssen, das einem selbst entschlüpft war und das sich darauf verließ, dass die Mutter das gewohnte Full-Service-Betreuungsprogramm auch außerhalb der Gebärmutter erledigen würde.
Der Wermutstropfen während meiner Zeit im Kinderzimmer bestand aus Veronika.
Freundinnen waren wir nach wie vor nicht. Es war ihr ein dringendes Bedürfnis, mich darüber informieren, dass sie mich sehr merkwürdig fand, also eigentlich schon direkt ... ja ... scheiße. Tja nun. Dito. Vor allem deshalb, wie sie sagte, weil wir so unterschiedlich waren.
Das stimmte absolut. Und WIE das stimmte!
Sie hatte eine Fünf in der Wochenbettklausur, ich eine Eins. Sie hatte sich drei Jahre auf einen Ausbildungsplatz bewerben müssen und ich mich nur ein einziges Mal. Sie hatte Falten wie ein Faltenrock und ich keine.
„Ja, aber nicht, dass de jetz heulend nach Hause fährst, ne? Also falsch verstehen sollste mich da jetz auch nich ...“, wieder Veronika.
Frau Müller hatte uns ja extra gesagt, wir sollten nichts Privates von uns erzählen. Das würde nämlich keinen interessieren. Weder die Schwestern und schon mal gar nicht die Patienten. Ich stand im Kinderzimmer und hörte durch zwei Türen Veronikas Stimme. „Kann nich sein, dacht ich nur, nä? Als ich mit der Pille angefangen habe, hab ich SOLCHE Titten gekriegt. SOLCHE TITTEN! Und auch die ganzen Jungs in der Disco, nä? Die ham auch gefragt, ey sind die echt?“
Nun ja, das konnte ja noch heiter werden. Ich hielt mir vor Augen, dass Veronika erst 19 Jahre alt war und mit der Zeit etwas ruhiger werden würde. Ich wünschte mir für sie, dass sie das noch innerhalb der Ausbildungszeit schaffen würde. Sonst würde ich nämlich durchdrehen ...
Hepatitis und Verbrecher
Eines Tages kam ich mit hochbrisanten Körperausscheidungen in Kontakt. Wir hatten eine Patientin mit alter Hepatitis A- und frischer Hepatitis B-Infektion und auch Verdacht auf Hepatitis C und HIV. Blöderweise hatte sich eine Ärztin auch noch an der hochverseuchten Nadel, mit der man der Patientin Blut abgenommen hatte, gestochen. Zum Glück bestätigten sich Hepatitis C und HIV nicht.
Die Familie bekam das Zimmer, das entweder für Privatpatienten oder für Patientinnen mit ansteckenden und gefährlichen Krankheiten vorgesehen war, weil es eine eigene Toilette hatte. Angesichts dessen überdachte ich die„Vorteile“ meiner Privatversicherung ...
Eine der vielen Duschen auf dem Flur wurde mit einem „Gesperrt“-Schild versehen, die war dann nur noch für diese Patientin. Auf der Station war der Teufel los und ich sollte mal ins Zimmer gucken, beim Anlegen helfen, beim Kind Temperaturkontrolle machen und nach Körperausscheidungen des Babys gucken.
„Zieh Dir einen Schutzkittel an und pass auf!“, gab meine Mentorin Kathrin mir mit auf den Weg.
„Oh Gott, Hepatitis, Hepatitis, ich muss in die Todeszelle!“, dachte ich. Ich fürchtete mich. Sehr. Hepatitis! Sowas Furchtbares hatte es in meiner sorglosen Blümchenwelt bislang nicht gegeben. Magen-Darm-Grippe war das höchste der Gefühle gewesen.
Ich ging aufs Klo und übte ein möglichst unbefangenes „Hallo!“ vor dem Spiegel. Es sollte einem„Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem zauberhaften Baby!“gleichen und keinem„Herzlichen Glückwunsch zur Hepatitis, bitte stecken Sie mich bloß nicht an, ich möchte nämlich noch nicht so gerne sterben.“ Beiläufig streifte ich mir den Schutzkittel über und sah mir das Baby an.
Kinder von Hepatitis-Müttern wurden standardmäßig sofort nach der Geburt geimpft, und dieses Kind natürlich auch. Es roch somit leider überhaupt nicht mehr nach Baby, sondern nach Chemie.
Dann ging’s zur Mutter und ich fürchtete mich immer noch. Vor allem, wenn ich an die nette Zusatzinfo dachte, dass diese Frau es mit der Hygiene nicht ganz so genau nahm. So wie bei allen Patientinnen setzte ich mich ans Bett und fragte betont unbesorgt, ob ich ihre Brust mal abtasten dürfe. Ich durfte natürlich.
Schnockschnock – frische Handschuhe an.
„Sie müssen sich nach dem Besuch der Toilette immer sehr gründlich die Hände waschen, das wissen Sie, oder?“, fragte ich.
„Wieso?“, meinte sie.
Ich wollte das furchtbare Wort „Hepatitis“ nicht sagen. Somit umschrieb ich es.
„Weil auch unabhängig VON IHRER SPEZIELLEN SITUATION der Wochenfluss einer jeden Frau höchst keimbelastet ist. Da sind abgestorbene Eihaut, viele, viele Bakterien und Keime drin! Und die dürfen AUF KEINEN FALL ans Kind, sonst kriegt es eine hässliche Infektion.“
Ich hoffte, sie damit genug abgeschreckt zu haben. Sie schien mich zumindest verbal verstanden zu haben. Mehr konnte ich erstmal nicht erwarten. Nachdem ich wieder aus dem Zimmer gegangen war (und überraschenderweise nicht sterben musste), desinfizierte ich mir mit gefühlten fünf Litern Desinfektionslösung meine Hände. Die waren dann auf 20 Jahre im Voraus keimfrei.
Das mit dem infektiösen Wochenfluss (wenn man nicht gerade HIV, Tuberkulose, Hepatitis oder Ähnliches hat) ist aus heutiger Sicht übrigens total veraltet. Während meiner Ausbildungszeit hatte der Wochenfluss aufklärungsmäßig aber noch apokalyptische Konsequenzen, wenn er an Brust oder Kind kam. Die Engländerinnen hatten es da schon damals besser. Deren Wochenfluss war nämlich nicht so schrecklich. Und im Zuge der Europäisierung wurde dann auch der deutsche Wochenfluss zu einer harmlosen Ausscheidung.
Ein paar Tage später wurde es höchst spannend. Die Verlobte eines mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mörders bekam bei uns ihren Sohn. Sie selbst war Russin, der Kindsvater Kosovo-Albaner. Er hatte damals seine erste Ehefrau erstochen, was so ganz straffrei natürlich nicht war.
In unserem Stationszimmer hing ein Fahndungsfoto dieses Mannes, der eventuell hätte auftauchen können, um sein Kind zu sehen. Wir hätten ihm dies auch nicht verwehren, sondern normal bleiben und sofort die Kripo informieren sollen. Der Frau durften wir nicht sagen, dass wir in Kenntnis gesetzt worden waren, und als ich sie nach der Geburt besuchte, um sie beim erste Anlegen zu unterstützen, dachte ich nur:„Du arme Frau. Wenn Du wüsstest, was ich weiß ...“
Das Kind würde mit diesem familiären Hintergrund später bestimmt an Coolness nicht zu überbieten sein. Gott sei Dank verließen Mutter und Kind das Krankenhaus, ohne dass der Vater sie besuchte.
Die Polizei beehrte uns später ein weiteres Mal, denn eine bulgarische Prostituierte bekam bei uns Drillinge. Die Frau war 22 Jahre alt und illegal in Deutschland. Ihre drei Jungs sollten zur Adoption freigegeben werden, so hatte es die junge Mutter bereits vor der Geburt entschieden. Anfänglich gab sie keinen Vater an, sie wusste es nämlich nicht. Aber als sie nach gewissen Ähnlichkeiten Ausschau hielt, kam anscheinend nur ihr Zuhälter in Frage.
Die Frau hatte sich die Adptions-Entscheidung nicht leicht gemacht und sie bestimmt, das Wohl der Kinder im Auge behaltend, getroffen. Adoptiveltern gab es bereits. Ihr Zuhälter fand die Idee nicht so klasse. Letzten Endes gelangten die drei Kinder an liebevolle Adoptiveltern, der Kontakt zur leiblichen Mutter konnte sogar bestehen bleiben.
Solche Happy Ends waren schon irgendwie wichtig, auch für mein kleines Herz.
Leben und Tod ...
Ein paar Tage später fuhr ich wieder zum Frühdienst, und der Babynotarztwagen stand vor der Eingangstür. Schon allein dieser Anblick hatte etwas Bedrohliches.
Einem Neugeborenen im Kreißsaal ging es wohl unglaublich schlecht, hieß es. Und eine Stunde später wurden wir darüber informiert, dass dieses Kind gestorben war.
Die Eltern waren Afrikaner. Sie hatten schon drei Töchter, und dieses Baby war der lang ersehnte Sohn. Schwangerschaft und Geburt waren völlig normal verlaufen. Aber das Kind war gestorben. Ob an einem Herzfehler oder einem Umstellungsfehler des kindlichen Blutkreislaufes, man wusste es nicht.
Eineinhalb ewig lange Stunden hatte man verzweifelt versucht, das Baby zu reanimieren, zurück ins Leben zu holen. Und dann hatte man den Versuch aufgeben müssen.
Wann immer ich an dem Tag am Eingang des Kreißsaals vorbeiging, sah ich diese Tür mit den Augen der Eltern. Wenn er vorher noch hell und zauberhaft ausgesehen hatte, empfanden sie ihn nun sicher als dunkel, hoffnungslos und bedrohlich. Die Stimmung im Kreißsaal selbst war natürlich äußerst bedrückt.
Für diesen Tag stand auch die Welt im Kreißsaal einfach still. Und ich fand, dass sie das durfte.
Ich hatte noch nie ein totes Kind bzw. überhaupt einen Toten gesehen. Und eines Tages unvorbereitet in so eine Situation zu kommen, wäre für mich sehr schwierig gewesen. Daher fragte ich, ob ich mir dieses Kind mal ansehen dürfe.
Ich durfte.
Weil die Hebamme das Baby aber schon so oft an die Eltern gegeben hatte und mich nicht auch noch begleiten konnte, bat sie mich darum, mir das Baby selbst aus dem Kühlschrank zu holen.
Mir schlug das Herz bis zum Hals, als ich mir Handschuhe anzog. Ich ging wie in Zeitlupe zu dem Kühlschrank, in dem der kleine Junge lag. Ich befürchtete, das Kind sofort zu sehen, wenn ich die Tür öffnen würde, und war überrascht, dass dem nicht so war.
Er war in ein Tuch eingehüllt. Ich hatte nun viele Neugeborene gesehen – vorneweg meine eigenen –, sie gewickelt, angezogen und gebadet. Ich wusste, wie sie sich anfühlten, wie sie reagierten. Dieses Kind tat nichts dergleichen.
Es war merkwürdig, durch ein Tuch hindurch etwas sehr Vertrautes zu spüren, an dem aber doch etwas entscheidend anders war. Es war eine eigenartige Situation, die mich schon fast mit etwas Angst erfüllte. Aber was sollte passieren? Das Kind konnte mich ja nun nicht aus heiterem Himmel anspringen oder sonstwas mit mir anstellen. Wie merkwürdig, dass man von so einer irrationalen Angst beschlichen werden konnte, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzte. Es war sehr beklemmend.
Ich legte den Jungen vorsichtig auf einen Wagen und nahm das Tuch ab. Der Kleine war natürlich kühlschrankkalt. Aber davon abgesehen sah er auf den ersten Blick völlig normal aus. Was er ja auch war, bis auf die Tatsache, dass er gestorben war.
Er war unglaublich niedlich. Schwarze Löckchen, ganz süße Öhrchen, leicht plattes Näschen. Er schien zu schlafen. Unwillkürlich beobachtete ich seinen Bauch, ob er vielleicht doch noch atmete. Verrückt, eigentlich.
Die Lippen waren blutleer und wenn man ein zweites Mal hinsah, konnte man sehen, dass das Kind tatsächlich auch„lebensleer“ war. Es war „nichts mehr drin“. Das Leben, die Seele, was auch immer, es war einfach nicht mehr vorhanden. Ich nahm die kleinen Hände in meine, streichelte den kleinen Jungen, und es fühlte sich völlig anders an, als ich es erwartet hatte.
Die Leichenstarre ging auch in die Hautschichten, und somit fühlte sich das kleine Gesicht an wie das einer Puppe.
„Du hast es einfach nicht geschafft, hm?“, stellte ich ohne Erwartung einer Antwort fest.
Dieses gesamte Ausmaß, die Traurigkeit, die Verzweiflung der Eltern ... Ich war mir darüber im Klaren, dass das eine unerträglich schwere Zeit für sie sein musste. Was es genau für sie bedeutete, blieb mir verborgen, denn diese Erfahrung hatte ich nie machen müssen.
„Ich kann Sie gut verstehen“, das wäre mir nie über die Lippen gekommen.