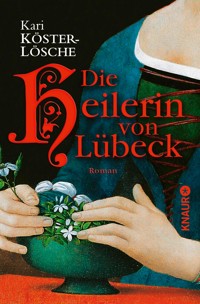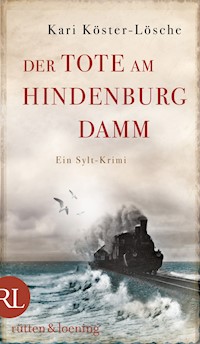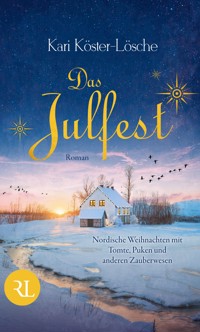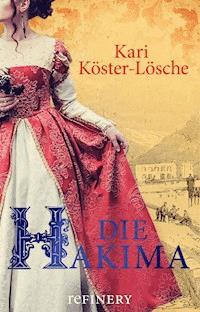Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine starke Frau in einer unruhigen Zeit: "Die Heilerin von Alexandria" von Kari Köster-Lösche, jetzt als eBook bei dotbooks. Alexandria, 106 n. Chr. In den Hafen läuft ein Sklavenschiff mit kostbarer Fracht ein. Die junge Thalia, Tochter eines Philosophen aus Kleinasien, wird an den griechischen Arzt Leptinos verkauft. Während sich Leptinos als Gefolgsmann des römischen Oberrichters Trimalchio und als Geliebter von dessen Erzfeindin Afrania in ein gefährliches Doppelspiel verstrickt, vertieft sich Thalia in die Schriften des berühmten Arztes Soranos von Ephesos – und erwirbt schließlich unschätzbare Kenntnisse als Ärztin und Hebamme. Als ein mysteriöser Mord ganz Alexandria in Angst und Schrecken versetzt, ist auch Thalia in Gefahr – denn unbemerkt ist sie in ein Netz aus Intrigen geraten ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Heilerin von Alexandria" von Kari Köster-Lösche. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Alexandria, 106 n. Chr. In den Hafen läuft ein Sklavenschiff mit kostbarer Fracht ein. Die junge Thalia, Tochter eines Philosophen aus Kleinasien, wird an den griechischen Arzt Leptinos verkauft. Während sich Leptinos als Gefolgsmann des römischen Oberrichters Trimalchio und als Geliebter von dessen Erzfeindin Afrania in ein gefährliches Doppelspiel verstrickt, vertieft sich Thalia in die Schriften des berühmten Arztes Soranos von Ephesos – und erwirbt schließlich unschätzbare Kenntnisse als Ärztin und Hebamme.
Als ein mysteriöser Mord ganz Alexandria in Angst und Schrecken versetzt, ist auch Thalia in Gefahr – denn unbemerkt ist sie in ein Netz aus Intrigen geraten …
Über die Autorin:
Kari Köster-Lösche, 1946 in Lübeck geboren, Tierärztin und Wikingerexpertin, hat einen Großteil ihrer Jugend im schwedischen Uppsala, dem Zentrum der nordischen Kultur, verbracht. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Nordfriesland.
Kari Köster-Lösche veröffentlicht bei dotbooks bereits die historischen Romane »Die Erbin der Gaukler«, »Jagd im Eis«, »Die Wagenlenkerin«, »Die Hexe von Tondern«, »Die Reeder« und das Kinderbuch »Stille Nacht, eisige Nacht« sowie zwei historische Romanserien:
DIE WIKINGER-SAGA:»Der Thorshammer – Band 1«»Das Drachenboot – Band 2«»Die Bronzefibel – Band 3«
DIE SACHSEN-SAGA:»Das Blutgericht – Erster Roman«»Donars Rache – Zweiter Roman«»Mit Kreuz und Schwert – Dritter Roman«
Beide Romanserien sind jeweils auch als Sammelband erhältlich.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2014
Copyright © der Originalausgabe 1998 by Paul List Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Atelier Nele Schütz, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Sergemi
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-858-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Heilerin von Alexandria« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kari Köster-Lösche
Die Heilerin von Alexandria
Roman
dotbooks.
TEIL 1 – SKLAVIN
KAPITEL 1 DER PHAROS
Die Männer hinter der unteren Balustrade des Leuchtturms der Insel Pharos sahen dem Segler neugierig entgegen. In der schon tiefstehenden Sonne glänzte die graublaue Farbe des Schiffsrumpfes, die den Piraten die meiste Zeit des Tages ausreichend Tarnung und Schutz gegen die römischen Galeeren bot.
Der schnelle Segler gierte schwer in den mitlaufenden Wellen. Aber kaum hatte er den Wellenbrecher passiert, richtete er sich auf und glitt elegant in das ruhige Gewässer des Haupthafens von Alexandria. Der Pirat auf dem Achterschiff neben dem Steuermann grüßte lachend das Wachpersonal auf dem Turm, während auf Deck Geschäftigkeit ausbrach. Die nackten Füße der Seeleute klatschten auf dem nassen Deck. Kurz danach hob sich das schwere Tuch des Rahsegels.
Kein lautes Wort fiel, und jeder Handgriff saß. Die Leuchtturmwärter nickten anerkennend. Pompejus der Kilikier konnte es sich leisten, die Römer zu verhöhnen – ob mit seinem Namen, den er sich zum Spott des römischen Oberbefehlshabers und Piratenjägers Pompejus zugelegt hatte, oder mit seinem Schiff, das stets schneller verschwand, als der Alarm der Römer bis zu ihren Militärstützpunkten gelangte.
Der Hafen war brechend voll. Vor der Mole des Palastviertels lagen unzählige Schiffe an Bojen und warteten auf einen Platz zum Entladen am Emporium. Pompejus verzog spöttisch seine dicken Lippen. Er hatte verderbliche Ware geladen. Er beanspruchte bevorzugte Abfertigung wie der Kapitän eines Getreideschiffes in Rom.
Während das Piratenschiff in den Wind schoß, ließ Pompejus seinen Blick über den Kai zwischen Emporium und Schleuse streifen, wo die einstöckigen Verkaufshallen standen.
Das Piratenschiff trieb zwischen den Ankerleinen anderer Schiffe achteraus auf das Heptastadion zu. Pompejus wartete noch eine Schiffslänge. Dann brüllte er seinen Befehl. Der Mann am Heck fischte die nächste erreichbare Ankerleine am Haken aus dem Wasser und begann sie durchzusäbeln.
Kurz danach erreichte auf dem Kai ein blauer Wimpel die Spitze einer Stange.
»Na also«, brummelte Pompejus und schlug seinen hocherhobenen Arm nach unten.
Wenige Augenblicke später stieß das blaugraue Heck zwischen die buntgestrichenen Rümpfe der anderen Boote am Heptastadion.
Im Nu vergrößerte sich der Kreis neugieriger Leute, bis der Durchgangsverkehr nach Pharos blockiert war. Nicht alle Tage bekam man ein Sklavenschiff von Übersee zu sehen. Seeräuber waren seltener geworden, seitdem die Römer sie entschlossen bekämpften; den Alexandrinern war es ein Vergnügen mitanzusehen, wie Pompejus der Kilikier den Römern ein Schnippchen schlug.
Einer der Seeleute schlug den Riegel der Ladeluke zurück und brüllte einen Befehl nach unten. Ein Sklave nach dem anderen kletterte an Deck. Die Zuschauer johlten vor Vergnügen. Die Sklaven waren weißhäutig und barbarisch schmutzig. Kot und Erbrochenes hingen an ihren zerfetzten Kleidungsstücken; die Thraker trugen sogar Schafwolle auf der Haut.
Erwartungsvolles Schweigen machte sich breit, als der Seemann an der Luke einen Fluch ausstieß und in den Schiffsrumpf abtauchte. Danach kroch widerwillig der letzte Sklave heraus. Er hatte safrangelbe kurze Haare, die ihm wie eine Bürste vom Kopf abstanden, und eine gespaltene Oberlippe wie ein Hase. Als er sich aufrichtete, seufzten die Alexandriner vor Erstaunen.
Der ungehorsame Sklave war eine junge Frau.
Die Gefangenen wurden einzeln über die Planke vom Heck auf den Kai geschubst. Zwei Männer mit scharfen krummen Nasen und noch schärferen Waffen paßten auf, daß keiner weglief. Ein dritter fädelte eine Kette durch den Ring, der den Sklaven bereits während der Überfahrt um einen Fußknöchel gelegt worden war.
»Was machen wir mit diesem Trugbild von Weib, mit dieser lieblichsten Gorgo zwischen Alexandria und Bithynien?« spottete der Seemann, der an Bord für die Sicherheit der Sklaven verantwortlich war. »Über den Bug oder über die Planke?« Seine Hand grub sich schmerzhaft in Thalias Schulter, während er auf die Entscheidung des Schiffseigners wartete. Sie bemühte sich, ihm nicht zu zeigen, wie unangenehm ihr die Berührung seiner rissigen Fingerkuppen war.
»Bei Sabazios' Stößel«, schrie Pompejus über die ganze Länge des Schiffs, eher erstaunt als wütend, »sie hat den Platz eines Mannes eingenommen, und sie wird den Preis eines Mannes bringen! Ich verkaufe sie als wundersame Ausgeburt eines Frühlingsfestes. Sie soll dem Käufer Glück bringen.«
»Wünsch es ihm nur – aber die im Bett, und sein Stößel wird schrumpfen, bis er sich selbst für einen neugeborenen Säugling ansieht, mag er noch so tapfer sein!« Der Seemann lachte schallend und gab Thalia einen Stoß, der sie taumeln ließ. Ihre Schienbeine stießen gegen die Planke, und sie unterdrückte einen Schmerzensschrei.
»Glaub mir, Pompejus«, fuhr der Mann fort, während er scharf aufpaßte, daß die. minderwertige Sklavin sich nicht ins Hafenwasser stürzen konnte, um ihrem Leben ein Ende zu machen, »die nimmt niemand. Sie wird dir die Haare vom Kopf fressen wie eine Bergziege, während du auf den Käufer wartest. Völlig überflüssig, sie aufzubewahren, wenn du mich fragst.«
»Wer fragt schon einen Ziegenhirten!« knurrte Pompejus.
Panik erfaßte Thalia, während sie sich bemühte, unter den Stößen des Sklaventreibers in ihrem Rücken nicht das Gleichgewicht auf der schmalen Planke zu verlieren. Ihre Hoffnung, an eine einsichtige Herrin verkauft zu werden, von der sie sich freikaufen konnte, sank.
Aber dann betrat sie den Boden von Alexandria. Es ließ ihr Herz klopfen, und dies hatte nichts mit den Seeräubern zu tun.
»Ein Bordell ist ausgeschlossen«, fuhr der Kilikier hartnäckig fort, dessen Stimme Thalia allmählich zu hassen begann. Sie widerstand mit Mühe der Versuchung, ihn mit scharfer Zunge zurechtzuweisen. »Und selbst als Hüterin von Kindern kommt sie nicht in Frage. Daß eine Sideterin sich in einer menschlichen Sprache verständlich machen kann, wird kein Käufer rund ums römische Meer dir glauben.«
»Ich werde sie an die Priester des Krokodilgottes verkaufen«, entschied Pompejus, bevor er den Kopf in den Nacken legte und einen Strahl aus dem Bocksbeutel in seinen offenen Mund laufen ließ.
Thalia fuhr herum und starrte den Kapitän entsetzt an.
Während Pompejus sich die Weintropfen aus dem Bart wischte, ruhte sein Blick nachdenklich auf ihr. »Die Krokodile verstehen deine Hilfeschreie nicht«, erklärte er grinsend. »Wenn du überhaupt reden kannst.«
Aber Thalia hatte sich wieder gefangen und zitterte nicht einmal, als sie dem Mann mit der Kette ihren Fuß hinhielt.
Die Kunde von der Ankunft eines kilikischen Sklavenschiffes breitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt aus. Dem Arzt Leptinos kam sie wie gerufen. Sein ehemaliger Lehrmeister hatte seine Praxis nach Rom verlegt. Die meisten Instrumente hatte Soranos von Ephesus mitgenommen, seine Sklaven verkauft.
Leptinos hatte das iatreion übernommen, das Soran nach eigenen Plänen hatte bauen lassen, und benötigte nun alles mögliche gleichzeitig, vor allem aber einen jungen Mann, den er als Helfer anlernen konnte, am besten einen Griechen. Die griechischen und römischen Patienten hatten kein Zutrauen zu Ägyptern, die sich meistens nur mit Zauberei befaßten.
Der junge Arzt räkelte sich auf der Liege in seinem Speisezimmer und wartete darauf, daß der kleine Küchensklave ihm das Essen auftrug. Die Auktion würde erst beginnen, wenn der Gnomon am Poseidontempel die fünfte Stunde anzeigte. Versonnen strich er über seinen sauber geschnittenen Bart. Seine Zukunft sah er glänzend vor sich liegen. Ein vernünftiger Arzt begrub seine unvermeidlichen Toten irgendwo in der Provinz und ging nach Rom, wenn er sich einen guten Ruf erworben hatte.
Das Tappen von nackten Füßen störte ihn in seinen Gedanken; er stützte den Kopf in die Hand und sah dem Ägypter entgegen. Tjelptah mochte zwölf oder dreizehn Überschwemmungen erlebt haben. Er trug einen Hocker aus schwarzem Ebenholz mit einem Krug darauf, und mit der Zunge zwischen den Lippen brachte er es fertig, ihn abzusetzen, ohne den Wein zu verschütten.
Leptinos fing lächelnd Tjelptahs schüchternen Blick auf. Er hatte ihn und seine Mutter Wernero erst vor wenigen Tagen gekauft.
»Es sind Kroketten von Tintenfischen, Gebieter«, meldete Tjelptah mit leiser Stimme. »Meine Mutter würde sie nächstes Mal gerne mit Kümmel und Asantwurzel würzen, wenn es dir recht ist. Sie sind dann noch köstlicher, meint sie.«
»Ich mag keinen Fisch«, sagte Leptinos und kostete vom Rosenwein. Soran hatte ihm die Vorräte überlassen, weil die Fracht teurer war als der Neuerwerb. »Und Pfeffer reicht. So feurig wie möglich.« Er lächelte dem erschrockenen Tjelptah ermutigend zu und schickte ihn mit einem Klaps auf das Hinterteil hinaus.
Es war unangenehm still im iatreion, totenstill. Leptinos schob sich hastig einige Kroketten in den Mund und ging in den Behandlungsraum hinüber.
Wenigstens waren die Körbe mit Verbandsmaterial gefüllt, mit Schwämmen und Schienen. Aber die bestellten Instrumente waren noch nicht geliefert worden. Er seufzte unlustig bei dem Gedanken, daß viele Patienten von Soran ihren Arzt jetzt wechseln würden. Wenn er es genau betrachtete, hatte er keinen einzigen übernommen.
Endlich war es Zeit, zu den Verkaufshallen am Hafen zu gehen. Leptinos legte sorgfältig die Chlamys über den Chiton und verließ sein Haus, Tjelptah dicht auf den Fersen. Er konnte es sich nicht leisten, sich auf der Straße ohne Sklaven zu zeigen; außerdem mußte der Junge ihm den Hut nachtragen.
Außerhalb des stillen iatreions schlug ihm der Lärm der Großstadt wie eine Flutwelle entgegen. Nach wenigen Schritten im Gewühl von Wagen und Passanten auf der Canopisallee, die das Mondtor mit dem Sonnentor verband, war er in Schweiß gebadet. Die schmalen Gassen, die vom großen Hafen senkrecht auf die Allee stießen, schluckten den größten Teil des Nordwindes.
Eine Wolke von Staub signalisierte römische Ritter, und Leptinos wich unter die Arkaden aus. Die Soldaten hatten ihre eigenen Ärzte und benötigten seine Dienste nie. Gerade noch rechtzeitig bemerkte er seinen Irrtum und sprang wieder auf die Straße. Der Vizekönig des römischen Kaisers ließ sich von der kaiserlichen Garde geleiten. Wollte er auch zur Sklavenauktion? fragte sich Leptinos, während er emsig den Zeigefinger zum Gruß in die Höhe hielt und zufrieden konstatierte, daß Lucius Valerius Poplicola ihn immerhin zur Kenntnis genommen hatte. Als der Staub sich gelegt hatte, setzte Leptinos seinen Weg fort. Der Morgen ließ sich vielversprechend an.
Bis zum Beginn der Versteigerung war zwar noch Zeit, aber die Halle am Kai begann sich mit interessiertem Publikum zu füllen. Leptinos hielt sich nur kurz bei einigen Bekannten auf und schlenderte dann zum Podest, auf dem die nackten Sklaven schon zur Besichtigung freigegeben waren.
Er zupfte sich am Bart, während er seine Augen über die Gruppe der Männer schweifen ließ. Alle waren frisch gewaschen und eingeölt. Die Freiwilligen spannten die Brust und ließen die Armmuskeln spielen. Zurückhaltender waren die Männer, die die Sklavenhändler auf ihren Feldern eingefangen oder in Fischerbooten gekapert hatten.
Als ihm die einzige Frau ins Auge fiel, brach Leptinos in ein erheitertes Lachen aus. Sehr helle Haut und strohgelbes Haar, die unästhetische Farbzusammenstellung des fernen Nordens. Dazu eine Lippenmißbildung, die ihr ein kamelartiges Aussehen gab.
Er beugte sich vor und faßte die rosigen äußeren Schamlippen ins Auge, die glatt und feucht im Flaum der krausen blonden Haare lagen. Nein, die Sklavin war kein Hermaphrodit, sondern ein gewöhnliches weibliches Wesen ohne weitere Verbildungen, die seine ärztliche Neugier gereizt hätten.
Thalia preßte erbittert die Lippen zusammen. Einen Augenblick geriet sie in Versuchung, dem jungen Mann auf den Kopf zu spucken. Aber möglicherweise konnte er es sich leisten, sie zu kaufen, um sie im Hafenbecken zu versenken. Seine schmale gerade Nase und die hohe Stirn über den grünen Augen ließen ihn geradezu schön wirken, und an seiner Barttracht erkannte sie, daß er ein Grieche war. Ein reicher, intelligenter Grieche mit dem rohen Gemüt eines Römers.
»Was stimmt dich so vergnügt, Herr?« fragte Tjelptah, der ganz allmählich Vertrauen zu seinem neuen Herrn faßte.
Leptinos beachtete ihn nicht. Vom Eingang zwischen den Säulen flüsterte eine heisere Stimme: »Werden auch Säuglinge verkauft? Wo ist der Besitzer?« Der Mann konnte die Lautstärke seiner Rede nicht kontrollieren.
Böser Halskatarrh, dachte Leptinos und drehte sich um. Sein Blick fiel auf eine korpulente Frau, die sich durch die inzwischen angewachsene Menge von Interessenten hindurchstieß. Ihre prallen Brüste strafften die Falten des dünnen Gewandes, das über den Brustspitzen naß war. Hinter ihr her drängte ein dürrer Mann.
In unmittelbarer Nähe von Leptinos packte der Mann die Frau am Arm und fauchte tonlos in ihr Ohr: »Halte dich hier heraus, Melissa, Süße! Wenn er Säuglinge hat, so sind sie mein! Ich habe meine eigenen Ammen. Du weißt es.«
»Du hast doch schon genug Prostituierte, Barnabas«, schnaufte die Dicke erregt. »Sieh mich an! Ich brauche dringend einen Säugling!«
Barnabas musterte sie kühl aus Augen, die so schwarz waren wie seine langen Schläfenhaare und das Käppchen auf seinem Kopf. »Ich sehe, daß du gemolken werden willst. Aber nicht von meiner Ware.« Er hüstelte.
Der Amme stieg das Blut in den Kopf. Leptinos konnte ihre Wärme neben sich fühlen. Zuviel Wein? Oder das Herz. Unauffällig schnupperte er an ihrem Atem. Er war rein, wie es sich bei einer Amme gehörte. Dann dachte er an den Halskatarrh. Die Juden hatten ihre eigenen Ärzte, ganz gewiß auch der bekannteste Händler der Stadt, aber ein Versuch war es wert.
»Mute dir nicht zuviel zu, Melissa«, sagte Leptinos ernst. »Mir scheint, daß dein Fleisch sich im status laxans befindet, in der Erschlaffung. Du solltest jetzt kein Kind nähren, damit sich keine weitere Krankheitsmaterie in dir ansammelt und abgelagert wird, verstehst du?«
Melissa stieß einen spitzen Schrei aus. Ihre Gesichtsfarbe wechselte von rot zu weiß, und Schweiß trat auf ihre Stirn. »Ich habe dich schon gesehen«, stammelte sie. »Du arbeitest doch beim Arzt Soranos am Mondtor, oder nicht?«
Leptinos schüttelte den Kopf. »Soran hat Alexandria den Rücken gekehrt. Wenn du in mein iatreion am Mondtor kommen möchtest, so bist du willkommen.«
»Ich werde darüber nachdenken«, murmelte Melissa und bewegte sich rückwärts, den Säulen entgegen. Nur kein Aufsehen jetzt. Wenn ihr erst einmal der Ruf anhaftete, krank zu sein, würde kein Bordellbesitzer ihr jemals wieder einen Säugling zum Aufziehen anvertrauen.
Leptinos sah ihr nach. Er spürte, wie Barnabas an ihn heranrückte. »Danke, Grieche. Vielleicht hast du Lust, mich mal aufzusuchen?«
»Vielleicht, Herr der Säuglinge und Prostituierten«, versprach Leptinos mit leisem Spott.
Barnabas lächelte hintersinnig. »Mein Handelshaus am Sonnentor kann dir jeder zeigen.« Er schob sich zur Bühne vor.
Thalia, die am Rand der Sklavengruppe stand, hatte das Gespräch verfolgt und für einen Augenblick sogar ihre Lage vergessen. Daß der Grieche Arzt war, erklärte sein beleidigendes Verhalten nicht, wohl aber seine Neugier.
In diesem Augenblick erschienen der griechische Versteigerer und der römische Prokurator für Handelsangelegenheiten. Der Auktionator wartete, bis das Publikum sich beruhigte und still wurde. »Salve«, sagte er. »Ich biete heute Sklaven des kilikischen Händlers Pompejus feil: achtzehn bullenstarke, arbeitsgewohnte Männer, eine Jungfrau von der kilikischen Küste, ungefähr achtzehn Winter alt, einen kleinen Jungen von sieben Wintern und zwei fette, gesunde weibliche Säuglinge.«
Der römische Beamte in der Tunica des Ritters eröffnete die Versteigerung mit einem Nicken.
Leptinos betrachtete begehrlich zwei bildschöne Jünglinge. Intelligente Gesichter und unbeschnitten. Jeder von ihnen würde als Gehilfe das Herz der griechischen Patienten höher schlagen und die Zahl der Hilfegesuche in die Höhe schnellen lassen. Und die Geldbörsen öffnen.
»Dreitausend Asse«, sagte der Versteigerer und hielt den Arm des Thrakers wie den eines Siegers in die Höhe.
O ihr Götter, dachte Leptinos und zog seine Hand vom Beutel. Der römische Beamte bot mit und würde sie bekommen. Der Auktionator würde sich beeilen, ihm die Männer zuzuschlagen. Gelegentlich würde es sich für ihn auszahlen.
Die hageren Ziegenhirten aus den Bergen, die danach an der Reihe waren, interessierten Leptinos nicht. Am ganzen Körper behaart wie Pan – ihre Bocksfüße hatte der Auktionator mit Fußlappen umwickelt und sie im übrigen in Lavendelöl getränkt –, würden sie keinen Gewinn für ein iatreion darstellen.
In dem Maße, wie das Häufchen attraktiver Sklaven schmolz, verdünnte sich auch Leptinos Zuversicht. Schließlich waren alle Männer verkauft, die meisten an begüterte Alexandriner. Die Säuglinge gingen an Barnabas.
Verärgert und enttäuscht begann Leptinos, sich seinen Weg zum Ausgang zu bahnen. Er hatte das Ende der Halle erreicht, als ihn die Worte des Versteigerers aufhielten. »Eine kräftige junge Frau, geeignet für alle Arbeiten, die in einem römischen oder griechischen Haushalt anfallen. Sie ist unberührt.«
Die Leute ringsum kicherten, aber niemand bot. Leptinos drehte sich um und schob sich erneut bis zum Rand des Podests durch. Sie sieht immerhin kräftig und belastbar aus, dachte er, ohne den vom Versteigerer angepriesenen Vorzügen zuzuhören. »Spricht sie Griechisch?« fragte er mitten in die berufsmäßige Litanei hinein.
Der Auktionator drehte sich mit hochgezogenen Augenbrauen zu Pompejus dem Kilikier um, der in seiner Nähe stand. »Ihr Jungfernhäutchen ist anscheinend weniger gefragt als ihre Zunge. Welche Sprache spricht sie?«
Der Pirat zupfte an seinem Ohrläppchen, an dem ein großer Goldring baumelte. »Tja, um genau zu sein, weiß ich es nicht«, bekannte er. »Könnte auch sein, daß sie stumm ist. Aber sie versteht, was man ihr sagt.«
»In welcher Sprache versteht sie, du Tölpel«, herrschte Leptinos ihn an.
Thalia entschied sich. Besser der Arzt als die Krokodile. »In Griechisch, Lateinisch, Kilikisch und Sidetisch«, antwortete sie beherrscht.
Leptinos wandte sich verblüfft zu ihr um. »Wieso denn das?« fragte er verärgert in das schallende Gelächter hinter seinem Rücken hinein.
»Mein Vater ist in dieser Hinsicht Epikureer. Er ließ mich nicht anders als meinen Bruder erziehen«, sagte Thalia leise und versuchte, ihre Tränen zurückzuhalten. Sie hätte besser gesagt: Er war Epikureer. Bei dem nächtlichen Überfall auf sein Haus hatte ihr Vater Frau und Kinder tapfer verteidigt. Aber was konnte einer, der sonst mit der Zunge kämpft, schon gegen Schwerter ausrichten? Als man Thalia aus den Armen ihrer Mutter gerissen hatte, lag er auf dem Boden, und sein schwarzer Philosophenmantel schwamm im Blut.
Leptinos starrte die in jeder Hinsicht merkwürdige junge Frau an; als Sklavin würde sie niemanden in Versuchung führen. Die Römerinnen würden sich den Händen einer derart verunstalteten Gehilfin anvertrauen, ohne ein argwöhnisches Auge auf die eigenen Ehemänner haben zu müssen. Und selbstverständlich brauchte er auch weibliche Patienten. »Ich kann sie eigentlich nicht gebrauchen«, sagte er abweisend. »Mit einer solchen Erziehung wird sie nie fügsam wie andere Sklaven sein.«
Das war auch die persönliche Meinung des Versteigerers. Aber seine Dienstleistung bestand nicht darin, einem Käufer das Interesse auszureden. Er hatte außerdem das Zögern des Griechen wahrgenommen. »Andererseits kommt sie dich nicht teuer, edler Grieche«, sagte er eifrig. »Wenn du die reife Frucht einem Bordell zum Anstechen überläßt, hast du den halben Kaufpreis schon wieder eingenommen. Es sei denn, natürlich, daß du selbst ...«
»Sie ist garantiert Jungfrau«, fiel Pompejus ein, der die Chance ebenfalls witterte. »Ich habe mich selber davon überzeugt, aber dir steht es selbstverständlich frei, es zu überprüfen.«
Thalia trat zurück, bis die Wand ihre unwillkürliche Flucht aufhielt. Immer noch schauderte sie, wenn sie an die Finger des Seeräubers dachte. Der Arzt winkte ab. Da sich kein weiterer Interessent meldete, schob der Auktionator den kleinen Jungen vor, den er aufgespart hatte, um die Aufmerksamkeit des Publikums bis zuletzt wachzuhalten. Thalia atmete auf.
Die kühle Wand im Rücken trug dazu bei, daß ihr Verstand wieder anfing zu arbeiten. Dieser Römer auf dem Podium mußte aus amtlichen Gründen anwesend sein, obwohl er zwei Männer gekauft hatte. »Ich bin frei geboren«, unterbrach sie den Versteigerer kühn. »Ich bin die Tochter des bekannten Philosophen Athenagoras in Side, das zum Römischen Reich gehört. Ich spreche den Männern, die meine Familie grausam ermordet und mich geraubt haben, jegliches Recht ab, mich zu verkaufen.«
Da sie das fehlerfreie Latein von Gebildeten sprach, zog sie augenblicklich die Aufmerksamkeit des römischen Beamten auf sich. Sein humorloses langes Gesicht ließ keine Regung erkennen, obwohl er ihre Bemerkung über die Zugehörigkeit von Side zum Reich zutiefst mißbilligt hatte. Da erlaubte sich ein Weib, die römische Schutzmacht zu tadeln, noch dazu vor den Ohren anderer. »Kannst du den Nachweis deiner angeblich freien Geburt erbringen?«
Thalia stieß sich von der Wand ab. »Wie denn?« fragte sie heftig. »Mein Vater ist tot!«
»Also keine Zeugen und keine Freilassungsurkunde. Dann hättest du besser geschwiegen«, bemerkte der Prokurator kühl.
Hinter ihrem Rücken krampfte Thalia die Hände zusammen. Dieser Römer war möglicherweise für römisches Handelsrecht zuständig, aber nicht für Gerechtigkeit.
Während des nutzlosen Wortwechsels hatte der Versteigerer den Griechen beobachtet. Er kannte viele Tricks. Mittlerweile war er davon überzeugt, daß der Mann sehr wohl interessiert war und den Preis zu drücken versuchte. Er wandte sich an den Kilikier. »Dann kannst du sie jetzt zum Syrer Tatian bringen. Er war bereit, fünfhundert Asse zu geben.«
Pompejus kannte keinen Tatian, aber er nickte bedächtig. Der Versteigerer war ein Fachmann, dessen Können sich im Preis für seine Dienste sehr fühlbar niederschlug. Er mußte wissen, warum er einen Käufer Tatian ins Spiel brachte.
»Vielleicht kann ich dir den Weg ersparen«, fiel Leptinos ein. »Für vierhundertfünfzig.«
Das Weib war wirklich nicht mehr als dreihundert Asse wert. Wenn überhaupt. Pompejus lächelte in seinen struppigen Bart hinein.
Der Auktionator sah Leptinos gequält an. Ein Dilettant, obwohl Grieche. Aber das schnelle Ende des Handels kam ihm entgegen. Er hatte heute noch eine weitere Versteigerung zu leiten. Er hielt dem Käufer seine offene Handfläche hin.
Gleichgültig klatschte Leptinos drauf. »Tjelptah, du bist dafür verantwortlich, daß sie auf dem Heimweg nicht davonläuft«, knurrte er, mit einemmal schlecht gelaunt, während er die Münzen aus dem Beutel zusammenzählte. Plötzlich hatte er das Gefühl, daß der Kauf dieser Frau ihn irgendwann reuen könnte. Es war ein Jammer um die schönen Thraker. Sie würden als Fackelträger vor dem Porticus des Procurators ad Mercurium Alexandreae enden. Welche Vergeudung!
Tjelptah sprang auf das Podium und ging mit der Neuen nach hinten. Er sah ihr genau auf die Finger, als sie ihren zerfetzten, schmutzigen Chiton anzog und die Sandalen schnürte. Thalia beachtete ihn nicht. Ihre Gedanken schlugen Purzelbäume. Sie hatte sich eine Frau als Herrin vorgestellt und Dienstleistungen, die sie hassen würde: kämmen, baden, einölen und wieder kämmen. Aber immer war da ein wenig Hoffnung gewesen, daß sie auch hätte vorlesen dürfen, vielleicht sogar die Korrespondenz erledigen. Aber was konnte ein Mann schon von ihr wollen? Thalia stöhnte leise.
Als sie in die Halle zurückging, verschwand der große Grieche gerade hinter einer der Säulen, die das Vordach stützten. Jenseits des schattenspendenden Daches flimmerte der Kai im grellen Sonnenlicht. »Ist dein Herr ein freundlicher Herr, Tjelptah?« fragte Thalia.
Der Junge mit dem dichten schwarzen Haar, das nur neben der Schläfe eine lange Haarlocke bildete, betrachtete Thalia abweisend. Sein Gebieter hatte Anspruch darauf, daß nicht über ihn geklatscht wurde. Er schob die Unterlippe vor und schwieg.
Wie Hermas, ging es Thalia durch den Kopf, aber sie verbot sich, gerade jetzt immer wieder an ihr Elternhaus zurückzudenken. Ihr kleiner Bruder war im Getümmel des Überfalls erschlagen worden.
Tjelptah sprang auf den gestampften Lehmboden hinunter und trabte seinem Herrn nach. Thalia ging zögernd hinter ihm her, dann blieb sie in der Sonne stehen. Am frühen Morgen hatte sie das Hafenbecken als widerrechtlich Geraubte betrachtet. Jetzt sah sie es als Sklavin und wunderte sich, daß das Wasser noch die gleiche schmutzige, stinkende Brühe war wie am Morgen. Der Pharos warf trotz der Mittagssonne Lichtblitze auf die See.
Der Gott Poseidon auf seiner Spitze nahm keine Notiz von einer jungen Frau, die erwartet hatte, ihn und die berühmten Tempel Ägyptens als Reisende zu besichtigen, und statt dessen an seinen Füßen vorbei in Ketten zum Sklavenmarkt befördert worden war. Thalia rieb sich verzweifelt die Wange trocken, über die eine Träne rollte. Sie haßte diesen Gott, der Seeräuber beschützte.
Der Ägypter scheuchte die neue Sklavin mit dem Hut des Gebieters vorwärts. Natürlich hatte er es nicht wirklich eilig. Aber sein Herr hatte ihm die Aufsicht über sie übertragen. Als sie sich endlich bewegte, übernahm er mit hochmütiger Miene die Führung.
Thalia staunte über die Höhe der Häuser, die Menschenmassen und den Lärm. Mit ihrer Mutter hatte sie Athen, Ephesos und Tarsos besucht, aber diese Städte konnten sich mit Alexandria nicht messen. Durch diese Straßen waren Pharaonen getragen worden, die zu Göttern geworden waren. Sie vergaß ihr Elend und wurde ganz stumm vor Ehrfurcht.
»So komm endlich!« schnauzte Tjelptah sie an. »Wenn du dich nicht beeilst, darfst du dich gleich vor dem Gebieter auf den Bauch strecken.«
Thalia erschrak. Der Herr schien sehr streng zu sein. Und er hatte sie eigentlich nicht haben wollen. Wenn sie sich nicht willig zeigte, würde er sie wahrscheinlich verkaufen. Selbst an der Brücke über einen Kanal hielt sie sich jetzt nicht mehr auf, obwohl er sie an ihre Heimat erinnerte.
Tjelptah war mächtig stolz darauf, daß sie so viel Respekt vor ihm hatte. Er setzte sich in Trab.
Schnaufend langten sie am Eingang zum iatreion an, das inmitten von Büschen und Bäumen lag. Thalia starrte verwundert in den kleinen Teich, der durch Fische und einen Reiher belebt war, im Gegensatz zur Liegehalle, die ganz leer war. Ein Anwesen wie dieses hatte sie nicht erwartet; es war wie ein kleines griechisches asklepieion. Aber sie sah weder Priester noch Ärzte noch Kranke.
Ihr Herz beruhigte sich langsam, während Tjelptah sie auf der Suche nach dem Gebieter durch das Haus führte.
Leptinos saß in einem fast leeren Raum auf einem Hocker und las. Er sah auf. »Wie heißt du?«
»Thalia«, antwortete sie.
»Gut, bleiben wir bei dem Namen«, sagte Leptinos. »Du wirst das iatreion als Helferin in Ordnung halten.« Er runzelte mißmutig die Stirn, weil sie sich mit einem Anflug von Erstaunen umsah, nachdem sie endlich aufgehört hatte, in den Buchspind zu starren. »Du wirst dich über Mangel an Arbeit nicht zu beklagen haben. Auch an Blut, Ausscheidungen und amputierten Gliedmaßen wird kein Mangel sein. Aber ich verlange peinlichste Sauberkeit in diesen Räumen, an meinen Instrumenten und in der Liegehalle bis hin zu den Aborten für die Ratsuchenden. Du bist allein für alles verantwortlich.« Er winkte sie mit dem Handrücken fort und vertiefte sich wieder in den Text.
Die Erwähnung des Blutes erschreckte Thalia. Dennoch wurden ihr die Knie nicht deswegen weich, sondern vor Erleichterung. Wenn sie ihn richtig verstanden hatte, waren hier die ärztliche Praxis und das Haus scharf voneinander getrennt. Und sie sollte im iatreion arbeiten. Es blieb ihr erspart, seinen Rücken und seine Füße zu waschen.
Tjelptah warf ihr einen hämischen Blick zu. »Abgeschnittene Hände, Beine, Köpfe. Blut. Freu dich nicht zu früh.«
KAPITEL 2 ALEXANDRIA
Es wäre sinnlos, die Tür zu verbarrikadieren. Thalia wußte, daß sie zu ihrem Herrn gehen mußte, wenn er sie rief. Er hatte einen rechtlichen Anspruch auf ihren Körper.
Aber die erste Nacht ging vorüber, und nichts geschah. Beschwingt und zuversichtlich sprang sie früh am nächsten Morgen von der Kline, durchstreifte das Anwesen und stellte sich selbst einen Plan für ihre Pflichten auf. In der Liegehalle waren Ameisen, und auf dem Dach fehlten Ziegel. Die Taue für einen der Schaukelsessel mußten auch ersetzt werden. Sie spähte gerade nach oben, als sie das Geräusch von laufenden Füßen hörte.
Ein braunhäutiger kleiner Bursche warf ihr eine Briefrolle vor die Füße und schoß davon, bevor sie ihn halten konnte. Thalia brachte sie zu Leptinos hinein und blieb bei ihm stehen, während er die Botschaft las. »Man verlangt nach Soranos von Ephesos«, murmelte er. »Genauer: Der neue römische Oberrichter verlangt nach ihm. Na, wir werden sehen.«
Wenige Augenblicke später schleppte Thalia den Instrumentenkasten und den Arzneikasten hinter ihrem neuen Herrn her, ohne zu verstehen, warum er ein so eigenartiges Gesicht gemacht hatte. Er war Arzt und besuchte einen Patienten. Worin bestand seine Sorge? Ihre bestand jedenfalls darin, die beiden Kästen heil durch die Menge zu transportieren. Es war noch früh, die Luft war frisch, und anscheinend hatten es sich alle Alexandriner in den Kopf gesetzt, ihre Geschäfte jetzt zu erledigen. Leerer wurde die Straße erst, als sie in das römische Viertel kamen mit breiten Straßen, Palästen zu beiden Seiten und wenigen Männern in weißen Togen mit prachtvollen Mustern.
Im Haus, das sie nach dem schnellen Marsch erreichten, befand man sich in heller Aufregung. Der Sklave riß die Pforte weit auf, als er in dem Griechen den Arzt erkannte. »Schnell, Herr!« sagte er gepreßt. »Der Stratege Gaius Cornelius Trimalchio liegt im Sterben.«
Sklaven eilten mit Schüsseln durch das Atrium, angetrieben vom Händeklatschen einer älteren Matrone, deren purpurverzierte Stola die Knöchel auf altmodische Art bedeckte. Die braunroten Haare waren straff gekämmt und zu einem Dutt zusammengefaßt. Ihre befehlerische Stimme klang hart und scharf.
Leptinos' Versuch, sie zugunsten des sterbenden Kranken zu unterbrechen, wischte sie einfach beiseite. Er hatte zu warten, bevor sie sich ihm widmen konnte. Er hatte auch zu schweigen, bis sie ausgesprochen hatte. »Ich halte nichts von griechischen Ärzten, um dies gleich klarzustellen. Aber Gaius Cornelius Trimalchio, Römer und Herr dieses Hauses, fürchtet, daß die bewährten römischen Mittel in einem fremden Land zu schwach sind. Er beharrt auf der Behandlung durch den Arzt Soran.« Sie rümpfte mißbilligend die Nase.
»Es gilt, hier ein Mißverständnis auszuräumen, Herrin des Hauses«, sagte Leptinos ohne Unterwürfigkeit. »Soranos, der an der ganzen Küste über einen ausgezeichneten Ruf als Arzt verfügt, hat seine Tätigkeit nach Rom verlegt. Der römische Stratege Trimalchio ist gut beraten, nach der Behandlung von Soran zu verlangen. Ich war mehrere Jahre sein Schüler und führe nun die Praxis weiter.«
»Unter dieser Voraussetzung hättest du gar nicht zu kommen brauchen. Ein römischer Arzt oder Soranos!« Ihr hochmütiges Gesicht wurde noch eine Spur abweisender.
»Dein Bote verschwand, bevor ich den Brief gelesen hatte. Im übrigen sollte man dem Hausherrn die Wahl seines Arztes überlassen. Vielleicht möchte er einfach nur gesund werden.«
Sie setzte zu einer scharfen Erwiderung an, als eine klagende Stimme durch die offene Tür in einem der Seitenflügel ertönte. »Cornelia Tertia, mische dich nicht ständig in meine Angelegenheiten. Der Soranschüler soll kommen, bevor mein Inneres ausläuft wie ein geplatzter Wasserschlauch.«
»Weinschlauch, meinst du wohl«, versetzte Cornelia merklich zurückhaltender.
Leptinos trat ohne ein weiteres Wort am Wasserbassin vorbei in das Schlafzimmer. Der Kranke ruhte mit geschlossenen Augen auf einer schmalen Liege, seine Hände hingen bis zu den Löwentatzen hinunter. Er ähnelte der Frau im Atrium wie eine überalterte Pflaume der anderen, jedoch bewies das schlaffe Gemächt unterhalb der hochgeschobenen Tunica zweifelsfrei, daß er ein Mann war. Ein süßlicher Geruch lag in der Luft, der auch nicht verschwand, als ein schmächtiger junger Mann die Schüssel mit dünnen, stinkenden Exkrementen entfernte. Seine Augen waren voll Sorge und seine Hände bebten derart, daß die bräunliche Flüssigkeit wie im Seegang schwappte.
Thalia sah ihm mitfühlend nach. Sie hatten Angst um ihren Herrn.
»Man hat mich bereits am ersten Tag nach meiner Ankunft in Alexandria vergiftet«, stöhnte Trimalchio. Jetzt sah Thalia die roten Adern im Weißen seiner Augen, die im übrigen hellbraun waren. Und darunter bläuliche Tränensäcke, die ihn im großen und ganzen zu einem farbenprächtigen Kranken machten. »Meine Schwester ist unfähig zu begreifen, daß ein alexandrinischer Arzt alexandrinische Gifte besser kennen muß als ein römischer. Ich brauche ein Gegenmittel des Landes.«
»Zweifellos, Stratege. Aber laß mich nun die Diagnosen stellen.« Mit in sich gekehrtem Blick ertastete Leptinos die Stelle am Handgelenk des Kranken, an dem der Puls zu fühlen sein mußte. Er fand ihn hart und pochend und legte den schweißbedeckten Arm behutsam neben den Leib zurück, während er den Atem des Römers tief in sich einsog und geübt seinen Widerwillen verbarg. »Hast du etwas von dem Gift in deinen Speisen geschmeckt?«
»Wie denn? Nach einem Schluck von diesem schweren ägyptischen Wein? Ein Getränk, in dem Dionysos sich suhlen könnte! Warum hat mich niemand gewarnt?« Trimalchio fuhr hoch und erbrach sich in eine weitere Schüssel, die ihm der Sklave hastig unter den Mund schob. Während der Mann mit dem säuerlich riechenden Inhalt davoneilte, wischte ihm ein junges Mädchen den Schweiß aus dem Gesicht.
Thalia registrierte, daß der Hausherr trotz seiner Schwäche noch kräftig genug war, um sich ohne zu zittern auf den Ellenbogen zu stemmen. Wie ein Sterbender sah er nicht aus. Vielleicht war Leptinos noch zeitig genug eingetroffen, um ihn zu retten.
Als der Ausbruch vorüber war, beugte sich Leptinos über den Leib des Römers und legte sein Ohr auf dessen nackten Bauch. Thalia starrte ihm weiterhin in das faunartige Gesicht, um dem Anblick des Gemächts auszuweichen. Als Leptinos sich wieder aufrichtete, strahlte er maßvolle Zuversicht aus. »Das Gift in deinem Körper hat zum status laxans, einer Erschlaffung im Gedärm geführt, Trimalchio. Zweifellos ein sehr ernster Zustand.«
»Status laxans! Unsinn!« unterbrach ihn Cornelia, die sich mittlerweile in der Tür aufgepflanzt hatte. »Es ist nichts als ein Status des Kotzens nach zuviel Wein.«
»Hingegen ist der Spannungszustand deiner Adern wegen des Kampfes gegen die Giftwirkung schon fast zu stark. Wir haben es mit einem aus status laxans und status strictus gemischten Zustand zu tun«, fuhr Leptinos fort, ohne sich um die Hausfrau zu kümmern, während der Blick des Kranken beunruhigt an ihm hing.
»Und der Zustand seiner Säfte?«
Diese Römerin ließ sich nicht einmal durch Ignorieren in ihre Schranken weisen. Leptinos drehte sich gelassen um und bedachte sie mit einem feinen Lächeln, das nur knapp an Verächtlichkeit vorbeiging. »Cornelia Tertia, ich gehöre zur Schule der Methodiker. Wir halten nichts von der Säftelehre. Solltest du der Meinung sein, daß dem Körper des Strategen das Gift durch einen tüchtigen Aderlaß entzogen werden muß, so laß nach einem Eristrateer senden. Gewiß wird Trimalchio dir für die schmerzhafte Behandlung in seinem Hause, in dem anscheinend du zu bestimmen hast, danken. Wäre er bei mir im iatreion, würde ich vorziehen, seinen Körper mit meinen sanften Methoden umzustimmen.«
Der Oberrichter fuhr wieder hoch, hielt sich den Kopf mit beiden Händen und sagte mit fester Stimme: »Sei dankbar, Schwester, daß ich bereit war, dich in meinem Hause aufzunehmen. Es würde mir nicht schwerfallen, dich zu verheiraten, wenn ich es wollte. Unter der manus-Klausel.«
Cornelia preßte die Lippen zusammen und ging mit raschen Schritten davon. Sie glaubte nicht an ein Gift, an die Heirat noch viel weniger, und der griechische Arzt machte sie wütend.
Leptinos wechselte mit dem Strategen einen verständnisinnigen Blick. Trimalchio winkte dem Jungen an der Wand, und dieser schaffte eilig einen Faltstuhl für den Arzt herbei.
»Ich werde dir ein stärkendes Mittel mischen«, sagte Leptinos, indes er sich bemühte, seine langen Beine in würdiger Haltung unter dem Hocker unterzubringen. »Während es seine Wirkung entfaltet, werden deine Sklaven nach meinen Anweisungen ein Bad bereiten. Als dein Arzt empfehle ich, nach demjenigen zu suchen, der dir in deinem eigenen Haushalt nach dem Leben trachtet, Stratege. Beim nächsten Mal könnte ich möglicherweise weniger schnell zur Stelle sein.«
Trimalchio stemmte sich auf seiner Liege hoch. »Du stimmst mir zu, daß es ein Gift war, Arzt? Ich werde Boten zu allen drei Prokuratoren senden und einen nach Nikopolis zum Präfekten. Wenn außer mir niemand, der am Gelage beteiligt war, krank ist, galt der Anschlag mir allein. Was hältst du davon?«
Leptinos nickte. »Zu wissen, wie viele Personen vergiftet wurden, bestimmt den Kreis der Täter genauer. Vielleicht wird man nicht allzu viele Sklaven verhören müssen, um die Wahrheit zu erfahren.«
Der Stratege ließ sich wieder auf den Rücken zurücksinken und starrte auf die weißgetünchte Zimmerdecke, die schmuckloser war, als es einem römischen Beamten zustand. Alexandria! Er haßte es jetzt schon. Aber man hatte ihm nur die Position eines alexandrinischen Oberrichters anbieten können, niedriger im Rang als jeder andere kaiserliche Oberbeamte.
Während sich Trimalchio den Träumen über seine Karriere hingab, widmete sich Leptinos der Heilung seines ersten wichtigen Kranken. Eine einfache Magenverstimmung nach einer durchzechten Nacht war ausreichend mit einer Abkochung aus Pfefferminzblättern zu behandeln; sein Hantieren mit dem Bleitöpfchen, das Lykion enthielt, war reine Optik, um den Kranken zu beeindrucken. Er schickte Thalia mit der fertigen Mischung im Tiegel hinaus, damit sie sie auf dem Herdfeuer erhitzte.
Nachdenklich drehte Trimalchio den Kopf zu seinem Leibsklaven, der mit übereinandergelegten Händen und leerem Blick an der Wand stand. Es würde ihm leid tun, ihn zu verlieren, er war ein brauchbarer Bursche. Aber sein Tod würde ein Baustein in seiner eigenen Karriere sein. Möglicherweise könnte auch der Arzt nützlich sein. Der Grieche schien ein gutes Gespür für die Bedürfnisse eines ehrgeizigen Römers zu besitzen.
Thalia fand die Küche mit Hilfe ihrer Nase; der feine Faden eines duftenden Holzfeuers leitete sie in den gegenüberliegenden Flügel des Hauses. Eine ältere Sklavin sah ihr händeringend und mit vor Angst geweiteten Augen entgegen. »Wird der Herr sterben?« flüsterte sie.
Thalia, die Zeit genug gehabt hatte, den Strategen zu beobachten, schüttelte spontan den Kopf, bevor ihr einfiel, daß sie gewiß nicht befugt war, den Gesundheitszustand von Kranken zu beurteilen. Aber es war zu spät.
Die Küchensklavin schlug die Hände vor ihr faltiges Gesicht. »Gaius wird leben, Ceres, Herrscherin über Leben und Tod, sei Dank.«
Thalia fühlte sich sofort mit ihr verbunden. Ceres war der römische Name für Demeter, der sie selber anhing. »Ihr hängt sehr an eurem Herrn«, sagte sie staunend. »Er muß ein guter Herr sein.«
Die alte Frau ließ verwundert ihre Hände nach unten sacken. »Gaius ein guter Herr? Wenn auch nur ein Krümelchen von Verdacht auf Gift zurückbleibt, läßt er uns alle foltern. Und weißt du, was dann passiert? Jeder schiebt einem anderen die Schuld in die Schuhe. Die meisten aber meinem Sohn Fabianus, denn der mischt dem Herrn den Wein.«
»Ist dein Sohn ein junger Mann mit auffallend schmalen Schultern, der im Schlafzimmer Dienst tut?«
Die Frau nickte. »Sein Leibsklave. Er ist nicht der Kräftigste, aber er hat einen hellen Kopf. Deswegen hat er auch die meiste Angst.«
»Wenn es so ist«, sagte Thalia, »will ich euren Römer lieber nicht auch noch verbrühen.« Sie nahm den Tiegelgriff mit einem Zipfel ihres Chitons und trug ihn am Wasserbecken vorbei ins Krankenzimmer.
Leptinos sah Thalia ungeduldig entgegen, entriß ihr den dampfenden Sud, blies darüber, stützte selber den Römer hoch und hielt ihm die Schale an die Lippen. »Indisches Lykion gilt als das Wirksamste«, plauderte er, indes Trimalchio die Lippen spitzte und geräuschvoll schlürfte. »Es wirkt sehr schnell.«
Trimalchio schlug die Augen auf und sah den Arzt dankbar an. »Ich bin sicher, daß die Bäder den letzten Rest der Giftwirkung verschwinden lassen werden.«
»Eine Decke«, befahl Leptinos und bellte: »Eine römische aus Wolle, keine ägyptische!«
Fabianus schrak zusammen und rannte los. Nach einer Weile kam er mit einer Decke zurück, die einen Ziegenhirten im Taurusgebirge gewärmt hätte.
Behutsam wickelte Leptinos den Römer bis zum Hals ein. Dann ging er in den Patio und erteilte laute Befehle, daß man ihm Wasser erhitzen möge. Seine Stimme wurde leiser, als er in die Küche trat, und Cornelia Tertia mischte sich wieder ein. Der Stratege lauschte und nickte allmählich ein.
Er atmete regelmäßig und sah überhaupt nicht sterbenskrank aus. Eher wie ein Faun im Schafspelz, der erfolgreich Nixen geärgert hat. Aber er glaubte an ein Gift. Thalia holte tief Luft. Ihr Blick ging zu Fabianus hinüber, der wieder an der Wand stand und nervös auf seiner Unterlippe nagte. Er wußte Bescheid.
Nach einiger Zeit klatschten Füße auf den Steinen, und vier Haussklaven schleppten zwei schmale Wannen herein. Leptinos folgte ihnen.
»Hierhin, schnell!« befahl der Arzt und ließ die Wannen auf zwei Scherenhockern abstellen und zurechtrücken. »Merke dir die Wärme, die ich für diese Anwendung benötige, Thalia.«
Willig hielt Thalia ihren Finger ins Wasser, bevor Leptinos behutsam die Füße des Römers anwinkelte und ins Heilbad stellte, dem ein Duft verschiedener Arten von Kräutern entströmte.
Nach genau bemessener Zeit ließ Leptinos die Wannen und die Hocker entfernen, trocknete nach dem Rhythmus einer Musik, die nur er hörte, die Füße des Römers und deckte sie anschließend sorgfältig zu.
Als sie sich auf Zehenspitzen aus dem Raum stahlen, schlief der Oberrichter schon wieder. Thalia sah als letztes, wie sein Sklave ihm mit einem gewaltigen Strauß von Vogelfedern Luft vor die blubbernden Lippen fächelte.
Die ungewohnte Mittagshitze draußen trieb Thalia den Schweiß auf die Haut, zumal die Kästen ziemlich schwer waren. Dankbar sah sie, daß Leptinos auf den schattigen Arkadenbogen eines prächtigen griechischen Gebäudes zusteuerte. Er warf einem kleinen Ägypter eine Münze zu, und Thalia setzte die Kästen auf einem Sims ab.
»Wenn es wirklich Gift war«, begann sie nachdenklich, »warum läßt man dann den Sklaven mit dem Herrn allein, den er angeblich vergiften will?«
Leptinos machte eine angeekelte Grimasse, was den ägyptischen Wasserverkäufer zu einem lautstarken Protest veranlaßte. Sein Wasser war frisch und der Kunde nur Grieche. Leptinos gebot ihm mit einem unwilligen Knurren Schweigen. »Der Römer leidet an nichts außer an den Nachwirkungen eines dionysischen Gelages«, sagte er zu Thalia.
»Warum hast du ihn dann in seiner Meinung bestärkt, er sei vergiftet worden?« fragte Thalia betroffen.
Leptinos trank in kleinen Schlucken. Das Wasser war angenehm kühl und ohne jeden Beigeschmack. Wernero würde der kleinen Wilden beibringen müssen, daß eine Sklavin von ihrem Herrn keine Rechenschaft fordert. Er betrachtete Thalia halb verärgert, halb amüsiert.
Als sie die Hoffnung auf eine Antwort aufgegeben hatte und die Kästen wieder in die Arme nahm, antwortete Leptinos.
»Es war nicht die Meinung des Strategen. Es war die für die Öffentlichkeit bestimmte Erklärung für ein Besäufnis. Ich habe ihm beigepflichtet. Er und das Römische Reich werden es mir danken.«
Thalia ließ um ein Haar die Kästen wieder fallen. »Dafür wird der junge Mann sterben müssen«, stammelte sie.
»Welcher junge Mann? Ein Sklave wird sterben«, versetzte Leptinos. Blinzelnd trat er auf die schattenlose Straße. Es wurde höchste Zeit, das iatreion zu erreichen. Niemand von Rang ließ sich jetzt noch draußen sehen.
Nach einigen Wochen hatte Thalia sich eingelebt. Das große Anwesen mit Wohn- und Behandlungsräumen, Liegehalle, Küchenhaus, Teich und Laubhütte vereinte alle Annehmlichkeiten einer griechischen Tempelanlage mit denen eines begüterten ägyptischen Privathauses. Allerdings gab es nach Thalias Meinung Arbeit für mehr Hände, als vorhanden waren. Der einzige ägyptische Gärtner kroch wie eine Schnecke durch den Garten, mit viel Liebe zu einzelnen Pflanzen und einer unendlichen Geduld, wenn es galt, eine Blume zum Blühen zu bringen. Aber für Hunderte andere fehlte ihm die Zeit. Nur Thalia schien es aufzufallen.
Warum Leptinos nicht mehr Sklaven besaß, wagte sie ihn nicht zu fragen. Als Grund vermutete sie Geldmangel und fehlende Kreditwürdigkeit bei den Verleihern. Oder fehlendes Interesse.
Thalia hatte inzwischen festgestellt, daß Leptinos ziemlich unordentlich war. Es mangelte an vielem, vor allem an chirurgischen Instrumenten. Dagegen waren Schüsseln in Hülle und Fülle da, in denen Aderlaßblut aufgefangen wurde. Sie hatte schon zweimal Gelegenheit gehabt, sie auszuleeren und zu putzen, und sie fand es gräßlich.
Beim ersten Aderlaß ihres Lebens starrte sie fassungslos in den Schaum, dessen Rot sich mit dem Kupfergrün des Gefäßes vermengte. Als Leptinos die schwarze Manschette zum Abbinden der Ader versehentlich hineinrutschte, tauchte die schwarze palla ihres Vaters aus ihrer Erinnerung auf.
»Verzeihung, o ihr Gesegneten!« brüllte Tjelptah, so laut er konnte.
Als nächstes spürte Thalia einen gewaltigen Fußtritt in ihrem Hinterteil. Sie lag auf dem Boden inmitten von Blutklumpen, und Tjelptah blickte strahlend auf sie herunter.
»Sie befleckt den Marmor. Beseitige sie«, befahl Leptinos mit kalter Stimme.
»Wegfegen?« fragte der Ägypter entzückt.
Aber Thalia rappelte sich von selber auf und machte sauber. Da sie fortan weder die Scham des Versagens zu empfinden noch Tjelptahs kräftige ägyptische Zehen in ihrem rückwärtigen Körperteil zu spüren wünschte – ganz zu schweigen davon, daß sie das gerinnende Blut aufwischen mußte –, gelang es ihr, beim zweiten Aderlaß mit zusammengebissenen Zähnen und bebenden Händen an der Abfallgrube anzulangen.
Trotz dieser Schüsseln und trotz des Blutes war ihr der Behandlungsraum der liebste des iatreions. Keinem außer Leptinos stand es zu, sie daraus zu verjagen. Sobald er sich abends zu seinem Privatleben außer Haus begab, mindestens an einem Abend in der Woche, setzte Thalia sich vor das Regal mit den Buchrollen.
Es waren hauptsächlich Abschriften der Werke von Soranos. Ganz unten lagen die Anleitungen zur Geburtshilfe und Säuglingspflege. Diese nahm Thalia sich am liebsten vor, knabberte dabei stibitzte Sonnenblumenkerne und klapperte hin und wieder mit den Schüsseln. Sie kannte nur einen Menschen, der vor Blut größere Abscheu als sie selber hatte: Tjelptah.
Seine Mutter wagte sich nie ins Haus, und Thalia war froh darüber. Aus Wernero wurde sie nicht schlau. Sie verfolgte sie aus dem Küchenhaus heraus mit verbissener, tückischer Miene. Sicherheitshalber machte Thalia einen weiten Bogen um die Ägypterin.
Manchmal, meistens mittags, wenn die Hitze am größten war und die Kranken zu Hause ruhten, lief sie zum Kanal, der, wie sie inzwischen wußte, den Hafen mit dem Mareotis-See verband. Hier segelten oder wurden die kleinen Schiffe getreidelt, die Dinge des täglichen Lebens aus Ägypten und Äthiopien nach Alexandria brachten. Einmal sah sie ein Floß, das aus lauter Töpfen und Krügen bestand; sechs Männer balancierten auf darübergelegten Brettern und lenkten das ungefüge Ding mit Baumästen. Ein anderes Mal kam eine ganze Flotte von Schiffen mit Bienenkörben vorbei. Sie waren waagerecht gestapelt, und um ihre Enden summten Bienen.
Eines Tages fing eine Gruppe von Ägyptern ihre Aufmerksamkeit ein. Mit langen Röcken bekleidet, trugen sie ihren Gott zum Kanal hinunter, angeführt von ihrem Priester, der rückwärts einherschritt. Von Zeit zu Zeit erhob er seine Stimme zu einem tragenden Gesang, dessen Text er von einer Papyrusrolle ablas. Fasziniert starrte Thalia hin, bis das letzte Fädchen der Räucherfeuer neben dem Treidelpfad verweht war. Erschrocken merkte sie, daß sie sich verspätet hatte.
Als sie sich wieder in den Behandlungsraum zurückschlich, war sie auf eine Bestrafung gefaßt, weil sie die gewaschenen Leinenstreifen noch nicht zusammengerollt hatte. Aber Leptinos stand mitten im Raum, betrachtete die leeren Wände mit den unbenutzten Haken und knetete gedankenvoll seine Fingergelenke. »Wir müssen meine Instrumente holen. Die alten sind jämmerlich. Mach dich fertig und rufe auch Tjelptah.«
Thalia nickte erleichtert und machte sich auf die Suche nach dem Jungen. Als sie in das Küchenhaus hineinschaute, war dort nur Wernero, die Maische durch ein Sieb in den Bierbottich preßte.
»Was willst du, Rote?« knurrte die Ägypterin, deren Sicht zwar durch den herabhängenden Zipfel eines schwarzen Kopftuches eingeschränkt war, die sich aber trotzdem Thalias Anwesenheit bewußt war. Um die Ausländerin schnell wieder loszuwerden, sprach sie Griechisch, obwohl darauf nur der Gebieter Anspruch hatte. Diese Mißgestaltete ließ den Ärger ansteigen wie das Wasser des Nils: Sie lenkte die Gunst des Gebieters von ihrem Sohn ab. Obendrein sollte sie auf seine Anordnung auch für die Rote kochen und Bier brauen. Nun, sie würde ihr nur das schäumende, schlechte zukommen lassen. Wernero öffnete ihren breiten Mund mit den vollen Lippen und lachte unbekümmert.
»Leptinos braucht Tjelptah«, sagte Thalia, als Wernero endlich das Kopftuch auf den Rücken warf und sie aus ihren dunklen, mandelförmigen Augen ansah. An einem Ohrläppchen baumelte ein breiter Goldring.
Wernero liebte zwei Männer auf dieser Welt: ihren Sohn und den Gebieter. Sie konnte wie ein oberägyptischer Panther werden, wenn sie in Wut geriet. »Für dich ist der Herr der Gebieter, du, du ...« Sie verschluckte den Rest ihrer Beschimpfung. Womöglich würde die Rote sich rächen.
»Hier bin ich«, rief Tjelptah und tauchte mit einer lebenden Gans unter dem Arm hinter Thalia auf. Das Tier war groß und fett und sein Schnabel mit den Füßen zusammengebunden.
»Der Herr braucht dich, um seine Instrumente zu tragen«, erklärte Thalia geduldig.
»Aber er hatte mir erlaubt, heute im Tempel ein Brandopfer zu entzünden.« Auf dem großflächigen Gesicht des Jungen zeichnete sich Enttäuschung ab. Er sah seiner Mutter sehr ähnlich; auch bei ihm lagen die Wangenknochen weit auseinander, und das Kinn lief spitz zu; seine Haut jedoch war heller als ihre.
Wernero schüttelte verstört den Kopf und mied es ängstlich, der Roten auf den Mund zu schauen. Seitdem sie da war, geriet alles durcheinander, selbst fromme Handlungen störte sie. Sie war bösartig wie eine Gazelle und eine wandelnde Verhöhnung des Hasengottes von Werneros Heimat in Mittelägypten. »Du mußt gehen, wenn der Gebieter ruft«, sagte sie in ihrem heimatlichen Dialekt und strich ihrem Sohn zärtlich die einzelne Locke glatt, die ihm bis auf die Schulter hinunterreichte. »Beachte die Rote einfach nicht.«
Unter halb geschlossenen Augenlidern spähte sie den beiden auf ihrem Weg zum Vorderhaus nach. Sie war sehr stolz auf Tjelptah und dankbar für die Liebe, die der Gebieter ihm entgegenbrachte. Und der Roten würde sie zeigen, wo ihr Platz war.
An diesem Tag ging es auf den Straßen noch lebhafter als sonst zu. Auf einem kleinen Platz, an dem sich zwei Straßen kreuzten, mußten sie sich ihren Weg durch eine Volksmenge bahnen, die einem griechischen Rhetor lauschte. Er stand auf der leeren Ladefläche eines Karrens und warf zu seinen Worten abwechselnd die Hände und die Zipfel seines langen Gewandes in die Höhe. Seine scharfe Zunge in heimatlich klingendem Griechisch richtete sich gegen die Römer. Thalia hätte ihm gerne zugehört.
»Gefährliches Geschwätz«, murrte Leptinos und schob die Leute mit beiden Armen beiseite, um sich Platz zu verschaffen.
»Beeile dich, du Eselin«, zischte Tjelptah hinter Thalia. »Der Gebieter schaufelt nicht wie ein Wasserrad von Faijum, damit du dich ausruhst.« Er schob Thalia vorwärts. Sie spürte die harte Spitze seines Knüppels zwischen den Schulterblättern.
Aber sie kümmerte sich nicht um ihn. Das Gemurmel der Griechen hinter ihnen ging im Rattern von zweiräderigen Wagen auf dem holperigen Boden unter, als sie in das ägyptische Alexandria eintauchten.
Männer mit nackten braunen Oberkörpern feuerten mit ihren Rufen die Esel an und klatschten ihnen auf die Hinterbacken. Ägypterinnen schritten mit Wasserkrügen auf den Köpfen an ihnen vorbei. In den Seitengassen standen Hütten aus luftig geschichteten Lehmziegeln mit Dächern aus Stroh; kleine nackte Kinder hockten in den Türöffnungen und richteten ihre staunenden Augen auf die hellhäutige Frau.
Thalia blieb stehen, um ein Taubenhaus mit vielen offenen Tonröhren zu betrachten, das wie ein Kegel in einem winzigen Garten aufragte.
Tjelptah legte ihr seine Hand auf die Schulter. »Du brauchst dich nicht zu fürchten, auch wenn der Gebieter nicht mehr zu sehen ist. Er erwartet, daß ich dich beschütze wie ein älterer Bruder, und das werde ich tun.« Er genoß die Achtung und die Bewunderung, die ihm von den herbeilaufenden Kleinen entgegengebracht wurde. Thalia ließ ihm seinen dummen Triumph. Er war noch ein Kind.
Plötzlich warf Tjelptah das Bündel, das wie ein Futtersack am Knüppel über seiner Schulter hing, auf die Erde. Er ließ sich auf den Knien in den Staub fallen und die ganze Kinderschar mit ihm. Thalia sah verdutzt auf die wolligen Köpfe hinunter, bevor sie sich umdrehte.
Ein kahlköpfiger Priester näherte sich mit langen, gleitenden Schritten. Ihm folgten Männer und Frauen in tiefer Andacht, die einem in weißes Leinen gehüllten Gegenstand galt. Tjelptah sagte mit seiner hellen Stimme: »Danke dem Schöpfergott Chnum, er lebe, sei heil und gesund, damit er dich liebt. Deine eigenen Götter haben hier keine Macht.«
Es gab keinen Grund, einem fremden Gott die Achtung zu versagen, und so sank Thalia neben Tjelptah auf die Knie. »Tragen sie den Gott Chnum mit sich?« flüsterte sie und fügte respektvoll wie Tjelptah hinzu: »Er lebe, sei heil und gesund«, damit der Junge keinen Grund fand, ihr die Antwort wieder zu verweigern.
Erstaunt riß Tjelptah bei ihrer Frage die Augen auf und versuchte vergebens, sein Kichern zu unterdrücken. Thalia ließ sich davon anstecken, während sie das längliche Bündel auf den Schultern der Frommen neugierig betrachtete. Hinter sich hörte sie unbestimmbare Geräusche, näher an Lachen als an Weinen.
Der Priester strebte unberührt davon den wuchtigen Eingangssäulen eines Tempels entgegen; aber sein Gefolge war wegen der kindlichen Respektlosigkeit tief bestürzt. Der Mann mit dem heiligen Gegenstand zischte Tjelptah in loderndem Zorn eine Beschimpfung ins Gesicht. Sein Kopf war wie der des Priesters geschoren, aber seine Kopfhaut war blau eingefärbt. Thalia sah ihm erschrocken nach.
Erst als die Gläubigen das Heiligtum durch einen schmalen Eingang zwischen den hohen Säulen betreten hatten, konnte Tjelptah sein krampfartiges Lachen beenden. Er brach in Tränen aus, die ihm zwischen den Fingern hindurchtropften, während Thalia ihn fassungslos beobachtete. »Du bist roh und ohne Sitte wie das Meer, hinter dem dein Elternhaus steht«, preßte er schließlich schluchzend heraus. »Du weißt nichts. Chnum, er lebe, sei heil und gesund, verläßt sein Heiligtum nur an seinem Fest. Sein Priester beerdigt heute einen Widder, der Chnum heilig ist. Aber du lachst in der Gegenwart des unsichtbaren Gottes!«
Tjelptah hatte zuerst gelacht, aber Thalia hatte nicht das Herz, ihn darauf aufmerksam zu machen. Schweigend erhob sie sich und strich sich den gelben Sand von den Knien.
Leptinos' weiße Chlamys leuchtete an der nächsten Ecke, und für kurze Zeit sah Thalia seine winkende Hand. Sie packte Tjelptah am Rockbund und zog ihn mit sich, bis sie in eine Straße einbogen, die vom blechernen Lärm der Metallhandwerker widerhallte.
»Wo bleibt ihr nur?« fragte Leptinos ungehalten. »Der Instrumentenmacher verliert jeden Respekt vor mir, wenn ich ohne meine Sklaven ankomme, und jedes Zutrauen zu meinem Geldbeutel, was für ihn vielleicht viel entscheidender ist.«
»Aber Gebieter«, sagte Tjelptah und blickte strahlend zu ihm auf, »dein Ruhm macht Unterägypten hell. Er wird sich hüten, dir minderwertige Messer anzudrehen!«
»Meinst du?« fragte Leptinos, lächelte zärtlich und drückte einen schnellen Kuß auf Tjelptahs Stirn. Dann überquerte er die Straße, um einige Häuser weiter unter den beschatteten Bogen einer Werkstatt zu treten.
Thalia drängte sich neben ihn in das Gewölbe. Draußen mußte Tjelptah die Fragen des benachbarten Handwerkers beantworten; als sie das Wort für rot verstand, wußte sie, daß der Mann sich als erstes nach ihr erkundigt hatte. Die Roten, das waren alle weißhäutigen Fremden.
»Hast du die Instrumente endlich fertig, Mose?« Leptinos ließ seine Unzufriedenheit deutlich heraushören.
Der Handwerker, ein dünner Mann mit sehnigen kräftigen Armen, ließ sich nicht nervös machen. »Schon lange, ehrwürdiger Leptinos, Herr des Unwohlseins«, sagte er in beschwichtigendem Ton und brachte mit den verwirrenden Gesten eines Magiers mehrere Kästen zum Vorschein, deren Deckel er aufschlug. »Genau, wie du sie bestellt hast«, sagte er, nicht ohne Stolz.
Leptinos holte einen spatelförmigen Messergriff aus einer paßgenauen Aussparung in dem dunklen Edelholz des Kastens. Das Gold und Silber der Einlegearbeit funkelten, als er den Griff in seiner Hand wog und ihn dann prüfend mit ganzer Handfläche umschloß. »Ausgezeichnet«, lobte er und sah erneut in den Kasten. »Brustförmige Klinge, schmale gerade, schmale gekrümmte, einschneidig, zweischneidig, myrtenblattförmig ... Ich sehe, du hast alles berücksichtigt.«
Der Handwerker nickte zufrieden und legte Leptinos wortlos ein weiteres Kästchen vor.
Leptinos runzelte beim Anblick des sichelförmig gebogenen Schneidwerkzeuges mit ganz glattem Griff die Stirn. »Das habe ich nicht bestellt«, sagte er in abweisendem Ton. »Ich beabsichtige nicht, ungeborene Kinder zu zerstückeln. Ich befasse mich nicht mit Frauenangelegenheiten.«
Mose nickte. »Der gelehrte Soranos von Ephesos hatte es bestellt, aber es war vor seiner Abreise nicht fertig geworden. Es hätte sein können, daß du ...«
»Dann schicke es ihm nach«, unterbrach Leptinos ihn kurzangebunden. »Ich verwende auch keine Instrumente, die aussehen, als könnte ich mir keine ordentlichen leisten.«
Der alte Mann zuckte zusammen. »Meister Soranos wollte sie so ...« murmelte er und strich zärtlich über das polierte Holz.
Leptinos wandte sich gleichgültig von ihm ab und rief Tjelptah herein. Während der Junge die Kästen zwischen sich und Thalia aufteilte, feilschte Leptinos beleidigend kurz um den Preis und verließ wenig später die Werkstatt mit Tjelptah auf den Fersen.
Thalia zögerte auf der Schwelle und kehrte zu Mose zurück. »Warum wollte Meister Soranos die Griffe so und nicht anders haben?« fragte sie leise.
Der Mann betrachtete das fremdartige junge Mädchen mit Scheu. Es war leicht zu erkennen, daß sie unter dem Schutz des Hasengottes vom fünfzehnten Gau stand, dessen Hauptstadt von Toth, dem Gott des Heilwesens, regiert wurde. Ganz gewiß war es ihr vorbestimmt, mehr über die Instrumente des Soranos zu erfahren, der ein Liebling von Toth war. Er neigte ehrerbietig seinen Kopf. »Meister Soranos verlangte, daß seine Instrumente makellos glatt und blank sein sollten. Griffe mit Bändern und Rillen warf er durch meine Werkstatt, daß ich um mein Leben fürchten mußte. Einmal ...« Mose verstummte und lächelte vor sich hin.
»Einmal ...« drängte Thalia.
Mose lachte sie an. »Mein Nachbar hatte gerade einen Fisch abgewogen und ihn mir hingelegt. Da schlug Meister Soranos die Schneide bis zum Heft in den Karpfen. Siehst du, was ich meine? brüllte er und zeigte auf die Einlegearbeiten, als er es wieder herausgezogen hatte. Willst du, daß deine Gedärme zwischen Elfenbein und Silberfäden hängenbleiben? Das war das einzige Mal, daß ich Meister Soranos habe laut werden hören. Damals war ich zu Tode erschrocken ... Ich glaube, er hatte gerade bei der Ärzteversammlung versucht, den anderen das auszureden, was er als Eitelkeiten bezeichnete. Er war schon wütend, als er hier ankam.«
Thalia nickte. Irgendwie verstand sie die Bewunderung des alten Handwerkers für einen Mann, der mit Leib und Seele Arzt war.
»Aber noch wichtiger war ihm die Schneide selbst«, fuhr Mose fort und zwinkerte sich die Erinnerung aus den Augen. Mit Soranos war auch ein Teil seines Lebens vergangen. »Er fand immer noch eine Unregelmäßigkeit, die man nur mit dem geschliffenen Smaragd erkennen konnte, den er am Hals trug. Ich mußte sie bearbeiten, bis er zufrieden war. Altes Fleisch ist giftig, sagte er immer. Es bleibt in den Scharten liegen, ohne daß man es sieht.«
Thalia stellte die Kästen vorsichtig auf den Boden. Sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, die kühle Glätte des Stahls selber unter den Fingern zu spüren. »Ich verstehe, was er meint«, murmelte sie nachdenklich. Das Gedärm konnte sich in den Scharten der Säuberung entziehen, dort faulen und zu Gift werden. Laut sagte sie: »Ein wunderschönes Instrument. Deine Hände muß Asklepios geführt haben.«
Mose lächelte wie über ein kostbares Geschenk, das sie ihm gemacht hatte. »Dein Gebieter weiß meine beste Arbeit nicht zu schätzen; ich dachte es mir schon vorher. Aber ich würde mich freuen, wenn du das Messer von mir als Geschenk annehmen würdest.«
Das Messer wurde schwerer in Thalias Hand, je länger sie es betrachtete. Eine Kostbarkeit, die er für viel Geld verkaufen konnte. Mit einem tiefen Seufzer war sie drauf und dran, es ihm zurückzugeben. Und dann sah sie ihm in die Augen. »Ich danke dir«, stammelte sie.
Verwirrt grübelte sie darüber nach, warum er sich so tief verbeugte. Sie war reich beschenkt worden, aber Mose schien es umgekehrt zu sehen.
Immer noch in Gedanken, befand sie sich auf einmal neben der Abzweigung eines gewundenen Gäßchens, als sie bemerkte, daß die eben noch lebhafte Straße der Schmiede jetzt wie leer gefegt war. Leptinos und Tjelptah waren fort.
Beunruhigt sah sie sich um. Gebannt folgte sie mit den Augen einer Hand, die aus der Schwärze eines Gewölbes heraus eine kräftige Kette um ein hölzernes Gatter legte. Alle anderen Werkstätten waren bereits gesichert. Als die Hand verschwand, merkte sie, daß auch das metallische Klingen von Kupfer und das Klopfen von Holzschlegeln auf Papyrusmark verstummt waren.