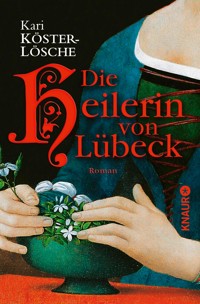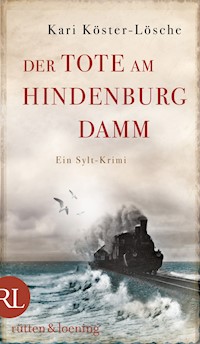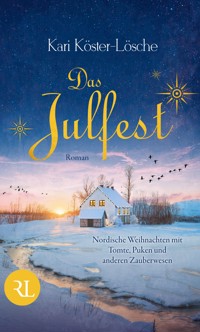Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aufstieg und Fall einer Rostocker Reedereifamilie – "Die Reeder" von Kari Köster-Lösche jetzt als eBook bei dotbooks. Rostock, Ende des 19. Jahrhunderts: Als sein Vater plötzlich stirbt, ist Hans Brinkmann nicht nur für das Wohl seiner Familie verantwortlich, sondern auch Alleininhaber einer der erfolgreichsten Reedereien Deutschlands. Zwischen wirtschaftlichen Zwängen und den Schrecken des 1. Weltkriegs muss Hans die richtigen Entscheidungen zum Wohle aller treffen. Trotz des Misstrauens, das ihm sogar aus seiner eigenen Familie entgegenschlägt, will der junge Mann um jeden Preis das Erbe seines Vaters bewahren. Auch die Stellung der Brinkmanns in der Rostocker Gesellschaft hängt davon ab – und damit die Zukunft seiner Kinder. Die Chronik einer Familie – wie ein altes Fotoalbum, bei dem sich hinter jeder Porträtaufnahme und den sorgfältig inszenierten Gruppenbildern Geheimnisse und Intrigen, Skandale und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbergen. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Reeder" von Kari Köster-Lösche. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rostock, Ende des 19. Jahrhunderts: Als sein Vater plötzlich stirbt, ist Hans Brinkmann nicht nur für das Wohl seiner Familie verantwortlich, sondern auch Alleininhaber einer der erfolgreichsten Reedereien Deutschlands. Zwischen wirtschaftlichen Zwängen und den Schrecken des 1. Weltkriegs muss Hans die richtigen Entscheidungen zum Wohle aller treffen. Trotz des Misstrauens, das ihm sogar aus seiner eigenen Familie entgegenschlägt, will der junge Mann um jeden Preis das Erbe seines Vaters bewahren. Auch die Stellung der Brinkmanns in der Rostocker Gesellschaft hängt davon ab – und damit die Zukunft seiner Kinder.
Die Chronik einer Familie – wie ein altes Fotoalbum, bei dem sich hinter jeder Porträtaufnahme und den sorgfältig inszenierten Gruppenbildern Geheimnisse und Intrigen, Skandale und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbergen.
Über die Autorin:
Kari Köster-Lösche, 1946 in Lübeck geboren, Tierärztin und Geschichtsexpertin, hat einen Großteil ihrer Jugend im schwedischen Uppsala, dem Zentrum der nordischen Kultur, verbracht. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Nordfriesland.
Ebenfalls bei dotbooks erscheinen folgende Romane:
Die Wagenlenkerin
Die Heilerin von Alexandria
Der Thorshammer. Band 1 der Wikinger-Saga
Das Drachenboot. Band 2 der Wikinger-Saga
Die Bronzefibel. Band 3 der Wikinger-Saga
***
Neuausgabe Oktober 2015
Copyright © der Originalausgabe 1999 Verlagshaus Goethestraße GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/seamartini Graphics
ISBN 978-3-95824-189-3
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Reeder an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Kari Köster-Lösche
Die Reeder
Roman
dotbooks.
Inhalt
Teil I: Der Lehrling Brinkmann
1. Kapitel, 1822/23
2. Kapitel 1825
3. Kapitel 1826-1828
4. Kapitel 1829-1831
5. Kapitel 1832-1834
6. Kapitel 1835
7. Kapitel 1836/37
Teil II: Die Werft und Reederei
8. Kapitel 1837-1841
9. Kapitel 1842-1848
10. Kapitel 1850
11. Kapitel 1853-1856
12. Kapitel 1857-1859
13. Kapitel 1865
Teil III: Die Söhne
14. Kapitel 1866-1871
15. Kapitel 1872-1877
16. Kapitel 1888-1889
17. Kapitel 1889-1890
18. Kapitel 1890-1924
Literatur
Teil I: Der Lehrling Brinkmann
1. Kapitel (1822/23)
Friedrich Wilhelm schäumte vor Wut. Erstens hatte sein Vater ihn schon wieder ausgescholten, obwohl er nicht schuld hatte, und zweitens sah er im Vorübergehen, wie sein kleiner Bruder Johann sich schon wieder an der Puppe von Catharina zu schaffen machte. Johann, mit nacktem Hinterteil, kniete auf dem Boden, vor sich das nur noch dürftig angezogene Püppchen von Catharina, stemmte mit der einen Hand den Hals nach hinten und bohrte mit dem Daumen der anderen Hand im groben Stoff, der das Bäuchlein bedeckte. Mit leisem Ratschen zerriß es, und Stroh quoll heraus.
Friedrich Wilhelm trat zu, von hinten, ohne Vorwarnung, mit Genuß und ohne sich zu schämen, denn er war erst sechs Jahre alt. Wenn es um solche Dinge ging, stand er selten auf der Seite von Johann, einem der Zwillinge. Johann, gerade vier Jahre, flog nach vorne. Verblüfft rieb er sich die Stirn, dann sah er sich um, wußte wohl nicht, was seinen Sturzflug verursacht hatte. Erst jetzt erblickte er seinen Bruder.
»Mutter! Mutter!«, brüllte er aus Leibeskräften.
»Halt’s Maul!«, fauchte Friedrich Wilhelm und gab ihm eine Maulschelle.
Aber es war bereits zu spät. Die Mutter, noch blasser als sonst, stand bereits hinter ihm, schob ihn unsanft beiseite und hob den kleinen Jungen auf. Johann, sicher in ihrem Arm, streckte seinem Bruder über die Schulter der Mutter die Zunge heraus.
»Mußt du denn immer Streit machen?«, seufzte Abigael Brinkmann und sah ihren ältesten Sohn anklagend an. »Ich weiß ja, daß du es gut meinst, aber in letzter Zeit häuft es sich so. Bitte Friedrich Wilhelm, um meinetwillen ...« Sie strich ihm über das Haar. Er schüttelte die Hand seiner Mutter mit einer wilden Bewegung ab.
»Ich mache keinen Streit«, fauchte er. »Merkst du denn nicht, daß Johann das mit Absicht macht? Nicht nur heute. Jedesmal!«
»Nein, gewiß nicht«, versuchte seine Mutter ihn zu beruhigen. »Und du machst mir das Leben so schwer, selbst wenn es gut gemeint ist.« Ohne Friedrich Wilhelm weiter zu beachten, verließ sie das Zimmer und ging wieder in die Küche, wo der Zwillingsbruder von Johann, Christian, auf dem Boden zu Füßen von Catharina mit zwei vertrockneten Kastanien spielte. Die beiden wenigstens waren friedlich. Abigael seufzte unhörbar. Ihre so verschiedenen Kinder vertrugen sich manchmal schlecht. Catharina, die Kartoffeln schälte, sah zur Mutter auf, sagte jedoch nichts.
»Fein«, sagte Abigael und lächelte sie an. Catharina trug die Schalen hauchdünn ab, wie sie es ihr gesagt hatte. Sie machte immer, was man ihr sagte. Pauline dagegen war dafür nicht geeignet. Großzügig in allem, in der Kleiderordnung wie im Handeln, wanderten bei ihr die halben Kartoffeln in den Abfall, wenn nur ein schwarzes Stippchen an der Schale war. Sie vor allem war es, die sich nicht an die seit zwei Jahren verschlechterten wirtschaftlichen Verhältnisse im Land gewöhnen konnte.
Abigael Brinkmann hockte sich vor den Herd, wich wie gewohnt dem herausquellenden Rauch aus und schob einige Scheite Holz nach, damit das Wasser im großen Topf endlich kochen konnte. An Riga, Petersburg und Turku hatte sie früher gedacht, an die Orte, von denen ihr Vater erzählte, wenn er zwischen seinen Seereisen nach Hause kam und zwei, drei Tage blieb. Am liebsten wäre sie von seinem Schoß überhaupt nicht gewichen, und ihr Vater hatte sie nach Meinung der Mutter über Gebühr lange dort oben behalten. »Setz dem Kind keine Flöhe ins Ohr«, hatte sie gefordert, »ein Mädchen geht nicht zur See, also laß sie in Ruhe.« Abigael aber war in seiner schützenden Umarmung zum Kapitän geworden, war durch die runden buckeligen Schären nach Stockholm gesegelt, hatte von dort den Weg um Schonen in nur zwei langen Schlägen geschafft, war mit Lotsenhilfe durch den quirlenden Sund gebraust und hatte schließlich in Gotenhafen Ladung übernommen, Holz natürlich, das dringend in Rostock gebraucht wurde. Und weil sie den Mut eines Walfängers und die List eines Seeräuberkapitäns mit der Tollkühnheit eines Wikingers vereinte, war sie gegen den Sturm nach Hause zurückgeflogen und hatte die höchsten Preise erzielt.
Ein Funke knallte aus dem Feuerloch und traf ihre Wange; sie schlug die Tür zu und erhob sich. Sie, die einst in ihrer Jugend so hochfahrend geträumt hatte, träumte nun schon lange nicht mehr. Sie hatte sich ans Bücken gewöhnen müssen. Dann lauschte sie in den kurzen Flur zwischen Zimmer und Küche. »Friedrich Wilhelm?«, fragte sie. »Bist du schon gegangen?«
Ihr Ältester stapfte in die Küche, mit trotzigem Gesicht. Er starrte auf seine Stiefel.
»Bitte«, sagte Abigael, und er ging endlich. Sie sah ihm nach, ihrem unendlich geliebten Sohn, der ihr in vielem so ähnlich war. Nicht besonders groß, aber sein gedrungener Körper wirkte bereits jetzt so verläßlich, daß sie ihn manchmal schon über seine Jahre hinaus forderte. Auch jetzt überforderte sie sein Verständnis. Ihr war durchaus klar, daß er Johann gegenüber recht hatte. Ihr Mann nannte es Starrsinn, wenn der Junge seine eigenen Wege ging und nicht bereit war, die Meinung anderer ohne Nachdenken zu übernehmen, besonders die von seinem Vater nicht. Und auch nur manchmal war er willens, überhaupt darüber nachzudenken. Einmal hatte Abigael ihn wie einen Hund knurren hören, als Friedrich darauf hinwies, daß seine, des Schmieds, Erfahrung alles Erproben und Versuchen seines Sohnes überflüssig mache. Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater bekümmerte sie. Aber sie gab Friedrich Wilhelm recht. Wann hätten jemals die Erfahrungen der Alten den Jungen einen Schmerz erspart?
Friedrich Wilhelm, in der kurzen Hose des noch nicht konfirmierten Jungen und mit langen braunen Strümpfen, weil es bitterkalt war, klapperte auf Holzschuhen hinaus in den Hof, wo der Vater ein Pferd beschlug, selbst genauso dampfend wie das Pferd. Nur dessen Besitzer dampfte nicht; mit energischer Hand ruckte er von Zeit zu Zeit am Zügel und stemmte dabei seine ganze Masse Lebendgewicht in das schon längst harte Maul des Kaltbluts. Das Pferd zerrte zurück.
»Was ist nun, Brinkmann?«, knurrte Dedow. Seine dröhnende Stimme veranlaßte das Pferd, ein Ohr nach vorne zu stellen, das andere immer noch fast flach nach hinten gelegt. In den Augen sah man das Weiße. »Geht’s nun, oder geht’s nicht?«
Brinkmann schwieg, hielt das heiße Hufeisen in das Schmiedefeuer, betrachtete es prüfend und schwenkte es endlich, warmrot, aus dem Feuer hinüber zum Pferd, wo es sich schmurgelnd seinen Platz suchte. »Geht«, bestätigte er bedächtig.
Friedrich Wilhelm drehte sich hastig weg. Dieser scheußliche Gestank von brennendem Horn brachte ihn jedesmal fast zum Erbrechen. Aber der Vater durfte es nicht sehen. Es machte ihn genauso weißglühend wie seine Hufeisen. Heute hatte der Junge kein Glück.
»Dein Ältester wird dir noch Freude machen«, spottete der dicke Dedow, Braumeister im nahen Rostock, und beobachtete den Jungen voll hämischer Freude. »Der kotzt den Gäulen vor die Füße. Wird eine schöne Schweinerei geben ...«
Der Schmied ließ sich nicht provozieren. Er ließ den Fuß des schweren Arbeitspferdes nach dem letzten Hammerschlag sinken und beobachtete, wie dieses den Huf tastend auf den gefrorenen Lehmboden setzte, zuerst mit der Vorderkante, dann mit der ganzen Sohle. »Führ ihn mal durch den Hof.«
»Stinken wird es gottserbärmlich«, stichelte Dedow weiter und setzte sich in Bewegung. »Wie auf einem Passagierschiff bei Sturm.« Friedrich Wilhelm fuhr herum und beobachtete den Mann gespannt. Was wußte der von Schiffen?
Der Vater zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Lieber mit einer alten Mähre über Land als mit einem neuen Schiff auf See«, antwortete er. »Auf ein Schiff setze ich meinen Fuß nicht.« Außerdem war es so undenkbar wie Schnee im Juli, daß der Sohn eines Kavalleristen aus der 8. schwedischen Brigade beim Anblick eines Pferdes kotzte. Er war sicher, daß Friedrich Wilhelm ihm diese Schande nicht ein weiteres Mal antun würde.
»Ich möchte wohl«, sagte der Junge sehnsüchtig, und sein Blick fand die Lücke zwischen dem Wohnhaus, der Schmiede und dem Stall für eingestellte Pferde, dort, wo er das Meer riechen und seinen Schimmer ahnen konnte, wenn der Tag sonnig, die Sicht gut war und die Sonne in seinem Rücken stand.
Der Vater lächelte grimmig. »Solange ich und der Graf etwas zu sagen haben, wird das wohl nichts werden.« Er räumte sein Handwerkszeug beiseite. »Mach sauber.«
Dedow ging, ohne sich umzusehen, den Kutschergaul am kurzen Zügel. Friedrich Wilhelm griff sich den Reisigbesen und begann die Hornspäne zusammenzukehren. Er sah verbissen zur Wetterfahne auf dem Dachfirst hoch – ein Pferd, das von einem Jungen gehalten und gerade beschlagen wird –, um nicht an die Schnipsel denken zu müssen, die wie erfrorene Finger auf dem Hof lagen, grau oder rötlich, gekrümmt, als habe es ihnen weh getan, abgeschnitten zu werden. Ob der eiserne Junge besser durchgehalten hatte? Der Geruch verbrannten Fleisches lag dick und träge im Hofraum, der neblige Frost drückte ihn hinunter. Friedrich Wilhelm stürzte zum Dunghaufen und übergab sich.
Zum Mittagessen waren sie alle beisammen: Vater Friedrich, Mutter Abigael, Pauline, die älteste Tochter, die in der Nähstube von Fräulein Gollnow das Nähen lernte und die bereits zehn Jahre war, die achtjährige Catharina, Friedrich Wilhelm und die beiden Zwillinge Christian und Johann. Hans Elias, der Fünfjährige, war nicht am Tisch. Die Mutter hatte ihn in das Ehebett gelegt und alle Decken über ihn gepackt. Trotzdem fröstelte ihn, daß er mit den Zähnen klapperte. Wenn Abigael dachte, daß er nun endlich eingeschlafen sei, schrie er wieder auf, und sie strich ihm mit der Hand über die heiße Stirn. Mehr konnte man nicht tun.
Weil der Vater in den letzten zwei Tagen Kundschaft gehabt hatte, gab es Kartoffeln mit Quark.
»Wir danken dem Herrn für seine Gnade. Amen«, sagte der Schmied unbeholfen, jedoch mit fester, christlicher Stimme.
»Amen«, wiederholte Catharina inbrünstig, mit gefalteten Händen und in die Ferne gerichtetem Blick. Die Aufmerksamkeit der Familie konzentrierte sich für einen Moment erneut auf Catharina. Der Vater betete mechanisch, sie aber war fromm, seit einiger Zeit zumindest. Catharina kehrte sofort mit schuldbewußtem Ausdruck in die Wirklichkeit zurück und suchte mit Blicken die Zustimmung des Vaters. Er wandte die Augen ab; er wollte nicht von seiner Tochter um Liebe angebettelt werden.
»Iß«, forderte er den Ältesten auf. Was die anderen Söhne werden würden, entzog sich seiner Vorstellungskraft, Friedrich Wilhelm aber als zukünftiger Schmied hatte seine Muskeln zu kräftigen. Friedrich dachte vorausschauend wie sein eigener Vater. Der hatte ihm die Schmiede vermacht; er war der Älteste gewesen. Genauso wollte er es handhaben. Er schob seinem Sohn eine Kartoffel zu. Friedrich Wilhelm aß heißhungrig aber gleichgültig.
Johann nahm gleich nach dem Vater, obwohl ihm das nicht zukam. Als der Vater wegsah, stibitzte er aus der Kartoffelschüssel. Um seine Mutter kümmerte er sich nicht, und sie sah weg.
Abigael versorgte stillschweigend Christian, der wie üblich träumte. Die Gabel in der Faust neben dem Teller, stand er am Tisch, geschubst und bedrängt von beiden Seiten durch die Geschwister, ohne es überhaupt zu bemerken. Seine tiefliegenden dunkelblauen Augen suchten außerhalb des Hauses nach einem Ziel, trafen aber nur die gegenüberliegende schmutzigweiße Hauswand. Da blickte er endlich auf seinen Teller.
»Mutter, sieht die Welt wie eine Kartoffel aus?«, wollte er wissen. »Kann angehen, vielleicht etwas bunter«, antwortete Abigael, und nach einem kurzen Seitenblick auf ihren strengen Mann tupfte sie etwas Molke auf die Kartoffel. »Hier«, sagte sie, »ist der große Ozean zwischen Europa und Amerika. Und hier der andere bei Australien. Und dieser winzige Klecks ist unsere Ostsee, im Vergleich zu den Weltmeeren nichts anderes als Fliegendreck – und doch so groß, wenn man drin ist.«
»Bist du schon mal auf einem Schiff gewesen, Mutter?«, fragte Friedrich Wilhelm atemlos, während Christian verzückt die Kartoffel anstarrte, die jetzt Weltkugel war.
Abigael nickte glücklich. »Manchmal«, sagte sie. »Manchmal. Ich habe in Gotenhafen Baumstämme aus-, in London Kohle eingeladen, genauso wie in Riga Getreide ...«
»Wirklich?« Friedrich Wilhelm blickte die Mutter an, als wäre es zum ersten Mal, und er sah weder die Strähnen, die ihr wie ungestriegeltes Pferdehaar ins Gesicht fielen, noch die dunklen Ringe unter ihren übergroßen blauen Augen, sondern seine wunderschöne Mutter, die sich in einen Seefahrer verwandelt hatte.
»Hör mit dem Unsinn auf!«, forderte Friedrich laut, wie immer tief gekränkt, wenn die Kinder mit offenem Mund an seiner Frau hingen. Er sorgte für das Brot; sie hatte die Liebe der Kinder und er allenfalls Respekt. »Märchen! Lügen, wenn man’s genau nimmt. Wann wärst du schon in Gotenhafen gewesen? Du sollst nicht lügen, spricht der Herr!«
Abigael und Friedrich Wilhelm sahen sich erschrocken an, und beide bekamen wieder ihr Alltagsgesicht. »Unser Leben ist schwer genug«, widersprach die Hausfrau leise. »Man muß ein bißchen träumen, um es erträglich zu machen. Ich glaube nicht, daß unser Herr Träume als Lügen ansieht.«
»Die Entscheidung, was Lügen und was Träume sind, wollen wir IHM überlassen. Wir können froh sein, daß wir es so gut haben«, sagte Friedrich mit schneidender Stimme. »Jeden Tag sollen wir Gott auf den Knien danken, daß wir zu essen haben, ein Haus und mehrere gesunde Söhne.«
»Amen«, sagte Catharina laut und fromm.
Abigael neigte zustimmend den Kopf, aber Friedrich Wilhelm erkannte zum ersten Mal mit unkindlicher Schärfe, daß sie zwar nachgab, sich jedoch nicht fügte. Ein harter Zug blieb um ihren Mund stehen.
Christian, der die ganze Zeit geschwiegen hatte, nahm vorsichtig seinen Holzteller zwischen beide Hände, drehte sich um und balancierte ihn fort.
»Wo willst du hin? Du hast noch nichts gegessen!«, sagte der Schmied, grollend wegen seiner widerspenstigen Familie.
»Ich muß sie in Sicherheit bringen«, antwortete Christian versonnen. »Ich will immer sehen können, wie es aussieht, wo ich hinwill. Sie kommt auf mein Bett.«
»Haben wir Kartoffeln zu vergeuden?«, schrie Friedrich erbittert. Er ergriff seinen Sohn am Ärmel, zerrte ihn zu sich heran, daß er über seine Füße stolperte, und stopfte ihm die weißbesprenkelte Erdkugel in den Mund. »Du mit deinen fixen Ideen, Abigael. Wenn du ihm einredest, der Dreck auf dem Boden wäre Goldstaub, sammelt er den noch auf.«
Christian aber dachte nicht an dergleichen. Zutiefst verstört stand er stocksteif und würgte an seiner Weltkugel. Man kann die Welt doch nicht essen, dachte er verzweifelt. Sie ist viel zu schön! Tränen tropften auf seine Hand, und der Vater wandte sich angewidert ab.
»Gib ihm noch etwas Meer«, sagte Friedrich Wilhelm zu seiner Mutter, »dann rutscht die Welt besser.«
Christian sah seinen Bruder mit tränennassen Augen dankbar an. Der verstand ihn wenigstens. Dann schaffte er es endlich, sich von dem Kloß im Hals zu befreien.
So unerfreulich ging es nicht bei allen Mahlzeiten im Hause Brinkmann am Küterbruch zu. Hin und wieder fühlte Abigael auch Dankbarkeit ihrem Mann gegenüber, dank dessen fleißiger Arbeit sie fast nie Not zu leiden hatten. Auch jetzt noch nicht, obwohl seit dem Erlaß des neuen Gesetzes die Verhältnisse nicht gerade rosig waren. Überall begehrten aus der Leibeigenschaft Entlassene Arbeit und Brot.
Manchmal aber ..., da platzte sie fast vor Zorn, daß sie nicht herauskonnte aus ihrer Haut, in die sie sich wie eingenäht fühlte wie eine Leiche auf See. Oh, wäre sie doch nur ein Mann gewesen! Heute aber fühlte sie, weder Dankbarkeit noch Zorn, sondern nur eine große Schwäche und Leere. Sie mußte kämpfen, um nach dem Essen aufstehen und den kleinen Hans Elias versorgen zu können. Es war selbstverständlich? daß Catharina ihr zur Hand ging beim Geschirrabwaschen und Tischdecken, beim Kochen und Saubermachen, und Pauline auch, soweit sie im Hause war, aber ein krankes Kind brauchte die Mutter.
Hans Elias schrie wieder, und benommen von Müdigkeit und Sorge schleppte Abigael sich ins Nebenzimmer.
Der kleine Junge hatte einen Arm über die Augen gelegt und wimmerte nun. Seine Mutter bemerkte er gar nicht, bis sie ihn sanft berührte. Da schrie er wieder laut auf und bog sich nach hinten durch, als habe seine Mutter die Sehne gespannt. Abigael strich in ihrer Ratlosigkeit die Bettdecke glatt, sie wagte ihren Sohn nicht mehr anzufassen.
»Au, au!«, klagte Hans Elias. Dann erbrach er lange und heftig.
Als es vorbei war und er mit schweißglänzendem Gesicht wieder zurückgesunken war, fiel auch Abigael in sich zusammen und konnte nur noch den einen Gedanken fassen, daß es bald aufhören möge. Nach einer Weile verließ sie auf Zehenspitzen das Zimmer und ging in den Hof, in dem erneut rhythmische Hammerschläge dröhnten. »Du mußt den Arzt holen«, verlangte sie.
»Meinst du wirklich?«, fragte Friedrich mißtrauisch »Ja, wenn es um die Hebamme ginge, da würde ich nichts sagen, rein gar nichts. Aber einen Arzt? Es schickt sich nicht.« Er sah zornig auf den Boden, und seine Hände am Hammer wurden weiß. »Du und deine Allüren! Wahrscheinlich ist es sowieso nur eine Erkältung!«
»Du gefühlloser Stier!«, schrie Abigael ihren Mann an. »Ich werde Dr. Stein rufen!«
Friedrich ergriff hart das Handgelenk seiner Frau. »Das«, sagte er rauh, »das ist das einzige, was du nicht tun wirst.«
Abigael war zwar außer sich vor Angst, aber dennoch hatte ihr Verstand nicht ausgesetzt, im Gegenteil, er konzentrierte sich auf das Notwendige. Sie zwang sich zur Ruhe. »Du kannst mir meine Herkunft vorwerfen, wann du willst«, sagte sie, »zu oft tust du es ja auch, aber jetzt – jetzt nicht. Jetzt hole einen Arzt! Meinetwegen nicht Doktor Stein.« Und obwohl sie ein wenig kleiner als ihr Mann war, schien sie auf ihn hinunterzublicken.
»Ja«, sagte Friedrich zu seinem eigenen Erstaunen und stapfte los. Er wandte noch nicht einmal ein, daß sie ihn nicht bezahlen konnten. Während Abigael am Bett ihres Sohnes wachte, halb in Kummer versunken, halb im Schlaf, wanderte ihr Mann, der einfache Dorfschmied, zum ersten Mal in seinem Leben nach Rostock, um einen Arzt zu suchen. Weder kannte er einen, noch wußte er, wie man sich einer solchen Respektsperson gegenüber verhält, noch, ob der Arzt überhaupt kommen würde, wenn er ihm sagte, wohin. Die ärmlichen Häuser im Küterbruch von Liesenhagen waren gewöhnlich nicht der Ort, auf den studierte Personen ihren Fuß setzen. Und was Graf Poggenow dazu sagen würde, wußte er überhaupt nicht. Zwar hatte der über ihn als freien Handwerker nicht soviel zu sagen wie über seine Bauern, mochten sie nun leibeigen sein oder nicht mehr trotzdem wußte Friedrich nicht recht, ob die Sache gemeldet oder gar genehmigt werden mußte. Zum ersten Mal verfluchte er die Ordnung, in die er hineingeboren worden war.
»Es ist«, sagte der Arzt, der am nächsten Morgen mit angewidertem Gesicht den Meinen Raum betrat, in dem sich außer dem kranken Kind und der immer noch wachenden Abigael auch Catharina befand, »nicht meine Gewohnheit, Hilferufe zu ignorieren. Allerdings bin ich noch nie in ein Dorf eines Rittergutes gerufen worden. Man bedenke: ein Dorf!«, murmelte er vor sich hin, schüttelte den Kopf über sich selber und führte das Schnupftuch an die Nase, das er zufällig in der Hand hielt. Er beugte sich über das Kind. »Pflegt das Kind immer einen solchen stupiden Gesichtsausdruck zu zeigen?«, wollte er von Abigael wissen.
Sie beobachtete den Arzt unablässig. »Einen stupiden Ausdruck?«, fragte sie hilflos.
»Blöde, gute Frau, blöde.«
Abigael schnellte zu ihrem Sohn herum und zwang sich, ihn zu betrachten, wie der Arzt ihn angesehen hatte. Es war nicht zu verkennen: Hans Elias hatte sich über Nacht verändert. Seine Augen waren zusammengeschrumpft, die Nase flach und breiter, und die wenigen Erfahrungen, die sich in seinem kurzen Leben in sein Gesicht eingeprägt hatten, waren verschwunden. Er war nicht mehr derjenige, dem sie gestern das Erbrochene vom Kittelchen gewischt hatte.
»Ein Wechselbalg«, flüsterte Catharina laut.
»Das junge Mädchen geht wohl besser hinaus«, verlangte der Arzt mit verärgerter Stimme und schob sie mit dem Stöckchen in seiner Hand auf die Türöffnung zu. »Hier ist nicht der Pfingstmarkt. Demnächst werden wohl noch die Ochsen aufmarschieren.« Vorwurfsvoll sah er die Mutter an. Abigael aber antwortete nicht. Angstgeschüttelt blickte sie zu ihm hoch.
Der Arzt legte sein Taschentuch über den schmalen, etwas gefleckten Arm des Jungen und fühlte seinen Puls. Dann seufzte er. »Wie ich mir dachte«, sagte er. »Ihr Sohn hat die neue Krankheit, die Lähme.« Mit eleganter Bewegung hob er sein Lorgnon ans Auge und beugte sich interessiert noch etwas tiefer über den Jungen, der fast so schnell atmete, wie ein Libellenflügel schwirrt. »Er wird sterben. Ich kann nichts machen.« Nach einer winzigen, dem Zustand des Patienten angemessenen Pause fügte er hinzu: »Ihr Mann soll mir mein Honorar in die Wohnung bringen.«
Danach verließ der Arzt das Haus und kehrte zu seinen Kranken nach Rostock zurück, zurück zu den Villen der aufstrebenden Hafenstadt, wo ihm während einer Konsultation Dienerschaft zur Verfügung stand, was er nicht nur beanspruchen konnte, sondern für ihn so selbstverständlich war, daß er normalerweise nicht darauf hinzuweisen brauchte. Er schmunzelte ein wenig, als er an das soeben überstandene Abenteuer dachte. Die Kollegen würden es kaum glauben wollen. Aber die unbeholfene Aufforderung des Schmiedes hatte ihm eine gewisse Bewunderung eingeflößt; außerdem hatte ihn vorübergehend Neugier erfüllt für das Leben des einfachen Volkes da draußen, aus dem sich jemand für berechtigt hielt, einen Arzt zu konsultieren, als sei er Bürger der ehemaligen Hansestadt Rostock. Abrupt unterbrach er seine Überlegungen mit einem erlösenden Rülpser.
Er war enttäuscht worden. An diesen Leuten war nichts Besonderes. Es gab keine Urkraft im einfachen Volk. Aber, immerhin, er hatte erstmals die Symptome dieser neuartigen Erkrankung gesehen und konnte nun noch besser als vorher unter Kollegen darüber diskutieren. In der Freimaurervereinigung hatte er mit großem Erfolg einen Vortrag zum Thema: »Die Meningitis cerebrospinalis, vom historisch-geographischen und pathologisch-therapeutischen Standpunkt bearbeitet« gehalten. Nun konnte er an eine Erweiterung der Thematik denken.
Hans Elias starb nach vier Tagen. Scheu stand der Schmied mehrmals in diesen unwirklichen Tagen und Nächten hinter seiner Frau, legte ihr vorsichtig eine seiner schweren Hände auf die Schulter, fühlte, wie sich noch immer das Fleisch unter seiner Hand fest und prall wölbte, und atmete laut und hilflos. Nur einmal drehte sie sich um, und da sah sie in seinen Augen Liebe. Sie fing haltlos zu weinen an. Es gab keine Hoffnung mehr.
Während der darauffolgenden Trauertage, in denen Abigael sich nicht von ihrem Stuhl rührte, erkrankte auch Johann.
»Eine Erkältung«, sagte Friedrich und kümmerte sich nicht um ihn. Der Junge verkroch sich im Bett und wurde von den hilfreichen Nachbarn und den Schwestern mit den notdürftigsten Handreichungen versorgt sowie mit Essen, als er endlich wieder schlucken konnte. Erst einige Zeit nach dem Begräbnis bemerkte man, daß Johann von der Erkältung ein starkes Hinken seines linken Beines zurückbehalten hatte.
»Was es nicht alles gibt«, staunten die Nachbarn. Das Staunen verging ihnen aber bald, denn in diesem kältesten Winter seit Menschengedenken gab es noch mehr Kinder, die an der Lähme starben, und auch andere Fälle von Erkältung mit nachfolgendem steifem Gang kamen vor. Dennoch aber blieb Johann das einzige Hinkebein unter den vielen Johanns dieser Jahrgänge, und zur Unterscheidung von den anderen hieß er ab diesem Winter Johann Hinkepoot.
Im Spätsommer, kurz nach der Geburt des siebten, also sechsten lebenden Brinkmannschen Kindes, begann für Friedrich Wilhelm die Schulzeit. Dieser Tag machte auf ihn einen sehr viel größeren Eindruck als das plötzliche Auftauchen von Carl Brinkmann.
»Säugling Corl«, hieß er bei der Hebamme von der Stunde seiner Geburt an und bald auch unter den anderen Familienmitgliedern, damit man ihn nicht mit dem Onkel Karl in einen Topf warf, aber entgegen dieser hoffnungsvollen Bezeichnung wollte er nicht saugen. Statt dessen zeichnete er sich durch anhaltendes Geschrei aus, das später von jedem in der Familie, im Rückblick betrachtet, als Musikalität erklärt wurde. Einstweilen aber machte er seiner Mutter große Probleme, so daß sie sich genötigt sah, für ihn Ziegenmilch zu besorgen, die er jedoch nicht vertrug. Daher war und blieb er klein, und nur Abigael wußte, daß der erste Keim zu diesem Mickern bereits gelegt worden war, bevor sie den Schock um Hans Elias’ Krankheit zu erleiden gehabt hatte.
Da die Mutter wegen Säugling Corl verhindert war, begleitete Pauline ihren Bruder zur Schule. Nun kam er selbstverständlich täglich mindestens einmal am Schulgebäude vorbei und kannte auch den Lehrer und dieser Friedrich Wilhelm. Die Eskorte hatte also nichts damit zu tun, daß er womöglich sich nicht traute oder nicht allein hingefunden hätte. Das alles war es nicht: Am ersten Schultag mußte der Erstkläßler begleitet werden, das gehörte sich einfach.
Pauline, das große schlanke Mädchen mit den grauen Augen, war fast schon eine Schönheit. Ihre blonden Zöpfe, nie ganz zu bändigen, weil die lockigen Haare sich nicht in Reih und Glied fügen wollten, sahen immer etwas unordentlich aus. Pauline war auch das einzige von den Kindern mit dichten Sommersprossen über der Nase, und diese hielt besonders Catharina für häßlich und gewöhnlich, was sie auch laut sagte. Pauline, die sich zuweilen heimlich in einer Pfütze spiegelte, mußte ihr recht geben, ausnahmsweise, denn das vermied sie sonst nach Kräften. Die Mutter war die einzige, die Pauline zärtlich mit der Fingerspitze über den Nasenrücken fuhr und sie dann anlächelte.
Friedrich Wilhelm, heute ohne seine gewöhnliche neugierige Quirligkeit mit kerzengeradem Rücken und steifem Hals, damit der ungewohnte Tornister ihm nicht vom Rücken rutschte, wanderte ernst und nachdenklich neben seiner Schwester einher, erst den Küterbruch bis zum Ende, dann links um die Ecke am Kaufmann Fecht vorbei, der ausgerechnet heute nicht in der Tür stand. Was hätte er ihm heute wohl auf den Weg mitgegeben? Sicher nicht: ›Wer langsam geht, kommt auch vorwärts.‹ Vielleicht: ›Durch Fragen wird man klug.‹ Er nahm sich vor, viel zu fragen. Dann aber fiel ihm wieder Pauline ein. Sollte er sich nun über Paulines Begleitung ärgern, oder sollte er sich freuen, daß sie wegen der feierlichen Angelegenheit einen Arbeitstag geopfert hatte?
In der Schröpfgrube blieb Friedrich Wilhelm abrupt stehen, genau in einer Pfütze, über die er eigentlich hätte hinüberspringen wollen.
»Wann bist du in die Schule gegangen?«, fragte er. »Ich kann mich überhaupt nicht erinnern.«
Pauline schüttelte traurig den Kopf. »Ich durfte nicht hin. Geh aus der Pfütze, bitte.«
»Was?«
»Geh aus der Pfütze«, wiederholte die große Schwester ungeduldig. »Wenn Vater deine Schuhe sieht, schlägt er mich.«
»Was ist mit der Schule?«
»Ich durfte nicht, weil ich ein Mädchen bin. Wäre ich doch nur ein Junge geworden!«, wünschte Pauline voll Inbrunst.
»Meinst du, daß ich auch nicht gehen dürfte ...«
»... wenn du Friederike Wilhelmine wärst?«, ergänzte Pauline und lachte laut über seine abweisende Grimasse. »Nein, dann nicht.«
»Hat Mutter das verboten?«, fragte der Junge.
Pauline war rasch mit Denken und rasch mit Antworten. »Bestimmt nicht. Eher Vater. Dem traue ich das zu. Oder es war der Graf.« Friedrich Wilhelm sah sie an, dann rasch zu Boden. Ganz klar war ihm nicht, was seine Schwester meinte. Aber sein Mitleid und sein Gerechtigkeitssinn waren groß.
»Weißt du was, Pauline?«, sagte er begeistert. »Ich werde für uns beide lernen. Ich werde dir abends alles erzählen, was Lehrer Knagge am Morgen gesagt hat. Du und ich werden gemeinsam lernen. Dadurch wird der Unterricht auch billiger«, fügte er vernünftig hinzu, weil er dachte, seine Schwester benötige vielleicht doch noch einen letzten Anstoß, um überzeugt zu werden.
Aber Pauline benötigte keinen. »Würdest du das wirklich tun?«, fragte sie begeistert. »Oh, Fritzi, du bist ein Schatz!« Sie nahm ihren Bruder an den Schultern und gab ihm ganz unbekümmert mitten auf den Mund einen schmatzenden Kuß.
»Laß das, Pauline«, wehrte Friedrich Wilhelm verlegen ab. »Was sollen denn die Leute denken?«
»Das hätte auch die fromme Catharina gesagt haben können«, sang Pauline in selbsterfundener Melodie, faßte ihren Bruder an den Händen und tanzte mit ihm wie wild um die Pfütze herum, neben der sie immer noch standen. Ihr langes graues Kleid schwärzte sich vor Nässe, aber das war Pauline ganz egal. Ein Mann mit einem hochbeladenen Karren wartete mürrisch.
»Wer sollte eigentlich wen begleiten?«, fragte Friedrich Wilhelm grinsend und zog seine Schwester beiseite. »Komm, wir müssen gehen.«
Zwei Frauen, die die Kinder beobachtet hatten, schüttelten entrüstet die Köpfe. »Nicht jeder, der klug schnacken kann, hat auch kluge Kinder«, sagte die eine bissig.
»Schändlich«, bestätigte die andere und ließ die zwei Brinkmann-Kinder nicht aus den Augen. »Man müßte es mal dem Friedrich sagen.«
Die Frau nickte. »Müßte man. Aber das kommt von ihr! Die mit ihren Allüren! Zu und zu hochnäsig!«
Das Schulgebäude, in dem Lehrer Knagge mit fünf Kindern, seiner dürren Frau und einem fetten Schwein wohnte, war schon lange nicht mehr geweißt worden. Schmutzig waren die Wände, und im Reetdach wuchsen dicke grüne Moospolster, aus denen bei Regenwetter die Nässe troff. Friedrich Wilhelm blieb vor dem Haus stehen; mit offenem Mund ließ er seine Augen wandern, von der Schornsteinöffnung, aus der sich ein kaum sichtbares Rauchfähnchen löste, bis zum winzigen Gemüsegarten, den gerade das energische Schwein sich zu erobern anschickte. Ab heute war dieses Haus nicht einfach eine Schule, sondern der Beginn seines Erwachsenwerdens. Deshalb sah das Gebäude heute auch ganz anders aus als sonst. Außer fünf Kindern mit Tornistern war niemand zu sehen. Und diese schauten erwartungsvoll mal zur Haustür, mal auf das Schwein. »Schneller!«, feuerte ein großer Junge, von dem Friedrich Wilhelm wußte, daß er Otto hieß, die Sau an. Die Sau kümmerte sich nicht um ihn, aber sie stemmte unverdrossen die unterste Holzplanke. Einer von den kleineren Jungen kam heran. »Meinst du, daß sie es schafft?«, fragte er Pauline zutraulich. »Wir haben gewettet. Möchtest du auch?«
Pauline starrte ihn verdutzt an.
»Um was?«, fragte Friedrich Wilhelm lässig.
Der andere wies nach rückwärts mit dem Daumen. »Um ein Vogelgerippe. Mit Schnabel. Berting hat es.«
Friedrich Wilhelm war unbeeindruckt. »Was für eins?«
»Große Möwe. So einen Schnabel hat die! So einen.« Und der Junge maß mit beiden Händen eine Schnabelgröße ab, die wohl zu einem Reiher gehören mochte.
»Du spinnst wohl«, erklärte Friedrich Wilhelm verächtlich. »Außerdem: Möwe brauche ich nicht. Wenn du gesagt hättest Storch, ja dann vielleicht ... Worum geht’s denn eigentlich?«
»Darum«, sagte der andere wichtigtuerisch und beobachtete Pauline, ob sie auch genau zuhörte, »ob der Pekfinger entdeckt, daß seine Sau im Kohl ist oder nicht. Oder seine Frau, das zählt auch. Ich jedenfalls habe gewettet, daß sie drin ist, bevor sie es spitzkriegen.«
»Ich halte dagegen«, schrie ein anderer Junge, dürr und mit hängenden Schultern. Seine Oberlippe war gespalten, weswegen er Spaltmuul genannt wurde. Friedrich Wilhelm kannte ihn nicht näher, wußte aber, daß er gerne zuschlug.
Friedrich Wilhelm beobachtete die Sau und versuchte die Lage abzuschätzen. Die Schule müßte eigentlich schon begonnen haben, denn die Kirchturmuhr hatte gerade zehn geschlagen. Und die Planke war an einer Seite schon lose.
»Beeil dich, wenn’s gelten soll«, drängte der Kleine.
»Gut, sie schafft’s«, entschied Friedrich Wilhelm entschlossen.
Spaltmuul, der Kleine und Friedrich Wilhelm beobachteten schweigend das Schwein. Berting, als Halter des Schnabels, hatte nicht mitgewettet. Drinnen im Haus ertönte das Klingeln.
»Gewonnen!«, jubelte der Kleine fröhlich und griff nach der Trophäe, als die Sau die Vorderfüße in den Grünkohl schob und ihre Klauen eine junge Pflanze umlegten.
»Noch nicht, du Aas!«, schrie Spaltmuul, und nicht nur die oberen Schneidezähne wurden sichtbar, sondern auch der zerklüftete Gaumen. »Frau Lehrer, passen S’ up Sei Ehr Söög up! Se fret de’rn Kohl!«, brüllte er und hielt den wütenden Kleinen mit seinen langen Armen fest. »Frau Lehrer, Frau Lehrer!«
Auf seinen Ruf hin eilte nicht nur die Lehrersfrau aus dem Garten herbei, sondern Lehrer Knagge selbst trat majestätisch in die Haustür, die Klingel noch in der Hand.
»Wer ruft?«, dröhnte seine Stimme. »Wer ruft in dieser entsetzlichen Sprache, von der man behauptet, sie sei eine Sprache, während sie in Wahrheit nur eine Mißgeburt des niederen Volkes ist?« Wie ein Feldherr sah der Lehrer sich um.
»Päule!«, rief seine Frau klagend, »du hast die Bohle nicht angenagelt, jetzt ist die Sau im Gemüse. Mußtest du das denn vergessen?«
»Ich habe es nicht vergessen, Ilsing, ich hatte den Globus zu betreuen«, erklärte der Lehrer mit Würde. »Dem Unterrichtsmaterial ist größere Wichtigkeit beizumessen als unseren persönlichen Belangen.« Dann fiel sein Blick auf das Spaltmuul. »Ach Achim, ach Achim! Wie oft habe ich dir erklärt, daß man nicht ›Sei Ehr‹ sagen darf.«
»Ich wollte doch nur höflich sein, Herr Knagge«, verteidigte das Spaltmuul sich. »Und außerdem war Sei Ehr Garten wirklich in Gefahr. Da ist es doch pottegal, wie ich ihm rette!«
So ein hinterlistiges Stück, dachte Friedrich Wilhelm wütend. Den Schnabel hatte er zwar nicht haben wollen, aber dem Spaltmuul gönnte er ihn auch nicht. Betrug war das, nichts anderes als Betrug. Sachte stieß er den Kleinen mit dem Ellenbogen an und zog die Augenbrauen hoch. Der Kleine nickte.
Friedrich Wilhelm trat kurzentschlossen mit dem Schuh dem langen Jungen das Bein weg, und der Kleine stürzte sich von hinten auf ihn. Im Nu lagen sie im Dreck, rollten über die Straße, während der Lehrer voll Staunen zusah. Seine Frau kümmerte sich gar nicht um die Jungs, sie packte die Sau am Schwanz, drehte ihn ein, und das Schwein, an einem der empfindlichsten Körperteile gequält, fing an, erbärmlich zu quieken, schnurrte herum und biß der Lehrersgattin ins Bein. »O Chott, o Chott!«, schrie sie.
Lehrer Knagge, hin- und hergerissen zwischen Beruf und Familie, wußte nicht, was tun. Hilflos sah er mal hierhin, mal dorthin. »Ilsing, so lauf doch!«
Ilsing humpelte, immer noch schreiend, los und die Sau mit ihr, verbissen im umfangreichen Stoff des Kleides und nicht bereit, den Feind loszulassen.
»Friedrich Wilhelm, hilf ihr!«, gellte der Ruf von Pauline.
Niemand bekam so recht mit, woher es kam, daß Friedrich Wilhelm mitten im Kampf die Situation erfaßt hatte, aber plötzlich saß er rittlings auf der Sau, die die Lehrersfrau losließ und sich sofort dem neuen Feind widmete. Um ihren Bruder zu entsetzen, drosch Pauline nun ihrerseits auf das Spaltmuul ein, und die Kämpfe gingen unter Getöse, Geschrei und Gequieke weiter.
»So tu doch was!«, rief die händeringende Lehrersgattin.
»Was denn?«
Aber es war nicht nötig. So schnell, wie der Kampfangefangen hatte, hörte er auch auf Pauline stand mit dunkelrotem Kopf auf; klopfte sich das Kleid verzweifelt hinten und vorne sauber, und Friedrich Wilhelm sprang von der Sau ab, die mit wackelndem Gesäuge eilig hinter das Haus stakte. Nur Spaltmuul bekam das Ende der Kampfhandlungen so schnell nicht mit. Er lag immer noch im Staub und glotzte um sich, die Fäuste schlagbereit in der Luft.
Der Lehrer räusperte sich erleichtert. »Wie ein Ritter hast du dich gehalten, mein Junge. Wie heißt du?«
»Sie kennen mich doch«, sagte Friedrich Wilhelm erstaunt. »Ich bin Friedrich Wilhelm von Schmiedemeister Friedrich Brinkmann.«
»Ganz recht«, erwiderte Lehrer Knagge. »Aber am ersten Schultag muß man seinen Namen sagen. Das ist so üblich. Ich werde dich Ritter Friedrich nennen.«
»Fiete Ritter!«, schrie der Kleine und lachte unbändig los. Selbst das Spaltmuul grinste schief.
Lehrer Knagge schwenkte erneut die Glocke und sagte: »Nun wollen wir aber doch mit der Schule beginnen. Eltern und andere Angehörige können nach Hause gehen.«
Pauline sah sich um. Sie war die einzige Person, die unter Eltern und Angehörige fiel. Also knickste sie höflich zur Lehrersgattin hinüber, dann zu Herrn Knagge, winkte ihrem Bruder zu und ging.
Friedrich Wilhelm ärgerte sich jetzt doch, daß man ihm eine Aufsichtsperson mitgegeben hatte. Er blickte nicht hoch und winkte auch nicht zurück.
Der Schulraum war klein, wie die ganze Schule. Dafür besaß das Rittergut noch eine weitere. Vier Schulbänke für je zwei jungen und vorne ein Tisch für Herrn Knagge. Der Kanonenofen an der Längsseite paßte schon fast nicht mehr hinein; dem nächstsitzenden Schüler versengte es im Winter fast die Beine, dafür mußte er aber auch die Asche hinaustragen.
Sie waren sechs Kinder zuzüglich der drei von Lehrer Knagge, die im schulfähigen Alter waren. Friedrich Wilhelm kam mit dem Kleinen, der eigentlich Willi hieß, und einem Knaggeschen Sohn, dem Hansi, in die vorderste Bank.
Kaum saßen sie in den Bänken, waren das Wohlwollen und die Unbeholfenheit, die Lehrer Knagge draußen im Garten gezeigt hatte, wie weggewischt. Er machte ein strenges Gesicht und hieß alle jungen die Hände auf das schräge Pult vor sich legen. Dann ging er umher und besah sich das Ergebnis. »Sauberkeit ist das erste Lernziel«, sagte er. »Du und du und du, ihr geht raus und wascht euch.« Auch Friedrich Wilhelm war dabei.
Die älteren Jungs flogen gewissermaßen nach draußen. »Warum?«, fragte Friedrich Wilhelm, bekam aber keine Antwort. Auch Willi wußte es nicht. Drinnen begriffen sie es beide. »Heute nur zwei«, sagte Lehrer Knagge und wies mit seinem knochigen Zeigefinger auf Willi und Friedrich Wilhelm, »weil ihr neu seid. Ihr werdet es schon lernen.« Mit einem breiten braunen Lineal schlug er den beiden Neuen zweimal über die präsentierten Hände. Sie waren in der Tat nicht so sauber wie die von den anderen Jungs. Hinter Friedrich Wilhelm kicherte das Spaltmuul. Warte, dir werde ich’s zeigen, schwor sich Friedrich Wilhelm.
»Das zweite Lernziel ist das Lesen«, verkündete Lehrer Knagge, und alle Kinder lasen, die älteren von ihren Schiefertafeln, die sie selber beschrieben, die neuen von der großen Wandtafel. Kurz vor Mittag las der Lehrer aus dem Katechismus vor. »Damit wir uns nicht gegen die Schulordnung vergehen«, sagte er und machte, mit Behagen zur Tür schnuppernd, Schluß.
Am Nachmittag lernten alle das kleine Abc zu schreiben. Eine Stunde lang bekamen Friedrich Wilhelm und Willi Buchstaben auf die Tafel gemalt, auf die eigene Schiefertafel sogar vorgeschrieben, und dann hatten sie zu üben, zu üben und nochmals zu üben, wie Herr Knagge sagte.
Friedrich Wilhelm hatte es nach wenigen Tagen bereits begriffen, sowohl den Benimm als auch das Lesen und das Abc, übte er doch abends wie versprochen heimlich mit Pauline weiter. Aber Willi tat sich schwerer.
»Herr Pekfinger«, rief Willi am Ende der ersten Woche verzweifelt, »es geht nicht, die Buchstaben wollen mir nicht in den Griffel.«
»Dann leg den Griffel auf den Tisch«, befahl Lehrer Knagge, »und deine Hände daneben.« Dann schlug er zu, erst auf das Schreibwerkzeug, dann auf die Hände. »Für den Griffel, weil er obsternatsch ist, für dich, weil du ihn nicht im Griff hast.« Willi heulte erbärmlich auf, und der Griffel sprang in zwei Teilen auf den Boden. Nun weinte Willi noch viel mehr. Griffel kosteten Geld, und davon besaß im Dorf kaum jemand zuviel. »Merke dir«, sagte Herr Knagge, »jeder ist für seine Sachen verantwortlich und muß für sie geradestehen. Entgegen deiner Vermutung erhältst du für den Spitznamen keine Schläge.«
Willi sah ihn verständnislos aus seinen verheulten Augen an.
»Sei still, Willi«, sagte Friedrich Wilhelm, nun öfter Fiete Ritter genannt, »das ist gerecht, das gilt sogar für die Frau Lehrer Knagge.« Lehrer Knagge wollte aufbrausen, dann besann er sich. Aufmerksam und etwas nachdenklich betrachtete er Friedrich Wilhelm. »Ich glaube, ich weiß, was du meinst«, sagte er. »Würdest du es mir trotzdem erklären?«
»Bei uns ist meine Mutter für das Schwein zuständig«, erklärte Fiete nach kurzem Nachdenken, »bestimmt ist das bei Ihnen auch so.«
»Das ist richtig«, entgegnete Herr Knagge, »aber Frau Knagge wurde nicht zur Rechenschaft gezogen. Ich selber auch nicht. Woraus du entnehmen mögest, daß es in der Welt nicht immer gerecht zugeht.« Friedrich Wilhelm antwortete darauf nichts mehr, obwohl es sehr ungerecht war, daß Willi und der Griffel bestraft worden waren, die Sau aber und Frau Knagge nicht, von Herrn Lehrer Knagge ganz zu schweigen. Er sah ihn wütend an. Dabei hätte er drauf schwören mögen, daß Pekfinger mit gewissem Wohlwollen zurückblickte.
Der kleine Willi hatte von dem ganzen Wortwechsel nichts verstanden, aber ab da hing er mit Bewunderung an seinem großen Freund Fiete, der nicht nur ihn, Willi, sondern auch Griffel und Schweine verteidigte. Und jetzt wußte er auch ungefähr, was er sich unter einem Ritter vorzustellen hatte. Friedrich Wilhelm aber befreundete sich noch mehr mit Berting, denn dieser wußte nicht nur Möwenskelette zu besorgen, sondern tatsächlich einen Storchschnabel.
Eine Hand auf dem Rücken, hielt er Fiete eines Morgens mit der anderen ein kleines Blümchen vor die Nase. »Willst einen Storchschnabel?«, fragte er und grinste dabei. Als Fiete nur empört guckte, zog er hinter dem Rücken einen langen gelben Schnabel hervor. »Kannst beide haben«, sagte er gutmütig. Friedrich Wilhelm hütete den einen wie einen Schatz, den anderen schenkte er Pauline.
Nach einigen Wochen buchstabierte sich Fiete bereits durch die Bibel und durch das großherzoglich-mecklenburgische Gesangbuch durch. Pauline und er saßen, solange das Licht es zuließ, im Innenhof und lasen. Abigael duldete stillschweigend, daß Pauline ihr weniger als gewohnt half, und zog vermehrt Catharina hinzu, und dennoch – manchmal schaffte sie es einfach nicht ohne die große Tochter, denn Säugling Carl blieb unruhig und schrie häufig.
»Warum braucht Pauline nicht mehr zu arbeiten?«, maulte Catharina eines späten Abends und schmiegte sich an die Knie ihres Vaters.
»Dummes Zeug!«, sagte Friedrich und zog einen Weidenzweig aus dem Bündel. Er warf einen Blick aus dem Fenster. Lange würde es nicht mehr dauern, dann mußte er mit dem Flechten aufhören. Die ersten Sterne standen bereits sichtbar am Himmel.
»Nein, wirklich!«, beharrte Catharina.
»Könntest du mal den Stein für Körling holen?«, bat Abigael hastig. »Er ist schon vorgewärmt. Liegt auf der Herdplatte. Brauchst ihn nur noch einzuschlagen.«
»Warum geht Pauline nicht? Sie muß wohl nachholen, was sie versäumt hat«, sagte Catharina gehässig und trottete widerwillig hinaus.
»Was hat sie denn?«, knurrte Friedrich und flocht, so hastig er konnte, drüber, drunter, nächste Rute.
»Ach, sie ist wohl etwas unzufrieden mit allem«, sagte Abigael verschwommen. »Es ist das Alter.«
»Ich habe kein Alter!«, widersprach Catharina, und sie wußte noch nicht, daß das tatsächlich zutraf. »Aber ich muß mich abrackern, und Line kann mit Fiete in der Ecke sitzen und faulenzen! Dabei ist denen Gottes Wort sowieso egal.«
»Sag bitte nicht Fiete, Line auch nicht«, mahnte Abigael. »Und sei nicht so aufsässig.«
»In Anstand leben, in Anstand handeln, in Anstand sterben, sage ich! Gefaulenzt wird nicht!« Friedrich ließ seine Arbeit auf die Knie sinken. »Ihr werdet mir jetzt beide sagen, worum es eigentlich geht!« Abigael schwieg mit verkniffenem Mund, mit um so mehr Freude berichtete Catharina, mit gefalteten Händen, laut und aufgeregt. Ab da durfte Pauline nicht mehr mit Friedrich Wilhelm lernen. Aber sie hatte von ihrer Mutter viel Willen und Einfallsreichtum mitbekommen. Sie müßte nun täglich eine Stunde länger in der Nähstube arbeiten, sagte sie laut und trotzig; sie hätten jetzt gerade besonders viel zu tun. Und nur Fiete wußte, was sie da wirklich machte.
2. Kapitel (1825)
Mit neun Jahren war Fiete Ritter immer noch nicht besonders groß, aber er war breit in den Schultern, dank der Arbeit, die er in der Schmiede leistete, und bereits ausreichend gewitzt. »Halt dich an das elfte Gebot und laß dich nicht verblüffen«, hämmerte ihm sein Freund, Kaufmann Fecht, mehrmals pro Woche in seinen Schädel, so lange, bis Fiete sich endlich daran hielt. Als er begriffen hatte, daß 50 Schilling nicht weniger, sondern mehr sind als ein Taler, hatte der Kaufmann ihn freigesprochen. »Eine Bauersfrau will nie einen Taler zahlen«, erklärte er, »die ziehen leichter siebzig Schillinge aus dem Sparstrumpf als einen einzigen Blanken. Also laß dir die siebzig geben und erkläre, es handele sich um einen Gefallen.«
Das einzige, das ihn an der Arbeit freute, war das Vertrauen, das er bei seinem Vater genoß, wenn es galt, die beschlagenen Pferde zu ihren Besitzern zurückzubringen, wenn diese was häufig vorkam keine Zeit hatten dabeizubleiben. Ja, es bürgerte sich allmählich sogar ein, daß der Vater für sich warb, indem er in den Dörfern, die zu Gut Liesenack gehörten, bekanntmachen ließ, daß er ein Pferd, das beschlagen werden sollte, holen und bringen lassen würde. Irgendwann erfuhr es auch der Graf, und das paßte ihm gut, hielt es doch seine Leute von der Kneipe ab. Ab da bevorzugte er die Dienste von Friedrich Brinkmann und seinem zuverlässigen Sohn.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!