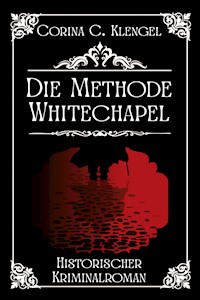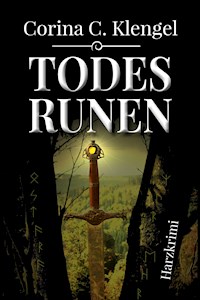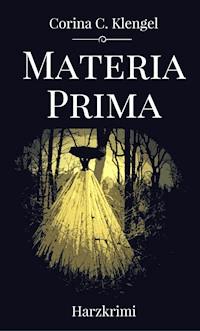Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Auf der Flucht vor ihrem gewaltbereiten Ex-Ehemann verschlägt es Sarah Leitner und ihre kleine Tochter in ein einsames Dorf im Harz. Anfangs ist sie nur verwundert über die Ablehnung, die sie dort erfährt. Sie beginnt zu ahnen, dass die Menschen in diesem Dorf ein dunkles Geheimnis hüten, welches Sarah fast zum Verhängnis wird, als ihr ein Büchlein aus der Zeit der Hexenverfolgung in die Hände fällt. Denn genau dieses Dorf war einst Schauplatz eines grausamen Hexenprozesses, der an einer sagenumwobenen Quelle endete. Löste der Prozess tatsächlich einen Fluch aus? Was hat es mit dem rätselhaften Steinkreis auf sich? Warum mussten die Vorbesitzer von Sarahs Haus sterben? Zusammen mit dem jungen Pfarrer des Dorfes kommt sie dem Geheimnis auf die Spur. Doch dann taucht Sarahs Mann auf…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Corina C. Klengel
Die Hexenquelle
Impressum
Die Hexenquelle
ISBN 978-3-947167-05-0
ePub Version V1.0 (10-2017)
© 2017 by Corina C. Klengel
Cover © Corina C. Klengel (www.ccklengel.de)
Autorenfoto © Ania Schulz (www.as-fotografie.com)
Lektorat & DTP:
Sascha Exner
Verlag:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1163 · D-37104 Duderstadt
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
Web: www.harzkrimis.de · E-Mail: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Innentitel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Epilog
Über die Autorin
Materia Prima
Venedigerzeichen
Harzhimmel
Todesrune
Über den Harzkrimi
Harzkrimi-Tipp 1
Harzkrimi-Tipp 2
Harzkrimi-Tipp 3
Harzkrimi-Tipp 4
Harzkrimi-Tipp 5
Prolog
Regentropfen bahnten sich ihren Weg durch die Bäume und ließen das Herbstlaub leise knistern. Die Beamten hielten sich an Seilen fest, während sie vorsichtig die schlammige, steile Böschung herabstiegen. Es war erst kurz nach vier und doch schon so dunkel, dass sie Schwierigkeiten hatten, zu sehen, wo sie ihre Füße hinstellten konnten, die in völlig durchnässten Schuhen steckten, ohne in die Tiefe zu rutschen. Urplötzlich durchschnitt ein gleißender Lichtstrahl die Szenerie. Gleich darauf blitzten zwei weitere Halogenstrahler auf und zerteilten die milchige Dämmerung wie mit einem Skalpell. Es offenbarte sich ein Bild des Grauens. Obwohl es um das auf dem Dach liegende Autowrack, unten in dem engen Tal und oben auf der schmalen Bergstraße von Polizeibeamten, Feuerwehrleuten und einer Gruppe von Einheimischen geradezu wimmelte, breitete sich jetzt bleierne Stille aus. Nur langsam kam Leben zurück in die Szenerie. Männer und Frauen in weißen Tyvek Overalls packten Aluminiumkoffer und hangelten sich in die Tiefe. Selbst die Befehle der Feuerwehrleute, die mit ihren Seilen die Tatorttechniker sicherten, fielen weniger laut aus als sonst.
Gerd Wegener hatte schon einiges gesehen. Eigentlich war er mit seiner Familie aus Frankfurt weggezogen, um so etwas nicht mehr sehen zu müssen. Dennoch erfasste er das bizarre Szenario von der Straße aus mit professionellem Blick. Die Frau sollte laut den gefundenen Papieren Anfang Fünfzig gewesen sein. Schlank war sie, bemerkte Wegener anerkennend, der stets um den Erhalt seiner Figur bemüht war. Ihr Gesicht konnte er nicht erkennen. Von seinem Standort aus war nur eine blutige Masse zu sehen. Sie lag neben dem dunklen Wagen, der so zerstört war, dass sich auf den ersten Blick die Marke nicht ausmachen ließ. Der Mann lag bis zur Hüfte unter der Fahrerseite des Wagens. Beide Körper waren so zerschunden, dass der Drang sie zuzudecken, fast übermächtig wurde. Dünne Metallstreben, die einst als Zierleisten dienten, hatten sich durch Kleidung und Haut gebohrt.
Wegener ließ den Blick schweifen. Der Wald wies an dieser Stelle überwiegend Fichten und ein paar Tannen auf. Am Grund der Böschung lagen zahlreiche Gerippe von quer liegenden, toten Nadelbäumen mit weißgrauen, nadellosen Ästen. Einer dieser knochenfahlen, in Jahren gebleichten, durch innere Trockenheit gestählten Äste stakte in dem Körper der Frau. Sie musste auf eines der pflanzlichen Gerippe geschleudert worden sein, dachte Wegener, während er Entsetzen und Widerwillen mit Macht hinter seiner, in vielen Jahren erworbenen Professionalität zurückdrängte. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass er sich beim Anblick des weißen Astes in der Lunge der Frau fragte, ob es nicht eher eine menschliche Hand als der Sturz gewesen war, die diesen Ast durch menschliches Gewebe gestoßen hatte. Er schüttelte unmerklich den Kopf. Es musste an der mythengetränkten Atmosphäre des Oberharzes liegen, dass er auf so einen Gedanken kam.
Bewusst hakte er die Parameter seines kriminologischen Wissens ab und verglich sie mit dem Tatort. Dass die Leichen nicht erst seit dem Morgen hier lagen, sah Wegener sogar von seinem entfernten Standort aus. Noch immer lehnte er tatenlos am Kotflügel seines Kleinwagens. Er kramte in seiner Jacketttasche herum, bis er endlich seinen Kaugummi fand. Mit einer schnellen und exakten Bewegung steckte er sich ein Dragee in den Mund, ohne das Treiben im Tal auch nur einen Lidschlag aus den Augen zu lassen. Es war schon Jahre her, seit er die letzte Zigarette angezündet hatte. Doch in Momenten wie diesem war der Drang, sich eine Kippe zwischen die Lippen zu klemmen, so groß, als habe er erst am Vortag mit dem Rauchen aufgehört. Der scharfe Minzgeschmack löste die Sucht gesteuerte Spannung etwas.
Noch war es nicht sein Fall und er war auch nicht sicher, dass dies sein Fall werden würde. Lörcke war ein guter Mann, aber vielleicht etwas voreilig gewesen, als er das Dezernat für Delikte gegen Personen und damit ihn alarmierte. Und doch … Wieder arbeitete sich sein Blick von Detail zu Detail. Irgendwie hatte er hier ein ungutes Gefühl. Klamme, kalte Nässe zog ihm von unten die Beine hoch und drängte ihn, die feuchten Füße zu bewegen. Doch Wegener stand still da und betrachtete die Leichen.
„Wie lange?“, rief er der Rechtsmedizinerin zu, die vor der Frauenleiche hockte.
„Schwer zu sagen … Ich tippe auf mindestens sechs Tage.“ Ihr prüfender Blick maß die Umgebung. „Bei diesen niedrigen Temperaturen hält sich ein Körper.“
„Stammen alle Verletzungen vom Unfall?“
„Das nicht“, rief die Pathologin zurück und wies auf das zerstörte Gesicht der Toten.
„Tierfraß?“
Sie drehte sich nicht zu ihm um, aber ihr Kopf im weißen Plastikoverall nickte. Die Rechtsmedizinerin stand auf und wendete sich der zweiten Leiche zu.
Bedächtig kaute Wegener an seinem Kaugummi. Er fixierte den Beamten, der das Autowrack studierte. Wegener hatte bemerkt, dass sich Henning Meyer schon seit geraumer Zeit nicht mehr bewegt hatte und mit seiner Taschenlampe eine einzige Stelle beleuchtete.
Wegener wartete geduldig. Sein Blick fiel auf den Steinblock, der die eh schon enge Bergstraße begrenzte. Rötlich zeichnete sich ein Muster darauf ab. Es sah aus wie ein liegendes Horn.
„Gerd?“
Wegener wandte sich von dem sonderbaren Horn ab und dem Kollegen Meyer zu, der ihn gerufen hatte.
„Sieht so aus, als sei die Servolenkung ausgefallen. Eine der Druckleitungen ist hin.“
„Rechnen wir sechs Tage zurück, da hatten wir Dauerregen“, murmelte Wegener eher an sein eigenes alter Ego gewandt und betrachtete die Serpentine sinnend. „Deswegen haben sie die Kurve nicht gekriegt.“ Nachdenklich kaute er auf seinem Kaugummi und fragte den Hang hinab rufend: „Und? Hat jemand die Lenkung sabotiert?“
Meyer zog sich die Latexhandschuhe mit einem klatschenden Geräusch von den Händen. Er zögerte. „Schwer zu sagen. Da war ein Bruch im Material und das Hydrauliköl ist ausgelaufen …“ Unschlüssig kehrte sein Blick zum Wrack zurück. Meyer wusste sehr wohl, dass der weitere Verlauf dieses Falles an ihm lag. Er zögerte.
„Was denn nun? Ist da was gebrochen oder gebrochen worden?“, fragte Wegener drängend.
Noch einmal nahm sich der Tatorttechniker Zeit. Dann antwortete er: „Gebrochen!“
„Sicher?“
Verhaltenes Nicken.
„Okay! Dr. Giresch?“, rief er erneut in den Grund der Böschung.
Die Rechtsmedizinerin tauchte hinter dem Wrack auf. „Glaube auch nicht, dass das hier ein Fall für Sie ist, Herr Wegener“, sagte sie in der ihrer typischen langsamen Art, „obwohl … es sieht ja wirklich schlimm aus.“ Unschlüssig sah sich die Ärztin um. „Warten Sie noch meinen Bericht ab!“
Gerd Wegener überlegte und ließ noch einmal prüfend seinen Blick schweifen. Für einen Unfall war er nicht zuständig. Doch das ungute Gefühl hing wie ein lästiges Störgeräusch in seinem Hinterkopf. Überall lag die Habe der beiden Unfallopfer verstreut. Offensichtlich hatten die beiden Silberborn verlassen wollen. Diverse Koffer hatten sich geöffnet und ihr gesamtes Innenleben über den Waldboden verteilt. Unschuldige Utensilien wie ein einzelner Schuh hier und dort die einstmals hübsche rote Bluse gaben der Szenerie etwas Unwirkliches. Vielleicht fraß sich deshalb die Unsicherheit wie ein Schimmelmyzel in den Köpfen der Anwesenden fest.
Wegener versuchte im Geiste das Geschehen zu rekonstruieren. Der Wagen war mit hoher Geschwindigkeit von oben gekommen, hatte den Stein mit dem gruseligen Horn darauf gestreift, bevor der Fahrer das Lenkrad veriss, das ihm mangels Lenkhilfe nicht mehr gehorchte. Viele Meter weit hatte sich der Wagen überschlagen und war dabei immer wieder auf einen der runden, aus dem Erdreich ragenden Felsen aufgeschlagen, bis er völlig ramponiert in den Fichtenleichen und deren Geäst zur Ruhe gekommen war. Bei so einem Sturz walteten enorme Kräfte.
„Die Menschen liegen außerhalb des Wagens und sind mit Metallstreben und Ästen durchbohrt. Es sieht aus, als habe jemand die beiden erstochen und dann deren Habe durchsucht’, hatte Lörcke sichtlich angeschlagen berichtet. ‚Bizarr’, hatte Dieter Wolkert das Szenario genannt. Wolkert war ein erfahrener Mann. Auch Dr. Hannah Giresch, die Rechtsmedizinerin mit dem untrüglichen kriminalistischen Gespür, schien sich nicht ganz sicher. Wegener ließ sich die Worte der Kollegen noch einmal durch den Kopf gehen. Sein Blick glitt über eine Gruppe von Bewohnern des nächstgelegenen Dorfes, aus dem die Unfallopfer stammten.
Alle starrten gebannt in die Tiefe. Alle, außer dieser Frau, die Blicke geradezu magisch auf sich zog. Es störte sie keineswegs, dass Wegener die Gruppe und auch sie taxierte. Sie senkte ihre hellen Augen um keinen Deut. Es kam selten vor, dass Wegener vor einem Blick flüchtete. Doch nun war tatsächlich er es, der wegschaute. Das war ihm schon lange nicht mehr passiert. Er schüttelte den Kopf und rief seinen Kollegen zu: „Schickt mir den Bericht rüber. Vor allem guckt noch mal, ob ihr einen Hinweis auf Beteiligung eines anderen Fahrzeugs findet. Aber ich denke, das hier ist kein Fall für die Mordkommission.“
Zufrieden schaute die hochgewachsene Frau dem Kripobeamten aus Goslar hinterher, der sich anschickte, in seinen Wagen zu steigen.
„War’s gut? Ich hab doch alles richtig gemacht, nicht wahr?“, zischte der grobschlächtige, halslose Mann neben ihr tonlos ins Ohr und tappte wie ein Kind von einem Fuß auf den anderen. Seine rechte Schulter hing ein wenig herunter. Er leckte sich aufgeregt die Lippen. Gierig wartete er auf das Lob und reckte sich der Frau entgegen wie ein Seehund nach einer gelungenen Showeinlage.
Die Frau ließ sich Zeit. Endlich raunte sie ihm zu: „Ja, Konrad, alles war gut!“
Kapitel 1
Ein paar Monate zuvor…
„Sieh sie dir gut an … verlässt du mich, bringe ich zuerst diesen Bastard um, von dem du behauptest, es sei meine Tochter und dann … dann bringe ich dich um, meine Liebste!“, hauchte es neben ihrem Ohr, während die Tür zu Adinas Schlafzimmer geöffnet wurde. Das Mädchen schlief. Sarah hoffte, dass sie nicht erwachte und sehen musste, was hier vor sich ging. Hier in ihrem Heim, das doch ein Ort war, in dem man sicher und behütet sein sollte.
Die in ihr Haar gekrallte Hand riss ihr unbarmherzig den Kopf nach hinten und drehte sie zu dem hübschen Spiegel mit dem Jugendstilrahmen herum. Mit einem hässlich ratschenden Geräusch riss er ihr die Seidenbluse und den BH herunter, bis sie mit bloßem Oberkörper da stand. „Dies gehört mir – allein mir!“, raunte Markus ihr zu und zeigte auf ihr Spiegelbild. Erst strich seine Hand liebkosend über ihre linke Brust, dann folgte ein berstender Schmerz, als ihr Gesicht in den Spiegel gestoßen wurde.
Zurück im Heute…
Sarah zuckte auf und konzentrierte sich wieder auf die Straße.
Es war ein Jahr, fünf Monate und dreizehn Tage her. Wie oft würde sich dieser Abschnitt ihres Lebens noch vor ihrem inneren Auge wiederholen?
Unwillkürlich fuhren ihre Finger über die feine weiße Linie an ihrem Haaransatz. Sie hatte Glück gehabt, man sah die Narbe nur, wenn man bewusst danach suchte. Sarah nahm die rechte Hand zurück ans Steuer.
Mühsam kämpfte sich ihr müder Blick an denen auf höchster Stufe arbeitenden Scheibenwischer vorbei auf die Straße.
Wendete sich womöglich der Himmel höchstselbst gegen ihre Entscheidung? War sie so falsch? Als sie mit Erik und Sabine darüber gesprochen hatte, hatte ihr Plan so vernünftig gewirkt. Bis heute Morgen hatte sie ja auch noch ihre Freunde gehabt, die ihr beigestanden und sie auf ihrem Weg bestärkt hatten. Mit der Entfernung zu ihnen und allem, was ihr vertraut war, mehrten sich die Zweifel wieder. Sarah war ins Unbekannte aufgebrochen und nun schien sich alles zu einer dunklen Warnung vor ihrem Plan zu verdichten.
„Das Unbekannte …“, wiederholte Sarah ihre Gedanken leise vor sich hinmurmelnd. „Jetzt übertreib nicht so maßlos, du bist nun auf dich gestellt und musst endlich wieder lernen, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen! So sieht es aus!“
Selbständig Denken und Handeln Es war nicht eben Sarahs Stärke, jedenfalls nicht, wenn es ihre eigene Belange betraf. Nicht mehr. Vor Markus’ Zeit war das anders gewesen. Aber sie hatte die Veränderung einfach nicht bemerkt - hatte es nicht merken wollen. So, wie sie in den Jahren ihrer Ehe hinter ihrem Mann hergetappt war - dekorativ, lieb, hübsch - war sie ihrer Mutter doch ähnlicher, als sie es wahrhaben wollte …
Sarahs Harmoniebedürfnis hatte sie immer wieder diverse Varianten der Realitätsverweigerung finden lassen. Wie so etwas ging, hatte sie von Opa Hermes gelernt, der sie gern und hingebungsvoll mit in seine Welt genommen hatte, eine Märchenwelt voller Harmonie, in der sich alles zum Guten wendete. Die Welt von Opa Hermes - er hieß eigentlich Heinrich Hermersdorf - war jedoch alles andere als harmonisch. Über all die Jahre hatte er die ständige Nörgelei und die spitzen Bemerkungen seiner zweifellos sehr anstrengenden Frau Elisabeth klaglos ertragen. Er war zwar ein einfacher Bauer aus dem Westerwald, aber es waren wohl seine Fantasie und seine eigentümliche Wortgewandtheit, die maßgeblich zu dem beigetragen hatte, was Sarah heute war. Nur einmal hatte Sarah ihn ungehalten erlebt: als sie ihm Markus als ihren Zukünftigen vorgestellt hatte. Obwohl es in ihrer Jugend keinen Grund gegeben hatte, vor der Realität zu fliehen, waren die Märchen und Geschichten von Sarahs Opa wie ein Stückchen Urlaub aus der Wirklichkeit gewesen. Diesen Luxus gönnte sich Sarah in den letzten Jahren immer öfter.
Noch einmal schaute Sarah in den Rückspiegel, in dem sie ihre Tochter Adina sehen konnte. Ihr schlafendes Gesicht hatte die Erinnerung wieder wach werden lassen. Damals hatte Adina auch geschlafen …
Wenn Markus sie fand, würde er Adina töten. Daran zweifelte Sarah keinen Augenblick. Nun hörte sie Adina vom Rücksitz her jammern. Die Realität außerhalb des Autos war auch gar zu scheußlich und Adina genauso erschöpft wie ihre Mutter. Sarah kämpfte ihre eigene Müdigkeit nieder und versuchte ihrer Stimme einen optimistischen Klang zu geben.
„… In einer Zeit, wo es noch Tore zwischen den Welten gab, da wurde einst ein Königskind geboren. Das Mädchen, auf das seine guten Eltern lange, lange hatten warten müssen, sah aus wie ein Ebenbild ihrer Mutter, deren Schönheit im ganzen Land gepriesen wurde. Ihre Haut war von der Reinheit und Farbe frisch aufgeschnittenen Holzes und ihr Haar hatte den schwarzen Glanz eines Adlerflügels …“
„So wie ich?“
„So wie du“, bestätigte Sarah, froh, die Aufmerksamkeit ihrer Tochter gewonnen zu haben.
„… Der weise Merlin wusste, dass diesem wunderschönen kleinen Mädchen eine große Aufgabe bevorstand. Bald … schon sehr bald würde die kleine Prinzessin ihre lieben Eltern wieder verlassen müssen, um in eine völlig unbekannte neue Welt aufzubrechen. Nur dort, in der fremden Welt, in der selbst Merlin noch nicht gewesen war, konnte die Prinzessin den Schlüssel zur Rettung ihrer eigenen Welt finden ...“, erzählte Sarah weiter, bis das Köpfchen ihrer Tochter abermals zur Seite sank.
Leicht vorgebeugt blinzelte Sarah mit vor Übermüdung brennenden Augen über das Lenkrad. Ihre Hände waren schweißfeucht verkrampft, ihre Bluse klebte ihr am Körper, Rücken, Gesäß und Oberschenkel taten ihr ebenso weh wie ihr Kopf. Sie dachte sehnsüchtig an ein warmes, nach beruhigendem Lavendel duftendes Bad. Hoffentlich waren ihre Sachen angekommen.
Sie und Adina waren auf dem Weg in ein kleines, möbliertes Ferienhaus, das für die nächste Zeit ihr Heim werden sollte. Ein gemietetes Haus, mitten im Harz. Kaum dachte sie an das Unbekannte, das sie und ihre Tochter erwartete, kam der Zweifel zurück und ließ ihr kaum noch Raum für andere Gedanken. Verstohlen schaute sie in den Rückspiegel. Adina schlief unruhig. War es richtig gewesen, so plötzlich ihre Zelte in Freiburg abzubrechen? Oder war sie hysterisch und reagierte übertrieben?
„Nein“, murmelte sie verhalten. Einem Mantra gleich wiederholte sie in Gedanken, was Erik und Sabine ihr seit anderthalb Jahren sagten. „Es gab keinen anderen Weg!“, bekräftigte sie, trotz ihrer Zweifel.
Oder doch? Was würden ihre Eltern sagen, wenn sie wüssten, was sie gerade tat? Hans-Hermann Leitner würde entrüstet feststellen: „Kind, Liebes – du bist ja hysterisch! Das steht dir nicht – wahrlich nicht.“ Und er würde wie bei jedem zwischenmenschlichen Problem hilflos nach seiner Frau rufen. „Gertchen! Rede mit dem Kind!“
Sarahs Augen brannten. Vor einem Jahr, vier Monaten und zweiundzwanzig Tagen - kurz nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus - war sie, die angesehene Journalistin Sarah Leitner-Bergholm, aus der angesehenen Bergholmvilla über den Dächern von Freiburg ausgezogen und hatte ihren angesehenen Gatten Markus Bergholm verlassen.
Zwischen dem ersten Schlag von Markus bis zu ihrem Auszug waren viele Jahre, viele Schläge und Hunderte seiner Änderungsbeteuerungen ins Land gegangen. Schließlich war sie geflüchtet – fast zu spät. Sie hatte eine Wohnung gemietet.
Bald nach dieser Entscheidung hatten sich Zukunftsängste eingestellt. Sarah hatte eine Tochter und nur wenige Ersparnisse. Deswegen hatte sie weiterhin zeitweise in ihrem alten Job bei der Zeitung gearbeitet, wenn auch in einer kleineren Lokalredaktion statt in ihrem alten Büro neben dem ihres Mannes.
Sabine hatte sie einmal gefragt, ob sie Markus noch liebe, weil sie so an ihrem Job festhielt. Sarah hatte lange über diese Frage nachgedacht. Ja, ein Teil von ihr liebte Markus noch immer. Aber dieser Teil liebte jenen jungen, strahlenden, vor Energie strotzenden Markus, den sie in München kennen gelernt hatte. Der heutige Markus machte ihr Angst. Mehr noch - seine Nähe verursachte ein dumpfes Gefühl aufsteigender Panik, vor allem jene Nähe, die nicht durch die Kontrolle der Öffentlichkeit abgesichert war.
Nach der Scheidung war es Markus immer weniger gelungen, sein eloquent weltmännisches Gehabe aufrecht zu erhalten. Es folgten Nachstellungen, Drohungen, Telefonterror und die Belagerung ihrer Haustür. Die Situation drohte völlig zu eskalieren, da sich Markus im Recht sah. Sie, Sarah, war sein Eigentum und sie war auch zugleich der Dieb, der ihm sein Eigentum streitig machte. Sie war zu seinem erklärten Feind geworden, und Markus verwendete seine gesamte Kraft und Energie, um diesen Feind zu bekämpfen.
Und dann hatte dieser Briefumschlag im Flur ihrer Wohnung gelegen. Eine Woche war das her. Er war von Markus. Als sie das unpersönliche braune Packpapier öffnete, waren ihr Scherben entgegengefallen. Scherben mit Blut daran – es waren die Scherben ihres Jugendstilspiegels und es war auch ihr Blut. Der Brief, den er beigelegt hatte, brannte ihr förmlich in den Händen, immer wenn sie daran dachte.
Erst töte ich den Bastard und dann dich, meine Liebste! M.
Sie trug das Schriftstück klein eingerollt an einem Lederband um den Hals, zusammen mit einem Schutzamulett, das ihr Sabine zum Trost geschenkt hatte.
Nicht dass sie seine Worte je vergessen würde – die makabre Kette war so etwas wie Warnung und Schutzzauber zugleich.
Markus’ langjähriger Freund Erik war schier fassungslos über die Persönlichkeitsveränderung, die sich im aggressiven Verhalten von Markus widerspiegelte. Am allerwenigsten verstand es Sarah selbst.
Sie dachte an Markus’ volles hellblondes Haar, das ihm seitlich in die Stirn fiel, die blauen Augen, die immer lachend gewirkt hatten, seine ebenmäßigen Zähne, die seinem Lachen etwas Einnehmendes gaben … gegeben hatten. Diesen jungen, temperamentvollen Mann würde sie nie, nie wieder sehen. Heute wirkte sein Gesicht eher kantig, seine blauen Augen eisig und er trug sein Haar kurz und kontrolliert.
Die Regentropfen traktierten die Windschutzscheibe mit mürbender Unablässigkeit. Sarah streckte sich im Sitz, atmete entschlossen durch und drängte die Erinnerung an Markus’ Gesicht zurück. Erik und Sabine hatten völlig recht, er würde sich von nichts und niemanden von seiner Drohung abringen lassen. Ihre Flucht war richtig.
Niemand würde sie in diesem kleinen Harzer Dorf vermuten. Niemand außer Erik und Sabine, die ihr diese Flucht mit einem Auftrag schmackhaft gemacht hatten. Sarah lächelte. Was hätte sie ohne diese Freunde gemacht?
Adina warf den Kopf hin und her und schmatzte ein wenig. Wahrscheinlich würde sie gleich aufwachen.
Während Sarah den Blinker betätigte, um an der Autobahnabfahrt Rügen abzufahren, legte sie sich eine grobe Fortsetzung des Märchens zurecht, das sie auf dieser Fahrt für Adina begonnen hatte. Als sie die stark befahrene Autobahn verließ und auf eine wenig befahrene Landstraße Richtung Harz einbog, machte sie die plötzliche Einsamkeit beklommen. Ihre Augen begannen erneut zu brennen, doch sie drängte die Tränen zurück, denn Adina erwachte.
Und dies tat sie, wie alle Vierjährigen greinend und erbost darüber, die heile Welt der Träume verlassen zu müssen. Angesichts der Lautstärke, mit der die schweren Tropfen auf das Wagendach des Geländewagens prasselten, wurde Adinas Protest zu einem ängstlichen Wimmern.
Sarah sah im Rückspiegel, dass auch ihr Hund Angus misstrauisch über die hintere Sitzbank schielte. Je ernster er dreinschaute, desto witziger sah er aus.
Adina jammerte: „Mami …“
„Dinchen, ist ja alles gut“, tröstete Sarah. „Weißt du … wir sind jetzt schon ganz nah am Harz und ich hab dir doch erzählt, dass es hier noch all die guten Wesen gibt, die für die Natur sorgen.“
„Hm-m“, machte die Vierjährige und schnüffelte wenig überzeugt vor sich hin.
„Weißt du … da draußen schütten ein paar Riesen nun ganz viel Wasser auf die Berge.“
Adinas Interesse erwachte. „Waru-um?“
„Na überleg doch mal, irgendjemand muss die hohen Berge doch sauber machen!“
„Waru-um?“
Sarah starrte angestrengt durch die regennasse Windschutzscheibe und zuckelte immer langsamer werdend die steile, enge Straße hinauf. „Schau, bald ist doch Ostern und die Blümchen warten doch schon darauf, dass der Schnee weggespült wird und sie aus der Erde dürfen.“
„Wird der weggespült?“, fragte Adina erstaunt.
„Na klar! Er wird vom Berg gespült und dann gefressen!“ Sarah trat kurz auf die Bremse. Ein anderer Wagen blendete sie.
„Gefressen?“, fragte Adina interessiert. Ihre ängstliche Spannung ließ nach.
„Weißt du, Dinchen, in der Stadt, da wird der Schnee dreckig und taut dann einfach weg. Denn die Schneefresser mögen keinen dreckigen Schnee aus der Stadt essen, der nach Autoabgasen schmeckt!“
„Schneefresser mögen nur Harz-Schnee?“
„Nicht nur den vom Harz. Sie essen am liebsten sauberen Bergschnee und den am allerliebsten, wenn er mit einer Sauce aus süßem Frühlingsregen über die Berghänge hinuntergespült wird, denn sie können nicht klettern!“
Adina starrte nachdenklich aus dem Seitenfenster. „Ist der Regen da draußen süß?“
„Ja, an manchen Tagen im Frühling ist der Regen süß!“
„Kann ich den Regen probieren?“
„Natürlich, aber nicht jetzt.“
„Doch!“, beharrte Adina. Sie hatte zu dem für sie typischen, überaus energischen Ton zurückgefunden, den Sarah eigentlich hätte bremsen müssen.
„Nein Mäuschen, er ist noch ein paar Tage lang süß. Ehrenwort!“
„Ich will aber jetzt!“
Sarah fühlte, dass Adina gegen den Vordersitz trat. Sie glaubte ihrer Tochter Geduld schuldig zu sein. Immerhin war sie es, die Adinas Welt hatte zusammenbrechen lassen. „Pass auf Dinchen – ich muss gleich noch mal auf die Karte nachsehen, damit wir uns nicht verfahren. Dann mache ich dir das Fenster auf und du kannst den Regen probieren. Aber ich muss erst eine Stelle finden, wo ich halten kann!“
Die Niederschläge waren heftiger als alles, was Sarah bisher kannte.
„Eine wirklich komische Gegend hier“, murmelte Sarah leise vor sich hin.
„Halten wir je-etzt?“, quengelte Adina von hinten.
„Hab noch ein wenig Geduld.“ Sarah atmete einmal tief durch, denn auch in ihre Stimme hatte sich ein leichtes Zittern verirrt.
Die Straße wurde immer schmaler. Sarah suchte den rechten Straßenrand nach einer Parkbucht ab. Sie war verunsichert und befürchtete, eine Abfahrt verpasst zu haben. „Mist“, fluchte sie verhalten, „die Abfahrt nach Silberborn hätte längst kommen müssen!“
„Wann sind wir endlich da?“, quengelte Adina. Sie war nach der Strapaze der weiten Fahrt völlig überreizt. Auch Angus mautschte leise vor sich hin und machte deutlich, dass es ihm keinen Spaß mehr machte, zwischen Koffern, Taschen und Kartons zu kauern.
Es war etwa acht Uhr abends, als sie durch einen Ort namens Wildemann fuhren. Sarah nahm jene bedrückende Leblosigkeit wahr, die jemand empfindet, der sich fremd und allein fühlt. Niemand war zu sehen. Jede Ecke und jede Hauswand, die sie mit schmerzlicher Klarheit wahrnahm, wirkte fremd und feindlich. Im weißlichen Licht der Straßenlaternen sahen alle Gebäude gleich aus. Die meisten waren mit senkrechten Brettern verkleidet. Haustüren führten direkt auf die Straße.
„Bei Sonne und wenn der Frühling ein paar grüne Flecken hier her zaubert, sieht es bestimmt sehr hübsch aus“, intonierte Sarah, ohne viel Überzeugungskraft. Schemenhaft registrierte sie, dass sich weitere Häuser nach oben in den Hang fraßen. Offensichtlich handelte es sich hier um ein extrem enges Tal, denn die letzten Fensterlichter befanden sich weit oben über ihr. Sarah zog fröstelnd die Schultern hoch.
In ihrer bisherigen Welt wiesen Dorfstraßen hübsche Vorgärten auf, hie und da lockerte ein Baum, eine Bank oder ein Gedenkstein das Bild auf. Aber hier gab es offenbar nur Häuserfronten in dunklem Holz, und nicht einmal einen Bordstein.
Dann brach der Ort einfach ab und sie waren unmittelbar nach dem letzten Haus wieder von dichtem Wald umgeben. Normalerweise mochte Sarah die Natur, doch dieser undurchdringliche Nadelwald hatte etwas Bedrohliches an sich. Immer wieder leuchteten die Augen eines Wildtieres wie zwei glühende Punkte auf. Sarahs zunehmende Verzagtheit übertrug sich und Adina fing an zu weinen. Angus’ sorgenvolles Hundegesicht ruhte auf der Rückenlehne.
„Oh mein armes Schätzchen! Nun dauert es wirklich nicht mehr lang. Schau!“ Sarah wies nach vor. „Dort vorn habe ich ein Licht gesehen. Du auch?“
„Nein. Ist es das Dorf, wo wir hin wollen?“, fragte Adina hoffnungsvoll.
„Entweder das, oder es ist die Trostfee, die dich weinen gehört hat. Du weiß doch, je mehr man weint, desto heller muss sie leuchten!“
Sarah bemerkte einen abgehenden Waldweg und fuhr kurzentschlossen hinein. „So mein Schatz, jetzt kannst du den Regen kosten.“ Sie drückte einen Knopf, um Adinas Fenster ein Stück weit zu öffnen. Dann schaute sie sich im Lichtkegel der Autoleuchte die Karte an. Ihr schmaler Finger fuhr die Strecke auf der Karte entlang, während sie mit ihrer Müdigkeit rang. Fast starr blieb ihr Blick an dem mattgrauen Reif an ihrem Ringfinger hängen, der letzten Verbindung zu ihrer Ehe. Entschlossen zwang sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Karte und die feine gelbe Linie, die ihre Straße darstellte. Sie hatte die Abfahrt verpasst und musste ein Stück weit zurückfahren. Sarah schaute sich noch einmal die Route an. Ihr Zielort lag im Oberharz zwischen Clausthal Zellerfeld und Goslar. Sie hätte doch die Route über Goslar wählen sollen. Sie hätte nie gedacht, dass es mitten in Deutschland derart ausgedehnte zivilisationsfreie Gebiete gab.
Es half nichts, sie musste bis fast nach Lautenthal zurück und sich über ein verschlungenes Sträßchen bis zu ihrem Zielort durchkämpfen. Sarah fuhr mit dem Finger ihre Route ab und sagte sich die Worte vor, um sie sich besser einzuprägen. Die Namen, die sie dabei leise aussprach, hätten aus einem von Opa Hermes’ Märchen stammen könnten. „Wildemann, Lautenthal, Bockswiese … am Auerhahn vorbei … eine Serpentine hoch … Silberborn.“
Sarah schloss das Fenster wieder und legte den Rückwärtsgang ein. Die Reifen rutschten durch. Panik stieg in Sarah auf. Wenn sie sich hier in dieser Einöde festfuhr … Mit zitternden Fingern schaltete sie den Vierradantrieb zu und setzte sachte ein zweites Mal an. Endlich fanden die Reifen Halt und der Wagen bewegte sich stockend zurück auf die Straße.
Nach einer Zeit wand sich das Sträßchen - es verdiente kaum noch diesen Namen - einer Schlange gleich ein Tal hinauf. Sarah kniff die übermüdeten Augen zusammen. Ihr Scheinwerferkegel schien seit einer Ewigkeit nichts Anderes mehr als fahle Fichtenstämme zu erfassen. Im zweiten Gang folgte sie der Straße, als sie plötzlich merkte, dass eine der vielen Kurven enger geriet, als sie erwartet hatte. Sie bremste abrupt und erkannte mit Schrecken, dass sie fast eine graue Felswand gerammt hätte, die sie nun ungläubig anstarrte. Von links schob sich ein rötlicher Halbmond in die graue Front. Womöglich eine Versteinerung aus Urzeiten, sagte Sarah sich und betrachtete das eigenartige Bildnis. Es hätte der Stoßzahn eines größeren Urtieres sein können.
„Was ist denn?“, fragte Adina schnüffelnd von hinten und Sarah überlegte, ob sie ihre Tochter auf das merkwürdige Naturbildnis aufmerksam machen sollte. Da sie selbst bei dem Anblick ein arg beklemmendes Gefühl bekam, entschied sie sich dagegen und setzte ihre Fahrt mit dem Kommentar: „Es ist nichts, Schätzchen“ fort.
So plötzlich, wie der Wald sie verschlungen hatte, so plötzlich gab er sie wieder frei. Fast dachte Sarah, sie wäre im Kreis gefahren, denn Silberborn unterschied sich auf den ersten Blick kaum von den anderen Orten, die sie bereits durchquert hatte. Wieder jene Holzhäuser und Haustüren, die direkt auf die Straße führten. Doch das Dorf schien kleiner und irgendwie älter zu sein.
Wie sollte sie ihr Haus finden? Sarah hatte nicht mit menschenleeren Straßen gerechnet. Im Schritttempo durchfuhr sie die Ansammlung von Häusern und passierte dann eine kleine Kirche, die kaum größer als ein Wohnhaus war. Sie kannte ihr zukünftiges Heim nur von einem Bild im Internet, wo es als rotbraunes, komfortables Feriendomizil im Harz angepriesen wurde. Ängstlich ließ sie ihren Blick schweifen und suchte ihr Haus. Die Straße mündete in einer Wendeplatte, die an dichtem Wald endete. Wenige Meter vor ihr zweigte links ein Weg ab. Langsam fuhr Sarah darauf zu und blendete die Scheinwerfer auf. Der unbefestigte Weg führte tatsächlich auf ein unbeleuchtetes Haus zu, das dem auf der Abbildung ähnelte.
Entschlossen bog sie in den namenlosen Matschweg ein. Im nächsten Moment trat sie wieder einmal hart auf die Bremse: An der Ecke des Hauses glaubte sie eine Gestalt zu sehen, die sie anzustarren schien. Der Wagen geriet ins Schlingern und stand. Sarah suchte panisch das Dunkel ab. Nichts.
Ihre Nerven waren wohl völlig überreizt. Sie fuhr langsam weiter und stellte den Wagen vor der Haustür ab.
„Warte noch einen Augenblick, Adinchen“, sagte sie zu ihrer Tochter. Sie stieg aus und ging zur Tür. Vorsichtig steckte sie den Schlüssel, der den ganzen Tag wie ein Rettungsanker neben ihr auf dem Beifahrersitz gelegen hatte, in das Schloss. Er passte. Sie waren angekommen.
Sarah betätigte den Lichtschalter. Nichts passierte. Die Panik wollte wieder aufsteigen, aber sie ermahnte sich zur Ruhe. Hatte sie nicht eine Taschenlampe im Handschuhfach? Sarah holte die Lampe und begann ihre Suche nach dem Sicherungskasten. Sie fand ihn schließlich hinter der Haustür und legte alle Hebel um. Sofort wurde der Flur in aufdringliche grünweiße Helligkeit getaucht. Sarah sah, dass man ihre kistenverpackte Habe wahllos hier und vermutlich im Wohnzimmer verteilt hatte. Viele der Kartons waren umgekippt. Hatte jemand darin gewühlt?
Merkwürdig. Eriks Studenten hatten den Auftrag übernommen, und sie hatten damals so einen netten Eindruck gemacht.
Sarah weigerte sich, zu registrieren, dass sie in einem Chaos gelandet war. Seufzend zog sie einen der unversehrten Kartons vor die Haustür, um sie am Zufallen zu hindern, und kehrte zum Wagen zurück. „Zieh dein Mäntelchen an, Liebes, im Haus ist es noch kalt.“
Adina näherte sich neugierig ihrem neuen Heim. Angus sprang behände über den Sitz nach draußen und verschwand augenblicklich in der Dunkelheit, um sich zu erleichtern.
Sarah öffnete die Heckklappe ihres Wagens und begann ihn leer zu räumen. Mittlerweile war sie so erschöpft, dass sie dabei fast in Trance fiel.
Die letzte Kiste ließ sie härter als beabsichtigt auf die Küchentheke fallen. Sie atmete einmal durch und begann dann sofort mit der Zubereitung eines schnellen Tütennudelgerichts für Adina, die fast über ihrem Teller einschlief.
Während Adina aß, durchforstete Sarah das Kistenchaos nach der Bettwäsche und richtete die Schlafzimmer her. Es war mittlerweile fast halb zehn, und Adina fiel in ihrem neuen Bett angekommen sofort in tiefen Schlaf.
Dieses Glück war Sarah nicht vergönnt. Obwohl sie zum Umfallen müde war, kam ihr Geist nicht zur Ruhe. Immer wenn sie nicht durch Adina oder ihre Arbeit gefordert war, kam es zurück, das ewige Durchdenken des Vergangenen und die bange Frage, ob sie das, was geschehen war, hätte sehen und aufhalten müssen. Sie warf sich in dem fremden Bett mit dem fremden Geruch herum, bis die Laken völlig zerwühlt waren. Warm wurde es auch nicht recht, obwohl die Heizkörper knackten.
Ein Geräusch ließ sie hochfahren. Starr vor Schreck sah sie die Schlafzimmertür langsam aufschwingen. In einer kurzen Vision sah sie das kantige Gesicht von Markus vor sich. Doch es war nur Angus, der leise hereinschlich, sich neben ihrem Bett niederließ und behaglich seufzte. Für ihn war es einfach. Er war zu Hause, wenn er in ihrer Nähe war.
Sarah ließ sich in ihr Kissen sinken und heulte sich in den Schlaf.
Fast katzenhaft bewegte sich Freya Steiger durch die Tannen oberhalb von Silberborn und genoss die Schärfe der kalten Morgenluft. Das eisige Wasser der Quelle, in dem noch die fahle Scheibe des Mondes zu sehen gewesen war, hatte ihr seine belebenden Kräfte geschenkt. Freya hatte an diesem Tag nicht nur ihre rituelle Waschung vorgenommen, sie hatte den Rest der Nacht auch für ein stilles Zwiegespräch mit der Mondgöttin genutzt, die ihr über die Wasseroberfläche erschienen war. Zwar wusste sie noch immer nicht, warum sich die Legende nicht erfüllte, aber sie fühlte die wohltuende Kraft der Zuversicht, die ihr dieses Gebet gegeben hatte.
Zwei Hirschkühe sahen erstaunt auf und setzten behäbig zur Flucht an. Freyas bernsteingelbe Augen verschmälerten sich zu einem dezenten Lächeln, als sie erkannte, dass die Tiere sie nicht kommen gehört hatten. Obwohl nicht mehr jung, bewegte sich Freya mit der Anmut einer jungen Frau. Ihre Schritte im Wald waren nur für geübte Ohren zu hören. Freya kannte hier jedes Steinchen und jeden Ast. Dies war ihre Welt.
Doch anstatt zurück zu ihrem Haus, dem größten in Silberborn, zu gehen, wo ihr Mann sie sehnlichst mit dem Frühstück erwartete, schlug sie einen anderen Weg ein. Eckard konnte warten. Es war seine Lebensaufgabe, zu warten, bis sie ihn brauchte. Sie brauchte ihn selten.
Ihre vollen Lippen verzogen sich zu einem boshaften Lächeln bei dem Gedanken, dass Helene nun wohl seit geraumer Zeit vor ihrem Haus auf und ab trampelte, um sie nicht zu verpassen. Auch Helene wartete auf sie. Sie war loyal und zuweilen recht brauchbar. Aber ihr Geist war von einer Beschränktheit, dass Freya sie am liebsten in der Quelle ertränkt hätte, um nicht ständig von dem dummen und anbiedernden Geschwätz belästigt zu werden. Im Geiste sandte sie eine stumme Entschuldigung an die Mondgöttin, verbunden mit dem Versprechen, ihr niemanden von so geringem Wert und so ungefälligem Äußeren anzubieten.
Helene tauchte vor ihrem inneren Auge auf, während Freya auf das neue Holzhaus zuschritt. Helenes ergrauendes Haar war ständig fettig und ihre Silhouette glich einem Sauerkrautfass. Dabei war die Frau nur wenige Jahre älter als sie selbst. Angewidert vertrieb Freya das Bild und strich den schweren dunkelroten Stoff ihres Mantels glatt, der ihrer schlanken Figur schmeichelnd folgte. Mit einer sinnlichen Geste zwirbelte sie ihr langes Haar hinter dem linken Ohr zusammen, sodass es sich wie ein langer Zopf über ihre Brust legte. Lautlos näherte sie sich dem Haus, in dem sie inzwischen jeden Winkel kannte. Sie hatte alles selbst noch einmal durchsucht, nachdem Konrad versagt hatte. Aber auch sie hatte nichts gefunden.
Jeden der Kartons hatte sie sich sehr sorgfältig angesehen. Sie hatten ihr viel über die Besitzerin erzählt. Sie war demnach eine Frau, die mit einem vier- oder fünfjährigen Mädchen kam. Freya hatte jedes Buch, jedes Kleidungsstück und jedes Spielzeug eingehend studiert. Der Besitz der Frau war geschmackvoll und zeugte von hoher Bildung. Dennoch hatten die Besitztümer Freya nicht verraten, warum Gisela gerade diese Frau ausgesucht hatte. Bevor sie nach Hause ging, wollte sich Freya einen Blick auf diejenige gönnen, die Gisela ihr als Gegnerin gesandt hatte. Noch lag das Holzhaus im Zwielicht zwischen Nacht und Tag. Lautlos schlich Freya an der Wand aus schweren Rundhölzern entlang und schaute kurz in das Wohnzimmer. Mit schnellen Schritten bewegte sie sich zur Seitenwand und sah ins Fenster. Im ersten Zimmer lugte ein Wust von schwarzem, lockigem Haar unter einer Kinderbettdecke hervor. Freya nahm alle Einzelheiten des Bildes in sich auf. Im nächsten Fenster erblickte sie die Frau. Ein Hund lag neben dem Bett. Auch er schlief und bemerkte sie nicht.
Auf den ersten Blick wirkte die Gestalt in diesem Bett kaum älter als das Kind nebenan. Auch sie hatte volles lockiges Haar, das ihren Kopf wie eine Corona umgab. Anerkennend fuhr Freyas Blick über das nackte Bein und taxierte den Körper der jungen Frau, die ihre Bettdecke umfasst hielt, als umarme sie jemanden. Freya bemerkte, dass sich der Hund aufrichtete. Aber er blickte nicht zum Fenster, hinter dem sie stand, sondern zur Tür. Das Kind kam und kletterte zu ihrer Mutter ins Bett. Leise zog sich Freya zurück.
Hübsch, dachte sie zufrieden, alle beide. Selbst die Mutter wäre eine würdige Gabe für die Mondgöttin.
Während Freya nach Hause ging, gab sich ihre Phantasie genüsslich dem Bild hin, wie dieses Gesicht unter ihrer Hand im Wasser der Quelle untertauchte.
Nachdenklich klappte Paul Seeger das Buch über Symbole zu. Fast widerstrebend nahm er noch einmal den glitzernden Anhänger in die Hand und besah sich das eigentümliche Schmuckstück. Er hatte es am Vortag am Ufer der Lame gefunden. Er schien aus Silber und durchaus von Wert zu sein.
In einem normalen Dorf hätte er den Anhänger herumzeigen und den Besitzer erfragen können, um ihn zurückzugeben. Aber er lebte keineswegs in einem Dorf, das man als normal bezeichnen konnte. Dieser Anhänger war eines einer langen Reihe von Indizien, die dafür sprachen, dass die Sagen rund um den Harz nicht nur ein Touristenscherz waren. Er betrachtete das kunstvolle Gebilde, das er durchaus schön gefunden hätte, hätte er seine Bedeutung nicht gekannt.
Stilisierte Ranken aus Silber bildeten einen Ring um einen fünfzackigen Stern. Der fünfzackige Stern, das wusste er aus seinem Theologiestudium, war das alte Zeichen für den Hexenglauben, insbesondere dieses hier. Das auf zwei Schenkeln stehende Pentagramm, stand für die weiße Magie. Die Spitzen standen für die vier Aristoteles’schen Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft und den Geist in der Spitze des uralten Symbols. Doch bei diesem Pentagramm wies die Spitze nach unten. Ein umgekehrtes Pentagramm wurde, wie auch das umgedrehte Kreuz, von den Menschen benutzt, die sich dunklen Göttern verschrieben hatten.
Auf dem Ring hockte eine kunstvoll auf ihre Grundform reduzierte Fledermaus. Unten zierte das Schmuckstück ein blutroter, tropfenförmiger Stein.
Aus dem Buch hatte Paul Seeger zu seiner Verwunderung erfahren, dass dieser Anhänger ein bekanntes Symbol darstellte, das selbst unter Hexen verboten war. Das alte Buch über Symbolik bezeichnete den Anhänger als ‚Lamia’. Er galt als Symbol für die Dunkelheit, für den Lebenssaft und für die daraus resultierende Erneuerung. Die Fledermaus, ein nachtaktives Säugetier, das sich der Legende nach vom Blut anderer Lebewesen ernährte, sich erneuerte aus dem Leben anderer ...
Lamia …
War es eigentlich Zufall, dass jenes Flüsschen, das oben im Wald seine Quelle hatte, Lame hieß? Vermutlich nicht.
Paul Seeger beschloss, beim Landeskirchenamt Erkundigungen und Rat über das merkwürdige Schmuckstück einzuholen. Er hatte hier oben versagt und er wusste, er würde sehr bald Hilfe brauchen.
Unzufrieden schaute er aus dem Fenster. Am Morgen hatte er einen dunklen Geländewagen vor dem Haus der Müllers gesehen. Man munkelte ja schon seit geraumer Zeit, dass die Erben das Haus verkaufen oder vermieten wollten. Hoffentlich war es einigermaßen in Ordnung. Paul Seeger erinnerte sich an die unwirschen Bemerkungen von Maria Sontner, die normalerweise die Freundlichkeit in Person war, weil Freya Steiger unbedingt den Schlüssel zu Müllers Haus hatte haben wollen, angeblich um etwas zu holen, was ihr gehöre.
Er konnte diese Freya Steiger einfach nicht einschätzen, mehr noch, er mochte sie nicht. Und ihre plötzliche Anfrage an ihn mehrte seinen Widerwillen derart, dass fast so etwas wie Zorn in ihm aufstieg. Nein, es war keine Anfrage, sondern ein Befehl. Sie hatte ihm unmissverständlich erklärt, dass er das Kind der Steiners mit dem Wasser zu taufen hatte, das der Quelle in der Nacht der Tag-und-Nacht-Gleichen entnommen werden sollte. Wie kam sie dazu, so etwas von ihm zu verlangen? So etwas musste ihn als Mann der Kirche unweigerlich empören.
Er erinnerte sich gut an ihr herablassendes Lächeln. Erwartete sie das als eine Art Gegenleistung dafür, dass ihre Tochter ihm hin und wieder im Haushalt half? Diesem Vorschlag von Freya Steiger, der anfangs so sehr nach Hilfsbereitschaft ausgesehen hatte, hatte Paul sowieso nur unwillig und aus Höflichkeit zugestimmt. Wieso wurde er das Gefühl nicht los, dass sie ihn lenkte? Er hatte das Taufritual in dieser Form natürlich rigoros abgelehnt. Nicht nur, weil er sich als Pastor solchen Auswüchsen alten Heidentums verweigerte, er hatte sich zudem in dem Gefühl gesonnt, endlich ein Exempel statuieren zu können.
Er stieß ein freudloses Lachen aus. Er war mittlerweile sechsunddreißig und wohl noch immer hoffnungslos naiv. Aber nun wusste er: Es war Freya Steiger, die die Geschicke des Dorfes bestimmte, nicht er.
Sie war zugegebener Maßen eine faszinierende Persönlichkeit, obwohl ihre Schönheit den Zenit bereits überschritten hatte. Er hätte wer weiß was darum gegeben, ihr Charisma und ihre Überzeugungskraft zu besitzen, um die Menschen hier oben auf den Weg Gottes einzuschwören. Doch er hatte es gerade mal so weit gebracht, sich ihren Wünschen zu widersetzen.
Mittlerweile ahnte er, wie gefährlich es werden konnte, sich mit Freya Steiger anzulegen. Sie hatte ihn nach seiner ach so großartigen Weigerung mit diesem feinen, kaum auszumachenden Lächeln im Gesicht wortlos angeblickt und war dann gegangen. Geblieben war Konrad. Unter seinem stieren Blick hatte er sich kaum zu rühren gewagt. Einen Moment lang war die irrationale Angst in ihm aufgestiegen, Konrad würde sich auf ihn stürzen. Doch dann war auch er aufgestanden und Freya gefolgt.
Als guter Christ verbot Paul Seeger sich natürlich, vom Äußeren auf innere Werte oder gar das Fehlen derselben zu schließen. Aber wann immer er die gedrungene, leicht schiefe Gestalt dieses Mannes mit den winzigen, fast schwarzen Augen sah, suchte er Distanz zwischen sich und ihn zu bringen. Der Mann war eine gestaltgewordene Drohung, vor allem für ihn, der er offen Partei gegen Freya Steiger eingenommen hatte. Konrad Gerke war dieser Frau geradezu hündisch ergeben.
Ja, Paul Seeger war sich sicher, er würde hier bald Hilfe brauchen.
Entschlossen schob er das Amulett und seinen Ärger über die heidnischen Auswüchse dieses Dorfes zur Seite und beschloss, den neuen Bewohnern von Silberborn einen Willkommensbesuch abzustatten.
Sarah starrte gegen die hölzerne Decke des fremden Schlafzimmers, in dem sie in nächster Zukunft ihre Nächte zubringen würde. Adina lag zusammengekuschelt an ihrer linken Seite. Es musste wohl gegen halb sieben gewesen sein, als sie ihre Tochter durch den Flur hatte tappen hören. Das Mädchen war ihrem leisen Ruf gefolgt und schlaftrunken ohne einen Laut von sich zu geben unter ihre Bettdecke gekrochen. Das tat Adina nahezu täglich, seit sie das große, moderne, perfekt eingerichtete Haus hoch oben über den Dächern Freiburgs verlassen hatten. Dankbar horchte Sarah dem ruhigen, gleichmäßigen Atmen ihrer Tochter - einem der wenigen vertrauten Dinge, die ihr geblieben waren. Adina schlief tief und fest.
Sarah beobachtete fasziniert das Farbspiel, das Sonne und eilig dahinstrebende Wolken dem Raum angedeihen ließen. Grundsätzlich schien ihr das Zimmer wegen der Vorherrschaft von rötlichem Holz zu dunkel. Dennoch wirkte es warm und freundlich.
Es war ihre Freundin Sabine, die dieses Haus ausgesucht hatte. Sarah hätte lieber etwas in der Nähe einer größeren Stadt gemietet, doch dieses Haus entsprach den Bedürfnissen einer Frau, die untertauchen wollte, tatsächlich perfekt. Es gehörte einem jungen Mann aus Hannover, der es gerade erst geerbt hatte und der es am liebsten mitsamt Inventar verkaufen würde. So hatte Sarah das Häuschen möbliert mieten und ohne ein großes Umzugsunternehmen auskommen können. Sie war Sabines Mann Erik unendlich dankbar, dass er zusammen mit den Studenten, die bei ihm ein Praktikum absolvierten, für den Transport ihrer Habe gesorgt hatte. Dadurch hatte sie Freiburg im Verborgenen und nahezu spurlos verlassen können. Erik und Sabine würden auch die Räumung ihrer bisherigen Bleibe organisieren, die aber erst zwei Monate später erfolgen sollte.
Doch Sarah gab sich keinen Illusionen hin. Markus war ein besserer Journalist, als ihr zurzeit recht war. Er würde sehr schnell merken, dass das Licht in ihrer Freiburger Wohnung von einer Zeitschaltuhr und nicht von ihr selbst betätigt wurde. Und er konnte besser recherchieren als so mancher Detektiv. Er würde sie finden. Andererseits … sie hatte noch nie so ein abgelegenes Dorf wie dieses erlebt. Dieser Umstand würde es Markus schwer machen, sie aufzuspüren.
Erik und Sabine waren die einzigen, die wussten, wo sie war. Mit einem schmerzhaften Stich im Herzen dachte Sarah an ihre Eltern. Zwar hatte sie ihnen gesagt, was sie vorhatte, aber nicht, wohin sie gehen würde und wann. Ihre Eltern nicht ins Vertrauen ziehen zu können, kam ihr wie Verrat vor, doch sie wusste, ihre Eltern würden Markus’ Charme nicht lange standhalten. Nicht seinem Charme und schon gar nicht dem Ansehen und der gesellschaftlichen Stellung der Bergholms.
Sarah schloss die Augen und rief sich das Bild ihrer Mutter vor Augen. Sie war klein, vollschlank und hatte das gleiche dicke, dunkle Haar und jenen olivfarbenen Teint wie Sarah selbst. Ihrer Mutter zufolge hatten sie dieses exotische Aussehen marodierenden Hunnenhorden zu verdanken, die ihre Gene einstmals bei mehr oder minder glücklichen Westerwälderinnen hinterlassen hatten. Gertrud, von ihrem Mann liebevoll ‚Gertchen’ genannt, trug ihr volles Haar meist straff zurückgekämmt und ordentlich zusammengesteckt. Immer huschte sie hin und her, brachte Getränke, holte Essen und Leckereien, wischte, ordnete, nickte und lächelte. Wenn Hans-Hermann Leitner von seiner Arbeit zurückkehrte, ließ sie alles stehen und liegen, um sich voll und ganz ihrem Mann zu widmen. Sie standen kurz vor ihrer goldenen Hochzeit und noch immer blitzte zuweilen jener Jungmädchenglanz in den Augen ihrer Mutter auf, wenn sie ihren Hans-Hermann betrachtete. Gertrud liebte ihren Mann noch immer mit ihrer ganzen Seele und wurde ebenso geliebt. Bevor sich Markus so verändert hatte, war es Sarah nie in den Sinn gekommen, dass ihre eigene Ehe anders verlaufen könnte als die ihrer Eltern.
Im zweiten Jahr ihrer Ehe hatte er sie zum ersten Mal geschlagen. Erst hatte sie ihm geglaubt, als er beteuert hatte, dass dies ein einmaliger Ausrutscher gewesen sei, den er bitterlich bereue. Doch der Ausrutscher blieb kein Einzelfall. In der Zeit ihrer Schwangerschaft hatte sich Markus’ Verhalten drastisch gewandelt. Seine Eifersucht, die Sarah anfangs geschmeichelt hatte, nahm beängstigende Formen an. Er hatte nie geglaubt, Adinas Vater zu sein, denn Adina hatte weder sein blondes Haar noch seine tiefblauen Augen geerbt. Genau wie Sarah hatte sie tiefschwarze, üppige Locken, riesige braun-schwarze Augen und einen olivfarbenen Teint. Markus hatte Adina vom ersten Tag an gehasst. Das Baby hat ihm die Frau genommen. Er war nicht bereit, von der Aufmerksamkeit, die ihm seine Ehefrau seiner Meinung nach schuldete, etwas an diesen wimmernden Wurm abzugeben.
Adina schien die Ablehnung ihres Vaters instinktiv immer gespürt zu haben. Ohne einen Kommentar oder ein Wort des Protestes hatte die Kleine ihr schönes altrosa Kinderzimmer mit dem geblümten Himmelbett und den großen terrassenförmigen Garten verlassen, um mit ihrer Mama in eine Wohnung am anderen Ende von Freiburg zu ziehen. Alles war gut, solange Mama und der verrückte Mischling Angus bei ihr waren.
Adina atmete einmal tief durch und zog leise schmatzend die Lippen zusammen, als sauge sie an etwas. Sarah sah auf sie herab und lächelte. Ja, sie hatte sich richtig entschieden.
Adina erwachte und kuschelte sich noch dichter an Sarah, so als wolle sie die Wirklichkeit aus ihrem Blick aussperren. Sarah streichelte ihr übers Haar und flüsterte: „Die Kunde von Prinzessin Dynias Schönheit verbreitete sich im ganzen Land.“ Sie sah, dass Adina breit lächelte, und fuhr fort. „Es gab den Menschen neue Hoffnung, ein so schönes Königskind am Hofe zu wissen, das auch noch die Klugheit seines Vaters, des weisen Königs, geerbt hatte. Selbst der allwissende Merlin, auf dem in dieser Zeit alle Hoffnung lag, sprach Gutes über das schöne Königskind! Insgeheim wusste er, das die Zukunft des Landes Ostia in den Händen der kleinen Dynia lag, denn er hatte schon lange gemerkt, dass die kleine Prinzessin die magische Gabe hatte.“
„Sie konnte zaubern?“
„Nun, nicht richtig zaubern, aber sie konnte sehen, wo die Augen der anderen versagten, sie konnte in den Gefühlen anderer lesen und sie konnte alle magischen Wesen sehen und mit ihnen reden. Das konnten nur wenige. Damit hatte die Prinzessin alles, was ein Weltenwanderer brauchte.“
„Ein Weltenwanderer?“
„Ja, Dinchen, überall gibt es Menschen, die irgendwann wandern müssen.“
„So wie wir?“
„Ja, so wie wir. Und diese Wanderer sind immer ganz besondere Menschen. Sie müssen genauso geschickt, klug und stark wie ein König sein, um in der neuen Welt bestehen zu können. Es ist ja nicht immer einfach, sich in fremden Welten zurechtzufinden.“
Adina dachte eine Weile nach. Dann kam endlich die Frage, vor der sich Sarah seit mehr als einem Jahr fürchtete.
„Warum sind wir Weltenwanderer?“
Sarah hatte sich längst Antworten zurechtgelegt, doch nun verwarf sie sie alle.
„Weißt du, Dinchen, es gibt verschiedene Gründe, warum jemand zum Wanderer wird. Manche Menschen leiden Not und müssen ihr Glück woanders finden. Andere … andere flüchten vor einer Gefahr …“
„Und die Prinzessin ist auch ein Wanderer?“
„Ja, auch Dynia muss wandern. Sie wird Merlins letzter Lehrling und muss in andere Welten reisen, weil Ostia vom Untergang bedroht ist. Sie muss das Wissen finden, wie man das Unglück Ostias aufhalten kann. Und außerdem muss Dynia fliehen, weil sie ein Mädchen ist. Nie hatte jemand zuvor von einem Mädchen mit den Gaben eines Großmagiers gehört. In Dynias Welt waren es bisher immer die Jungen, die solche Gaben besaßen und zum nächsten Großmagier wurden. Doch nun scheint es ein Mädchen zu sein, dem diese unendlich schwere Bürde zufällt. Das gefiel den Menschen in Ostia gar nicht.“
„Warum nicht?“
„Es ist anders, als sie es gewohnt sind. Menschen haben meist Angst vor Veränderungen und deshalb verlangten sie vom König und der Königin, Dynia wegzuschicken, damit ein weiteres magisches Kind geboren werden kann.“
„Aber das macht die Eltern doch traurig!“
„Ja, Dinchen, es macht die Eltern sehr traurig.“
„Sind Opa Hans und Oma Gertchen auch traurig, weil wir weg sind?“
„Ja. Das sind sie.“
„Aber sie könnten doch auch hier her kommen. Es ist ein Wichtelhaus! Das ist schön!“
Sarah schaute ihre Tochter erstaunt an. „Ein Wichtelhaus?“
„Ja, es sieht genauso aus wie die Wichtelhäuschen, die wir immer bei Opa und Oma bauen, nur groß. Ich mag Wichtelhäuschen!“, verkündete Adina mit ausgebreiteten Ärmchen und lachte.
Sarah hatte mit Adina immer aus Stöckchen kleine Häuser für die Waldwichtel gebaut. Sie schaute sich um. Adina hatte Recht. Dieses nordische Blockhaus war nach dem gleichen Prinzip gebaut. Sarah lächelte. Sie wohnten also in einem Wichtelhaus.
„Können Opa und Oma nicht kommen?“, fragte Adina noch einmal.
„Vielleicht später. Weißt du, auch Prinzessin Dynia musste allein gehen und durfte weder Merlin noch ihre Eltern noch Arios, den Gänsejungen, mitnehmen. Manchmal geht es eben nicht anders.“
„Wo ging sie denn hin?“
„Sie geriet einfach in eine andere Welt, als sie schlief, so wie du gestern. Sie geriet durch ein Tor, weil niemand ihren Schlaf bewachte, weißt du. Du hattest Glück, wir sind zusammen in die neue Welt aufgebrochen … wir zwei und Angus!“
Adina dachte angestrengt nach. Dann hellte sich ihre Mine auf. „Erleben wir Abenteuer?“
„Aber ja!“
„So wie die Prinzessin?“
„So wie die Prinzessin!“
„Und die Prinzessin war allein? Wo waren denn ihre Eltern? Und wo war Merlin?“
„Normalerweise schläft in Ostia niemand allein. Aber an diesem Tag … Die Eltern wussten ja schon lange, dass der Tag irgendwann kommen musste. Dynias Vater war schon vor vielen Fruchtzeiten fortgegangen, um die anderen Könige zu besuchen und um sich ein Bild von der Lage im Reich zu machen. Es war nämlich so: Die magischen Tore, die nur der Großmagier öffnen durfte, hatten sich von allein geöffnet und schlossen sich nicht wieder. Dadurch geriet der gefräßige rote Sand in Dynias Welt. Das war schlimm, denn der Sand fraß das Leben auf.“
„So wie der Sand im Urlaub, im Pyramidenland?“
„Ja, genau wie im Pyramidenland. Selbst Merlin konnte die Tore nicht mehr alle schließen. Eines Tages erreichte die Kunde den Hof von Ostia, dass der rote Sand bereits das Reich Suda vernichtet hatte. Sie brauchten eine Lösung. Und Dynia war Merlin eine gute Schülerin. Sie war zwar noch sehr jung, aber nur sie konnte in die anderen Welten reisen und Wissen sammeln. Wissen, welches Ostia vielleicht retten konnte. Denn Merlin wurde langsam zu alt dafür. Auch konnte er nicht weg, denn er musste die Tore in Dynias Welt finden und schließen. So beschloss er, dass Dynia erstmals allein einschlafen sollte. Aber auch er war sehr, sehr traurig, wusste er doch, dass sie am nächsten Morgen in einer anderen Welt aufwachen würde. Arios, der Dynia von ganzem Herzen liebte, hatte sich Merlin in den Weg gestellt und wollte den Großmagier von seinem Vorhaben abbringen, doch er war nur ein einfacher Gänsejunge. Merlin hatte den Jungen trotzdem sehr gern und was er tun musste, tat ihm unendlich leid, doch er konnte nicht riskieren, dass Arios Dynia etwas sagte. Da schwang er seinen Zauberstab und zauberte den Gänsejungen für eine Zeit in den See, der neben dem Schloss lag. Schweren Herzens führte Merlin Dynia in weitem Bogen um den See herum, damit sie den verzauberten Arios nicht sah, in den Wald und ließ sie unter einer großen, herrlich duftenden Fichte einschlafen. Er betrachtete sie noch ein bisschen, dann ging er ganz leise und sehr traurig weg.“
„Und dann?“
„Na ja … dann wachte die Prinzessin irgendwann auf und hatte großen Hunger … wie du jetzt“, schmunzelte Sarah und kitzelte ihre Tochter. Als Adina lauthals lachte und Angus wie toll dazu bellte, stand Sarah auf, um das Frühstück vorzubereiten.
Erstmals inspizierte Sarah ihr neues Heim bei Tageslicht. Die Heizkörper knackten zwar, doch es wurde nicht recht warm. Sie nahm sich vor, die Eigner des Hauses anzurufen, um sie nach der Heizung zu befragen. Dennoch hatte Adina mit ihrer Begeisterung recht. Es war ein freundliches Haus.
Die anheimelnde Atmosphäre setzte sich auch in den anderen Räumen fort. Das Wohnzimmer mit Essecke und der angrenzenden kleinen Küche nahm etwa die Hälfte des Hauses ein. Auf der anderen Seite des Flurs lagen zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Abstellkammer und der Heizungsraum.
Sarah ging auf die bis zum Boden reichenden Wohnzimmerfenster zu, die den Blick auf eine kleine Terrasse mit beigefarbenen Natursteinen und einen kleinen Garten freigaben. Die ungepflegte Rasenfläche endete abrupt am Fuße schlanker, dunkler Tannen.
Sie hätte es schlimmer treffen können, befand Sarah einigermaßen zufrieden. Doch der Gedanke, dass die nächsten Nachbarn so weit entfernt wohnten und sie vermutlich mehr als eine halbe Stunde zur nächsten Stadt und zu den nächsten Einkaufsmöglichkeiten brauchte, ängstigte sie doch etwas. Zwischen ihr und dem Dorf lag die Kirche, hinter ihr nichts als Harzer Tannenwald. Sie rieb sich die Arme, doch nicht nur wegen der Kälte. Es war mehr die Einsamkeit, die sie schauern ließ. Wieder einmal. Seufzend ging Sarah hinaus, um mit der Suche nach den nötigsten Tagesutensilien zu beginnen.
Auf der Suche nach einem Lagerplatz für die Kartons war Sarah im Carport fündig geworden. Er bot eine kleine Abstellkammer, in der nur ein Rasenmäher stand. Zufrieden kehrte sie zum Haus zurück. Als sie sich der Haustür näherte, stutzte sie. Was sie zunächst für eine Holzverzierung gehalten hatte, erkannte sie in der Morgensonne als verschnörkelte Schriftzeichen. Vorsichtig ließ sie die Hand über die merkwürdigen Schnitzereien gleiten, die nur jeweils an einer Seite erhaben waren. Die linke Zeile wandte sich der aufgehenden Morgensonne zu. Stand man auf der Westseite, sah man so gut wie nichts von den Buchstaben. Genau umgekehrt war es auf der rechten Türseite.
Die linke Textzeile begann an einem fünfzackigen Stern mitten über der Tür, die rechte Zeile endete an diesem. Sarah bewunderte die feine Arbeit und versuchte die Buchstaben zu entziffern.
Uralter Fluch an uraltem Ort
Brechen kann ihn nur ein …
Sarah stellte sich auf die Zehenspitzen, um das letzte Wort besser lesen zu können. Es war verkratzt. Stand dort „Wort“? Oder gar „Mord“?
Sie zog sich die Bank neben der Tür heran, stieg darauf und fuhr vorsichtig mit den Fingern über diesen Teil des Schnitzwerkes. Holzsplitter bogen sich nach oben. Hier hatte wirklich jemand mit einem Messer an der Inschrift herum manipuliert. Merkwürdig.
Die Buchstaben rechts der Tür waren nur sehr schwer zu entziffern, vermutlich konnte man sie erst dann richtig lesen, wenn die Abendsonne die Zeile beleuchtete. Der Stern über der Tür war von einem Kreis mit Symbolen umgeben, der vermutlich die zwölf Tierkreiszeichen darstellte. Rechts und links daneben erschienen das erste und das letzte Wort des Textes.
Sarah runzelte die Stirn und stieg von der Bank. Sie schüttelte sich. „Meine Güte! Na ja, vielleicht sieht diese eigenartige Schnitzerei in der Abendsonne etwas weniger beängstigend aus“, murmelte sie und beschloss anzunehmen, dass der Spruch mit der unverfänglichen Version, also mit „Wort“ endete.
Es war mittlerweile Nachmittag. Die Sonne machte aus dem Schwarzgrün des Tannenwaldes ein sanfteres Dunkelgrün, aus dem hier und da die noch dürren Zweige eines winterlichen Laubbaumes hervorragten.
Immer wieder wanderte Sarah zum Wohnzimmerfenster, um nach Adina zu schauen, die ungestüm mit Angus im Garten spielte. Die Nähe des Waldes machte Sarah mehr Angst als ihrer Tochter, die sich hier sehr wohl zu fühlen schien.
Mittlerweile war der Berg Kartons deutlich kleiner geworden. Sarah hatte trotz der frischen Temperatur die Haustür offen gelassen, weil sie die geleerten und zusammenfalteten Pappkartons nach und nach in die kleine Abstellkammer im Carport trug. Leider gab es im Haus kein Regal für ihre Bücher. Sie würde wohl noch einige geeignete Möbelstücke für ihre Arbeitsecke und auch für Adinas Zimmer kaufen müssen.
Sie sah sich in dem nun überschaubaren Wohnzimmer um und befand, dass sie eine Belohnung verdient hätte. Sarah öffnete einen kleineren Karton, der neben ihrem Notebook einige persönliche Gegenstände enthielt, und nahm eine Specksteinfigur mit üppigen weiblichen Formen in die Hand. Sie hatte das Fruchtbarkeitssymbol während eines Urlaubs in der Dominikanischen Republik erstanden. Markus hatte sie wegen ihres Kunstgeschmacks verhöhnt und darauf bestanden, dass diese Figur unter Verschluss blieb. Die zwanzig Zentimeter Speckstein hätten ja das erlauchte Auge eines kunstbeflissenen Besuchers beleidigen und Markus’ Ansehen schaden können.
Mit einer Spur von trotzigem Stolz stellte Sarah die Figur auf den dicken Eichenbalken über dem Kamin.
Abermals warf sie einen Blick in den Garten, um nach Adina zu sehen. Nachdenklich beobachtete sie Angus, der bewegungslos verharrte und in den Wald starrte. Nun nahm auch Sarah dort schemenhafte eine Bewegung wahr. Mit einem Anflug von Panik stürzte sie zur Terrassentür, um Adina zu rufen. Doch ihre Tochter kam ihr zuvor.
„Mami!“, rief sie begeistert, „da, schau, da sind Pferdchen im Wald!“
Verwirrt starrte Sarah auf die bräunlichen Schatten hinter der fast undurchdringlichen Wand von Tannen und lachte erleichtert auf. „Schätzchen – das sind doch keine Pferdchen, das sind Rehe!“
„Ach so!“, sagte Adina enttäuscht.
Waren es überhaupt Rehe? Sie waren recht groß. Oder waren es Hirschkühe? Sarahs Unsicherheit nahm wieder zu. Mit der Fauna des Harzes kannte sie sich noch nicht sehr gut aus, aber das sollte sich ändern. Schließlich beinhaltete ihr Auftrag ein Portrait des Harzes für Erik und Sabines Verlag. Sarah lächelte. Wie gut ihre Freunde sie doch kannten. Hinter diesem Buchauftrag konnte sie sich verstecken und ihre Flucht kaschieren, für die sie sich noch immer ein Stück weit schämte.
Ihr Blick kehrte zu Adina und zu dem Wild zurück. Waren Hirsche gefährlich? Nachdenklich schloss sie die Tür wieder.
Als Sarah in den Flur trat und in der offenen Haustür einen Mann stehen sah, schrie sie gellend auf. Sie wich zurück und stürzte rücklings über einen verbliebenen Karton. Als sie versuchte, sich hochzurappeln, fühlte sie seine Hände auf ihren Armen. In ihrer Panik hätte sie fast um sich geschlagen, doch dann drang schließlich eine ruhige, angenehme Stimme zu ihr durch.
„Geht es ...? Warten Sie, ich helfe Ihnen … schön langsam ...“ Die Stimme gehörte nicht Markus. Hitze stieg ihr in die Wangen, als sie den besorgten Blick aus den braunen Augen registrierte. Hektisch richtete sie sich auf.
Doch auch ihr Gegenüber machte ein schuldbewusstes Gesicht. Vorsichtig half er ihr auf die Beine.
Sarah nestelte nervös an sich herum. „Es tut mir leid … ich …“ Es wollte ihr nichts Sinnvolles als Erklärung für ihr Verhalten einfallen.
„Es ist wohl eher meine Sache, mich zu entschuldigen. Ich habe Sie furchtbar erschreckt. Ich wollte gerade klopfen, als Sie in den Flur kamen.“ Noch immer ruhte sein Blick abschätzend auf ihr. „Seeger, Paul Seeger … ich bin Pfarrer dieser Gemeinde und Ihr neuer Nachbar. Ich sah Ihren Wagen und wollte Sie hier willkommen heißen. Das ist mir wohl gründlich misslungen!“ Sein Mund verzog sich zu einem so missglückten Lächeln, das etwas mitreißend Komisches hatte.
„Du meine Güte, was müssen Sie nur von mir denken.“ Mit unsicheren Gesten strich Sarah an ihrem Haar herum, dessen Fülle sich regelmäßig aus jeder Spangenform befreite. „Kommen Sie doch bitte herein und trinken Sie einen Kaffee mit mir.“
„Sind Sie sicher?“, fragte er und sein Blick erinnerte Sarah an einen jungen Hund, der gerade Herrchens Lieblingsschuh gefressen hatte. Sie nickte lachend.
„Dann gern“, antwortete Paul Seeger und folgte Sarah zur Küche, blieb aber vor der offenen Theke stehen, sorgsam darauf bedacht, bei ihr nicht noch einmal das Gefühl der Bedrängnis hervorzurufen.