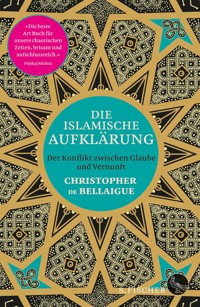
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Erhellend, großartig geschrieben, ein Buch, das uns hilft, das Verständnis zwischen islamischer Welt und Moderne zu verstehen.« Yuval Noah Harari, Autor von »Eine kurze Geschichte der Menschheit« Die islamische Aufklärung hat längst stattgefunden. In einer fulminanten Erzählung demontiert Christopher de Bellaigue die oft selbstgefällige westliche Sicht auf die arabische Welt. Auch in Ägypten, im Iran und der Türkei gab es nach 1800 eine breite Bewegung für Freiheit, Gleichheit und Demokratie und für einen weltlichen Staat, für Frauenrechte und Gewerkschaften, freie Presse und die Abschaffung der Sklaverei. In atemberaubender Geschwindigkeit modernisierten sich die arabischen Gesellschaften. Doch die Gegenaufklärung folgte auf dem Fuß, mit autokratischen Regimen und fundamentalistischem Terror. De Bellaigue schildert den Kampf zwischen Glaube und Vernunft und um eine neue muslimische Identität. Eine reiche, überraschende Geschichte, eine radikal neue Sicht auf den modernen Islam. »Eine ausgesprochen originelle und informative Studie über die Zusammenstöße zwischen dem Islam und der Moderne in Istanbul, Kairo und Teheran während der letzten zweihundert Jahre.« Orhan Pamuk »Christopher de Bellaigue gehört seit Langem schon zu den einfallsreichsten und anregendsten Interpreten einiger von Angst und Vorurteil verstellter Realitäten. In ›Die islamische Aufklärung‹ seziert er den selbstgefälligen Gegensatz zwischen Islam und Moderne und enthüllt dabei eine faszinierende Welt: eine Welt, in der Menschen sich unter dem Druck der Geschichte ständig verändern, improvisieren und sich anpassen. Es ist genau das richtige Buch für unsere in Unordnung geratene Welt: zeitgemäß, dringlich und erhellend.« Pankaj Mishra »Zur rechten Zeit, tiefsinnig und provokativ.« Peter Frankopan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 777
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Christopher de Bellaigue
Die islamische Aufklärung
Der Konflikt zwischen Glaube und Vernunft
Über dieses Buch
Die islamische Aufklärung hat längst stattgefunden. In einer fulminanten Erzählung demontiert Christopher de Bellaigue die oft selbstgefällige westliche Sicht auf die arabische Welt. Auch in Ägypten, im Iran und der Türkei gab es nach 1800 eine breite Bewegung für Freiheit, Gleichheit und Demokratie und für einen weltlichen Staat, für Frauenrechte und Gewerkschaften, freie Presse und die Abschaffung der Sklaverei. In atemberaubender Geschwindigkeit modernisierten sich die arabischen Gesellschaften. Doch die Gegenaufklärung folgte auf dem Fuß, mit autokratischen Regimen und fundamentalistischem Terror. De Bellaigue schildert den Kampf zwischen Glaube und Vernunft und um eine neue muslimische Identität. Eine reiche, überraschende Geschichte, eine radikal neue Sicht auf den modernen Islam.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Christopher de Bellaigue, geboren 1971, studierte an der Cambridge University und war Fellow an der Harvard University und der University of Oxford. Er lebte über fünf Jahre in Teheran und bereiste als Journalist Südasien und den Mittleren Osten. Er schreibt für Economist, Guardian und die New York Review of Books und lebt in London.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei S. FISCHER
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt am Main; nach einer Idee von Bodley Head
Die englische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Islamic Enlightenment. The modern struggle between faith and reason« bei The Bodley Head, an Imprint of Vintage, London.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
ISBN 978-3-10-490646-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Einleitung
Erstes Kapitel Kairo
Zweites Kapitel Istanbul
Drittes Kapitel Teheran
Viertes Kapitel Strudel
Fünftes Kapitel Nation
Sechstes Kapitel Gegenaufklärung
Schluss
Bildteil
Danksagung
Bibliographie
Verzeichnis der Abbildungen
Für Diana Rodney
Einleitung
Jane Eyre, Vollwaise und Lehrerin im Mädcheninternat Lowood zur Zeit König Georgs III. von England, liegt wach im Bett und denkt über ihre Zukunft nach.
»Ich habe hier acht Jahre gedient; und jetzt wünsche ich ja nichts weiter, als anderswo dienen zu können. Kann ich meinen eigenen Willen denn nicht wenigstens so weit durchsetzen? Ist die Sache denn nicht tunlich? Ja – ja – das Ende ist nicht so schwer, wenn mein Gehirn nur tätig genug wäre, um die Mittel, es zu erreichen, aufspüren zu können.«
Ich saß aufrecht im Bette, um mein vorerwähntes Hirn zur Tätigkeit anzuspornen; es war eine frostige Nacht; ich bedeckte meine Schultern mit einem Schal, und dann fing ich wieder mit allen Kräften an zu denken.
»Was wünsche ich denn eigentlich? Eine neue Stelle, in einem neuen Hause, unter neuen Gesichtern, unter neuen Verhältnissen. […] Wie machen die Leute es nun, um eine neue Stelle zu bekommen? Sie wenden sich an ihre Freunde, wie ich vermute – ich habe keine Freunde. Es gibt aber noch viele Menschen, die keine Freunde haben und sich selbst umsehen müssen und sich selbst helfen. Welches sind denn nun ihre Hilfsquellen?«
Ja, das wusste ich nicht; niemand konnte mir antworten. Deshalb befahl ich meinem Hirn, eine Antwort zu finden, und zwar so schnell wie möglich. [Dann] kam sie ruhig und natürlich in meinen Sinn: – »Leute, welche Stellungen suchen, kündigen es an; du musst es im – Shire Herald ankündigen.«
»Aber wie? Ich weiß nichts von Zeitungsannoncen.«
Schnell und wie von selbst kamen die Antworten jetzt:
»Du musst die Annonce und das Geld für dieselbe an den Herausgeber des Herald einschicken; bei der ersten Gelegenheit, die sich dir darbietet, musst du die Sendung in Lowton auf die Post geben; die Antwort muss an J.E. an das dortige Postamt geschickt werden; eine Woche nachdem du deinen Brief abgesandt, kannst du hingehen und dich erkundigen, ob irgend eine Antwort eingetroffen ist; daraufhin hast du zu handeln.«
Diese schlaflos verbrachte Stunde ist die Ecke, um die Jane Eyre biegen muss, um Mr Rochester in die Arme zu laufen, denn ihr Entschluss, in der Lokalzeitung eine Anzeige aufzugeben, führt dazu, dass sie viele Meilen entfernt eine neue Stellung annimmt, als Hauslehrerin des Mündels von Mr Rochester in Thornfield Hall. Der Umzug dorthin bestimmt den Weg, den ein sehr beliebter Roman nehmen wird, und dennoch kann man etwas Größeres und gesellschaftlich Bedeutsameres darin erkennen: den Weg in eine neue Welt.
Janes Verlangen bedarf keiner Einleitung. Sie sucht nach Vielfalt und Bewegung, und die Erziehung, die sie genossen hat, bietet ihr die dazu nötigen Mittel. Denn die Erziehung, die ihr in einer der immer zahlreicheren englischen Mädchenschulen zuteilwurde, hat ihrem ausgezeichneten Verstand Ziel und Richtung verliehen, bewahrt sie zugleich aber auch vor jeglichem Minderwertigkeitsgefühl. Jane ist unabhängig im Geiste, und das erlaubt ihr auch die nötige Unabhängigkeit im Blick auf die Mittel. Jane Eyre ist ein moderner Mensch.
Ihre Modernität erstreckt sich auf ihre Sicht der Welt und der eigenen Stellung darin. Jane ist Christin, aber in der Stunde der Unentschlossenheit lässt sie keinen Rosenkranz durch die Finger gleiten; sie bemüht nicht die Evangelien – und erst recht sucht sie nicht nach Zeichen am Sternenhimmel. Der Glaube schenkt ihr Kraft in den moralischen und emotionalen Krisen ihres Lebens, doch bei ganz praktischen Problemen, etwa als sie nach der »klaren, sachlichen Sprache« sucht, die ihren flattrigen Verstand zur Ruhe bringen kann, fragt sie nicht Gott, sondern sich selbst, Jane.
Zur Verwirklichung ihres Plans benötigt Jane allerdings die Hilfe gewisser Einrichtungen des modernen England. Ohne die Lokalzeitung, ohne das Postamt und – wenn es schließlich darum geht, nach Thornfield Hall zu gelangen – ohne ein Fortbewegungsmittel, mit dem sie über eine der für alleinreisende Frauen hinreichend sicheren Mautstraßen fahren kann, würde sie gar nichts erreichen.
Mehr noch als all diese Dinge braucht Jane indessen eine Gesellschaft, die akzeptiert, dass sie Herrin ihres eigenen Schicksals ist – eine unverheiratete Frau, die die Freiheit besitzt, in eine Postkutsche zu steigen und zu reisen, wohin es ihr beliebt, ohne Gefahr zu laufen, dass ihr Ruf darunter litte.
Dieses Bild aus dem georgianischen England wollen wir nun in eine ganz andere Umgebung versetzen. Stellen wir uns vor, Charlotte Brontës Roman wäre in einem außereuropäischen Milieu angesiedelt. Nach den Maßstäben der im 19. Jahrhundert erreichten Globalisierung liegt diese neue Umgebung gar nicht so fern. Um dorthin zu gelangen, braucht man lediglich das Mittelmeer zu überqueren. Dort stößt man auf eine nahe Verwandte der jüdisch-christlichen Zivilisation, in der Jane lebt, eine Zivilisation, die im dritten und jüngsten der hebräischen Monotheismen gründet und vom griechischen Denken beeinflusst wurde.
Das ist die Zivilisation des Islam. Wie wäre diese Zivilisation mit Jane Eyre und den Vorstellungen von Selbstverwirklichung umgegangen, die ihr des Nachts den Schlaf rauben? Hätte sie das Verhalten dieser Frau gebilligt, oder hätte sie die Nase darüber gerümpft? Hätte sie Jane Eyre »verstanden«?
Könnte ich diese Frage mit ja beantworten, hielten Sie dieses Buch wahrscheinlich jetzt nicht in den Händen – oder es wäre ein ganz anderes Buch geworden. Die islamische Zivilisation hätte Jane Eyre in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts weder gebilligt noch verstanden, weil die nötigen Voraussetzungen dazu fehlten.
Betrachten wir zunächst einmal das Vehikel, über das ein muslimisches Publikum ihr hätte begegnen können: das gedruckte Buch. Das wäre zu der Zeit, in der Jane Eyre spielt, ein völliger Reinfall gewesen, denn auch fast vierhundert Jahre nachdem Gutenberg das geistige und religiöse Leben Europas durch die Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern revolutioniert hatte, war die Druckerpresse für den Islam immer noch eine unerwünschte, für den allgemeinen Gebrauch nicht zugelassene ausländische Innovation. Dann war da die Frage der Übersetzung der Brontë’schen Prosa in die dortigen Sprachen. Die Zahl der Türkisch-, Arabisch- und Persischsprechenden mit ausreichenden Englischkenntnissen war verschwindend gering, und im Nahen wie auch Mittleren Osten gab es keinen Markt für übersetzte ausländische Werke.
Selbst wenn diese Einschränkungen überwunden worden wären und vertrauenswürdige Schreiber in großen Stückzahlen Kopien einer übersetzten Jane Eyre produziert hätten, wäre das Publikum doch aus einem weiteren Grund nur winzig klein geblieben. Nach neuesten Erkenntnissen lag die Alphabetisierungsrate in der Türkei, Ägypten und dem Iran – den drei wichtigsten geistigen und politischen Zentren der Region – um die Wende zum 19. Jahrhundert bei etwa 3 Prozent, gegenüber mehr als 68 Prozent bei den Männern und 43 Prozent bei den Frauen in England. In Amsterdam, damals die Welthauptstadt der Lese- und Schreibfähigkeit, lagen diese Zahlen bei 85 bzw. 64 Prozent. Es kann kein Lesepublikum geben, wenn niemand lesen kann.
Aber lassen wir uns von solchen Überlegungen nicht beirren und stellen uns vor, durch professionelle Geschichtenerzähler hätten zahlreiche Muslime Bekanntschaft mit dem Leben und der Zeit der Jane Eyre gemacht. Wie hätten sie darauf reagiert? Die Vorstellung von Zeitungen und einem Postdienst hätte für Verwirrung gesorgt in Ländern, in denen es so etwas gar nicht gab, und ebenso die Phantasie einer Kutschverbindung zwischen Städten. Und dann erst die moralische Büchse der Pandora, die Janes Verhalten öffnete. Es war skandalös, dass eine Heldin ohne Begleitperson durchs Land zog, sich in einen Mann verliebte, die Aufmerksamkeit eines anderen Mannes erregte – und nach dieser schamlosen Zurschaustellung von der Autorin auch noch als ein Vorbild an Tugend dargestellt wurde.
Schon die gesellschaftlichen Systeme waren in Janes England völlig anders geartet: Wo war der Harem, der geschützte, allein den Frauen vorbehaltene Raum innerhalb der Familie, und warum hatte Mr Rochester keine Sklaven? Ganz zu schweigen von Mr Rochesters zügellosen weiblichen Gästen in Thornfield Hall, die auf dem Pianoforte spielten, auf Pferden ritten und ihren Busen wie auch langes fließendes Haar herzeigten.
Das wohl noch Freundlichste, was man über den Plot des Romans hätte sagen können, war, dass er die Überlegenheit der muslimischen Lehre verdeutliche. Nach muslimischem Recht hätte Mr Rochester Jane zu seiner zweiten Frau (von maximal vier erlaubten) nehmen können, und er wäre in der Lage gewesen, den Rest an Tugend, der ihr verblieben war, ohne den ganzen Unsinn über die Irre auf dem Speicher zu retten.
Kurz gesagt, aus der Sicht eines Muslims zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Figur der Jane Eyre eine krasse, für niemanden verständliche Unmöglichkeit und die Geschichte ihres Lebens derart absurd, dass sie schon an geistige Verwirrung grenzte.
Mit der Erfindung des Dampfschiffs vervielfachten sich die möglichen Reiseziele. Das Reisen wurde einfacher. Und mit der Eisenbahn wurde es noch einfacher. Wie das Reisen durch diese Mittel beschleunigt wurde, so wurde auch die Kommunikation beschleunigt, und zwar durch den Telegraphen. Nachrichten aus fernen Ländern, die zuvor ein Jahr gebraucht hätten, brauchten nun nur noch eine Stunde. Die Welt wurde in eine andere Gussform gegossen.
In dieser kurzen Passage aus dem Jahr 1891 beschreibt die türkische Literatin Fatma Aliye die Intensität des technischen Wandels, der das Osmanische Reich in den vorangegangenen Jahrzehnten bewegt und inspiriert hatte. Ihr letzter Satz ist wunderbar unentschieden: Der Sinn des Lebens und die Bürde, ihn zu interpretieren, sickern aus der sicheren Vergangenheit in eine weiche und formbare Zukunft. Alles ist ganz anders als in Aliyes rigider und genau eingeteilter Kindheit in den 1860er Jahren, dieser abgeschlossenen, exklusiven Welt, in der Aliye – Tochter eines angesehenen osmanischen Würdenträgers – lebte und die auf die Bewahrung der Unterschiede ausgerichtet schien.
Mit fünfzehn Jahren begann für Aliye die Zeit der Verschleierung, und vier Jahre später wurde sie verheiratet. Sie lernte heimlich Französisch, um ihre Mutter nicht zu erzürnen, die im Erlernen dieser Sprache der Ungläubigen ein Zeichen für den Abfall vom Glauben erblickte. Aber niemand – nicht einmal der stirnrunzelnde und despotische Sultan Abdülhamid II. – konnte die Moderne aufhalten, und im Gefolge der ins Reich strömenden Erfindungen erweiterte sich die Souveränität und Autonomie des Einzelnen. Die gerade erst übernommene Institution der Presse gab Aliye die Möglichkeit, ihre heimlich geschriebenen Texte in einem rasch wachsenden Publikum lesekundiger Osmanen zu verbreiten, das dank der Ausbreitung der Schulbildung gerade in Entstehung begriffen war. Fatma Aliye war eine herausragende Stimme in der jungen Welt der in türkischer Sprache erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften. Sie schrieb über Mädchenbildung und wandte sich entschieden gegen die übliche männliche Herabsetzung der Frauen. Ihre frühe literarische Produktion erschien unter Pseudonymen wie »eine Frau«, und als sie schließlich den Mut fand, Romane unter ihrem eigenen Namen zu veröffentlichen, schrieben Zyniker beiderlei Geschlechts sie ihrem Vater oder ihrem Bruder zu.
Auch die Schwestern Brontë hatten unter – in ihrem Fall männlich klingenden – Pseudonymen veröffentlicht, weil sie bezweifelten, dass jemand die Werke unbekannter junger Frauen aus Yorkshire würde lesen wollen. Es ist schon seltsam, aber ähnliche Fragen hinsichtlich der Fähigkeiten von Frauen sollten wenig später im fernen Istanbul gestellt werden, wo schon 1869 eine Autorin in einer der neuen Frauenzeitschriften, der Wochenzeitung Terakki-i-Muhadderat (»Fortschritt muslimischer Frauen«), zornig erklärte: »Männer sind ebenso wenig dafür geschaffen, Frauen zu dienen, wie Frauen, von Männern beherrscht zu werden … Sind wir nicht in der Lage, Wissen und Fertigkeiten zu erlangen? Was ist der Unterschied zwischen unseren Beinen, Augen und Hirnen – und ihren? Sind wir keine Menschen? Verdammt uns allein unser Geschlecht zu dieser Lage? Niemand, der mit einem gesunden Menschenverstand ausgestattet ist, akzeptiert das.« Als das Osmanische Reich sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts modernisierte, entwickelten immer mehr selbstbewusste türkische Frauen ein Weltbild, das dem ihrer Geschlechtsgenossinnen im Westen weitestgehend ähnelte – bis hin zu dem Punkt, an dem die Geschichte einer jungen Frau wie Jane Eyre, die ihre Entscheidungen selbst trifft, sich verliebt, ihren Lebensunterhalt verdient und ihren Weg geht, durchaus nicht mehr so absonderlich erschien.
Zu den Dingen, die Fatma Aliyes Leben so ergreifend machen, gehört ihr produktives Verhältnis zu den Veränderungen in ihrer Umwelt. Sie war eine wahrhaft moderne Frau, von der Modernisierung geprägt und ihrerseits die Modernisierung prägend. Und sie begab sich furchtlos auf die neuen und gefährlichen Felder der Frauenrechte und der öffentlichen Meinung.
Eines ihrer bekanntesten Werke ist ein Briefroman, in dem Frauen aus der Oberschicht über ihr Leben und ihre Liebe sprechen – eine Geschichte, die unsinnig wäre ohne einen osmanischen Postdienst, der in der Tat 1840 geschaffen worden war. Aliye schrieb über Frauen, die mit fremden Männern über Philosophie diskutierten, auf Dampfschiffen bei der Überfahrt über den Bosporus, der das historische Istanbul von Asien trennt – diese Schifffahrtslinie war unter großem Beifall 1854 eröffnet worden.
Fatma Aliye übernahm dieselben philanthropischen Aufgaben wie zahlreiche prominente Frauen im Westen. Sie gründete eine Wohlfahrtsorganisation für die Familien von Soldaten, die im Türkisch-Griechischen Krieg von 1897 gefallen waren. Ihre Werke wurden ins Französische und ins Arabische übersetzt, und 1893 wurde sie mit der Aufnahme in die Frauenbibliothek der Weltausstellung in Chicago geehrt. Ihre späten Jahre verbrachte sie in Sorge um ihre jüngste Tochter Zübeyde, die zum Leidwesen ihrer Mutter zum Katholizismus übergetreten war und ihre Ordensgelübde in Notre-Dame de Paris abgelegt hatte. Bei diesen sorgenvollen Bemühungen reiste Aliye durch Europa – eine muslimische Frau allein (oder zusammen mit einer anderen Tochter) in einem ungläubigen Land. Dass eine Frau ihres Standes solch ein Maß an Autonomie beanspruchte, wäre in ihrer Jugendzeit noch undenkbar gewesen. Nach Frankreich zu reisen und dort mit den Einheimischen zu verkehren hätte schlimme Zweifel an ihrer Sittsamkeit geweckt, und man hätte sie nach ihrer Rückkehr gemieden. Das war nun anders.
Was sollen wir von Zübeydes Bemerkung halten, die Frage der »Gleichheit der Geschlechter in der Gesellschaft und der Kampf darum« seien ihrer Mutter »nachgegangen«? In Fatma Aliyes Kindertagen hatte es in der Türkei keine Frage der »Gleichheit der Geschlechter« gegeben. Und es hatte keinen »Kampf« darum gegeben. Beides war nun anders.
Wir brauchen nicht auf einen Roman wie Jane Eyre zurückzugreifen, um uns eine Vorstellung von den Fortschritten zu machen, die Frauen in der westlichen Welt während der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts machten. Es gibt zahlreiche geschichtliche Darstellungen und Biographien über Frauen, die sich selbst bildeten und in die Arbeitswelt eintraten, während rund um sie herum viele Gesetze und Einstellungen sich änderten. Andererseits ist die Geschichte ihrer späteren muslimischen Entsprechungen – Fatma Aliyes Geschichte sozusagen – im Westen weit weniger bekannt, und das lässt sich nicht allein auf die natürliche Neigung der Menschen zurückführen, sich eher für Geschichten aus ihrem näheren Umfeld zu interessieren. Auch betrifft dieser blinde Fleck im westlichen Geschichtsbild nicht allein muslimische Frauen. Der Westen weigert sich von jeher, in irgendeinem Aspekt muslimischer Kultur und muslimischen Lebens die Möglichkeit – oder gar Unvermeidlichkeit – der Erneuerung und der Moderne zu erkennen. Diesen dunklen Fleck gibt es seit Hunderten von Jahren, aber in jüngster Zeit ist er noch größer und dunkler geworden. Er hindert uns, auch nur den Versuch zu unternehmen, die Vergangenheit zu verstehen, und ermuntert uns stattdessen, auf Abstand zu bleiben, in Sackgassen zu geraten und den Behauptungen von Demagogen und Vereinfachern Glauben zu schenken. Er ist ein Hindernis für ein ausgewogenenes und kohärentes Bild der Weltgeschichte.
In einer Zeit, da im Namen des Islam zahllose Grausamkeiten begangen werden, leidet das Bild der muslimischen Zivilisation unter einer historischen Fehleinschätzung, die von triumphalistischen westlichen Historikern und von muslimischen Renegaten propagiert wird. Diese Leute sind sich einig in der Forderung, die Religion Mohammeds müsse ihre Stellung in der modernen Welt und ihr Denken überprüfen. Der Islam solle sich denselben geistigen und sozialen Veränderungen unterziehen, die der Westen vom 15. bis zum 19. Jahrhundert erlebte und die das Fundament der heutigen Gesellschaft legten. Der Islam brauche eine Aufklärung. Der Islam brauche eine Reformation, eine Renaissance und einen Sinn für Humor. Die Muslime müssten lernen, Beleidigungen ihres Propheten gelassen hinzunehmen, und dürften ihre Heiligen Schriften nicht mehr buchstäblich als Gottes Wort ansehen – wie viele Anhänger des christlichen und des jüdischen Glaubens dies getan haben.
Hinter solchen Ratschlägen steht ein einfacher Gedanke. Danach haben interne Defizite die islamische Zivilisation daran gehindert, eine Reihe unverzichtbarer Übergangsriten zu absolvieren, ohne die sie ihre Rückständigkeit niemals zu überwinden vermögen wird. Aber diese Kommentare sagen mehr über die Menschen, die sie äußern, als über den Islam.
Wenn Sie glauben, die moderne islamische Zivilisation sei von solchen Reformen unberührt geblieben, liegt es auf der Hand, dass eine ganze Reihe aus Ihrer eigenen Geschichte vertrauter Gestalten in der islamischen Vergangenheit nicht vorkommen, dass die Welt des Islam weiterhin auf seine säkularen Philosophen, seine Feministinnen, seine Wissenschaftler, seine Demokraten und seine Revolutionäre wartet. Und wer könnte da noch bestreiten, dass eine von geistigen und politischen Reformen freie islamische Geschichte die gesellschaftliche und kulturelle Moderne verfehlen muss? Politik, Bildung, Wissenschaft, Medizin, Sexualität – für mehr als 1,5 Milliarden Muslime weltweit ist die Liste der Gebiete, auf denen die Moderne erst noch Einzug halten müsste, buchstäblich endlos.
Auch wer kein Fachwissen über die islamischen Gesellschaften besitzt, dürfte leicht erkennen, dass diese Denkweise in eine Sackgasse führt. Dem aufmerksamen westlichen Besucher, der muslimische Länder bereist, entgeht durchaus nicht, dass die Moderne für die Menschen dort eine überwältigende Tatsache ihres alltäglichen Lebens darstellt. Der zweifache Imperativ, einerseits modern und universell zu sein und andererseits an traditionellen religiösen, kulturellen und nationalen Identitäten festzuhalten, kompliziert und bereichert ihr gesamtes Tun. Es hat etwas wunderbar Aufrichtiges und zugleich Bedeutungsloses, wenn der Westen Modernität einfordert von Menschen, deren Leben davon längst durchtränkt ist.
Auch hier bei uns braucht man nur die Augen aufzumachen, um in der westlichen Welt Millionen von Menschen muslimischen Glaubens oder muslimischer Herkunft ein Leben führen zu sehen, das erfolgreich die modernen Werte der Toleranz, des Empirismus und der Verinnerlichung oder Verdünnung des Glaubens in sich aufgenommen hat. Man schenkt ihnen nicht sonderlich viel Beachtung – und weshalb sollte man das auch tun? Sie enthaupten niemanden, laufen nicht Amok und versuchen auch nicht, ihre nichtmuslimischen Nachbarn zu bekehren. Aber sie sind überall um uns herum, leben in der modernen Welt und verstehen sich als Muslime.
Wie es zu dieser Anpassung kam, möchte ich hier erzählen, und zwar durch Leben und Abenteuer jener muslimischen Pioniere, von denen wir meinten, es hätte sie nie gegeben. Ich möchte zeigen, dass Nichtmuslime und selbst manche Muslime, die dem Islam eine Aufklärung aufdrängen wollen, offene Türen einrennen. Die in diesem Buch beschriebenen Menschen werden uns vor Augen führen, dass der Islam in den letzten zwei Jahrhunderten einen schmerzhaften, aber zugleich auch beglückenden Wandel erfahren hat – der zugleich eine Reformation, eine Aufklärung und eine industrielle Revolution war. Man erlebte dort einen unaufhaltsamen, aber vitalisierenden Umbruch – Reformen, Gegenbewegungen, Innovationen, Entdeckungen und Verrat.
Aber weshalb übersahen wir im Westen all die Veränderungen, zu denen es im Nahen und Mittleren Osten kam, und das zu einer Zeit, als die Region ein immer beliebteres Ziel für Reisende wurde, von Herman Melville, der 1857 Jerusalem besuchte – und »öde Felsen« fand, die ihn »mit kalten, grauen Augen« anstarrten –, bis hin zu Königin Viktorias zwanzigjährigem Sohn Bernie (dem späteren Eduard VII.), der 1862 das Heilige Land bereiste und erst lebendig wurde, als er am Berg Karmel Wachteln jagte? Die Antwort lautet, dass nur wenige aus dem Westen mit offenem Sinn in den Orient kamen, wer immer es sein mochte. Es ist schon erstaunlich, wie selten man im 19. Jahrhundert auf eine überzeugende Wahrnehmung der damals in der gesamten Region entstehenden spannungsreichen, veränderlichen und letztlich äußerst zerbrechlichen Gesellschaften oder auch der Möglichkeit stößt, dass deren Bewohner eine dynamische, ja sogar revolutionäre Kraft darstellen mochten. Leute, deren Vorstellung von Fortschritt so eng war, dass sie nur die eigenen Erfahrungen umfasste, und die dazu neigten, in unbekannten Gesellschaften Stillstand und Verfall zu sehen, bemerkten dort tatsächlich nur Stillstand und Verfall. Ob sie den Orient nun durch die Zugfenster des immer rascheren Fortschritts in ihren eigenen Ländern betrachteten oder (wie der viktorianische Berufsfotograf Francis Bedford, der Bernie 1862 begleitete) in der Hoffnung, den zeitlosen Ölberg zu Geld machen zu können. Die übliche Einstellung westlicher Besucher bestand darin, die Erstarrung des Orients zu beklagen, zu verspotten oder einzufangen – sie also auf jeden Fall zu bemerken.
Dieses Vorurteil hatte beträchtlichen Einfluss auf westliche Geschichtsvorstellungen. Aufgrund des Hangs, die Menschen im Orient auf den Status von Kindern zu reduzieren, setzte sich die Vorstellung fest, sie seien passive Beobachter, während die Ereignisse sich vor ihren verständnislosen Augen entfalteten. Diese weniger bedeutsamen Regionen seien dazu verdammt, schläfrig, passiv und nur in der Verteidigung des Status quo beharrlich zu sein. Trägheit und Sinnlichkeit dienten als Ausgangspunkte für Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, von denen wir das Bild der muslimischen Welt als eines von den Strömen der Geschichte unberührten Atolls geerbt haben.
Flaubert schrieb 1850 aus Kairo an einen Freund (sieben Jahre vor der Veröffentlichung seines Romans Madame Bovary, der ihm Anklagen wegen Verstoßes gegen die guten Sitten einbrachte) inmitten lebhafter Schilderungen ägyptischer Prostituierter, der »alte Orient« sei dort »immer noch jung …, weil sich da nichts ändert. Die Bibel ist hier ein Gemälde zeitgenössischer Sitten.« Seine Spekulationen über die Zukunft Ägyptens kreisten nicht um die Frage, was das Land tun werde, sondern was andere ihm antun würden. Bei der nächstbesten Gelegenheit werde »England Ägypten nehmen, Rußland Konstantinopel«, prophezeite er. Und in der Zwischenzeit nahm Flaubert alle, die ihm begegneten.
Die Orientalistin und zukünftige Mitarbeiterin der Kolonialverwaltung Gertrude Bell hätte es eigentlich besser wissen müssen – immerhin beherrschte sie die Sprachen der von ihr besuchten Länder. Aber in den 1890er Jahren schrieb sie, Persien sei »aus der lebendigen Welt herausgefallen … Die Schlichtheit der Landschaft ist die schlichte Schönheit des Todes.« In der Erinnerung an ihr Empfinden, als sie vor den Toren Teherans stand, schreibt sie: »Du erkennst, welche Kluft da besteht. Der Orient schaut auf sich selbst. Er weiß nichts von der weiteren Welt, deren Bürger du bist. Er fragt dich nicht nach dir und nach deiner Kultur.« Reiseschriftsteller arbeiten anders als Journalisten oder Historiker. Sie interessieren sich weniger für die Fakten als für die eigene Befruchtung dieser Fakten, und deshalb sind sie weniger zuverlässige Zeugen. Das gilt in ganz besonderem Maße für den jungen italienischen Schriftsteller und Journalisten Edmondo De Amicis, der im Herbst 1874 Istanbul besuchte. Er war bereits bekannt für seine kraftvollen Beschreibungen, und seine Arbeitsmethode bestand darin, ausgiebig Notizen zu machen, bevor er seine schriftlichen Skizzen zu Hause überarbeitete und dabei Perspektiven und kompositorische Details für das endgültige Gemälde »verbesserte«. Sein Reisetagbuch Konstantinopel enthält brillante Beschreibungen der Menschenmengen auf der Galata-Brücke über das Goldene Horn, des Serail (diese »geheimnisvolle, verheißungsreiche …, ungeheure Residenz«) und des europäischen Viertels, in dem auch Flauberts Madame Bovary verkauft wurde – der türkische Zensor hatte die Ehebruchsszenen wohl übersehen.
Bei De Amicis kommt zu den üblichen Problemen der Reiseschriftstellerei noch hinzu, dass er sich kaum eine Woche in Istanbul aufhielt und sich dennoch nicht des oberflächlichen Charakters seiner Beobachtungen bewusst war. Er war sich seiner selbst so sicher, dass er Konstantinopel im Präsens schrieb, dem Tempus der Zeitlosigkeit, als hätte alles, was er gesehen hatte, auch nach seinem Besuch noch Bestand – und das bis heute, da wir ihn lesen.
Ihren Höhepunkt erreicht De Amicis romantische Empfindsamkeit in seiner Beschreibung der Hunde der Stadt. Es ist eine feingesponnene Horrorgeschichte voller grotesker Kopulationen, knurrender Kampfhunde und vergifteter Frikadellen (ausgelegt von einem Arzt, der nachts einmal ungestört schlafen möchte). Trotz aller literarischen Qualitäten lässt der Text uns jedoch im Dunkeln hinsichtlich der Bedeutung der Hunde für die Modernisierung der Stadt.
Ganz anders eine Erörterung derselben Frage durch einen Türken namens Ibrahim Sinasi ein paar Jahre später. Sinasi, 1826 in Istanbul geboren, hatte eine breite Ausbildung genossen und war zum Vater des modernen türkischen Journalismus geworden. Sein Ansatz im Blick auf die flohverseuchten Köter der Stadt, die Abfälle durchwühlten, bellten, knurrten und die Menschen mit ihren ungestümen Kriegen oder Kämpfen um ein Stück Knochen aufhielten, war keineswegs pittoresk, sondern entschieden zweckorientiert. War es richtig, fragte er in seiner Zeitungskolumne, dass ein »aufrechter Mensch« einer »derart irrationalen Bestie« ausgesetzt war, wenn er seinen Geschäften in der Stadt nachging? Er empfahl, die Hunde zu entfernen und notfalls in ländliche Gebiete zu bringen, wo man sie als Wachhunde einsetzen könne, bevor er mit einem Aphorismus schloss, dem auch viktorianische Gesundheitsschützer hätten zustimmen können und der in freier Übersetzung lautete: »Sauberkeit ist etwas nahezu Göttliches.« Der Unterschied zwischen De Amicis’ und Sinasis Behandlung derselben Frage – zwischen dem Bewohner, der die Stadt für seine Zwecke nutzt, und dem Besucher, der sie durch sein Opernglas betrachtet – ist eine beredte Warnung davor, die Aussagen der Orientalisten für bare Münze zu nehmen.
In Wirklichkeit war der von diesen europäischen Besuchern beschriebene Orient in wichtigen Aspekten ganz anders, als sie ihn zeichneten. Das Wissen und die Annahmen, die sie übernommen hatten und an ihre Leser im Westen weitergaben, waren bestenfalls unvollständig. Die Länder, über die sie und andere Autoren schrieben, als handelte es sich um versteinerte Schichten, erlebten in Wirklichkeit heftige Erschütterungen.
Dieses Erdbeben war von demselben Westen ausgelöst worden, aus dem die Reiseschriftsteller kamen – Franzosen, Engländer, Iberer, Italiener, die im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts spürten, dass das Osmanische Reich geschwächt war, und die ausschwärmten, um diese Schwäche auszunutzen. Diese Kaufleute, Gesandten, Glücksritter, Dichter, Missionare und am Ende auch Besatzer machten sich auf nach Nordafrika, in die Levante, in die Türkei und nach Griechenland. Aus symbolischen Gründen datiert man ihr erstes Auftreten oft auf das Jahr 1798, als Napoleon in Ägypten einfiel und eine der modernsten Gesellschaften der Welt mit einer der rückständigsten zusammenstieß.
Dass nun Europäer erstmals seit den Kreuzzügen wieder massenhaft in der muslimischen Welt auftauchten, zwang die Eliten der Region – Herrscher und Geistliche, Verwaltungsbeamte und Militärkommandeure – zu dem Eingeständnis, dass sie nur durch die Übernahme westlicher Praktiken und Technologien verhindern konnten, politisch und wirtschaftlich in Bedeutungslosigkeit zu versinken. Der Historiker Juan Cole hat die folgenden, außerordentlich schnellen Veränderungen sehr gut zusammengefasst.
Innerhalb von Jahrzehnten ließen Intellektuelle die ptolemäische Astronomie zugunsten der kopernikanischen fallen …, Geschäftsleute gründeten Kapitalgesellschaften (die nach islamischem Recht ursprünglich nicht zugelassen waren), Generäle ließen ihre Armeen nun anders ausbilden und veranlassten den Bau von Waffenfabriken, der regionale Patriotismus verstärkte sich und bereitete dem Nationalismus den Weg, aufgrund des Aufbaus einer nicht nur auf Selbstversorgung ausgerichteten Landwirtschaft und dank der neuen Medizin begann die Bevölkerung exponentiell zu wachsen, Dampfschiffe durchpflügten plötzlich das Rote Meer und den Persischen Golf, der Agrarkapitalismus und die neuen Fabriken führten zu neuartigen Klassenkonflikten.[1]
Während des gesamten 19. Jahrhunderts beschleunigte sich der Wandel. Er kannte weder Grenzen noch rote Linien. Mitte des Jahrhunderts verkündete das Osmanische Reich die Gleichheit zwischen muslimischen und christlichen Untertanen, verbot den Sklavenhandel, und die vom Harem symbolisierte Trennung der Geschlechter begann ihren Niedergang. Die Scheichs und Mullahs mussten erleben, dass ihre alten Privilegien in Recht und öffentlicher Moral von einer expandierenden staatlichen Bürokratie übernommen wurden. Der Widerstand der Geistlichkeit gegen medizinische Sektionen wurde überwunden, und man richtete anatomische Theater ein. Auch die Kultur veränderte sich mit dem Aufschwung außerreligiöser Schulbildung und einer Reform der arabischen, türkischen und persischen Sprache – damit man die modernen Gedichte, Romane und Zeitungsartikel dem neuen mächtigen Publikum – der »Öffentlichkeit« – besser präsentieren konnte.
Zu den Eigenheiten der Innovation im 19. Jahrhundert gehört auch deren teleskopartig zusammengedrängter Charakter. Diese Komprimierung der Ereignisse zeigte sich etwa in der Tatsache, dass der auf das 15. Jahrhundert zurückgehende Druck mit beweglichen Lettern fast zur selben Zeit eingeführt wurde wie der 1844 erfundene Telegraph.
Trotz mangelnder Bereitschaft, Veränderungen anzuerkennen, wenn er sie sah, bot Edmondo De Amicis in seinem Buch über Istanbul doch eine Schilderung heftigen Wandels. »Stambul ist einer ewigen Verwandlung unterworfen«, schrieb er in einer außergewöhnlichen Passage, »in ihr sind alte Städte, die zerfallen, neue, die gestern geboren wurden, andere im Werden begriffen. Alles ist in Umwälzung, alles in Verwirrung; überall sehen wir die Spuren gigantischer Arbeit: durchbohrte Berge, halb abgetragene Hügel, Weiler, dem Erdboden gleichgemacht.«
Die Geschichte der muslimischen Modernisierung wird gelegentlich als Versuch einiger weniger Potentaten dargestellt, einer widerwilligen Bevölkerung ausländische Neuerungen aufzuzwingen. Muhammad Ali, nahezu die gesamte erste Hälfte des 19. Jahrhunderts Vizekönig von Ägypten, und sein Fast-Zeitgenosse (und nomineller Oberherr), der türkische Sultan Mahmud II., waren in der Tat Modernisierer und Zuchtmeister, und es gab auch häufig Widerstand im Volk gegen angeblich gottlose Innovationen.
Dass Reformen von solcher Tragweite Anlass zu Kontroversen und Widerstand geben, kann nicht verwundern. Die Moderne ist selbst in ihren besten Zeiten voller Spannungen, Verrenkungen und Unruhen und (wie Nietzsche es mit einer Wendung sagte, die eine kaleidoskopisch verfremdete Perspektive zum Ausdruck bringt) »ein verhängnisvolles Zugleich von Frühling und Herbst«. Aber der Gedanke, die Modernisierung habe im Orient keine natürliche Anhängerschaft besessen, steht im Widerspruch zum Wesen des Fortschritts, der generell von Minderheiten propagiert wird, auf Opposition oder Begeisterung trifft und schließlich Hindernisse überwindet, bevor er Wurzeln schlägt. Und obwohl die Prinzipien der Modernisierung und des Fortschritts aus dem Westen in den Orient kamen, war der Umstand, dass ihre Ursprünge anderswo lagen, doch noch kein Hindernis für ihre Übernahme in dieser neuen Umgebung. Entgegen der These einer absichtlichen muslimischen Rückständigkeit leistete der Islam keinen größeren Widerstand gegen die Modernisierung, als die jüdisch-christliche Kultur dies in früheren Zeiten getan hatte.
Wie die echte Begeisterung vieler der in diesem Buch beschriebenen Menschen zeigt, gelingt der Transfer von Ideen am ehesten, wenn sie als universell wahrgenommen werden und nicht als geschäftliche Ziele einer feindseligen Ideologie. Die Souveränität des Individuums, die Nützlichkeit von Hygiene und die Fehlbarkeit gekrönter Häupter (um nur drei zu nennen) tragen kein Ausschließlichkeit garantierendes Markenzeichen, sondern können von allen verstanden werden. Tatsächlich passte die muslimische Welt sich diesen und vielen anderen Werten sehr viel schneller an, als der Westen sie ersonnen hatte, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Tatsächlich mussten muslimische Konservative in ihrem Kampf gegen die neuen Ideen und Praktiken feststellen, dass sie den Wandel nicht zu unterbinden vermochten, sondern allenfalls hoffen konnten, ihn zu zähmen oder abzuschwächen. So entstand der verführerische Gedanke, man könne die Moderne auf eine Reihe von Ideen (und Techniken) begrenzen, die den Islam stärkten, ohne ihn zu verändern. Danach sollte der Islam einige der Fortschritte übernehmen, die man im Westen ersonnen hatte, wenn man nicht gerade damit beschäftigt war, widerwärtig und gottlos zu sein. Diese Ideen könnten den Dingen oberflächlich aufgepfropft werden, damit sie besser funktionierten, aber darunter bliebe der gute alte Islam erhalten, wie von jeher allem überlegen, was der Westen zu bieten hatte. Aber dieser auf Rosinenpickerei ausgerichtete Ansatz funktionierte nicht wirklich. Wenn Menschen sich erst einmal darauf einlassen, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, fällt es ihnen schwer, diese fortschrittliche Weltsicht aufzugeben. Jede praktische Bemühung in diese Richtung scheint sich großzügig auszuzahlen in Gestalt neuer Annehmlichkeiten, erweiterter Horizonte und eines erweiterten Selbstwertgefühls. Der Fortschritt wirbt für sich selbst.
Will man ermessen, wie stark die islamische Gesellschaft sich im 19. Jahrhundert veränderte, reicht ein Blick auf die Entwicklung, die das geistliche Establishment in Ägypten erlebte. Als Napoleon 1798 in Ägypten eindrang, reagierten die Scheichs auf Werte und Wissen der Franzosen mit Abscheu, und der bedeutendste ägyptische Chronist der Invasion, Abdarrahman al-Gabarti, flehte zu Gott, er möge, »ihre Zungen mit Stummheit schlagen …, ihren Geist verwirren und ihren Atem zum Stillstand bringen«.
Ein Jahrhundert später hatte Gabartis gesegnetes Land sich dermaßen verändert, dass die höchste juristische Autorität, der Geistliche Muhammad Abduh, Darwin bewunderte, mit Tolstoi korrespondierte (der von der russisch-orthodoxen Kirche exkommuniziert worden war) und seine Kenntnis europäischer Sprachen dazu nutzte, möglichst viel vom Wissen der Ungläubigen aufzunehmen.
Bis zum Ersten Weltkrieg hatte sich unter dem Einfluss Abduhs und anderer Gleichgesinnter in den drei geistigen und politischen Zentren des Nahen und Mittleren Ostens, in Ägypten, der Türkei und in Persien, eine starke Modernisierungstendenz entwickelt, die Ideen anzog und von dort aus auch in den umliegenden Regionen verbreitete. Das politische Bewusstsein war gewachsen, und politische wie auch nationale Bestrebungen zielten zunehmend auf die Schaffung jenes universellen Symbols des politischen Liberalismus: der demokratisch gewählten Legislative, ohne die kein Regime Legitimität beanspruchen konnte.
Aber der Ausbruch des Ersten Weltkriegs und seine verheerenden Folgen ermunterten Gegner des Liberalismus und des fortschrittlichen Denkens, die nun zu einem massiven Gegenschlag ausholten. Der Versailler Vertrag, in dem die siegreichen Alliierten 1919 ihre Beute verteilten und Deutschland zur Strafe gewaltige Reparationszahlungen auferlegten, besiegelte auch formell das Ende des Osmanischen Reiches. Die muslimischen Länder wurden zerstreut und wanderten zum Teil ins imperialistische Inventar westlicher Mächte, während sie nach dem Zweiten Weltkrieg trotz einer starken antikolonialistischen Strömung zu einem Schlachtfeld des Kalten Krieges wurden, auf dem die beiden Blöcke um Einfluss konkurrierten. Angesichts dieser massenhaften Unterjochung und Manipulation kann es nicht verwundern, dass viele Muslime nach politischen Möglichkeiten suchten, ihrem Hass auf den Westen Ausdruck zu verleihen.
Der Erste Weltkrieg war eine Wasserscheide in der Geschichte der islamischen Aufklärung. Vor diesem Konflikt hatte die Region sich in Richtung der Moderne und einer Übernahme liberaler säkularer Werte bewegt. Nun kam diese Entwicklung zum Stillstand, und der Abscheu der Muslime vor der kolonialen Ausbeutung fand seinen Ausdruck in Widerstandsideologien.
Der Aufstieg solcher Ideologien und ihr Umschlag in Gewalt wirft eine wichtige Frage auf, die unmittelbar auf die islamische Aufklärung zielt. Wenn der Islam sich bis zum Ersten Weltkrieg so erfolgreich auf die Moderne einließ, wie war es dann möglich, dass eine reaktionäre Erweckungsbewegung immer weitere Teile der muslimischen Welt erfasste?
Der politische Islam – also der Islamismus – ist eine Ideologie, die als antiimperialistische und später dann antikommunistische Reaktion auf die Zerstückelung des Nahen und Mittleren Ostens entstand und ein Ventil für die bei vielen Muslimen verbreitete Befürchtung bot, die Region könne unwiderruflich einer der beiden allesverschlingenden Ideologien anheimfallen. Daraus ging der radikale Islam hervor, ein unappetitlicher Millenarismus, den die Mehrheit der Muslime nur undeutlich wahrnimmt. Die von einer Minderheit der Muslime heute oft glorifizierte Gewalt und Unwissenheit sollte in Wirklichkeit als eine Art Bumerang der islamischen Aufklärung verstanden werden – als eine wenn auch verabscheuungswürdige Facette der Moderne selbst.
Wir sollten vorsichtig mit Begriffen wie »Moderne« oder »Fortschritt« umgehen, die im Westen entstanden und dort geläufig sind. Der Ausdruck »Aufklärung« stellt hier möglicherweise einen besonders heiklen Maßstab dar, weil er mit einer beträchtlichen Bürde an Eigenlob daherkommt. Sir Isaac Newtons enlightenment; Frankreichs lumières; Leibniz’ »Aufklärung« – in welcher europäischen Sprache man es auch sagen mag, das Wort lässt an eine mutige Herausforderung des Status quo an allen Fronten denken, von der Descartes’schen Behauptung der Individualität bis hin zu den majestätischen Eröffnungsakkorden der Mozart’schen Zauberflöte, der Aufklärungsoper par excellence. Dies sind glanzvolle Ereignisse innerhalb eines allgemeineren Umfelds der Gärung und des Wandels: Ausbau des Bildungswesens (von dem Jane Eyre profitieren sollte), Aufkommen von Massendruckerzeugnissen und Entstehung der Öffentlichkeit, Verbesserung der hygienischen Verhältnisse und des häuslichen Lebens (im 18. Jahrhundert begann sich die moderne Kernfamilie herauszubilden), Entdeckung neuer Welten (am Himmel und unter dem Mikroskop), Aufstieg der Museen, Abstieg des Feudalismus und Vorbereitungen für die Apotheose der Moderne in der Französischen Revolution.
Die Muslime waren nicht die Urheber der Leistungen, die wir heute mit der Aufklärung assoziieren. Kein Schmied in Istanbul entdeckte die beweglichen Lettern. Kein muslimischer Voltaire attackierte die Geistlichkeit am Nil. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man anerkennt, dass die muslimische Zivilisation nicht die Aufklärung hervorbrachte, oder ob man sagt, sie habe deren Ergebnisse nicht akzeptiert oder nicht von ihren Früchten gegessen. Das ist eine weitreichende These. Sie besagt, dass Erfahrungen, die viele für universell halten, für die Muslime entweder konstitutionell unzugänglich wären oder – schlimmer noch – dass die Muslime sich bewusst davon abgeschnitten hätten. Sie besagt, dass die muslimischen Länder sich von Wissenschaft, Demokratie und Gleichheitsgrundsatz ferngehalten hätten. Es ist eine These, die man in der gespaltenen, abweisenden, nervösen Welt von heute häufig hört – und sie ist Unsinn.
In diesem Buch möchte ich darlegen, dass es tatsächlich eine islamische Aufklärung gegeben hat, die unter dem Einfluss des Westens stand, aber zu einer eigenen Form fand. Die Verbindung beider Worte mag seltsam erscheinen, aber wie man von einem Römischen und einem Britischen Reich sprechen und dabei im Auge behalten kann, dass sie sich in der Organisation, im Ethos und in der Ökonomie voneinander unterschieden, so können wir auch von einer modernen »islamischen« Aufklärung sprechen, ohne zu erwarten, dass sie denselben Weg einschlägt wie ihre europäischen oder amerikanischen Entsprechungen. Der Ausdruck verweist auf die Überwindung der Dogmen durch bewiesenes Wissen, auf die Degradierung des Klerus von seiner Stellung als Schiedsrichter der Gesellschaft und die Verbannung der Religion in den Bereich der Privatsphäre. Er verweist auf den Aufstieg demokratischer Prinzipien und die Entstehung des Individuums, das die Kollektive, denen es angehört, in Frage stellt. Diese Ideen lassen sich auf alle Glaubenssysteme übertragen, und sie fanden auch Eingang in das islamische Glaubenssystem. Dort sind sie heute am Werk – auch wenn sie, wie wir noch sehen werden, Rückschläge erlitten.
Das Erwachen des Westens ist mit großer Sorgfalt dargestellt worden, aber dies ist das erste, ursprünglich englischsprachige, für eine breite Leserschaft bestimmte Buch, das die Transformation des Islam dokumentiert. Ich stütze mich auf die Schriften von Wissenschaftlern, Journalisten und Memoirenschreibern. Sie schrieben vielfach mit einer Treffsicherheit, die aus dem Umstand resultiert, dass sie aus eigener Erfahrung berichteten, und sie zeigten auf, wie der Islam seit dem 18. Jahrhundert zu Veränderungen gedrängt wurde – nicht nur unter dem Einfluss des Westens, sondern auch aufgrund drängender innerer Bedürfnisse. Die Welt des Islam wurde in ein neues Zeitalter katapultiert.
»Die Welt des Islam« – und dennoch konzentriere ich mich hier auf das Geschehen in drei Regionen des Nahen und Mittleren Ostens: Ägypten, die Türkei und den Iran. Die Modernisierung fand auch andernorts statt. Die erste konstitutionelle Monarchie der muslimischen Welt entstand 1861 in Tunis. In Indien wurde das 1875 gegründete Mohammedan Anglo-Oriental College die erste höhere Bildungsanstalt für säkulare Bildung in der muslimischen Welt. Doch die einflussreichsten Erscheinungen und Menschen, die wir mit den großen Veränderungen in Denken und Kultur verbinden, fanden sich in den wie Katalysatoren wirkenden Ländern Ägypten, Türkei und Iran. Wie das Herz des Islam nach Mekka blickt, so blickte der Verstand des Islam im 19. und dem größten Teil des 20. Jahrhunderts nach Kairo, Istanbul und Teheran. In diesen drei dynamischen und turbulenten Städten nahmen Modernisierung, sozialer Wandel und Revolution ihren Lauf – anfangs in gleichzeitigen, aber weitgehend voneinander unabhängigen Schritten, dann als eine große, verschränkte Transformation, die die muslimische Welt veränderte.
Diese schrittweise Vereinigung unterschiedlicher Bestrebungen spiegelt sich auch im Aufbau dieses Buches, das mit geographisch abgegrenzten Teilen – Kairo, Istanbul und Teheran – beginnt, bevor es die Entwicklungen zusammenführt im vierten Kapitel, das sich unter dem Titel »Strudel« mit den heftigen sozialen Veränderungen während des 19. Jahrhunderts befasst, und im fünften Kapitel, »Nation«, das den Aufstieg des modernen Staates behandelt. Das Schlusskapitel, »Gegenaufklärung«, beschreibt, in welcher Weise diese Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg in Frage gestellt wurden.
In den 1980er Jahren, mit denen dieses Buch schließt, begann in der islamischen Geschichte ein neues Zeitalter. Die iranische Revolution von 1979 verband einen militanten Islam mit einem Regimewechsel und veränderte die Bedingungen eines politischen Engagements des Islam. Als 1981 der ägyptische Staatspräsident Sadat von eigenen Soldaten ermordet wurde, war dies ein Sieg für den Takfiri-Islamismus, der den Grundgedanken vieler militanter Gruppen unserer Zeit darstellt und behauptet, gottlose oder ungerechte Muslime verdienten den Tod. Auch die Türkei schlug 1980 einen neuen Weg ein, als das Militär die Herrschaft im Land übernahm. Die Militärdiktatur führte indirekt – und unwillentlich – zu einem wählbaren Islamismus, der 2002 Recep Tayyip Erdogans AKP an die Macht brachte.
Diese Entwicklungen bewegten sich im Kontext eines verstärkten internationalistischen Dschihads gegen die Sowjets in Afghanistan, der es wiederum dem Dschihad-Sponsor Saudi-Arabien ermöglichte, sich auf die Weltbühne zu drängen und den Iran, die Türkei und Ägypten als treibende Kräfte in der muslimischen Welt herauszufordern. Die Internationalisierung der weltweiten islamischen Sache, von den Kriegen in Afghanistan, Algerien und Bosnien bis hin zur Entstehung transnationaler islamischer Akteure wie al-Qaida, verloren etablierte geographische Zentren der Ideologie und der Politik an Boden gegenüber einem globalen virtuellen Markt für religiösen Austausch. In Denken, Politik und Gesellschaft lag die Führung der islamischen Welt nun nicht mehr in Kairo, Istanbul und Teheran. Schon der Gedanke eines physisch-geographischen Zentrums, das die Führung über das islamische Denken ausübte, war bald schon veraltet und abwegig. Die relativ friedliche Koexistenz zwischen Sunniten und Schiiten zerbrach nach der westlichen Invasion Afghanistans und des Irak in den 2000er Jahren, während Saudi-Arabien und der Iran Front gegeneinander machten und eine verwüstete Landschaft spalteten. Der Arabische Frühling versprach 2011 für kurze Zeit eine Wiederbelebung von Werten der Aufklärung, bevor er weiterer Gewalt und totalitären Herrschaftssystemen unterlag, die durch Massenmigration und Umweltkatastrophen noch verschlimmert wurden.
Der Auslöser für die Modernisierung der islamischen Welt war der Zusammenstoß westlicher und islamischer Zivilisationen, der Napoleons Einmarsch in Ägypten 1798 begleitete. Wollen wir verstehen, wie es dazu kam, müssen wir jedoch kurz weiter zurück in die islamische Vergangenheit schauen, die vielen später vorgebrachten Argumenten Nahrung und Inspiration lieferte.
Die frühere Geschichte der islamischen Kernländer lässt sich grob in zwei Zeitalter unterteilen, ein halbes Jahrtausend des Glanzes, des Wohlstands und großer Leistungen im Gefolge der Ausbreitung des Islam außerhalb seiner arabischen Geburtsstätte nach Mohammeds Tod im Jahr 632 und eine spätere Periode der Abschließung und eines verstärkten Konservatismus, welche die Region zutiefst verwundbar für den Westen machte. Der mittelalterliche Pomp der Religion bewies deren Fähigkeit, Ideen hervorzubringen und die allgemeine menschliche Entwicklung voranzubringen; ihr späterer Niedergang bewies das Gegenteil. Wie konnte der Islam seine Lebensgeister zurückgewinnen? Sollte man ihn für die Welt öffnen oder vor ihr schützen? Das waren die Fragen, die Reformer im 19. Jahrhundert immer wieder stellten, während sie nach dem richtigen Weg suchten und sich dabei in der eigenen Vergangenheit nach Anleitung umschauten.
Von zentraler Bedeutung für die ambivalenten Gefühle gegenüber westlichen Innovationen war der Gedanke, dass doch sie und nicht die Europäer oder Amerikaner sich der Gunst Gottes erfreuten. Gott hatte den Islam als letzte der abrahamitischen Religionen geschaffen, und zwar nicht zur Ergänzung des Christentums, sondern um es auszulöschen, und selbstverständlich unterstellte man, dass nach der Einführung des Islam keinerlei Notwendigkeit mehr für den christlichen oder jüdischen Glauben bestand.
Während mehrerer Jahrhunderte nach der Gründung des Islam hatte die Umma, die Gemeinschaft der Gläubigen, allen Grund, sich für die Siegerin der Geschichte zu halten. Nur göttliche Parteinahme bei der Befruchtung des menschlichen Geistes vermochte die wundersame Ausbreitung des Islam nach 632 zu erklären, der aus der arabischen Halbinsel hervorbrach, Byzanz riesige Gebiete abrang und dem vierhundert Jahre alten Sassanidenreich im Iran ein Ende setzte. Im Namen des Islam entstanden neue Reiche, zuerst in Damaskus unter der Ummayyaden-Dynastie, dann ab der Mitte des 8. Jahrhunderts in Bagdad unter den Abbasiden. Die Expansion setzte sich fort bis nach Afrika hinein, bis auf die iberische Halbinsel und bis nach China. Aus einem bedrängten Wüstenkult wurde der Islam zur herrschenden Kraft in der bekannten Welt.
Im Jahr 732 war er nahe daran, Europa muslimisch zu machen. Wäre die Schlacht von Tours und Poitiers vom Kalifen statt von den Franken gewonnen worden, dann wäre es, wie der Aufklärungshistoriker Edward Gibbon schrieb, »möglich gewesen, daß der Koran in den Schulen von Oxford gelehrt und von den Kanzeln einem beschnittenen Volke die Offenbarungen Mohammeds verkündet worden wären«. Und der deutsche Historiker Hans Delbrück erklärte, es gebe »keine Schlacht, die wichtiger wäre in der Weltgeschichte als die Schlacht von Tours«.
Nach Tours und Poitiers hatten die muslimischen und die christlichen Reiche sich in ihren jeweiligen Teilen Eurasiens mehr oder weniger etabliert, und nahezu ein Jahrtausend lang stritten sie miteinander im längsten Kampf der Kulturen, seit die alten Griechen und Römer mit den Persern gerungen hatten. Aber auf politischem, militärischem und geistigem Gebiet neigte die Waage sich doch eindeutig zugunsten der Muslime. Nirgendwo sonst strahlte der Glanz des Islam so hell wie im Bagdad der Abbasiden, das gut zweihundert Jahre lang den Anspruch erheben konnte, die Hauptstadt der zivilisierten Welt zu sein. Die am Tigris gelegene, Mitte des 8. Jahrhunderts von dem Kalifen Mansur gegründete Stadt, die nicht nur Araber, sondern auch Perser und aramäisch sprechende Juden und Christen anzog, war das Zentrum eines Reiches, das erstmals seit Alexander dem Großen Ost und West vereinte. Die Abbasidenherrschaft stützte sich auf staatliche Macht, Handel und intellektuelle Handelsstraßen von gewaltiger Länge. Zugleich war der Islam unter den Abbasiden offen für fremde Einflüsse und übernahm Geschmack und Wissen anderer Kulturen.
Im 9. Jahrhundert reisten Emissäre der Abbasiden durch die bekannte Welt und brachten indische Abhandlungen zur Mathematik, persische Theorien zur Staatskunst und Vorbilder für jene umgängliche literarische Promenadenmischung mit nach Hause, die die Erzählungen aus tausendundeiner Nacht darstellen. Vor allem aber holten die Männer des Kalifen aus Byzanz nahezu den gesamten Schriftenbestand der griechischen Kultur nach Bagdad.
Auf diesen kulturellen Schätzen aufbauend, begannen die Muslime, ihren eigenen Beitrag zum menschlichen Wissen zu leisten – nicht nur im eigentlichen Herrschaftsgebiet der Abbasiden, sondern auch im Großteil der Fürstentümer in der Umgebung. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts popularisierte der Astronom al-Khwarizmi die Verwendung von Zahlzeichen und verblüffte später westliche Gelehrte mit seinen außergewöhnlich hochentwickelten Sterntafeln. Hundert Jahre später verwendete der aus Basra stammende Alhazen in einem Experiment erstmals eine Lochkamera. Im frühen 10. Jahrhundert entdeckte der Arzt al-Razi den Unterschied zwischen Masern und Pocken. Sein persischer Landsmann Omar Khayyam sorgte für Fortschritte in der Algebra – vom arabischen al-dschabr: Zusammenfügen von Zerbrochenem – und verfasste eine Manifest für den Hedonismus, seine berühmten Vierzeiler. Am anderen Ende der muslimischen Welt, in Andalusien, einem abtrünnigen Emirat, das weite Teile des heutigen Spanien und Portugal umfasste, glänzte man auf dem Gebiet der Landwirtschaft und führte die Aubergine, die Wassermelone, den Spinat und den Hartweizen ein, der heute als unverzichtbar für gute Linguine gilt. Und überall in seinen höchst unterschiedlichen Herrschaftsgebieten verschmolz der Islam mit seiner Umwelt und brachte eine Kultur voller Raffinement und Schönheit hervor, mit Glanzleistungen auf dem Gebiet der Architektur, der Textilien, der Keramik und der Metallurgie.
Manche Zentren muslimischer Gelehrsamkeit im Goldenen Zeitalter des Islam waren so dynamisch und so frei in der ungehinderten Ausübung des rationalen Verstandes, dass der Engländer Adelard von Bath, der in den frühen Jahrzenten des 12. Jahrhunderts den Mittelmeerraum bereiste und das arabische Wissen in sich aufnahm, die Nase über seine unwissenden Landsleute rümpfte: »Ich habe von meinen arabischen Lehrern gelernt, die Vernunft zum Führer zu nehmen«, schrieb er; »du hingegen bist zufrieden, als Gefangener einer Kette von fabelnden Autoritäten zu folgen. Welchen anderen Namen kann man der Autorität geben als den einer Kette?«[2]
Die Leistungen der klassischen islamischen Zivilisation – und die Kluft zwischen ihr und der zumeist rückschrittlichen christlichen Welt, in der nach dem Untergang des Römischen Reichs die Gelehrsamkeit stagnierte und Wissen sogar verlorenging – sollten die im 19. Jahrhundert hervortretenden Modernisierer inspirieren, aber auch verstören. Noch komplizierter wurde der Prozess durch die Tatsache, dass Staat, Handel und Kunst sich im islamischen Raum gemeinsam mit den Religionswissenschaften und anderen säkularen Formen des Umgangs mit dem Wissen entwickelt hatten. Es kam zu einer Spaltung zwischen den theologischen und den philosophischen Traditionen, zwischen Glaube und Vernunft, und an dieser Front sollte die islamische Aufklärung ihre Kämpfe ausfechten.
Der Prophet hatte den Muslimen einen Weg aufgezeigt, dem Muslime zu folgen hatten – die Scharia, deren Rohmaterial der Koran, der Hadith oder die Sammlung der Aussprüche des Propheten und die Sunna bildeten, die Aufzeichnung seines Tuns und Beispiels. Die Scharia enthielt Regeln, die Männer und Frauen befolgen sollten, wenn sie ein gottgefälliges Leben führen wollten, aber damit sie zu einem Rechtssystem im eigentlichen Sinne wurde, musste sie von religiösen Autoritäten, der Ulema (wörtlich: »die Wissenden«) ausgearbeitet werden, und zu diesem Zweck wurden Rechtsschulen gegründet.
Die frühen Muslime hatten nicht viel über philosophische Fragen wie ihre Stellung gegenüber Gott oder das Verhältnis Gottes zum Kosmos nachgedacht. Die Abbasiden begannen, diesen Mangel zu beheben. Die von ihnen in Auftrag gegebenen Übersetzungen klassischer griechischer Texte ermöglichten es den Muslimen, gemeinsam mit den antiken Denkern über die Natur und die Mechanik des Universums und die Arbeitsweise Gottes nachzudenken.
Im 8. Jahrhundert wandte sich eine Mutazila genannte Gruppe gegen den Fatalismus und behauptete, dass der Mensch über einen freien Willen verfüge. Zur Begründung verwies sie auf Koranverse, die zeigten, dass Gott keine Freude an einem untätigen Verstand habe. In einem dieser Verse heißt es: »Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Tauben und Stummen, die nicht begreifen.« Die Mutaziliten wandten sich auch gegen den Anthropomorphismus – den Gedanken, dass Gott menschliche Attribute besitze – und behaupteten, der Koran sei nicht gleichewig mit Gott, sondern erschaffen worden.
Die Argumente waren spekulativen Charakters und luden zu weiterer Spekulation ein. Manche gelehrte faylasufs (eine Abwandlung des griechischen »philosophos«) stellten sogar die Geltung einzelner religiöser Wahrheiten in Frage, etwa das Wunder des Prophetentums und sogar die Scharia. Sie sahen in den göttlichen Gesetzen ein nützliches, wenngleich unbefriedigendes Mittel, die harten Kanten des Menschen ein wenig abzuschleifen, ein Mittel, das indessen nicht an den elaborierten Tugendbegriff heranreichte, zu dem sie selbst Zugang hatten. Einige der kühnsten Denker der islamischen Welt behaupteten nun, man müsse diese Wege durch Vernunft und Erfahrung finden. So auch Ibn Sina, der im Westen Avicenna genannt wird. Von gutem Aussehen, mit einnehmendem Wesen und ausgesprochen reiselustig, verbrachte er die ersten Jahrzehnte des 11. Jahrhunderts an mehreren persischen Höfen, wo man ihn wie einen jungen Mozart begrüßte. Er heilte einen König, der glaubte, eine Kuh zu sein, und schrieb eine medizinische Abhandlung, seinen Kanon der Medizin. Zudem formulierte er einen berühmten »Gottesbeweis«, der auch nach Europa gelangte, wo er bis zur Aufklärung überlebte. Obwohl von der Existenz Gottes überzeugt, nahm er sich selbst von den kleinlicheren göttlichen Verboten aus und trank jeden Tag einen Becher Wein, weil er dadurch besser studieren konnte, und er verrichtete die fünf täglichen Gebete nicht deshalb, weil der Allmächtige dies so wünschte, sondern weil das seine Konzentration verbesserte.
Trotz ihres elitären Charakters schufen die Weisen, Künstler und Verwalter des Goldenen Zeitalters des Islam eine Kultur, die zugleich eins und vielfältig war, weil die zentrifugalen Kräfte der Stammes- und Volkszugehörigkeit ein Gegengewicht in der einen, polaren Wahrheit des höchsten Wunders Gott fanden. Der Zweck aller menschlichen Errungenschaften war der Ruhm Gottes, aber der Fleiß, das Urteilsvermögen und die Innovation, die darin eingingen, gehörten dem Menschen. Auch vertrat die klassisch-islamische Zivilisation nicht die bei späteren »Fundamentalisten« so beliebte Ansicht, nur was schon zu Zeiten des Propheten bestanden habe, könne als wahrhaft islamisch gelten. Im Arabien des Propheten hatte es keine Kuppeln, keine Sanskritweisheit, keine Rosenlauben gegeben – die reife islamische Zivilisation hatte all dem Raum gegeben.
Natürlich waren nicht alle glücklich mit dieser ökumenischen, fortschrittlichen Lebensauffassung, und eine konkurrierende, am Buchstaben klebende und moralistische Strömung behauptete, die Spekulationen der faylasufs seien genau das, was der Koran zu verhindern suche. Da die Menschen Gott nicht zu begreifen vermochten, nähere man sich ihm am besten im Geiste des bila kayf, nämlich »ohne nach dem Wie zu fragen«. Dieser Ausdruck wurde im 10. Jahrhundert von Abu l-Hasan al-Aschari popularisiert, einem Theologen aus Basra, der anfangs mit den Mutaziliten sympathisiert hatte, später aber zu deren Gegner wurde und erklärte: »Wir glauben, dass Gott alles geschaffen hat, indem er ihm einfach befahl zu sein, wie er sagt: ›Unser Wort zu einem Ding, so wir es wollen, ist nur, daß wir zu ihm sprechen: ›Sei!‹, und so ist’s.«
Obwohl die Mutaziliten im späten 9. Jahrhundert verfolgt wurden, hatte ihr Vermächtnis doch Bestand. Sie hatten auf beispiellose Weise zur Spekulation ermuntert, und selbst ihre Gegner mussten kalam – die Erörterung des Glaubens auf der Basis rationaler Kriterien – als Fach in ihren Schulen akzeptieren. Im 19. und 20. Jahrhundert sollte gegen Reformer des Islam oft der Vorwurf des Mutazilismus erhoben werden, wie auch ihre Kritiker häufig an den führenden Gegner der Philosophie, den Rechtsgelehrten Ahmad Ibn Hanbal, erinnerten, der überzeugt war, man müsse in den Hadithen nach Gottes Willen suchen, und deshalb 25000 davon auswendig lernte. Die Spaltung zwischen Fundamentalismus und Philosophie nahm ihren Anfang im 9. Jahrhundert.
Aus der Sicht des 21. Jahrhunderts ist klar, dass der Niedergang seinen Anfang bereits in der Blütezeit der islamischen Zivilisation nahm. Im 10. Jahrhundert begann die muslimische Welt sich zu spalten, wobei Sunniten und Schiiten sich zu rivalisierenden Staaten konsolidierten, die einander bekämpften. Eine Zeitlang schien es, als könnte die schiitische Minderheit die gesamte arabische Welt erobern, doch dank des Sturzes des Fatimidenkalifats in Kairo 1171 durch Saladdin etablierten sich die Sunniten als die dominierende Kraft. Mit dem Aufstieg der Safawidendynastie im persischen Hochland zu Beginn des 16. Jahrhunderts trennten die iranischen Muslime sich entschieden von ihren sunnitischen Glaubensbrüdern, und der Iran wurde zu dem schiitischen Staat, der er bis heute geblieben ist.
Auch äußere Bedrohungen hemmten die muslimische Kreativität. Die Ende des 11. Jahrhunderts einsetzenden Kreuzzüge wurden als Zeichen göttlichen Unmuts gedeutet. Das 13. Jahrhundert erlebte die Reconquista des muslimischen Spanien am einen, die Invasion der Mongolen am anderen Ende der muslimischen Welt. Wie zu erwarten, führten diese Katastrophen zu Zweifeln, Introspektion und dem Wunsch, die Gunst Gottes zurückzugewinnen. Genau dieses Gefühl einer akuten Bedrohung, die sich nur abwenden ließ, wenn man Gewissheit an die Stelle des Zweifels setzte, hatte die Niederlage der philosophischen islamischen Denker zur Folge, die ihre puristischen Gegner ihnen zufügten.
Schuld war der Rationalismus. Das behauptete jedenfalls ein erzürnter Flüchtling vor den Mongolen, Ahmad Ibn Taymiyya. Er wurde zum herausragenden Rechtsgelehrten der Zeit und bekämpfte die Vernunft in all ihren Formen – selbst als Mittel zur Prüfung der islamischen Lehre. Die Ulema sollte sich allein auf den Koran, die Hadithe und die Sunna der »Ahnen« berufen, womit er nicht allein den Propheten meinte, sondern auch dessen Gefährten und deren unmittelbare Nachfolger. Ziel des Gläubigen sei es nicht, Gott zu erkennen, sondern ihm zu gehorchen. Hinsichtlich der Fähigkeiten des Menschen war Ibn Taymiyyas Sicht erkennbar defensiv und pessimistisch.
Als in Westeuropa die Renaissance ihren Höhepunkt erreichte, hatte die spekulative Tradition im Islam ihre Vorrangstellung an den Schulen eingebüßt, und die siegreichen Strömungen konzentrierten sich entweder auf die buchstäbliche Bedeutung des Wortes Gottes oder auf esoterische Wege zu seiner Erkenntnis. Die buchstabenorientierte Ulema und die Mystiker gingen unterschiedlich vor. Erstere versuchte, die Welt enger zu machen, Letztere, aus ihr zu fliehen. Zusammen hatten sie verheerende Auswirkungen auf die islamische Zivilisation, die das Ergebnis einer freudvollen Auseinandersetzung mit der Mechanik der Welt und der Kanalisierung der Neugier in Denkgebäude, Kunst und Verwaltung gewesen war – mit der Folge, dass die islamische Zivilisation sich in vielen ihrer lebendigsten Formen verlangsamte und schließlich ganz zum Stillstand kam. Das fragile Gleichgewicht zwischen Konservatismus und Innovation, Aufgeschlossenheit und Authentizität, das es Kulturen ermöglicht, sich weiterzuentwickeln und dennoch erkennbar sie selbst zu bleiben, gelangte an ein Ende.
Anfangs wurde diese Verlangsamung noch vom Glanz des Osmanischen Reiches überdeckt. 1453 fiel die byzantinische Hauptstadt Konstantinopel an Sultan Mehmed II. und wurde zu Istanbul. Aus der Hagia Sophia, der größten Basilika der Christenheit, wurde eine Moschee. Anderthalb Jahrhunderte später umfasste das Reich außer den osmanischen Kernlanden in Anatolien und dem Kaukasus auch den Balkan, den östlichen und südlichen Mittelmeerraum sowie die heiligen Stätten in Mekka und Medina. Aber die Osmanen-Dynastie wird heute mehr als jede andere mit dem Verlust jener Originalität und Finesse assoziiert, die Abbasiden und Fatimiden einst besessen hatten, und es war der Blick auf die Osmanen, der Europa zu dem Schluss veranlasste, der Islam sei ein System zur Erstickung menschlichen Potentials. Tatsächlich erinnerte der Zustand der Religionswissenschaft im Osmanischen Reich zunehmend an eine Totenstarre. Generationen von Gelehrten hatten die alten rivalisierenden Hadith-Sammlungen auf einige wenige, angeblich autoritative Kompendien zurückgestutzt. Auch die wichtigsten Differenzen zwischen den vier sunnitischen Rechtsschulen waren längst ausdiskutiert. Der Grundsatz des taqlid, der Nachahmung der Inhaber religiöser Autorität, beherrschte die Religionsschulen, und ijtihad, der eigenständige Gebrauch des Verstandes, galt nicht mehr als akzeptabler Weg zur Bestimmung des göttlichen Willens. Angesichts der so autoritativ und erschöpfend festgeschriebenen Scharia wirkte der Versuch, mit den Mitteln des schwächlichen menschlichen Verstandes nach der Wahrheit zu suchen, fast schon wie Anmaßung und Torheit. In Klöstern und Moscheen kehrte sich die Stimmung gegen Spekulation, Vernunft und Kreativität.
Der Islam verfiel demselben Aberglauben und derselben Abwehrhaltung, die weite Teile Europas im Mittealter heimgesucht hatten. Nun wurde allseits akzeptiert, dass Mohammed frei von Sünden gewesen sei und diverse Wunder gewirkt habe, etwa die Spaltung des Mondes, so dass ein Stern zwischen den Hälfen sichtbar wurde. Prediger lenkten die Aufmerksamkeit auf die Übel des Tabaks, des Kaffees und der Mathematik. Und auch die profanen Traditionen der Musik, des Tanzes und der Heiligenverehrung, die sämtlich mit der Mystik verbunden waren, wurden nun von den Kanzeln herab gebrandmarkt. Als wollte man die Isolation des Glaubens noch hervorheben, wurde Christen und Juden verboten, Mekka und Medina zu betreten. Und besonders berüchtigt vielleicht: 1580 wurde die letzte verbliebene Sternwarte der islamischen Welt, im Istanbuler Stadtteil Galata, geschlossen, weil sie angeblich die Astrologie förderte und Gott erzürnt hatte, so dass er die Pest schickte.
Auch die Bildung außerhalb der Religionsschulen litt unter Ignoranz und begrenzten Horizonten. Im Ägypten des 18. Jahrhunderts besuchte man die Schule, um den Koran auswendig zu lernen. Der Koran vermittelte alles, was man für dieses und das nächste Leben brauchte, so dass der Dorflehrer zwar eifrigen Gebrauch von seinem Palmstock machte, aber auf Gebieten wie Geschichte, Geographie oder Naturwissenschaften kaum etwas oder gar nichts zu bieten hatte. Den Rechenunterricht überließ man dem öffentlichen Wäger auf dem Marktplatz, zu dem man junge Männer (fast nie aber junge Frauen) schickte, damit sie die elementarsten Grundsätze des Wiegens und Messens erlernten. In der breiten Bevölkerung genoss die Alchemie größeres Vertrauen als die Chemie, der Chirurgie kamen die Barbiere zwischen den Rasuren nach, und die Zeit-Berechner an den großen Moscheen widersetzten sich weiterhin der kopernikanischen Wahrheit eines heliozentrischen Universums.
In dieser engstirnigen Welt war es keineswegs ausgemacht, dass Neugier eine Tugend sein konnte, denn durch Neugier verlor man die Sicherheit der arabischen Welt des 17. Jahrhunderts. Ein moderner Einwohner Kairos schrieb dazu: »Niemand hatte jemals von Birma gehört. Niemand wusste oder fand es sonderlich interessant, wo die Quelle ihres eigenen Nil lag, abgesehen davon, dass sie weit entfernt war, in den Ländern, aus denen die afrikanischen Sklaven kamen. Welchen Nutzen hätte solch ein Wissen gehabt?«[3] Obwohl Teile des Nahen und Mittleren Ostens bereits mit der übrigen Welt verflochten waren – so exportierte man ägyptische Baumwolle über Alexandria nach Europa –, bestand kaum ein Bewusstsein dafür, dass Diplomatie, Handel und Krieg Wirkungen entfalten konnten, die über einen äußerst eng begrenzten Bereich hinausgingen. Im osmanischen Konstantinopel hielt man die Französische Revolution weitgehend für eine ferne Erschütterung ohne sonderliche Bedeutung und die Revolutionäre für eine »bösartige Bande«, die die Religion leugnete und Lügen verbreitete. Man nimmt an, dass das Wort »Amerika« in der persischen Sprache erst in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts auftauchte.





























