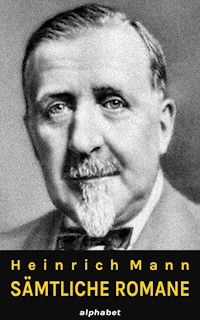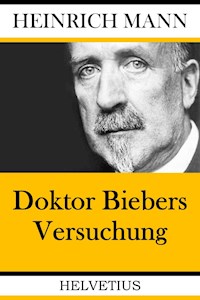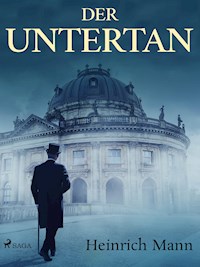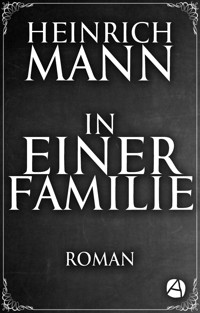Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Die Jagd nach Liebe ist ein Roman von Heinrich Mann, erschienen 1903. Der Text war erst im Januar desselben Jahres entworfen und die Niederschrift bereits im Sommer abgeschlossen worden. Der dekadente Millionärssohn Claude begehrt die schöne Ute, wird sie aber nie besitzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Die Jagd nach Liebe
I. Ziele
In Utes rotes Haar stieß ein einzelner Sonnenstrahl einen metallischen Glanz, als sei er ein Dolchstoß. Ute wandte Bella den Rücken. Sie hielt eine Hand auf der Hüfte, streckte die andere weit aus gegen die Dachkammer im kalten Nachmittagslicht und sagte über ihre Schulter hinweg, in den schrägen Winkel hinein, zu dem Totenschädel Nathanael:
»Ziele! ... Um Herrschaft kämpfen, den andern schaden, ihren Haß einatmen, die eigene Persönlichkeit wirken fühlen, Rausch erregen, die Seelen alle zittern sehen: Ziele!«
Darauf drehte sie sich um. Bella blinzelte ihr gelassen zu. Sie ruhte fleischig und gemütlich in ihrem niedrigen Korbstuhl zwischen seidenen Kissen, denen sie glich. Ihr Haar, breit frisiert und blond ohne Glanz, beschattete ihre weiten, weichen Züge und die Nase, die beweglich und zu lang war. Ihr fleischiges Handgelenk hing kraftlos vom Teetisch. Sie fragte:
»Und der gute alte Herr aus Lindau, der dir Rosen geschickt hat, was ist mit dem?«
»Er war neulich im ›Othello‹, und er wollte wieder anfangen. Ich sagte ihm: Ach so, das sind Sie. Ich habe mit Ihnen über Divorçons gesprochen und über die Ehe im allgemeinen, und Sie haben daraus geschlossen, daß Sie mir Rosen schicken dürfen. Das war dumm, aber Sie können nichts dafür. Denn es ist meine Schuld, wenn ich immer vergesse, daß man mit einem jungen Mädchen von einer Sache nicht um der Sache willen redet, sondern wegen des jungen Mädchens. – Und dann hab ich ihn stehen lassen.«
Bella wiegte den Kopf.
»Wer weiß ...«
»Ob er mich nicht geheiratet hätte?«
Ute trat dicht vor die andere hin und sah tief auf sie herab.
»Und du bist Künstlerin?«
Bella murmelte:
»Lieber Gott, ich singe ...«
»Du singst wie aus seidenen Kissen hervor, und so einladend.«
»Wenn du meinst, daß ich singe, um meine Persönlichkeit wirken zu fühlen. Papa kauft mir von seinen Tantiemen Ringe und Kleider, anstatt vernünftigerweise eine Mitgift für mich zurückzulegen.«
»Ach ja ...«
Ute machte zwei ungeduldige Schritte.
»Aber ich spiele, damit sogar noch in Nathanaels leerem Gebein ein Schwindel entsteht! ... Wenn ich denke, ich sollte schließlich das alles erarbeitet haben zugunsten eines einzigen – damit ein einzelner Bürger mich heiratet. Meine ganze Kunst, meine Arbeit, meine gepflegte, mühsam erarbeitete Persönlichkeit einem einzelnen Bürger in die täppischen Hände zu werfen! Es wäre ein Verrat an jeder von meinen Schminkbüchsen!«
Bella sah ihre Freundin die Wand hinschreiten. Auf abgedankten Kartentischen wechselten Photographien von Schauspielern mit Lanolintöpfen und Puderdosen. Über Archibalds Bildnis hinweg schleuderte Ute eine starke Geste nach dem Schriftstück, das ein rotes Bändchen an einen Nagel knüpfte.
»Das ist mein Engagement, es ist ja mit einer Art Dienstmädchenschrift geschrieben, und es gilt ja nur für eine Sommerbühne, eine ziemliche Schmiere, irgendwo mitten im Walde: aber ich schwöre dir, wenn ich das nicht hätte, wenn Archibald mich fallengelassen hätte, wenn er mein Temperament nicht genügend oder sonst irgendeinen Schaden an meinem Talent gefunden hätte – oh, ich hätte euch kein Wort davon gesagt, aber ich wäre dort unten irgendwo aus der Isar gezogen worden. Dann hättet ihr's euch denken können!«
Bella kreischte weich.
»Nein! Daß deswegen ein hübsches Mädchen sich umbringt, nein, das hätten wir uns so leicht nicht gedacht.«
»Aber wenn das hübsche Mädchen einem landläufigen Assessor zuliebe ins Wasser springt, dann sind alle einverstanden?«
»Mein Gott ja, das kennt man.«
»Ich aber werde eine große und berühmte Schauspielerin – oder ich ende übel«, sagte Ute schauerlich und tief.
Sie stand aufgerichtet wie eine Erscheinung, groß, starkknochig, die Arme lang herabgelassen an dem schwarzen Hängekleid, das Gesicht erloschen unter dem hohen Brand ihres Haars.
Plötzlich zuckte ihr starker Mund, sie warf den Kopf zurück, das Kinn bog sich, schon leicht gepolstert, fahl von Chypre, ihr Blick flammte kalt zwischen den mit Kohle gefärbten Wimpern, die schwarzen Barren der Brauen drohten unter ihrem wilden Haar.
»Ich habe keine Angst«, sagte sie. »Ich werde, was ich will.«
Bella war eingeschüchtert. Die Züge der Freundin erschienen ihr zu groß, zu mächtig gehauen, sie fand ihren Mut zu unbedingt, ihr Wesen zu großartig.
»Wenn es nur gut geht«, meinte sie schwach. »Aus den meisten wird doch nichts ... Übrigens, mit dir ist es etwas anderes – da du Claude hast.«
»Was soll das. Du weißt ganz genau, daß der Kleine mein Freund ist. Darum gibt er mir Geld, und darum geb ich's ihm zurück, sobald ich eine große Gage habe.«
»Und wenn du keine kriegst?«
»Ausgeschlossen.«
»Versuche den Fall zu setzen. Womit entschädigst du ihn dann? ... Er liebt dich, nicht wahr?«
»Und du nimmst an, wenn ich ihn nicht bezahlen kann, muß ich ihn wiederlieben.«
»Man nimmt das an.«
»Du bist mal modern heute.«
»Bitte sehr, ich kenne keine, die so modern wäre wie ich. Glaub doch nur nicht, beste Ute, daß ich weniger entschlossen ums Dasein kämpfen werde als du. Man wird mich heiraten: denk daran, was ich dir sage. Ah! niemand, der mich nicht heiratet, wird irgendwas von mir erlangen.«
»Von mir erlangt er auch das Heiraten nicht.«
»Wer dir Geld geben darf, der hat schon was erlangt.«
»Nochmals, Bella, du sprichst doch von Claude, und du weißt, daß er zwanzig ist, geradeso alt wie ich, und daß er schon Mätressen hat, und daß er eines Tages sehr reich sein wird, und daß er mein Freund ist. Nun paß einmal auf: er unterscheidet zwischen mir und seinen Mätressen. Von ihnen nimmt er, was sie geben können, zu mir kommt er mit höhern, feinern Bedürfnissen.«
»Und – bezahlt sie?«
»Unter Umständen. Wir könnten ja viel mehr Geld haben. Hast du noch nie bedacht, wie dumm es von uns ist, das viele Geld, das die Männer für Liebe ausgeben, alles an untergeordnete Geschöpfe weggehen zu lassen, an Mädchen aus dem Volk, die bloß durch ihre Gliedmaßen heraufkommen und dann mit ihren Automobilen uns überfahren. Wir könnten selber drinsitzen, sag ich mir oft. Das bißchen, was man dafür von uns verlangt – Gott, ich spreche nicht von mir, für mich gibt es nur die Kunst ... Aber ihr andern, warum tut ihr den jungen Leuten, euren Standesgenossen, eigentlich nicht den Gefallen?«
»Das geht doch nicht«, meinte Bella sanft. Aber Ute verliebte sich in ihren Einfall.
»Der junge Mensch wird euch den ehemaligen Dienstmädchen vorziehen, selbst wenn ihr weniger schön seid. Ihr steht doch geistig auf seinem Niveau, manchmal höher. Und das braucht er. Wir haben es doch nicht mit dem nervenstarken Knoten zu tun, der den Krieg von siebzig mitgemacht hat und mit seiner Mannesgewalt ein Frauchen beseligt, dem er Kinder abzuhalten und Lampen zu putzen gibt. Der von heute ist schwächer als wir, er weint nach einer Gefährtin – fällt es dir nicht auf, daß heute fast immer der Mann im Arm der Frau hängt –, nach einer Erlöserin aus seiner nihilistischen Einsamkeit.«
Bella schluckte eine gut durchgekaute Makrone hinunter.
»Nihilistische Einsamkeit, was ist das. Trinkst du keinen Tee?«
Ute trank und erklärte:
»Die Einsamkeit, in der er mit seinen vor Nervenschwäche welt-, staats- und menschenfeindlich gewordenen, auf das Nichts gerichteten Gedanken umherwankt.«
»Komisch«, bemerkte Bella und kaute. »So was kann uns nicht passieren.«
»Du siehst, wie leicht wir diesem schwachen Menschen sein Geld abnehmen könnten – seine letzte Kraft – ohne ihm was Erhebliches dafür hinzugeben.«
»Du bist – na, ich pfeif ja auch drauf, aber du bist schon entsetzlich unmoralisch.«
»Das ist mein Stolz.«
Bella nickte.
»Man muß es sein. Es liegt in der Luft und wird verlangt.«
»Nein, ich bin es«, sagte Ute.
Sie schwiegen. Dann bemerkte Ute:
»Die Teeblätter sind abscheulich trocken, ich habe sie vom Bäcker an der Ecke. Papa, der Lump, konnte mir kein Geld geben, und Claude muß Archibald bezahlen. Claude hat auch nicht immer was. Sein Vater ist wieder krank, er kann ihn um nichts bitten.«
Bella zögerte.
»Und wenn der Herr Marehn stirbt?«
»Nun dann –«, machte Ute.
»Es ist doch nicht sicher, wieviel seine Mutter ihm dann gibt. Du mußt auf alles gefaßt sein, Ute. Die Frau hat ja andere Männer zu versorgen, bevor sie an Claude denken kann.«
Ute hob die Schultern.
»Drum such ich vorher noch meine Ausstattung zusammenzubringen, wenigstens für die klassischen Rollen. Die hält jahrelang.«
»Kannst du dir vorstellen, was dann aus Claude würde?«
»Nein. Schön wäre es nicht«, erklärte Ute mitleidig und mit Ungeduld.
»Dann unterstützt du ihn.«
»Tatsache ist – wenn ich mir vorstelle, was ich Leben nenne und wozu ich entschlossen bin: Rivalinnen wegärgern, für den Erfolg lügen, stehlen, bestechen und, wenn es sein müßte, morden; – das alles könnte er nicht. Bloß sein Geld macht ihn zum Leben fähig. Wenn ich arbeite, staunt er mich immer an, als sei ich aus einer unbegreiflichen Welt. Aber er hat was für sich. Er ist auch frech. Wir andern, wir sind ganz frech egoistisch. Claude hat etwas – Archibald nennt es den Zynismus der Güte. Neulich, als wir früh um sechs nach dem Bauernball in Lokale zogen – Papa wollte noch Sekt trinken, der Lump kriegt nie genug. Mama hatte einen Rausch und meinte, dann brauchte sie an dem Morgen wohl nicht mehr die Treppe zu scheuern. Claude hatte die ganze Nacht alles bezahlt. Aber da, mitten in der Ludwigstraße, stellt er sich vor Papa, den jungen Ende, den Lumpen, hin und sagt:
»Jetzt hab ich nur noch das Stundengeld für Ihre Tochter. Das geb ich nicht her.«
»Ich sag dir, Papa war einen Augenblick still. Ich dachte: Und wenn ihm das jemand auf dem Theater vormachte, wüßte er gar nicht, wie schön es ist – und wollte ihn deswegen geringschätzen. Aber ich konnte nicht.«
Bella wühlte sich erregt aus ihren Kissen heraus.
»Er hat deinem Vater, dem jungen Ende, mal Bescheid gesagt. Den Vätern muß man Bescheid sagen.«
Aber Ute bewegte die Hand.
»Das verstehst du nicht. Er hat Papa, dem Lumpen, keine Lehre geben wollen. Wozu übrigens. Er hat nicht einmal mir Eindruck machen wollen. Besonders zart war die Szene überhaupt nicht von ihm, denn die andern hörten zu, was mir aber natürlich egal war. Was ich glaube: in seiner Güte ist eine ganze Menge Verachtung, die stille Verachtung eines Schwachen ... Nein, er ist gar nicht zu verachten.«
»Aber zu lieben auch nicht«, sagte Bella. »Ich verstehe dich.«
Ihr früherer Gedanke hielt sie fest.
»Die Väter müssen's mal hören! Meiner, der von seinem großen Einkommen jedes Jahr 450 Mark zurücklegt und sich einbildet, davon sollen Mama und ich nachher leben – und mir das Studium verbietet!«
»Er weiß es noch immer nicht?«
»Keine Ahnung. Mama fragt manchmal schüchtern an, ob ich nicht doch noch was lernen solle. Dabei bin ich gleich fertig ausgebildet. Wir werfen 's Geld hinaus für Toiletten – denn das will er – und verkaufen sie gleich wieder an Tändlerinnen. Davon wird das Konservatorium bezahlt. Manchmal mit noch schäbigeren Hilfsmitteln. Aber zum Mittagsessen trinken wir täglich Sekt.«
Die weiche Bella war ganz in Empörung. Ute sagte wegwerfend:
»Deiner ist ein gediegener Bürger und meiner ein Lump, der bei allen festlichen Veranstaltungen Spaß macht und schmarotzt. Aber sie nützen uns einer so wenig wie der andere.«
»Wir sind auf uns selbst gestellt.«
»Und das ist recht!«
Sie standen beide auf den Füßen, Bella griff in den Zigarettenkasten.
»Arbeiten!« rief Ute und baute ihre Gestalt pomphaft auf vor Nathanael. »Nur arbeiten!«
»Da es sein muß«, sagte Bella entschlossen. »Studieren: den Tanz um den goldenen Mann!«
»Nein! Die Kunst allein!« so deklamierte Ute. »Immer nur sie! Wozu Männer. Ich will nicht einmal meine Zeit dafür verlieren, mit ihnen zu kämpfen. Wenn einer mir nützen kann, und es durchaus nicht anders tut, dann –«
Sie beendete nicht.
»Was liegt viel daran«, sagte sie und knallte laut mit zwei Fingern. »Stark sein!«
»Recht hast!« sagte Bella und bettete einen riesigen schwarzen Hut auf ihr breites Nest stumpfblonder Haare.
»Meine Arbeit! Meine Kunst!« so warf Ute den Knochen Nathanael ins Gesicht, bald mit Grabesstimme und bald mit gellem Schrei. Sie arbeitete.
Auf einmal rief Bella:
»Da ist ja Claude! Grüß Gott, Herr Claude!«
Claude vollführte einen kleinen steifen Gruß, nur mit dem Kopf – und blieb auf der Schwelle, dunkel gekleidet, schmächtig, gelblichblond, mit matten Schatten im schmalen Gesicht, schwachem Kinn, peinlich geschlossenem Mund und die Lider mit Stolz halb gesenkt über den verwischt blauen Blick.
Er blinzelte in die kalkweiße Kammer. Am Fenster, von dem die Sonne sich zurückzog, brannten auf dem Plakat eines Künstlerfestes die roten Tänzerinnen. Die Photographien ringsumher strotzten voll prunkender Gebärden, eine Weckuhr tickte laut und hart. Ein fetter und scharfer Duft von Kosmetiken und jungen Mädchen überlud die Ofenwärme. Er sah Bella mit den Händen am Hut, so daß der Kopf verlockend im Rahmen beider Arme stand, mit straff herausgearbeiteter Büste, ausladender Hüfte, gelassen in ihrer spannkräftigen Fülle. Aber Ute warf sich kniend am Boden umher. Ihre Hände griffen hoch in die Luft, stark und weiß an ihren schmalen, festen Gelenken. Und ihre langen Schenkel arbeiteten, stürmten, spielten mit unter den rollenden Falten des Kleides, als zwei starke biegsame Mimen. Sie deuchte ihm ganz und gar so kühn und schwer, wie der Sturz ihres metallischen Haares über ihrem hellen Profil, mit der geraden, breitgesattelten Nase, den weiten grauen Augen, schwarz überbrückt, dem gewölbten und fahlen Kinn, der feucht vorgeschobenen, fleischigen Unterlippe ... Claude meinte sehr lange auf der Schwelle zu stehen, und er verspätete sich dort nicht zum erstenmal. Dies waren zwei Empörte, laut und ihrer Sache gewiß. Er fühlte sich vorschriftsmäßig, streng verhalten, schüchtern aus Zweifelmut.
Er trat vor, drückte Bella die Hand und sagte: »Wenn du erlaubst, Ute, begleite ich dich nachher zur Stunde.«
»Ich hab noch Zeit«, sagte Ute. Dann schrie sie wieder:
»So werde die Haarnadel zum Dolche! Gleichviel ... Und nur eine Unschuld!«
»Aber ich muß machen«, sagte Bella. »Adieu, Schatz.«
Sie wollte an Claude vorbei.
»Was haben denn Sie am Arm. Ach! Ist denn Ihr Papa – Ja? Oh, das ist ja schrecklich!«
Ihr Gesicht war erschrocken darüber, daß es traurig zu sein hatte. Sie zog eine Schulter hoch, wand sich förmlich, um aus der Tragweite des Trauerfalles zu entkommen.
»Dann muß ich furchtbar eilen, daß ich nachher Ihrer Frau Mutter einen Besuch machen kann. Adieu, o Gott, wie schrecklich für Sie.«
Die Tür klappte zu. Ute hatte sich aufgerafft. Sie stellte sich vor Claude, sie dachte an ihre Kostüme.
»Das ist wirklich unangenehm«, sagte sie.
»Wie man's nimmt«, meinte Claude sanft. »Ich glaube, ihm lag nicht mehr viel daran.«
»Hast du ihn noch gesprochen?«
»Gestern. Er ließ mich rufen, seit vier Wochen mal wieder. Er saß wie immer in seinem Rollstuhl, er war etwas kurzluftig, und er konnte nicht sprechen. Er gab mir einen Tausendmarkschein.«
Ute nickte. Das waren die Kostüme, wenigstens die Hälfte von ihnen.
»Er wollte mir erst noch mehr geben, dann machte er eine Bewegung, als fände er's überflüssig ... Mama hat ihn gar nicht mehr gesehen ... Nun sind wir also soweit.«
»Wie weit?«
»Daß du deine Wohnung haben kannst.«
»Die Kostüme kommen erst.«
»Es kommt alles.«
»Eine ernste Frage, Claude. Bist du sicher, daß deiner Mutter viel übrigbleiben wird – für dich?«
Claude lächelte.
»Du meinst, von Eisenmann geht vor. Aber du mußt wissen, ich bin ein stiller Vorwurf. Oh, ich will es gar nicht sein. Womit die Frau sich unterhält, wie gleichgültig ist mir das. Wenn sie mich jemals liebgehabt hätte – weiter nehme ich ihr nichts übel. Aber sie fühlt irrtümlicherweise einen stummen Tadel, sooft ich ins Zimmer trete, drum wird sie mich immer mittels Taschengeld loswerden wollen.«
»Sie meint vielleicht, dein Papa hat dich gegen sie aufgebracht.«
»Der arme Papa, er konnte doch von der Frau schließlich nichts anderes verlangen. Seit fünfzehn Jahren im Rollstuhl. Ich habe wenige Überzeugungen, Ute, aber eine habe ich.«
»Die wird auch danach sein.«
»Wir betrügen jede Frau, der wir unter die Augen treten ohne die redliche Absicht, sie zu besitzen. Denn jede, aber jede einzelne, setzt das voraus und verlangt es. Wer erst in einem Zustand ist wie der arme Papa, der darf zu einer Frau – zu seiner eigenen oder einer andern – nicht einmal mehr sagen: ›Guten Tag, heute regnet's.‹ Das ist grober Betrug.«
Ute lachte kurz. Dann faltete sie geringschätzig den Mundwinkel. »Immer der eine Gegenstand, den du zu wichtig nimmst. Sprechen wir von unsern Angelegenheiten. Die Wohnung in der Karl-Theodor-Straße gefällt mir.«
»Achthundert. Ich gehe morgen früh und miete sie.«
»Das bleibt mein Absteigequartier, sooft ich nach München komme.«
»Sooft du nach München kommst«, wiederholte er eintönig. Seine Lider zuckten. Ute sah ihn neugierig an, schüttelte den Kopf und wandte sich ab.
»Daß du mich hier herausnimmst, das ist das Beste, weißt du, was du für mich getan hast. Es ist tatsächlich nicht mehr auszuhalten.«
Sie machte zwei Bühnenschritte.
»Ist der junge Ende aufsässig?« fragte Claude. Ute hob die Arme.
»Der Mensch könnte mich nicht so reizen, wenn ich nicht fühlte, ich habe etwas in mir, wenn ich das nicht totmache, wenn ich es nicht ganz totmache, werde ich auch so.«
»Na, so doch nicht.«
»Mich mit leichten, nicht erarbeiteten Erfolgen zu begnügen, da liegt die Gefahr. Wenn wir bei diesem betitelten und reichen Volk auftreten, das im Durchschnitt weder seine Glieder gebrauchen noch eine Schönheit fühlen kann – wie verlockend ist das Beispiel des jungen Ende, der diese Damen malt und diesen Baronessen Verse in den Mund legt. Es kostet so wenig, und der Erfolg ist da, man wirkt, man fühlt sich. Und ich lasse mich fortreißen von Papa, dem Lumpen, schwindle wie er, entweihe meine Kunst, und habe mit meinem Kitsch Erfolg, und amüsiere mich wie der junge Ende – ich bin doch fast so jung wie er – und bin ordentlich glücklich ... Das muß aufhören.«
»Soll es auch; aber reg dich weiter auf, du bist schön dabei.«
»Wirklich? Das ist kein Kitsch. Höre: Nächsten Donnerstag sollen wir zu der Gräfin Stockwenzel, lebende Bilder stellen. Daraus wird nichts. Vorher ziehe ich um.«
»Wie du befiehlst. Ich gehe sofort hinunter und spreche mit Herrn Ende.«
»Weißt du, das ist das Schlimme, daß er mich niemals schlecht behandelt hat. Wie kann er auch, der heitere Gemütsmensch. Er mißhandelt nicht einmal Mama. Was soll ich ihm vorwerfen, er spricht so gütig und nachsichtig mit ihr, wie man mit einem abgenutzten alten Haustier nur sprechen kann. Seit zwanzig Jahren tut sie alle Arbeit, aus Liebe zum jungen Ende, hat nur wenig körperliche Bedürfnisse und gar keine geistigen ... Mich aber verführt er durch Kameradschaftlichkeit.«
Sie fing wieder an das R zu rollen.
»Verführung ist die wahre Gewalt! – Ich habe Blut, mein Vater; so jugendliches, so warmes Blut, als eine ...«
Dann sagte sie erbittert:
»Er ist eigentlich liebenswürdig, der junge Ende. Wenn er mir nicht so grenzenlos zuwider wäre, wär er mir riesig sympathisch.«
»Nun, ich geh also, dich ihm abkaufen.«
»Du gefällst mir. Denkst du das so einfach abzumachen?«
»Ich rechne darauf, daß er mir auf den Weg hilft. Schließlich ist er der Erfahrenere – der Ältere ist er allerdings nie, der junge Ende.«
»Gehen wir«, entschied Ute. Aber sie besann sich:
»Nein. Erst noch einmal die letzte Szene. Während du bei Papa bist, muß ich mich umziehen, für den Besuch bei deiner Mutter.«
»Kind, es ist keine Haarnadel«, sagte Claude gefällig.
»So werde die Haarnadel zum Dolche! – Gleichviel!« schrie Ute und wand sich auf den Knien, vor Nathanael.
Claude sprach kühl und wohlerzogen:
»Was? Dahin war es gekommen? Nicht doch, nicht doch! Besinn dich. Auch du hast nur ein Leben zu verlieren.«
»Und nur eine Unschuld!«
»Die über alle Gewalt erhaben ist.«
»Aber nicht über alle Verführung ... Gewalt! Gewalt! Wer kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heißt, ist nichts! Verführung ist die wahre Gewalt! ... Ich habe Blut, mein Vater; so jugendliches, so warmes Blut, als eine. Auch meine Sinne sind Sinne. Ich stehe für nichts. Ich bin für nichts gut. Ich kenne das Haus der Grimaldi.« Ute brach ab.
»Ich kenne auch das Haus der Stockwenzel. Aber das muß ich schon sagen: wenn der junge Ende mich nicht zum Verrat meiner Kunst verführt – die andern verführen mich zu gar nichts. Herrschaft, wenn diese Kavaliere mit den dicken Schnauzbärten und den breiten Schultern mich in die Winkel drängen und mich streicheln wollen wie ein Pferd ... Ist das widerlich!«
Sie stand auf, sehr blaß.
»Nein, mit der Wärme meines Blutes ist es glücklicherweise eher faul.«
Auch Claude war erbleicht. Sie trat auf den Stiegenflur hinaus.
»Ich schließe dir auf«, sagte Ute. »Mama ist, glaub ich, auf Besorgungen, und den jungen Ende darf man durch Läuten nicht belästigen. Dann kriegt Mama am Abend keinen Kuß.«
»Denkst du an einen Bestimmten?« fragte Claude kalt und sah fest geradeaus.
»Woran? Ach, bei der Stockwenzel?«
»Du weißt, ich stehe jeden Augenblick zu deiner Verfügung.«
»O laß doch«, murmelte Ute. »Was gehn denn uns solche Leute an.«
Sie öffnete die Tür der Wohnung, gleich neben ihrer Dachkammer. Inzwischen zeigte sich auf der Treppe eine kleine Frau mit einem Korb Holz. Sie war in einem alten Paletot, der ihr nicht paßte. Graues Haar hing um ihr Gesicht, das voll staubiger, versteinerter Falten war, wie das eines Mörtelweibs. Ute knickte förmlich zusammen.
»Guten Tag, Mama, bitte, geh voran«, sagte sie, sichtlich angestrengt durch die eigene Sanftmut. Claude grüßte, die Frau verschwand. Ute flüsterte:
»Ich habe immer solche Angst, sie wie ein Dienstmädchen zu behandeln ... Das alles ist ja nicht länger haltbar. Raus!«
Sie blieb vor ihrem Schlafzimmer stehen.
»Hol mich nachher ab. Viel Vergnügen.«
Claude ging den Korridor zu Ende, schluckte hinunter und klopfte.
Der junge Ende hatte seinen Stuhl und seine Staffelei schon verlassen. Seine gepflegte Person lief auf Lackschuhen durch das öde Atelier mit zwei geöffneten Armen dem Gast entgegen.
»Mein lieber, lieber Freund! Herzlich willkommen! Gerade habe ich an Sie gedacht.«
»Zu welchem Zweck?« fragte Claude, leise und entschieden wie immer. Ende rief, und er schwenkte seine weiße, lange und volle Hand – Utes Hand:
»Zweck? Um einen freundlichen Gedanken zu haben. Uns selbst und andern immer zu freundlichen Gedanken verhelfen: Das ist die ganze Kunst!«
›Stimmt‹, dachte Claude. ›Davon lebst du.‹
Und des fröhlichen Rheinländers schlanke, leichtlebige Gestalt, seine gewinnenden Gebärden und sein blonder Lockenkopf, die Herzlichkeit seiner unverfänglichen, leeren Züge und seine sonnigen Augen – alles deuchte ihm über die Maßen minderwertig. Dennoch war dieser Springinsfeld von vierzig Jahren Utes Vater. Die frühe Ehe mußte ihn jung gelassen haben, und daß er für Arbeit, Sorgen, Menschenerkenntnis und Unterordnung immer die Form eines Vergnügens gefunden hatte.
»Die Sezessionisten in allen Künsten«, sagte der junge Ende, »wollen fortwährend Stimmung machen, und fortwährend versetzen sie einen in schlechte Stimmung. Da schauen Sie unser neues Theater an mit seinen dürftigen Linien und den großen, kalkweißen Flächen. Das soll schön sein? Wenn man den Vorhang ansieht, ahnt man schon all den Kummer, der einem nachher vorgespielt werden soll. Und es wäre so leicht, etwas Hübsches zu machen, so leicht!«
Er erfaßte Claude mit seiner warmen Hand und führte ihn vor das gleich fertige Gemälde.
»Ist es nicht schelmisch?« fragte er.
»Schelmisch ist das Wort«, sagte Claude.
Der junge Ende setzte dem venezianischen Blumenmädchen ein Glanzlicht auf den reinlichen Fingernagel.
»Im kommenden Frühling soll ich nämlich die Ehre haben, die Frau Gräfin Stockwenzel nach Venedig zu begleiten. Und da hab ich schon soviel Aufträge, können Sie denken. Es gibt ja gerade in den besten Kreisen soviel liebe Menschen, denen man eine wahre Freude bereitet, wenn man etwas Hübsches macht.«
»Und da machen Sie die Blumenmädchen schon im voraus?«
»Natürlich. In Venedig werde ich wohl keine Zeit haben.«
»Und ohne Modell?«
»Versteht sich ... Ich will Ihnen sagen, mein lieber Freund, ein venezianisches Blumenmädchen, wie der deutsche Liebhaber es wünscht und sich vorstellt, das hab ich im Kopf, dazu brauch ich weiter nichts. Und die deutschen Maler, die von Venedig Blumenmädchen herschicken, die wohnen auch nur dort, um durch die Echtheit des Herstellungsortes Eindruck zu machen. Die Blumenmädchen malen sie darum doch, wie sie in Deutschland verlangt werden.«
Claude suchte nach einem Übergang.
»Was werden Sie denn am Donnerstag bei der Gräfin Stockwenzel veranstalten?«
»Oh, ich bitte Sie, daran denke ich noch gar nicht. Vorerst bin ich am Montag zum Regenten befohlen, wegen der Auszeichnungen für die Literatur ... Jawohl, mein lieber Herr Claude, man hat hohen Orts die Bemerkung gemacht, daß München sein Gepräge als Kunststadt heute fast ebensosehr von den Schriftstellern erhält wie von den Malern. Es sollen Orden verteilt werden, Pensionen sogar, ganz als ob es Maler wären. Als Kommissionsmitglied bin auch ich von oben ernannt worden. Ich habe sogar den Vorzug, als Sprecher zu dienen.«
»Sie? ...«
»Wie Sie erstaunen! Bin ich so ganz ohne Verdienst? Glauben Sie nicht, daß ich mir viel beimesse. Aber ich habe das eine für mich, daß die Herrschaften mit mir reden können, ohne Satire oder geistigen Hochmut in mir zu fühlen. Mein Gott, dem sind sie bei Literaten ausgesetzt. Drum vertrete in allen Kreisen, die die Bildung nicht gern entbehren, sich aber ihretwegen keinen Unannehmlichkeiten aussetzen möchten, meistens ich die Literatur.«
»Es wird ihr ja gleich sein«, meinte Claude.
»Lieber Freund, es heißt ohne Arg sich schicken, bevor man es mit Bitterkeit tun muß ... Kommen Sie, setzen Sie sich ... Sagen Sie das doch meiner Ute, Sie haben so viel Einfluß auf das Mädchen.«
»Ich? Nicht den geringsten. Und Ute ist der gegenteiligen Ansicht.«
»Ich weiß. Leider. Sie will es sich verbitten, daß Ihre Exzellenz die Frau Gräfin Stockwenzel sie gutes Kind und du nennt ... Mich nennt die Gräfin einfach Ende, ohne Herr.«
»Und ›Ihr‹?«
»Hahaha. Und dabei weiß ich genau, wie gut sich Ute am Donnerstag unterhalten wird.«
»Sie weiß es auch und will sich der Möglichkeit, bei Stockwenzels glücklich zu sein, entziehen. Sie geht nicht mehr hin.«
»Wir haben ja schon zugesagt, mein Lieber.«
»Sie zieht vorher um ... Lassen Sie's gut sein, Herr Ende, Sie sehen doch ein, daß Ute einmal heraus muß.«
»Aber das ist etwas ganz Neues. Ihren Vater verlassen, noch bevor ihr Studium beendet ist.«
»Nächstes Jahr ist sie mündig.«
»Nächstes Jahr«, wiederholte der junge Ende geringschätzig, ohne Verständnis für so weite Zeiträume.
»Sie muß einmal Ernst machen«, bemerkte Claude.
»Womit?«
»Mit ihrer Kunst.«
»Ernst mit ihrer Kunst!«
Ende hob fassungslos beide Arme auf.
»Wenn sie nicht heiter ist, die Kunst, was hat sie dann für einen Zweck?«
»Das ist Sache der Künstler, Herr Ende.«
»Ah! Mich rechnen Sie nicht dazu? Sie werden noch anderer Meinung werden, Herr Marehn. Sie werden noch erkennen, wer von uns der richtige Künstler ist, und daß Ute sich selbst aufgibt, sobald sie mich aufgibt. Sagen Sie ihr das! Ich kann ja mit ihr nicht sprechen, sie behandelt mich von oben herab. Ich schäme mich nicht, Ihnen das zu gestehen, denn es ist nur der Irrtum eines jungen Mädchens. Es ist in ihr allerlei Krankhaftes. Ich glaube, sie sollte etwas für ihre Hygiene tun, und die Gedanken an ernste Kunst würden ihr vergehn.«
»Dann sollte sie lieber nichts dafür tun.«
»Sie hat, mit mir zusammen, vielen Personen Freude gemacht. Sie ist der Liebling einer hohen und reichen Gesellschaft gewesen. Sie ist verwöhnt, ihr Talent ist durch feinsinnige Anerkennung erwärmt, in einer Luft von Lebensfreude unter gefälligen Menschen aufgewachsen. Meinen Sie, es wird den Feinden draußen, den argwöhnischen Zuschauern, die an ihr Eintrittsgeld denken, standhalten? Wird sie aus den Balgereien mit Kolleginnen, Direktoren, Rezensenten, Nachstellern genug Illusionen retten?«
»Sie verzichtet auf Illusionen, sie will Wirklichkeitskunst«, sagte Claude stolz.
»Hat sie für eine so wütende Laufbahn genug Temperament? Sie ist kalt. Sie, Herr Marehn, müssen das bemerkt haben.«
›Der Hund greift mich an‹, dachte Claude.
»Sie erreicht alles, was sie will«, äußerte er. »Denn sie weiß genau, was sie kann. Das werden Sie, Herr Ende, zuerst merken. Denn Ute zieht von Ihnen fort, ohne sich vor den Folgen zu fürchten. Was können Sie tun, Sie werden doch keinen Lärm schlagen.«
Ende wehrte ab; er dachte an Wichtigeres.
»Wem soll ich am Donnerstag ihre Rolle geben? Wie rücksichtlos ist das Mädchen, sie stört uns alle.«
»Vor allem werden Sie selbst, Herr Ende, dadurch geschädigt, daß Sie sich nun in den Salons nicht mehr Ihrer Tochter bedienen können. Das sieht auch Ute ein. Ich komme eben, um die Vergütung des Schadens mit Ihnen zu besprechen.«
Der junge Ende stand auf, erhaben vor Schmerz.
»Sie erschüttern mich! Sie glauben, mir mein Kind abkaufen zu können ...«
Er drehte den Kopf auf dem Rande seines hohen Halskragens angstvoll hin und her, glättete mit einer Handbewegung ein empörtes Meer und setzte sich wieder.
»Ich will Ihnen nicht zürnen. Ich würde durch meine Unversöhnlichkeit Ihrer Menschenfeindlichkeit recht geben. Sie sollen an Güte glauben. Oh, diese jungen Leute, die sich aus Stolz vornehmen, die Welt recht schwarz zu finden, wohin gelangen sie! Sie sollen es nicht mehr für möglich halten, Herr Marehn, daß ein Vater sich seine Tochter bezahlen läßt – und dadurch sollen Sie selber glücklicher werden.«
»Sehr angenehm«, sagte Claude.
»Sie lieben Ute als Jugendfreund. Sie haben das redlichste, trauteste und reinste Verhältnis zu ihr ... Warum sehen Sie mich so kalt und zornig an ... Meinen Sie aber nicht, daß andere das Mädchen anders lieben und daß ich schon oft Gelegenheit gehabt hätte, mir eine abscheuliche Hilfeleistung bezahlen zu lassen. Oh, ich vergesse solche Vorkommnisse. So etwas muß man rasch vergessen. Ich zweifle am Ende sogar, ob es wirklich geschehen ist. Der Mensch kann nicht schlecht sein, lieber Herr Marehn. Denn wenn ich selbst ernstlich in mir nachfrage: ich finde mich ganz unfähig zu der Schurkerei, die Sie heute bei mir vorausgesetzt haben.«
Er sah klar und frei in Claudes Augen, die sich halb schlossen. Claude dachte: ›Dazu sind Sie allerdings zu minderwertig. Hätten Sie mir nach dem ersten Wort einen Preis gestellt, Sie würden mir Achtung eingeflößt haben. Zu wissen, daß man ein Schurke ist, und sich gut zu heißen, das hat etwas für sich. Sie wissen nichts. Sie tun alles, damit Ihre Tochter einmal das Brot eines Liebhabers essen muß und daß Sie mitessen können; aber Sie werden, auch wenn's soweit ist, nie erfahren, daß Sie das waren. Ihre Tochter verkaufen – niemals. Sie verkaufen nur gefälschte Venezianerinnen: zu höheren Schurkereien versteigen Sie sich nicht.‹
»Sie laden sich eine schwere Verantwortung auf, Herr Marehn«, sagte Ende sanft und eindringlich.
»Ich?«
»Denken Sie gar nicht daran, daß ohne Ihr Geld Ute zu dem allem außerstande wäre?«
Merkwürdig, nein, daran hatte Claude nie gedacht. Der Wille in dem allem war doch Ute.
»Diese jungen Leute halten ihre Freiheit für grenzenlos, sie meinen, niemand achtet auf sie. Neulich hat die Frau Gräfin Stockwenzel von Ihnen gesprochen.«
»Von mir?«
»Das wundert Sie. Die Frau Gräfin hat doch mit Ihrem Papa geschäftlich zu tun. Sie sind ihr nicht unbekannt. Da können Sie denken, was die Gerüchte, die über Sie und Ute umgehen, auf Ihre Exzellenz für einen Eindruck machen.«
»Daß ich mit ihr ein Verhältnis habe? Die Menschen sind zu gut, so etwas glauben sie nicht.«
»Mein Lieber, Sie schädigen Ute«, sagte der Vater leise und feierlich.
»Es ist ihr gleich, Herr Ende. Ich habe mich nicht mit ihr zeigen wollen. Aber sie zeigt sich mit mir.«
»Das Mädchen sucht etwas darin, es ist schrecklich. Aber Sie selbst, lieber Herr Marehn, auch Sie haben einen Ruf zu verlieren. Sie sollten die gute Gesellschaft nicht herausfordern, indem Sie ihr ein junges Mädchen abspenstig machen, das sie so gütig war aufzunehmen. Früher oder später werden Sie die gute Gesellschaft nötig haben. Dann wird man Sie auch fühlen lassen, daß Frau Gisela Gigereit – um nur diese zu nennen – zwar jedermann bekannt ist, daß man ihr aber im Theater kein Bier kauft. Ich habe Ihnen keinen Rat zu geben ...«
»Allerdings nein«, sagte Claude bestimmt.
Der junge Ende schien, verzweifelnd, irgend etwas über die Achsel zu werfen.
»Und schließlich – ich bin ein Mensch – Sie tun auch mir sehr unrecht. Wird die Gräfin Stockwenzel, nachdem meine Tochter sich von Ihnen eine Wohnung hat einrichten lassen, mich, den Vater, noch nach Venedig mitnehmen?
Sehen Sie!«
Claude beschloß heftig zu werden.
»Wollen Sie mich nun zu Wort kommen lassen! Sie können doch nicht von mir verlangen, daß ich Ihnen Geldverluste beibringe und einfach meiner Wege gehe. Ich habe niemals die Absicht gehabt, Ihnen Ihre Tochter abzukaufen, Sie sind übertrieben kitzlig. Ich will Ihnen einfach ersetzen, was meine Handlungsweise Sie kostet ... Lassen Sie mich ausreden! Wieviel ich Ihnen geben kann, weiß ich heute noch nicht. Mein Vater ist erst seit drei Stunden tot ...«
»Was denn? Was sagen Sie? Aber Herr Claude! Mein armer, lieber Claude! Und die ganze Zeit haben Sie den Hut vor Ihren Krepp gehalten. Soll ich denn Ihren Schmerz nicht teilen?«
Claudes Gesicht sagte: ›Nein, lieber nicht.‹
»Solch enges, rührendes Verhältnis, wie es Sie mit Ihrem Vater verband! Und nun auf einmal alles – Sie sehen mich wahrhaft ergriffen!«
Claude sah es, ohne daß er zweifeln konnte.
»Oh, es ist furchtbar, solch einen Menschen zu verlieren, wie man ihn nur einmal verliert. Aber ein Trost ist es doch, daß uns das nur einmal zustoßen kann! Mein lieber, lieber Herr Claude. Nur immer das Gute im Leben suchen! Es ist immer da.«
›Wie der Knochen zuunterst im Straßenkehricht. Ein unentwegter Hund findet ihn‹, dachte Claude. Er machte sich los von des jungen Ende warmer Hand, zog seine Brieftasche und legte den Tausendmarkschein hin. Ende sah ihn gar nicht.
»Welch schwere Zeit, bei Ihrer Jugend.«
›Allerdings‹, meinte Claude für sich. ›Ich hätte ja Utes Wohnung davon zahlen sollen. Aber komm ich denn anders fort von Ihnen?‹
»Später mehr«, erklärte er mit zusammengezogenen Brauen.
»Und wie wird Ihre Frau Mutter das tragen!«
Claude ging rasch und steif hinaus, die Schulterblätter zurückgedrängt. Im Korridor mußte er über Frau Endes Füße wegsteigen; sie lag und scheuerte. Es roch in der Wohnung arm und nach Scheuerlappen. Er öffnete eine Tür: das Zimmer war mit gelbem Kretonne ausgeschlagen und duftete gut; nur daß die Fenster schon zu lange geschlossen waren. Am Bett und über Stuhllehnen hingen ein halbes Dutzend Röcke, Unterröcke und Blusen. Auf der Kommode lag Wäsche, darüber zwei Leihbibliotheksbände und ganz oben ein halbes Butterbrot. Lanolintöpfe waren überall verteilt. Am Boden trieb sich ein rosaseidenes Kissen umher, neben einem Irrigator und drei alten Handschuhen. Dazwischen, über die Schulter dem Spiegel zugewendet, stand Ute, in einem halblangen Paletot, einem dunkeln, wundervoll fallenden. Sie war neu frisiert und trug einen Riesenhut wie Bella. Sie erblickte Claude im Spiegel und fragte:
»Nun, was hab ich gekostet?«
II. Das Loch im Frack
Sie gingen die Leopoldstraße zu Ende. Claude stellte fest, daß er mit dem Zylinder doch noch etwas höher sei als Utes Haar. Man starrte sie an. Er dachte daran, daß man sie für seine Geliebte hielt, und schämte sich seiner Genugtuung. Er sagte plötzlich:
»Der junge Ende hat auch verraten, daß man zwischen dir und mir was vermutet. Ich habe geantwortet, du machst dir nichts daraus.«
»Ganz recht.«
»Es ist mir doch unlieb, daß ich dich kompromittieren muß. Ich habe dich dafür zu lieb. So viel ist sicher, daß deine eigene Wohnung die Sache bedeutend verschlimmern wird.«
»Was heißt verschlimmern. Es gehört zu meinem Beruf als Schauspielerin, daß man mir ewig Verhältnisse zutrauen wird – bis in mein hohes Alter. Ob ich sie habe oder nicht – glauben tut man's doch. Mir genügt's, daß ich keine habe.«
»Du bist stark, ich bewundere dich, daß du dich über alles hinwegsetzen kannst. Aber ist es so wünschenswert, es tun zu müssen?«
Er verwirrte sich.
»Ich will ja nichts sagen, du bist berufen; du gehörst der Kunst. Ich habe keinen Anspruch auf dich, wie könntest du meine Frau sein. Ich komme mir so klein vor, wenn ich dich spielen sehe!«
»Armer Claude«, sagte sie etwas künstlich, viel zu stark mit sich selbst beschäftigt, um ihn deutlich zu hören, wenn er von sich sprach.
»Du bist verliebt. Das gibt sich.«
Claude murmelte starr, mit einem tiefen Zittern:
»Nie.«
Ute hielt sich dabei nicht auf.
»Mich über alles hinwegsetzen zu müssen, was das Volk glaubt und versteht, das ist ja mein Stolz. Allein zu sein: im Leben und auf der Bühne, immer einem weihelosen und gebannten Theatersaal gegenüber, immer allein als geschulte, bewußte Persönlichkeit vor einem dumpfen Haufen, immer durch kundige Mittel schön, geschickt, beredt und allen überlegen zu sein, die klatschen.«
»Und niemals bei einem einzigen fühlen, was alles du ihm bist – daß du ihm alles bist. Und ihn lieben, meinetwegen bloß, weil du ihm alles bist. Das niemals?«
»Dazu fühle ich mich nicht veranlagt.«
»Ich nur dafür – dich zu lieben.«
»Sei nicht so schwach.«
»Könntest du nicht doch – oh, nicht mich heiraten, davon spreche ich nicht mehr, ich lasse dich der Kunst. Aber dich von mir lieben lassen, mir erlauben – du weißt, ich habe immer nur dich geliebt ...«
»Immer nur! Du bist zwanzig. Weißt du denn, was noch kommt.«
»Nichts. Ich werde immer nur dich lieben. Glaub es, glaub es. Und das wird in meinem Leben das einzige sein, was zählt. Das einzige, wofür ich da bin.«
Er äußerte seine Leidenschaft vollkommen höflich und sah dabei den Vorübergehenden ins Gesicht. Ute empfand, daß mit diesem Ton auf der Bühne nichts zu machen gewesen wäre. Sie sagte:
»Hör auf. Du langweilst mich.«
»Ich wollte dich noch einmal bitten, ob du mich nicht lieben willst. Zu Hause fehlt mir schon der Mut, ich bitte dich auf der Straße ...«
Da sie nicht antwortete, fügte er hinzu:
»Wie ein Bettler um ein Geldstück.«
Das gefiel ihr; sie sagte ein wenig wärmer:
»Ich hab dich ja gerne, was willst du mehr.«
Sie betrachtete ihn von der Seite, mit gleichgültigem Wohlwollen. ›Gott sei Dank hat er fast keinen Bart, ist von sanften Sitten, und ich kann mit ihm machen, was ich will.‹
»Oh, was ich mehr will«, sagte er.
»Du stehst mir doch immer am nächsten.«
»Aber so fern.«
»Genug, bitte, du willst hoffentlich nicht für die Wohnung deinen Lohn haben.«
»O Ute!«
Claude war heftig erschrocken. Er atmete mehrmals stark, bezwang sich.
»Das war mal häßlich.«
»Ach, verzeih«, sagte sie, »ich bin nervös.«
Bis zum Odeonsplatz sprachen sie nicht. Dort lachte Ute vor sich hin.
»Weißt du, von wem du noch am meisten zu fürchten hast? Von Archibald. Der könnte mir gefährlich werden.«
»Du machst Witze?«
»Gar nicht. Ihr seid mir alle zu korrekt ... Oh, Archibald kann das auch sein, sobald er will. Bitte: Geheimer Hofrat Professor von Archibald, Ehrenmitglied der Königlichen Hofbühne, Direktor der K. B. Akademie für dramatische Kunst, Ritter hoher Orden, Günstling und Freund des Regenten – wer bringt's denn überhaupt so weit. Und wenn man zusieht, was steckt drin? Ein alter Mime ... Er sollte noch mehr abgetakelt sein. Ein sehr alter Mime, von Schminke und Schreien ganz rauh und heiser geworden, das wäre, glaube ich, meine Schwäche.«
Claude biß die Zähne aufeinander.
»Ich kann doch nicht eifersüchtig sein auf Archibald; mir scheint, das würde uns beide erniedrigen, mich und dich.«
»Warum?«
»Stell dir eine tief empfindende Frau vor, die bemerken muß, daß sie die Mitbewerberin einer Dirne ist ... Übrigens spielst du bloß mit einer Verderbtheit, von der du nichts fühlst.«
»Wer weiß ... Was mich so reizt, das ist, wenn der alte Mime aus einem Loch im Staatsfrack des Geheimrats herausgrinst.«
»Wieso. Was meinst du.«
»Pst. Nachher«, machte Ute.
Sie waren angelangt. Der Diener in bayrisch Blau führte sie die breite Treppe hinauf.
»Der Herr Geheimrat sind in seiner Privatwohnung und erwarten das gnädige Fräulein.«
Claude nahm ihr den Paletot ab. Sie waren kaum im Arbeitszimmer des Direktors, eine wilde Wirrnis auf seinem Schreibtisch spielte ihnen Nächte voll genialen Fiebers vor, da krachte das Parkett unter leichten, sieghaften Schritten.
Archibald kam auf Schnallenschuhen, sah niemand an, dachte an nichts als an seine Wirkung, lehnte sich gegen den Schreibtisch, kreuzte die Beine in ihren seidenen Strümpfen, die Arme über der Brust voll gestickter Palmen neben sonnenähnlichen Ordenssternen, und zog den Hals ein. Der Kopf, von dem gefärbten Rest eines schwarzen Schopfes spitz beleckt, saß dick auf der rundlichen Gestalt, mit dem kühnen Magen. Archibald ließ einen fettigen Glanz von Marmor seine aufgeblasenen Wangen bestreichen und über seinen edlen Nasenrücken spiegeln und befahl seinen Augen zu blitzen. Sein Mund, blau vom Messer und gewulstet, bebte, bevor er sprach, wie ein Rennpferd, ehe man es losläßt. Er sagte mit sehr hoher, metallischer Stimme, ebenso leicht und sieghaft wie sein Schritt:
»Kind, es ist keine Haarnadel.«
»So werde die Haarnadel zum Dolche!« schrie Ute und wälzte sich.
Aber Archibald machte eine jähe Bewegung gegen Claude; er bemerkte ihn. Und er kam geneigten, zärtlichen Hauptes auf den jungen Mann zu, der dunkel vor einem dunkeln Teppich stand.
»Süßester Freund, wär's möglich, Sie – Sie erblickt ich? Sie, den ein Schicksal eben erst traf, ein unnennbares? Soll ich es denn glauben, was die Leute sagen: Ihr Vater – – aber nein, nein –«
Archibald, den Oberkörper abgewandt, streckte die gespreizte Hand aus.
»Ich will's nicht glauben! Süßester Freund, es wäre zu schwer, ich trüge es nicht. Weiß der Himmel, ich überlebte es nicht!«
Er verschwand rasch hinter einem Vorhang und kam sogleich, weiß im Gesicht, wieder zurück. Die Hände ganz oben in der Luft gerungen, rief er:
»Ich überlebe es nicht!«
Geschüttelt von Schluchzen, den klagenden Blick an der Decke, wankte er zweimal durch das Zimmer. Schließlich nahm er Claudes Hand; sich fassend, noch mit etwas Feuchtigkeit in der Stimme, begann er seinen Monolog.
»Ich denke an diesen Mann. Er war einer von denen, die niemand vergißt, der sie gekannt hat. Warum? Weil sie stark sind und von ihrer Rolle überzeugt wie ein großer Schauspieler. So war Ihr Vater, Herr Marehn. Ich hatte mit ihm zu tun, als wir dieses Haus bauten. Dieses Haus, das der Stolz meines Lebens ist, diese Pflanzstätte hehrer Kunst, die der Nachwelt zu schenken mir beschieden war, ich habe sie immerhin mit seiner Hilfe errichtet.«
Claude bewunderte das »immerhin«.
»Hat er mir zu schaffen gemacht, dieser Mann!«
Archibald ließ Claudes Hand los, er machte, die Stirn gesenkt, die Hände auf dem Rücken, zwei nachdenkliche Schritte.
Claude wußte Bescheid; bei dem Geschäft mit Archibald war sein Vater der Hereingefallene gewesen. Ihm hatte das Grundstück gehört. Er hatte es unternommen, das Konservatorium für dramatische Kunst darauf zu errichten, eine private Anstalt, die Archibald pachten wollte. Das Baukapital hatte Marehn aufnehmen müssen. Es hatte nicht ausgereicht; und Archibald, der hinter dem Gläubiger versteckt gewesen war, hatte den fertigen Bau eingesteigert, um ihn mit gutem Nutzen dem Staat zu verkaufen. Darauf war er Direktor des königlichen Instituts und Geheimrat geworden.
»Soll ich Ihnen sagen«, fragte Archibald, »mit wem ich ihn verglich, diesen stillen, bleichen und mächtigen Mann in der Dämmerung seines Kabinetts? Diesen denkenden Punkt, der, immer unbeweglich, Geschäfte von unerhörter Weite ausstrahlte und beherrschte? Der nie die Sonne breit auf einer Straße liegen sah, und in dessen Namen weite Ländereien sich mit Wohnungen bedeckten, Prachtbauten erstanden, und Städte, bis in entlegene Winkel Europas, ihr Bild veränderten? Ich verglich ihn mit König Philipp!« erklärte Archibald und beschrieb eine Gebärde, langsam und stählern.
»Sie übertreiben«, sagte Claude, aber ohne Anspruch auf Beachtung.
»König Philipp im Eskorial, während seiner letzten Lebensjahre, als er im Dunkel einer Gruftkapelle, angesichts seines Sarges, und vor den leeren Blicken eines Schädels, die Geschicke der Welt lenkte. Sage ich zuviel? Konnte nicht auch Ihr Vater, in dem totenhaften Schweigen seiner Zelle, ›am Abend jedes Tages berechnen, wie die Herzen seiner Völker in seinen fernsten Himmelsstrichen schlugen‹? Hieß nicht auch er, was unsere Finanzleute angeht, ›der reichste Mann in der getauften Welt‹? ... Er war nicht nur ein reicher Mann: er war ein Mann – nehmt alles nur in allem.«
Und Archibald drückte nochmals die Hand des Sohnes. Er schlüpfte hinter einen Vorhang, kehrte abgeschminkt wieder. Dann sagte er leichter, mit einer Stimme, in der die umwickelten Paukenschläge eines Trauermarsches nur schwach noch rollten:
»Es ist gut, daß Sie da sind, wir brauchen Sie. Haben Sie ein Auge auf Ihre schöne Freundin! Wir sind jetzt soweit, seit gestern schaut was heraus.«
›Seit gestern?‹ wollte Claude fragen, aber Archibald hatte ihn mit einem Händedruck auf das Sofa gesetzt und stand bei Ute. Sie hatte die Leistung ihres Meisters mit großen Augen lebhaft nachgefühlt. Ob Archibald sein Beileid aussprach oder einen Witz riß, er war immer im Theater, und Ute arbeitete mit ihm.
»Mein Fräulein, ich gehöre Ihnen!« rief er, ausbrechend in laute Fanfaren. »Lassen Sie sich nicht einschüchtern durch mein Kleid. Mein königlicher Herr hat mich zu seinem Fest befohlen. Und keine Minute Ihrer Stunde, mein Fräulein, habe ich an meine Toilette verlieren wollen. Ich bin der redlichste Mann, wie, Herr Marehn? Auch Ihr Vater wußte das. Ich stehle Ihnen keine Ihrer kostbaren Minuten.«
›Das Stück kostet dreiundachtzigeindrittel Pfennig‹, berechnete Claude, während Ute spielte.
Archibald nickte, gab eine metallene Replik, blitzte zu Claude hinüber. Ihm lag am Beifall dieses Knaben, ihm, der keinem Menschen mehr den Hof machte, wenn er nicht königlicher Prinz oder Redakteur war. Er hatte so viel Macht erspielt, daß er keinen Mächtigen mehr achtete: alle waren schlechtere Komödianten als er. Kein Staatsmann hatte seinen Schritt, kein Reicher seine Faust, kein Feldherr sein Auge. Sie waren seelenlos und ohne Formen in ihre Funktionen hineingestiegen. Archibald atmete und prangte in der seinigen. Und ein Befremden überraschte ihn nur noch vor diesem strengen Träumer, dessen Schüchternheit ihn wie Drohung anmutete, der schlicht und steif aus seinem gemieteten Coupé stieg vor der Tür zu einer Arbeiterversammlung, der ohne Raschheiten und Eitelkeiten an der Seite sehr schöner Frauen ging, eine junge Schauspielerin beschützte, auf seinem zwanzigjährigen Kopf den Zylinder lüftete und im Spekulanten-Königreich seines Vaters die Erbfolge antrat. Überall, wo sie sich nebeneinander zeigten, würde Archibald der Vorzug werden: dessen war er gewiß. Und doch witterte er, dieser stille Kleine habe eine Rolle, so schön wie seine glänzendste.
Er mußte Ute auffangen, die hauchte:
»Lassen Sie mich sie küssen, diese väterliche Hand.«
»Glauben Sie's, Herr Marehn? Ihre Freundin hat doch Temperament!«
»Ich habe nie daran gezweifelt«, sagte Claude.
»Aber ich!«
Archibald schmetterte durch die Nase. Seine Brauen bogen sich hoch, herausfordernd. Claude verstummte; Ute drängte:
»Also was nun, Herr Geheimrat.«
»Geduld, mein Fräulein! Was habe ich Ihnen gesagt, Herr Marehn: ich werde vielleicht das Talent Ihrer Freundin wecken – vielleicht! Sie ahnte es erst in sich. Es war noch nichts zu spüren, ich stand noch für nichts ein, ich war noch für nichts gut. Jetzt habe ich's gemerkt, das Talent dieser Künstlerin. Von heute ab, mein Fräulein, sind Sie Künstlerin!«
Er ging hinter den Schreibtisch zu den Kränzen, pflückte, auf den Fußspitzen, ein Lorbeerblatt und brachte es Ute. Dann setzte er wieder ein, eine Skala höher als der vorige Schlußton.
»Oh! mein Herr! wenn Sie wüßten, wenn Sie beurteilen könnten, mit welcher Liebe, mit welcher Kennerschaft solch ein Talent freigemacht, zum Bewußtsein seiner selbst gebracht werden will!«
»Ich kann mir's denken«, erklärte Claude.
»Was der sich denken kann«, murmelte Archibald und grinste Ute an. Claude sah nur seinen feierlichen Rücken.
»Wenn er sich denken könnte, was wir gestern für 'ne diebische kleine Szene zusammen gespielt haben – auf dem Sofa, wo er sitzt.«
»Jaja«, machte Ute, jäh angewidert.
»Sie haben die feine Rolle gehabt, haben mich hineingelegt, kleiner Schäker. Aber passen Sie auf, wir begegnen uns doch noch mal im Dunkeln.«
Sie sah ihn vertauscht, den Geheimrat abgesetzt, den Professor vom Katheder gefallen. Der kunstvoll hergerichtete, auf Amtlichkeit und Einschüchterung gearbeitete Kopf war vom Hals heruntergeklappt wie eine Maske aus Pappe. Und der wirkliche Archibald, der durch Stellungen, Titel, Ehrerweisungen ewig unberührbare Duzfreund jedes umherstreichenden Artisten, streckte seine geduckte Fratze aus einem Loch im starren Frack des andern. Ute erschrak auch diesmal, so gut sie ihn schon kannte, den tieferen Archibald. Dann überlegte sie, daß diese Harmonika gelber abgeschminkter Falten, im Schatten einer Kulisse zu einem gemeinen Witze feixend, am Ende noch Exzellenz heißen werde. Und Stolz packte sie. ›Das ist die Kunst. Und ich werde es gerade soweit bringen – durch die Kunst, nur durch die Kunst. Man soll sehen, was die für eine Macht ist!‹
Archibald, zurückverwandelt, verlangte:
»Nun, mein Fräulein, die Szene im Ganzen.«
Ute spielte, hingerissen von Ehrgeiz und von Siegesgewißheit. Archibald unterstützte sie anfangs nur. Allmählich vergaß er sie, begann selber zu wachsen, griff aus, sang, läutete Glocken, gab sich ganz – wie er's nur einmal jährlich, zur Fremdenzeit, tat.
Beim Abschied sagte er:
»Erlauben Sie, daß ich dieser Schülerin selbst den Hals einwickele? ... Ich danke Ihnen.«
Mit Bühnengeflüster, dreißig Meter weit hörbar, sagte er zu Claude:
»Ich warne Sie, mein Lieber, ich warne Sie.«
»Kein Grund«, meinte Claude kühl.
»Doch!«
Archibald rollte einen fürchterlichen Blick nach Ute hin.
»Ich bin auch nur ein Mensch!«
Er drehte sich jäh um und ging fort. Der Diener riß vor ihm eine Tür auf.
Draußen hielt Claudes Wagen.
»Diesen Monat hast du ihn also wieder?« fragte Ute, wie sie abfuhren.
»Dummerweise«, sagte er, die Stirn in Falten.
»Du wirst schon wieder Geld kriegen. Ich verlaß mich ganz auf dich, weißt. Du bist mir als Freund ganz genug, Archibald hat nicht die geringste Aussicht.«
»So.«
»Du bist eifersüchtig, weil ich mich für den alten Mimen begeistert habe?«
»Mir scheint, er prahlt mit dir. Oder wenigstens droht er mir?«
Sie verzog den Mund.
»Hast du nicht gemerkt, daß er mir heimlich was sagte? Er drehte dir den Rücken, inzwischen konnte ich wieder das Loch in seinem Frack sehen.«
»Versteh ich nicht.«
»Ach was, ich werde doch mit dem da kein Geheimnis vor dir haben. Wozu denn. Wenn ich's noch nötig hätte, dich eifersüchtig zu machen, armer Kerl. Zu meinem Vergnügen tue ich's aber nicht. Also er ist gestern bei mir abgefallen.«
»Gestern? Er hat dir einen Antrag gestellt?«
»Antrag sieht dir ähnlich. Er hat mich haben wollen.«
Claude fuhr auf.
»Und bei dem waren wir eben? Dem hab ich die Hand gegeben?«
»War sie nicht gewaschen? ... Daß er seine Schülerinnen fast alle verführt, wußten wir vorher, wie? Darum ist er doch immer der Meister. Was du eben wohl wolltest.«
Claude war beschämt.
»Ach ja: das alte Zeremoniell in unserm Blut, bei uns Männern. Geschlechtsmoral. Ritterlichkeit. Glauben, wenn wir überrascht werden, immer noch, wir müßten vom Leder ziehen, ihr könntet nicht allein fertig werden.«
»Ich hab mich wundervoll herausgespielt. Archibald ist himmlisch. Die Verführungsszene, das war die beste Stunde, die er mir überhaupt gegeben hat. Ich habe riesig dabei gelernt.«
»Jaja. Aber wie kamst du gestern zu ihm. Es war ja nicht der Tag.«
»Hör zu. Vorgestern abend – ich spiele gerade, ich spiele so, wie ich bloß für Nathanael spiele, und wie ich erst wieder spielen werde, wenn ich das Apokalyptische Tier, das Publikum, im Dunkeln schnaufen fühle – da kommt Mama hinauf zu mir, mit einem Brief von Archibald an sie. Unglaublich, aber wahr, an sie. Es stand drin, er habe nach ernstlicher Prüfung doch zu wenig Temperament bei mir gefunden. Um dich und mich nicht zu schädigen, als ehrlicher Mann müsse er meine Mutter wissen lassen, daß er nicht mehr hoffe, eine gute Schauspielerin aus mir machen zu können.
»Ich hab mich furchtbar zusammengenommen, hab Mama heilig schwören lassen, daß sie dem jungen Ende nichts sagen würde, und hab sie hinausgeschoben; sie benahm sich schrecklich blöde. Dann bin ich aber in Tränen ausgebrochen, kann ich dir sagen. Und die Nacht war ich nicht im Bett. Über zwei Stühlen hab ich gelegen und geheult, geheult. Und was ich dem Nathanael alles gesagt habe, das ahnt keiner.«
Sie sah ihm plötzlich voll in die Augen.
»Wenn es nicht doch noch gut gegangen wäre, weißt du, dann säße ich nicht hier. Dann hätte ich das Schloß geschlossen am gutgeheizten Ofen und wäre eingeschlafen.«
Er wollte rufen: ›Ohne mir ein Wort zu sagen, ohne alles!‹ Aber er blieb reglos in seinem Winkel und hörte zu.
»Gestern früh geh ich also zu ihm. Er war in seinem Amtszimmer, es warteten eine Menge Leute, aber er kam gleich herüber. Er sagt mir ganz bieder, viel Temperament habe ich wirklich nicht, aber er könne was aus mir machen, sogar wenn ich gar keins hätte. Soviel traue er seinem Einfluß zu. Ich müsse ihn bloß belohnen. Und dann wurde er wie ein alter Clown. Ich frage bloß: ›Und wenn ich's nicht tue?‹ Er zuckt die Achseln. ›Das würde meine Ansicht bestätigen, daß Ihr Temperament nicht zureicht.‹ Dann fängt er wieder an.«
Claude ward von einer Frage gequält.
»Wo war das?«
»Auf dem Sofa, wo du heute gesessen hast. Mir ward schrecklich übel. Aber ich versicherte ihm, ich habe viel mehr Temperament, als er glaube. Er schüttelt den Kopf. ›Wie hab ich Ihnen bisher mein Temperament zeigen können‹, ruf ich. ›Einem Herrn, der wie jeder andere zu mir »Guten Tag, Fräulein« sagt.‹ Er werde künftig was ganz anderes sagen, meint er.
Ich frage: ›Und dann wollen Sie mir Engagements verschaffen, nur weil ich Ihre Geliebte bin? ... Nein, ich werde das niemals annehmen. Die Kunst steht mir zu hoch. Habe ich nicht die Fähigkeiten einer wahren Künstlerin, habe ich doch ihren Stolz. Und auch ihren Willen!‹ rufe ich und mache mich los. Es war Zeit. Ich hatte einen gräßlichen Schreck bekommen.
Er richtete sich auf, ganz rot; trotz seines abscheulichen Zustandes hatte er gestutzt. ›Das ist der erste Anlauf zu was Ordentlichem‹, sagt er. ›Schade.‹
›Schade? Nun können Sie mich ja mit gutem Gewissen unterstützen. Sie sehen, was ich bin.‹
›Schade. Da Sie ja nicht wollen.‹
›Das bringen Sie fertig?‹ sage ich kalt vor Entsetzen – und etwas davon fühlte ich –, ›Sie bringen es fertig, ein Talent zu morden, weil eine Frau Ihnen nicht zu Willen ist?‹
›Sie haben ja ohnedies einen Liebhaber, was macht's Ihnen‹, meint er. Und ich, aufspringend, ausbrechend:
›Sie? Sie sind der Schurke, der das sagt? Sie, der Alternde, wollen einem uneigennützigen Knaben die Freundin stehlen? Sie wollen meine Kunst zerbrechen, die ich demütig in Ihre Hände gelegt hatte? Weil ich Ihnen widerstehe, wollen Sie mich und mein Können, von dem Sie überzeugt sind, von dem ich Sie in diesem Augenblick überzeuge, wegwerfen, verraten, unmöglich machen?!‹
Hier schluchzte ich. Zum erstenmal gelang mir ein ganz richtiges Schluchzen. Dann schrie ich weiter:
›So etwas gibt es? Das kommt nicht nur in schlechten Stücken vor? Wie können Sie die Augen erheben. Sie, ein Künstler, vor der Künstlerin, die Sie verderben wollen? Die Orden, die Sie durch Kunst erwarben, sie müssen Ihnen doch die Brust versengen!‹
Er trug gar keine, aber das bemerkte ich erst später. Oh, es kam alles auf einmal zutage, was ich langsam in mir geschaffen, erarbeitet hatte, ganz allein, in meiner Bude. Alles, alles ...«
»Ich weiß«, sagte Claude leise.
»Auf einmal wußte auch Archibald alles. Er stand, als ich schon fertig war, noch eine ganze Minute starr da. Dann sagte er: ›Donnerwetter. Nein, das geht doch nicht. Sie muß ich behalten.‹
Ich erholte mich erst allmählich. Du, in meinem Leben hab ich noch keine solche Freude gehabt. Mein erster Triumph! Er wollte nicht mehr das beliebige Fräulein, das ihn besuchte. Er bekundete Achtung vor einer, namens Ute Ende!
›Ist das sicher?‹ fragte ich wieder im ganz gewöhnlichen Ton. ›Wollen Sie nie wieder solche Ansprüche stellen?‹
›Oh, nie ist zuviel gesagt‹, meinte er. Er behalte sich alle Rechte vor ... Na, lassen wir ihn dabei.«
»Jawohl«, sagte Claude.
Sie kamen an.
»Übrigens beglückwünsche ich dich, du bist fein durchgekommen.«
»Das hat er ja auch gesagt. Ich schiene das Talent zu haben, viel zu erreichen und nichts dafür zu geben. Das könne mir noch sehr viel nützen. Ich glaub's. Ich werd alles, was ich will. Und geben will ich nichts. Ich kann auch nichts geben. Dafür hab ich eben die Kunst. Das muß den Leuten genügen.«
Claude schloß die Lippen ganz fest und half ihr aussteigen, gesetzt und beflissen.
III. Einer, der das könnte
Wie sie durch das Rauchzimmer gingen, saßen an dem grün bedeckten Tisch vor großen Papieren der alte Panier und von Eisenmann. Panier holte beim Anblick eines weiblichen Wesens seine Gichtbeine unter dem grünen Teppich heraus und stützte sich empor. Auf seiner gekrümmten Hand war ein dicker Knoten. Er stand endlich aufgerichtet, kurz, beleibt, ohne Hals, wüste violette Röte über dem gewellten weißen Bart, funkelnde Brillen unter schwarzen struppigen Brauen und ehrsames Greisenhaar auf der Stirn voll heftiger dummer Laster. Er wartete schmunzelnd, ob man ihn vorstellte:
»Panier«, sagte er schließlich selbst mit einem Kratzfuß.
Ute wollte weiter, aber er rief:
»Herrjeses, das is ja woll – Sind Sie nicht Fräulein Ende? ... Is die auch schon 'ne Dame! Nöh, nu dürfen Sie man nich gleich weglaufen. Wir müssen Sie uns doch erst 'n bischen besehn. Was machen Sie denn, Fräulein Ute, Sie sollen ja jetzt beim Theater sein – oder Sie lernen dafür.«
»Ja, ich lerne dafür«, sagte Ute, und all ihr Fleisch war in Angst. Die gefräßigen schwarzen Augen des Alten zogen ihr die Röcke stramm über den Schenkeln und öffneten ihr die Knöpfe vor der Brust.
»Is doch die Möglichkeit«, äußerte er. »Was aus den kleinen Mädchen wird. Daß wir Sie nicht gesehn haben, das is ja woll seit Anno – drei, vier Jahr is es ja woll. Na, und voriges Jahr sind wir doch auch 'n bischen nach München gekommen. Da haben wir aber gar nie das Vergnügen gehabt.«
»Haben Sie's nun nachgeholt?« fragte Ute und ließ ihn stehen.
Von Eisenmann blieb hinter seinen Papieren herrisch zurückgelehnt, einen Arm über den Tisch geschoben, den andern auf der Hüfte. Er war mager, gelblich und herausfordernd. Seine Stirn erhob sich schmal und entblößt, der schwarze Schnurrbart zottelte stürmisch über seinen blassen jähzornigen Lippen. Er fragte Claude mit Strenge, wo er gewesen sei. Claude erklärte dem Freunde seiner Mutter nachlässig, daß er Fräulein Ende zur Stunde begleitet habe.
»An einem Tage wie heute ist das ein Fehler«, behauptete von Eisenmann. »Ihre Frau Mutter hat nach Ihnen gefragt.«
»Dann wird sie es mir selbst sagen«, meinte Claude schonend. Er schämte sich vor von Eisenmann, der die Geschmacklosigkeit beging, ihn zu hofmeistern. Es ihm zu sagen, wäre auch wieder geschmacklos gewesen. Der Mensch mußte doch selbst fühlen, daß er sich falsch benahm. Aber von Eisenmann hielt Claudes Milde für Herausforderung.
»Ich spreche als Freund Ihrer Mutter!« rief er erhobenen Hauptes. »Ich genieße das Vertrauen Ihrer Mutter.«
»Ich weiß«, machte Claude zerstreut. Der Mensch genoß doch noch mehr. Wollte er ihm denn weismachen, er habe kein Verhältnis mit seiner Mutter. Wie konnte jemand so taktlos sein.
»Sie werden künftig von Ihrer Mutter abhängen, und die Interessen Ihrer Mutter vertrete ich! ... Sie werden also guttun, sich mit mir besser zu stellen als bisher.«
Panier griff ein.
»Laß ihn man, Claude. Er ist nicht halb so wild, wie er tut. Und wir sind auch noch da, mein Jung. Immer 's Panier hoch! Wir sind doch der engste Geschäftsfreund von deinem seligen Vater. Wir lassen dich nicht darben, dazu haben wir zuviel Pietät. Will er dir mal nichts geben, dann komm du man zu uns, und fertig is die Kiste.«
»Danke«, sagte Claude. »Es wird sich schon machen.«
Aber von Eisenmanns Augen loderten in noch böserem Blau aus völlig schwarzen Winkeln. Er sprang sogar auf, vergaß alle Hoheit, hatte Speichel im Mundwinkel. Claude versagte es sich, sichtbar die Achseln zu heben. Er dachte: ›Das Individuum ist, was Matthacker eine Sauerstoffnatur nennt. Er verbrennt enorm viel, verschlingt Massen Fleisch, ohne stärker zu werden, regt sich fortwährend auf, bespuckt die ganze Welt von einem furchtbar hohen Posten, und weiß selber nicht, wie er da hinaufkommt.‹
»Ich wiederhole Ihnen ...«, sagte von Eisenmann und fauchte ein paarmal. Inzwischen erhob sich draußen Frau Marehns Stimme, und von Eisenmann mäßigte sich.
»Sie werden selbst zugeben, daß es ein Fehler war, heute an Frivolitäten zu denken.«
Claude betrachtete ihn mit Teilnahme. Aber aus dem gelben Salon kehrte Ute eilig zurück.
»Sie reden von meiner Arbeit als von etwas Frivolem? Herr von Eisenmann, das ist ein Fehler von Ihnen.«
Und in ihrer Haltung und ihrer Stimme waren viel steilere Anmaßungen als in seiner.
»Nu süh mal«, sagte Panier.
»Mein Fräulein, das sind Gesichtspunkte«, erklärte schneidend von Eisenmann.
»Allerdings. Man muß die äußerliche Vorschriftsmäßigkeit entbehren können, ohne damit gleich alles zu verlieren«, meinte Claude sehr stramm.
»Nu süh mal«, sagte Panier. » Jetzt kann er sich wehren, wo die Dame dabei ist. Tjatja, die Damen.«
Claude sagte noch etwas, er redete sogar mit von Eisenmann gleichzeitig und ohne ihn zu hören. Ute stand geringschätzig dabei. Panier sagte ihr: