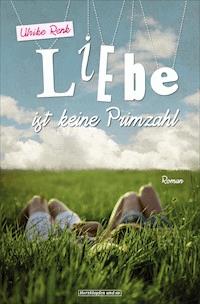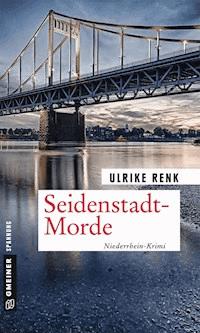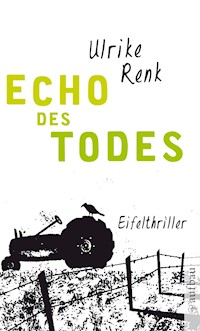Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ostpreußen Saga
- Sprache: Deutsch
Verlorene Heimat – eine starke junge Frau zwischen Liebe und Verlust.
Kurz nach ihrer Hochzeit erfährt Frederike, dass ihr Mann eine schwere Krankheit hat. Er geht in ein Sanatorium, und Frederike hofft auf seine Genesung. Doch als er stirbt, steht Frederike vor den Trümmern ihres Lebens.
Allein und ohne eigenes Vermögen muss sie das Gut mit der großen Trakehnerzucht bewirtschaften. Jahre der Verzweiflung und Einsamkeit folgen, bis sie Gebhard von Mansfeld kennenlernt. Ganz langsam gelingt es ihr, wieder an das Glück zu glauben. Doch dann kommt Hitler an die Macht, und plötzlich weiß Frederike nicht, ob sie und ihre Liebsten noch sicher sind ...
Die große emotionale Familiensaga aus Ostpreußen, die auf wahren Begebenheiten beruht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über Ulrike Renk
Ulrike Renk lebt als freie Autorin in Krefeld. Bei Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane „Die Frau des Seidenwebers“, „Die Heilerin“, „Die Seidenmagd“ sowie die Bestseller „Die Australierin“, „Die australischen Schwestern“ und „Das Versprechen der australischen Schwestern“ erschienen. Mehr Informationen zur Autorin unter www.ulrikerenk.de
Informationen zum Buch
Frederike ist mit Ax verheiratet, muss jedoch kurz nach ihrer Hochzeit erfahren, dass ihr Mann ihr seine tödliche Krankheit verheimlicht hat. Statt einer gemeinsamen Zukunft auf Sobotka muss Frederike das Gut, die Ländereien und die große Trakehnerzucht selbständig bewirtschaften, während ihr Mann in einem Sanatorium in Davos ist. Zunächst scheinen seine Heilungschancen gut zu stehen, dann jedoch verschlechtert sich sein Zustand rapide, und Ax stirbt. Frederike ist fassungslos – wie soll sie, Anfang zwanzig und verwitwet, dieses Schicksal bewältigen? Es folgen arbeitsame und einsame Jahre, in denen Frederike beweisen muss, dass sie dem Erbe ihres Mannes gewachsen ist. Dann lernt sie bei ihrer Jugendfreundin Gebhard von Mansfeld kennen. Doch ihr gemeinsames Glück ist nur von kurzer Dauer, denn wenig später kommt Hitler an die Macht, und die von Mansfelds sind – als entschiedene Gegner der Nazis – schon bald nicht mehr sicher …
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrike Renk
Die Jahre der Schwalben
Roman
Inhaltsübersicht
Über Ulrike Renk
Informationen zum Buch
Newsletter
Die Güter, die Bewohner und die wichtigsten Leute
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Nachwort
Danksagung
Impressum
Für Sophie, Friederike und Moritz zu Putlitz
Und für Christian Loefke, meinen Lieblingsbruder
Die Güter, die Bewohner und die wichtigsten Leute
FENNHUSEN
Die Familie
Erik und Stefanie von Fennhusen
Eriks Stiefkinder:
Frederike von Weidenfels geb. 1909
Fritz von Fennhusen geb. 1911
Gerta von Fennhusen geb. 1913
Gemeinsame Kinder:
Irmgard (Irmi) geb. 1921
Gisela (Gilusch) geb. 1922
Erik geb. 1924
Albrecht (Ali) geb. 1927
Die Leute auf Fennhusen
Hans – Kutscher
Meta Schneider – Köchin
Leni – 1. Hausmädchen
Gerulis – 1. Hausdiener
Inge – Zimmermädchen
Koslowski – Schweizer
Nachbarn und Freunde Fennhusen
Familie zu Hermannsdorf
Familie zu Husen-Wahlheim
Rudolph von Hauptberge
Familie zu Olechnewitz
Familie von Larum-Stil
SOBOTKA
Alexander (Ax) zu Stieglitz
Die Leute auf Sobotka
Lore – Köchin
Gustav – Diener
Igor – Bursche
Piotr – Bursche
Jusuf – Schweizer
Frans – 1. Hausdiener
Minna – 1. Hausmädchen
Frau Dahlhoff – Mamsell
Stanislav (Stanis) – Stallmeister
Jan Mazur – Leiter des Gestüts
Heinrich von Aaken – Verwalter
Ruth von Aaken – Frau des Verwalters
Isaak Otto von Aaken – Sohn des Verwalters
Esther Lisbeth von Aaken – Tochter des Verwalters
Rachel Charlotte von Aaken – Tochter des Verwalters
LESKOW
Walter und Adelheid geb. Hofer von Lobenstein (Hilde) zu Mansfeld
Die Leute auf Leskow
Joseph – 1. Hausdiener
Anna Jobst – Köchin
Hedwig – 1. Hausmädchen
Fritz – 2. Diener
Frieda – Küchenmädchen
Willi – Kutscher
Fred Spitzner – Schäfer
Fritz Dannemann – Inspektor
MANSFELD BURGHOF
Gebhard zu Mansfeld
Die Leute auf Mansfeld Burghof
Blumenthal – Gärtner
Ilse – Hausmädchen
Lore – Köchin
Ursa Berndt – Sekretärin
Paula – Wäscherin
Else – Kindermädchen
Nikolaus Pirow – Verwalter
Wanda – Kinderfrau
GROSSWIESENTAL
Werner (Skepti) und Thea zu Mansfeld
Kapitel 1
Fennhusen, Frühjahr 1930
Es regnete ohne Unterlass, aber es war ein milder Regen, der die Luft zu reinigen schien. Frederike wischte über die Scheibe und sah hinaus in die vertraute Umgebung. Die ersten Kirschblüten öffneten sich, nun da das Frühjahr endgültig den Winter verdrängt hatte.
»Wie jeht es Ihnen?«, fragte Hans leise. Der alte Kutscher war nicht mit dem Landauer zum Bahnhof gekommen, sondern mit dem Automobil.
»Ach Hans, für dich bin ich doch immer noch Freddy«, seufzte Frederike. »Das war schon immer so und wird auch so bleiben.«
Hans räusperte sich. »Nun ja, du bis awwer jetzt ’ne verheiratete Frau, Baronin von Stieglitz.«
»Ja.« Frederike senkte den Kopf. Seit neun Monaten war sie mit Ax verheiratet, und nun kehrte sie zum ersten Mal nach Fennhusen, auf das Gut ihrer Familie zurück. Ihre Gefühle waren gemischt. »Wie geht es allen?«
»Irmi und Gilusch machen sich prächtig. Und Klein Erik hat anjefangen zu reiten«, sagte Hans schmunzelnd. »Ali wird immer mehr zu ’nem Dickkopf. Mittem werden wir noch Spaß haben.«
»Das habe ich gehört.« Frederike lächelte. Trotz des großen Altersunterschieds lagen ihr die vier kleinen Geschwister aus der dritten Ehe ihrer Mutter ebenso sehr am Herzen wie ihre beiden anderen Halbgeschwister, die schon erwachsen waren und nicht mehr auf dem Gut wohnten.
»Das Irmichen is een kleener Wirbelwind, awwer reiten kannse fast so jut, wie du.« Hans klang so stolz, als ob er über seine eigene Familie sprechen würde.
Wieder schaute Frederike nach draußen. Sie hatte das Gut Fennhusen in den letzten zehn Jahren immer als ihr Zuhause, ihre Heimat betrachtet, doch das war nun vorbei. Was würde Mutter sagen? Wie würde sie sich verhalten? In den letzten Monaten hatte Frederike sich geweigert, ihre Mutter zu treffen, aber nun musste sie sich dem Gespräch mit ihr stellen.
Hans lenkte das Automobil durch die Toreinfahrt, der nasse Kies knirschte unter den Reifen. Auf den ersten Blick hatte sich nichts verändert, dort waren die Stallungen, die Häuser des Gesindes, das runde Blumenbeet vor dem Treppenaufgang, das ihre Mutter angelegt hatte. Die Narzissen waren schon fast alle verwelkt, aber die Tulpen öffneten ihre Blüten.
Sobald der Wagen stand, stieg Frederike aus. Sie holte tief Luft. Es roch nach frischem Regen und feuchter Erde. Sie liebte diese Schauer im Frühjahr, die die Natur zum Erwachen brachten.
Die Eingangstür wurde geöffnet, ihre Mutter winkte.
»Komm rein, Freddy«, rief sie. »Du wirst noch ganz nass. Nicht, dass du uns krank wirst.«
Wütend kniff Frederike die Augen zusammen. Krank? Nun ja, ihre Mutter hatte sie wahrhaftig mehr ausgesetzt, als nur einem Regenschauer. Langsam ging sie zum Haus, stieg die Treppe empor.
»Guten Tag, Mutter«, sagte sie steif und streckte Stefanie von Fennhusen die Hand entgegen. Ihre Mutter zog überrascht die Augenbrauen hoch und schüttelte Frederike kurz die Hand.
»Wenn du es so willst«, murmelte Stefanie verletzt, drehte sich um und ging in die große Diele. »Ich habe dir dein Zimmer herrichten lassen. Möchtest du einen Tee?«
»Mir wäre ein heißes Bad lieber.«
»Darf ich Ihren Mantel nehmen?«, fragte Inge, das Hausmädchen. »Ich werde ihn zum Trocknen nach unten bringen.«
»Danke, Inge.«
»Sag Leni Bescheid, dass sie das Bad einlassen soll. Ich hoffe, der Ofen ist angeheizt.«
»Sofort, gnädige Frau.« Inge eilte nach unten ins Souterrain, wo sich die Gesinderäume und die Küche befanden.
Am liebsten wäre Frederike ihr gefolgt, wäre eingetaucht in die Wärme und die Düfte der Küche und hätte sich von Schneider, der Köchin, verwöhnen lassen – so wie früher. Aber nichts war mehr wie früher.
»Einen Tee, solange du auf das Bad wartest?«, wollte Stefanie wissen. Ihre Stimme klang nun kühler.
»Ich nehme lieber etwas Stärkeres.«
»Freddy! Freddy!« Irmi stürzte die Treppe hinunter und sprang Frederike in die Arme. »Endlich bist du da. Bleibst du hier? Ziehst du wieder zu uns zurück? Bitte, bitte, bitte.«
»Irmikind, mein Irmikind. Du wirst zu groß und zu schwer, als dass ich dich tragen und rumschwenken könnte«, sagte Frederike und drehte sich einmal mit ihrer Schwester im Kreis, bevor sie sie wieder auf dem Boden absetzte. »Wo ist Gilusch?«
»Gilusch ist auf ihrem Zimmer, und da bleibt sie heute auch«, sagte Stefanie und zog die Stirn in Falten. »Du kannst sie morgen begrüßen. Die Jungs sind im Kinderzimmer, denen kannst du nachher hallo sagen.«
Frederike sah Irmi fragend an, ihre kleine Schwester nickte ernst. »Gilusch war frech«, flüsterte sie.
»Zu Mutter?«, flüsterte Frederike zurück.
»Ja, und zur Lehrerin.«
»Grundgütiger. Wieso das denn?«
»Wer flüstert, lügt«, sagte Stefanie laut und streng. »Willst du jetzt einen Drink, oder willst du weiter Kinderspielchen spielen? Ich dachte, aus dem Alter bist du raus!«
»Oh, oh«, seufzte Frederike.
»Geh lieber«, meinte Irmi leise, »sonst bekommst du auch noch Stubenarrest.«
Frederike lachte laut auf. »Ich komme nachher noch zu dir«, versprach sie ihrer Schwester. Dann folgte sie der Mutter in den kleinen Salon, in dem Stefanie auch ihren Sekretär hatte.
»Bourbon? Cognac? Sherry? Gin?«
»Gin-Fizz nehme ich gerne.« Frederike folgte. Die Atmosphäre war mehr als kühl, was nicht überraschend war.
Stefanie goss sich selbst einen Sherry ein und läutete nach Gerulis, dem ersten Hausdiener.
»Meine Tochter möchte einen Gin-Fizz«, sagte sie ihm.
»Freddy! Wie schön, dass du endlich wieder hier bist.« Gerulis lächelte, dann wurde sein Gesicht wieder ernst. »Einen Gin-Fizz, sehr gerne, gnädige Frau.«
Sie setzten sich gegenüber in die beiden Sessel, die vor dem Kamin standen, und schwiegen sich an, bis Gerulis den Drink brachte.
Stefanie konnte eisern schweigen, das wusste Frederike aus Erfahrung. Also biss sie die Zähne zusammen, hob das Glas und zwang sich zu lächeln. »Cheers, Mutter.«
»Prost, Freddy.«
»Ist Onkel Erik da? Ich muss ihn dringend sprechen.«
»Er kommt gleich, im Moment ist er noch mit dem Inspektor auf den Feldern. Der Winter war lang in diesem Jahr. Wir haben schon April, aber wir konnten erst jetzt den Dung ausbringen. Bis letzte Woche lag noch Schnee.«
»Ja, bei uns auch.« Frederike räusperte sich, nippte noch einmal am Gin. »Was macht Fritz?«, fragte sie und hoffte, dass es leichthin klang.
»Er ist in Berlin und studiert Technik. Außerdem will er einen Pilotenschein machen.« Stefanie schüttelte den Kopf. »Er war schon immer verrückt nach mechanischen Dingen.«
Frederike lächelte. Ihr Halbbruder Fritz aus der zweiten Ehe ihrer Mutter war nur zwei Jahre jünger als sie. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie er als Kind immer alles auseinandergebaut und untersucht hatte.
»Und Gerta?«
»Sie ist immer noch krank. Im Herbst hatte sie einen Infekt mit hohem Fieber und hat sich noch nicht davon erholt. Im Moment ist sie auf der Kurischen Nehrung. Ich hoffe, dass die Seeluft ihr guttut. Das hatte ich dir aber geschrieben.« Stefanie sah sie an. »Doch du beantwortest meine Briefe ja nicht, möglicherweise liest du sie gar nicht.«
Frederike hielt die Luft an, dann trank sie das Glas in einem Zug leer und stellte es auf das Tischchen neben ihr. »Ich werde mal schauen, ob mein Bad schon fertig ist«, sagte sie, stand auf und ging zur Tür.
»Um sechs gibt es Essen. Vielleicht ist Erik schon früher da, dann lasse ich dich rufen.«
»Danke.«
»Ich weiß, dass du mir böse bist, aber ich wollte nur das Beste für dich«, sagte Stefanie.
»Das Beste? Das Beste? Mutter, du hast mich in eine Ehe mit einem todkranken Mann gedrängt, im vollen Bewusstsein, wie es um ihn steht. Obwohl ich dich mehrfach gefragt habe, hast du es geleugnet. Ax hat Tuberkulose, das ist eine schwere und sehr ansteckende Krankheit. Vielleicht habe ich es auch schon. Ansonsten werde ich wahrscheinlich sehr jung Witwe werden.« Sie schnaufte.
»Man kann es behandeln …«, sagte Stefanie unsicher. »Und es gibt Tests. Hast du dich testen lassen?«
Frederike starrte sie wütend an.
»Außerdem hat er es schon einmal überwunden, vielleicht gelingt es ihm diesmal auch.«
»Mutter, er hat es nie überwunden, es gab nur einen Stillstand. Das weiß ich jetzt, und du wusstest es auch.«
»Wie … nun, wie geht es ihm?« Stefanie klang verlegen. »Du warst doch bei ihm?«
»Ja, ich war bei ihm. Schon mehrfach. Zuletzt über Weihnachten. Es war nicht so, wie ich mir das erste Weihnachtsfest mit meinem Ehemann vorgestellt habe.« Frederike biss sich auf die Innenseite ihrer Wange, dann drehte sie sich um, öffnete die Tür und ging. Sie war wütend, zu wütend, um noch länger mit ihrer Mutter zu sprechen. Vielleicht würde sie sonst Dinge sagen, die sie später bereute.
Für einen Moment stand sie unschlüssig im Flur, doch dann zog es sie ins Souterrain zu den Leuten – wie die Angestellten des Gutshauses genannt wurden. Sie öffnete die Tür, die zum Treppenhaus führte, und ging nach unten.
Vorne lagen die Räume mit den Vorrats- und Weinkellern. Nach hinten raus fiel das Gelände etwas ab, und dort war das Souterrain fast ebenerdig mit dem Hof. Rechts und links lagen die Gesinderäume und das Leutezimmer, wo die Hausangestellten das Essen einnahmen, vor Kopf war die große Küche. Schon als Frederike die Treppe hinunterging, hörte sie das Klappern der Töpfe und Pfannen, das Klirren des Geschirrs, und vor allem hörte sie die durchdringende Stimme von Frau Schneider, der Köchin.
»Erbarmung, wollt ihr beim Spülen einschlafen? Nun ljecht mal eine Hand zu! Wir haben Arbeet zu erlediejen. Dat Essen wartet nich!«
Frederike öffnete die Tür zur Küche, und sofort fühlte sie sich wieder zu Hause. Es roch nach frischem Brot, ausgelassenem Speck, nach Braten und Soße. Auf dem Herd kochte das Wasser, Eier wurden aufgeschlagen, die Mädchen rannten, schnippelten, kneteten, fluchten, und im Zentrum stand Schneider, die Köchin. Sie schaute auf und sah Frederike an.
»Marjellchen, na endlich. Hab schon jedacht, du kommst nie wieder runter zu uns.«
»Erbarmung«, sagte Frederike und lachte, »das würde ich mir nicht erlauben.«
»Komm, lass uns an meinen Platz jehn. Da hamwe Ruhe.« Die Köchin, sie schien Frederike noch breiter als früher, kämpfte sich zur Fensterfront vor. Darunter stand ein großer Tisch, auf dem das Haushaltsbuch der Köchin lag. Frederike setzte sich auf die Bank, Schneider ließ sich schnaufend auf ihrem gepolsterten Stuhl nieder, der schon bessere Zeiten gesehen hatte, den sie sich aber weigerte, ersetzen zu lassen.
»Wie jeht es dir, Kindchen? Und wie isses mit dem Lorechen? Un was is mit deim Mann? Isser wieder jesund? Hach, so viele Frajen. Iss erst ma was. Inge, bring sießes Brot und Butter, das Marjellchen is jankerich nach jutem Essen.« Dann lehnte sie sich zurück, faltete ihre Hände über dem voluminösen Bauch und sah Frederike an. »Blass biste«, sagte sie leise. »Nun sach schon.«
»Ach Schneider, was soll ich sagen? Schreibt Ihnen Lore denn nicht?«
»Manchmal. Aber das sind nur Briefe, Marjellchen. Ich will wissen mehr. Wie jeht es dir?«
Inge, eins der Mädchen, kam und stellte dampfendes Brot, frische, süße Butter und Marmelade auf den Tisch. Sie knickste verlegen und ging dann wieder.
»Es geht mir gut.« Frederike senkte den Kopf. »So weit.«
»Erbarmung, dat is jelogen. Und das weeßte ooch. Nu sach schon.«
»Ax ist in Davos. Er ist sehr krank, obwohl es ihm langsam bessergeht. Lore ist eine wahre Hilfe, ohne sie wäre ich verloren.«
»Meen Lorechen«, sagte die Köchin stolz. »Ich hab sie anjelernt.«
Frederike musste lächeln. »Das ist wahr. Sie zu haben, ist ein Stück Heimat in der Ferne.«
»Sind see jemein zu dir? Die Leute?«, fragte die Köchin leise.
»Gemein? Nein.« Frederike schüttelte den Kopf. »Gemein sind sie nicht. Aber sie akzeptieren mich auch nicht. Nicht richtig. Ich bin die Frau des Gutsherrn. Aber er ist seit unserer Hochzeit im letzten Jahr nicht mehr auf dem Gut gewesen.« Sie lachte bitter auf. »Ich werde erst im Herbst einundzwanzig, sie nehmen mich nicht für voll. Das kann ich ja verstehen, aber ich muss das Gut trotzdem führen, nur weiß ich nicht, wie.«
»Marjellchen.« Die Köchin lehnte sich vor, drückte Frederikes Hand. »Nun iss ma erst, und dann jehste nach oben und nimmst een heißes Bad. Das Mädchen hat alles vorbereitet. Und dann kommt der Jnädigste, und der wird schon wissen, wasse machen sollst.« Sie nickte und schob Frederike den Teller hin.
Erst wollte Frederike nichts essen, doch der Duft des Brotes war zu verführerisch, und sie langte zu. Es schmeckte köstlich, besser als alles, was sie auf Sobotka, dem Gut ihres Mannes, in den letzten Monaten gegessen hatte. Und das, obwohl Lore – die Köchin dort – von hier stammte.
Schließlich aber ging Frederike nach oben. Sie hatte ihre Hündin Fortuna auf Sobotka gelassen, weil Frederike nach diesem unleidlichen Besuch auf Fennhusen noch nach Berlin zu ihrer besten Freundin Thea fahren wollte. Doch nun, als Frederike ihr Zimmer betrat, fehlte ihr der Hund. In den letzten Monaten war Fortuna immer an ihrer Seite gewesen, hatte sie sogar nach Davos begleitet.
»Freddy!« Leni stand strahlend im Zimmer. »Ich habe schon deine Sachen ausgepackt, und das Bad ist auch bereit. Wie geht es dir denn?«
Leni schien alt geworden zu sein. Graue Strähnen mischten sich unter das blonde Haar, Falten hatten sich um den Mund und in den Hals des Zimmermädchens eingegraben.
War das schon vorher so? dachte Frederike erstaunt. Ich bin mit Leni aufgewachsen, sie ist in der Familie, seit ich denken kann. Natürlich wird sie älter – ist es mir vorher nur nie aufgefallen?
»Oder soll ich dich jetzt siezen?«, fragte Leni leise nach und schaute zu Boden.
»Unfug. Natürlich nicht.« Frederike lachte auf. Sie ging auf das Dienstmädchen zu und umarmte sie. »Es ist so schön, dich zu sehen. Und mir geht es so weit gut. Die Umstände sind schwierig.«
»Das haben wir alle gehört. Wie geht es dem Gnädigsten?«
»Es wird besser. Aber es dauert.« Frederike hatte keine Lust, noch weiter darüber zu sprechen. Es war immer so schmerzhaft, und jedes Mal kochte die Wut auf ihre Mutter erneut hoch. Wie hatte Stefanie es bloß zulassen können? Nicht nur zulassen, sie hatte Frederike geradezu ermutigt, diese Ehe einzugehen. Diese Ehe mit Ax von Stieglitz, der nicht nur vierzehn Jahre älter war als Frederike, sondern auch noch schwer an Tuberkulose erkrankt.
Leni war schon das Hausmädchen von Stefanie gewesen, als die Familie noch in Potsdam gewohnt hatte – sie kannte Frederike von klein auf und wusste ihre knappe Antwort zu deuten.
»Ich habe schon das Wasser ins Bad gelassen und werde noch heißes nachfüllen. Brauchst du Hilfe beim Auskleiden?«, fragte sie.
»Danke, Leni, das ist wundervoll. Und seit wann brauche ich Hilfe beim Auskleiden?« Frederike zwinkerte dem Zimmermädchen zu. »Bitte sorg dafür, dass nachher Gin-Fizz für mich bereitsteht. Irgendwie muss ich ja den Abend mit meinen Eltern überstehen.«
Frederike zog sich aus, legte neue Kleidung zurecht. Auf Sobotka hatte sie viel Personal – aber sie brauchte es nicht. Der Haushalt lief, zwar noch nicht wie am Schnürchen, aber er lief. Sorgen machte ihr das Gut selbst. Sie konnte zwar dem Haushalt vorstehen, aber wie man ein so großes Gut führte, das wusste sie nicht. Ax war ihr keine Hilfe und würde es in absehbarer Zeit auch nicht sein. Deshalb musste sie unbedingt mit Onkel Erik, ihrem Stiefvater, sprechen. Und darum war sie hier.
Nun aber ging sie über den Flur und in das Badezimmer. Dampf waberte durch den Raum, der große Spiegel war beschlagen. Frederike legte den Bademantel auf den Schemel und stieg in die gusseiserne Wanne mit den Klauenfüßen. An der Seite lag die duftende Seife, die Schneider selbst herstellte. Frederike liebte den Geruch, sie würde die Köchin bitten, ihr einige Seifenstücke mitzugeben. Dann hätte sie wenigstens den Geruch der Heimat auf Sobotka.
Kapitel 2
»Freddy, was für eine Freude, dich zu sehen.« Erik von Fennhusen schloss seine Stieftochter in die Arme. »Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut, Onkel Erik. Aber ich muss mit dir reden.«
»Ja, ich habe deine Briefe bekommen. Es dauert wohl noch, bis das Essen serviert wird. Lass uns in den Salon gehen. Möchtest du etwas trinken?«
Frederike schaute sich um. »Wo ist Mutter?«
»Sie hat noch zu tun und wird erst zum Essen zu uns stoßen.«
Frederike versuchte ihre Erleichterung nicht zu zeigen. »Ich hätte gerne einen Gin-Fizz und dazu eine Karaffe Wasser.«
»Mit einem Spritzer Zitrone? Nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm?« Erik von Fennhusen zwinkerte ihr zu. Das war eine Familienanekdote und bezog sich auf den ersten Hauslehrer, den Frederike und ihre Geschwister gehabt hatten. Er bestand immer auf einer Karaffe Wasser an seinem Pult, mit etwas Zitrone. Und er hatte daraus fast jeden Morgen ein Drama gemacht.
»Wasser à la Obermann wäre ein Traum«, sagte Frederike und lachte auf. »Herrje, wie lange das her zu sein scheint – eine Ewigkeit.« Sie folgte Erik in den Salon. Im Kamin brannte altes Tannenholz – sehr harzig –, immer wieder knackte es.
Frederike stellte sich vor den Kamin und streckte die Hände aus. »Ich liebe diesen Geruch.«
»Tanne ist kein gutes Brennholz, aber dies ist wenigstens abgelagert. Gin-Fizz wolltest du?« Onkel Erik ging zur Anrichte und mixte die Drinks. »Eis und Zitronensaft ist schon da. Gerulis hat wohl mitgedacht, Gin-Fizz ist ja dein Lieblingsdrink.« Er nahm die Gläser, kam zu Frederike. »Bitte.«
»Ich bin froh, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, du hast sie eigentlich gar nicht.«
Sie setzten sich in die beiden Sessel am Kamin und sahen sich an. Obwohl Erik von Fennhusen der dritte Mann ihrer Mutter war, war er doch der einzige wirkliche Vater, den Frederike erlebt hatte. Ihr leiblicher Vater, Fred von Weidenfels, der erste Mann ihrer Mutter, war schon vor Frederikes Geburt bei einem Jagdunfall tödlich verunglückt. Stefanie hatte dann Egbert von Fennhusen geehelicht und zwei weitere Kinder – Fritz und Gerta – bekommen. Doch ihr zweiter Mann starb schon am Anfang des großen Krieges, der Europa verwüstete. 1920 hatte Stefanie dann Erik geheiratet, einen Vetter ihres zweiten Mannes, und vier weitere Kinder bekommen. Alle Kinder mit dem Namen von Fennhusen waren erbtechnisch abgesichert, Frederike – geborene zu Weidenfels – war das nicht. Das letzte Geld ihrer Erbschaft hatte die Mutter in Kriegsanleihen untergebracht, doch diese waren inzwischen keinen Pfennig mehr wert. So war Frederike mittellos, aber nicht ohne Heimat – das hatte ihr ihr zweiter Stiefvater Erik versichert. Auf Fennhusen war sie immer willkommen. Seine inzwischen ältliche Schwester Edeltraut und ihre Freundin Martha, beide hatten ihre Verlobten im Krieg verloren, lebten seit Jahren ebenfalls auf dem Gut. Frederike hätte auch als Mamsell in eine Anstellung gehen können, sie hatte das nötige Wissen zur Hauswirtschaft und Gutsleitung auf einer Schule in Bad Godesberg erworben, doch alles kam anders.
Eriks Schützling, Ax zu Stieglitz, hatte Frederike umworben und ihr Herz gewonnen. Nun war sie zwar mit Ax verheiratet, aber bei weitem nicht so glücklich, wie sie gehofft hatte.
»Es tut mir sehr leid, Freddy«, sagte Erik leise und hob sein Glas. »Du weißt, deine Heimat ist hier, egal was passiert. Cheers.«
Frederike zögerte kurz, aber dann nahm sie einen Schluck. »Und du weißt, dass das nicht stimmt«, sagte sie dann. »Ich habe hier keine Heimat mehr.«
»Deine Mutter hat es nicht böse gemeint, Freddy.«
»Sie wusste es. Ich habe sie gefragt. Vor der Verlobung und vor der Hochzeit. Sie hat es immer geleugnet. Immer. Aber sie wusste es. Sie hat mich ins Messer laufen lassen, Onkel Erik. Wieso hat sie das getan?«, fragte Frederike verzweifelt. »Hast du es auch gewusst?«
Erik schüttelte den Kopf. »Ich wusste, dass er als Kind Tuberkulose hatte, aber er galt lange als geheilt.« Erik räusperte sich. »Wie geht es ihm, und wie sind die Prognosen? Sei ehrlich, Freddy. Mit mir kannst du es sein.«
Frederike hob die Arme. »Keine Ahnung. Es ging ihm sehr schlecht, als er letztes Jahr nach Davos kam. Inzwischen ist es besser. Ich war jetzt mehrfach da und habe ihn besucht. Wenn es so weitergeht, kann Ax vielleicht zum Sommer hin nach Hause. Aber sicher ist das nicht. Und belastbar ist er auch nicht.« Sie vergrub das Gesicht in den Händen. »Ich weiß einfach nicht mehr weiter.«
»Und der Inspektor?«
»Er ist das größte Problem. Aber ich habe gar keine Ahnung, wie man so ein Gut leitet. Wir haben neuntausend Morgen Land – davon sind etwa zweitausend Morgen Nutzwald. Es gibt die Pferdezucht, die Land- und die Forstwirtschaft. Ich kann den Haushalt führen und den Gutsgarten bewirtschaften, aber das Gut führen, das kann ich nicht.«
»Hast du Unterlagen mitgebracht?«
Frederike nickte. »Der Inspektor wollte sie mir nicht aushändigen, aber ich habe ihn gezwungen. Sie sind in meinem Zimmer. Soll ich sie holen?«
»Jetzt nicht. Jetzt feiern wir einfach, dass du da bist. Um alles Weitere kümmern wir uns später. Ich helfe dir, versprochen.«
»Danke, Onkel Erik.« Das erste Mal seit langem fühlte sie sich erleichtert und aufgehoben. Erik von Fennhusen sagte nie etwas leichthin, auf sein Wort war immer Verlass. Er würde ihr helfen, und er würde Lösungen finden.
»Ihr habt es eigentlich noch leichter als wir – das Gut liegt in Polen, und ihr könnt eure Waren ohne Zollabgaben verkaufen. Bei uns wird es immer schlimmer. Alles, was ins Reich geht, wird doppelt versteuert. Aber es soll ja bald den Deutsch-Polnischen Roggenvertrag geben, der den Handel erleichtern soll.«
»Ax wollte immer nur ins Reich verkaufen, der Inspektor sieht das auch so. Ich sehe das anders.«
»Da hast du recht, Freddy. Es geht nicht um Patriotismus in dieser Zeit, es geht ums Überleben. Und das wird nicht einfacher werden.«
»Aber der Young-Plan wird uns doch helfen.«
»Das bezweifele ich sehr. Der Young-Plan ist Augenwischerei. Seit dem Versailler Vertrag kämpfen wir mit diesen Reparationszahlungen. Egal wie sie es drehen und wenden – durch die Zahlungen ist das Reich geknebelt und gefesselt. Und nach dem Schwarzen Freitag sehe ich tatsächlich schwarz. So viele Leute haben Geld an der Börse verloren in den letzten Jahren, warum sollten sie Anleihen aufnehmen? Es gibt zig Arbeitslose und die Zahl steigt.«
»Was hältst du von der NSDAP? Sie ist in aller Munde …«
»Geh mir weg mit diesen Rechtspopulisten. Die haben doch keine Ahnung von Politik und dem Weltgeschehen. Sie sehen nur ihre Chance darauf, plötzlich an die Macht zu kommen. Sie wollen alles verändern, Deutschland wieder groß machen – Donnerlittchen –, wie soll das denn gehen und überhaupt: warum? Das Kaiserreich war zum Schluss ein Schuss in den Ofen, und zwar ein gewaltiger. Deutschland ist ein schönes Land, ohne Frage, aber wir sind nicht besser als andere Länder. Wer das behauptet, hat keine Ahnung.« Onkel Erik hatte sich in Rage geredet. Nun sah er Frederike an. »Tut mir leid, ich wollte mich nicht so aufregen. Möchtest du noch etwas trinken?«
»Ich bin so froh, dass ich mit dir reden kann. Auf Sobotka habe ich niemanden. Bis zum Essen nehme ich aber lieber nur noch Soda«, meinte Frederike und lächelte. »Du glaubst also, dass der Young-Plan scheitert?«
»Ich glaube, dass die Weimarer Republik scheitert«, entgegnete Erik düster. Dann hob er den Kopf und sah Frederike an. »Und wie wird das mit Ax weitergehen? Er schreibt mir, aber seine Briefe sind sehr nebulös. Er hofft viel, schreibt aber wenig darüber, wie es tatsächlich mit ihm aussieht.«
»Der Professor ist guter Hoffnung, wenn Ax sich weiterhin so erholt. Aber Ax ist schwach. Ein Spaziergang kostet ihn alle Kräfte, danach muss er erst wieder ruhen.« Frederike seufzte. »So habe ich mir meine Ehe nicht vorgestellt.«
»Das glaube ich. Und es tut mir sehr leid.«
»Du kannst ja nichts dafür. Ich wäre nur froh, wenn du mir bei den Finanzen helfen würdest. Das ist wirklich grauenvoll. Ich verstehe die Bücher einfach nicht.«
»Eigentlich solltest du das auch nicht müssen«, murmelte Onkel Erik in sein Glas. »Du solltest lieben und reisen und Spaß haben. Du solltest leben. Wann, wenn nicht jetzt?«
»Ich liebe ihn ja«, sagte Frederike leise.
»Wirklich?« Onkel Erik sah sie an. »Wirklich? Weißt du denn überhaupt, was Liebe ist? Es tut mir alles so leid, mein Schatz.«
In diesem Moment erklang der Essensgong, und beide waren erleichtert. Sie mochten und schätzten sich, aber schwere Themen an- und auszusprechen lag ihnen beiden nicht.
»Schneider wird für dich gezaubert haben. Das ganze Personal war aus dem Häuschen, als sie hörten, dass du kommst.« Erik nahm Frederikes Ellenbogen und geleitete sie in die große Diele. Vor dem Esszimmer stand schon Tante Edeltraut. Stefanie kam die Treppe hinuntergeeilt, Irmi im Schlepptau.
»Ich darf mit euch essen!«, sagte Irmi stolz und nahm Frederikes Hand.
Gerulis öffnete die Tür zum Esszimmer – es war alles wie früher. Frederike fühlte sich aufgehoben und vertraut, aber dennoch kam sie sich wie ein Gast vor. Sie gehörte nicht mehr zu diesem Haushalt, und sie würde nie wieder wirklich dazugehören.
»Der Winter war hart und lang«, erklärte Stefanie. »Es gibt noch nicht viel junges Gemüse. Und vom Spargel ist noch lange nichts zu sehen.«
»Mama … das weiß ich doch.«
»Ich wollte es nur gesagt haben.« Stefanie lächelte, das Lächeln erreichte allerdings nicht ihre Augen. »Aber Brunnenkresse und Bärlauch konnten wir schon ernten. Deshalb gibt es ein Kräutersüppchen als Vorspeise.«
»Liebe Freddy, wie geht es dir? Wir haben dich ja ewig nicht gesehen!«, fiel Tante Edeltraut Stefanie ins Wort. »Dass du Weihnachten nicht hier warst, hat uns fast das Herz gebrochen.«
»Ich war in Davos … bei Ax«, sagte Frederike zögerlich.
»Das muss ein wunderschöner Ort sein. Das hört man immer wieder. Und wie geht es Ax?«, fragte Tante Edeltraut.
Frederike seufzte. Sie beschloss, der Fragerei ein Ende zu setzen. »Ax ist krank, er ist schwerkrank. Dem Professor zufolge wird er nicht mehr gesund werden. Aber er kann sich erholen, und das tut er nun ja auch in Davos in der klaren Bergluft. Aber richtig, richtig gesund wird er nie wieder. Er ist invalide, lungenkrank und wird es zeit seines Lebens bleiben.« Frederike suchte den Blick ihrer Mutter. »Er ist schwach, zu schwach, um eheliche Dinge zu vollziehen. Aber laut dem Professor sollten wir das sowieso nicht tun, weil ich mich anstecken könnte. Bisher hatte ich Glück, ich habe mich nicht infiziert. Aber ich habe auch schreckliche Angst davor. Ich habe in Davos etliche Lungenkranke kennengelernt. Auch junge Frauen, die schon am Ende ihres Lebens stehen.« Frederike schaute in die Runde, ihr Lächeln war bitter. »Diese Frauen werden vielleicht in den nächsten Jahren sterben. Ich fühle mich mumifiziert – ich bin zwar gesund, aber mit einem kranken Mann verheiratet. Ich kann darauf hoffen, dass es ihm bessergeht und er nach Hause kommen kann, aber eine normale Ehe und Kinder werden wir nie haben – außer ich setze mein eigenes Leben aufs Spiel. So hat es mir der Professor erklärt.« Frederike nahm einen großen Schluck aus ihrem Weinglas. »Ihr fragt, wie es Ax geht. Vielleicht wollt ihr das wirklich wissen. Aber wollt ihr auch wissen, wie es um unsere Ehe steht und ob ich den zu Stieglitz einen Erben schenken werde? Das wird wohl nicht der Fall sein, denn so sehr ich Kinder mag, mein Leben ist mir kostbarer. Ich werde es nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.« Frederike schnaufte. »Habe ich nun alle Fragen beantwortet? Oder möchtest du noch irgendetwas wissen, Mutter?«
Stefanie von Fennhusen wandte sich ab. »Kind, das ist entwürdigend. Muss das sein?«, hauchte sie.
»Und die Wölfe?«, fragte Irmi. »Was ist mit den Wölfen? Hast du sie noch?«
Überrascht sah Frederike ihre Halbschwester an. Dann lachte sie auf. »Du schaffst es, mich mit einem Satz auf den Boden zurückzuholen. Das ist phänomenal. Danke, Irmikind.«
»Aber … aber ich will doch nur wissen, was mit den Wölfen ist«, antwortete das kleine Mädchen verwirrt.
»Sie gibt es noch. Und die Jungwölfin scheint trächtig zu sein. Ich hoffe, sie wirft.«
»Du willst die Wölfe behalten?«, fragte Stefanie. »Die bringen doch keinen Nutzen.«
»Oh, wirklich?« Frederike schlug die Hände an die Wangen, dann lächelte sie. »Das ist richtig, Mutter, die Wölfe bringen keinen Nutzen, sie kosten nur – Zeit, Geld und Platz. Es ist ein unnützer Luxus, sie zu halten. Andere Leute haben Gehege mit Pfauen – wir haben Wölfe. Das war mal schick, jetzt ist es das nicht mehr.« Sie schüttelte den Kopf. »Aber Ax liebt die Wölfe. Und ich tue es auch. Wir werden uns wahrscheinlich von einigen Sachen trennen müssen – in erster Linie von Personal. Ich kann den Gutshaushalt nicht mehr so führen wie in der Kaiserzeit. Ich werde Leute entlassen müssen. Aber solange Ax lebt, werde ich die Wölfe behalten. Er liebt sie.«
Sie wandte sich zu Irmi. »Die Wölfe bleiben.«
Irmi lachte und schlug in die Hände. »Ich hätte gerne einen Wolfswelpen. Können wir nicht auch Wölfe halten, Papa?«
»Darüber reden wir später.« Erik von Fennhusen räusperte sich. »Gerulis, es ist Zeit für den nächsten Gang.«
Nach dem Essen holte Frederike die Bücher aus ihrem Zimmer und ging in Onkel Eriks Büro.
»Ich habe nicht gewusst«, sagte er leise, »dass es so schlimm um Ax steht. Und deine Mutter wird es auch nicht gewusst haben. Trag es ihr nicht nach.«
»Ich fürchte, ich bin weit davon entfernt, es ihr zu verzeihen«, gestand Frederike. »Das Kind ist in den Brunnen gefallen, lass uns nicht mehr darüber reden.« Sie schob ihm die Bücher zu. »Dieses Thema ist allerdings wohl auch nicht besonders angenehm. Ich schäme mich ein wenig, dass ich dich um Hilfe bitten muss, du hast ja nun wahrlich selbst genug zu tun.«
»Ich bitte dich, Freddy, es ist doch selbstverständlich, dass ich dir helfe.« Er setzte sich die Brille, die er seit einiger Zeit hatte, auf die Nase und nahm die Bücher vor und versenkte sich darin. Frederike lehnte sich zurück. Sie mochte das Arbeitszimmer ihres Stiefvaters, hatte es schon immer geliebt. Im Kamin knisterte ein Feuer, draußen war es inzwischen dunkel. Die Sessel knarrten immer ein wenig, wenn man sich darauf bewegte, aber sie rochen so herrlich nach altem Leder. Der Teppich auf dem Parkett war abgetreten, aber ohne ihn konnte sie sich das Zimmer nicht vorstellen.
Die Regale an den Wänden waren mit Büchern vollgestopft. Auch diese, fand Frederike, hatten einen sehr eigenen, vertrauten Geruch.
Auf dem Kaminsims tickte die Uhr. Gerulis, der erste Hausdiener, zog sie jeden Morgen mit einem Schlüssel auf, den er an seinem Bund um den Gürtel trug.
Frederike verknüpfte so viele Erinnerungen mit diesem Zimmer, mit dem ganzen Gut. Hier war sie sehr glücklich gewesen. Dieses Gefühl, zu Hause zu sein, hatte sie auf Sobotka nicht. Vielleicht noch nicht, hoffte sie, denn schließlich wohnte sie noch kein Jahr dort.
Aber es war nicht nur der Inspektor, mit dem sie Kummer hatte, es war auch das übrige Personal, das sie nicht wirklich ernst zu nehmen schien. Einzig Lore, die Köchin, die sie von Fennhusen mitgenommen hatte, gab ihr Halt.
Aufgrund von Ax’ Krankheit gab es auch keine Gesellschaften und keine großartigen sozialen Kontakte. Die Nachbarn hatten ihr am Anfang Höflichkeitsbesuche abgestattet, aber kennengelernt hatte sie niemanden so wirklich.
Sie hatte Ax’ Arbeitszimmer übernommen, traf sich dort jeden Morgen mit der Mamsell und besprach mit ihr den Tag. Auch den Gärtner und den Inspektor bestellte sie fast täglich ein. Dennoch fällte der Inspektor die meisten Entscheidungen eigenmächtig und berichtete ihr erst im Nachhinein davon. Es war nicht so, dass Frederike viel von der Landwirtschaft oder der Verwaltung eines Gutes verstand, aber die Vorgehensweise des Inspektors störte sie mächtig. Sie hoffte, dass ihr Stiefvater ihr hier weiterhelfen konnte.
Erik hatte sich in die Bücher vertieft. Er nahm ein Blatt Papier, einen Stift und notierte sich verschiedene Dinge. Frederike kannte ihn, sie wusste, in solchen Momenten sollte man ihn am besten nicht stören, also hing sie weiter ihren Gedanken nach.
Übermorgen würde sie nach Berlin fahren und sich mit Thea treffen. Seit ihrer Hochzeit hatte sie Thea nicht mehr gesehen, und sie freute sich sehr auf diesen Besuch. Zwar war sie mehrfach nach Davos gefahren, aber das waren ja Krankenbesuche gewesen, und außer dem Luftkurort und dem Gut hatte sie in den letzten Monaten nichts anderes erlebt. Sie hatte ihren Hengst Kobold eingeritten, hatte mit Fortuna das Gut erkundet, und sie hatte sich um die Wölfe gekümmert. Die meiste Zeit aber verbrachte sie damit, das Gut zu leiten. Und, das musste sie sich eingestehen, sie machte es nicht besonders gut.
Onkel Erik schaute auf. »Hast du mit Ax über die Zahlen gesprochen?«
»Nur im Ansatz. Er kann sich nicht lange konzentrieren.«
»Und was sagt der Inspektor zu den Zahlen? Warum habt ihr die Jungpferde verkauft? Den Weizen solltet ihr wirklich nicht ins Reich verkaufen, hier sind die Zölle viel zu hoch. Das Gut liegt doch in Polen – ihr könnt es in Polen verkaufen.«
»Genau deshalb bin ich ja hier. Der Inspektor hat es gemacht und mich vor vollendete Tatsachen gestellt.«
»Der Inspektor entscheidet das selbst? Ohne das mit dir zu besprechen?«
Frederike streifte die Schuhe ab und zog die Knie an, sie versank beinahe in dem großen Sessel. »Ganz genau«, sagte sie dann leise. »Ich habe keine Ahnung von der Gutsführung. Den Haushalt kann ich leiten, und das gelingt mir so weit ganz gut, aber was wann wie auf den Feldern gepflanzt werden soll, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche Getreidesorten gut sind und wie die Feldfolge sein sollte.« Sie seufzte. »Auch vom Nutzwald habe ich keine Ahnung. Und der Inspektor spricht einfach nicht mit mir.«
»Aber war das denn schon immer so? Ich hatte das Gefühl, dass sich Ax gut um das Gut kümmert. Manchmal hat er mich um Rat gefragt, aber grundsätzlich schien er alles im Griff zu haben.«
»Er hat dem Inspektor vertraut – aber der Inspektor hat auch früher nie selbst entschieden, sondern wichtige Entscheidungen mit Ax abgesprochen. Das geht jetzt allerdings nicht. Ich hoffe, das wird sich zumindest wieder ändern, wenn Ax zu Kräften kommt.«
»Das kann ja aber dauern, und ihr müsst jetzt die Felder bestellen. Bisher ist nur wenig Saatgut für dieses Jahr vermerkt. Das kann einfach nicht sein. Ihr könnt ja die Äcker nicht brachliegen lassen. Wir haben April, die Arbeit geht jetzt los, aber die Vorbereitungen hätten schon längst getroffen werden müssen.« Erik nahm nachdenklich die Brille ab und massierte sich den Nasenrücken.
»Ich weiß«, sagte Frederike leise. »Den Garten habe ich unter Kontrolle, und mit dem Gärtner bin ich d’accord.«
»Ich hatte nichts anderes von dir erwartet, mein Kind. Du kannst ganz sicher den Haushalt führen, ein Gut zu bewirtschaften ist eine Nummer zu groß für dich. Aber du wirst es lernen – weil du es musst.« Er stöhnte leise auf. »Es tut mir so leid. Was haben wir dir angetan?«
Frederike straffte die Schultern. »Ich trage es Mutter nach, dass sie mir nichts über Ax Erkrankung gesagt hat, aber angetan habt ihr mir nichts. Ich habe mich für Ax entschieden, weil ich ihn liebe.«
»Man könnte die Ehe annullieren lassen …«
»Onkel Erik!« Frederike war entsetzt.
»Ihr habt sie ja nicht … vollzogen …«
»Aber … aber … nein, das geht nicht.«
»Denk darüber nach, Kind.«
»Nein. Das kann ich Ax’ nicht antun. Und vielleicht irrt sich der Professor ja auch. Man braucht Zeit, um diese Krankheit zu bekämpfen. Und es gibt Erfolge.«
»Ich bin froh, dass du so denkst – so liebevoll über deinen Mann denkst und redest. Ich sehe sehr wohl, wie schwer das alles für deine noch so jungen Schultern ist und was du alles zu stemmen hast.« Wieder rieb er sich den Nasenrücken, seufzte. »Ich würde gerne nach Sobotka fahren und mit dem Inspektor reden, wenn du nichts dagegen hast.«
»Wie bitte? Das würdest du wirklich tun?«
»Ja, und zwar so schnell wie möglich.«
»Das bedeutet?«
»Morgen. Mit dem Auto brauchen wir fünf Stunden, wenn wir gut durchkommen.«
»Morgen? Das ist nicht dein Ernst.« Frederike setzte sich auf, schlüpfte in ihre Schuhe. »Aber ich wollte doch …«
»Auch hier auf Fennhusen gibt es viel zu tun«, unterbrach Erik sie. »Gerade jetzt im Frühjahr. Das weißt du ja auch. Ich kann meinem Inspektor allerdings vertrauen. Wir haben alle nötigen Dinge besprochen. Ich könnte also morgen … ach nein, morgen ist ja die Viehauktion in Graudenz, zu der ich mit dem Schweizer wollte. Wir brauchen einen neuen Bullen für die Milchkühe.« Er brummelte vor sich hin, überlegte. »Nächste Woche. Wir fahren nächste Woche nach Sobotka. Zum Glück ist ja noch Stammkapital da, du bist nicht mittellos, dein Mann hat mehr Geld als ich, auch wenn mein Gut besser läuft als seins.« Erik lachte leise. »Wie lange wolltest du bleiben?«
»Bis übermorgen. Dann wollte ich für ein paar Tage nach Berlin zu Thea fahren.«
»Das passt doch. Auf dem Rückweg kommst du hier vorbei, und wir fahren gemeinsam nach Sobotka.«
»Onkel Erik – von Berlin aus muss ich durch den polnischen Korridor fahren, wenn ich hierhin will. Nach Sobotka ist es mit dem Zug für mich einfacher.«
»Natürlich, natürlich … dann treffen wir uns dort. Ich komme mit dem Automobil. Ich hasse Zugfahrten.«
»Ich weiß.« Frederike lächelte. »Danke, dass du das machst.«
»Ich habe es dir versprochen, und ich halte meine Versprechen, Kind.« Erik von Fennhusen lachte auf. »Da bist du erwachsen und verheiratet, und ich nenne dich immer noch Kind. Aber das wirst du für mich bleiben.«
»Ich finde es schön und keineswegs unangemessen.«
»Dann geh du mal zu Bett, du bist nach dem langen Tag sicherlich müde. Ich werde mich noch ein wenig mit den Büchern beschäftigen.«
»Danke, Onkel Erik. Du bist der beste Vater, den ich mir vorstellen kann, auch wenn du nicht mein leiblicher bist.«
»Ach Kind, jetzt werde ich sentimental … «
Kapitel 3
Den nächsten Tag verbrachte Frederike mit ihren Halbgeschwistern auf dem Gut. Sie gingen in den Stall und besuchten den Schweizer, der Koslowski hieß und nicht aus der Schweiz kam, aber die Oberaufsicht über die Milchwirtschaft des Gutes hatte. Im Stall gab es einige Neuzugänge und einige alte Bekannte. Ihr Pony Dups lebte immer noch, jetzt wurde es von Irmi und Gilusch geritten. Für Frederike war es schon längst zu klein.
»Hast nen neuen Gaul?«, fragte Hans, der Kutscher, sie.
»Kobold. Ein Ostpreußisches Warmblut …« Frederike musste sich das Lächeln verkneifen.
»Ein echter Trakehner, wir sind ja hier nich in ’nem Gerichtshof, der Rassen bestimmt. Und? Wie isser?«
»Leichtgängig, gute Vorderhand, springfreudig. Aber noch jung und ein wenig ungestüm. Er ist nicht so … fest, wie es Lorbass war.« Frederike senkte den Kopf. Ihr Hengst Lorbass hatte eine Kolik bekommen und war vor knapp zwei Jahren gestorben.
»Du kannst nich einen Gaul mittem anderen vergleichen. Dat geht nich, Marjellchen. Die sind alle eijene Charaktere. Und wenne jut mittem auskommst, umso besser. Würd mir jerne mal deinen Kobold anschauen.«
»Vielleicht komme ich im Herbst mit ihm zur Jagd hierher.«
»Na, das wäre ja ein Bockbierfest, Freddychen. Dat würd mir freuen!«
Irmi zeigte ihr all die frisch geworfenen Lämmchen, Fohlen, Kälbchen und natürlich die zwei Würfe der Hofhunde.
»Papa sagt, den nächsten Wurf von Fortuna bekommen wir auch? Er spricht immer wieder davon«, meinte das Mädchen aufgeregt. »Wir haben ja ihre Tochter, Parza, aber sie ist noch nicht alt genug, um zu werfen, sagt Papa.«
»Damit hat er völlig recht. Wo ist denn Parza?«
»Bei Gilusch. Was ich ungerecht finde, denn Gilusch hat ja auch Helena. Ich habe gar keinen eigenen Hund.« Plötzlich strahlten ihre Augen. »Aber vielleicht kann ich ja eines der Wolfswelpen von dir haben?«
»Warum hast du keinen eigenen Hund?«, fragte Frederike, nahm die Hand ihrer Schwester und ging zurück mit ihr zum Haus.
»Weil … weil ich mich nicht wirklich kümmere, sagt Mama. Aber das stimmt nicht. Sie hat mir Kaninchen gegeben, im Verschlag. Aber Kaninchen sind langweilig. Und ich sollte mich um die Puten- und Gänseküken kümmern, aber die beißen und sind … na ja, irgendwie doofe Vögel. Das wollte ich nicht. Mama versteht das nicht, um einen Hund würde ich mich kümmern. Immerzu.«
Frederike lachte. »Was ist mit Dups, kümmerst du dich um sie?«
»Natürlich!« Irmi blieb empört stehen. »Hat jemand etwas anderes behauptet?«
»Nein, Irmikind.« Frederike konnte das Lachen kaum unterdrücken. »Aber nimm für ein halbes Jahr ein paar Karnickel in Pflege, füttere sie, miste die Ställe aus, kümmere dich um Schneiders Küken – dann wird Mutter dir einen Hund erlauben.«
»Meinst du?«
»Ich weiß es, Schatz.« Frederike umarmte die kleine Schwester und zog sie mit sich. »Jetzt lass uns in die Küche gehen, Schneider hat bestimmt eine Leckerei für uns.«
In der Küche saß Gilusch auf der Bank unter dem Fenster. Als sie Frederike sah, sprang sie auf und hüpfte auf sie zu.
»Freddy! Freddy!«
»Liebste Gilusch, durftest du dein Zimmer endlich verlassen?«
Gilusch nickte, schob die Unterlippe vor. »Mama ist immer so streng.«
»Du bist immer so frech.« Irmi drehte ihr eine lange Nase, dann schnupperte sie. »Schneider, du hast Glumsebällchen gemacht!«
»Ei sicher. Und Baiser hab ich ooch jebacken. Da drieben steht die Dose. Nehmt euch.«
Die beiden Mädchen stürmten zur Anrichte.
»Erbarmung, was is mit dir, Freddychen? Magst du nix Sießes mehr?«
»Danke, Schneider, im Moment nicht. Ich nehme an, dass du heute Abend wieder so ein üppiges Mahl kredenzen wirst.«
»Ei, jibbt meene Hiehnerbeene, schön in Buttermilch einjelegt und dann ausjebacken.«
»Obwohl Lore bei dir gelernt hat, schmecken ihre Hühnerbeine nicht so gut wie deine. Ich weiß noch, dass Fritz immer sagte, dass er für sie töten würde.« Frederike lachte.
»Ei, das sacht er heite awwer och noch. Der liebe Bowke, wird awwer Zeit, das er och mal wieder herkimmt.«
»Es ist herrlich, mal wieder in deiner Küche zu sein.«
»Da fiel ich mich aber gebumfidelt, Marjellchen. Dabei haste doch och ne scheene Kiche, habse ja jesehen.« Sie sah Frederike nachdenklich an. »Scheen isse wohl, aber wohl fühlen tuste dich nich, oder?«
Frederike schüttelte den Kopf. »Das kommt bestimmt noch. Wenn Ax erst einmal wieder zu Hause ist.« Sie biss sich auf die Lippe.
»Erbarmung«, murmelte Schneider. »Ei, das wollen wir mal hoffen.«
Tatsächlich wurde am Abend wieder reichlich aufgetischt. Die Stimmung war jedoch kühl. Stefanie redete nur das Nötigste und sah ihre Tochter kaum an. Auch über Tag hatten sie sich nicht gesehen und gesprochen.
Onkel Erik ignorierte den Frost, der in der Luft lag, und erzählte munter von der Viehauktion.
»Und jetzt haben wir einen neuen Bullen?«, tat Tante Edeltraut interessiert.
»Ja. Ein Prachtexemplar. Ich denke, er wird für ganz wunderbare Kälbchen sorgen.« Erik blickte auf, es schien so, als würde er erst jetzt die schlechte Stimmung wahrnehmen. »Geht es dir nicht gut, Steff?«, fragte er verwundert.
»Mir ist gestern etwas auf den Magen geschlagen«, sagte Stefanie. Sie sah Frederike an, kniff dabei die Augen ein wenig zusammen. »Aber das ist nicht der Rede wert. Man muss nicht alles aussprechen, was einen beschäftigt, nicht wahr? Manche Dinge relativieren sich oft im Laufe der Zeit.«
»Hast du jemanden auf der Auktion gesprochen?«, versuchte Tante Edeltraut das Thema zu wechseln.
»Ich habe den unsäglichen Koch gesehen, aber natürlich habe ich kein Wort mit ihm gewechselt.«
»Wer ist das?«, fragte Frederike. »Den Namen kenn ich gar nicht.«
»Erich Koch ist der Gauleiter der NSDAP in Ostpreußen«, erklärte Tante Edeltraut. »Diese Partei hat immer mehr Zulauf.«
»Besser die, als die KPD«, meinte Onkel Erik. »Wir alle wünschen uns, dass Hindenburgs Osthilfeskandal vergessen wird und er etwas mehr Einfluss nehmen kann, ohne dass ihm Korruption vorgeworfen wird.«
»Und wer ist nun dieser Koch?«
»Ein durch und durch unangenehmer Mensch. Er ist nur auf seinen Vorteil bedacht.« Onkel Erik schüttelte den Kopf. »Das meinen zu Hermannsdorf und zu Husen-Wahlheim, unsere Nachbarn, auch – mit ihnen habe ich mich in Graudenz getroffen.«
»Wie geht es ihnen? Wir werden uns doch sicher zu Pfingsten treffen.«
»Spätestens, Edel. Wir haben natürlich über die Landwirtschaft gesprochen. Der Winter war hart und lang, da geht es ihnen genauso wie uns. Letztes Jahr konnten wir schon drei Wochen früher die Gülle und den Dung ausfahren.«
»Müssen wir uns Sorgen machen?«, fragte Stefanie.
»Noch nicht. Es kommt darauf an, wie schnell sich jetzt die Böden erwärmen und wir aussäen können.«
»Eigentlich hängt immer alles vom Wetter ab, und das können wir nicht beeinflussen«, sagte Frederike. »Bei uns hat es vor zwei Wochen schon getaut, und der Dung ist auf den Feldern.« Sie seufzte.
»Aber das ist doch gut, Kindchen«, meinte Tante Edeltraut.
»Das wäre es, wenn der Inspektor vernünftiges Saatgut gekauft hätte«, sagte Onkel Erik und räusperte sich. »Ich fahre nächste Woche für zwei Tage nach Sobotka, um nach dem Rechten zu sehen.«
»Jetzt? In dieser Zeit? Wo du auf unserem Gut so gebraucht wirst?«, fragte Stefanie empört.
»Freddy braucht Hilfe.« Er senkte den Kopf, dann schaute er Stefanie an. »Wir sind mit dafür verantwortlich, dass sie in dieser unglücklichen Lage steckt, und natürlich werden wir ihr helfen und sie unterstützen. Das steht ja wohl außer Frage.«
»Nun gut, wie du meinst«, sagte Stefanie indigniert. »Sollen wir die Tafel aufheben? Vielleicht werden die Gespräche ja drüben am Kamin etwas angenehmer.«
»Ich hole mir nur schnell mein Strickzeug«, sagte Tante Edeltraut. »Du kannst mir schon einen Likör einschenken.«
Auch Frederike stand auf. Sie ging hoch in ihr Zimmer, nahm sich ihre Strickjacke und nutzte die Zeit, um sich kurz frisch zu machen. Die Worte ihrer Mutter waren eine Kampfansage gewesen. Doch Frederike war jetzt erwachsen. Sie ließ sich nicht mehr in die Schranken weisen, so wie Irmi oder Gilusch. So schnell bekam Mutter sie nicht klein.
Dann ging sie langsam wieder hinunter. In der großen Diele standen immer noch die zwei großen Ohrensessel – dahinter hatte sie sich als Kind oft versteckt, um zu lauschen. Die Tür zum Salon schloss nicht richtig, das hatte sie noch nie, und jetzt war das immer noch so. Diesmal jedoch kroch Frederike nicht hinter den Sessel, sie nahm darauf Platz und versuchte zu verstehen, was im Salon gesprochen wurde.
»Wie konntest du nur?«, fuhr Stefanie ihren Mann an. »Freddy ist erwachsen. Sie muss mit ihren Problemen selbst fertig werden.«
»Steff, ich bitte dich. Freddy hat diese Probleme durch uns, durch dich. Wusstest du, wie krank Ax ist? Wusstest du es?«, schnaubte Erik.
»Dass er Schwindsucht hat, wusste ich. Aber das wusstest du doch auch.«
»Er hatte es als Kind und galt als geheilt. Dass es nicht so ist, habe ich erst nach ihrer Hochzeit erfahren.«
»Was einmal geheilt werden kann, kann es auch beim nächsten Mal. Sie soll sich nicht so anstellen, Ax ist in den besten Händen, er kann noch einen Erben mit ihr zeugen.«
»Steff!« Erik klang entsetzt. Frederike zog die Knie an, schlang die Arme um ihre Beine und hörte weiter zu. »Der Professor hat gesagt, dass diese Art von Kontakt gefährlich sei. Das willst du deiner Tochter doch nicht zumuten, nur damit es einen Erben gibt, der dann vielleicht auch noch Vollwaise wird.«
»Noch ist das so, aber das kann sich ja ändern. Günter von Großmannshausen hatte Schwindsucht und hat danach noch Kinder gezeugt, ebenso Friederich von Eckenstein, Herbert zu Glockhausen – es gibt etliche Beispiele. Schwindsucht ist heilbar.«
»Bis zu einem gewissen Stadium. Und Ax scheint das überschritten zu haben.«
»Papperlapapp. Freddy will sich nur nicht darauf einlassen. Im Moment ist alles für sie Drama – sie alleine auf dem Gut, der schwerschwerkranke Mann, die arme Freddy.« Stefanie lachte bitter auf. »Ich habe schon mehr überstanden als sie.«
»Ja, das hast du. Und du wünschst ihr deine Erfahrungen bestimmt nicht, oder, Steff? Und deshalb fahre ich nach Sobotka und helfe ihr. Der Inspektor dort scheint ein Idiot zu sein.«
»Er ist schon seit Jahren auf Sobotka, und bisher hat er seine Arbeit immer gut gemacht.«
»Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Die Bücher sind auf jeden Fall nicht in Ordnung.«
»Du kannst nicht noch ein zweites Gut führen, vor allem nicht eines, das so weit weg und so groß ist.«
»Das weiß ich auch, Steff. Aber Freddy kann es auch nicht alleine. Und deshalb werde ich ihr helfen. Ende der Diskussion.«
»Freddy ist nicht deine Tochter, sie ist noch nicht einmal mit dir verwandt. Du hast hier Familie, die dich braucht.«
»Ich will ja nicht hinziehen, sondern nur für ein paar Tage nach dem Rechten sehen. Es stimmt, sie ist nicht meine leibliche Tochter, sie ist noch nicht einmal eine von Fennhusen. Sie ist die Tochter aus deiner ersten Ehe. Als ich dich geheiratet habe, habe ich die Verantwortung für sie genauso übernommen wie für Gerta und Fritz.«
»Wie du meinst«, sagte Stefanie schnippisch.
Frederike hörte Schritte auf der Treppe. Das würde Tante Edeltraut sein. Schnell ging Frederike zur Tür, die ins Souterrain führte, öffnete sie leise, stieg zwei Stufen hinab und wartete. Als Tante Edeltraut die Diele erreichte, ging Frederike wieder nach oben und tat so, als wäre sie gerade aus der Küche gekommen.
»Na, warst du bei Schneider naschen? Hat dir das Essen nicht gereicht?« Tante Edeltraut lächelte.
»Niemand kann so gut kochen wie unsere Schneider«, sagte Frederike ausweichend.
»Das stimmt. Ich hoffe, mein Bruder hat mir schon einen Likör eingeschenkt. Die leckeren Liköre, die Schneider ansetzt, unterstützen die Verdauung ungemein.« Sie öffnete die Tür zum Salon. »Da sind wir wieder«, sagte sie fröhlich und nahm auf dem Sofa Platz. »Mein Likör, Erik?«
»Kommt sofort. Und du, Freddy? Noch einen Gin?«
»Das wäre zauberhaft.« Für einen Moment sondierte Frederike die Lage. Ihre Mutter saß auf einem der Sessel und starrte in das Kaminfeuer. Sie sah grimmig aus. Der Sessel neben ihr war noch frei, auf dem Tischchen neben dem dritten stand Onkel Eriks Glas. Schnell entschied Frederike sich dafür, neben Tante Edeltraut Platz zu nehmen. Tante Edeltraut nahm ihr Strickzeug zur Hand. In fast jeder freien Minute strickte sie Socken in allen Größen – die bekamen dann die Leute zu Weihnachten.
»Was macht Tante Martha?«, fragte Frederike. »Ich habe mich gewundert, dass sie nicht hier ist.«
Tante Martha war eine alte Freundin von Edeltraut. Beide hatten ihre Verlobten im großen Krieg verloren, der Europa verwüstet hatte. Früher war Martha nur zur Sommerfrische nach Fennhusen gekommen. Dann hatte sie die Sommerfrische immer länger ausgedehnt, und schließlich war sie ganz geblieben. Und sie war von Fennhusen, genau wie Edeltraut – Eriks Schwester –, nicht mehr wegzudenken.
»Martha ist bei Gerta, wusstest du das nicht? Sie sind auf der Kurischen Nehrung.«
»Dass Gerta dort ist, hat mir Mutter gesagt.«
»Nun, Martha begleitet sie … dem armen Mädchen geht es ja so schlecht.«
»Ich dachte, sie ist nur dort, um wieder zu Kräften zu kommen nach ihrer Krankheit?« Frederike runzelte die Stirn. »Mutter, was hat Gerta denn?«
»Einen seltenen Ausschlag«, antwortete Stefanie kurz. »Das wird schon wieder.«
»Wir machen uns große Sorgen, denn keiner weiß so recht, was sie genau hat«, sagte Edeltraut sorgenvoll, ohne auf Stefanies Aussage zu achten. »Jedenfalls ist Martha mit ihr gefahren, und das ist auch gut so. Das Kind braucht jemanden an seiner Seite.«
Oh, dachte Frederike erstaunt, der Ton zwischen Tante Edeltraut und Mutter ist wieder schärfer geworden. Da scheint es Konflikte zu geben.
»Nun, Gerta ist fast erwachsen. Sie ist zwar schwach, aber nicht pflegebedürftig. Sie hätte die Zeit dort auch alleine verbringen können«, antwortete Stefanie. »Und ich konnte ja nun auf keinen Fall mitfahren und die kleinen Kinder hier alleine lassen. Da stimmst du doch zu, Edel?«
»Natürlich, Stefanie.« Tante Edeltraut nahm das Glas mit dem Likör, das Erik ihr reichte, trank einen großen Schluck. »Dennoch geht es dem Mädchen schlecht. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass man sie im Reich bei einem Professor vorstellen sollte. Bisher ist sie ja nur in der Provinz behandelt worden.«
»Wenn der Aufenthalt auf der Kurischen Nehrung keine Wirkung zeigt, werden wir das sicherlich tun«, sagte Erik versöhnlich. »Du fährst morgen nach Berlin, Freddy?«
»Ja, ich nehme den ersten Zug um zehn. Dann bin ich abends bei Thea. Ich freue mich sehr darauf. Soll ich Thea fragen? Ihre Eltern kennen bestimmt Koryphäen, was jede Krankheit angeht.«
Edeltraut lachte. »Das stimmt. Aber Mimi und Heinrich sind doch gar nicht in der Hauptstadt, oder täusche ich mich da? Ich meine, sie wären nach Amerika gereist.«
»Tatsächlich? Amerika …«, sagte Frederike schwärmerisch. »Da möchte ich auch mal hin.«
»Dann musst du dich beeilen«, sagte Onkel Erik düster. »Ich denke mal, in ein paar Jahren wird das nicht mehr möglich sein.«
»Wieso?«
»Es gab gerade erst eine Verordnung gegen fremdrassige Einflüsse. Ich habe es heute Morgen in der Zeitung gelesen. Musik, Tänze und andere Einflüsse von Schwarzen werden verboten. Und das wird noch mehr werden, da kannst du dir sicher sein.«
»Was bedeutet das denn? Dass man keinen Jazz mehr hören, keinen Shimmy-Shimmy oder Charleston mehr tanzen darf?«, fragte Frederike entsetzt.
»Genau das bedeutet es. Ich finde es einerseits gut, wenn wir patriotisch sind, wenn wir uns auf unsere Kultur besinnen, aber dieser Rechtsruck geht durch das ganze Land, und er beängstigt mich.«
»Patriotisch.« Edeltraut seufzte auf. »Unser letzter Patriotismus hat uns in den Krieg geführt. Daran kann ich nichts Gutes sehen.«
»Das war doch der Kaiser, Edel. Er wollte den Krieg. So sind wir doch nicht alle«, sagte Stefanie entschieden. »Aber seit dem Kriegsende und den Versailler Verträgen ist es fast so, als müsste man sich schämen, deutsch zu sein. Schaut doch nur mal, was sie mit Ostpreußen gemacht haben. Sie haben es abgespalten. Und die Sache mit dem polnischen Korridor ist aberwitzig. Und jetzt hat Hindenburg auch noch das Liquidationsabkommen unterschrieben.« Sie seufzte ebenfalls.
»Das Abkommen bringt uns Erleichterung, Steff«, wandte Erik ein.
»Aber nur kurzfristig.« Tante Edeltraut klapperte eifrig mit ihren Stricknadeln. »Der Versailler Vertrag ist unser Ruin – langfristig. Auch wenn die Reparationszahlungen nun als Anleihen verkauft werden. Nach dem Schwarzen Freitag ist das alles mehr als fraglich.«
»Die NSDAP ist furchtbar, aber sie hat einige Ideen, die tauglich sind«, meinte Stefanie und stand auf. »Möchte noch jemand einen Drink?«
»Jazz zu verbieten ist nicht tauglich«, murmelte Frederike. »Und muss es dann nicht auch ›Getränk‹ statt ›Drink‹ heißen?«
»Willst du Haare spalten?« Stefanie lachte auf. »Es wird ja nicht alles verdammt, was amerikanisch oder englisch ist. Es geht um die Neger, um die fremden Rassen.«
»Vor allem um die Juden, das ist ein Elend«, seufzte Tante Edeltraut.
»Es gibt jüdische Schwarze?«, fragte Frederike verblüfft.
»Hast du die Politik in den letzten Monaten nicht verfolgt, mein Kind?« Stefanie gab ihr noch einen Gin. »Vielleicht gibt es auch jüdische Schwarze, aber grundsätzlich sind das zwei Paar Schuhe.«
»Und beide ähnlich entsetzlich«, murrte Tante Edel. »Die wollen Köpfe vermessen, um die Rasse festzustellen. Und die Arier sollen viel wertvoller sein als alle anderen Rassen. Was für ein Unfug.«
»Nein, Mutter, ich hatte die letzten Monate einfach viel zu viel zu tun. Du weißt schon – das Gut, der kranke Mann, die Reisen nach Davos und wieder zurück, mit Politik habe ich mich nicht beschäftigt, eher mit Krankenakten und Arztberichten.«
»Du musst nicht gleich ausfallend werden«, herrschte Stefanie ihre Tochter an. »Ich wusste nicht, wie schlimm es ist. Das habe ich nicht gewusst.«
»Dass er krank ist, wusstest du schon.«
»Ja, ich wusste, dass die Krankheit wieder ausgebrochen ist. Aber es kann immer noch heilbar sein. Willst du mir das jetzt bis zu meinem Lebensende vorhalten?«
»Ich fürchte, das werde ich.« Frederike nahm ihr Glas, stand auf und prostete allen zu. »Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.« Dann ging sie.
In der Diele holte sie tief Luft. Es hatte sie Kraft gekostet, ihrer Mutter so gegenüberzutreten, aber es hatte auch gutgetan. Die letzten Monate hatte die Wut in ihr gebrodelt, wie in einem Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Und jetzt hatte Frederike ihrer Mutter die Stirn geboten – das erste Mal.
Kapitel 4
Am nächsten Morgen weckte Leni, das erste Hausmädchen, Frederike.
»Guten Morgen«, sagte sie fröhlich und stellte den Krug mit dem heißen Wasser auf dem Waschtisch ab. Dann zog sie die Vorhänge auf. »Es scheint ein herrlicher Tag zu werden. Endlich, nach all dem Regen.«
»Wie … wie spät ist es?«, fragte Frederike verschlafen.
»Halb sieben. Um sieben ist wie immer die Andacht unten im kleinen Salon. Brauchst du Hilfe beim Anziehen?«
»Halb sieben – das ist ja mitten in der Nacht.« Frederike zog sich das Kissen über das Gesicht.
»Nein, halb vier ist mitten in der Nacht. Da müssen die Stubenmädchen aufstehen. Halb sieben ist eine durchaus passable Zeit. Brauchst du nun Hilfe?«
»Nur beim Aufwachen, alles andere schaffe ich schon«, murmelte Frederike und drehte sich zur Seite.
»Gut.« Leni zog ihr das Daunenbett weg. Im Raum war es empfindlich kalt, denn der Ofen war nicht an.
»So habe ich das nicht gemeint.« Frederike griff nach der Decke. »Ein Feuer wäre schön.«
»Der Ofen wird so schnell nicht warm, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Du fährst doch schon nach dem Frühstück. Soll ich dir beim Packen helfen?«