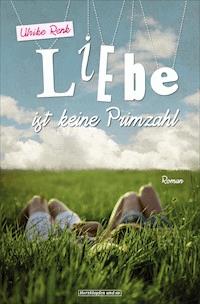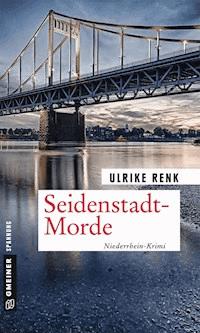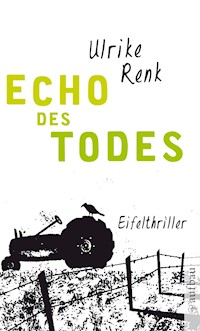Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Seidenstadt-Saga
- Sprache: Deutsch
Zerbrechliches Glück.
1938: Nach der Pogromnacht ist im Leben von Ruth und ihrer Familie nichts mehr, wie es war. Die Übergriffe lasten schwer auf ihnen und ihren Freunden. Wer kann, verlässt die Heimat, um den immer massiveren Anfeindungen zu entgehen. Auch die Meyers bemühen sich um Visa, doch die Chancen, das Land schnell verlassen zu können, stehen schlecht. Vor allem wollen sie eines: als Familie zusammenbleiben. Dann passiert, wovor sich alle gefürchtet haben: Ruths Vater wird verhaftet. Ruth sieht keine andere Möglichkeit, als auf eigene Faust zu versuchen, ins Ausland zu kommen: Nur so, glaubt sie, ihren Vater und ihre Familie retten zu können … Eine dramatische Familiengeschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Ulrike Renk
Ulrike Renk, Jahrgang 1967, studierte Literatur und Medienwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Familiengeschichten haben sie schon immer fasziniert, und so verwebt sie in ihren erfolgreichen Romanen Realität mit Fiktion.
Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Australien-Saga und ihre Ostpreußen-Saga sowie zahlreiche historische Romane vor.
Mehr Informationen zur Autorin unter www.ulrikerenk.de
Informationen zum Buch
Zerbrechliches Glück.
1938: Nach der Pogromnacht ist im Leben von Ruth und ihrer Familie nichts mehr, wie es war. Die Übergriffe lasten schwer auf ihnen und ihren Freunden. Wer kann, verlässt die Heimat, um den immer massiveren Anfeindungen zu entgehen. Auch die Meyers bemühen sich um Visa, doch die Chancen, das Land schnell verlassen zu können, stehen schlecht. Vor allem wollen sie eines: als Familie zusammenbleiben. Dann passiert, wovor sich alle gefürchtet haben: Ruths Vater wird verhaftet. Ruth sieht keine andere Möglichkeit, als auf eigene Faust zu versuchen, ins Ausland zu kommen: Nur so, glaubt sie, ihren Vater und ihre Familie retten zu können …
Eine dramatische Familiengeschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrike Renk
Zeit aus Glas
Das Schicksal einer Familie
Roman
Inhaltsübersicht
Über Ulrike Renk
Informationen zum Buch
Newsletter
Personenverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Nachwort
Danksagung
Impressum
Für meine drei Ks
in Liebe
Philipp
Tim
Robin
Personenverzeichnis
Familie Meyer
Emilie Meyer (Großmutter)
Martha
Wilhelmine Meyer (Omi) und Valentin Meyer (Opi)
Karl
Martha Meyer (geb. Meyer) und Karl Meyer
Ruth
Ilse
Hedwig Simons (geb. Meyer) und Berthold Simons
Hans Simons
Freunde der Familie Meyer
Hans Aretz (ehemaliger Chauffeur)
Josefine Aretz (Tante Finchen)
Helmuth
Rita
Sofie und Walter Gompetz
Jakub Zimmermann
Heiner Goldstein (Glaser)
Familie Kruitmans
Familie Goldmann
Freddy und Olivia Sanderson
Jill
Hilde und Werner Koppel
Marlies
Edith und Jakub Nebel
Kapitel 1
Krefeld, November 1938
»Ihr könnt jetzt gehen, es scheint sicher zu sein«, sagte Josefine und schaute aus dem Fenster. »Niemand ist auf der Straße.« Sie sah Ruth und Ilse sorgenvoll an. »Aber mir wäre es lieber, ihr würdet bleiben.«
»Das geht nicht, Tante Finchen«, sagte die siebzehnjährige Ruth und biss sich auf die Lippen. Ihr war flau im Magen, sie hatte Angst, eine Angst, so groß, wie sie sie im Leben noch nicht verspürt hatte.
»Ich muss wissen, was mit Mutti und Vati ist.« Sie blickte zu Ilse, ihrer jüngeren Schwester. »Aber du kannst hierbleiben …«
Ilse schüttelte stumm den Kopf.
Wieder sah Josefine Aretz nach draußen. »Dann geht jetzt. Schnell, aber unauffällig. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, das wisst ihr!«
»Danke, dass ihr für uns da seid.« Mit entschlossenen Schritten machte sie sich auf den Weg. Ilse folgte ihr, nach ein paar Metern griff sie nach ihrer Hand. Sie war warm und lag fest in der ihren, aber Ruth spürte, dass auch sie Angst hatte.
Auf der anderen Straßenseite lag der kleine Schreibwarenladen der Familie Tauber. Curt Tauber nagelte gerade Bretter vor das eingeschlagene Schaufenster. Erst jetzt bemerkte Ruth die Scherben auf dem Bürgersteig.
Es war ungewöhnlich ruhig, fast schon gespenstisch nach dem Chaos und den Verwüstungen des letzten Tages. Eine Dunstglocke lag über der Stadt, es roch nach Qualm und Rauch, nach verbranntem Holz und Stoff, nach Vergeltung und Zerstörung.
Den neunten November 1938 würde Ruth nie vergessen, die Bilder hatten sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Die lodernden Flammen, die aus der Synagoge schlugen.
Ihnen kam eine Frau entgegen, sie hatte den Kopf gesenkt, doch Ruth erkannte Hilde Goldschmitt.
»Guten Tag, Frau Goldschmitt«, sagte sie.
Die Frau blieb stehen.
»Was macht ihr denn auf der Straße?«, zischte sie. »Das ist doch viel zu gefährlich.«
»Wir wollen nach Hause …«, sagte Ruth.
»Wo kommt ihr denn her?«
»Wir haben die Nacht bei unserem Chauffeur verbracht«, antwortete Ilse, ihre Stimme klang ängstlich.
»Habt ihr nicht gesehen, was die Nazis getan haben?«, sagte Frau Goldschmitt. »Wer weiß, ob sie damit fertig sind.«
»Die Synagoge hat gebrannt«, sagte Ruth. »Man konnte die Flammen bis zu uns sehen.«
»Alle Synagogen in allen Städten haben gebrannt oder brennen noch, sagt man. An eurer Stelle würde ich zusehen, dass ihr von der Straße kommt.« Sie nickte ihnen zu und lief weiter.
Ruth wurde mulmig zumute. Auch beim Möbelgeschäft der Familie Kaufmann waren die Fensterscheiben zerbrochen worden, die Ausstellungsstücke lagen zerschlagen auf der Straße verstreut. Sie konnte Frau Kaufmann im Laden sehen, sie weinte bitterlich. Doch wo war Herr Kaufmann?
»Komm weiter«, sagte Ilse. »Ich habe Angst.«
Die Nacht hatten Ruth und ihre dreizehnjährige Schwester Ilse bei Familie Aretz in der Innenstadt verbracht – Hans Aretz war lange Jahre der Chauffeur von Ruths Vater gewesen, bevor er ihn hatte entlassen müssen, weil er als Jude keine arischen Angestellten haben durfte. Seit langem schon waren die Familien befreundet.
Mit eiligen Schritten, den Kopf tief in ihren Schals vergraben, liefen sie Richtung Bismarckviertel, nur wenige Passanten kamen ihnen auf dem Weg entgegen. Der randalierende Mob des letzten Tages schien sich verkrochen zu haben. Dort, wo die Synagoge gestanden hatte, stieg immer noch Rauch in den verhangenen Himmel, und Ruth musste sich zwingen, den Blick abzuwenden. Menschen, die nicht davor zurückschreckten, ein Gotteshaus niederzubrennen, waren noch zu ganz anderen Dingen fähig, das war ihr klar geworden.
Wo waren bloß ihre Eltern? Hatten auch sie sich in Sicherheit bringen können? Ruth hatte sie angefleht, Schutz zu suchen und nicht in ihrem Haus zu bleiben. Wie sehr hoffte sie, dass die Eltern ihrem Flehen gefolgt waren.
Mit gesenktem Blick gingen die Mädchen weiter. Manche Bürgersteige waren von Splittern übersät, etliche Fensterscheiben waren eingeworfen worden. Da und dort lag beschädigtes und zerbrochenes Mobiliar auf den Straßen – von jüdischen Geschäften, die geplündert worden waren.
Doch je näher sie dem Stadtrand kamen, umso weniger Verwüstungen gab es, das machte Ruth Hoffnung.
»Meinst du, sie haben unser Haus …?«, fragte Ilse mit erstickter Stimme.
Ruth antwortete nicht, die Angst vor dem, was sie möglicherweise gleich sehen würden, schnürte ihr die Kehle zu.
Dann bogen sie in die Schlageterallee ein – die Straße lag ruhig und friedlich vor ihnen. Die Kastanien, die erst vor wenigen Jahren gepflanzt worden waren, hatten fast ihre ganzen Blätter verloren und streckten die kahlen Äste in den bleichen, grauen Himmel. Das Laub raschelte unter ihren Füßen, als sie den Bürgersteig entlanggingen. Es war kalt, viel kühler als in den letzten Tagen, bestimmt würde es bald anfangen zu frieren.
Plötzlich blieb Ruth stehen und kniff die Augen zusammen. Auf der Mitte der Straße lag etwas. Aber was war es? Es wirkte fremd und trotzdem auf eine merkwürdige Art vertraut … Langsam ging sie weiter, dann erkannte sie, worum es sich bei dem Gegenstand handelte. Wie vor den Kopf geschlagen blieb Ruth stehen, ballte unwillkürlich die Hände zu Fäusten – es war die taubenblaue Haustür ihres Elternhauses. Was macht die Tür mitten auf der Straße, und wie kommt sie dort hin? Eine Tür gehört in ein Haus und nicht auf die Straße. Irgendetwas in ihr weigerte sich, den Gedanken zu Ende zu denken. Wie in Trance ging sie weiter, ihre Schritte wurden schneller, je näher sie ihrem Elternhaus kam. Sie schaute nach links und nach rechts, aber alle Häuser, die Seite an Seite gebaut worden waren, sahen intakt aus, nichts schien beschädigt. Noch ein paar Schritte, und sie stand vor ihrem Zuhause. Es war tatsächlich ihre Haustür, die auf der Straße lag, der Eingang nun eine hässlich klaffende Öffnung im Mauerwerk. Aber woher kam dieses Geräusch? Ein unaufhörliches Rauschen, kaum wahrzunehmen, aber doch da. Dann sah sie es: Wasser lief über die Treppe in den Vorgarten und weiter nach unten, zur Garage.
Sie haben die Wasserhähne aufgedreht, dachte Ruth, und auf einmal war sie voller Wut, einer Wut, die sogar die Angst um ihre Eltern in den Hintergrund drängte. Sie haben einfach das Wasser aufgedreht. Mutters Teppiche und der schöne Parkettboden … Aber warum hatte noch keiner das Wasser abgedreht? Wo waren Mutti und Vati, dass sie nicht das Wasser abdrehten?
»Du bleibst hier und wartest«, zischte sie Ilse zu, dann lief sie die Stufen nach oben. Unter ihren Schuhsohlen knirschte es, und erst jetzt bemerkte Ruth, dass alle Fensterscheiben eingeschlagen worden waren. Sie blickte nach oben – selbst im dritten Stock gab es kein Fenster mehr, das unbeschädigt war. Was sie für Raureif gehalten hatte, waren Glassplitter.
»Mutti? Vati?«, rief Ruth erst zaghaft, dann immer lauter. Einen Moment zögerte sie weiterzugehen, was würde sie im oberen Stock erwarten? Welches Bild des Grauens? Dann watete sie durch das strömende Wasser die Treppe hinauf. Alles war nass, Wasser rann durch die Decken, lief an den Wänden entlang. Die Teppiche waren aufgequollen, das Parkett quietschte unter ihren Füßen.
Außer dem Rauschen und dem Wind, der durch die nackten Fenster strich, war nichts zu hören.
»Mutti? Vati?« Ruth schrie nun, rannte in das Herrenzimmer. Und erstarrte. Alle Bilder, alle Gemälde waren von den Wänden gerissen worden und lagen in Fetzen auf dem Boden. Das Sofa war umgestoßen, die Polsterung quoll heraus, und die Federung bewegte sich leicht im Wind. Vatis Bücher hatte jemand aus dem Einbauregal gerissen, es sah so aus, als wäre eine Armee darübergelaufen.
Ruth war fassungslos. Eine solche Zerstörung hatte sie noch nie gesehen. Nicht darüber nachdenken, sie musste ihre Eltern finden!
»Wo seid ihr? Wo seid ihr nur?« Der allerschrecklichste Gedanke tauchte in einer Ecke ihres Bewusstseins auf, aber sie erlaubte sich nicht, ihn zu Ende zu denken. Einfach nicht denken.
Wie in Trance erreichte Ruth das Bad, erst einmal musste sie die Hähne zudrehen, das Wasser stoppen. In der Tür blieb sie abrupt stehen, das Wasser kam nicht aus den Hähnen – die Wände waren aufgebrochen, die Leitungen herausgerissen und zerstört worden – das Wasser strömte aus den offenen Leitungen.
Mechanisch versuchte Ruth, die Leitungen zurück in die Wand zu drücken, dann wurde ihr bewusst, wie sinnlos das war.
»Hallo? Ist jemand hier?« Ihre Stimme hallte im Haus wider, bald war es nur noch ein Wimmern.
»Wo seid ihr?«, schluchzte sie.
Oben in der Mansarde befand sich das Zimmer von Großmutter. Vielleicht hatten sie sich alle dort versteckt? Ruth hetzte die Treppe nach oben.
Die Türen zu den Zimmern musste sie nicht öffnen, sie waren aus den Angeln gerissen worden. Das Zimmer ihrer Großmutter war genauso verwüstet wie alle anderen Räume auch. Sie sah sofort, dass sich hier niemand versteckte.
Ruths Blick fiel auf die Ölbilder an den Wänden, die Großmutter Emilie aus ihrem Haus in Anrath mitgebracht hatte – Porträts ihrer Eltern und Großeltern. Sie hingen noch, nur hatte jemand mit einem Messer in die Augen, die Münder und die Herzen gestochen und die Leinwände zerrissen. Für einen Moment starrte Ruth das Gemetzel an, dann drehte sie sich um und lief zum kleinen Haushaltsraum an Ende des Flurs – die letzte Chance, das letzte Zimmer, in dem sie noch nicht gewesen war. Mit klopfendem Herzen spähte sie hinein – auch hier lag alles durcheinander, nur der große Schrank stand noch dort, wo sie ihn hingeschoben hatte. Immerhin hatten sie das Versteck nicht gefunden.
Auf einmal hörte sie Schritte auf der Treppe, schwere Schritte. Sie zuckte zusammen. Die Schritte ihrer Eltern klangen anders. Waren die Braunen wiedergekommen? Hatten sie beobachtet, wie sie in das Haus gegangen war? Was war mit Ilse?
»Ruth? Ruth, bist du hier?«
Erleichterung breitete sich wie eine warme Welle in Ruth aus. Es war die Stimme von Hans Aretz. »Ruth, Ilse sagte, dass du hier bist. Wir müssen das Wasser abstellen.«
»Was machst du hier, Onkel Hans? Wo sind meine Eltern?«
»Das weiß ich nicht, meine Liebe«, antwortete Hans, seine Stimme klang seltsam sonor. »Bestimmt werden sie sich in Sicherheit gebracht haben.«
»Aber warum sind sie dann jetzt nicht hier?«
Aretz zuckte hilflos mit den Schultern. »Ich weiß es nicht.« Er nahm Ruth in den Arm. »Aber solange es mich gibt, habt ihr ein Zuhause. Ich werde immer für euch da sein – egal, was kommt.«
»Das Wasser … alles hier …« Ruth fehlte der Atem, um weitersprechen zu können.
Aretz nickte. »Wir müssen den Haupthahn abstellen.«
»Den Haupthahn? Ich …«
»Der ist im Keller. Ich mach das schon, Spätzchen. Komm, lass uns hinuntergehen.« Behutsam führte er Ruth nach unten. Es dauerte nicht lange, bis der sprudelnde Fluss zu einem Rinnsal wurde und schließlich ganz aufhörte. Immer noch tropfte Wasser aus den Decken, ein penetrantes Geräusch, Ruth versuchte, darüber hinwegzuhören.
Plötzlich stand Ilse vor ihnen, zitternd und tränenüberströmt.
»Was ist mit Mutti und Vati?«, fragte Ilse fast tonlos. »Und Großmutter?«
Ruth schüttelte den Kopf. »Alles ist kaputt, aber von ihnen keine Spur.«
»Haben sie sie mitgenommen?«
»Ich weiß es nicht«, murmelte Ruth und biss sich auf die Lippe, bis sie den metallischen Geschmack von Blut wahrnahm. »Ich glaube es aber nicht.« Sie wusste selbst, wie hohl ihre Worte klangen. »Ich will es nicht glauben.«
»Vielleicht sind sie ja bei Omi und Opi in der Klosterstraße?«
Ruth sah Ilse an. »Das könnte sein. Überhaupt müssen wir schauen, wie es ihnen geht.«
»Was für eine Misere«, sagte Aretz erschüttert. »Die Braunen haben ganze Arbeit geleistet.« Dann schaute er die beiden Mädchen an. »Geht bitte zurück zu Tante Finchen. Dort seid ihr sicher. Ich muss zur Arbeit, ich habe gestern schon gefehlt, ich kann nicht noch einen Tag wegbleiben.«
Ruth schüttelte heftig den Kopf. »Wir gehen jetzt erst zur Klosterstraße. Hoffentlich ist Omi und Opi nichts passiert. Ilse kann dortbleiben, und ich werde Mutti und Vati suchen.«
Aretz seufzte. Er kannte Ruths Dickkopf – sie ließ sich nicht so schnell von ihren Plänen abbringen, aber sie war auch immer bedacht und riskierte keine unnötigen Schwierigkeiten.
»Aber pass auf deine Schwester auf. Denk daran, sie ist noch viel jünger als du.« Erneut seufzte er. »Gern lasse ich euch nicht allein, aber ich habe keine Wahl. Heute Abend, nach meinem Dienst, komme ich wieder hierher, und dann werden wir sehen, was wir machen können.«
»Danke, Onkel Hans«, sagte Ruth und drückte seine Hand. Sie sahen ihm nach, bis er hinter der Straßenecke verschwunden war.
»Ich will zu Omi und Opi«, sagte Ilse leise und wischte sich eine Träne von der Wange. »Und Mutti und Vati finden.«
»Ich auch«, sagte Ruth und straffte die Schultern. »Aber vorher muss ich noch einmal ins Haus.«
»Warum denn? Ach bitte, lass mich nicht wieder allein.«
»Warte hier, es dauert nicht lange.«
Im Hauswirtschaftszimmer in der Mansarde angekommen, schob Ruth den Wäscheschrank Stück für Stück zur Seite, der den Blick auf die kleine Tapetentür freigab, die zu einer noch kleineren Abstellkammer führte. Bevor sie gestern das Haus mit Ilse hatte verlassen müssen, hatten sie dort alles, was ihnen wichtig erschien, versteckt. Das gute Geschirr und Kristall ihrer Mutter, Papiere und Unterlagen.
Schnell kroch sie in das kleine Kabuff, tastete mit den Fingern an der Wand entlang und fand schließlich, was sie gesucht hatte – ihr altes Tagebuch. Eilig steckte sie es in die Manteltasche. Das Tagebuch war wichtig, sie würde es brauchen. Dann nahm sie alle verbliebene Kraft zusammen und schob den Schrank wieder zurück vor die Tür. Falls die randalierenden Männer zurückkommen sollten, würden sie vielleicht auch ein weiteres Mal das Versteck nicht entdecken.
Ruth lief nach unten, Ilse stand im Vorgarten und zitterte, ihre Unterlippe nach vorn geschoben, ihre Augen schwammen.
»Komm schon, Ilse«, sagte Ruth, die sich alle Tränen verkniff. »Wir müssen los.«
»Was hast du im Haus gemacht?«, fragte Ilse. »Warum musstest du noch einmal rein?«
»Ich musste etwas holen.« Ruth tastete nach dem Tagebuch, das schwer in der Manteltasche lag – aber sie musste sich vergewissern, dass es wirklich da war.
»Was denn?«
»Mein Tagebuch.«
»Du hast mich allein gelassen, um dein albernes Tagebuch zu holen? Dort stehen doch nur deine Tennisgeschichten drin und alles über deinen geliebten Kurt.«
»Ilse!« Ruth blieb stehen und sah ihre Schwester entsetzt an.
Ilse senkte den Kopf. »Verzeih, ich wollte nicht gemein sein.« Sie nahm Ruths Hand. »Ich habe nur so fürchterliche Angst. Alles ist so … schrecklich.«
»Ich weiß!« Ruth umarmte Ilse kurz, zog sie dann weiter. »Kannst du dich noch an den Sommer vor zwei Jahren erinnern? Als wir immerzu in der Kull waren? Mit all den anderen Mädchen und Jungs aus der Gemeinde? Als die Nürnberger Gesetze rauskamen und auf einmal so vieles verboten war?«
»Ja, klar. Wir durften nicht mehr ins Schwimmbad oder Kino«, sagte Ilse. »Es hat sich furchtbar angefühlt. So, als hätten wir eine ansteckende Krankheit.«
»Die haben wir aber nicht. Niemand von uns. Wir sind normal – im Gegensatz zu denen.«
Ilse schaute sich erschrocken um. »Ruth!«, wisperte sie entsetzt.
»Sei's drum. Also, damals habe ich jedenfalls eine Geheimschrift entwickelt, und jeder meiner Freunde hat davon eine Abschrift bekommen – um sie zu entschlüsseln. Bisher haben wir sie nur selten gebraucht – eher für Schabernack. Aber jetzt könnte es wichtig werden, dass wir uns verständigen können, ohne dass die Braunen verstehen, worum es geht. Um geheime Treffen zu vereinbaren oder so etwas.«
»Wirklich? Du hast eine Geheimschrift erfunden? Du bist so knorke. So einzig!«
Ruth drückte ihren Arm. »Der Code steht in meinem Tagebuch, deshalb musste ich es holen. Willst du mir helfen? Wir werden an alle Nachrichten schreiben – einen geheimen Treffpunkt vereinbaren.«
Ilse nickte ernsthaft. »Ja, ich bin dabei. Natürlich. Wäre ja auch fatal, wenn nicht.«
Inzwischen hatten sie den Bismarckplatz erreicht. Hier waren wieder deutlich mehr Menschen auf der Straße. Vorsichtig musterte Ruth die Passanten. Waren Braune unter ihnen? Dann stockte ihr der Atem. Mit aufgerissenen Augen zeigte sie vor sich. »Dort … da vorn, schau nur, Ilse, da ist Vati!« Sie ließ den Arm ihrer Schwester los und rannte dem Mann im grauen Wollmantel, den Hut tief in das Gesicht gezogen, entgegen.
»Vati!«
Ruth hätte ihn unter Tausenden erkannt.
Karl blickte auf, ein Lächeln erhellte sein von Falten überzogenes Gesicht. »Ruthchen. Meine Ruth!« Er breitete die Arme aus. »Mein Töchterchen.«
Sie fielen sich in die Arme, hielten sich ganz fest. Ruth atmete den vertrauten Duft ihres Vaters ein. Er roch immer ein wenig nach Seife und Leder – nach Schuhcreme und nach Pomade. Zeit seines erwachsenen Lebens war er Vertreter und Handlungsreisender für Schuhe gewesen, bis Hitler den Juden verboten hatte, zu arbeiten.
»Wo ist Mutti?«
»Sie ist bei den Gompetz. Da waren wir die ganze Nacht. Sie ist in Sicherheit.«
»Dem Himmel sei Dank«, sagte Ruth erleichtert.
Auch Ilse umarmte nun schluchzend ihren Vater. »Es ist so schrecklich. So fatal …«
»Ja, das ist es«, sagte Karl ernst.
»Wir waren beim Haus …« Ruth stockte, wie sollte sie ihrem Vater erzählen, wie es dort aussah?
Karl nickte. »Ich war heute früh schon dort, aber ich konnte nichts machen. Als ich hineingehen wollte, habe ich gemerkt, dass bei Merländer noch Braune waren. Sie müssen ziemlich gewütet haben, dem Lärm nach zu urteilen. Ich hatte Angst, ihnen zu begegnen.«
»Bei Merländer waren sie auch? Was ist mit Rosi?«
»Ich weiß es nicht. Ich bin, so schnell es ging, zurück zu eurer Mutter. Sie ist ganz außer sich.«
»Mutti darf das Haus nicht sehen, so wie es jetzt ist«, sagte Ruth bedrückt. »Es würde sie umbringen.« Sie schluckte. »Onkel Hans war da. Er hat den Hauptwasserhahn abgedreht … zumindest läuft jetzt kein Wasser mehr. Aber es sieht schlimm aus.«
»Aretz? Hat er euch hingebracht?«
»Nein, wir sind allein zur Schlageterallee gelaufen, er hat nur kurz seine Arbeit unterbrochen, um nach dem Rechten zu sehen.«
»Ach Ruth, du hattest recht mit all deinen Befürchtungen.« Karl seufzte.
»Onkel Hans kommt heute Abend wieder und hilft beim Aufräumen«, sagte Ruth. »Das hat er mir vorhin versprochen.«
»Dieser Mann ist ein Engel, ein Held«, sagte Karl. »Obwohl ich befürchte, dass es mit Aufräumen allein wohl nicht getan ist …«
Ilse begann wieder zu weinen.
»Sie sind Monster«, stieß Ruth hervor. »Ganz schreckliche Monster, und sie beherrschen unser Land und machen alles kaputt.«
»Pst. Ruth, um Himmels willen.« Karl sah sich hektisch um. »Du darfst so etwas nicht sagen. Nicht laut und nie in der Öffentlichkeit!«
Ruth sah ihn an. »Das ist ja das Schlimme.«
Karl zog seine Töchter an sich und drückte sie fest. »Wir werden weitermachen, wir versuchen, alles zu tun, was in unserer Macht steht, aber ich befürchte, wir werden das Haus nie wieder so herrichten können, wie es einmal war.«
»Wir schaffen das schon, Vati.«
»Was wäre ich ohne euch?«
»Wollt ihr jetzt direkt zurück?«, fragte Ilse und klang plötzlich verzagt. »Ohne vorher zu Mutti zu gehen?«
Ruth strich ihr über die Wange. »Geh du zu Mutti und tröste sie. Vati und ich gehen zum Haus. Wenn wir alle zu Mutti gehen, wird das nichts mit dem Großreinemachen. Die paar Meter schaffst du allein, oder?«
Zu gern wäre auch sie zu den Gompetz gegangen, hätte Trost in den Armen der Mutter gesucht, aber sie wusste, dass sie jetzt stark sein musste.
Karl sah Ruth an. »Du bist so tapfer«, flüsterte er.
»Nein, eigentlich bin ich feige. Ich will Mutti erst sehen, wenn wir so aufgeräumt haben, dass sie es ertragen kann«, antwortete Ruth leise und drehte sich um.
Schweigend gingen sie zurück zum Haus.
»Bitte, Vati, lass uns die Tür von der Straße holen. Bisher fahren die Autos drum herum, aber bald schon wird einer der … einer dieser Menschen ohne Respekt und Anstand einfach darüberfahren.«
»Meinst du, wir können sie zu zweit tragen?«
»Das können wir, bestimmt.«
Sie hoben das Türblatt an, hievten es empor und trugen es bis zum Vorgarten, wo sie es keuchend fallen ließen.
»So, der erste Schritt ist getan«, sagte Ruth zufrieden und wischte den Dreck von den Händen und blickte zu Karl. Ihr Vater schien geschrumpft zu sein, auf einmal wirkte er klein und verletzlich. Immer wieder blinzelte er, nahm die Brille ab und rieb die Gläser blank. Als hoffe er, dass sich das Bild, das sich ihm bot, dadurch verändern würde. Ruth erinnerte sich noch zu gut daran, wie stolz ihr Vater beim Bau des Hauses gewesen war. Jetzt stand er vor der schier aussichtslosen Situation, es zumindest wieder bewohnbar zu machen. Karl hatte immer ein gutes Gespür für Zahlen gehabt, aber anpacken und Dinge reparieren konnte er nicht, nicht zuletzt wegen seines Augenleidens, das ihn fast blind gemacht hatte. Für alles Handwerklich-Praktische war in den vergangenen Jahren Hans Aretz zuständig gewesen. Mit einem Mal tat Vati ihr unendlich leid. Wie hilflos musste er sich gerade jetzt fühlen?
Sie räusperte sich. »Am besten kehre ich erst einmal die Scherben zusammen. Und sie sind scharf, Vati …, nicht, dass du dich schneidest …«
»Ich helfe dir natürlich.«
»Nein, bei Scherben ist es fatal, wenn der eine von der einen Seite und der andere von der anderen Seite fegt.« Ruth überlegte. »Bring du doch erst einmal die kaputten Stühle nach draußen. Alles, was du allein tragen kannst. Ich fange oben mit dem Fegen an.«
»Gut, so machen wir es.« Ruth konnte hören, wie schwer ihm die Situation fiel.
»Ach, Vati.«
»Ich wünschte, ich könnte mehr tun«, sagte er und senkte den Kopf.
»Dass du hier und am Leben bist, ist schon genug«, meinte Ruth, zog ihren Mantel aus und krempelte die Ärmel hoch. Sie nahm den Besen mit den harten Borsten, der für die Veranda benutzt worden war, und ging zielstrebig nach oben.
Unsicher sah sie sich um. Die Scherben lagen überall, auch auf den Läufern und den Teppichen. Ruth lief wieder nach unten, holte sich ihre gefütterten Lederhandschuhe, die sie gerade erst für den Winter bekommen hatte. Dann machte sie sich im obersten Stockwerk daran, die mit spitzen Glassplittern übersäten Teppiche zusammenzurollen. Sie waren schwer, vollgesogen mit Wasser, und trotz der Handschuhe musste Ruth aufpassen, dass nicht einer der Splitter durch das Leder drang und sie verletzte. Schon bald lief ihr der Schweiß über die Stirn, auch wenn der Wind eisig durch die Fensterrahmen pfiff. Unten hörte sie ihren Vater rumoren und oftmals auch fluchen.
Dann plötzlich vernahm sie von unten eine tiefe Männerstimme. Wie erstarrt blieb Ruth stehen. Waren die Nazis zurückgekommen? Mit angehaltenem Atem versuchte sie zu hören, was gesprochen wurde. Dann erkannte sie die Stimme – es war Walter Gompetz, der Freund der Familie, bei dem ihre Eltern in der letzten Nacht untergekommen waren. Ruth schwang wieder den Besen, und schon bald hörte sie zwei Männer unten fluchen und schimpfen. Obwohl die Situation so bedrückend war, musste Ruth lächeln: Zwar fluchten und schimpften sie, aber sie taten auch, was getan werden musste.
Gegen Mittag ertönte ein Ruf aus dem Flur. »Essen! Es gibt Suppe und Würstchen!«, und Ruth ging nach unten. Außer Walter waren noch weitere Freunde und Bekannte der Familie gekommen. Tante Hedwig, Sofie Gompetz und Thea Horn. Luise Dahl stand in der Tür, neben ihr ihre Tochter Lotte. Als sie Ruth die Treppe herunterkommen sah, lief sie mit Tränen in den Augen zu der Freundin und umarmte sie. »Es war so schrecklich letzte Nacht. Und ich bin unendlich froh, dass euch nichts passiert ist.«
»Ihr wart zu Hause?«, fragte Ruth und konnte es kaum glauben.
Lotte nickte.
»Wollten sie denn nicht auch zu euch?«
Luise schnaubte. »Weshalb hätten sie zu uns kommen sollen? Bei uns gibt es nichts zu holen.«
Ruth blickte in die Runde. »Ihr meint, die Braunen seien gekommen, um zu räubern?«, fragte sie fassungslos.
»Nein, Kind«, sagte Walter Gompetz und legte väterlich den Arm um ihre Schulter. »Sie wollten zerstören. Die letzten Jahre haben doch gezeigt, dass sie es vor allem auf die Juden abgesehen haben, die erfolgreich sind. An ihnen lassen sie ihren Neid und ihre Wut aus.«
»Aber wir haben ihnen doch nichts getan«, sagte Ruth voller Verzweiflung. »Gar nichts.«
»Das stimmt, aber das ist ihnen egal.«
»Wie sind sie denn in das Haus gekommen?«, fragte Ruth ihren Vater. »Ihr wart doch sicher nicht mehr hier?«
»Nein, wir sind direkt zu Gompetz gegangen, nachdem ihr mit Aretz weg wart.«
»Theißen war es«, flüsterte Lotte, sie war kreidebleich. »Theißen ist durch den Garten und hat im Souterrain ein Fenster eingeschlagen. Dann ist er ins Haus rein und hat die Haustür für die anderen geöffnet.«
»Theißen? Unser Nachbar?«, fragte Karl nun entsetzt.
Lotte nickte. »Er ist ja schon lange bei den Nazis.«
»Das weiß ich, aber …«, sagte Karl mit erstickter Stimme und wandte sich ab.
»Vati?«, fragte Ruth besorgt, doch er schüttelte nur den Kopf.
»Lass ihn, er braucht einen Moment, um sich zu fangen«, meinte Sofie. »Ich habe Möhreneintopf gekocht, dazu gibt es Rindswürste. Ich habe auch Schüsseln mitgebracht – Walter sagte, sie haben hier alles zerschlagen.« Im Hausflur stand ein Bollerwagen, den großen Suppentopf hatte sie in eine Decke gewickelt, damit er nicht auskühlte. Sie setzten sich auf die nun trockene Treppe und aßen.
»Was ist mit Mutti?«, fragte Ruth Sofie, die neben ihr hockte.
»Es ist gut, dass Ilse bei ihr ist, ich denke, deine Mutter hatte einen Nervenzusammenbruch. Die Ereignisse der gestrigen Nacht und die Sorge um euch beide, das war zu viel für sie.«
»Wie geht es euch?«, fragte plötzlich eine zittrige Stimme an der Haustür. »Oje, das sieht ja furchtbar aus. Oje!«
»Opi!« Ruth sprang auf. »Opi, was machst du denn hier?«
»Ich habe all die furchtbaren Berichte gehört und musste einfach herkommen und sehen, wie es euch geht. Emilie ist bei uns. Wir haben uns alle so große Sorgen gemacht.«
Entsetzt sah er sich um. »Haben die das getan?«
Ruth nickte. »Ja, das haben sie.« Plötzlich schämte sie sich, weil sie nicht mehr daran gedacht hatte, sich bei den Großeltern zu melden. »Geht es euch gut?«, fragte sie leise.
Opi sah sie an und nahm sie dann fest in den Arm. »Ja, ja, Ruthchen, uns geht es gut. Großmutter Emilie auch. Wir hatten zwar eine sehr sorgenvolle Nacht, weil immer wieder Pöbel durch die Straße lief, aber zu uns sind sie nicht vorgedrungen. So ein Masel.« Wieder sah er sich kopfschüttelnd um. »Aber hier haben sie gewütet. Grundgütiger! Was soll nur aus uns, aus diesem Land werden? Es macht mich ganz meschugge.«
»Hier«, sagte Luise Dahl, die wie immer praktisch veranlagt war, reichte ihm eine Schale mit noch dampfender Möhrensuppe und legte eine Rindswurst dazu. »Essen Sie erst einmal, Herr Meyer. Mit vollem Bauch kann man immer noch klagen, aber es geht leichter.«
»Risches. Sie sind alle risches. Und was sie tun, auch.«
»Ja, Opi, aber das wussten wir doch schon. Wir wissen, dass die Nazis die Juden hassen und dass sie boshaft, risches, sind. Das werden wir aber auch nicht mehr ändern können.« Ruth legte ihm eine Hand auf den Arm. »Die Suppe von Tante Sofie ist wirklich lecker. Iss mal.«
Während die anderen aßen, war Karl in sein Arbeitszimmer gegangen, nun kam er wieder zu ihnen.
»Vater. Was machst du hier?«, fragte er. »Ist alles gut bei euch?« Er drückte seinen Vater. »Wie geht es Mutter?«, fragte er besorgt. »Geht es ihr gut?«
»Ja, mein Sohn. Die Nacht war laut und unruhig, aber niemand ist in unser Haus eingedrungen. Auch Emilie geht es gut, sie ist bei uns.« Er schluckte. »Ich habe Berichte im Radio gehört. Sie klangen harmlos, aber man muss ja zwischen den Zeilen lesen in dieser Zeit. Was für ein Schlamassel. Was wirst du tun, Sohn?«
Karl sah sich hilflos um. »Ich weiß es nicht, Vater. Ich weiß es wirklich nicht. Hier können wir vorerst nicht mehr wohnen.«
»Ihr könnt bei uns bleiben«, sagte Walter Gompetz sofort. »Wirklich.« Er sah seine Frau an, Sofie nickte. »Natürlich könnt ihr das, und ich bestehe darauf, dass ihr es tut.«
»Aber ihr habt nur eine Wohnung … wie sollen wir da alle unterkommen?«, fragte Karl. »Das geht nicht.«
»Ach, Karl, mein lieber Karl, natürlich wird das gehen. Wir werden eben ein wenig zusammenrücken. Es ist auch nur für kurze Zeit.« Sofie räusperte sich. »Wir haben das Ausreisezertifikat für Amerika bekommen. Schon vor einer Weile. Nun haben wir auch fast alle Dokumente zusammen, und in wenigen Wochen werden wir auswandern dürfen«, sagte sie leise.
»Tante Sofie, das ist doch wunderbar!«, rief Ruth und küsste sie auf die Wange. »Wie schön für euch.«
»Ja, für uns ist es schön«, sagte sie mit gesenktem Kopf.
»Na, da muss man aber erst einmal drankommen, an so ein Zertifikat«, schnaubte Luise Dahl. »Unsereins hat da keine Chance.«
»Hast du denn einen Antrag gestellt?«, fragte Sofie. »Wir haben unseren vor zwei Jahren eingereicht.«
»Dann weißt du ja auch, was man alles angeben muss. Ich kann kein Kapital vorweisen«, sagte Luise bitter. »Und nein, ich habe mich erst gar nicht bemüht – wir würden ohnehin keine Ausreisegenehmigung bekommen.« Sie sah in die Runde. »Das wisst ihr alle. Man braucht Geld, um auswandern zu können.«
»Liebe Luise, wir haben auch keinen Antrag gestellt«, warf Valentin ein. »Wir können einfach nicht glauben, dass wir Alten, die wir immer für das Land da waren, verfolgt werden. Und auch du wirst nichts zu befürchten haben. So bitter das ist – die Nazis sind hinter den jungen und erfolgreichen Juden her.«
»Aber ich bin nicht mehr jung«, sagte Karl leise. »Ich bin fast fünfzig, ich habe mein Leben lang hier gearbeitet und Steuern gezahlt. Wir haben uns in unserer Gemeinde für Hilfsbedürftige engagiert. Und als Dank haben die Braunen mein Heim zerstört.«
»Karl, du bist ein erfolgreicher Geschäftsmann – das war Neid, der Neid deines Nachbarn Theißen, dem dummen Nazi«, sagte Walter leise und sah sich dann, erschrocken von seinen eigenen Worten, um.
»Er ist ein Spieler«, sagte Karl nun. »Wusstet ihr das? Er hat um Geld gespielt. Um viel Geld. Und er hat viel verloren. Gegen Merländer hat er gespielt, in dubiosen Kartenrunden in Düsseldorf. Einige Zeit hat er gewonnen und auch als Geschäftsmann gut verdient. Das war die Zeit, als er das Nachbargrundstück gekauft und angefangen hat, dort zu bauen.« Karl schüttelte den Kopf. »Ich mochte ihn nie, aber ich wollte ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis.«
»Du hast ihm doch sogar Geld gegeben«, sagte Opi.
»Ja, ich habe ihm Geld geliehen. Er hatte Spielschulden und konnte den Bau nicht fortsetzen. Also kam er zu mir und bat mich um einen Kredit. Da Martha und ich nicht wollten, dass hier eine Bauruine steht, gab ich ihm den Betrag. Es war ein zinsloser Kredit, und er hat auch den größten Teil zurückbezahlt.«
»Nicht alles?«, fragte Walter nach.
Karl schüttelte den Kopf. »Nachdem die Nürnberger Gesetze herausgekommen waren, hat er die Zahlungen eingestellt. Einfach so, ohne ein Wort. Es war aber nicht mehr viel. Ich habe seine Schuld als abgegolten angesehen.« Er sah sich um.
»Doch dass er zu so etwas fähig ist, nicht zu fassen.«
»Dieser miese Schmock«, sagte Valentin und schnaubte.
»Wir waren hier so glücklich«, sagte Karl leise.
»Das werden wir wieder«, meinte Ruth entschlossen. »Wir werden alles aufräumen, säubern und reparieren.«
Nachdenklich sah Karl seine Tochter an, sagte aber nichts.
Ruth aß den letzten Löffel des Eintopfs und stellte dann den Teller wieder auf den Bollerwagen. Ihr war kalt, aber im Mantel ließ sich nicht gut arbeiten. Sie ging in das erste Stockwerk, nahm den Besen. »Ich helfe dir.« Lotte war ihr gefolgt und sah sich nun erschrocken um. »Hier oben haben sie ja auch alles zerstört.«
»In der Mansarde ebenso, dort habe ich die Scherben schon aufgefegt und die kaputten Sachen, die ich allein tragen konnte, hinuntergebracht.«
Lotte ging in Ruths Zimmer, unter ihren Schuhen knirschte es.
»Dein schönes Zimmer …«, flüsterte sie. »Ich habe dich immer ein wenig darum beneidet.«
»Nun gibt es nichts mehr, was zu beneiden wäre.«
»Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.«
»Ich habe hinten angefangen, im Schlafzimmer meiner Eltern. Habe die zerschnittenen Daunendecken zusammengeschnürt und nach draußen gebracht.« Im Vorgarten wuchs der Berg an beschädigten oder zerstörten Gegenständen. Jakub Zimmermann, ein weiterer Freund der Familie, war mit einem Pritschenwagen gekommen. Die Männer luden den Müll und Eimer voller Scherben ein.
»Kannst du mir helfen, die Matratzen nach unten zu bringen?«, fragte Ruth ihre Freundin.
Jakub nahm die Matratzen entgegen und warf sie auf den Wagen, der schon fast voll war.
»Ich bringe das nach Inrath, zur Müllkippe«, sagte er. »Und komme dann wieder. Mit einer Fuhre wird es ja nicht getan sein.«
»Ist unser Haus das einzige, das zerstört wurde?«, fragte Ruth leise.
Jakub schüttelte den Kopf. »In der Stadt sind viele Geschäfte von Gemeindemitgliedern geplündert worden, und auch noch einige andere Häuser und Wohnungen sind betroffen.«
Ruth schloss die Augen. Sie hatte noch mehr Fragen, wusste aber nicht, ob sie die Antworten ertragen würde. Also schwieg sie.
Als sie und Lotte wieder in den ersten Stock kamen, stand Karl an der Tür des Schlafzimmers.
»Ach, Ruthchen«, sagte er mit fast tonloser Stimme. »Ach, Ruthchen.«
»Wir räumen auf, Vati!«
»Das kann man nicht mehr aufräumen«, sagte Karl. Er ging zum Kleiderschrank, der in die Wand eingebaut war, öffnete die Tür und nickte. »Ich habe es mir gedacht. Sie haben Muttis Pelzmantel mitgenommen. Auch den Schmuck haben sie gestohlen. Zum Glück hat Mutti die wichtigsten Dinge gestern mit zu Gompetz genommen. Und einiges hat Aretz.«
»Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, wir müssen aufräumen, müssen weitermachen«, sagte Ruth. »Komm, Lotte, lass uns nach drüben in mein Zimmer gehen.«
»Wir schaffen das. Gemeinsam«, sagte Lotte. Ruth wusste, wenn sie jetzt aufhören würde, würde die schwarze Verzweiflung, die sich in ihrem Inneren befand, sich ausbreiten und sie ausfüllen. Dann würde es ihr wie ihrer Mutter gehen, und das durfte nicht sein. Solange sie sich beschäftigte, war sie abgelenkt von den schrecklichen Gedanken – und von der Furcht.
Ein weiteres Mal beluden Walter und Jakub den Pritschenwagen.
»Morgen komme ich wieder«, versprach Jakub. »Wir sind noch lange nicht fertig.«
»Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll«, sagte Karl mit belegter Stimme.
Jakub schüttelte den Kopf. »Wir müssen jetzt zusammenhalten. Das ist doch selbstverständlich.«
Kapitel 2
Es dämmerte schon, und Ruth war am Ende ihrer Kräfte. Am Nachmittag war Ilse zurückgekommen, um zu helfen. Einen Eimer nach dem anderen, voller Scherben und Unrat, trugen sie nach draußen.
»Wie geht es Mutti?«, hatte Ruth gefragt.
»Doktor Hirschfelder war da und hat ihr eine Spritze gegeben. Sie schläft jetzt. Er hat auch Tabletten dagelassen, die sie beruhigen sollen«, sagte Ilse. Die beiden Mädchen packten einige Taschen mit Kleidung und anderen Dingen, die noch zu retten waren.
»Meinst du, sie kommen heute Nacht wieder?«, fragte Ilse ängstlich.
»Ich weiß es nicht, aber es könnte sein.«
»Ich will hier weg.« Ilses Augen füllten sich mit Tränen. »Ich will weg von hier.«
»Willst du zurück zu Mutti?«
»Nein, ich kann sie nicht trösten. Ihr Anblick bricht mir das Herz.« Sie blickte nach draußen, die Vorhänge vor den leeren Fenstern flatterten im Wind, es wurde langsam dunkel.
Plötzlich fuhr ein Auto in die Einfahrt. Der schwarze Adler, der früher ihrem Vater gehört hatte und den er, nachdem er seinen Beruf nicht mehr ausüben durfte, Hans Aretz, seinem ehemaligen Chauffeur, überlassen hatte.
»Onkel Hans ist da!« Ruth schloss die Augen. »Welch ein Glück«, murmelte sie. Er wusste immer, was zu tun war. Auch Karl atmete erleichtert auf.
Hans Aretz ging wortlos an dem Müll- und Schutthaufen vorbei, stieg die Treppe nach oben. Er sah sich kopfschüttelnd um.
»Hier können Sie vorerst nicht mehr wohnen, Karl«, sagte er. »Das ist ein ganzes Stück Arbeit, das da vor uns liegt.«
Karl nickte. »Martha und ich können bei Freunden bleiben.«
»Die Mädchen kommen wieder mit zu uns«, sagte Aretz entschieden. »Wer weiß, was heute Nacht noch passiert. Es herrscht eine seltsame Stimmung in der Stadt.«
»Danke«, sagte Karl. »Bei Ihnen sind sie in Sicherheit.«
»Dürfen wir wirklich wieder zu dir, Onkel Hans?«, fragte Ilse und putzte sich die Nase.
»Natürlich. Ich bringe euch jetzt heim und komme dann wieder. Wenigstens die Tür und die Fenster im Erdgeschoss sollten wir noch verrammeln. Man muss ja keine Einladungen an die Braunen verschicken.«
»Was würde ich nur ohne Sie tun?«
»Sie haben mir in meinem Leben mehr als einmal geholfen, ich verdanke Ihnen viel. Nun kann ich etwas zurückgeben. Kommt, Mädchen, lasst uns fahren.«
»Moment!«, rief Ilse, lief nach oben und holte die Taschen, die sie gepackt hatte. Auch Ruth hatte noch Kleidung gefunden, die nicht zerschnitten worden war. Nicht nur ihren Schrank hatte sie durchsucht, sondern auch die Schränke der Eltern.
»Nimm das nachher mit zu Gompetz«, sagte sie zu ihrem Vater. »Die gute Weißwäsche, die sie nicht gefunden haben, habe ich auf den Dachboden gebracht – es ist alles nass, also habe ich sie auf dem Speicher aufgehängt, damit sie keine Stockflecken bekommt.«
***
Josefine Aretz hatte ein einfaches, aber nahrhaftes Essen gekocht. Die Mädchen aßen schweigend. Helmuth und Rita, die Kinder der Aretz, saßen auf der Bank und sahen ihnen zu. Hans hatte hastig ein paar Bissen runtergeschlungen, dann bat er seine Frau um belegte Brote.
»Eine Kanne mit Tee wäre auch nicht verkehrt«, sagte er. »Mach ruhig einen ordentlichen Schuss Rum hinein, es wird heute Nacht eisig werden, und das Haus hat sich mit Wasser vollgesogen wie ein Schwamm. Wir können nur hoffen, dass es keinen Frost gibt – dann platzen uns die Böden und Wände auf.«
Ilse schluckte, legte ihren Löffel zur Seite und senkte den Kopf.
»Hans!«, ermahnte Josefine ihren Mann. »Denk an die Kinder.«
»Ach, Ilschen, es tut mir leid, alles wird gut werden.«
»Das glaube ich auch«, log Ruth und legte Ilse die Hand auf die Schulter. »Komm, iss noch ein bisschen. Tante Finchen hat so lecker gekocht.«
»Danke, aber ich kann nicht mehr«, murmelte Ilse.
»Ist schon gut, mein Kind«, sagte Josefine und strich ihr tröstend über den Kopf. Dann schmierte sie einige Brote, kochte Tee mit Rum. Kaum war der Tee in der Stahlkanne, als Aretz auch schon wieder aufbrach.
»Öffne niemandem die Tür«, flüsterte er noch seiner Frau zu.
Ilse war in Ritas Zimmer gegangen, dort hatte Josefine Betten für sie vorbereitet. Die elfjährige Rita würde die nächsten Tage das Zimmer mit ihrem Bruder Helmuth teilen. Rita folgte Ilse.
Die Familien Meyer und Aretz hatten früher oft die Ferien gemeinsam verbracht, da Karl wegen seines Augenleidens nicht selbst Auto fahren konnte. Die Kinder waren zusammen aufgewachsen und zu Freunden geworden.
»Ilse, du kannst meinen Teddy haben«, sagte Rita. »Er tröstet mich immer richtig gut, und ich glaube, du kannst Trost gebrauchen.«
Ilse, die bisher nicht viel gesagt hatte, fing plötzlich bitterlich an zu weinen. »Danke, Rita. Ich …«
Ruth hatte den Kopf gehoben und lauschte. Als sie ihre Schwester weinen hörte, wollte sie aufstehen, aber Helmuth hielt sie davon ab. »Lass Rita machen. Sie ist noch jung und manchmal richtig blöd, so wie es kleine Schwestern eben sind«, er lächelte schief. »Aber das kriegt sie sicherlich gut hin. Sie kann sich in andere hineinversetzen wie kein anderer. Ich …« Er sah Ruth an. »Wie geht es dir? Eine blöde Frage sicherlich.« Immer wieder kippte seine Stimme von hoch nach tief. Wäre die Situation nicht so bedrückend, würde sie jetzt kichern, wurde Ruth klar. Aber ihr war nicht nach Kichern, ihr war nach Heulen. Am liebsten hätte sie sich die Decke über den Kopf gezogen und wäre erst aufgetaucht, wenn die Welt wieder in Ordnung war – aber würde das jemals der Fall sein? Im Moment glaubte sie nicht daran.
Ruth nahm Helmuths Hand in ihre, hielt sie fest. »Deine Frage ist nicht blöd, aber ich weiß nicht, ob und wie ich sie beantworten soll. Es ist alles so unvorstellbar schrecklich. So unwirklich und grauenvoll. Ich möchte tot sein, das alles nicht erleben, und gleichzeitig möchte ich natürlich leben … aber nicht so. Nein, auf keinen Fall so.« Ruth senkte den Kopf. »Vati und Mutti flüstern nur noch, seit Monaten. Alle flüstern nur noch, als ob sie die Dinge vor uns geheim halten könnten – aber das können sie nicht. Wie auch? Es ist doch so offensichtlich: Die Synagoge brennt, die Straßen sind voller Schutt und Splitter. Die Welt ist aus den Fugen, wie wollen sie das vor uns verbergen?«
In ihren Augen schwammen Tränen, als sie ihn jetzt ansah. »Du und Rita – ihr müsst euch alles, was in diesen Tagen passiert, einprägen. Ihr müsst hinsehen und euch später daran erinnern. Ihr müsst es bewahren. Auch wenn ihr keine Juden seid – oder vielleicht gerade deshalb.«
Helmuth schüttelte den Kopf. »Warum wir? Müsst ihr es nicht umso mehr? Ihr als Juden? Ihr müsst es erzählen!«
Ruth nahm nun auch noch seine andere Hand. Sie waren warm und fest, Hände eines Freundes, eines Vertrauten. Ihr Blick wurde fest. »Aber Helmuth, es wird uns doch nicht mehr geben«, flüsterte sie. »Die Nazis wollen uns vertreiben. Sie wollen keine Juden mehr in Deutschland.«
»Sie können euch doch nicht alle vertreiben.«
»Vermutlich nicht. Und vielleicht hören sie ja auch auf, wenn ein Teil gegangen ist – das ist zumindest das, was die Leute aus meiner Gemeinde glauben. Wir sollen gehen und unser Hab und Gut hierlassen.«
»Das ist doch ungerecht. Das ist fatal«, schnaubte Helmuth.
»Möglich, aber was ist ein Haus, was ist Besitz gegen ein würdevolles Leben?«
Helmuth sah sie an. »Ihr könnt nicht gehen. Ich kenne dich und deine Familie fast mein Leben lang, ohne euch wäre mein Vater untergegangen – dein Vater hat ihn gerettet.«
»Ich will auch nicht weg, Krefeld, unser Haus in der Schlageterallee, das ist doch mein Zuhause, aber nun ist alles anders. Die Nazis machen unser Leben kaputt, und ich habe Angst, große Angst. Du hast die Zerstörung nicht gesehen, hast nicht gesehen, was und wie sie es gemacht haben. Zum Glück war keiner von uns da, denn sonst hätten sie uns etwas angetan, da bin ich mir sicher.« Ruth schloss kurz die Augen, aber in ihrem Kopf erschienen sofort wieder die hässlichen und furchtbaren Bilder. Schnell sah sie Helmuth an.
»Magst du darüber reden?«, fragte er leise.
»Ich weiß nicht, ob ich das kann«, flüsterte Ruth. »Es war so ein schrecklicher Anblick; sie haben in unserem Haus regelrecht gewütet und einfach alles kaputt gemacht – als wollten sie alles auslöschen.«
Fassungslos schüttelte Helmuth den Kopf. »Was sind das nur für Monster?«
»Ich weiß nicht, warum sie uns so hassen. Ich habe niemandem etwas getan, und es wird seit Jahren immer schlimmer und schlimmer. Aber jetzt ist es klar – in diesem Land können wir nicht bleiben.«
»Ihr habt doch schon die Ausreiseanträge für Amerika gestellt«, meinte Helmuth.
»Ja, aber wenn die Quoten so bleiben, können wir frühestens in drei Jahren weg. Und wer weiß, was bis dahin ist.« Plötzlich fühlte sich Ruth unendlich müde, sie musste ein Gähnen unterdrücken. Ihr ganzer Körper schmerzte, und sie fühlte sich leer und ausgelaugt. »Ich muss ins Bett. Morgen will ich wieder zum Haus und weiter aufräumen.«
»Ich komme mit und helfe dir«, sagte Helmuth entschlossen.
Josefine, die die Küche aufräumte, hatte mit halbem Ohr mitgehört. Nun drehte sie sich um. »Nein, Helmuth«, sagte sie.
»Nein«, sagte Ruth beinah gleichzeitig. »Das geht nicht. Du musst zur Schule.«
»Papperlapapp. Vati geht doch auch und hilft. Und in der Schule … heute gab es kaum Unterricht, alles drehte sich um den Brand der Synagoge und die Ausschreitungen. Immer nur Getuschel und Geflüster, selbst die Lehrer waren nicht bei der Sache.«
»Das mag sein«, sagte Ruth. »Aber du musst dich und deine Familie schützen, und das geht am besten, wenn du dich unauffällig verhältst. Du musst so normal wie möglich weitermachen, damit hilfst du uns mehr, als wenn du das Augenmerk auf dich und damit auch auf uns richtest.«
»Ruth hat recht, Helmuth.« Josefine trocknete sich die Hände ab und setzte sich zu den beiden an den Tisch. »Es ist löblich, dass du Meyers helfen willst – aber ihnen ist nicht damit gedient, wenn sie plötzlich im Augenmerk der Nazis stehen.«
»Das tun sie doch sowieso, Mutti. Die haben ihr Haus zerstört. Und jetzt müssen wir es wieder herrichten, wo wollen sie denn sonst hin?«
Ruth sah ihn an. »Dort werden wir sicherlich nicht mehr wohnen.« Dass es tatsächlich so sein würde, wurde ihr erst in diesem Moment klar. Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Am liebsten wäre sie aufgestanden und nach draußen gerannt, aber das ging nicht, es war zu gefährlich.
Tante Finchen und Helmuth sahen sie an und schwiegen.
»Du meinst … ihr werdet nie wieder dort wohnen?«, fragte Helmuth leise.
»Ich kann es mir nicht vorstellen.«
»Ich auch nicht«, sagte Ilse mit erstickter Stimme. Keiner hatte bemerkt, dass sie in der Tür stand und das Gespräch mit angehört hatte. »Nicht in diesem Haus. Ich könnte dort nie wieder barfuß laufen, egal, wie viele Splitter wir auffegen.« Sie sah ihre Schwester an, versuchte die Tränen wegzudrücken. »Ich hätte immer Angst vor den Braunen, ich will dorthin nicht mehr zurück.«
Ruth nickte. »Ja, ich fühle genauso. Mal sehen, was die Eltern denken.«
»Warum können die einfach so unser Zuhause zerstören? Was haben wir denen denn getan?«, schluchzte Ilse.
»Nichts! Wir haben nichts getan, Ilschen. Vergiss das nie. Niemals. Wir tragen keine Schuld.« Ruth stand auf und nahm ihre Schwester in die Arme, drückte sie an sich. »Ich kann dir nicht versprechen, dass alles gut wird, aber ich werde alles dafür tun.«
»Ich wäre jetzt so gern bei Mutti – bei Mutti, wie sie früher war.«
Ruth drückte ihre Schwester noch fester an sich. »Ja. Ich auch.«
Josefine zog es das Herz zusammen, sie trat zu den Mädchen, umarmte sie.
»Was in den letzten Tagen passiert ist, ist ungemein scheußlich. Und schmerzhaft. Aber hier werdet ihr immer eine Zuflucht, eine Heimstatt haben. Hier wird euch keiner verfolgen, wir müssen nur achtsam sein.« Sie schaute von Ruth zu Ilse und zurück. »Versteht ihr das? Es geht um eure Sicherheit und auch … ja, auch um unsere.«
»Ja, das verstehe ich«, sagte Ruth. »Ihr werdet Ärger bekommen, wenn ihr uns Juden unterstützt. Wir können sicherlich woanders unterkommen.«
Josefine Aretz atmete tief ein.
»Meine liebe Ruth, so habe ich das nicht gemeint, und du weißt das auch. Du bist hier kein Gast, du bist Teil der Familie – wie auch Ilse. Ihr beide seid fast wie meine Kinder, ich habe euch aufwachsen sehen. Ihr gehört zu uns.« Sie schluckte, musste einen Moment innehalten. »Ich will euch nicht wegschicken – im Gegenteil. Ich möchte euch hierbehalten. Aber wir müssen aufpassen, damit die Braunen euch nicht hier finden.« Sie sah von Ruth zu Ilse, sah beide voller Ernst an. »Ich bin jetzt für euch verantwortlich, und deshalb ist es wichtig, dass ihr auf mich hört. Versteht ihr das? Es geht um euer Leben, aber es geht auch um das Leben von Rita und Helmuth.«
Ilse atmete hörbar aus. »Ja, Tante Finchen«, sagte sie mit zitternder Stimme.
»Natürlich hast du recht, Tante Finchen, wir versprechen, vorsichtig zu sein«, schloss sich Ruth an. Ihre Stimme klang fest und entschlossen. »Trotzdem möchte ich gern morgen zurück nach Hause und weiter aufräumen.«
»Warum?«, fragte Helmuth. »Hast du nicht gerade gesagt, dass du nie wieder dort wohnen willst?«
»Ich möchte die Sachen aussortieren, die noch nicht zerstört sind, und außerdem … müssen dieses Chaos, diese Zerstörung beseitigt werden. Aus der Welt geschafft, so gut wie möglich zumindest. Ansonsten hätten uns die Braunen besiegt, und das könnte ich nicht ertragen.«
»Was wird, werden wir in den nächsten Tagen sehen«, sagte Josefine. »Jetzt solltet ihr ins Bett gehen und versuchen zu schlafen.«
Die Mädchen nickten. Arm in Arm gingen sie in Ritas Zimmer. Sie zogen sich aus, suchten aus den Taschen und Koffern, die sie mitgebracht hatten, Nachtwäsche heraus.
»Ich habe die Zahnbürsten vergessen« sagte Ruth entsetzt. »Wir haben keine Zahnbürsten …«
»Hier.« Tante Finchen stand in der Tür und hielt ihr zwei neue Zahnbürsten hin. »Ich hatte noch welche. Ich habe immer einige auf Vorrat – noch aus der Zeit, als Hans mit eurem Vater auf Reisen war, er hat immer seine in den Pensionen vergessen.«
»Danke«, sagte Ruth. Sie und Ilse gingen in das kleine Bad, machten sich nachtfertig.
»Geh du schon ins Bett, ich komme gleich«, sagte Ruth zu Ilse, als sie im Bad fertig waren.
»Du kommst wirklich?«, fragte Ilse ängstlich.
»Wenn ich es doch sage. Nun geh schon. Ich möchte nur noch etwas mit Tante Finchen besprechen.«
»Dann ist ja gut.«
Ruth ging in die Küche, wo Josefine am Küchentisch saß. Das Radio lief, aber so leise, dass man kaum etwas verstehen konnte.
»Haben sie etwas gesagt?«, fragte Ruth und zeigte auf das Radiogerät.
»Nur Lügen. Hans sagt immer, dass das Radio nur Propaganda verbreitet. Das große Sprachrohr der Nazis. Und ich befürchte, er hat recht. Sie berichten von vereinzelten Ausschreitungen, ohne zu erwähnen, dass die Synagogen brannten. Ich habe von etlichen Leuten gehört, dass es auch in Moers, Neuss, Düsseldorf und Köln zu Ausschreitungen gekommen ist. Man weiß nichts Genaues, aber vermutlich wird es überall so gewesen sein wie hier.« Sie sah Ruth an. »Es tut mir so leid, Liebes.«
»Wir sollten nicht bei euch sein«, sagte Ruth leise. »Ihr seid keine Juden, aber ihr werdet durch uns mit in den Schlamassel hineingezogen, und vielleicht werdet ihr dafür büßen müssen.«
»O nein, Ruth, so darfst du nicht denken. Ohne deinen Vater wären wir damals verloren gewesen. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, mein Liebes, die andere Seite seid ihr – ihr als Personen, als Menschen, als Freunde, die ihr für uns geworden seid. Ich habe das nicht nur so dahingesagt – du bist fast wie eine Tochter für mich. Ihr beide. Ich könnte euch doch niemals in solch einer Situation wegschicken. Niemals! Wir müssen füreinander da sein und die Menschlichkeit bewahren.«
Ruth biss sich auf die Lippen. »Was wird werden, Tante Finchen? Wie soll unser Leben weitergehen?«
»Ich weiß es nicht, Liebes. Ich weiß es wirklich nicht.«
Sie sahen sich lange an, beide wussten, dass die Zukunft ungewiss war.
»Versuch zu schlafen, Ruth. Und sei für Ilse da.«
»Danke, dass wir hier sein dürfen.«
»Ich nehme deinen Dank an – jetzt, ein einziges Mal. Und dann ist es gut. Ihr seid hier. Basta. Und über Dank wird nicht mehr gesprochen.«
Ruth nickte. »Dank … ja. Gute Nacht.« Ein kleines Lächeln schlich sich auf ihre Lippen, obwohl Ruth gedacht hatte, dass sie nie wieder lächeln könnte. Vielleicht hatte sie sich getäuscht. Nachdenklich ging sie in das Kinderzimmer. Ilse lag schon im Bett, schlief aber noch nicht.
»Du musst morgen zu Mutti gehen«, sagte Ilse.
»Es gibt so viel im Haus zu tun …«
»Ja, aber du musst dennoch mit zu Mutti. Bitte. Ich kann das nicht allein. Es war so schrecklich, sie hat nur geweint und wirre Sachen gesagt.«
»Was für wirre Sachen?« Den Gedanken an die Mutter hatte Ruth den ganzen Tag immer wieder von sich weggeschoben, es war zu viel für sie.
»Sie jammerte und sagte, es wäre besser, gar nicht mehr zu leben, als hier und …« Ilse sah Ruth an, die Hilflosigkeit malte bleiche Schatten in ihr Gesicht. »Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.«
»Gar nichts, Kleines.« Ruth setzte sich auf das Bett und sah ihre Schwester an. »Mit Muttis Nerven ist es nicht gut bestellt, das weißt du ja, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen.«
»Trotzdem musst du mitkommen morgen. Versprich es mir«, flehte Ilse sie an.
»Ja, natürlich. Ich komme mit«, sagte Ruth und hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch. »Aber jetzt müssen wir schlafen.«
»Gute Nacht, Ruth«, sagte Ilse und drückte ihre Puppe an sich, die sie schon gestern mitgenommen hatte – sie war weder nass noch beschädigt, nur alt. Und sie roch so herrlich nach zu Hause. Ilse schnupperte an ihren Haaren, dann nahm sie Ritas Teddybär in den anderen Arm, schloss die Augen und schlief ein.
Sie ist noch so wunderbar unschuldig, dachte Ruth und schlüpfte in das Behelfsbett, das aber eine warme Decke hatte und überraschend bequem war. Obwohl jeder Knochen in ihrem Körper schmerzte und sie mehr Muskeln als jemals zuvor zu haben schien, die sich nun bemerkbar machten, konnte sie nicht in den Schlaf finden. Immer wieder döste sie ein, aber dann waren da die Bilder von ihrem mutwillig zerstörten Zuhause, das verzweifelte Gesicht ihres Vaters.
Spät in der Nacht hörte sie, wie Onkel Hans endlich wiederkam. Tante Finchen war aufgeblieben und hatte auf ihn gewartet.
»Ich koche dir einen Tee«, hörte sie sie sagen.
»Nein. Ich nehme einen Schnaps, und dann muss ich ins Bett.«
»Du siehst furchtbar aus.« Das war Finchens leise, aber eindringliche Stimme.
Ruth rutschte ein wenig näher zum Türspalt. Sie wusste, es gehörte sich nicht zu lauschen, aber vielleicht hatte Onkel Hans ja neue Informationen.
»Uns geht es gut«, sagte er gerade. »Uns geht es wirklich gut, Finchen. Wenn wir Juden wären, würde ich zusehen, dass wir unseren Boppes aus dem Land bekommen – egal wie. Denn eins ist sicher, sie werden hier nicht mehr glücklich werden. Es ist eine verdammte Schande.« Seine Stimme wurde lauter.
»Pst«, zischte Josefine. »Wenn dich jemand hört?«
»Ist mir egal! Es ist doch nicht zu fassen, was man ihnen angetan hat.«
»Mir ist es aber nicht egal!«, sagte Josefine mit Nachdruck. »Willst du auch in ein Konzentrationslager kommen? Nach Dachau? So wie Frank Müller? Ihn haben sie mitgenommen, weil er lauthals gegen die Braunen geschimpft hat. Drei Monate war er in Dachau – seitdem ist er ein gebrochener Mann.« Sie atmete tief ein. »Du darfst deine Meinung haben. Und ich teile sie ja auch, wie du weißt – aber du darfst sie nicht laut äußern. Jetzt nicht mehr. Schon seit dreiunddreißig nicht mehr. Damals haben sie doch schon angefangen, alle mundtot zu machen, wenn nicht gar Schlimmeres. Du kennst doch die Situation, du weißt doch, wie gefährlich es ist.«
»Aber man kann es doch nicht so hinnehmen.«
»Das tun wir ja auch nicht. Wir helfen, wir sind da. Aber wir müssen an Helmuth und Rita denken. Wenn wir beide nach Dachau kommen, was wird dann aus den Kindern?«
Hans Aretz schwieg betroffen, dann räusperte er sich. »Du hast ja recht. Wir müssen vor allem an sie denken. Die Zeiten, in denen man politisch etwas hätte tun können, sind vorbei. Aber dennoch gibt es Wege, um da zu sein, zu helfen, aber auch um unseren Standpunkt zu zeigen. Und das müssen wir machen – gerade für unsere Kinder. Was sollen sie denn später von uns denken? Du und ich, wir waren noch nie Duckmäuser. Wir hatten und haben unsere Einstellung. Und zeigen sie auch.«
»Das stimmt. Aber was willst du denn tun?«, fragte Josefine, ihre Stimme klang verzweifelt.
»Wir können im Kleinen helfen. Im Moment bedeutet das, dass wir weiterhin für die Meyers da sind – für Karl und Martha und die Mädchen.«
Nun schwieg Josefine für einen Moment. »Meinst du das ernst?«, fragte sie dann leise.
Ruth, die ihr Ohr an die Türspalte gepresst hatte, kniff die Augen zusammen, versuchte die Tränen der Enttäuschung zurückzuhalten. Alles und jeder hatte sich gegen sie verschworen. Wenn Josefine so dachte, dann konnten sie nicht hierbleiben. Keine Minute könnten sie länger hierbleiben. Aber wo sollten sie nun, mitten in der Nacht, noch hin? Das elende Gefühl, allen ausgeliefert, auf Hilfe angewiesen zu sein, machte sie mutlos. Sie kannte dieses Gefühl bisher nicht. Hier, hier bei den Aretz, hatte sie den letzten sicheren Unterschlupf erhofft und auch fest daran geglaubt, doch Josefines Worte hatten sie eines Besseren belehrt.
»Meinst du das wirklich ernst?«, fragte Josefine erneut, ihre Stimme klang entrüstet. »Den Meyers zu helfen ist keine, aber auch gar keine Geste, kein politisches Zeichen oder sonst etwas. Die Meyers sind ein Teil unserer Familie. Dass Ruth und Ilse hier sind, ist mehr als selbstverständlich«, ihre Stimme wurde lauter. »Die Meyers sind unsere Freunde. Karl hat dich aus dem Dreck gezogen. Ohne ihn wären wir nicht hier. Wage nie wieder, ein Engagement für die Meyers mit einer politischen Tat gleichzusetzen.«
Ruth sackte in sich zusammen. Tränen der Erleichterung liefen ihr über die Wangen. Zitternd schlich sie zurück auf das Behelfsbett und betete. Lange schon hatte sie nicht mehr gebetet. Ihre Familie war zwar jüdisch und ging am Sabbat in die Synagoge – aber nur Mutti folgte dem Gottesdienst. Vati ging mit, um andere zu treffen und mit ihnen zu diskutieren, und auch Ruth und Ilse standen lieber im Vorhof mit den anderen Jugendlichen, als dem Gottesdienst von der Empore aus zu lauschen.
Jetzt aber, das spürte sie deutlich, war die Zeit, um zu beten. Und auch die Zeit, um zu danken. Die Aretz waren keine Juden, aber Gott musste sie geschickt haben. Josefine lehnte sie nicht ab, wie Ruth bei ihren ersten Worten gedacht hatte. Im Gegenteil – die Aretz würden für sie da sein. Was für ein Glück.