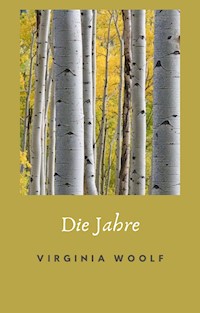
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Diese Ausgabe ist einzigartig;
- Die Übersetzung ist vollständig original und wurde für das Ale. Mar. SAS;
- Alle Rechte vorbehalten.
The Years ist ein Roman von Virginia Woolf aus dem Jahr 1937 und war der letzte Roman, der zu ihren Lebzeiten veröffentlicht wurde. Nur 4 Jahre später würde sie sich das Leben nehmen, nachdem sie seit ihrer Jugend an psychischen Problemen litt. The Years" erzählt die Geschichte der Familie Pargiter über einen Zeitraum von fünfzig Jahren und konzentriert sich dabei auf die Details im Leben der Figuren. Die meisten Abschnitte des Buches finden an einem einzigen Tag in einem Jahr statt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1880
1891
1907
1908
1910
1911
1913
1914
1917
1918
Gegenwart
Die Jahre
VIRGINIA WOOLF
1937
Übersetzung 2021 edition by Ale. Mar.
Alle Rechte vorbehalten
1880
Es war ein unsicherer Frühling. Das Wetter, das ständig wechselte, schickte blaue und violette Wolken über das Land. Auf dem Land blickten die Bauern besorgt auf die Felder, in London wurden Regenschirme aufgespannt und wieder geschlossen, wenn die Menschen zum Himmel schauten. Aber im April war ein solches Wetter zu erwarten. Tausende von Verkäufern machten diese Bemerkung, als sie Damen in Volantkleidern, die auf der anderen Seite des Ladentisches bei Whiteley's und den Army and Navy Stores standen, ordentliche Pakete überreichten. Ununterbrochene Prozessionen von Käufern im West End, von Geschäftsleuten im East End, zogen über die Bürgersteige, wie Karawanen, die unaufhörlich marschierten - so schien es denjenigen, die irgendeinen Grund hatten, innezuhalten, zum Beispiel, um einen Brief aufzugeben, oder an einem Clubfenster in Piccadilly. Der Strom von Landaus, Victorias und Droschken war unaufhörlich; denn die Saison begann. In den ruhigeren Straßen trugen Musiker ihre zerbrechlichen und meist melancholischen Klänge vor, die hier in den Bäumen des Hyde Park, hier in St. James's vom Zwitschern der Spatzen und den plötzlichen Ausbrüchen der verliebten, aber unregelmäßig auftretenden Drossel widerhallten oder parodiert wurden. Die Tauben auf den Plätzen schlurften in den Baumwipfeln, ließen den einen oder anderen Zweig fallen und krähten immer wieder das Schlaflied, das immer wieder unterbrochen wurde. Die Tore am Marble Arch und am Apsley House wurden am Nachmittag von Damen in vielfarbigen Kleidern mit Bustles und von Herren in Gehröcken, die Stöcke trugen, mit Nelken verstopft. Hier kam die Prinzessin, und als sie vorbeikam, wurden Hüte gelüftet. In den Kellern der langen Alleen der Wohnquartiere bereiteten Dienstmädchen in Mütze und Schürze den Tee zu. Geschickt stieg man aus dem Keller hinauf, stellte die silberne Teekanne auf den Tisch, und Jungfrauen und Jungfern mit Händen, die die Wunden von Bermondsey und Hoxton gestopft hatten, maßen sorgfältig einen, zwei, drei, vier Löffel voll Tee ab. Wenn die Sonne unterging, öffneten sich in ihren Glaskäfigen eine Million kleiner Gaslaternen, die wie die Augen in Pfauenfedern geformt waren, aber dennoch blieben weite Strecken der Dunkelheit auf dem Bürgersteig zurück. Das gemischte Licht der Lampen und der untergehenden Sonne spiegelte sich gleichermaßen in den ruhigen Gewässern des Round Pond und der Serpentine. Ausgehende Gäste, die in Droschken über die Brücke trabten, blickten einen Moment lang auf den reizvollen Anblick. Endlich ging der Mond auf, und seine polierte Münze leuchtete, obwohl sie ab und zu von Wolkenfetzen verdeckt wurde, mit Gelassenheit, mit Strenge oder vielleicht mit völliger Gleichgültigkeit. Langsam drehend, wie die Strahlen eines Suchscheinwerfers, zogen die Tage, die Wochen, die Jahre einer nach dem anderen über den Himmel.
Oberst Abel Pargiter saß nach dem Mittagessen in seinem Club und unterhielt sich. Da seine Gefährten in den Ledersesseln Männer seines Typs waren, Männer, die Soldaten, Beamte gewesen waren, Männer, die jetzt im Ruhestand waren, ließen sie mit alten Witzen und Geschichten ihre Vergangenheit in Indien, Afrika, Ägypten wieder aufleben, und dann, durch einen natürlichen Übergang, wandten sie sich der Gegenwart zu. Es ging um eine Ernennung, um eine mögliche Ernennung.
Plötzlich beugte sich der Jüngste und Stämmigste der drei nach vorne. Gestern hatte er zu Mittag gegessen mit . . . Hier verstummte die Stimme des Sprechers. Die anderen beugten sich zu ihm; mit einer kurzen Handbewegung entließ Oberst Abel den Diener, der gerade die Kaffeetassen abräumte. Die drei glatzköpfigen und gräulichen Köpfe blieben einige Minuten lang dicht beieinander. Dann warf sich Oberst Abel in seinem Stuhl zurück. Der neugierige Glanz, der in all ihre Augen gekommen war, als Major Elkin seine Geschichte begann, war völlig aus Oberst Pargiters Gesicht verschwunden. Er saß da und starrte vor sich hin, mit hellen blauen Augen, die ein wenig verschraubt schienen, als sei das grelle Licht des Ostens noch in ihnen; und an den Augenwinkeln waren sie gerunzelt, als sei der Staub noch in ihnen. Irgendein Gedanke war ihm gekommen, der das, was die anderen sagten, für ihn uninteressant machte, ja, es war ihm unangenehm. Er stand auf und schaute aus dem Fenster hinunter auf den Piccadilly. Er hielt seine Zigarre in der Schwebe und blickte auf die Dächer von Omnibussen, Droschken, Victorias, Vans und Landaus hinunter. Er war raus aus allem, schien seine Haltung zu sagen; er hatte nicht mehr die Finger im Spiel. Schwermut legte sich auf sein rotes, hübsches Gesicht, während er so dastand und starrte. Plötzlich kam ihm ein Gedanke in den Sinn. Er hatte eine Frage zu stellen; er drehte sich um, um sie zu stellen, aber seine Freunde waren weg. Die kleine Gruppe hatte sich aufgelöst. Elkins war bereits durch die Tür geeilt; Brand hatte sich entfernt, um mit einem anderen Mann zu sprechen. Oberst Pargiter hielt sich den Mund zu, was er hätte sagen können, und wandte sich wieder dem Fenster zu, das den Piccadilly überblickte. Jeder in der belebten Straße, so schien es, hatte irgendein Ziel vor Augen. Jeder hatte es eilig, irgendeine Verabredung einzuhalten. Selbst die Damen in ihren Viktorien und Kutschen trabten den Piccadilly hinunter, um irgendeine Besorgung zu machen. Die Leute kamen zurück nach London; sie richteten sich für die Saison ein. Aber für ihn würde es keine Saison geben; für ihn gab es nichts zu tun. Seine Frau lag im Sterben; aber sie starb nicht. Heute ging es ihr besser, morgen würde es ihr schlechter gehen; eine neue Krankenschwester war im Anmarsch; und so ging es weiter. Er nahm eine Zeitung in die Hand und blätterte die Seiten um. Er sah sich ein Bild der Westfassade des Kölner Doms an. Er warf die Zeitung zurück an ihren Platz zwischen die anderen Papiere. Eines Tages - das war sein Euphemismus für die Zeit, wenn seine Frau tot war - würde er London aufgeben, dachte er, und auf dem Lande leben. Aber dann war da das Haus; dann waren da die Kinder; und da war auch ... sein Gesicht veränderte sich; es wurde weniger unzufrieden, aber auch ein wenig verstohlen und unruhig.
Er musste ja schließlich irgendwo hin. Während sie tratschten, hatte er diesen Gedanken im Hinterkopf behalten. Als er sich umdrehte und feststellte, dass sie weg waren, war das der Balsam, den er auf seine Wunde klatschte. Er würde zu Mira gehen; zumindest Mira würde sich freuen, ihn zu sehen. Als er den Klub verließ, wandte er sich also nicht nach Osten, wo die geschäftigen Männer hingingen, und auch nicht nach Westen, wo sein eigenes Haus in der Abercorn Terrace lag, sondern nahm seinen Weg über die harten Pfade durch den Green Park in Richtung Westminster. Das Gras war sehr grün; die Blätter begannen zu sprießen; kleine grüne Krallen, wie die Krallen der Vögel, schoben sich aus den Zweigen heraus; es gab überall ein Funkeln, eine Belebung; die Luft roch sauber und lebhaft. Aber Oberst Pargiter sah weder das Gras noch die Bäume. Er marschierte durch den Park, in seinem eng geknöpften Mantel, den Blick geradeaus gerichtet. Doch als er nach Westminster kam, blieb er stehen. Dieser Teil der Angelegenheit gefiel ihm überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn er sich der kleinen Straße näherte, die unter der riesigen Masse der Abtei lag, der Straße mit den schmuddeligen kleinen Häusern mit den gelben Vorhängen und den Karten in den Fenstern, der Straße, in der der Muffin-Mann immer zu klingeln schien, in der die Kinder schrien und zwischen den weißen Kreidestrichen auf dem Bürgersteig hin und her hüpften, hielt er inne, schaute nach rechts, schaute nach links; und dann ging er sehr scharf zu Nummer dreißig und klingelte. Er starrte direkt auf die Tür, während er mit gesenktem Kopf wartete. Er wollte nicht auf der Türschwelle stehend gesehen werden. Er mochte es nicht, darauf zu warten, hereingelassen zu werden. Er mochte es nicht, wenn Frau Sims ihn hereinließ. Es roch immer im Haus, und im Garten hingen immer schmutzige Kleider auf der Leine. Er ging die Treppe hinauf, mürrisch und schwer, und betrat das Wohnzimmer.
Niemand war da; er war zu früh dran. Er schaute sich mit Widerwillen im Zimmer um. Es standen zu viele kleine Gegenstände herum. Er fühlte sich fehl am Platz und viel zu groß, als er aufrecht vor dem drapierten Kamin stand, vor einem Paravent, auf dem ein Eisvogel gemalt war, der sich gerade auf ein paar Binsen niederließ. Auf dem Boden darüber huschten Schritte hin und her. War da jemand bei ihr? fragte er sich lauschend. Draußen schrien Kinder auf der Straße. Es war schäbig; es war gemein; es war heimlich. Eines Tages, sagte er zu sich selbst ... aber die Tür öffnete sich und seine Geliebte, Mira, kam herein.
"Oh Bogy, mein Lieber!" rief sie aus. Ihr Haar war sehr unordentlich; sie sah ein wenig flauschig aus; aber sie war sehr viel jünger als er und wirklich froh, ihn zu sehen, dachte er. Der kleine Hund hüpfte an ihr hoch.
"Lulu, Lulu", rief sie und fing den kleinen Hund mit einer Hand auf, während sie die andere an ihr Haar legte, "komm und lass dich von Onkel Bogy anschauen."
Der Colonel setzte sich in den knarrenden Korbstuhl. Sie setzte den Hund auf sein Knie. Hinter einem seiner Ohren war ein roter Fleck - wahrscheinlich ein Ekzem. Der Colonel setzte seine Brille auf und beugte sich hinunter, um das Ohr des Hundes zu betrachten. Mira küsste ihn dort, wo sein Kragen auf seinen Hals traf. Dann fiel seine Brille herunter. Sie schnappte sie sich und setzte sie dem Hund auf. Der alte Knabe war heute nicht bei Sinnen, spürte sie. In dieser geheimnisvollen Welt der Clubs und des Familienlebens, von der er ihr nie erzählte, stimmte etwas nicht. Er war gekommen, bevor sie sich die Haare gemacht hatte, was ein Ärgernis war. Aber es war ihre Pflicht, ihn abzulenken. So huschte sie - ihre immer größer werdende Figur erlaubte ihr immer noch, zwischen Tisch und Stuhl hin und her zu gleiten - hin und her; sie entfernte den Kaminschirm und zündete, bevor er sie aufhalten konnte, das widerspenstige Herbergsfeuer an. Dann hockte sie sich auf die Armlehne seines Stuhls.
"Oh, Mira", sagte sie, betrachtete sich im Spiegel und schob ihre Haarnadeln hin und her, "was bist du doch für ein schrecklich unordentliches Mädchen!" Sie löste eine lange Locke und ließ sie über ihre Schultern fallen. Es war immer noch wunderschönes, goldglänzendes Haar, obwohl sie auf die Vierzig zuging und, wenn man die Wahrheit wüsste, eine achtjährige Tochter hatte, die bei Freunden in Bedford untergebracht war. Das Haar begann von selbst zu fallen, durch sein eigenes Gewicht, und als Bogy es fallen sah, bückte er sich und küsste ihr Haar. Eine Drehorgel hatte auf der Straße zu spielen begonnen, und die Kinder eilten alle in diese Richtung, so dass eine plötzliche Stille entstand. Der Oberst begann, ihren Hals zu streicheln. Er begann mit der Hand, die zwei Finger verloren hatte, etwas weiter unten zu fummeln, dort, wo der Hals in die Schultern übergeht. Mira rutschte auf den Boden und lehnte sich mit dem Rücken gegen sein Knie.
Dann war ein Knarren auf der Treppe zu hören; jemand klopfte, als wolle er sie vor ihrer Anwesenheit warnen. Mira steckte sogleich ihr Haar zusammen, stand auf und schloss die Tür.
Der Colonel begann in seiner methodischen Art, die Ohren des Hundes erneut zu untersuchen. War es ein Ekzem? oder war es kein Ekzem? Er betrachtete den roten Fleck, dann stellte er den Hund auf die Beine in den Korb und wartete. Das andauernde Flüstern auf dem Treppenabsatz draußen gefiel ihm nicht. Endlich kam Mira zurück; sie sah besorgt aus; und wenn sie besorgt aussah, sah sie alt aus. Sie begann, unter Kissen und Decken herumzuwühlen. Sie wollte ihre Tasche, sagte sie; wo hatte sie ihre Tasche hingestellt? In diesem Wust von Dingen, dachte der Colonel, könnte sie überall sein. Es war eine magere, armselig aussehende Tasche, als sie sie unter den Kissen in der Ecke des Sofas fand. Sie drehte sie auf den Kopf. Taschentücher, zerknüllte Papierschnipsel, Silber und Münzen fielen heraus, als sie sie schüttelte. Aber da hätte ein Sovereign drin sein müssen, sagte sie. "Ich bin sicher, ich hatte gestern einen", murmelte sie.
"Wie viel?", fragte der Colonel.
Es kam auf ein Pfund - nein, es kam auf ein Pfund acht und sechs Pence, sagte sie und murmelte etwas über die Wäsche. Der Oberst holte zwei Sovereigns aus seinem kleinen Goldkoffer und gab sie ihr. Sie nahm sie, und auf dem Treppenabsatz wurde weiter geflüstert.
"Waschen . . . ?", dachte der Colonel und sah sich im Zimmer um. Es war ein schmuddeliges kleines Loch; aber da sie so viel älter war als sie, war es nicht angebracht, Fragen über die Wäsche zu stellen. Da war sie wieder. Sie huschte durch den Raum, setzte sich auf den Boden und legte ihren Kopf gegen sein Knie. Das widerwillige Feuer, das schwach geflackert hatte, war nun erloschen. "Lass es sein", sagte er ungeduldig, als sie den Schürhaken aufnahm. "Lass es ausgehen." Sie legte den Schürhaken nieder. Der Hund schnarchte; die Drehorgel spielte. Seine Hand begann ihre Reise den Hals hinauf und hinunter, in das lange dichte Haar hinein und wieder heraus. In diesem kleinen Zimmer, so nahe an den anderen Häusern, kam die Dämmerung schnell; und die Vorhänge waren halb zugezogen. Er zog sie an sich; er küsste sie auf den Nacken; und dann begann die Hand, die zwei Finger verloren hatte, etwas tiefer unten zu fummeln, wo der Hals in die Schultern übergeht.
Ein plötzlicher Regenschauer prasselte auf das Pflaster, und die Kinder, die in ihren Kreidekäfigen hin und her hüpften, flitzten nach Hause. Der ältere Straßensänger, der am Bordstein entlang geschwankt war, die Fischermütze munter auf dem Hinterkopf, sang lustvoll "Count your blessings, Count your blessings...", schlug den Mantelkragen hoch und flüchtete sich unter den Laubengang eines Gasthauses, wo er seine Aufforderung beendete: "Count your blessings, Count your blessings. Every One." Dann schien die Sonne wieder; und trocknete das Pflaster.
"Er kocht nicht", sagte Milly Pargiter und schaute auf den Teekessel. Sie saß an dem runden Tisch im vorderen Salon des Hauses in der Abercorn Terrace. "Nicht annähernd kochend", wiederholte sie. Der Kessel war ein altmodischer Messingkessel mit einem Rosenmuster, das schon fast verblasst war. Eine schwache kleine Flamme flackerte unter der Messingschale auf und ab. Ihre Schwester Delia, die sich in einem Stuhl neben ihr zurücklehnte, beobachtete es ebenfalls. "Muss ein Kessel kochen?", fragte sie nach einem Moment müßig, als ob sie keine Antwort erwartete, und Milly antwortete nicht. Sie saßen schweigend da und beobachteten die kleine Flamme auf einem gelben Dochtbüschel. Es standen viele Teller und Tassen herum, als ob andere Leute kämen; aber im Augenblick waren sie allein. Der Raum war voll von Möbeln. Ihnen gegenüber stand ein holländischer Schrank mit blauem Porzellan in den Regalen; die Sonne des Aprilabends machte hier und da einen hellen Fleck auf dem Glas. Über dem Kamin lächelte das Porträt einer rothaarigen jungen Frau in weißem Musselin, die einen Korb mit Blumen auf dem Schoß hielt, auf sie herab.
Milly nahm eine Haarnadel vom Kopf und begann, den Docht in einzelne Stränge zu zerfasern, um die Flamme zu vergrößern.
"Aber das bringt doch nichts", sagte Delia gereizt, während sie sie beobachtete. Sie zappelte. Alles schien eine so unerträgliche Zeit in Anspruch zu nehmen. Dann kam Crosby herein und fragte, ob sie den Kessel in der Küche zum Kochen bringen solle, und Milly sagte Nein. Wie kann ich diesem Gezappel und Gefummel ein Ende setzen, sagte sie zu sich selbst, klopfte mit einem Messer auf den Tisch und betrachtete die schwache Flamme, die ihre Schwester mit einer Haarnadel neckte. Eine Mückenstimme begann unter dem Kessel zu heulen; aber da platzte die Tür wieder auf und ein kleines Mädchen in einer steifen rosa Kutte kam herein.
"Ich glaube, die Krankenschwester hätte dir eine saubere Schürze anziehen sollen", sagte Milly streng und imitierte das Verhalten einer erwachsenen Person. Auf ihrer Schürze war ein grüner Fleck, als ob sie auf Bäume geklettert wäre.
"Es war noch nicht aus der Wäsche gekommen", sagte Rose, das kleine Mädchen, mürrisch. Sie schaute auf den Tisch, aber von Tee war noch nicht die Rede.
Milly setzte ihre Haarnadel wieder an den Docht an. Delia lehnte sich zurück und blickte über ihre Schulter aus dem Fenster. Von dort, wo sie saß, konnte sie die Stufen der Haustür sehen.
"Nun, da ist Martin", sagte sie düster. Die Tür schlug zu; Bücher wurden auf den Flurtisch geklatscht, und Martin, ein Junge von zwölf Jahren, kam herein. Er hatte das rote Haar der Frau auf dem Bild, aber es war zerknittert.
"Geh und mach dich zurecht", sagte Delia streng. "Du hast noch viel Zeit", fügte sie hinzu. "Der Kessel kocht noch nicht."
Sie alle schauten auf den Kessel. Er hielt immer noch seinen leisen, melancholischen Gesang aufrecht, während die kleine Flamme unter der schwingenden Messingschale flackerte.
"Verdammt, der Kessel", sagte Martin und wandte sich scharf ab.
"Mama würde es nicht mögen, wenn du dich so ausdrücken würdest", tadelte Milly ihn wie in der Nachahmung einer älteren Person; denn ihre Mutter war so lange krank gewesen, dass beide Schwestern sich angewöhnt hatten, ihre Art mit den Kindern zu imitieren. Die Tür öffnete sich wieder.
"Das Tablett, Miss ...", sagte Crosby und hielt die Tür mit dem Fuß offen. Sie hatte ein Invalidentablett in den Händen.
"Das Tablett", sagte Milly. "Und wer nimmt jetzt das Tablett auf?" Wieder ahmte sie die Art einer älteren Person nach, die taktvoll mit Kindern umgehen möchte.
"Nicht du, Rose. Es ist zu schwer. Laß Martin es tragen; und du kannst mit ihm gehen. Aber bleib nicht hier. Sag Mama, was du gemacht hast, und dann den Kessel... den Kessel... . ."
Hier setzte sie ihre Haarnadel wieder an den Docht an. Ein dünner Dampfstoß trat aus der schlangenförmigen Tülle aus. Zuerst nur stoßweise, wurde er allmählich immer stärker, bis, gerade als sie Schritte auf der Treppe hörten, ein einziger kräftiger Dampfstrahl aus der Tülle kam.
"Es ist kochend heiß!" Milly rief aus. "Es ist kochend heiß!"
Sie aßen schweigend. Die Sonne schien, den wechselnden Lichtern auf dem Glas der holländischen Vitrine nach zu urteilen, ein und aus zu gehen. Manchmal leuchtete eine Schale tiefblau; dann wurde sie fahl. Lichter ruhten heimlich auf den Möbeln im anderen Raum. Hier war ein Muster; hier war eine kahle Stelle. Irgendwo gibt es Schönheit, dachte Delia, irgendwo gibt es Freiheit, und irgendwo, dachte sie, ist er - und trägt seine weiße Blume. . . . Aber ein Stock knirschte im Flur.
"Es ist Papa!" rief Milly warnend aus.
Augenblicklich zappelte Martin aus dem Sessel seines Vaters; Delia setzte sich aufrecht hin. Milly schob sofort eine sehr große, mit Rosen besprenkelte Tasse vor, die nicht zu den anderen passte. Der Colonel stand an der Tür und musterte die Gruppe ziemlich grimmig. Seine kleinen blauen Augen blickten um sie herum, als wollten sie einen Fehler finden; im Moment gab es keinen besonderen Fehler zu finden; aber er war außer sich; sie wussten sofort, bevor er sprach, dass er außer sich war.
"Dreckiger kleiner Rüpel", sagte er und kniff Rose ins Ohr, als er an ihr vorbeiging. Sie legte sofort ihre Hand über den Fleck auf ihrer Schürze.
"Geht es Mama gut?", sagte er und ließ sich in einer festen Masse in den großen Sessel fallen. Er verabscheute Tee; aber er nippte immer ein wenig aus der großen alten Tasse, die seinem Vater gehört hatte. Er hob sie an und nippte oberflächlich.
"Und was habt ihr so getrieben?", fragte er.
Er sah sich mit dem rauchigen, aber scharfsinnigen Blick um, der freundlich sein konnte, aber jetzt mürrisch war.
"Delia hatte ihre Musikstunde, und ich bin zu Whiteley gegangen -", begann Milly, eher als wäre sie ein Kind, das eine Lektion aufsagt.
"Geld ausgeben, wie?", sagte ihr Vater scharf, aber nicht unfreundlich.
"Nein, Papa; ich habe es dir gesagt. Sie haben die falschen Laken geschickt..."
"Und du, Martin?" fragte Oberst Pargiter und unterbrach die Aussage seiner Tochter. "Klassenletzter wie immer?"
"Oben!", rief Martin und stieß das Wort aus, als hätte er es bis zu diesem Augenblick mühsam zurückgehalten.
"Hm - was du nicht sagst", sagte sein Vater. Seine Düsternis lockerte sich ein wenig. Er griff in seine Hosentasche und holte eine Handvoll Silber heraus. Seine Kinder sahen ihm zu, wie er versuchte, aus all den Gulden einen Sechspence herauszufischen. Er hatte während der Meuterei zwei Finger der rechten Hand verloren, und die Muskeln waren geschrumpft, so dass die rechte Hand der Klaue eines alten Vogels glich. Er schlurfte und fummelte; aber da er die Verletzung immer ignorierte, wagten seine Kinder nicht, ihm zu helfen. Die glänzenden Knubbel der verstümmelten Finger faszinierten Rose.
"Bitte sehr, Martin", sagte er schließlich und reichte seinem Sohn den Sixpence. Dann nippte er wieder an seinem Tee und wischte sich den Schnurrbart.
"Wo ist Eleanor?", sagte er schließlich, als wolle er das Schweigen brechen.
"Es ist ihr Grove-Tag", erinnerte Milly ihn.
"Oh, ihr Grove-Tag", murmelte der Colonel. Er rührte den Zucker in der Tasse hin und her, als wolle er ihn zertrümmern.
"Die lieben alten Levys", sagte Delia zaghaft. Sie war seine Lieblingstochter; aber sie fühlte sich unsicher, wie viel sie in seiner gegenwärtigen Stimmung wagen konnte.
Er sagte nichts.
"Bertie Levy hat sechs Zehen an einem Fuß", meldete sich Rose plötzlich. Die anderen lachten. Aber der Colonel unterbrach sie.
"Du beeilst dich und gehst zu deiner Vorbereitung, mein Junge", sagte er und schaute Martin an, der immer noch aß.
"Lass ihn seinen Tee austrinken, Papa", sagte Milly und ahmte wieder die Art eines älteren Menschen nach.
"Und die neue Krankenschwester?", fragte der Colonel und trommelte auf die Tischkante. "Ist sie gekommen?"
"Ja ..." Milly begann. Aber es raschelte in der Halle, und Eleanor kam herein. Das war sehr zu ihrer Erleichterung; besonders zu der von Milly. Gott sei Dank, da ist Eleanor, dachte sie und blickte auf - die Schnullerin, die Streitschlichterin, der Puffer zwischen ihr und den Intensitäten und Streitigkeiten des Familienlebens. Sie verehrte ihre Schwester. Sie hätte sie Göttin genannt und sie mit einer Schönheit ausgestattet, die nicht die ihre war, mit Kleidern, die nicht die ihre waren, wenn sie nicht einen Stapel kleiner gesprenkelter Bücher und zwei schwarze Handschuhe getragen hätte. Beschütze mich, dachte sie und reichte ihr eine Teetasse, ich bin so ein mausgraues, unterdrücktes, unfähiges kleines Ding, verglichen mit Delia, die immer ihren Willen bekommt, während ich immer von Papa brüskiert werde, der aus irgendeinem Grund mürrisch war. Der Colonel lächelte Eleanor an. Und auch der rote Hund auf dem Kamin sah auf und wedelte mit dem Schwanz, als ob er sie für eine dieser zufriedenen Frauen hielt, die einem einen Knochen geben, sich aber danach die Hände waschen. Sie war die älteste der Töchter, etwa zweiundzwanzig, keine Schönheit, aber gesund und, obwohl im Moment müde, von Natur aus fröhlich.
"Tut mir leid, dass ich zu spät bin", sagte sie. "Ich wurde aufgehalten. Und ich habe nicht erwartet ..." Sie sah ihren Vater an.
"Ich habe früher Schluss gemacht, als ich dachte", sagte er hastig. "Das Treffen ...", er hielt kurz inne. Es hatte wieder einen Streit mit Mira gegeben.
"Und wie geht es Ihrem Grove?", fügte er hinzu.
"Oh, mein Grove ...", wiederholte sie; aber Milly reichte ihr die abgedeckte Schale.
"Ich wurde behalten", sagte Eleanor wieder und bediente sich. Sie begann zu essen; die Stimmung hellte sich auf.
"Jetzt erzähl uns, Papa", sagte Delia kühn - sie war seine Lieblingstochter -, "was du mit dir selbst gemacht hast. Hattest du irgendwelche Abenteuer?"
Die Bemerkung war unglücklich.
"Für einen alten Knacker wie mich gibt es keine Abenteuer", sagte der Colonel mürrisch. Er mahlte die Zuckerkörner gegen die Wände seiner Tasse. Dann schien er seine Schroffheit zu bereuen; er dachte einen Moment lang nach.
"Ich habe den alten Burke im Club getroffen; er hat mich gebeten, einen von euch zum Essen mitzubringen; Robin ist zurück, auf Urlaub", sagte er.
Er trank seinen Tee aus. Einige Tropfen fielen auf seinen kleinen Spitzbart. Er nahm sein großes Seidentaschentuch heraus und wischte sich ungeduldig das Kinn ab. Eleanor, die auf ihrem niedrigen Stuhl saß, sah einen neugierigen Blick erst auf Millys, dann auf Delias Gesicht. Sie hatte den Eindruck von Feindseligkeit zwischen den beiden. Aber sie sagten nichts. Sie aßen und tranken weiter, bis der Colonel seine Tasse nahm, sah, dass nichts darin war, und sie mit einem kleinen Klirren abstellte. Die Zeremonie des Teetrinkens war vorbei.
"Und jetzt, mein Junge, zieh dich aus und mach weiter mit deinen Vorbereitungen", sagte er zu Martin.
Martin zog die Hand zurück, die nach einem Teller ausgestreckt war.
"Gehen Sie", sagte der Oberst gebieterisch. Martin stand auf und ging, wobei er mit der Hand widerwillig an den Stühlen und Tischen entlangfuhr, als wolle er seinen Gang verzögern. Er schlug die Tür ziemlich heftig hinter sich zu. Der Colonel erhob sich und stand aufrecht zwischen ihnen in seinem fest zugeknöpften Gehrock.
"Und ich muss auch weg", sagte er. Aber er hielt einen Moment inne, als ob es für ihn nichts Besonderes gäbe, zu dem er aufbrechen müsste. Er stand sehr aufrecht zwischen ihnen, als ob er einen Befehl geben wollte, aber ihm fiel im Moment kein Befehl ein, den er geben konnte. Dann erinnerte er sich.
"Ich wünschte, eine von euch würde sich daran erinnern", sagte er und wandte sich unparteiisch an seine Töchter, "an Edward zu schreiben. . . . Sagt ihm, er soll an Mama schreiben."
"Ja", sagte Eleanor.
Er bewegte sich auf die Tür zu. Aber er blieb stehen.
"Und sag mir Bescheid, wenn Mama mich sehen will", bemerkte er. Dann hielt er inne und kniff seine jüngste Tochter ins Ohr.
"Schmutziger kleiner Rüpel", sagte er und deutete auf den grünen Fleck auf ihrer Schürze. Sie bedeckte ihn mit ihrer Hand. An der Tür hielt er wieder inne.
"Vergessen Sie nicht", sagte er und fummelte an der Klinke, "vergessen Sie nicht, Edward zu schreiben." Endlich hatte er die Klinke umgedreht und war weg.
Sie waren still. Es war etwas angespannt in der Atmosphäre, spürte Eleanor. Sie nahm eines der kleinen Bücher, die sie auf den Tisch hatte fallen lassen, und legte es aufgeschlagen auf ihr Knie. Aber sie sah es nicht an. Ihr Blick richtete sich eher geistesabwesend auf den weiter entfernten Raum. Im hinteren Garten kamen die Bäume heraus; an den Sträuchern hingen kleine Blätter - kleine ohrenförmige Blätter. Die Sonne schien, unbeständig; sie ging ein und ging aus, beleuchtete mal dies, mal das.
"Eleanor", unterbrach Rose. Sie hielt sich auf eine Weise, die der ihres Vaters seltsam ähnlich war.
"Eleanor", wiederholte sie mit leiser Stimme, denn ihre Schwester war nicht anwesend.
"Und?", sagte Eleanor und sah sie an.
"Ich möchte zu Lamley's gehen", sagte Rose.
Sie sah aus wie das Ebenbild ihres Vaters, der mit den Händen hinter dem Rücken dastand.
"Es ist zu spät für Lamley's", sagte Eleanor.
"Die machen erst um sieben zu", sagte Rose.
"Dann frag Martin, ob er mit dir geht", sagte Eleanor.
Das kleine Mädchen entfernte sich langsam in Richtung Tür. Eleanor nahm wieder ihre Kontobücher zur Hand.
"Aber du sollst nicht allein gehen, Rose; du sollst nicht allein gehen", sagte sie und blickte zu ihnen hinauf, als Rose die Tür erreichte. Sie nickte schweigend mit dem Kopf und Rose verschwand.
Sie ging die Treppe hinauf. Vor dem Schlafzimmer ihrer Mutter hielt sie inne und schnupperte an dem säuerlich-süßen Geruch, der von den Krügen, den Bechern, den abgedeckten Schalen auf dem Tisch vor der Tür abzuhängen schien. Sie ging wieder hinauf und blieb vor der Tür des Schulzimmers stehen. Sie wollte nicht hineingehen, denn sie hatte sich mit Martin gestritten. Sie hatten sich erst über Erridge und das Mikroskop gestritten und dann darüber, dass sie Miss Pyms Katzen nebenan erschossen hatten. Aber Eleanor hatte ihr gesagt, sie solle ihn fragen. Sie öffnete die Tür.
"Hallo, Martin...", begann sie.
Er saß an einem Tisch mit einem Buch vor sich und murmelte vor sich hin - vielleicht war es Griechisch, vielleicht war es Latein.
"Eleanor hat mir gesagt ...", begann sie und bemerkte, wie er errötete und wie sich seine Hand um ein Stück Papier schloss, als wolle er es zu einem Ball formen. "Um Sie zu fragen . .", begann sie und stellte sich mit dem Rücken gegen die Tür.
Eleanor lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Die Sonne stand jetzt auf den Bäumen im hinteren Garten. Die Knospen begannen zu schwellen. Das Frühlingslicht brachte natürlich die Schäbigkeit der Stuhlbezüge zum Vorschein. Der große Sessel hatte einen dunklen Fleck an der Stelle, wo ihr Vater seinen Kopf aufgestützt hatte, bemerkte sie. Aber wie viele Stühle es gab - wie geräumig, wie luftig es war nach dem Schlafzimmer, in dem die alte Frau Levy... Aber Milly und Delia schwiegen beide. Sie erinnerte sich an die Frage der Dinnerparty. Wer von ihnen sollte hingehen? Sie wollten beide hingehen. Sie wünschte sich, die Leute würden nicht sagen: "Bringt eine eurer Töchter mit." Sie wünschte, man würde sagen: "Bring Eleanor mit", oder "Bring Milly mit", oder "Bring Delia mit", anstatt sie alle in einen Topf zu werfen. Dann gäbe es keine Frage mehr.
"Nun", sagte Delia abrupt, "ich werde ..."
Sie stand auf, als ob sie irgendwo hingehen würde. Aber sie blieb stehen. Dann schlenderte sie zu dem Fenster hinüber, das auf die Straße hinausblickte. Die Häuser gegenüber hatten alle die gleichen kleinen Vorgärten, die gleichen Treppen, die gleichen Säulen, die gleichen Bogenfenster. Aber jetzt dämmerte es, und sie sahen in dem schwachen Licht gespenstisch und unwirklich aus. Lampen wurden angezündet; ein Licht glühte im Salon gegenüber; dann wurden die Vorhänge zugezogen, und der Raum war wie ausgestorben. Delia stand und schaute auf die Straße hinunter. Eine Frau aus der Unterschicht schob einen Kinderwagen, ein alter Mann wankte mit den Händen hinter dem Rücken. Dann war die Straße leer; es gab eine Pause. Da kam eine Droschke rasselnd die Straße herunter. Delia war einen Moment lang interessiert. Würde es vor ihrer Tür halten oder nicht? Sie schaute aufmerksamer hin. Aber dann, zu ihrem Bedauern, riss der Droschkenkutscher an den Zügeln, das Pferd stolperte weiter; die Droschke hielt zwei Türen weiter unten.
"Da ruft jemand bei den Stapletons an", rief sie zurück und hielt das Musselinrollo auseinander. Milly kam und stellte sich neben ihre Schwester, und gemeinsam sahen sie durch den Schlitz, wie ein junger Mann mit Zylinder aus dem Taxi stieg. Er streckte die Hand aus, um den Fahrer zu bezahlen.
"Lassen Sie sich nicht beim Gucken erwischen", sagte Eleanor warnend. Der junge Mann lief die Treppe hinauf ins Haus; die Tür schloss sich hinter ihm, und das Taxi fuhr davon.
Doch im Moment standen die beiden Mädchen am Fenster und schauten auf die Straße. In den Vorgärten leuchteten die Krokusse gelb und lila. Die Mandelbäume und Liguster waren mit Grün bestückt. Ein plötzlicher Windstoß riss die Straße hinunter und wehte ein Stück Papier über das Pflaster; und ein kleiner Wirbel aus trockenem Staub folgte ihm. Über den Dächern war einer jener roten und unbeständigen Londoner Sonnenuntergänge, die ein Fenster nach dem anderen golden glühen lassen. Der Frühlingsabend hatte etwas Wildes an sich; selbst hier, in der Abercorn Terrace, wechselte das Licht von Gold zu Schwarz, von Schwarz zu Gold. Delia ließ die Jalousie herunter, drehte sich um und kam zurück in den Salon und sagte plötzlich:
"Oh mein Gott!"
Eleanor, die ihre Bücher wieder an sich genommen hatte, blickte beunruhigt auf.
"Acht mal acht ...", sagte sie laut. "Was ist acht mal acht?"
Sie legte ihren Finger auf die Seite, um die Stelle zu markieren, und sah ihre Schwester an. Wie sie da mit zurückgeworfenem Kopf und im Sonnenuntergangslicht rot gefärbtem Haar stand, sah sie einen Moment lang trotzig, ja sogar schön aus. Neben ihr war Milly mausfarben und unscheinbar.
"Schau her, Delia", sagte Eleanor und schlug ihr Buch zu, "du musst nur warten . . ." Sie meinte, aber sie konnte es nicht aussprechen, "bis Mama stirbt."
"Nein, nein, nein", sagte Delia und streckte ihre Arme aus. "Es ist hoffnungslos . ...", begann sie. Aber sie brach ab, denn Crosby war hereingekommen. Sie trug ein Tablett. Mit einem verzweifelten Klirren stellte sie eine nach der anderen die Tassen, die Teller, die Messer, die Marmeladentöpfe, die Kuchenschalen und die Schalen mit Brot und Butter auf das Tablett. Dann balancierte sie es vorsichtig vor sich her und ging hinaus. Es gab eine Pause. Sie kam wieder herein, faltete das Tischtuch zusammen und rückte die Tische. Wieder gab es eine Pause. Ein oder zwei Augenblicke später kam sie zurück und trug zwei Lampen mit Seidenschirm. Sie stellte eine in den vorderen Raum und eine in den hinteren. Dann ging sie, knarrend in ihren billigen Schuhen, zum Fenster und zog die Vorhänge zu. Sie glitten mit einem vertrauten Klicken an der Messingstange entlang, und bald waren die Fenster von dicken, plastischen Falten aus weinrotem Plüsch verdeckt. Als sie die Vorhänge in beiden Zimmern zugezogen hatte, schien eine tiefe Stille über den Salon zu fallen. Die Welt draußen schien dicht und völlig abgeschnitten zu sein. Weit weg in der nächsten Straße hörten sie die Stimme eines Straßenhändlers dröhnen; die schweren Hufe von Lieferwagenpferden trappelten langsam die Straße hinunter. Einen Moment lang knirschten Räder auf der Straße; dann erstarben sie und die Stille war vollkommen.
Zwei gelbe Lichtkreise fielen unter die Lampen. Eleanor zog ihren Stuhl unter einen von ihnen, neigte den Kopf und fuhr mit dem Teil ihrer Arbeit fort, den sie immer bis zum Schluss aufhob, weil sie ihn so sehr verabscheute - das Hinzufügen von Zahlen. Ihre Lippen bewegten sich und ihr Bleistift machte kleine Punkte auf dem Papier, während sie Achten zu Sechsen, Fünfen zu Vieren addierte.
"Da!", sagte sie schließlich. "Das war's. Jetzt gehe ich und setze mich zu Mama."
Sie bückte sich, um ihre Handschuhe aufzuheben.
"Nein", sagte Milly und warf eine Zeitschrift beiseite, die sie aufgeschlagen hatte, "ich werde gehen ..."
Delia tauchte plötzlich aus dem Hinterzimmer auf, in dem sie herumgeschlichen war.
"Ich habe überhaupt nichts zu tun", sagte sie kurz. "Ich werde gehen."
Sie ging die Treppe hinauf, Schritt für Schritt, ganz langsam. Als sie zur Schlafzimmertür kam, vor der die Krüge und Gläser auf dem Tisch standen, hielt sie inne. Der süßsäuerliche Geruch von Krankheit machte sie leicht krank. Sie konnte sich nicht dazu zwingen, hineinzugehen. Durch das kleine Fenster am Ende des Ganges konnte sie flamingofarbene Wolkenkringel sehen, die auf einem blassblauen Himmel lagen. Nach der Dämmerung des Salons blendeten ihre Augen. Das Licht schien sie einen Moment lang zu fixieren. Dann hörte sie in der Etage darüber Kinderstimmen - Martin und Rose, die sich stritten.
"Dann eben nicht!", hörte sie Rose sagen. Eine Tür schlug zu. Sie hielt inne. Dann holte sie tief Luft, schaute noch einmal in den feurigen Himmel und klopfte an die Schlafzimmertür.
Die Schwester stand leise auf, legte den Finger an die Lippen und verließ das Zimmer. Frau Pargiter schlief. In einer Spalte der Kissen liegend, eine Hand unter die Wange gelegt, stöhnte Frau Pargiter leicht, als wandere sie in einer Welt, in der selbst im Schlaf kleine Hindernisse auf ihrem Weg lagen. Ihr Gesicht war eingefallen und schwer; die Haut war mit braunen Flecken befleckt; das Haar, das früher rot gewesen war, war jetzt weiß, nur dass es seltsame gelbe Flecken aufwies, als wären einige Locken in Eigelb getaucht worden. Ohne alle Ringe, außer ihrem Ehering, schienen allein ihre Finger darauf hinzuweisen, dass sie die private Welt der Krankheit betreten hatte. Aber sie sah nicht aus, als würde sie sterben; sie sah aus, als könnte sie in diesem Grenzbereich zwischen Leben und Tod für immer weiter existieren. Delia konnte keine Veränderung an ihr feststellen. Als sie sich setzte, schien alles in ihr auf Hochtouren zu laufen. Ein langes schmales Glas neben dem Bett spiegelte einen Ausschnitt des Himmels wider; es war im Moment mit rotem Licht geblendet. Der Schminktisch war beleuchtet. Das Licht schlug auf Silberflaschen und auf Glasflaschen, die alle in der perfekten Ordnung der Dinge, die nicht benutzt werden, aufgestellt waren. Zu dieser Abendstunde hatte das Krankenzimmer eine unwirkliche Sauberkeit, Ruhe und Ordnung. Neben dem Bett stand ein kleiner Tisch mit einer Brille, einem Gebetbuch und einer Vase mit Maiglöckchen. Auch die Blumen sahen unwirklich aus. Es gab nichts zu tun, außer zu schauen.
Sie starrte auf die gelbe Zeichnung ihres Großvaters mit dem hohen Licht auf seiner Nase; auf das Foto ihres Onkels Horace in seiner Uniform; auf die hagere und verdrehte Gestalt auf dem Kruzifix rechts.
"Aber du glaubst doch nicht daran!", sagte sie zornig und sah ihre in Schlaf versunkene Mutter an. "Du willst nicht sterben."
Sie sehnte sich nach ihrem Tod. Da lag sie - weich, verfallen, aber ewig, in der Spalte der Kissen, ein Hindernis, eine Verhinderung, ein Hindernis für alles Leben. Sie versuchte, ein Gefühl der Zuneigung, des Mitleids zu wecken. Zum Beispiel in jenem Sommer, sagte sie sich, in Sidmouth, als sie mich die Gartentreppe hinaufrief. . . . Aber die Szene schmolz dahin, als sie versuchte, sie zu betrachten. Da war natürlich noch die andere Szene, der Mann im Gehrock mit der Blume im Knopfloch. Aber sie hatte sich geschworen, vor dem Schlafengehen nicht daran zu denken. Woran sollte sie dann denken? An Großpapa mit dem weißen Licht auf der Nase? An das Gebetbuch? An die Maiglöckchen? Oder an den Spiegel? Die Sonne war untergegangen; das Glas war trübe und spiegelte nur noch einen graubraunen Himmelsfleck. Sie konnte nicht länger widerstehen.
"Er trägt eine weiße Blume in seinem Knopfloch", begann sie. Es brauchte ein paar Minuten der Vorbereitung. Es muss eine Halle geben; Palmenbänke; ein Boden unter ihnen, der mit den Köpfen der Leute überfüllt ist. Der Zauber begann zu wirken. Sie wurde durchdrungen von köstlichen Anflügen schmeichelnder und erregender Emotionen. Sie stand auf dem Podium; da war ein riesiges Publikum; alle schrien, winkten mit Taschentüchern, zischten und pfiffen. Dann stand sie auf. Sie erhob sich ganz in Weiß in der Mitte der Plattform; Herr Parnell war an ihrer Seite.
"Ich spreche für die Sache der Freiheit", begann sie und streckte die Hände aus, "für die Sache der Gerechtigkeit. . . ." Sie standen Seite an Seite. Er war sehr blass, aber seine dunklen Augen leuchteten. Er drehte sich zu ihr und flüsterte. . . .
Es gab eine plötzliche Unterbrechung. Frau Pargiter hatte sich auf ihren Kissen aufgerichtet.
"Wo bin ich?", rief sie. Sie war verängstigt und verwirrt, wie sie es oft beim Aufwachen war. Sie hob die Hand; sie schien um Hilfe zu rufen. "Wo bin ich?", wiederholte sie. Einen Moment lang war auch Delia verwirrt. Wo war sie?
"Hier, Mama! Hier!", sagte sie wie wild. "Hier, in deinem eigenen Zimmer."
Sie legte ihre Hand auf die Thekenplatte. Frau Pargiter umklammerte sie nervös. Sie schaute sich im Zimmer um, als ob sie jemanden suchen würde. Sie schien ihre Tochter nicht zu erkennen.
"Was ist los?", fragte sie. "Wo bin ich?" Dann sah sie Delia an und erinnerte sich.
"Oh, Delia - ich habe geträumt", murmelte sie halb entschuldigend. Sie lag einen Moment lang da und schaute aus dem Fenster. Die Lampen wurden angezündet, und ein plötzlicher sanfter Lichtschein kam auf die Straße hinaus.
"Es war ein schöner Tag ...", sie zögerte, "für ..." Es schien, als ob sie sich nicht erinnern konnte, wofür.
"Ein schöner Tag, ja, Mama", wiederholte Delia mit mechanischer Fröhlichkeit.
". ... für ...", versuchte ihre Mutter erneut.
Welcher Tag war es? Delia konnte sich nicht erinnern.
". . zum Geburtstag deines Onkels Digby", brachte Frau Pargiter schließlich hervor.
"Sagen Sie ihm von mir... Sagen Sie ihm, wie sehr ich mich freue."
"Ich werde es ihm sagen", sagte Delia. Sie hatte den Geburtstag ihres Onkels vergessen; aber ihre Mutter war in solchen Dingen pingelig.
"Tante Eugénie -", begann sie.
Aber ihre Mutter starrte auf den Schminktisch. Ein Schimmer von der Lampe draußen ließ das weiße Tuch extrem weiß aussehen.
"Schon wieder ein sauberes Tischtuch!" Mrs. Pargiter murmelte mürrisch. "Die Kosten, Delia, die Kosten - das ist es, was mich beunruhigt -"
"Das ist schon in Ordnung, Mama", sagte Delia dumpf. Ihre Augen waren auf das Porträt ihres Großvaters gerichtet; warum, so fragte sie sich, hatte der Künstler einen Tupfer weißer Kreide auf seine Nasenspitze gesetzt?
"Tante Eugénie hat dir ein paar Blumen mitgebracht", sagte sie.
Aus irgendeinem Grund schien Frau Pargiter erfreut. Ihr Blick ruhte nachdenklich auf dem sauberen Tischtuch, das einen Moment zuvor noch die Waschrechnung nahegelegt hatte.
"Tante Eugénie . .", sagte sie. "Wie gut ich mich erinnere" - ihre Stimme schien voller und runder zu werden - "an den Tag, als die Verlobung bekannt gegeben wurde. Wir waren alle im Garten; da kam ein Brief." Sie hielt inne. "Es kam ein Brief", wiederholte sie. Dann sagte sie eine Zeit lang nichts mehr. Sie schien in einer Erinnerung zu schwelgen.
"Der liebe kleine Junge ist gestorben, aber davon abgesehen ..." Sie hielt wieder inne. Sie schien heute Abend schwächer zu sein, dachte Delia, und ein Schauer der Freude durchfuhr sie. Ihre Sätze waren noch gebrochener als sonst. Welcher kleine Junge war gestorben? Während sie darauf wartete, dass ihre Mutter sprach, begann sie, die Windungen auf dem Tischtuch zu zählen.
"Du weißt doch, dass alle Cousins und Cousinen im Sommer zusammenkamen", nahm ihre Mutter plötzlich wieder auf. "Da war dein Onkel Horace. . . ."
"Der mit dem Glasauge", sagte Delia.
"Ja. Er hat sich auf dem Schaukelpferd am Auge verletzt. Die Tanten hielten so viel von Horace. Sie würden sagen ..." Hier gab es eine lange Pause. Sie schien nach den richtigen Worten zu ringen.
"Wenn Horace kommt, denken Sie daran, ihn nach der Esszimmertür zu fragen."
Eine seltsame Belustigung schien Frau Pargiter zu erfüllen. Sie lachte tatsächlich. Sie musste an einen längst vergangenen Familienwitz denken, vermutete Delia, als sie beobachtete, wie das Lächeln aufflackerte und wieder verschwand. Es herrschte völlige Stille. Ihre Mutter lag mit geschlossenen Augen da; die Hand mit dem einzelnen Ring, die weiße und verwelkte Hand, lag auf der Arbeitsplatte. In der Stille hörten sie das Klacken einer Kohle im Rost und das Dröhnen eines Straßenhändlers auf der Straße. Frau Pargiter sagte nichts mehr. Sie lag ganz still. Dann seufzte sie zutiefst.
Die Tür öffnete sich, und die Krankenschwester kam herein. Delia stand auf und ging hinaus. Wo bin ich? fragte sie sich und starrte auf einen weißen Krug, der von der untergehenden Sonne rosa gefärbt war. Einen Moment lang schien sie sich in einem Grenzbereich zwischen Leben und Tod zu befinden. Wo bin ich? wiederholte sie und starrte auf den rosa Krug, denn alles sah seltsam aus. Dann hörte sie Wasser rauschen und Füße, die auf dem Boden über ihr aufschlugen.
"Da bist du ja, Rosie", sagte die Krankenschwester und sah vom Rad der Nähmaschine auf, als Rose hereinkam.
Das Kinderzimmer war hell erleuchtet; auf dem Tisch stand eine unbeschattete Lampe. Frau C., die jede Woche mit der Wäsche kam, saß im Sessel mit einer Tasse in der Hand. "Los, geh nähen, du bist ein braves Mädchen", sagte die Schwester, als Rose Frau C. die Hand schüttelte, "sonst wirst du nie rechtzeitig zu Papas Geburtstag fertig", fügte sie hinzu und räumte einen Platz auf dem Kinderzimmertisch frei.
Rose öffnete die Tischschublade und nahm die Stiefeltasche heraus, die sie mit einem Muster aus blauen und roten Blumen für den Geburtstag ihres Vaters bestickte. Es waren noch einige Büschel kleiner, mit Bleistift gestickter Rosen zu bearbeiten. Sie breitete sie auf dem Tisch aus und begutachtete sie, während die Krankenschwester wieder aufnahm, was sie Mrs C. über Mrs. Kirbys Tochter erzählte. Aber Rose hörte nicht zu.
Dann werde ich allein gehen, beschloss sie und räumte den Kofferraum auf. Wenn Martin nicht mitkommt, dann gehe ich eben allein.
"Ich habe meine Arbeitsschachtel im Salon vergessen", sagte sie laut.
"Nun, dann gehen Sie und holen Sie es", sagte die Schwester, aber sie kümmerte sich nicht darum; sie wollte mit dem fortfahren, was sie Frau C. über die Tochter des Krämers sagte.
Jetzt hat das Abenteuer begonnen, sagte Rose zu sich selbst, als sie sich auf Zehenspitzen in das nächtliche Kinderzimmer schlich. Jetzt muss sie sich mit Munition und Proviant versorgen; sie muss den Schlüssel der Amme stehlen; aber wo war er? Jede Nacht wurde er aus Angst vor Einbrechern an einem anderen Ort versteckt. Entweder war er unter dem Taschentuchkasten oder in dem Kästchen, in dem sie die goldene Uhrenkette ihrer Mutter aufbewahrte. Da war sie. Jetzt hatte sie ihre Pistole und ihre Schrotflinte, dachte sie und nahm ihre eigene Geldbörse aus der Schublade, und genug Proviant, dachte sie, während sie sich Hut und Mantel über den Arm hängte, um vierzehn Tage durchzuhalten.
Sie stahl sich am Kinderzimmer vorbei, die Treppe hinunter. Sie lauschte aufmerksam, als sie die Tür zum Schulzimmer passierte. Sie muss aufpassen, dass sie nicht auf einen trockenen Ast tritt oder dass ein Zweig unter ihr knackt, sagte sie sich, während sie auf Zehenspitzen ging. Wieder blieb sie stehen und lauschte, als sie an der Schlafzimmertür ihrer Mutter vorbeikam. Alles war still. Dann stand sie einen Moment lang auf dem Treppenabsatz und schaute hinunter in den Flur. Der Hund schlief auf der Matte; die Luft war rein; der Flur war leer. Sie hörte Stimmen im Salon murmeln.
Mit äußerster Behutsamkeit drehte sie die Klinke der Haustür und schloss sie mit kaum hörbarem Klicken hinter sich. Bis sie um die Ecke war, hockte sie dicht an der Wand, damit niemand sie sehen konnte. Als sie die Ecke unter dem Goldregenbaum erreicht hatte, stand sie aufrecht.
"Ich bin Pargiter von Pargiters Pferd", sagte sie und schwenkte ihre Hand, "ich reite zur Rettung!"
Sie ritt bei Nacht in einer verzweifelten Mission zu einer belagerten Garnison, sagte sie sich. Sie hatte eine geheime Botschaft - sie ballte die Faust auf ihrer Handtasche -, die sie dem General persönlich überbringen musste. Ihr ganzes Leben hing davon ab. Die britische Flagge wehte immer noch auf dem zentralen Turm - Lamleys Laden war der zentrale Turm; der General stand auf dem Dach von Lamleys Laden und hielt sein Fernrohr an sein Auge. Ihr ganzes Leben hing davon ab, dass sie zu ihnen durch das feindliche Land ritt. Hier galoppierte sie durch die Wüste. Sie begann zu traben. Es wurde dunkel. Die Straßenlaternen wurden angezündet. Der Laternenanzünder steckte seinen Stock in die kleine Falltür; die Bäume in den Vorgärten bildeten ein schwankendes Netz von Schatten auf dem Bürgersteig; der Bürgersteig erstreckte sich breit und dunkel vor ihr. Dann war da die Kreuzung; und dann war da Lamleys Laden auf der kleinen Insel der Geschäfte gegenüber. Sie brauchte nur die Wüste zu durchqueren, den Fluss zu durchwaten, und sie war in Sicherheit. Mit dem Arm, der die Pistole hielt, gab sie ihrem Pferd die Sporen und galoppierte die Melrose Avenue hinunter. Als sie am Pfeilerkasten vorbeiritt, tauchte plötzlich die Gestalt eines Mannes unter der Gaslampe auf.
"Der Feind!" Rose rief zu sich selbst. "Der Feind! Peng!", rief sie, drückte den Abzug ihrer Pistole ab und sah ihm voll ins Gesicht, als sie an ihm vorbeiging. Es war ein schreckliches Gesicht: weiß, geschält, pockennarbig; er grinste sie an. Er streckte den Arm aus, als wolle er sie aufhalten. Er fing sie fast auf. Sie rannte an ihm vorbei. Das Spiel war vorbei.
Sie war wieder sie selbst, ein kleines Mädchen, das ihrer Schwester nicht gehorcht hatte, in ihren Hausschuhen, die zur Sicherheit zu Lamleys Laden flogen.
Die frischgebackene Mrs. Lamley stand hinter dem Tresen und faltete die Zeitungen zusammen. Sie grübelte zwischen ihren Zweigroschenuhren, Werkzeugkarten, Spielzeugbooten und Schachteln mit billigem Briefpapier über etwas Angenehmes nach, wie es schien; denn sie lächelte. Dann platzte Rose herein. Sie schaute fragend auf.
"Hallo, Rosie!", rief sie aus. "Was willst du, meine Liebe?"
Sie hielt ihre Hand auf dem Zeitungsstapel. Rose stand keuchend da. Sie hatte vergessen, weswegen sie gekommen war.
"Ich will die Schachtel mit den Enten im Fenster", fiel Rose schließlich ein.
Mrs. Lamley watschelte herum, um es zu holen.
"Ist es nicht ziemlich spät für ein kleines Mädchen wie dich, allein draußen zu sein?", fragte sie und sah sie an, als wüsste sie, dass sie in ihren Hausschuhen herausgekommen war und ihrer Schwester nicht gehorchte.
"Gute Nacht, meine Liebe, und lauf nach Hause", sagte sie und gab ihr das Päckchen. Das Kind schien auf der Türschwelle zu zögern: es stand da und starrte auf die Spielsachen unter der hängenden Öllampe; dann ging es zögernd hinaus.
Ich habe meine Botschaft dem General persönlich überbracht, sagte sie zu sich selbst, als sie wieder draußen auf dem Bürgersteig stand. Und das ist die Trophäe, sagte sie und klemmte sich die Schachtel unter den Arm. Ich kehre im Triumph mit dem Kopf des obersten Rebellen zurück, sagte sie sich, während sie die Strecke der Melrose Avenue vor sich betrachtete. Ich muss meinem Pferd die Sporen geben und galoppieren. Aber die Geschichte funktionierte nicht mehr. Die Melrose Avenue blieb die Melrose Avenue. Sie sah sie hinunter. Vor ihr lag die lange, kahle Straße. Die Bäume warfen ihre Schatten auf das Pflaster. Die Lampen standen in großem Abstand voneinander, und dazwischen gab es Lachen der Dunkelheit. Sie begann zu traben. Plötzlich, als sie den Laternenpfahl passierte, sah sie den Mann wieder. Er lehnte mit dem Rücken gegen den Laternenpfahl, und das Licht der Gaslampe flackerte über sein Gesicht. Als sie vorbeiging, saugte er seine Lippen ein und aus. Er machte ein miauendes Geräusch. Aber er streckte seine Hände nicht nach ihr aus; sie knöpften seine Kleidung auf.
Sie floh an ihm vorbei. Sie glaubte zu hören, wie er sie verfolgte. Sie hörte seine Füße auf dem Bürgersteig stampfen. Alles bebte, als sie rannte; rosa und schwarze Flecken tanzten vor ihren Augen, als sie die Türschwelle hinauflief, den Schlüssel ins Schloss steckte und die Flurtür öffnete. Es war ihr egal, ob sie ein Geräusch machte oder nicht. Sie hoffte, es würde jemand herauskommen und mit ihr sprechen. Aber niemand hörte sie. Der Flur war leer. Der Hund lag schlafend auf der Matte. Im Salon mischten sich noch Stimmen.
"Und wenn es sich fängt", sagte Eleanor, "wird es viel zu heiß sein."
Crosby hatte die Kohlen zu einem großen schwarzen Vorgebirge aufgeschichtet. Eine gelbe Rauchfahne schlängelte sich mürrisch um ihn herum; er begann zu brennen, und wenn er brannte, würde er viel zu heiß sein.
"Sie kann sehen, wie die Schwester den Zucker stiehlt, sagt sie. Sie kann ihren Schatten an der Wand sehen", sagte Milly. Sie sprachen über ihre Mutter.
"Und dann Edward", fügte sie hinzu, "der vergaß zu schreiben."
"Das erinnert mich daran", sagte Eleanor. Sie musste daran denken, Edward zu schreiben. Aber dafür würde nach dem Abendessen Zeit sein. Sie wollte nicht schreiben, sie wollte nicht reden; immer, wenn sie aus dem Hain zurückkam, hatte sie das Gefühl, als würden mehrere Dinge gleichzeitig vor sich gehen. Worte wiederholten sich in ihrem Kopf - Worte und Sehenswürdigkeiten. Sie dachte an die alte Frau Levy, die aufgestützt im Bett saß, mit ihrem weißen Haar in einem dicken Flop wie eine Perücke und ihrem Gesicht rissig wie ein alter glasierter Topf.
"Die, die gut zu mir waren, an die erinnere ich mich ... die, die in ihren Kutschen fuhren, als ich eine arme Witwe war, die schrubbte und raspelte -" Hier streckte sie ihren Arm aus, der gekrümmt und weiß war wie eine Baumwurzel. "Die, die gut zu mir waren, an die erinnere ich mich ..." wiederholte Eleanor, während sie auf das Feuer blickte. Dann kam die Tochter herein, die bei einem Schneider arbeitete. Sie trug Perlen, die so groß waren wie Hühnereier; sie hatte sich das Gesicht geschminkt; sie war wunderbar hübsch. Aber Milly machte eine kleine Bewegung.
"Ich dachte", sagte Eleanor spontan, "die Armen amüsieren sich mehr als wir."
"Die Levys?", sagte Milly geistesabwesend. Dann hellte sie sich auf.
"Erzählen Sie mir von den Levys", fügte sie hinzu. Eleanors Beziehungen zu "den Armen" - den Levys, den Grubbs, den Paravicinis, den Zwinglers und den Cobbs - amüsierten sie immer. Aber Eleanor mochte es nicht, über "die Armen" zu sprechen, als wären sie Menschen in einem Buch. Sie hatte eine große Bewunderung für Frau Levy, die an Krebs starb.
"Oh, sie sind so wie immer", sagte sie scharf. Milly sah sie an. Eleanor ist "grüblerisch", dachte sie. Der Familienwitz lautete: "Pass auf. Eleanor ist grüblerisch. Es ist ihr Grove-Tag." Eleanor schämte sich, aber aus irgendeinem Grund war sie immer gereizt, wenn sie vom Grove zurückkam - so viele verschiedene Dinge gingen ihr gleichzeitig im Kopf herum: Canning Place, Abercorn Terrace, dieses Zimmer, jenes Zimmer. Da war die alte Jüdin, die in ihrem heißen kleinen Zimmer im Bett saß; dann kam man hierher zurück, und da war Mama krank; Papa mürrisch; und Delia und Milly stritten sich wegen einer Party. . . . Aber sie beherrschte sich. Sie sollte versuchen, etwas zu sagen, um ihre Schwester zu amüsieren.
"Frau Levy hat ihre Miete fertig, für ein Wunder", sagte sie. "Lily hilft ihr. Lily hat einen Job in einer Schneiderei in Shoreditch. Sie kam mit Perlen und so herein. "Sie lieben Schmuck - Juden", fügte sie hinzu.
"Juden?", sagte Milly. Sie schien den Geschmack der Juden zu betrachten; und dann zu dimiss es.
"Ja", sagte sie. "Glänzend."
"Sie ist außerordentlich hübsch", sagte Eleanor und dachte an die roten Wangen und die weißen Perlen.
Milly lächelte; Eleanor würde sich immer für die Armen einsetzen. Sie hielt Eleanor für die beste, die weiseste, die bemerkenswerteste Person, die sie kannte.
"Ich glaube, du gehst mehr als alles andere gerne dorthin", sagte sie. "Ich glaube, Sie würden gerne dorthin gehen und dort leben, wenn es nach Ihnen ginge", fügte sie mit einem kleinen Seufzer hinzu.
Eleanor rutschte in ihrem Stuhl hin und her. Sie hatte ihre Träume, ihre Pläne, natürlich; aber sie wollte nicht darüber sprechen.
"Vielleicht wirst du das, wenn du verheiratet bist?", sagte Milly. Es lag etwas Verdrießliches und doch Klagendes in ihrer Stimme. Die Dinner-Party; die Dinner-Party der Burkes, dachte Eleanor. Sie wünschte, Milly käme nicht immer auf die Ehe zu sprechen. Und was wissen sie schon von der Ehe? fragte sie sich. Sie bleiben zu viel zu Hause, dachte sie; sie sehen nie jemanden außerhalb ihres eigenen Kreises. Hier sind sie eingepfercht, Tag für Tag. . . . Deshalb hatte sie gesagt: "Die Armen amüsieren sich mehr als wir." Es war ihr aufgefallen, als sie in den Salon zurückkam, mit all den Möbeln, den Blumen und den Krankenschwestern. . . . Wieder hielt sie sich zurück. Sie musste warten, bis sie allein war - bis sie sich abends die Zähne putzte. Wenn sie bei den anderen war, durfte sie nicht an zwei Dinge gleichzeitig denken. Sie nahm den Schürhaken und schlug die Kohle an.
"Schau! Was für eine Schönheit!", rief sie aus. Eine Flamme tanzte oben auf der Kohle, eine flinke und unbedeutende Flamme. Es war die Art von Flamme, die sie als Kinder zu machen pflegten, indem sie Salz auf das Feuer warfen. Sie schlug wieder zu, und ein Schauer von goldäugigen Funken flog den Schornstein hinauf. "Weißt du noch", sagte sie, "wie wir früher Feuerwehr spielten und Morris und ich den Schornstein in Brand setzten?"
"Und Pippy ging und holte Papa", sagte Milly. Sie hielt inne. Da war ein Geräusch im Flur. Ein Stock knirschte; jemand hängte einen Mantel auf. Eleanors Augen leuchteten auf. Das war Morris - ja, sie kannte das Geräusch, das er machte. Jetzt kam er herein. Sie schaute sich lächelnd um, als sich die Tür öffnete. Milly sprang auf.
Morris hat versucht, sie aufzuhalten.
"Gehen Sie nicht...", begann er.
"Ja!", rief sie aus. "Ich werde gehen. Ich werde ein Bad nehmen", fügte sie spontan hinzu. Sie verließ sie.
Morris setzte sich auf den Stuhl, den sie leer gelassen hatte. Er war froh, Eleanor allein vorzufinden. Keiner von beiden sprach einen Moment lang. Sie beobachteten die gelbe Rauchfahne und die kleine Flamme, die flink und belanglos hier und da auf dem schwarzen Kohlenhügel tanzte. Dann stellte er die übliche Frage:
"Wie geht es Mama?"
Sie sagte ihm; es gab keine Veränderung: "außer, dass sie mehr schläft", sagte sie. Er legte die Stirn in Falten. Er verlor sein jungenhaftes Aussehen, dachte Eleanor. Das war das Schlimmste in der Bar, sagten alle; man musste warten. Er war für Sanders Curry verzweifelt; und es war trostlose Arbeit, den ganzen Tag in den Gerichten herumzuhängen und zu warten.
"Wie geht es dem alten Curry?", fragte sie - der alte Curry hatte Temperament.
"Ein bisschen lebermäßig", sagte Morris grimmig.
"Und was hast du den ganzen Tag gemacht?", fragte sie.
"Nichts Besonderes", antwortete er.
"Immer noch Evans vs. Carter?"
"Ja", sagte er kurz.
"Und wer wird gewinnen?", fragte sie.
"Carter, natürlich", antwortete er.
Warum "natürlich", wollte sie fragen? Aber sie hatte neulich etwas Dummes gesagt - etwas, das zeigte, dass sie nicht zugehört hatte. Sie brachte die Dinge durcheinander; zum Beispiel, was war der Unterschied zwischen Common Law und der anderen Art von Recht? Sie sagte nichts. Sie saßen schweigend da und beobachteten die Flamme, die auf den Kohlen spielte. Es war eine grüne Flamme, flink, unbedeutend.
"Hältst du mich für einen schrecklichen Narren?", fragte er plötzlich. "Mit all dieser Krankheit und Edward und Martin, die bezahlt werden müssen - das muss für Papa eine ziemliche Belastung sein." Er zog die Stirn in Falten, so dass sie sich sagte, dass er seinen jungenhaften Blick verlor.
"Natürlich nicht", sagte sie mit Nachdruck. Natürlich wäre es für ihn absurd gewesen, in die Wirtschaft zu gehen; seine Leidenschaft galt dem Gesetz.
"Du wirst eines Tages Lordkanzler sein", sagte sie. "Da bin ich mir sicher." Er schüttelte den Kopf und lächelte.
"Ganz sicher", sagte sie und schaute ihn an, wie sie ihn immer anschaute, wenn er von der Schule zurückkam und Edward alle Preise hatte und Morris still dasaß - sie konnte ihn jetzt sehen - und sein Essen verschlang, ohne dass sich jemand um ihn kümmerte. Aber noch während sie ihn ansah, überkam sie ein Zweifel. Lordkanzler, hatte sie gesagt. Hätte sie nicht Lord Oberster Richter sagen sollen? Sie konnte sich nie merken, was was war: und deshalb wollte er nicht mit ihr über Evans v. Carter diskutieren.
Sie erzählte ihm auch nie von den Levys, außer im Scherz. Das war das Schlimmste am Erwachsenwerden, dachte sie; sie konnten die Dinge nicht mehr so teilen, wie sie es früher getan hatten. Wenn sie sich trafen, hatten sie nie Zeit, so zu reden, wie sie es früher getan hatten - über Dinge im Allgemeinen -, sie sprachen immer über Fakten - kleine Fakten. Sie schürte das Feuer. Plötzlich schallte ein lautes Geräusch durch den Raum. Es war Crosby, die sich am Gong in der Halle zu schaffen machte. Sie war wie eine Wilde, die sich an einem unverschämten Opfer rächt. Ein rauer Klang schallte durch den Raum. "Herrgott, das ist die Garderobenglocke!", sagte Morris. Er stand auf und streckte sich. Er hob die Arme und hielt sie einen Moment lang über dem Kopf schwebend. So wird er aussehen, wenn er Vater einer Familie ist, dachte Eleanor. Er ließ die Arme sinken und verließ den Raum. Sie saß einen Moment lang grübelnd da; dann richtete sie sich auf. Woran muss ich mich erinnern? fragte sie sich. Um Edward zu schreiben, überlegte sie und ging hinüber zum Schreibtisch ihrer Mutter. Das wird jetzt mein Tisch sein, dachte sie und betrachtete den silbernen Kerzenständer, die Miniatur ihres Großvaters, die Handwerkerbücher - auf einem war eine vergoldete Kuh eingestanzt - und das gefleckte Walross mit einem Pinsel im Rücken, das Martin seiner Mutter zum letzten Geburtstag geschenkt hatte.
Crosby hielt die Tür des Esszimmers offen, während sie darauf wartete, dass sie herunterkamen. Das Silber hat sich fürs Polieren gelohnt, dachte sie. Messer und Gabeln strahlten rund um den Tisch. Der ganze Raum mit seinen geschnitzten Stühlen, den Ölgemälden, den beiden Dolchen auf dem Kaminsims und der hübschen Anrichte - all die soliden Gegenstände, die Crosby jeden Tag abstaubte und polierte - sah am Abend am schönsten aus. Tagsüber nach Fleisch riechend und mit Sergamentüchern bedeckt, sah es abends beleuchtet und halb durchsichtig aus. Und sie waren eine hübsche Familie, dachte sie, als sie hereinkamen - die jungen Damen in ihren hübschen Kleidern aus blau-weißem, gesprenkelten Musselin; die Herren so adrett in ihren Smokings. Sie zog den Stuhl des Colonels für ihn heraus. Er war abends immer in bester Stimmung; er genoss sein Abendessen; und aus irgendeinem Grund war seine Trübsinnigkeit verschwunden. Er war in seiner jovialen Stimmung. Die Laune seiner Kinder stieg, als sie das bemerkten.
"Das ist ein hübsches Kleid, das du da trägst", sagte er zu Delia, als er sich setzte.
"Dieses alte?", sagte sie und tätschelte den blauen Musselin.





























