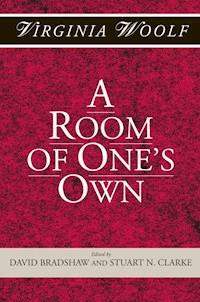9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Virginia Woolf, Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Zerrissen zwischen »akuter Verzweiflung« und »natürlichem Vergnügen« arbeitet Virginia Woolf vier Jahre lang an ihrem vorletzten und umfangreichsten Roman ›Die Jahre‹. Immer wieder vertraut sie zwischen dem Oktober 1912 und dem April 1936 die Qualen des Schreibens und Umschreibens, aber auch die Augenblicke eines »sehr glücklichen freien Gefühls« ihrem Tagebuch an. Und als das »wunderlichste« ihrer »Abenteuer« bei seinem Erscheinen im März 1937 von der Presse als ein Meisterwerk gefeiert wird und wochenlang an der Spitze der bestgehenden Titel der ›Herald Tribune‹ steht, notiert sie erleichtert und stolz: »Es wurden 25 000 Exemplare verkauft - bei weitem mein Rekord.« Dieser Erfolg mag nicht zuletzt auf die bei Virginia Woolf überraschende, auf den ersten Blick fast konventionelle Erzählweise zurückzuführen sein, auf den konkreten chronologischen Handlungsablauf eines Generationsromans zwischen 1880 und den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Das Buch ist, schreibt sie, »natürlich verschieden von den andern: hat, glaube ich, mehr ›wirkliches‹ Leben in sich...« Dieses ›wirkliche Leben‹ verkörpert die Londoner Offiziersfamilie Pargiter, bestehend aus den Eltern, Kindern und Enkeln. Zunächst leben sie noch alle zusammen auf dem alten Familienbesitz ›Abercorn‹, die todkranke Mutter und der Oberst mit seinem schmuddligen Geheimnis von der kleinen Mätresse, die drei Söhne und die vier Töchter. Feste werden gefeiert und Liebschaften geknüpft. Aber die Tage, Wochen und Jahre vergehen und führen unabänderlich jeden seinem eigenen individuellen Schicksal entgegen, führen zu Ehen, Geburt und Tod, zu Glück, Geselligkeit und Einsamkeit. Und doch hat Virginia Woolf, »die Dichterin des fließenden Erlebens, des Bewußtseinsstroms«, die Zeit angehalten durch das Immerwiederkehren gleicher Augenblicke. Erinnerungsschübe verbinden auseinandergerissene Schicksale über mehr als fünfzig Jahre, verknüpfen Gegenwart und Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Virginia Woolf
Die Jahre
Roman
Über dieses Buch
1880 beginnend, reicht die Chronik der Londoner Familie Pargiter bis in Virginia Woolfs Gegenwart um 1932, die Entstehungszeit des Romans. Sie folgt vor allem den Lebenswegen der Schwestern Eleanor, Delia, Milly und Rose: Während die Karrieren ihrer Brüder in Armee, Justiz und Universität ganz den traditionellen viktorianischen Normen entsprechen, reagieren die Töchter in ihren Entwicklungen sehr unterschiedlich auf die Enge des patriarchischen Elternhauses. Im Gegensatz zur völlig angepassten Eleanor, der Ältesten, schließt sich Rose, die Jüngste, in ihrer entschiedenen Opposition einem militanten Zweig der Suffragettenbewegung an. »Ich möchte das Ganze der heutigen Gesellschaft darstellen – nichts weniger: Fakten, aber auch die Vision«, schrieb Virginia Woolf im April 1933. Zu den Fakten gehören der Viktorianismus – zwischen den Zeilen heftig kritisiert –, die Frauenrechtsbewegung, der Erste Weltkrieg, die Vorboten des Faschismus. Die Vision: künstlerische, intellektuelle und berufliche Entfaltung ohne Einschränkungen durch jene Konventionen und Traditionen, mit denen Virginia Woolf selbst sich ihr Leben lang intensiv auseinandergesetzt hat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Virginia Woolf wurde am 25. Januar 1882 als Tochter des Biographen und Literaten Sir Leslie Stephen in London geboren. Zusammen mit ihrem Mann, dem Kritiker Leonard Woolf, gründete sie 1917 den Verlag The Hogarth Press. Ihre Romane stellen sie als Schriftstellerin neben James Joyce und Marcel Proust.
Zugleich war sie eine der lebendigsten Essayistinnen ihrer Zeit und hinterließ ein umfangreiches Tagebuch- und Briefwerk. Virginia Woolf nahm sich am 28. März 1941 in dem Fluß Ouse bei Lewes (Sussex) das Leben.
Klaus Reichert, 1938 geboren, ist Literaturwissenschaftler, Autor, Übersetzer und Herausgeber. Von 1964 bis 1968 war er Lektor in den Verlagen Insel und Suhrkamp, von 1975 bis 2003 war er Professor für Anglistik und Amerikanistik an der Frankfurter Universität, 1993 gründete er das »Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit«. Von 2002 bis 2011 war er Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Er schrieb Bücher über Shakespeare, Joyce, moderne Literatur und über die Geschichte und Theorie des Übersetzens, veröffentlichte drei Gedichtbände und ein Wüstentagebuch. Er übersetzte u.a. Shakespeare, Lewis Carroll, Joyce, John Cage und das Hohelied Salomos. Er war Herausgeber der deutschen Ausgabe von James Joyce und gibt seit 1989 im S. Fischer Verlag die Werke Virginia Woolfs heraus. Bei S. Fischer erschien seine Prosaübersetzung der Sonette Shakespeares.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
1880. Kapitel
1891. Kapitel
1907. Kapitel
1908. Kapitel
1910. Kapitel
1911. Kapitel
1913. Kapitel
1914. Kapitel
1917. Kapitel
1918. Kapitel
Gegenwart
Nachbemerkung des Herausgebers
1880
Es war ein launischer Frühling. Das Wetter, sich ständig verändernd, jagte Wolken aus Blau und Violett über die Erde. Auf dem Land schauten Bauern, die über ihre Felder blickten, sorgenvoll; in London klappten Menschen, die zum Himmel aufsahen, ihre Schirme auf und wieder zu. Doch im April mußte man mit derartigem Wetter rechnen. Tausende von Verkäufern und Verkäuferinnen machten diese Bemerkung, während sie Damen in gerüschten Kleidern, die bei Whiteley's oder in den Army and Navy Stores[1] auf der anderen Seite des Ladentischs standen, ordentlich geschnürte Päckchen überreichten. Endlose Prozessionen von Kauflustigen im West End und Geschäftsleuten im East End paradierten über die Bürgersteige wie unaufhörlich dahinziehende Karawanen – wenigstens wollte es jenen so scheinen, die einen Grund zum Verweilen hatten, sagen wir, um einen Brief einzuwerfen, oder am Fenster eines Clubs in der Piccadilly. Der Strom der Landauer, Victorias und Hansoms nahm kein Ende; denn die Saison fing an. In den ruhigeren Straßen ließen Musiker ihre brüchigen und meistenteils melancholischen Weisen ertönen, die ihr Echo, oder ihre Parodie, im Tschirpen der Spatzen und in den plötzlichen Ausbrüchen der amourösen, aber immer wieder stockenden Drosseln fanden, hier in den Bäumen des Hyde Park, hier in denen von St. James's[2]. Tauben trippelten in den Baumwipfeln der Squares hin und her, ließen hier und da ein Zweiglein fallen und gurrten unaufhörlich ihr immer wieder unterbrochenes Wiegenlied. Die Tore von Marble Arch und Apsley House[3] waren am Nachmittag blockiert von buntgewandeten Damen, die Tournüren trugen, und von Herren in Gehröcken, die Stöcke schwangen, Nelken trugen. Hier kam die Prinzessin, und Hüte wurden gelüftet, als sie vorüberfuhr. In den Souterrains der langen baumgesäumten Straßen der Wohnviertel bereiteten Dienstmädchen in Häubchen und Schürzen den Tee vor. Auf Umwegen aus dem Souterrain heraufgetragen, wurde die silberne Teekanne auf den Tisch gestellt, und junge Mädchen und alte Jungfern mit Händen, die die Schmerzen von Bermondsey und Hoxton[4] gelindert hatten, maßen bedachtsam ein, zwei, drei, vier Löffel Tee ab. Als die Sonne unterging, blühten Millionen kleiner Gaslichter, den Augen von Pfauenfedern gleich, in ihren gläsernen Käfigen auf, aber dennoch blieben auf den Bürgersteigen breite Streifen Dunkelheit zurück. Das gemischte Licht von Laternen und untergehender Sonne spiegelte sich gleichermaßen in den stillen Wassern des Round Pond und der Serpentine[5]. Menschen, die auf dem Weg zu ihren Dinnereinladungen in Hansoms über die Brücke trabten, betrachteten für einen kurzen Augenblick das bezaubernde Bild. Nach einer Weile ging der Mond auf, und seine blanke Münze, wenn auch hin und wieder von Wolkenfetzen verdunkelt, leuchtete voller Heiterkeit herab, voller Feierlichkeit, oder vielleicht auch voller Indifferenz. Sich langsam drehend, wie der Schein eines Suchlichts, zogen die Tage, die Wochen, die Jahre, nacheinander über den Himmel.
Colonel Abel Pargiter saß nach dem Lunch plaudernd in seinem Club. Da seine Gefährten in den Ledersesseln Männer seines eigenen Schlags waren, ehemalige Soldaten, Staatsbeamte, Männer, die jetzt im Ruhestand waren, ließen sie mit alten Witzen und Geschichten erst ihre Vergangenheit in Indien, Afrika, Ägypten aufleben und wandten sich dann, wie selbstverständlich, der Gegenwart zu. Es ging um eine Ernennung, eine mögliche Ernennung.
Plötzlich beugte der jüngste und schneidigste der drei sich vor. Gestern war er zum Lunch gewesen mit … Hier sank die Stimme des Sprechers zu einem Flüstern ab. Die anderen neigten sich näher; mit einer knappen Handbewegung wedelte Colonel Abel den Bediensteten fort, der die Kaffeetassen abräumte. Die drei kahl werdenden, angegrauten Köpfe steckten mehrere Minuten dicht beisammen. Dann ließ Colonel Abel sich in seinen Sessel zurückfallen. Das eigentümliche Glitzern, das in aller Augen getreten war, als Major Elkin zu seiner Geschichte ansetzte, war völlig aus Colonel Pargiters Gesicht verschwunden. Er starrte geradeaus vor sich hin, die hellblauen Augen ein wenig zusammengekniffen, als sei das Gleißen des Ostens noch in ihnen; und in den Winkeln ein wenig gekräuselt, als seien sie noch voller Staub. Ihm war ein Gedanke gekommen, der alles, was die anderen sagten, für ihn uninteressant machte; ja sogar abstoßend. Er erhob sich und sah durch das Fenster auf die Piccadilly hinunter. Die Zigarre ausgestreckt in der Hand, blickte er auf Omnibusse, Hansoms, Victorias, Lieferwagen und Landauer hinab. Er hatte mit alledem nichts mehr zu schaffen, schien seine Haltung zu sagen; er mischte nicht mehr mit. Etwas Düsteres legte sich über sein gutaussehendes rötliches Gesicht, während er schauend dastand. Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Er hatte eine Frage, die er stellen wollte; er drehte sich um, sie zu stellen, aber seine Freunde waren gegangen. Die kleine Gruppe hatte sich aufgelöst. Elkins hastete bereits durch die Tür; Brand hatte sich entfernt, um mit einem anderen Mann zu reden. Colonel Pargiter schloß den Mund über dem, was er vielleicht gesagt hätte, und wandte sich wieder dem Fenster zu, das auf die Piccadilly hinausging. Jeder in der geschäftigen Straße, so wollte es ihm scheinen, hatte ein Ziel. Jeder hastete dahin, um irgendeine Verabredung einzuhalten. Selbst die Damen in ihren Victorias und Broughams trabten über die Piccadilly und hatten dies oder das zu erledigen. Alle kamen nach London zurück; sie bereiteten sich auf die Saison vor. Aber für ihn würde es keine Saison geben; für ihn gab es nichts zu tun. Seine Frau lag im Sterben; starb aber nicht. Heute ging es ihr besser; morgen würde es ihr schlechter gehen; eine neue Pflegerin kam; und so ging es immer weiter. Er nahm eine Zeitung zur Hand und blätterte darin herum. Er betrachtete ein Bild von der Westfassade des Kölner Doms. Er warf die Zeitung zurück auf ihren Platz unter den anderen Zeitungen. Eines dieser Tage – das war sein Euphemismus für die Zeit, wenn seine Frau tot wäre – würde er London aufgeben, dachte er, und aufs Land ziehen. Aber zum einen war da das Haus; dann waren da die Kinder; und dann war da außerdem … sein Gesicht veränderte sich; es wirkte auf einmal weniger unzufrieden; aber auch ein wenig verstohlen und verlegen.
Es gab doch etwas, wo er hingehen konnte. Während sie geplaudert hatten, hatte er diesen Gedanken im Hinterkopf gehütet. Als er sich umgedreht und festgestellt hatte, daß die anderen gegangen waren, war das der Balsam, den er auf seine Wunde strich. Er würde Mira besuchen; Mira wenigstens würde sich freuen, ihn zu sehen. Und so wandte er sich, als er den Club verließ, nicht nach Osten, wohin die geschäftigen Männer gingen; noch nach Westen, wo in der Abercorn Terrace sein eigenes Haus lag; sondern begab sich über die asphaltierten Wege durch den Green Park[6] nach Westminster. Das Gras war sehr grün; die Blätter fingen an zu sprießen; kleine grüne Krallen, wie Vogelkrallen, brachen aus den Zweigen hervor; überall herrschte ein Glitzern, ein Belebtsein; die Luft roch sauber und frisch. Doch Colonel Pargiter sah weder das Gras noch die Bäume. In seinem fest zugeknöpften Rock marschierte er starr vor sich hin blickend durch den Park. Doch als er Westminster erreichte, blieb er stehen. Dieser Teil der Angelegenheit war ihm zuwider. Jedesmal, wenn er sich der kleinen Straße näherte, die sich unter den gewaltigen Massen der Abbey[7] duckte, der Straße voller schäbiger kleiner Häuser, mit vergilbten Vorhängen und Pappschildern in den Fenstern, der Straße, in der der Semmelverkäufer ständig seine Glocke zu läuten schien und Kinder in weißen Kreidekästchen auf dem Pflaster herumhüpften und schrien, blieb er stehen, blickte nach rechts, blickte nach links; und ging dann mit sehr schnellen Schritten zur Nummer dreißig und läutete. Während er wartete, blickte er geradeaus auf die Tür, den Kopf ein wenig eingezogen. Er wollte nicht auf dieser Türschwelle gesehen werden. Er haßte es, darauf zu warten, eingelassen zu werden. Er haßte es, wenn Mrs Sims ihn einließ. Immer roch es in diesem Haus; immer hing im Garten dahinter Wäsche auf der Leine. Er ging die Treppe hinauf, verdrossen und schwerfällig, und betrat das Wohnzimmer.
Niemand war da; er war zu früh. Angewidert sah er sich im Zimmer um. Zuviel Krimskrams stand herum. Er fühlte sich fehl am Platz, und überhaupt viel zu groß, als er aufrecht vor dem drapierten Kamin stand, dessen Schirm mit einem Eisvogel bemalt war, der im Begriff stand, sich auf einem Büschel Binsen niederzulassen. Schritte huschten im Stockwerk über ihm hin und her. War jemand bei ihr? fragte er sich, während er lauschte. Kinder schrien auf der Straße draußen. Es war schäbig; es war erbärmlich; es war verstohlen. Eines dieser Tage, sagte er zu sich selbst … aber die Tür ging auf, und seine Geliebte, Mira, kam herein.
»O Bogy, Lieber!« rief sie. Ihr Haar war sehr unordentlich; sie sah ein wenig zerzaust aus; aber sie war sehr viel jünger als er und wirklich froh, ihn zu sehen, dachte er. Das kleine Hündchen sprang an ihr hoch.
»Lulu, Lulu«, rief sie und fing das Hündchen mit einer Hand auf, während sie die andere an ihre Haare hob, »komm und laß dich von Onkel Bogy ansehen.«
Der Colonel ließ sich in dem knarrenden Korbsessel nieder. Sie hob den Hund auf seine Knie. Er hatte eine rote Stelle – möglicherweise ein Ekzem – hinter dem einen Ohr. Der Colonel setzte seine Brille auf und beugte sich vor, um sich das Ohr des Hundes anzusehen. Mira küßte ihn auf die Stelle, wo der Kragen den Nacken berührte. Dann fiel seine Brille herunter. Sie fing sie auf und setzte sie dem Hündchen auf die Nase. Der alte Knabe war heute nicht bei Laune, spürte sie. In der geheimnisvollen Welt der Clubs und der Familie, über die er nie mit ihr sprach, war irgend etwas nicht in Ordnung. Er war gekommen, bevor sie Zeit gehabt hatte, sich die Haare zu richten, was ärgerlich war. Aber es war ihre Pflicht, ihn aufzumuntern. Also huschte sie – ihre Figur, wenn auch behäbiger werdend, erlaubte es ihr immer noch, zwischen Tisch und Sessel hindurchzugleiten – hierhin und dorthin; nahm den Schirm vor dem Kamin weg und zündete, bevor er sie daran hindern konnte, das mißgünstige Logierhausfeuer an. Dann hockte sie sich auf die Lehne seines Sessels.
»O Mira!« sagte sie mit einem Blick in den Spiegel und fing an, ihre Haarnadeln umzustecken, »was bist du doch für ein schrecklich unordentliches Ding!« Sie löste eine lange Strähne und ließ sie über ihre Schulter fallen. Es war immer noch wunderschönes, golden glänzendes Haar, obwohl sie auf die Vierzig zuging und, um bei der Wahrheit zu bleiben, eine achtjährige Tochter hatte, die bei Freunden in Bedford untergebracht war. Das Haar begann, von selbst herabzufallen, von seinem eigenen Gewicht gezogen, und Bogy, der es fallen sah, beugte sich vor und küßte ihr Haar. Eine Drehorgel hatte ein Stück die Straße hinunter eingesetzt, und die Kinder liefen alle in diese Richtung davon und ließen eine plötzliche Stille zurück. Der Colonel fing an, ihren Nacken zu streicheln. Seine Hand, an der zwei Finger fehlten, kroch etwas tiefer, dahin, wo der Nacken in die Schulter übergeht. Mira ließ sich auf den Boden gleiten und lehnte den Rücken an seine Knie.
Dann knarrte es auf der Treppe; jemand klopfte, wie um sie auf seine Anwesenheit aufmerksam zu machen. Mira steckte ihre Haare sofort zusammen, stand auf und schloß die Tür.
Der Colonel machte sich auf seine methodische Art noch einmal daran, das Ohr des Hündchens zu untersuchen. War es ein Ekzem? oder war es kein Ekzem? Er begutachtete die rote Stelle, setzte den Hund dann auf allen vieren in den Korb und wartete. Ihm gefiel das anhaltende Flüstern auf dem Treppenabsatz draußen nicht. Nach einer Weile kam Mira zurück; sie sah besorgt aus; und wenn sie besorgt aussah, sah sie alt aus. Sie fing an, unter Kissen und Bezügen herumzukramen. Sie suchte ihre Handtasche, sagte sie; wo hatte sie sie nur hingetan? In diesem Durcheinander, dachte der Colonel, könnte sie überall sein. Es war eine schmale, ärmliche Tasche, als sie sie unter den Kissen in der Sofaecke fand. Sie drehte sie um. Taschentücher, zusammengeknüllte Papierschnipsel, Silber- und Kupfermünzen fielen heraus, als sie sie schüttelte. Aber es müßte doch noch ein Sovereign da sein, sagte sie. »Ich bin sicher, daß ich gestern noch einen hatte«, murmelte sie.
»Wieviel?« fragte der Colonel.
Es belief sich auf ein Pfund – nein, es belief sich auf ein Pfund, acht Shilling und sechs Pence, sagte sie und murmelte etwas von der Wäsche. Der Colonel schüttelte zwei Sovereigns aus seiner kleinen goldenen Börse und gab sie ihr. Sie nahm sie, und weiteres Geflüster auf dem Treppenabsatz folgte.
»Wäsche …?« dachte der Colonel und sah sich erneut im Zimmer um. Es war ein schäbiges kleines Loch; aber da er so viel älter war als sie, stand es ihm nicht zu, Fragen über die Wäsche zu stellen. Da war sie wieder. Sie huschte durch das Zimmer und setzte sich auf den Boden und lehnte den Kopf an sein Knie. Das mißgünstige Feuer, das nur schwächlich geflackert hatte, war jetzt ganz in sich zusammengesackt. »Laß es«, sagte er ungeduldig, als sie nach dem Schüreisen griff. »Laß es ausgehen.« Sie legte das Schüreisen zurück. Der Hund schnarchte; die Drehorgel spielte. Seine Hand begann ihre Reise ihren Nacken hinauf und wieder hinunter, hinein in die langen dichten Haare und wieder heraus. In diesem kleinen Zimmer, den anderen Häusern so nah, kam die Dämmerung schnell; und die Vorhänge waren halb zugezogen. Er zog sie an sich; er küßte ihren Nacken; und dann kroch die Hand, an der zwei Finger fehlten, ein Stück tiefer, dahin, wo der Nacken in die Schultern übergeht.
Ein plötzlicher Regenschauer ging auf das Pflaster nieder, und die Kinder, die in ihren Kreidekästchen herumgehüpft waren, rannten nach Hause. Der ältliche Straßensänger, der, eine Seemannsmütze keck auf den Hinterkopf geschoben, am Kantstein entlanggeschwankt war und aus voller Kehle »Count your blessings, Count your blessings –« gesungen hatte, schlug den Kragen seiner Jacke hoch und suchte Zuflucht unter dem Vordach eines Wirtshauses, wo er seine Aufforderung vervollständigte: »Count your blessings. Every One.« Dann schien die Sonne wieder; und trocknete das Pflaster.
»Er kocht nicht«, sagte Milly Pargiter, den Teekessel anstarrend. Sie saß an dem runden Tisch im vorderen Wohnzimmer des Hauses in der Abercorn Terrace. »Er kocht nicht einmal annähernd«, wiederholte sie. Der Kessel war ein altmodischer Messingkessel mit einem eingravierten Rosenmuster, das kaum noch zu erkennen war. Ein schwächliches kleines Flämmchen flackerte unter dem Messinggefäß auf und ab. Ihre Schwester Delia, die neben ihr in einem Sessel zurückgelehnt saß, beobachtete den Kessel ebenfalls. »Muß ein Kessel kochen?« fragte sie nach einem Augenblick müßig, als erwarte sie keine Antwort, und Milly antwortete auch nicht. Schweigend beobachteten sie die kleine Flamme auf dem Büschel des gelben Dochts. Zahlreiche Teller und Tassen standen auf dem Tisch, als würden weitere Personen erwartet, aber im Augenblick waren sie allein. Das Zimmer war voller Möbel. Ihnen gegenüber stand eine holländische Vitrine mit blauem Porzellan auf den Borden; die Sonne des Aprilabends zeichnete hier und da einen hellen Fleck auf die Scheiben. Über dem Kamin lächelte das Porträt einer rothaarigen jungen Frau in weißem Musselin, einen Korb mit Blumen auf dem Schoß, auf sie herab. Milly zog eine Nadel aus ihren Haaren und fing an, den Docht in einzelne Strähnen zu zerfransen, um die Flamme zu vergrößern.
»Aber das bringt doch nichts«, sagte Delia gereizt, während sie sie beobachtete. Sie rutschte unruhig hin und her. Alles schien so unerträglich lange zu dauern. Dann kam Crosby herein und fragte, ob sie den Kessel in der Küche aufsetzen solle, und Milly sagte Nein! Wie kann ich diesem Getändel und Getue ein Ende machen? fragte sie sich, während sie mit einem Messer auf dem Tisch herumtippte und das schwächliche Flämmchen beobachtete, an dem ihre Schwester mit einer Haarnadel herumzupfte. Ein Mückenstimmchen fing an, unter dem Kessel zu wimmern; aber hier flog die Tür aufs neue auf, und ein kleines Mädchen in einem steifen rosa Kleidchen kam herein.
»Ich finde, Nurse hätte dir ruhig eine saubere Schürze umbinden können«, sagte Milly streng, in Nachahmung einer erwachsenen Person. Ein grüner Fleck prangte auf der Schürze, als wäre sie auf einem Baum herumgeklettert.
»Sie war noch nicht aus der Wäsche zurück«, sagte Rose, das kleine Mädchen, mürrisch. Sie sah zum Tisch, aber an Tee war noch nicht zu denken.
Milly machte sich wieder mit der Haarnadel am Docht zu schaffen. Delia lehnte sich zurück und sah über ihre Schulter hinweg aus dem Fenster. Von da, wo sie saß, konnte sie die Treppe vor dem Haus sehen.
»Da ist ja Martin«, sagte sie finster. Die Tür schlug; Bücher wurden auf den Tisch in der Diele geknallt, und Martin, ein Junge von zwölf Jahren, kam herein. Er hatte die roten Haare der Frau auf dem Bild, aber seine waren zerzaust.
»Geh und richte dich her«, sagte Delia streng. »Du hast reichlich Zeit«, fügte sie hinzu. »Der Kessel kocht noch nicht.«
Alle sahen auf den Kessel. Er ließ immer noch sein schwaches melancholisches Singen ertönen, während die kleine Flamme unter dem hängenden Messinggefäß flackerte.
»Zum Teufel mit diesem Kessel«, sagte Martin und drehte sich abrupt um.
»Mama würde nicht wollen, daß du solche Ausdrücke benutzt«, tadelte Milly ihn wie in Nachahmung einer älteren Person; denn ihre Mutter war schon so lange krank, daß die beiden Schwestern sich angewöhnt hatten, im Umgang mit den Kleinen ihre Art nachzuahmen.
Die Tür öffnete sich erneut.
»Das Tablett, Miss …« sagte Crosby, die Tür mit dem Fuß aufhaltend. Sie hatte ein Krankentablett in den Händen.
»Das Tablett«, wiederholte Milly. »Also, wer trägt das Tablett nach oben?« Wieder ahmte sie die Art einer älteren Person nach, die im Umgang mit Kindern rücksichtsvoll sein will.
»Du nicht, Rose. Es ist zu schwer für dich. Martin soll es tragen; und du kannst mit ihm gehen. Aber bleibt nicht so lange. Erzählt Mama nur, was ihr gemacht habt; und dann wird der Kessel … der Kessel …«
Hier machte sie sich wieder mit der Haarnadel am Docht zu schaffen. Ein dünner Dampfstoß drang aus der schlangenförmigen Tülle. Erst noch unterbrochen, wurde er allmählich immer mächtiger, bis, gerade als sie Schritte auf der Treppe hörten, ein mächtiger Dampfstrahl aus der Tülle strömte.
»Er kocht!« rief Milly. »Er kocht!«
Sie aßen schweigend. Die Sonne, den wechselnden Lichtern auf der Scheibe der holländischen Vitrine nach zu urteilen, schien zu kommen und zu gehen. Gelegentlich leuchtete eine Schale tiefblau auf; und wurde dann wieder bleiern. Lichter spielten verstohlen auf den Möbeln im Nebenzimmer. Hier war ein Muster; hier ein kahler Fleck. Irgendwo ist Schönheit, dachte Delia, irgendwo ist Freiheit, und irgendwo, dachte sie, ist er – mit seiner weißen Blume … Aber ein Stock scharrte in der Diele.
»Es ist Papa!« rief Milly warnend.
Augenblicklich rutschte Martin aus dem Lehnsessel seines Vaters; Delia setzte sich gerade hin. Milly schob eilig eine sehr große, mit Rosen übersäte Tasse zurecht, die nicht zu den anderen paßte. Der Colonel stand in der Tür und musterte die Gruppe fast ingrimmig. Seine kleinen blauen Augen sahen in die Runde, wie auf der Suche nach etwas, woran er Anstoß nehmen konnte; im Moment gab es nichts Spezielles zum Anstoßnehmen; aber er war schlechter Dinge; sie wußten sofort, noch bevor er sprach, daß er schlechter Dinge war.
»Schmutziger kleiner Wildfang«, sagte er und zwickte Rose im Vorbeigehen ins Ohr. Sie legte sofort die Hand über den Fleck auf ihrer Schürze.
»Mit Mama alles in Ordnung?« fragte er und ließ sich als kompakte Masse in den großen Lehnsessel sinken. Er verabscheute Tee; nippte aber immer ein paar Schlückchen aus der großen alten Tasse, die seinem Vater gehört hatte. Er hob sie an und nippte mechanisch.
»Und was habt ihr alle getrieben?« fragte er.
Er sah sich mit dem verhangenen, aber gerissenen Blick um, der freundlich sein konnte, jetzt aber verdrießlich war.
»Delia hatte ihre Musikstunde, und ich bin zu Whiteley's gegangen –« fing Milly an, fast als wäre sie ein Kind, das eine Lektion aufsagt.
»Um Geld auszugeben, was?« sagte ihr Vater scharf, aber nicht unfreundlich.
»Nein, Papa; ich hatte es dir erzählt. Sie hatten die falschen Laken geschickt –«
»Und du, Martin?« unterbrach Colonel Pargiter die Berichterstattung seiner Tochter. »Der Schlechteste in deiner Klasse wie üblich?«
»Der Beste!« schrie Martin, die Worte hervorstoßend, als hätte er sie bis zu diesem Augenblick nur mit Mühe zurückgehalten.
»Hm – was du nicht sagst«, sagte sein Vater. Seine düstere Miene hellte sich ein wenig auf. Er versenkte die Hand in der Hosentasche und brachte eine Handvoll Silber zum Vorschein. Seine Kinder beobachteten, wie er versuchte, ein Sixpencestück aus all den Florins herauszufischen. Er hatte zwei Finger der rechten Hand während des Aufstands in Indien verloren,[8] und die Muskeln waren geschrumpft, so daß die rechte Hand der Klaue eines alten Vogels ähnelte. Er kramte und fummelte; aber da er selbst seine Verletzung immer ignorierte, wagten seine Kinder nicht, ihm zu helfen. Die glänzenden Stümpfe der verstümmelten Finger faszinierten Rose.
»Hier, Martin«, sagte er schließlich und gab seinem Sohn das Sixpencestück. Dann nippte er wieder an seinem Tee und tupfte sich den Schnurrbart ab.
»Wo ist Eleanor?« fragte er nach einer Weile, wie um das Schweigen zu brechen.
»Heute ist ihr Grove-Tag[9]«, erinnerte Milly ihn.
»Oh, ihr Grove-Tag«, murmelte der Colonel. Er rührte den Zucker in seiner Tasse um und um, als wollte er sie demolieren.
»Die guten alten Levys«, sagte Delia zögernd. Sie war seine Lieblingstochter; aber angesichts seiner augenblicklichen Stimmung war sie sich nicht sicher, wie weit sie sich vorwagen konnte.
Er sagte nichts.
»Bertie Levy hat sechs Zehen an dem einen Fuß«, piepste Rose unvermittelt. Die anderen lachten. Aber der Colonel unterbrach sie.
»Beeil dich und mach dich an deine Hausaufgaben, mein Junge«, sagte er mit einem Blick auf Martin, der noch aß.
»Laß ihn doch fertigessen, Papa«, sagte Milly, wieder die Art einer älteren Person imitierend.
»Und die neue Pflegerin?« fragte der Colonel, mit den Fingern auf die Tischkante trommelnd. »Ist sie gekommen?«
»Ja …« fing Milly an. Aber hier raschelte es in der Diele, und Eleanor kam herein. Sehr zu aller Erleichterung; vor allem Millys. Gott sei Dank, Eleanor ist da, dachte sie und hob den Kopf – die Trösterin, die Schlichterin von Streitigkeiten, der Puffer zwischen ihr und den Spannungen und Querelen des Familienlebens. Sie betete ihre Schwester an. Sie hätte sie eine Göttin genannt und sie mit einer Schönheit ausgestattet, die sie nicht besaß, mit Kleidern, die sie nicht besaß, hätte sie nicht einen Stapel kleiner, marmorierter Hefte und zwei schwarze Handschuhe in der Hand gehalten. Beschütze mich, dachte sie, als sie ihr eine Teetasse reichte, die ich ein so unscheinbares, mit Füßen getretenes, untüchtiges kleines Ding bin, verglichen mit Delia, die immer ihren Willen durchsetzt, während ich immer nur Abfuhren bekomme von Papa, der aus irgendeinem Grund verstimmt war. Der Colonel lächelte Eleanor an. Und der rote Hund auf dem Kaminvorleger sah ebenfalls auf und wedelte mit dem Schwanz, als erkenne er in ihr eine jener zufriedenstellenden Frauen, die einem einen Knochen geben, sich aber hinterher die Hände waschen. Sie war die älteste der Töchter, etwa zweiundzwanzig, keine Schönheit, aber gesund, und obgleich im Augenblick müde, von heiterem Wesen.
»Tut mir leid, daß ich so spät komme«, sagte sie. »Ich wurde aufgehalten. Und ich hatte nicht damit gerechnet –« Sie sah ihren Vater an.
»Ich konnte mich früher freimachen, als ich gedacht hatte«, sagte er hastig. »Die Sitzung –« er brach ab. Es hatte wieder einmal Streit mit Mira gegeben.
»Und was macht dein Grove, wie?« fügte er hinzu.
»Oh, mein Grove –« wiederholte sie; aber Milly reichte ihr die zugedeckte Schüssel.
»Ich wurde aufgehalten«, sagte Eleanor noch einmal und bediente sich. Sie fing an zu essen; die Atmosphäre entspannte sich.
»Und jetzt erzähl uns, Papa«, sagte Delia kühn – sie war seine Lieblingstochter – »was du getrieben hast. Hast du irgendwelche Abenteuer erlebt?«
Es war eine unglückliche Bemerkung.
»Für einen alten Esel wie mich gibt es keine Abenteuer«, sagte der Colonel verstimmt. Er zermalmte die Zuckerkörner an den Wänden seiner Tasse. Dann schien er seine Schroffheit zu bereuen; er dachte einen Augenblick nach.
»Ich habe den alten Burke im Club getroffen; er hat gesagt, ich soll eine von euch zum Dinner mitbringen; Robin ist zurück, auf Urlaub«, sagte er.
Er trank seinen Tee aus. Ein paar Tropfen fielen auf seinen kleinen Spitzbart. Er zog sein großes seidenes Taschentuch hervor und wischte sich ungeduldig das Kinn. Eleanor, die auf ihrem niedrigen Stuhl saß, sah einen seltsamen Ausdruck erst auf Millys Gesicht, dann auf Delias. Sie hatte den Eindruck einer Feindseligkeit zwischen den beiden. Aber sie sagten nichts. Sie aßen und tranken weiter, bis der Colonel seine Tasse hob, sah, daß nichts mehr drin war, und sie entschlossen mit einem leisen Klirren absetzte. Die Zeremonie des Teetrinkens war zu Ende.
»Und jetzt, mein Junge, mach dich ab und setz dich an deine Hausaufgaben«, sagte er zu Martin.
Martin zog die Hand zurück, die nach einer Platte ausgestreckt war.
»Na los, mach schon«, sagte der Colonel herrisch. Martin stand auf und ging, wobei er die Hand schleppend über die Stühle und Tische gleiten ließ, wie um sein Gehen hinauszuzögern. Er schlug die Tür ziemlich laut hinter sich zu. Der Colonel erhob sich und blieb in seinem fest zugeknöpften Gehrock aufrecht zwischen ihnen stehen.
»Und ich muß mich auch aufmachen«, sagte er. Aber er zögerte einen Augenblick, als gäbe es nichts Besonderes, zu dem er sich aufmachen müsse. Sehr aufrecht stand er zwischen ihnen, als wollte er irgendeine Anweisung geben, könnte sich aber im Augenblick auf keine besinnen. Dann fiel es ihm ein.
»Ich wäre froh, eine von euch würde daran denken«, sagte er gleichermaßen an alle seine Töchter gewandt, »an Edward zu schreiben … Sagt ihm, daß er Mama schreiben soll.«
»Ja«, antwortete Eleanor.
Er ging auf die Tür zu. Aber er blieb stehen.
»Und sagt mir Bescheid, wenn Mama mich sehen möchte«, setzte er hinzu. Dann hielt er inne und zwickte seine jüngste Tochter ins Ohr.
»Schmutziger kleiner Wildfang«, sagte er, auf den grünen Fleck auf ihrer Schürze deutend. Sie deckte die Hand darüber. An der Tür blieb er noch einmal stehen.
»Vergeßt nicht«, sagte er, während er sich mit dem Knauf abmühte, »vergeßt nicht, Edward zu schreiben.« Endlich hatte er den Knauf gedreht und war weg.
Sie schwiegen. Etwas Angespanntes lag in der Atmosphäre, spürte Eleanor. Sie ergriff eins der kleinen Büchlein, die sie auf den Tisch gelegt hatte, und schlug es auf ihren Knien auf. Aber sie sah nicht hinein. Ihr Blick richtete sich ziemlich gedankenverloren auf das hintere Zimmer. Die Bäume im Garten hinter dem Haus fingen an zu sprießen; kleine Blätter – kleine, wie Ohren geformte Blätter waren an den Sträuchern. Die Sonne schien, aber launisch; sie kam und sie ging, ließ jetzt dies aufleuchten, jetzt jenes – »Eleanor«, unterbrach Rose ihre Gedanken. Sie hielt sich auf eine Art, die der ihres Vaters eigenartig ähnlich war.
»Eleanor«, wiederholte sie mit leiser Stimme, denn ihre Schwester achtete nicht auf sie.
»Ja?« sagte Eleanor und sah sie an.
»Ich möchte zu Lamley's gehen«, sagte Rose.
Sie sah aus wie das Ebenbild ihres Vaters, als sie so dastand, die Hände auf dem Rücken verschränkt.
»Es ist zu spät für Lamley's«, sagte Eleanor.
»Sie machen erst um sieben zu«, sagte Rose.
»Dann bitte Martin, mit dir zu gehen«, sagte Eleanor.
Das kleine Mädchen ging langsam zur Tür. Eleanor nahm ihre Rechnungsbücher wieder auf.
»Aber du darfst nicht allein gehen, Rose; du darfst nicht allein gehen«, sagte sie, sie über die Bücher hinweg ansehend, als Rose die Tür erreichte. Schweigend mit dem Kopf nickend, verschwand Rose.
Sie ging nach oben. Sie blieb vor dem Zimmer ihrer Mutter stehen und atmete den süßsäuerlichen Geruch ein, der über den Krügen, den Gläsern, den abgedeckten Schalen auf dem Tisch vor der Tür zu hängen schien. Dann ging sie weiter nach oben und blieb vor der Tür des Schulzimmers stehen. Sie wollte nicht hineingehen, denn sie hatte sich mit Martin gestritten. Erst hatten sie sich über Erridge und das Mikroskop gestritten, und dann darüber, auf die Katzen von Miss Pym zu schießen, die nebenan wohnte. Aber Eleanor hatte gesagt, sie müsse ihn fragen. Sie öffnete die Tür.
»Hallo, Martin –« fing sie an.
Er saß an einem Tisch, ein aufgeschlagenes Buch vor sich, und murmelte vor sich hin – vielleicht war es griechisch, vielleicht lateinisch.
»Eleanor hat gesagt –« fing sie an und merkte, wie erhitzt er aussah, und daß seine Hand sich über einem Stück Papier schloß, als wolle er es zerknüllen. »Ich soll dich fragen –« fing sie an, und straffte sich und blieb mit dem Rücken zur Tür stehen.
Eleanor lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Die Sonne lag jetzt auf den Bäumen im Garten hinter dem Haus. Die Knospen fingen an zu schwellen. Das Frühlingslicht hob natürlich die Schäbigkeit der Sesselbezüge hervor. Der große Sessel hatte einen dunklen Fleck, wo ihr Vater immer den Kopf anlehnte, fiel ihr auf. Aber wie viele Sessel und Stühle es hier gab – wie geräumig, wie luftig es hier im Vergleich zu dem Schlafzimmer war, in dem die alte Mrs Levy – Doch Milly und Delia schwiegen beide. Es war wegen der Dinnergesellschaft, fiel ihr ein. Wer von ihnen würde hingehen dürfen? Sie wollten beide hingehen. Sie wünschte, die Leute würden nicht immer sagen: »Bringen Sie eine Ihrer Töchter mit.« Sie wünschte, sie würden sagen, »Bringen Sie Eleanor mit«, oder »Bringen Sie Milly mit«, oder »Bringen Sie Delia mit«, statt sie alle in einen Topf zu werfen. Dann gäbe es keine Unklarheiten.
»Nun«, sagte Delia abrupt, »ich werde …«
Sie stand auf, als wolle sie irgendwohin gehen. Aber sie blieb stehen. Dann schlenderte sie zum Fenster hinüber, das auf die Straße hinausging. Die Häuser gegenüber hatten alle dieselben kleinen Vorgärten; dieselben Stufen; dieselben Säulen; dieselben Rundfenster. Aber jetzt brach die Dämmerung herein, und sie sahen geisterhaft und substanzlos im schwindenden Licht aus. Lampen wurden angezündet; ein Licht leuchtete im Wohnzimmer gegenüber; dann wurden die Vorhänge zugezogen, und das Zimmer wurde ausgelöscht. Delia stand und sah auf die Straße hinaus. Eine Frau aus den unteren Schichten schob einen Kinderwagen; ein alter Mann schlurfte mit auf dem Rücken verschränkten Händen vorbei. Dann war die Straße leer; eine Pause trat ein. Dann bimmelte ein Hansom die Straße entlang. Delia merkte augenblicklich auf. Würde er vor ihrer Tür anhalten oder nicht? Sie sah aufmerksamer hin. Aber dann ruckte der Kutscher zu ihrem Bedauern an den Zügeln, das Pferd stolperte weiter; die Droschke hielt zwei Türen weiter an.
»Jemand besucht die Stapletons«, rief sie nach hinten, während sie den Musselinvorhang ein Stück beiseite hielt. Milly trat zu ihr und stellte sich neben ihre Schwester, und gemeinsam beobachteten sie durch den Spalt, wie ein junger Mann, der einen Zylinder trug, aus der Droschke stieg. Er hob die Hand, um den Fahrer zu bezahlen.
»Laßt euch nicht beim Gucken erwischen«, sagte Eleanor warnend. Der junge Mann lief die Stufen hinauf ins Haus; die Tür schloß sich hinter ihm, und die Droschke fuhr davon.
Aber für den Augenblick standen die beiden Mädchen am Fenster und sahen auf die Straße hinaus. Die Krokusse waren gelb und violett in den Vorgärten. Die Mandelbäumchen und die Ligustersträucher hatten grüne Spitzen. Ein plötzlicher Windstoß fegte die Straße entlang und trieb einen Papierfetzen über das Pflaster; und ein kleiner Wirbel aus trockenem Staub folgte. Über den Dächern hing einer jener roten und launischen Londoner Sonnenuntergänge, die Fenster um Fenster golden auflodern lassen. Etwas Wildes lag in diesem Frühlingsabend; selbst hier, in der Abercorn Terrace, wechselte das Licht von Gold zu Schwarz, von Schwarz zu Gold. Die Gardine fallenlassend, drehte Delia sich um, kam ins Wohnzimmer zurück und sagte unvermittelt:
»O mein Gott!«
Eleanor, die sich ihre Bücher wieder vorgenommen hatte, blickte beunruhigt auf.
»Acht mal acht …« sagte sie laut. »Wieviel ist acht mal acht?«
Den Finger auf die Seite gelegt, um die Stelle zu markieren, sah sie ihre Schwester an. Wie sie da stand, den Kopf zurückgeworfen, die Haare rot im Glühen des Sonnenuntergangs, sah sie für einen Augenblick trotzig aus, sogar schön. Neben ihr wirkte Milly mausfarben und unscheinbar.
»Hör zu, Delia«, sagte Eleanor und klappte ihr Buch zu, »du mußt nur warten …« Sie meinte, konnte es jedoch nicht aussprechen, »bis Mama stirbt«.
»Nein, nein, nein«, sagte Delia und breitete die Arme aus. »Es ist hoffnungslos …« fing sie an. Doch sie unterbrach sich, denn Crosby war hereingekommen. Sie trug ein Tablett. Stück für Stück stellte sie, begleitet von einem nervenaufreibenden kleinen Klirren, die Tassen, die Teller, die Messer, die Marmeladengläser, die Kuchenplatten und die Platten mit Brot und Butter auf das Tablett. Dann ging sie, es vorsichtig vor sich her balancierend, hinaus. Eine Pause trat ein. Doch wieder kam sie herein, faltete das Tischtuch zusammen und rückte die Tische. Wieder trat eine Pause ein. Einen oder zwei Augenblicke später kam sie mit zwei Lampen mit seidenen Schirmen zurück. Sie stellte eine ins vordere Zimmer, eine ins hintere. Dann ging sie in ihren billigen, quietschenden Schuhen zum Fenster und zog die Vorhänge zu. Sie glitten mit einem vertrauten Klicken über die Messingstange, und bald waren die Fenster hinter dicken, gemeißelten Falten aus bordeauxrotem Plüsch verborgen. Als sie die Vorhänge in beiden Zimmern zugezogen hatte, schien sich eine tiefe Stille über den Raum zu senken. Die Außenwelt schien dicht und vollständig abgeschnitten zu sein. Weit weg, in der nächsten Straße, hörten sie die leiernde Stimme eines Straßenhändlers; die schweren Hufe von Lastgäulen klapperten langsam die Straße hinunter. Einen Augenblick lang knirschten Räder über die Straße; dann erstarben sie, und die Stille war vollständig.
Zwei gelbe Lichtkreise fielen unter die Lampen. Eleanor zog ihren Stuhl unter den einen, senkte den Kopf und setzte den Teil ihrer Arbeit fort, den sie immer bis zuletzt aufschob, weil sie ihn so sehr verabscheute – das Addieren von Zahlen. Ihre Lippen bewegten sich, und ihr Bleistift hinterließ kleine Punkte auf dem Papier, als sie Achten zu Sechsen addierte, Fünfen zu Vieren.
»So«, sagte sie nach einer Weile. »Das wäre erledigt. Jetzt setze ich mich zu Mama.«
Sie bückte sich, um ihre Handschuhe aufzuheben.
»Nein«, sagte Milly und warf die Zeitschrift beiseite, die sie aufgeschlagen hatte, »ich gehe …«
Plötzlich tauchte Delia aus dem hinteren Zimmer auf, in dem sie sich herumgedrückt hatte.
»Ich habe nicht das geringste zu tun«, sagte sie knapp. »Ich gehe.«
Sie ging nach oben, Schritt für Schritt, sehr langsam. Als sie die Schlafzimmertür mit den Krügen und Gläsern erreichte, die auf dem Tisch davor standen, hielt sie inne. Der süßsäuerliche Geruch nach Krankheit ließ ihr ein wenig übel werden. Sie konnte sich nicht dazu überwinden, hineinzugehen. Durch das kleine Fenster am Ende des Flurs sah sie flamingofarbene Wolkenkräusel vor einem blaßblauen Himmel liegen. Nach dem Halblicht des Wohnzimmers waren ihre Augen geblendet. Sie schien einen Augenblick vom Licht an die Stelle gebannt. Dann hörte sie von oben die Stimmen der Kinder – Martin und Rose zankten sich.
»Dann eben nicht!« hörte sie Rose sagen. Eine Tür schlug zu. Sie zögerte. Dann machte sie einen tiefen Atemzug, sah noch einmal auf den flammenden Himmel und klopfte an die Schlafzimmertür.
Die Pflegerin erhob sich leise; legte einen Finger auf die Lippen und verließ das Zimmer. Mrs Pargiter schlief. In eine Mulde der Kissen eingesunken, eine Hand unter der Wange, stöhnte Mrs Pargiter leise, als durchwandere sie eine Welt, in der selbst im Schlaf kleine Hindernisse auf ihrem Weg lagen. Ihr Gesicht war verquollen und schwer; die Haut gezeichnet von braunen Flecken; die Haare, die einmal rot gewesen waren, waren jetzt weiß, bloß daß sich seltsame gelbe Stellen darunter mischten, als seien einige der Strähnen in Eigelb getaucht worden. Schmucklos bis auf den Ehering, schienen allein ihre Finger anzuzeigen, daß sie die private Welt der Krankheit betreten hatte. Aber sie sah nicht aus, als läge sie im Sterben; sie sah aus, als könne sie in diesem Grenzland zwischen Leben und Tod für immer weiterexistieren. Delia konnte keine Veränderung an ihr erkennen. Als sie sich setzte, schien alles in ihr in vollem Fluß zu sein. Ein hoher schmaler Spiegel neben dem Bett reflektierte einen Teil des Himmels; im Augenblick gleißte rotes Licht darin auf. Der Frisiertisch wurde davon beleuchtet. Das Licht blitzte auf silbernen Fläschchen und gläsernen Fläschchen auf, alle in der perfekten Ordnung von Dingen arrangiert, die nicht benutzt werden. Zu dieser Abendstunde besaß das Krankenzimmer eine unwirkliche Reinlichkeit, Stille und Ordnung. Da neben dem Bett stand ein kleiner Tisch mit Brille, Gebetbuch und einer Vase mit Maiglöckchen. Auch die Blumen sahen unwirklich aus. Das einzige, was man tun konnte, war schauen.
Sie starrte auf die vergilbte Porträtzeichnung ihres Großvaters mit dem Glanzlicht auf der Nase; auf die Photographie ihres Onkels Horace in Uniform; auf die hagere, gepeinigte Gestalt am Kruzifix weiter rechts.
»Aber du glaubst doch gar nicht daran!« sagte sie wild, den Blick auf ihre im Schlaf versunkene Mutter gerichtet. »Du willst gar nicht sterben.«
Sie sehnte sich danach, daß sie starb. Da war sie – sanft, hinfällig, aber ewigwährend, in die Mulde der Kissen gebettet, ein Hindernis, ein Hemmnis, eine Verhinderung allen Lebens. Sie versuchte, ein Gefühl der Zuneigung, des Mitleids, in sich anzufachen. In jenem Sommer zum Beispiel, sagte sie zu sich selbst, in Sidmouth, als sie mich die Gartentreppe heraufrief … Aber die Szene schmolz in sich zusammen, als sie versuchte, sie in Augenschein zu nehmen. Natürlich war da auch noch die andere Szene – der Mann im Gehrock mit der Blume im Knopfloch. Aber sie hatte sich geschworen, nicht vor dem Zubettgehen daran zu denken. Woran sollte sie dann denken? An Großpapa mit dem weißen Glanzpunkt auf der Nase? An das Gebetbuch? Die Maiglöckchen? Oder den Spiegel? Die Sonne war verschwunden; der Spiegel war dunkel und reflektierte jetzt nur noch einen graubraunen Flecken Himmel. Sie konnte nicht länger widerstehen.
»Er trug eine weiße Blume im Knopfloch«, fing sie an. Es erforderte ein paar Minuten der Vorbereitung. Es mußte eine Halle geben; Töpfe mit Palmen; und im Saal unter ihnen die dichtgedrängten Köpfe von Leuten. Der Zauber fing an zu wirken. Sie wurde durchdrungen von wundervollen Wirbeln schmeichelnder und aufregender Gefühle. Sie stand auf dem Podium; ein großes Publikum hatte sich versammelt; alle schrien, winkten mit Taschentüchern, zischten und pfiffen. Dann erhob sie sich. Ganz in Weiß stand sie mitten auf dem Podium; Mr Parnell[10] stand an ihrer Seite.
»Ich spreche für die Sache der Freiheit«, fing sie an und breitete die Arme weit aus, »für die Sache der Gerechtigkeit …« Sie standen Seite an Seite. Er war sehr blaß, aber seine dunklen Augen glühten. Er drehte sich zu ihr um und flüsterte …
Plötzlich wurde sie unterbrochen. Mrs Pargiter hatte sich in ihren Kissen aufgerichtet.
»Wo bin ich?« rief sie. Sie war verängstigt und verwirrt, wie sie es oft war, wenn sie wach wurde. Sie hob die Hand; sie schien um Hilfe zu flehen. »Wo bin ich?« wiederholte sie. Einen Moment war auch Delia verwirrt. Wo war sie?
»Hier, Mama! Hier!« sagte sie wild. »Hier, in deinem eigenen Zimmer.«
Sie legte die Hand auf die Decke. Mrs Pargiter ergriff sie nervös. Sie sah sich im Zimmer um, als suche sie jemanden. Sie schien ihre Tochter nicht zu erkennen.
»Was ist passiert?« fragte sie. »Wo bin ich?« Dann sah sie Delia an und erinnerte sich.
»Oh, Delia – ich habe geträumt«, murmelte sie halb entschuldigend. Einen Augenblick blieb sie liegen und sah aus dem Fenster. Die Straßenlampen wurden angezündet, und ein plötzlicher, weicher Lichtschein breitete sich über die Straße draußen.
»Es war ein schöner Tag für …«, sie zögerte, »für …« Anscheinend konnte sie sich nicht erinnern, wofür.
»Ein herrlicher Tag, ja, Mama«, wiederholte Delia mit mechanischer Munterkeit.
»… für …« versuchte ihre Mutter es noch einmal.
Was für ein Tag war heute? Delia konnte sich nicht erinnern.
»… für den Geburtstag von Onkel Digby«, brachte Mrs Pargiter schließlich hervor.
»Richte ihm von mir aus – richte ihm von mir aus, wie froh ich bin.«
»Ich werde es ihm ausrichten«, sagte Delia. Sie hatte den Geburtstag ihres Onkels vergessen; aber ihre Mutter war in diesen Dingen sehr genau.
»Tante Eugénie –« fing sie an.
Aber ihre Mutter sah auf den Frisiertisch. Ein Lichtschein, der von der Lampe draußen hereinfiel, ließ das weiße Tuch extrem weiß wirken.
»Schon wieder ein frisches Tischtuch!« murmelte Mrs Pargiter verdrießlich. »Die Kosten, Delia, Die Kosten, Delia, die Kosten – das ist es, was mir Sorgen macht –«
»Ist schon gut, Mama«, sagte Delia dumpf. Ihre Augen waren auf das Porträt ihres Großvaters gerichtet; wieso, fragte sie sich, hatte der Künstler einen weißen Kreidetupfen auf seine Nasenspitze gesetzt?
»Tante Eugénie hat dir Blumen gebracht«, sagte sie.
Aus irgendeinem Grund wirkte Mrs Pargiter erfreut. Ihre Augen ruhten nachdenklich auf dem sauberen Tischtuch, das sie noch vor einem Moment an die Wäscherechnung erinnert hatte.
»Tante Eugénie …« sagte sie. »Wie gut ich mich« – ihre Stimme schien voller und runder zu werden – »wie gut ich mich an den Tag erinnere, an dem die Verlobung bekanntgegeben wurde. Wir waren alle im Garten; da kam ein Brief.« Sie hielt inne. »Da kam ein Brief«, wiederholte sie. Dann sagte sie eine Weile nichts mehr. Sie schien einer Erinnerung nachzuhängen.
»Der liebe kleine Junge starb, aber abgesehen davon …« Sie hielt wieder inne. Sie wirkte heute abend schwächer, dachte Delia; und eine plötzliche Freude durchflutete sie. Ihre Sätze waren abgehackter als sonst. Welcher kleine Junge war gestorben? Sie fing an, die Rippen der Bettdecke zu zählen, während sie darauf wartete, daß ihre Mutter weitersprach.
»Weißt du, früher sind alle Cousins und Cousinen im Sommer immer zusammengekommen«, ergriff ihre Mutter plötzlich wieder das Wort. »Dein Onkel Horace war da …«
»Der mit dem Glasauge«, sagte Delia.
»Ja. Er hat sich das Auge auf dem Schaukelpferd verletzt. Die Tanten hielten so große Stücke auf Horace. Sie sagten immer …« Hier trat eine lange Pause ein. Sie schien nach den genauen Worten zu suchen.
»Wenn Horace kommt … denkt daran, ihn nach der Eßzimmertür zu fragen.«
Eine seltsame Belustigung schien Mrs Pargiter zu erfüllen. Sie lachte sogar. Sie mußte an einen längst vergangenen Familienwitz denken, vermutete Delia, während sie beobachtete, wie das Lächeln flackerte und erstarb. Völlige Stille trat ein. Ihre Mutter lag mit geschlossenen Augen da; die Hand mit dem einzelnen Ring, die weiße, ausgezehrte Hand, lag auf der Bettdecke. In der Stille konnten sie eine Kohle auf dem Kaminrost klicken hören, und einen Straßenhändler, der die Straße entlang seinen Spruch herunterleierte. Mrs Pargiter sagte nichts mehr. Sie lag völlig still. Dann seufzte sie tief auf.
Die Tür ging auf, und die Pflegerin kam herein. Delia erhob sich und ging hinaus. Wo bin ich? fragte sie sich, während sie einen weißen Krug anstarrte, der vom Licht der untergehenden Sonne rosa überhaucht war. Einen Augenblick lang schien sie sich in einem Grenzland zwischen Leben und Tod zu befinden. Wo bin ich? wiederholte sie, den Blick auf den rosafarbenen Krug gerichtet, denn alles sah so seltsam aus. Dann hörte sie im Stockwerk über sich Wasser rauschen und Füße über den Boden tappen.
»Da bist du ja, Rosie«, sagte Nurse und sah vom Rad der Nähmaschine auf, als Rose ins Zimmer kam.
Das Kinderzimmer war hell erleuchtet; auf dem Tisch stand eine Lampe ohne Schirm. Mrs C., die jede Woche mit der Wäsche kam, saß mit einer Tasse in der Hand im Sessel. »Sei ein braves Mädchen und hol deine Näharbeit«, sagte Nurse, als Rose Mrs C. die Hand gab, »sonst wirst du nie rechtzeitig zu Papas Geburtstag fertig«, fügte sie hinzu und räumte auf dem Kinderzimmertisch ein Stückchen Platz frei.
Rose zog die Tischschublade auf und nahm den Schuhbeutel heraus, den sie mit einem Muster aus blauen und roten Blumen für den Geburtstag ihres Vaters bestickte. Immer noch mußten mehrere Büschel der kleinen, mit Bleistift vorgezeichneten Rosen ausgearbeitet werden. Sie breitete ihre Arbeit auf dem Tisch aus und begutachtete sie, während Nurse mit der Geschichte über Mrs Kirbys Tochter fortfuhr, die sie Mrs C. erzählte. Aber Rose hörte nicht zu.
Dann gehe ich eben allein, beschloß sie, während sie den Schuhbeutel glattstrich. Wenn Martin nicht mit mir kommt, gehe ich eben allein.
»Ich hab mein Nähkästchen im Wohnzimmer gelassen«, sagte sie laut.
»Na, dann geh und hol es«, sagte Nurse, aber sie achtete nicht auf sie; sie wollte mit der Geschichte weiterkommen, die sie Mrs C. über die Tochter des Gemüsehändlers erzählte.
Jetzt fängt das Abenteuer an, sagte Rose zu sich selbst, als sie sich auf Zehenspitzen in ihr Schlafzimmer schlich. Jetzt mußte sie sich mit Munition und Proviant versorgen; sie mußte Nurses Haustürschlüssel stehlen; aber wo war der? Jeden Abend wurde er aus Angst vor Einbrechern an einer anderen Stelle versteckt. Entweder würde er unter dem Taschentuchetui liegen, oder in dem kleinen Kästchen, in dem Nurse die goldene Uhrkette ihrer Mutter aufbewahrte. Da war er. Jetzt hatte sie ihre Pistole und ihre Munition, dachte sie, als sie ihre eigene Geldbörse aus ihrer eigenen Schublade nahm, und genug Proviant, dachte sie, als sie sich Hut und Mantel über den Arm hängte, für mindestens zwei Wochen.
Sie schlich am Kinderzimmer vorbei und die Treppe hinunter. Sie spitzte die Ohren, als sie an der Tür des Schulzimmers vorbeikam. Sie mußte aufpassen, daß sie nicht auf einen trockenen Ast trat, und daß kein Zweig unter ihren Füßen knackte, mahnte sie sich selbst, als sie auf Zehenspitzen weiterschlich. Wieder blieb sie stehen und lauschte, als sie an der Tür zum Zimmer ihrer Mutter vorbeikam. Alles war still. Dann hielt sie einen Augenblick auf dem Treppenabsatz inne und sah in die Diele hinunter. Der Hund lag schlafend auf der Matte; die Luft war rein; die Diele war leer. Im Wohnzimmer hörte sie Stimmen murmeln.
Mit größter Sanftheit drehte sie das Schnappschloß der Haustür und zog sie mit einem kaum hörbaren Klicken hinter sich zu. Bis zur Ecke lief sie tief geduckt und dicht an die Mauer gedrückt, damit niemand sie sehen konnte. Als sie die Ecke unter dem Goldregenbaum erreichte, richtete sie sich auf.
»Ich bin Pargiter von Pargiters Reiterei«, sagte sie, ihren Arm schwenkend, »ich eile zur Rettung herbei!«
Sie ritt mitten in der Nacht in Erfüllung einer verzweifelten Mission zu einer belagerten Garnison, sagte sie zu sich selbst. Sie hatte eine geheime Botschaft – sie schloß die Faust um ihre Börse –, die sie dem General persönlich überbringen mußte. Das Leben aller hing davon ab. Die britische Fahne wehte noch über dem Hauptturm – Lamley's Laden war der Hauptturm; der General stand auf dem Dach von Lamley's Laden, das Teleskop vor dem Auge. Das Leben aller hing davon ab, daß sie durch feindliches Gebiet zu ihnen geritten kam. Hier galoppierte sie durch die Wüste. Sie fing an zu traben. Es wurde allmählich dunkel. Die Straßenlampen wurden angezündet. Der Laternenanzünder schob seine Stange durch die kleine Falltür; die Bäume in den Vorgärten zeichneten ein waberndes Muster aus Schatten auf das Pflaster; das Pflaster dehnte sich breit und dunkel vor ihr aus. Dann kam die Kreuzung; und dann Lamley's Laden inmitten der kleinen Insel der Geschäfte auf der gegenüberliegenden Seite. Sie mußte nur die Wüste durchqueren, die Furt durch den Fluß finden, und sie war in Sicherheit. Den Arm, der die Pistole hielt, hoch erhoben, gab sie ihrem Pferd die Sporen und galoppierte die Melrose Avenue hinunter. Als sie an der Briefkastensäule vorbeistürmte, tauchte plötzlich die Gestalt eines Mannes unter der Gaslaterne auf.
»Der Feind!« schrie Rose sich selbst zu. »Der Feind! Peng!« schrie sie, zog den Abzug ihrer Pistole und sah ihm im Vorbeilaufen mitten ins Gesicht. Es war ein schauerliches Gesicht: weiß, schuppig, pockennarbig; zu einem lüsternen Grinsen verzogen. Er streckte den Arm aus, wie um sie aufzuhalten. Fast hätte er sie eingefangen. Sie hetzte an ihm vorbei. Das Spiel war aus.
Sie war wieder sie selbst, ein kleines Mädchen, das seiner Schwester nicht gehorcht hatte, in Hausschuhen, und auf die Sicherheit von Lamley's Laden zuflüchtete.
Mrs Lamley mit ihrem frischem Gesicht stand hinter dem Ladentisch und faltete die Zeitungen. Umgeben von ihren Uhren für zwei Pennys, ihren auf Karton aufgenähten Werkzeugen, Spielzeugbooten und Schachteln mit billigem Briefpapier dachte sie, wie es schien, an etwas Erfreuliches; denn sie lächelte. Da platzte Rose herein. Sie hob fragend den Kopf.
»Hallo, Rosie!« rief sie. »Was kann ich für dich tun, Liebchen?«
Sie ließ die Hand auf dem Zeitungsstapel liegen. Rose stand außer Atem vor ihr. Sie hatte vergessen, weswegen sie gekommen war.
»Ich hätte gern die Schachtel mit den Enten aus dem Fenster«, erinnerte sie sich schließlich.
Mrs Lamley watschelte um den Ladentisch herum, um sie zu holen.
»Ist es nicht ziemlich spät für ein kleines Mädchen wie dich, noch ganz allein unterwegs zu sein?« fragte sie und sah sie an, als wisse sie ganz genau, daß sie in Hausschuhen aus dem Haus gelaufen war und ihrer Schwester nicht gehorcht hatte.
»Gute Nacht, Liebchen, und lauf schnell nach Hause«, sagte sie, als sie ihr das Päckchen gab. Die Kleine schien auf der Schwelle zu zögern: sie stand da und starrte die Spielsachen unter der hängenden Öllampe an; dann ging sie zögernd hinaus.
Ich habe dem General in eigener Person meine Botschaft überbracht, sagte sie zu sich selbst, als sie wieder draußen auf dem Pflaster stand. Und das hier ist die Trophäe, sagte sie und klemmte sich die Schachtel unter den Arm. Ich kehre im Triumph mit dem Kopf des Rebellenführers zurück, sagte sie zu sich selbst, während sie die Melrose Avenue entlangspähte, die sich vor ihr dehnte. Ich muß meinem Pferd die Sporen geben und galoppieren. Aber die Geschichte wirkte nicht mehr. Die Melrose Avenue blieb die Melrose Avenue. Sie sah sie entlang. Vor ihr lag das langgezogene Stück der völlig leeren Straße. Die Bäume warfen ihre zitternden Schatten über das Pflaster. Die Laternen standen sehr weit voneinander entfernt, und zwischen ihnen lagen tiefe Pfützen der Dunkelheit. Sie fing an zu traben. Plötzlich, als sie am Laternenmast vorbeikam, sah sie den Mann wieder. Er lehnte mit dem Rücken am Mast, und das Licht der Gaslampe flackerte über sein Gesicht. Als sie an ihm vorbeikam, bewegte er die Lippen vor und zurück. Er gab ein miauendes Geräusch von sich. Aber er streckte die Hände nicht nach ihr aus; sie waren damit beschäftigt, seine Kleidung aufzuknöpfen.
Sie floh an ihm vorbei. Sie glaubte, ihn hinter sich herkommen zu hören. Sie hörte seine Füße über das Pflaster poltern. Alles bebte, als sie rannte; rosa und schwarze Punkte tanzten vor ihren Augen, als sie die Stufen vor dem Haus hinauflief, den Schlüssel ins Schloß steckte und die Tür aufstieß. Es war ihr egal, ob sie ein Geräusch machte oder nicht. Sie hoffte, daß jemand kommen und mit ihr sprechen würde. Aber niemand hörte sie. Die Diele war leer. Der Hund lag schlafend auf der Matte. Stimmen murmelten immer noch im Wohnzimmer.
»Und wenn es dann endlich brennt«, sagte Eleanor, »wird es viel zu heiß sein.«
Crosby hatte die Kohlen zu einem großen schwarzen Gebirge aufgeschichtet. Ein gelber Rauchfaden wand sich plötzlich darum herum; die Flammen griffen allmählich, und wenn das Feuer dann endlich brannte, würde es viel zu heiß sein.
»Sie kann sehen, daß die Pflegerin den Zucker stiehlt, sagt sie. Sie kann ihren Schatten an der Wand sehen«, sagte Milly. Sie sprachen über ihre Mutter.
»Und dazu Edward«, fügte sie hinzu, »der immer zu schreiben vergißt.«
»Dabei fällt mir ein«, sagte Eleanor. Sie mußte daran denken, Edward zu schreiben. Aber dafür war nach dem Dinner Zeit. Sie wollte nicht schreiben; sie wollte nicht reden; wenn sie von Grove zurückkam, hatte sie immer das Gefühl, daß sich verschiedene Dinge gleichzeitig abspielten. Worte wiederholten sich unablässig in ihrem Kopf – Worte und Bilder. Sie dachte an die alte Mrs Levy, die von Kissen gestützt in ihrem Bett saß, die weißen Haare zu einem dicken Wust aufgeplustert, wie eine Perücke, und das Gesicht so rissig wie ein alter glasierter Krug.
»Die wo gut zu mir warn, die vergeß ich nich … Die wo in ihren Kutschen gefahrn sin, wie ich 'ne arme Witfrau war, die wo die Wäsche geschrubbt und gemangelt hat –« Hier streckte sie den Arm aus, der knorrig und weiß war wie die Wurzel eines Baums. »Die wo gut zu mir warn, die vergeß ich nich …« wiederholte Eleanor, während sie ins Feuer sah. Dann kam die Tochter herein, die bei einem Schneider arbeitete. Sie trug Perlen so groß wie Hühnereier; sie hatte angefangen, sich das Gesicht zu schminken; sie sah wunderhübsch aus. Aber Milly machte eine kleine Bewegung.
»Ich habe gerade gedacht«, sagte Eleanor aus einer Augenblickslaune heraus, »daß die Armen sich mehr amüsieren als wir.«
»Die Levys?« fragte Milly zerstreut. Dann hellte ihr Gesicht sich auf.
»Erzähl mir von den Levys«, fügte sie hinzu. Eleanors Beziehungen zu »den Armen« – den Levys, den Grubbs, den Paravicinis, den Zwinglers und den Cobbs – amüsierten sie immer. Aber Eleanor sprach nicht gern über »die Armen«, als wären sie Personen aus einem Buch. Sie empfand große Bewunderung für Mrs Levy, die an Krebs starb.
»Oh, da ist alles ganz wie immer«, sagte sie kurz angebunden. Milly sah sie an. Eleanor »brütet«, dachte sie. In der Familie war es gang und gäbe zu witzeln, »Oh, aufgepaßt. Eleanor brütet. Es ist ihr Grove-Tag.« Eleanor schämte sich deswegen, aber aus irgendeinem Grund war sie immer reizbar, wenn sie von Grove zurückkam – so viele verschiedene Dinge gingen ihr dann immer gleichzeitig durch den Kopf: Canning Place; Abercorn Terrace; dieses Zimmer; jenes Zimmer. Da war die alte Jüdin, die in ihrem stickigen kleinen Zimmer im Bett saß; dann kam man hierher zurück, und Mama war krank; Papa schlecht gelaunt; und Delia und Milly zankten sich wegen einer Einladung … Aber sie riß sich zusammen. Sie sollte versuchen, etwas zu sagen, was ihre Schwester amüsieren würde.
»Mrs Levy hatte wie durch ein Wunder die Miete da«, sagte sie. »Lily hilft ihr. Lily hat eine Stellung in einem Schneidergeschäft in Shoreditch gefunden. Sie kam über und über mit Perlen und was weiß ich behangen herein. Sie lieben schöne Dinge – die Juden«, fügte sie hinzu.
»Die Juden?« sagte Milly. Sie schien über den Geschmack der Juden nachzudenken; und ihn dann abzulehnen.
»Ja«, sagte sie. »Glänzende Dinge.«
»Sie ist ganz besonders hübsch«, sagte Eleanor im Gedanken an die roten Wangen und die weißen Perlen.
Milly lächelte; Eleanor trat immer für die Armen ein. Sie hielt Eleanor für die beste, die klügste, die bemerkenswerteste Person, die sie kannte.
»Ich glaube, du gehst für dein Leben gern zu ihnen«, sagte sie. »Ich glaube, wenn es nach dir ginge, würdest du hingehen und selbst dort leben«, fügte sie mit einem kleinen Seufzer hinzu.
Eleanor setzte sich anders hin. Sie hatte natürlich ihre Träume, ihre Pläne; aber sie wollte nicht darüber sprechen.
»Vielleicht wirst du es tatsächlich tun, wenn du verheiratet bist?« sagte Milly. Es lag etwas Mürrisches und doch Klagendes in ihrer Stimme. Die Dinnergesellschaft; die Dinnergesellschaft bei den Burkes, dachte Eleanor. Sie wünschte sich, Milly würde die Rede nicht ständig aufs Heiraten bringen. Was wissen sie denn schon vom Heiraten? fragte sie sich. Sie sind viel zu viel zu Hause, dachte sie; nie sehen sie jemanden, der nicht zu ihrem eigenen Kreis gehört. Tag für Tag sind sie hier eingepfercht … Deshalb hatte sie gesagt, »Die Armen amüsieren sich mehr als wir.« Der Gedanke war ihr eingefallen, als sie in dieses Wohnzimmer zurückgekommen war, mit all den Möbeln und den Blumen und den Krankenpflegerinnen … Wieder hielt sie inne. Sie mußte warten, bis sie allein war – bis sie sich später die Zähne putzte. Wenn sie mit den anderen zusammen war, mußte sie sich verbieten, gleichzeitig an zwei verschiedene Dinge zu denken. Sie nahm den Schürhaken und schlug damit auf die Kohlen ein.
»Sieh nur! Wie schön!« rief sie aus. Eine Flamme tanzte ganz oben auf den Kohlen, eine flinke und tändlerische Flamme. Es war die Art von Flamme, die sie als Kinder oft hervorgelockt hatten, indem sie Salz ins Feuer warfen. Sie schlug noch einmal zu, und ein Schauer goldäugiger Funken stob den Schornstein hinauf. »Weißt du noch«, sagte sie, »wie wir Feuerwehr gespielt und Morris und ich den Schornstein in Brand gesetzt haben?«
»Und Pippy ist losgerannt und hat Papa geholt«, sagte Milly. Sie verstummte. In der Diele war ein Geräusch. Ein Stock scharrte; jemand hängte einen Mantel auf. Eleanors Augen leuchteten auf. Das war Morris – ja; sie kannte das Geräusch, das er machte. Jetzt kam er herein. Sie sah sich mit einem Lächeln um, als die Tür geöffnet wurde. Milly sprang auf.
Morris versuchte, sie zurückzuhalten.
»Geh nicht –« fing er an.
»Doch!« rief sie. »Ich gehe. Ich gehe und nehme ein Bad«, fügte sie aus einer Augenblickslaune heraus hinzu. Sie ließ sie allein.
Morris setzte sich in den Sessel, den sie freigemacht hatte. Er war froh, Eleanor allein anzutreffen. Einen Augenblick lang schwiegen sie beide. Sie beobachteten den gelben Rauchfaden, und die kleine Flamme, die flink und tändlerisch hier und da über den schwarzen Kohlenberg tänzelte. Dann stellte er die übliche Frage:
»Wie geht es Mama?«
Sie sagte es ihm; es gab keine Veränderung: »außer daß sie mehr schläft«, sagte sie. Er runzelte die Stirn. Er verlor allmählich sein jungenhaftes Aussehen, dachte Eleanor. Das war das Schlimmste an der Juristerei, sagten alle; man mußte immerzu warten. Er arbeitete als Anwaltsassistent bei Sanders Curry; und es war öde Arbeit, den ganzen Tag mußte man bei Gericht herumsitzen und warten.
»Was macht der alte Curry?« fragte sie – der alte Curry hatte ein reizbares Temperament.
»Ein bißchen griesgrämig«, sagte Morris finster.
»Und was hast du den ganzen Tag gemacht?« fragte sie.
»Nichts Besonderes«, antwortete er.
»Immer noch Evans gegen Carter?«
»Ja«, sagte er kurz.
»Und wer wird gewinnen?« fragte sie.
»Carter natürlich«, antwortete er.
Wieso »natürlich«, hätte sie gern gefragt. Aber vor ein paar Tagen hatte sie etwas Dummes gesagt – etwas, das bewies, daß sie nicht zugehört hatte. Sie brachte Sachen durcheinander; zum Beispiel, was war der Unterschied zwischen dem Common Law und der anderen Art Recht?[11] Sie sagte nichts. Schweigend saßen sie beieinander und beobachteten die Flamme, die auf den Kohlen spielte. Es war eine grüne Flamme, flink, tändlerisch.
»Findest du, daß ich ein schrecklicher Dummkopf war?« fragte er plötzlich. »Angesichts dieser ganzen Krankheit, und wo Edward und Martin finanziert werden müssen – muß Papa es recht schwierig finden.« Er runzelte die Stirn auf eben die Weise, die sie für sich denken ließ, daß er sein jungenhaftes Aussehen verlor.