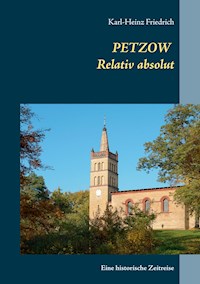Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Gutsbesitzerfamilie (von) Kaehne bestimmte über mehr als dreihundert Jahre Geschichte, Wohl und Wehe in Petzow, einem kleinen Dorf bei Werder an der Havel. Theodor Fontane bezeichnete sie einmal als "einen Ausnahmefall" indem sie es geschafft habe, sich "von der Pike auf" in den deutschen Adel "aufzudienen". Die Familiengeschichte der Kaehnes erreichte ihren gesellschaftlichen Höhepunkt, als ihr herausragendster Vertreter, Carl Friedrich August Kaehne (1775-1857), der als geistiger Vater der Petzower Ortserneuerung unter Mitwirkung von Lenné und Schinkel gilt, durch den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. in den Adelsstand erhoben wurde (1840). Sie erlebte ihre tieftraurigsten Zeiten, als die letzten beiden Gutsbesitzer als "Schießkaehnes" in die Geschichte eingingen, von Kurt Tucholsky in seinem Gedicht "Kähne" (1922) gegeißelt. Im Ergebnis umfangreicher Archivrecherchen wird dem Leser auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise Leben, Rolle und Bedeutung einer außergewöhnlichen Familie nähergebracht, die in entscheidendem Maße den kleinen märkischen Ort Petzow prägte, wobei die "Familienoberhäupter" den Mittelpunkt der Betrachtungen bilden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CARL FRIEDRICH AUGUST VON KAEHNE
1775-1857
INHALT
VORWORT
PETER I. (1590-1659)
CHRISTOPH (1638-1673)
PETER III. (1661-1716)
PETER IV. (1698-1741)
PETER V. (1720-1796)
AUGUST (1751-1814)
CARL I. (1775-1857)
CARL II. 1819-1910)
CARL III. (1860-1937)
CARL IV. (1894-1946)
NACHWORT
ANHANG
ERLÄUTERUNGEN
BILDNACHWEIS
ANMERKUNGEN
VORWORT
Wer immer nach Petzow kommt, kann an seinem einmaligen, denkmalgeschützten Ensemble von Dorf, Kirche, Herrenhaus und Park nicht vorbei. Als Auftraggeber und geistiger Vater der von Schinkel und Lenné wesentlich beeinflussten Komposition von Architektur und Gartenkunst in einer reizvollen Landschaft gilt der Freund der beiden, der damalige Gutsbesitzer und Amtsrat Carl Friedrich August von Kaehne (1775-1857). 1840 wird er durch den König Friedrich Wilhelm IV. geadelt. Petzow verdankt bis in die Gegenwart dem ambitionierten Dorfverschönerungsplan des Amtsrates einen bedeutenden Teil seines Rufes als ein „Juwel der Mark“.
Doch ohne eine solide Basis hätte Carl Friedrich August seine Visionen nicht verwirklichen können. Davor standen zwei für die Ahnen von „Peter Kaehne dem Ersten“ lange, mühselige und zum Teil von dramatischen Umständen geprägte Jahrhunderte. Theodor Fontane bezeichnete die Familie als „einen Ausnahmefall“ indem sie es geschafft habe, sich „von der Pike auf“ in den deutschen Adel emporzuarbeiten.1 Wer waren die Kaehnes? Wir wollen versuchen, darauf eine Antwort zu finden.
Der kleine märkische Ort Petzow, der heute ein Ortsteil der Stadt Werder (Havel) ist, wird erstmalig in einem Schriftstück erwähnt, das einer Lehnsaufzeichnung aus dem Jahre 1419 entstammt und im Thüringischen Landeshauptarchiv Weimar zu finden ist. Durch die Herzöge von Sachsen-Wittenberg als Lehnsherren, die die Landesherrschaft am Westufer des Schwielowsee ausübten, wird hier ein Eigentumswechsel bestätigt.2 1437 geht der Hof Petzow an das Kloster Lehnin über und verbleibt dort bis 1542. Im Jahre 1605 verfügt der Schulze über 2 Lehn- und 4 Erbhufe und 1624 gibt es hier sieben Hüfner, einen Hirten und einen Laufschmied.
Während des dreißigjährigen Krieges (1618-1648) siedelt Peter Kaehne (1590-1659) mit Frau und Kind in Petzow an und es beginnt in Not, Tragik und bitterer Armut eine außergewöhnliche Familiengeschichte. Gut zweihundert Jahre später erstrahlt das Haus „von Kaehne“ als eines der angesehensten des deutschen Landadels, nach weiteren hundert Jahren ist die Familie „im Mannesstamm erloschen“.
Die Kaehnes bestimmten über dreihundert Jahre lang Geschichte, Wohl und Wehe in Petzow. Wer die Kaehnes waren, darüber kann eine ganze Reihe von Akten und Dokumenten in verschiedenen Archiven Aufschluss geben. Neben umfangreichen weiteren Quellen aus dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv (BLHA) in Potsdam sind vor allem die Familienchronik von Karl Friedrich August und Carl Wilhelm Kaehne von 1837 und der Entwurf einer Familienchronik von Carl Heinz von Kaehne von 1938 von hoher Aussagekraft, zumal die damaligen Verfasser sich ihrerseits schon auf eine gesicherte Dokumentenüberlieferung stützen konnten. Weiteres Material wird im Archiv der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) in Berlin, dem Geheimen Staatsarchiv Berlin-Dahlem (GStAPK), dem Kreisarchiv Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig, dem Domstiftsarchiv Brandenburg und an einigen anderen Stellen verwahrt. Die hier verwendeten Archivalien sind für jeden Interessierten frei zugänglich.
Es gab und gibt eine Reihe Kontakte des Autors mit Angehörigen der Kaehne-Familie, von denen Peter Carl Eberhard Martin Hofacker von Kaehne aus Mönchengladbach (1935-2017), Sohn des Familienchronisten von 1938, Carl Heinz von Kaehne, und bis zu seinem Tod Sprecher der Erbengemeinschaft von Kaehne, besonders hervorgehoben sei. Viele Gespräche und die dankenswerte Überlassung von Reproduktionen aus seinem Archiv sowie seine Unterstützung bei der Einsicht in Archivakten und der Erwerbung von Kopien archivalischer Quellen sind für die heimatgeschichtliche Forschung in Petzow von großem Wert. Sehr bedeutungsvoll, weil unter erstmaliger Wortmeldung eines von Kaehne, war die von ihm und dem Autor gemeinsam initiierte Herausgabe einer 2003 erschienenen Zeitungsserie über die Ereignisse um den Tod des Berliner Flugzeugingenieurs Alfred Mehlhemmer im Petzower Park im Jahre 1943. Peter von Kaehnes gewissenhaft abwägende und von Toleranz getragene Sichtweise für historische Prozesse und Ereignisse ist beispielgebend für einen wohlbedachten Umgang mit der 300-jährigen, widerspruchsreichen Historie der Petzower Kaehnes. Seine Fähigkeit, sich dabei sowohl den positiven Seiten des Erbes der Petzower Gutsbesitzer als auch einer – für ihn selbst durchaus nicht leichten – kritischen Einschätzung der Lebensart einiger ihrer Protagonisten immer offen zu stellen, bestärkte letztendlich auch den Autor, als er sich des vorliegenden Themas annahm.
Helmut Christoph Carl Heinz von Kaehne aus Mühltal-Nieder-Beerbach überließ dem Heimatverein Petzow einige Dokumente sowie eine von ihm zusammengestellte Ahnentafel, die ein wichtiges und tragendes Element der Forschungen darstellt.
Die Kunsthistorikerin Pia Kühn-von Kaehne, eine Nachfahrin der Priesholzer Stammbaum-Linie3, mit der der Autor im Jahre 2011 eine Festschrift für die neue Petzower Kirchenorgel in gemeinsamer Redaktion mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark herausbrachte, vermittelt in ihrer Magisterarbeit von 1996 über das historische Ortsensemble von Petzow auch einen Einblick in die Geschichte der Familie (von) Kaehne. Die wissenschaftliche Arbeit, die z.B. der Stadtverwaltung Werder (Havel) und auch dem Autor vorliegt, wurde bereits vielfach zu historischen Beiträgen herangezogen. Sie bietet wie kein zweites Dokument eine Fülle von Informationen, Zusammenhängen und kulturhistorischen Erläuterungen auf der Basis seriöser historischer Forschung.4
Neben den Primärquellen, den Archivakten, bilden das Werk Pia Kühn-von Kaehnes sowie die schon genannten Aufzeichnungen von Carl Friedrich August/Carl Wilhelm Kaehne aus dem Jahre 1837 und Carl Heinz von Kaehne von 1938 den wesentlichen Grundstock der Quellen für dieses Buch. Auch wurden Artikel des verdienstvollen Potsdamer Archivars Dr. Gebhard Falk, dem eine akribische Quellenforschung zum Thema zu verdanken ist, zu Rate gezogen.
Anfang 2013 ist es dem Autor mit dem Kontakt zu einem in den USA lebenden Nachfahren der Petzower Linie gelungen, bisher in der Öffentlichkeit unbekanntes Bildmaterial zu erhalten, welches in hervorragender Weise die bisherigen Forschungsergebnisse ergänzt. Der in Fort Wayne (Indiana) lebende Bernhard Heinrich Westhoff ist als Kind im Jahre 1956 zusammen mit seiner Mutter Rosemarie (1919-2012) aus Deutschland in die USA ausgereist. Rosemarie Westhoff war die Tochter von Mignon von Kaehne (1887-1955) aus deren Ehe mit Wilhelm Modrow (1888-1924) und damit Enkeltochter von Carl von Kaehne III. (1860-1937) und dessen Frau Olga (1854-1948). Sie hinterließ neben dem bereits genannten Konvolut auch handschriftliche Notizen zur Familiengeschichte. Die Eigentümer erteilten dankenswerterweise ihre Genehmigung zur Veröffentlichung dieses Materials.
Der Autor, der selbst in Petzow wohnt, beschäftigt sich seit der Jahrtausendwende mit der Ortsgeschichte und der Familiengeschichte der Kaehnes. Etliche Ergebnisse dieser Forschungen spiegeln sich bereits in der ortsgeschichtlichen Ausstellung des Heimatmuseums „Waschhaus am Haussee“, auf der Internetseite des Heimatvereins, in den in unregelmäßigen Abständen herausgegebenen „Schriften des Heimatvereins Petzow e.V.“, wider. Zahlreiche Buchveröffentlichungen sowie Fernseh- und Rundfunksendungen hat der Autor im Laufe der Jahre mit Informationen zur Ortsgeschichte unterstützt. In Vorträgen, bei Führungen und Wanderungen und in persönlichen Gesprächen wurde aber auch deutlich, dass von Einwohnern, Besuchern und von vielen anderen historisch Interessierten ein bemerkenswert großes Bedürfnis an der Geschichte der Kaehne-Familie besteht. Die vom Heimatverein Petzow teilweise mehrfach aufgelegten kostenlosen Schriften über die Ortshistorie und zu einzelnen Themen aus der Kaehne-Geschichte5 erfreuen sich bereits großer Beliebtheit. Frühere Publikationen zur Ortsgeschichte sind inzwischen vergriffen.
Indem das vorliegende Buch Wissenswertes über die Gutsbesitzerfamilie vorstellt, möchte es eine Lücke in der Heimatgeschichtsschreibung schließen und dazu beitragen, eventuelle Wissensdefizite zu beseitigen. Es soll aber zugleich neugierig machen und zeigen, wie hochinteressant und spannend Geschichte auch an einem noch so kleinen Ort sein kann. Daher findet der Leser auch immer wieder Anhaltspunkte für die allgemeine historische Situation vor. Zu komplizierten zeitgeschichtlichen Begrifflichkeiten und Besonderheiten (Lehnswesen, Separation, Fideikommiss) wird in verschiedener Form eine kurze Definition angeboten. Die chronologisch ausgerichtete Erzählweise orientiert sich bewusst an den genannten familiengeschichtlichen Überlieferungen.
Dieses Buch ist das Ergebnis langer heimatgeschichtlicher Forschungsarbeit.
Der Band wurde gegenüber der Erstausgabe von 2014 aktualisiert. Allen, die daran ihren Anteil haben, sei hiermit herzlich gedankt. Recherchen und Niederschriften erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen.
Gern werden Hinweise, Ergänzungen, Richtigstellungen entgegengenommen, gleichwohl sind beim Autor bereits eingegangene Hinweise zur ersten Ausgabe hier berücksichtigt worden.
Petzow, im Frühjahr 2019
Karl-Heinz Friedrich
PETER I.(1590-1659)
Um zu den Wurzeln der Familie Kaehne6 vorzudringen, müssen wir uns zunächst in das 17. Jahrhundert zurück begeben. Versuchen wir einmal, uns zu vorzustellen, wie es sich zugetragen haben könnte…
Es ist in den 1630er Jahren. Mitten im Krieg, den man später den Dreißigjährigen nennen wird. Peter Kaehne 7, ein böhmischer Bauer8, kommt mit seiner Familie erschöpft und nach langen Irrwegen aus seiner Heimat in einem kleinen brandenburgischen Dorf namens Petzow9 an. Der Ort ist arg geschunden und verwahrlost, es herrscht große Armut. Mehrmals zogen plündernde Soldatenhorden, ob Schweden oder Kaiserliche, durch ihn hindurch. Vieles liegt wüst.
Aus seiner Heimat geflohen ist Kaehne, in den Wirren des Krieges, wie Zehntausende. Nie wissend, wohin sich das Blatt am Ende dieses Infernos wenden würde. Vielleicht scheint ihm Brandenburg für eine Bleibe etwas sicherer. Sicherer als Böhmen, wo er wegen seines protestantischen Glaubens um sein Leben fürchten muss. Aber auch in der Mark tobt der Krieg. Der oft unentschlossen agierende Kurfürst Georg Wilhelm laviert ständig zwischen dem katholischen Kaiser Ferdinand und dem protestantischen Schwedenkönig Gustav II. Adolf. Doch der Schwede ist nicht zuletzt auch des Kurfürsten Schwager. Die Ehe, die Gustav Adolf 1620 mit Georg Wilhelms Schwester Marie Eleonore einging, bindet Brandenburg immerhin familiär an das protestantische Lager.10 Vielleicht ist das ein kleiner Hoffnungsfunke in Peter Kaehne, vielleicht hat er aber auch gar nicht so weit gedacht. Warum er sich ausgerechnet hier niederlässt, wird sein Geheimnis bleiben.
Peter Kaehne bleibt und richtet sich trotz aller Widrigkeiten ein. Zusammen mit ihm seine Frau und sein Sohn Andreas. Später, in zweiter Ehe, wird 1638 ein zweiter Sohn, Christoph, geboren, noch später mit Peter ein dritter. Über die beiden Frauen Peter Kaehnes ist leider nichts Näheres zu erfahren. Der Amtshauptmann von Lehnin, Hans von Rochow, soll um 1660 in einem Schreiben in einer Lehnsangelegenheit, über die gleich zu lesen sein wird, an den Kurfürsten lediglich erwähnt haben, dass Peter aus erster Ehe den Sohn Andreas und aus zweiter Ehe die Söhne Christoph und Peter hinterlassen habe.11
1637 gilt in der Familie als das Jahr, in dem sie hier sesshaft wird.12 In eben diesem Jahr erwirbt Peter Kaehne das Lehnschulzengut von der verarmten Petzower Schulzenfamilie Pasch(e). Andreas „Paschen“ wehrt sich verzweifelt dagegen, hat jedoch durch unklare Verhältnisse und eine Menge Schulden keine Chance, zudem ist der Hof heruntergewirtschaftet und durch den Krieg nahezu verwüstet. Nach jahrelangem Hin und Her in gerichtlichen Auseinandersetzungen wird Kaehne am 9. Mai 1648 vor dem Amtshauptmann von Lehnin, Hans von Rochow, einen neuen Kaufvertrag für das Lehen abschließen. Damit wird Peter Kaehne gewissermaßen schon Dorfbürgermeister. Zudem überträgt man ihm das Petzower Schulzengericht, d.h. die Dorfgerichtsbarkeit für kleinere Rechtsstreitereien. 1651 legt Kaehne den Amtseid als Schulze vor der Berliner Lehnskanzlei ab.
Doch Armut und Elend prägen nach wie vor das Leben. Krieg und Pest haben grausame Spuren hinterlassen.