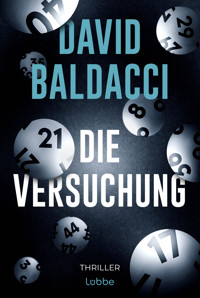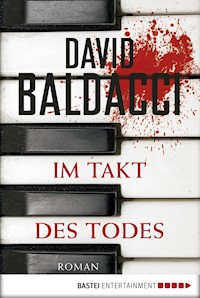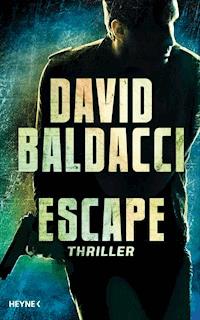7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die verwackelten Bilder eines gefolterten Russen, der seine letzten Worte in die Kamera spricht, versetzen die ganze Welt in Entsetzen. In rasender Geschwindigkeit verbreitet sich das Video über das Internet - und mit ihm die alarmierende Botschaft des Mannes: Er ist ein Opfer der russischen Regierung. Und er ist nicht das Einzige. In großem Stil räumt Russland sein eigenes Volk aus dem Weg. Kurz darauf spitzen sich die Konflikte zwischen den Großmächten der Welt zu. Ganze Armeen rüsten auf - es droht ein neuer globaler Krieg in nie da gewesenen Ausmaßen. Ein einziger Mann im Dienst einer multinationalen Geheimdienstorganisation soll die Wahrheit hinter den Gräueltaten aufdecken und den Krieg verhindern. Dieser Auftrag kann Shaw das Leben kosten - und die Welt retten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Anmerkung des Autors
Danksagungen
David Baldacci, geboren 1960, war Strafverteidiger und Wirtschaftsanwalt, ehe er 1996 mit DER PRÄSIDENT (verfilmt als ABSOLUTE POWER) seinen ersten Weltbestseller veröffentlichte. Mit jedem seiner Romane war er auf der Bestsellerliste der New York Times vertreten und international gleichermaßen erfolgreich. Seine Bücher wurden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und erschienen mit einer Gesamtauflage von über 50 Millionen
Exemplaren. Damit zählt er zu den Top-Autoren des Thriller-Genres. David Baldacci, der sich ebenso wie Ken Follett für die Leseförderung einsetzt, lebt mit seiner Familie in Virginia, nahe Washington, D. C.
David Baldacci
DIEKAMPAGNE
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonRainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Columbus Rose, Ltd.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Whole Truth«
Originalverlag: Grand Central Publishing
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2009 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © shutterstock / Danylchenko Jaroslav
Umschlaggestaltung: Rolf Hörner
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0939-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Zoe und Luke
Warum Zeit damit verschwenden,
die Wahrheit zu ergründen,
wenn man sie ebenso gut erschaffen kann?
Die hier zitierte Person hat um Anonymität gebeten,
da sie nicht dazu berechtigt ist,
sich zu Fragen zum Thema Wahrheit zu äußern.
Prolog
»Dick, ich brauche einen Krieg.«
»Nun, da sind Sie wie immer zum richtigen Mann gekommen, Mr. Creel.«
»Es wird kein gewöhnlicher Konflikt sein.«
»Ich erwarte auch nichts Gewöhnliches von Ihnen.«
»Aber Sie müssen es verkaufen. Sie müssen dafür sorgen, dass sie glauben, Dick.«
»Ich kann sie alles glauben machen.«
Kapitel 1
Um genau null Uhr Weltzeit, um Mitternacht Greenwich Time, erschien das Bild eines gefolterten Mannes auf der beliebtesten Website der Welt.
Die ersten sechs Worte des Mannes sollten jedem, der sie hörte, für immer im Gedächtnis bleiben.
»Ich bin tot. Ich wurde ermordet.«
Er sprach Russisch, doch auf Tastendruck wurde seine tragische Geschichte in den verschiedensten Sprachen untertitelt. Die russische Geheimpolizei hatte das Geständnis des »Landesverrats« aus dem Mann und seiner Familie herausgeprügelt. Dann aber war ihm die Flucht gelungen, und er hatte dieses krude Video aufgenommen.
Wer immer die Kamera bedient hatte, war entweder zu Tode verängstigt oder betrunken oder beides gewesen, denn das körnige Bild zitterte alle paar Sekunden.
Wenn dieses Video veröffentlicht worden sei, erklärte der Mann weiter, sei er von den Häschern der Regierung längst gefasst worden und bereits tot.
Sein Verbrechen? Das Verlangen nach Freiheit.
»Es gibt Zehntausende wie mich«, verkündete er der Welt. »Ihre Knochen bleichen in der Tundra Sibiriens oder vermodern in den tiefen Wassern des Balchaschsees in Kasachstan. Bald schon werden Sie Beweise dafür sehen. Nun, da ich tot bin, werden andere den Kampf fortführen.«
Während die Welt sich viel zu lange auf Osama bin Laden konzentriert habe, führte der Mann weiter aus, sei das »alte Böse« zurückgekehrt, das eine um ein Vielfaches größere Zerstörungskraft besitze als sämtliche islamischen Renegaten zusammen, und es sei tödlicher denn je.
»Es ist an der Zeit, dass die Welt die ganze Wahrheit erfährt!«, rief er in die Kamera und brach in Tränen aus. »Mein Name ist Konstantin … war Konstantin«, verbesserte er sich. »Für mich und meine Familie ist es zu spät. Wir alle sind tot … meine Frau, meine drei Kinder … tot. Vergesst mich nicht, und vergesst auch nicht, warum ich gestorben bin. Sorgt dafür, dass unser Tod nicht umsonst war.«
Als Bild und Stimme ausgeblendet wurden, erschien ein Atompilz auf den Monitoren. Unter diesem schrecklichen Bild standen die düsteren Sätze: Erst das russische Volk, dann der Rest der Welt. Können wir uns erlauben zu warten?
Die Spezialeffekte waren amateurhaft, doch das kümmerte niemanden. Konstantin und seine Familie hatten ihr Opfer gebracht, damit der Rest der Welt die Chance auf ein Überleben hatte.
Der Erste, der dieses Video zu Gesicht bekam, ein Computerprogrammierer in Houston, war wie vor den Kopf geschlagen. Per E-Mail schickte er die Datei an zwanzig Personen auf seiner Friendslist. Eine Französin war die Nächste, die das Video zu sehen bekam, nur wenige Sekunden später. Unter Tränen schickte sie es an fünfzig Freunde weiter. Nummer drei war ein Südafrikaner; er war so aufgeregt, dass er zuerst die BBC anrief und die Datei dann an achthundert seiner »engsten« Freunde im Web verschickte. Nummer vier war ein norwegisches Mädchen, das sich das Video voller Entsetzen anschaute und es dann an jeden mailte, den es kannte. Die nächsten tausend Personen, die sich das Video anschauten, lebten in neunzehn verschiedenen Staaten und leiteten es an durchschnittlich dreißig Freunde weiter, die es wiederum mit Dutzenden weiterer Freunde teilten. Was als digitaler Regentropfen im Meer des Internets begonnen hatte, schwoll binnen kürzester Zeit zu einem Tsunami aus Pixeln und Bytes von der Größe eines Kontinents an.
Wie eine sich rasch verbreitende Katastrophenmeldung löste das Video weltweit einen Sturm aus, wanderte von Blog zu Blog, von Chatroom zu Chatroom, von E-Mail-Postfach zu E-Mail-Postfach, wobei die Geschichte wucherte und sich veränderte, je öfter sie neu erzählt wurde. Die Gefahr, von blutrünstigen Russen überrannt zu werden, war bald allgegenwärtig. Drei Tage nach Konstantins beängstigender Botschaft kannte die ganze Welt seinen Namen, darunter viele Menschen, die weder den Namen des amerikanischen Präsidenten noch den des Papstes wussten.
Aus den E-Mails, Blogs und Chatrooms gelangte die Geschichte zu den Zeitungen, von Revolverblättern bis hin zu namhaften Zeitungen vom Kaliber einer New York Times, eines Wall Street Journal und anderer führender Tageszeitungen in aller Welt. Fast gleichzeitig geriet die Story in den globalen Fernsehkreislauf, von der ARD in Deutschland bis hin zur BBC und den ABC News. Sogar das chinesische Staatsfernsehen verkündete den möglichen Beginn der Apokalypse. Der Ruf »Vergesst Konstantin nicht!« erklang auf sämtlichen Kontinenten. Binnen kurzer Zeit war die Geschichte fest im kollektiven Bewusstsein der Welt verankert.
Die russische Regierung jedoch bestritt sie vehement. Präsident Gorschkow trat vor die versammelte Weltpresse und erklärte, die Geschichte sei nichts als eine perfide Lüge. Er werde »schlagende Beweise« vorlegen, dass eine Person wie Konstantin nie existiert habe.
Natürlich gab es auch Skeptiker, die ernste Zweifel daran hegten, wer Konstantin wirklich war und wen er und sein Video eigentlich repräsentierten. Diese Leute hätten den Toten und seine Geschichte gerne unter die Lupe genommen, doch wie viele andere auch hatten sie im Grunde schon alles gehört, was sie hören mussten, um zu einem Schluss zu gelangen.
So sollte die Welt nie erfahren, dass Konstantin in Wahrheit ein angehender Schauspieler aus Litauen war. Seine Wunden und sein ausgezehrtes Äußeres waren das Ergebnis geschickten Make-ups und professioneller Beleuchtung. Nach dem Dreh hatte er die Kostümierung abgelegt und - ausgerechnet - im Russischen Teehaus in der Siebenundfünfzigsten Straße in New York zu Mittag gegessen. Bezahlt hatte er mit ein paar Scheinen von den 50 000 Dollar, die er für den Dreh bekommen hatte. Da er ein dunkelhäutiger, gut aussehender Bursche war und überdies Spanisch sprach, war sein nächstes Ziel, eine Rolle in einer lateinamerikanischen Seifenoper zu ergattern.
Gleichzeitig würde die Welt nie wieder dieselbe sein.
Kapitel 2
Nicolas Creel leerte in Ruhe sein Glas Bombay Sapphire mit Tonic und zog sein Jackett an, ehe er sich zum Helikopter fahren ließ. Als er während des kurzen Fluges über den Hudson nach Jersey aus dem Hubschrauberfenster blickte, erinnerten ihn die Wolkenkratzer daran, wie weit er es gebracht hatte. Creel war in West Texas geboren, in einem Gebiet, das so groß und so dünn besiedelt war, dass die Menschen, die diese schier endlose Weite ihre Heimat nannten, kaum einmal einen Gedanken daran verschwendeten, dass es noch andere Orte auf der Welt gab, an denen man existieren konnte.
Creel hatte genau ein Jahr seines Lebens im Lone Star State verbracht, ehe er mit seinem Vater, einem Army Sergeant, auf die Philippinen gezogen war. Von dort war es dann in rascher Folge in sieben andere Länder gegangen, bis Creel senior schließlich in Korea stationiert wurde, wo er kurz darauf bei einer Explosion um Leben kam - ein »tragischer Unglücksfall«, wie die Army es nannte.
Nicolas besuchte das College und machte einen Abschluss als Ingenieur. Anschließend kratzte er das Geld für einen MBA-Studiengang zusammen, gab jedoch nach sechs Monaten auf und beschloss stattdessen, sich seine Sporen im Berufsleben zu verdienen.
Die einzige wertvolle Lektion, die sein Vater, der Berufssoldat, ihn gelehrt hatte, lautete: Das Pentagon kauft mehr Waffen als jeder andere auf der Welt und zahlt viel zu viel dafür. Tatsächlich verfügten die USA über das größte Sparschwein der Welt. Und es war ein verdammt gutes Geschäft, wie Creel rasch herausfand. Man konnte dem US-Militär problemlos Toiletten für 12 000 und Hämmer für 9000 Dollar verkaufen und kam dank diverser juristischer Tricks sogar damit durch.
So hatte Nicolas Creel die nächsten Jahre damit verbracht, das aufzubauen, was inzwischen der größte Rüstungskonzern der Welt geworden war: die Ares Corporation. Laut Forbes stand Creel mit einem Privatvermögen von mehr als 20 Milliarden Dollar auf Platz 14 der reichsten Männer der Welt; er nannte unter anderem eine Jacht mit Namen Shiloh sein Eigen, benannt nach jenem Ort, an dem eine der blutigsten Schlachten des Amerikanischen Bürgerkriegs getobt hatte.
Creels verstorbene Mutter war eine gebürtige Griechin gewesen, eine temperamentvolle und ehrgeizige Frau. Diese Eigenschaften - und ihr gutes Aussehen - hatte Creel von ihr geerbt. Nachdem sein Vater in Korea bei einem Unfall gestorben war, hatte Mrs. Creel einen Mann geheiratet, der ein gutes Stück höher auf der sozioökonomischen Leiter stand. Nicolas war von seinem Stiefvater in verschiedene Internate abgeschoben worden, wo er auf sich allein gestellt war. Während die Söhne anderer wohlhabender Väter verhätschelt wurden, musste er, der Außenseiter, um jeden Cent betteln und den Spott seiner Mitschüler über sich ergehen lassen. Diese bitteren Erfahrungen hatten ihm ein dickes Fell verschafft und seinen Ehrgeiz zusätzlich angestachelt.
Dass Creel sein Unternehmen nach dem griechischen Kriegsgott benannt hatte, war ein Tribut an seine Mutter, die er über alles geliebt hatte. Obwohl auf US-amerikanischem Boden geboren, hatte Creel sich nie als Amerikaner betrachtet. Zwar hatte die Ares Corporation ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, doch Creel war Weltbürger; er hatte schon vor Langem auf seine amerikanische Staatsbürgerschaft verzichtet. Dennoch verbrachte er so viel Zeit in den USA, wie er wollte, verfügte er doch über eine Armee von Anwälten und Wirtschaftsfachleuten, die jedes Schlupfloch im linguistischen Morast der amerikanischen Steuergesetzgebung aufstöberten.
Creel hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass er seinen Wohlstand verteilen musste, um sein Geschäft zu schützen. So wurde jeder große Rüstungsauftrag, der an Ares ging, auf möglichst viele der fünfzig US-Bundesstaaten verteilt, was in den teuren Hochglanzwerbekampagnen der Ares Corporation besonders hervorgehoben wurde.
»Eintausend Zulieferer, verteilt auf ganz Amerika, sorgen für Ihre Sicherheit«, verkündete eine volltönende, angenehme Hollywoodstimme in den Ares-Spots. Es klang patriotisch, war es aber nicht: Sollte irgendein Bürokrat sich an Kürzungen versuchen, würden 533 Kongressmitglieder sich wie ein Mann gegen den Übeltäter erheben, der versuchte, ihren Wählern die Jobs wegzunehmen. Die gleiche Taktik wandte Creel erfolgreich in einem Dutzend anderer Länder an.
Von Ares gebaute Kampfjets donnerten über die Stadien der World Series, des Super Bowl und der Fußballweltmeisterschaft hinweg - eine Formation silberglänzender Himmelsjäger wie aus Star Wars, Stückpreis 150 Millionen Dollar. Jede dieser Maschinen besaß genügend Feuerkraft, um eine Kleinstadt auszuradieren - wahrlich beeindruckend in ihrer furchterregenden Majestät.
Ares' weltweites Marketingbudget betrug drei Milliarden Dollar jährlich. Dank dieser riesigen Summe gab es keinen größeren Staat auf Erden - sofern er über ein ausreichendes Verteidigungsbudget verfügte -, der die Botschaften der Ares Corporation nicht immer wieder hörte: Wir sind stark. Wir stehen an eurer Seite. Wir sorgen für eure Sicherheit. Wir bewahren eure Freiheit. Wir allein stehen zwischen euch und ihnen.
Die Bilder waren publikumswirksam: Barbecues und Paraden; wehende Flaggen und Menschen, die vorbeirollenden Panzern und über sie hinweg donnernden Jets zuwinkten; entschlossen dreinblickende Soldaten mit geschwärzten Gesichtern, die sich ihren Weg durch feindliches Territorium bahnten.
Es gab kein Land auf Erden, das dieser Art Werbung widerstehen konnte, hatte Creel herausgefunden … nun, die Deutschen vielleicht, aber sie waren auch die Einzigen.
So, wie die Werbung konzipiert war, erweckte sie den Eindruck, die Ares Corporation verschenke die Waffen aus patriotischer Begeisterung; dabei überschritt sie in Wahrheit ständig ihr Budget und hinkte hinter dem Terminplan zurück. Das Unternehmen überzeugte Verteidigungsministerien in aller Welt davon, teures Kriegsspielzeug zu kaufen und dafür auf den billigeren Kleinkram zu verzichten, zum Beispiel auf Körperpanzer und Nachtsichtgeräte, von denen oftmals das Leben der einfachen Soldaten abhing.
Doch die Dinge änderten sich. Wie es schien, wurden die Menschen der Kriege müde. Die Besucherzahlen der großen Messen, die Ares jährlich veranstaltete, hatten nun schon mehrere Jahre in Folge abgenommen. Inzwischen war Ares' Marketingbudget größer als der Unternehmensgewinn. Das ließ nur eine Schlussfolgerung zu: Die Menschen kauften nicht mehr, was Creel anzubieten hatte.
So saß er nun in einem schmucken Raum in einem Gebäude, das seinem Unternehmen gehörte. Der große Mann ihm gegenüber trug Jeans und Kampfstiefel; sein Gesicht war braun gebrannt und wettergegerbt mit einem Loch in der Wange, das entweder die Mutter aller Pockennarben oder eine alte Schusswunde war. Seine Schultern waren breit, seine Hände riesig und furchteinflößend.
Creel schüttelte dem Mann nicht die Hand.
»Es hat angefangen«, sagte er.
»Ich habe den Genossen Konstantin gesehen.« Der Mann konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Sie sollten ihm einen Oscar geben.«
»Sämtliche Nachrichtenmagazine, darunter Sixty Minutes, bringen dieses Wochenende Reportagen darüber. Gorschkow, der Trottel, macht es uns leicht.«
»Was ist mit dem Vorfall?«
»Sie sind der Vorfall«, erwiderte Creel.
»Es hat auch vorher schon funktioniert, ohne dass wir jemanden geschickt haben.«
»Ich bin nicht an Kriegen interessiert, die nach hundert Tagen aufhören oder sich in Bandenkämpfe verwandeln. Damit können wir nicht mal unsere Portokasse füllen, Caesar.«
»Geben Sie mir den Plan, und ich werde ihn ausführen, Mr. Creel - wie immer.«
»Halten Sie sich bereit.«
»Natürlich. Es ist Ihre Show.«
»Darauf können Sie wetten.«
Auf dem Hubschrauberflug zurück zum Ares Building ließ Creel den Blick über die Beton-, Glas- und Stahltempel der Stadt schweifen. Du bist nicht mehr in West Texas, Nick.
Natürlich ging es hier nicht nur ums Geld. Oder darum, sein Unternehmen zu retten. Creel besaß mehr als genug finanzielle Mittel; egal, was er tat oder nicht, die Ares Corporation würde in jedem Fall überleben. Nein, hier ging es darum, die Welt wieder in ihre normalen Bahnen zu lenken, nachdem sie lange genug aus dem Ruder gelaufen war. Creel wollte nicht mehr zusehen, wie die Schwachen und Wilden den Starken und Zivilisierten ihren Willen aufzwangen. Er würde alles wieder zurechtrücken. Mancher würde vielleicht behaupten, er spiele Gott. Nun, in gewisser Weise war er Gott. Doch selbst ein wohlwollender Gott setzte bisweilen Gewalt und Zerstörung ein, um seinem Willen Nachdruck zu verleihen. Creel war fest entschlossen, genau das zu tun.
Zuerst würde der Schmerz kommen.
Dann die Verluste.
So war es immer. Tatsächlich war sein eigener Vater ein Opfer des Bestrebens gewesen, die Weltordnung zu bewahren. Creel wusste also aus eigener Erfahrung, was so etwas einem abverlangte. Doch am Ende würde es die Sache wert sein.
Er lehnte sich im Sitz zurück.
Konstantins Schöpfer wusste ein wenig.
Caesar wusste ein wenig.
Nicolas Creel wusste alles.
Götter wussten immer alles.
Kapitel 3
Für was steht das ›A‹?«, fragte der Mann in fließendem Englisch mit leichtem niederländischen Akzent.
Shaw blickte den Gentleman an, der ihm an der Passkontrolle des Flughafens Schiphol gegenüberstand, gut fünfzehn Kilometer südwestlich von Amsterdam. Schiphol war einer der geschäftigsten Flughäfen der Welt, fünf Meter unter Meeresspiegel und somit ständig bedroht von Trillionen Litern Wasser. Shaw hatte diesen Flughafen stets als Höhepunkt ingenieurtechnischer Kühnheit betrachtet. Andererseits lag der größte Teil des Landes unterhalb des Meeresspiegels, sodass die Niederländer gar keine Wahl hatten, was die Frage betraf, wo sie ihre Flugzeuge abstellen sollten.
»Wie bitte?«, erwiderte Shaw, obwohl er sehr genau wusste, worauf der Mann sich bezog.
Der Beamte stieß mit dem Finger auf Shaws Passfoto.
»Unter ›Vorname‹ steht hier nur der Buchstabe ›A‹. Wofür, wenn ich fragen darf?«
Shaw schaute auf seinen Pass.
Wie es dem Volk mit der größten durchschnittlichen Körpergröße geziemte, war der Zollbeamte trotz seiner ein Meter achtundachtzig sechs Zentimeter größer als der Durchschnittsniederländer, aber immer noch sechs Zentimeter kleiner als Shaw mit seiner imposanten Statur.
»Das steht für gar nichts. Meine Mutter hat mir nie einen Vornamen gegeben. Also habe ich mich selbst nach dem benannt, was ich bin: a Shaw, ein Shaw. Und Shaw ist mein Nachname. Der meiner Mutter, um genau zu sein.«
»Ihr Vater hatte nichts dagegen, dass sein Sohn nicht seinen Namen angenommen hat?«
»Man braucht keinen Vater, um ein Kind zu bekommen, nur um eins zu machen.«
»Und das Krankenhaus hat Ihnen auch keinen Namen gegeben?«
»Werden alle Babys in Krankenhäusern geboren?«, gab Shaw mit einem Lächeln zurück.
»Shaw also, hm? Das ist Irisch, nicht wahr? Wie George Bernard Shaw?«
Die Niederländer waren überaus gebildete Leute; Shaw war immer schon dieser Meinung gewesen. Sie waren wissbegierig und liebten es zu debattieren. Doch bis jetzt hatte er es noch nie erlebt, dass jemand ihn nach George Bernard Shaw gefragt hatte.
»Möglich. Aber ich bin Schotte. Highlander. Oder wenigstens kamen meine Vorfahren von dort«, fügte er rasch hinzu, denn es war ein amerikanerischer Pass, der dem Zollbeamten vorlag; Shaw hatte ein Dutzend davon. »Ich bin in Connecticut geboren. Waren Sie schon mal dort?«
»Nein«, antwortete der Mann, »aber ich würde gerne mal nach Amerika reisen.«
Shaw hatte diesen sehnsuchtsvollen Blick schon oft gesehen. »Nun ja, die Straßen dort sind zwar nicht mit Gold gepflastert und die Frauen sehen nicht alle wie Filmstars aus, aber es ist tatsächlich noch immer ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten.«
»Vielleicht, eines Tages, komme ich mal dorthin …«, seufzte der Zollbeamte und wandte sich wieder seiner Pflicht zu. »Sind Sie geschäftlich oder als Tourist hier?«
»Beides. Warum sollte ich so weit reisen und mich im Vorfeld für eins von beiden entscheiden?«
Der Mann lächelte. »Haben Sie etwas zu verzollen?«
»Ik heb niets aan te geven.«
»Sie sprechen Niederländisch?«, fragte der Beamte überrascht.
»Tut das nicht jeder?«
Der Mann lachte und versah Shaws Pass mit einem altmodischen Tintenstempel anstatt mit einer der Hightechsignaturen, wie sie heutzutage in vielen Ländern üblich waren. Es gab sogar Stempel, die eine digitale Signatur auf das Papier übertrugen. Shaw war Tinte immer schon lieber gewesen.
»Genießen Sie Ihren Aufenthalt«, sagte Shaws neuer niederländischer Freund, als er ihm den Pass zurückgab.
»Das habe ich vor.« Shaw ging zum Ausgang und zu dem Zug, der ihn in zwanzig Minuten zum Hauptbahnhof von Amsterdam bringen würde.
Von dort würde es dann immer aufregender werden. Aber zunächst hatte er eine Rolle zu spielen.
Er hatte nämlich Publikum.
Tatsächlich beobachteten seine Zuschauer ihn just in diesem Augenblick.
Kapitel 4
Vom Bahnhof aus nahm Shaw ein Taxi zum Amstel Intercontinental Hotel mit seinen 79 exklusiven Zimmern, viele mit beneidenswerter Aussicht auf die Amstel, obwohl Shaw nicht deswegen hier war.
Die Rolle, die er während der nächsten drei Tage spielen würde, war die eines Touristen. Es gab nur wenige Städte, die besser dafür geeignet waren als Amsterdam mit seinen 750 000 Einwohnern, von denen nur die Hälfte Niederländer waren. Shaw machte eine Bootsfahrt und schoss Fotos von der Stadt, die mehr Kanäle besaß als Venedig und fast 13 000 Brücken auf einer Fläche von nur knapp 200 Quadratkilometern, von denen obendrein ein Viertel Wasserfläche war.
Shaw fühlte sich besonders von den Hausbooten angezogen; fast 3000 waren entlang der Kanäle verankert. Sie gefielen ihm vor allem, weil sie etwas fest Verwurzeltes repräsentierten; zwar trieben sie auf dem Wasser, wurden aber nie bewegt. Und häufig wurden sie von einer Generation an die nächste weitervererbt.
Wie es wohl ist, sinnierte Shaw, so innig mit einem Ort verbunden zu sein?
Später zog er sich Shorts und Laufschuhe an und joggte durch den weitläufigen Oosterpark in der Nähe des Hotels. Shaw war im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben lang gerannt. Doch wenn alles nach Plan lief, würde es damit bald ein Ende haben - entweder das, oder er wäre tot. Dieses Risiko jedoch ging er mit Freuden ein. In gewisser Weise war er nämlich schon tot.
Shaw nippte an einem Kaffee im Bulldog, Amsterdams berühmtester Cafekette, und beobachtete die Menschen, wie sie ihren Geschäften nachgingen. Er behielt auch die Männer im Auge, die ihn so offenkundig beobachteten. Oh, es war erbärmlich, Amateuren zuschauen zu müssen - in diesem Fall Leuten, die nicht die leiseste Ahnung vom Observieren hatten.
Am nächsten Tag aß er zu Mittag in einem seiner Lieblingsrestaurants in der Stadt, das von einem alten Italiener geführt wurde. Die Gattin saß den ganzen Tag an einem Tisch und las Zeitung, während ihr Gemahl als Kellner, Küchenchef, Kassierer und Tellerwäscher zugleich fungierte. Es gab hier nur vier Barhocker und fünf Tische, das Reich der Frau abgezogen, und potenzielle Gäste mussten erst einmal am Eingang warten, wo der Mann sie in Augenschein nahm. Wenn er nickte, bekam man etwas zu essen. Drehte er sich wortlos um, musste man sich ein anderes Restaurant suchen.
Shaw war noch nie abgewiesen worden. Vielleicht lag es an seiner imposanten Statur oder den leuchtend blauen Augen, die jeden in ihren Bann zogen. Der wahrscheinlichste Grund jedoch war, dass er und der Wirt einst zusammengearbeitet hatten - und das nicht in der Gastronomie.
Am Abend warf Shaw sich in Schale und genoss im Musiektheater eine Oper. Natürlich hätte er nach Ende der Vorstellung zu seinem Hotel zurückgehen können; stattdessen beschloss er, die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Wegen der heutigen Nacht war er überhaupt erst nach Holland gekommen. Jetzt war er kein Tourist mehr.
Als er sich dem Rotlichtbezirk näherte, bemerkte er eine Bewegung in einer dunklen, besonders schmalen Gasse. Ein kleiner Junge stand dort in den Schatten, neben ihm ein grob aussehender Kerl mit offener Hose, der eine seiner großen Pranken unter den Bund des Jungen geschoben hatte.
Sofort wechselte Shaw die Richtung. Er huschte durch die Schatten und versetzte dem Mann einen Schlag auf den Hinterkopf. Es war ein exakt bemessener Hieb, der betäuben, nicht töten sollte, obwohl Shaw ernsthaft versucht war, den Kerl ins Jenseits zu befördern. Als der Mann bewusstlos am Boden lag, drückte Shaw dem Jungen 100 Euro in die Hand und schickte ihn mit einer ernsten Warnung auf Niederländisch weg. Als die schnellen Schritte des Kindes verhallten, hatte Shaw wenigstens die Gewissheit, dass der Junge zumindest nicht in dieser Nacht verhungern oder sterben würde.
Als er sich wieder in Richtung seines ursprünglichen Ziels auf den Weg machte, bemerkte er zum ersten Mal, dass die alte Börse direkt gegenüber vom Rotlichtbezirk stand. Das kam ihm irgendwie seltsam vor, bis er genauer darüber nachdachte. Geld und Prostitution waren schon immer Bettgefährten gewesen. Er fragte sich, ob einige der Damen wohl auch Aktien statt Bares akzeptierten.
Doch noch seltsamer als seine Nähe zur Börse war die Tatsache, dass der Rotlichtbezirk von allen Seiten die Oude Kerk umgab, die Alte Kirche, das älteste und größte Gotteshaus der Stadt. 1306 als schlichte Holzkapelle errichtet, war sie im Laufe der folgenden zwei Jahrhunderte immer mehr erweitert und vergrößert worden. Irgendein Witzbold hatte sogar zwei Brüste in den Messinggehweg vor dem Portal eingearbeitet. Shaw war schon ein paarmal in dem Gotteshaus gewesen. Dabei waren ihm besonders die Schnitzereien im Chorgestühl aufgefallen, die Männer mit offenkundigen Verdauungsaktivitäten zeigten. In früheren Zeiten mussten die Messen wirklich lang gewesen sein.
Heilige und Sünder, Gott und Huren, sinnierte Shaw, als er das Zentrum der Lastermeile erreichte. Die Holländer nannten dieses Viertel Walletjes oder »Kleine Mauern«. Angeblich gelangte nichts, was hinter den Mauern von Walletjes geschah, je nach außen - und genau darauf würde Shaw sich in dieser Nacht verlassen müssen.
Der Rotlichtbezirk war nicht allzu groß, vielleicht zwei Kanäle lang; doch es gab eine Menge zu sehen. Nachts waren die bestaussehenden Prostituierten auf dem Strich, darunter viele atemberaubende Osteuropäerinnen, die man mit falschen Versprechungen hierher gelockt hatte. Nun waren sie »im Gewerbe« gefangen, wie man es beschönigend nannte. Ironischerweise waren die Nachtnutten mehr Show als sonst etwas, denn wer wollte schon durch die schreiend-wollüstig aufgemachten Eingänge gehen, wenn Tausende einen dabei beobachten konnten? Morgens und nachmittags war es hier wesentlich ruhiger; dann kamen auch ernsthaft interessierte Kunden zu den zwar nicht ganz so gut aussehenden, aber effizienten Damen der zweiten und dritten Schicht.
Die Zimmer der Nutten waren dank des grellroten Neonlichts kaum zu verfehlen. In den Zimmern selbst gab es fluoreszierendes Licht, sodass die kaum vorhandene Kleidung der Mädchen leuchtete wie in der hellen Sommersonne. Shaw ging an einem Fenster nach dem anderen vorbei, in dem die Frauen standen oder tanzten oder erotisch posierten. In Wahrheit kamen die meisten Leute nur hierher, um zu gaffen, nicht um zu bumsen; trotzdem wurde in den Betten hier ungefähr eine Milliarde Euro pro Jahr erwirtschaftet.
Shaw hielt den Kopf gesenkt. Seine Füße führten ihn auf direktem Weg zu einem ganz bestimmten Ziel. Er war fast da.
Kapitel 5
Die Dame im Fenster war jung und schön. Sie hatte rabenschwarzes Haar, das sich in Wellen um ihre nackten Schultern legte. An Kleidung trug sie einen winzigen, kaum noch als solchen zu bezeichnenden String-Tanga, Highheels und eine billige Halskette zwischen den großen Brüsten, deren Nippel mit Sonnenblumenblüten bedeckt waren.
Interessante Aufmachung, dachte Shaw.
Er hielt Blickkontakt mit ihr, während er sich einen Weg durch die Masse der Fußgänger bahnte. Die Frau empfing ihn an der Tür, wo er sein Interesse bestätigte. Trotz ihrer Highheels war sie gut einen Kopf kleiner als er. Im Fenster hatte sie größer ausgesehen; aber im Schaufenster sahen ja viele Dinge größer aus, als sie tatsächlich waren. Und besser. Wenn man die Ware dann mit nach Hause nahm, sah sie mit einem Mal gar nicht mehr so toll aus.
Die Frau schloss die Tür und zog die roten Vorhänge zu - die einzigen Zeichen, dass Zimmer und Frau belegt waren. Der Raum war klein. Er hatte ein Waschbecken, eine Toilette und natürlich ein Bett. Neben dem Waschbecken befand sich ein Knopf, den die Nutte im Notfall betätigen konnte, um die Polizei zu alarmieren, die jeden Kunden einkassierte, der auf der Suche nach Befriedigung zu weit gegangen war. Dieses Viertel gehörte zu den am besten bewachten der Stadt; man tat eben alles, um die Steuereinnahmen weiter fließen zu lassen.
Shaw sah eine weitere Tür in der hinteren Wand und drehte sich weg: Aus dem Nebenzimmer waren laut und vernehmlich die Geräusche eines anderen, offenbar sehr beschäftigten Kunden zu hören. Die Stundenzimmer befanden sich unmittelbar nebeneinander, getrennt durch eine Rigipswand, manchmal auch nur durch einen Vorhang. Für dieses Geschäft benötigte man nicht sonderlich viel Platz oder Aufwand.
»Du siehst sehr gut aus«, sagte die Frau auf Holländisch. »Und du bist groß«, fügte sie hinzu und schaute zu Shaw hinauf. »Bist du überall so üppig ausgestattet? Ich bin da unten nämlich nicht so groß.« Unverhohlen starrte sie auf seinen Schritt.
»Spreekt u Engels?«, fragte Shaw.
Sie nickte. »Ja, ich spreche Englisch. Zwanzig Minuten kosten dreißig Euro, aber ich mache auch eine Stunde für fünfundsiebzig. Ein Sonderangebot, extra für dich«, fügte sie hinzu. Sie reichte ihm eine Liste auf Niederländisch, doch unten stand der Text auch in anderen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch und Arabisch. »Das sind die Dinge, die ich mache - oder auch nicht.«
Shaw gab ihr das Blatt zurück. »Ist dein Freund da?«, fragte er. »Ich warte schon seit Langem darauf, ihn endlich kennenzulernen.« Er schaute zur zweiten Tür.
Die Frau musterte ihn erneut, diesmal jedoch auf andere Weise. »Ja, er ist hier.«
Sie drehte sich um und führte Shaw zur Hintertür. Ihre nackten Pobacken waren fest, als sie mit übertriebenem Hüftschwung vor ihm herstolzierte. Shaw war nicht sicher, ob sie es aus Gewohnheit tat oder weil ihre Stilettos zu locker saßen.
Die Frau öffnete Shaw die Tür, winkte ihm hindurchzugehen und überließ ihn einem alten Mann, der an einem kleinen Tisch vor einer schlichten Mahlzeit saß: eine Käseecke, ein Stück Dorsch, eine Handvoll Brot und eine Flasche Wein.
Das Gesicht des Mannes war eine verwitterte Landschaft aus Rissen und Spalten; der weiße Bart war zottelig, der kleine Bauch weich und rund. Die Augen lugten unter schneeweißen Haarbüscheln hervor, die dringend gestutzt werden mussten.
Mit festem Blick schaute er Shaw an; dann deutete er auf den Tisch. »Hunger? Durst?«
Es gab einen zweiten Stuhl, doch Shaw beschloss, sich nicht zu setzen. Der Alte hätte ihn womöglich erschossen, hätte er versucht, es sich bequem zu machen, denn der Mann hielt eine Waffe in der linken Hand, genau auf Shaw gerichtet. Außerdem waren die im Vorfeld besprochenen Instruktionen eindeutig gewesen. Man setzte sich nicht. Und man aß und trank auch nichts, wenn man leben wollte.
Shaw hatte seinen Blick bereits durch den winzigen Raum schweifen lassen. Es gab nur eine Tür: die, durch die er gekommen war. Er hatte sich so positioniert, dass er sowohl die Tür als auch den Mann im Auge behalten konnte … und dessen Waffe.
Shaw schüttelte den Kopf. »Nein, danke. Ich hab schon im De Groene Lanteerne gegessen.« Das war ein billiges Restaurant, wo man traditionelle holländische Küche in einem dreihundert Jahre alten Schankraum servierte, der auch so aussah.
Nachdem die dämliche Parole ausgetauscht war, stand der Mann auf, zog ein Stück Papier aus der Tasche und reichte es Shaw.
Shaw schaute sich die Adresse und die anderen Informationen auf dem Zettel an, zerriss ihn und warf die Fetzen in die Toilette an der Wand; dann zog er ab. Wie auf ein Stichwort setzte der Mann einen alten, speckigen Hut auf, warf sich einen geflickten Mantel über und ging.
Shaw konnte noch nicht gehen. Sexuelle Begegnungen dauerten ein wenig länger, selbst bei Teenagern. Und man wusste nie, wer einen gerade beobachtete. Na ja, genau genommen wusste Shaw es. Es waren mehrere.
Shaw ging zurück in den Hauptraum, wo die Frau sich katzenhaft auf dem Bett räkelte. Die Vorhänge waren noch immer zugezogen, und ihr Taxameter lief.
»Willst du mich jetzt ficken?«, fragte die Frau gelangweilt und zog ihren Tanga hinunter. »Ist alles bezahlt«, fügte sie hinzu, als müsse sie Shaw erst noch verführen. »Eine ganze Stunde. Für weitere dreißig Euro halte ich mich auch nicht an die Liste.«
»Ne, bedankt«, sagte Shaw und lächelte höflich. Wenn man eine Dame in sexuellen Fragen abwies, tat man es am besten in ihrer Sprache.
»Warum denn nicht? Gibt es ein Problem?«, fragte sie offensichtlich beleidigt.
»Ich bin verheiratet«, sagte Shaw.
»Das sind die meisten Männer, die zu mir kommen.«
»Das glaube ich.«
»Wo ist dein Ehering?«, fragte sie misstrauisch.
»Den trage ich nie bei der Arbeit.«
»Bist du sicher, dass du mich nicht willst?« Ihr Tonfall war so ungläubig und verärgert wie ihr Gesichtsausdruck.
Shaw ließ sich seine Belustigung nicht anmerken. Die Frau musste wirklich neu in dem Geschäft sein, wenn ihre Eitelkeit noch intakt war. Die älteren Huren freuten sich über jede Gelegenheit, Geld zu machen, ohne dafür ins Bett hüpfen zu müssen.
»Ja, ich bin mir sicher«, sagte Shaw. Sie zog ihren Tanga hoch. »Schade.«
»Ja, schade«, sagte Shaw.
Bald würde er in Dublin sein, bei der einzigen Frau, die er je wirklich geliebt hatte. In zwei Tagen schon, wenn alles nach Plan lief.
Doch in seinem Job war das ein sehr großes »Wenn«.
Kapitel 6
Immer hat irgendein verdammter Tunesier, Marokkaner oder Ägypter etwas damit zu tun. Immer, ging es Shaw durch den Kopf. Machte man bei diesen Kerlen auch nur den geringsten Fehler, rissen sie einem die Eier ab und stopften sie einem ins Maul, und wenn man sie dann nach dem Grund fragte, sagten sie, Allah habe es ihnen befohlen … falls sie überhaupt etwas sagten. Ich sehe dich im Paradies, Ungläubiger. Dort kannst du mir bis in alle Ewigkeit dienen, du dreckiges Schwein. Shaw kannte die Reden auswendig.
Er packte den schweren Koffer fest mit der rechten Hand und hielt die Linke in die Höhe, während der drahtige Tunesier mit den roten Augen, dem grimmigen Gesicht und den gefletschten Zähnen ihn abtastete.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!