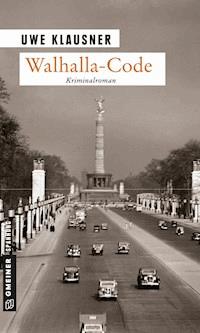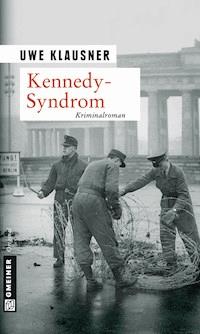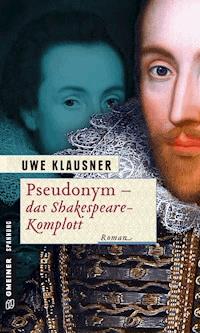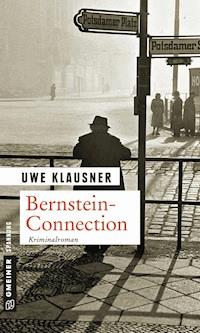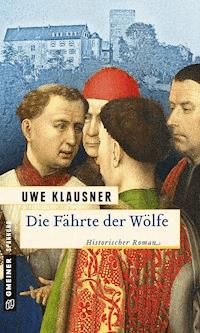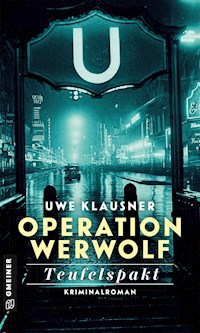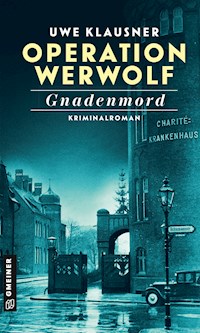Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bruder Hilpert und Berengar von Gamburg
- Sprache: Deutsch
Würzburg am Main, Anno Domini 1416. Ein unglaublicher Frevel erschüttert die Stadt und bringt Fürstbischof Johann von Brunn in eine äußerst prekäre Situation: Ausgerechnet fünf Tage vor Kiliani, dem höchsten Feiertag der Diözese, werden die Reliquien der drei Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan gestohlen. Und tausende von Pilgern befinden sich bereits in der Stadt. Die Lage droht zu eskalieren, sollten die Reliquien nicht bis zum Fest des heiligen Kilian am 8. Juli wieder auftauchen. Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Berengar von Gamburg, der Vogt des Grafen von Wertheim, ist per Zufall Zeuge eines Gesprächs zwischen Dieb und Auftraggeber geworden. Er wird mit der Lösung des Falls beauftragt. Widerwillig zwar, aber dennoch mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch, weil es sich bei dem Räuber um einen "alten Bekannten" handelt, macht er sich ans Werk. Dabei kann er sich der Unterstützung eines ebenso treuen wie scharfsinnigen Freundes gewiss sein: Bruder Hilpert, Bibliothekarius zu Maulbronn und einer der führenden Köpfe des Zisterzienserordens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Klausner
Die Kiliansverschwörung
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »Étienne Chevalier mit dem Hl. Stephan« von Jean Fouquet
Hauptpersonen
Hilpert von Maulbronn, 36 Jahre, Bibliothekarius, Inquisitor und hochgebildeter Asket, damit beauftragt, den Raub der Kilianreliquien aufzuklären
Berengar von Gamburg, 29, bärbeißiger Vogt des Grafen von Wertheim, Freund Hilperts und unverzichtbarer Helfer bei seinen Ermittlungen
Bruder Wilfried, 32, Stallmeister aus dem Kloster Bronnbach und Gefährte Hilperts, außer einem wachen Verstand mit einer gehörigen Portion Muskelkraft gesegnet
Johann von Brunn (1372–1440), Bischof von Würzburg und Machtpolitiker reinsten Wassers, skrupellos, hinterlistig und extrem einfallsreich, besonders dann, wenn es um die Durchsetzung seiner Interessen geht
Oddo di Colonna (1368–1431), Kardinaldiakon und Parteigänger des in der Heidelberger Burg gefangen gehaltenen Gegenpapstes Johannes XXIII.
Demetrius, 23, Mitglied des Würzburger Domkapitels und Erzdiakon
Schwester Irmingardis, 20, Benediktinerin aus dem Kloster St. Afra zu Würzburg
Agilulf, 50, Münzfälscher, Hehler und Reliquienhändler
Hildegard, seine Frau
Wigbert, Totengräber und Halbbruder von Agilulf
Ansgar, Agilulfs Komplize und Nachbar
Bertram von Klingenberg, Domschüler
Dorothea von Waldenburg, Konkubine des Bischofs
Eckehard Büttner, Weinhändler und ›Geschäftsmann‹
Eustachius von Marmelstein, Domkapitular und Vikarius
Fredegar von Stetten, Chorherr im Neumünster
Gumpert, Schmied und Gelegenheitsdieb
Hieronymus von Weißenfels, bischöflicher Kammerherr
Bruder Hilarius, Prior des Franziskanerklosters
Heribert, Berengars Schwager
Krätze und Skrofulus, Müllkutscher
Lazarus, genannt ›der Poet‹, Patronus des Siechenhauses
Melisande, Dirne
Sieglinde, Berengars Schwester
Prolog 1
Porta Appia in Rom, kurz vor Mitternacht (20.1.1416)
»Santa Maria Vergine – steh mir bei!«
Und das ausgerechnet ihm. Lorenzo, die Ruhe in Person, bekreuzigte sich. Er hatte Angst. Angst wie nie zuvor.
Als der Spuk begann, der ihn mit Brachialgewalt aus dem Halbschlaf riss, war er eingenickt. Die Schafweide war mit Raureif bedeckt, und das Mitternachtsläuten von San Sebastiano hallte durch die Nacht. In der Ferne, inmitten von Pinien, Steineichen und Zypressen, ragten die Türme der Porta Appia empor, und auf den Ölbäumen sammelte sich bleifarbener Tau. Die Grabmäler entlang der Heerstraße, Relikte aus ruhmreichen Tagen, ragten aus grau gestreiften Dunstschleiern empor, und der Mond übergoss die Landschaft mit fahlem Glanz. Selbst von den Straßenräubern, die hier, unweit der Tore Roms, betuchten Pilgern auflauerten, war nichts zu sehen.
Alles war friedlich und still. Zumindest sah es danach aus. Bis Lorenzos Nickerchen ein jähes Ende fand.
Als sich die Kolonne der Kapuzenmänner seinem Rastplatz näherte, wäre der alte Hirte vor Schreck fast in Ohnmacht gefallen. »Heilige Jungfrau Maria!«, wiederholte er und umklammerte seinen Stab, unsicher, ob er ihn als Waffe benutzen oder nicht besser die Flucht ergreifen solle. Dass er die Teilnehmer der nächtlichen Prozession nicht erkennen konnte, war eine Sache. Eine andere, dass sie kein Wort miteinander sprachen. Fast schien es, als seien sie nicht von dieser Welt. Wie Schattenwesen, die direkt aus dem Hades kamen.
Doch damit nicht genug. Wie er in einem Anflug von Panik bemerkte, trugen die Kapuzenmänner Sporen. Wie die piekfeinen Signori aus den Palazzi drinnen in der Stadt. An sich nichts Ungewöhnliches. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass sich unter ihren Umhängen die Konturen von Schwertern abzeichneten. Schließlich trieb sich hier draußen das übelste Gesindel von ganz Rom herum. Vor allem bei Nacht. Aber selbst wenn, warum um alles in der Welt hörte man dann ihr Klirren nicht? Vom Geräusch, das Stiefelabsätze auf Plastersteinen machten, gar nicht zu reden.
Dies war der Moment, in dem seine Panik in nacktes Entsetzen umzuschlagen begann. Er wollte in Deckung gehen, aber die Schafweide bot keinerlei Schutz. Dummerweise war das nächstgelegene Mausoleum, Unterstand an regnerischen Tagen, mindestens 100 Schritte entfernt. Für einen Achtzigjährigen viel zu weit.
Und außerdem war es längst zu spät. Die Kapuzenmänner waren höchstens noch 50 Schritt entfernt, mussten ihn eigentlich längst entdeckt haben. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals, und seine Knie waren so weich, dass er fürchtete, sie würden ihren Dienst versagen.
Der alte Hirte war auf das Schlimmste gefasst.
Doch zu seiner Überraschung würdigten ihn die in Zweierreihen gestaffelten Männer keines Blickes. Paar um Paar zog vorbei, Fackeln in der Hand, mit starrem, wie erloschenem Blick. Der alte Hirte blieb wie festgewurzelt stehen, und falls dies überhaupt möglich war, wich das letzte Quäntchen Farbe aus seinem wachsbleichen Gesicht.
Und dann geschah es.
Der letzte, sich auf seiner Seite des Weges völlig lautlos vorwärts bewegende Mann hob den Kopf. Tief in Gedanken, warf er seinem Nebenmann einen flüchtigen Blick zu. Und dann, als dieser ihn nicht erwiderte, blieb er abrupt stehen und warf einen Blick über die Schulter. Genau in die Richtung, wo sich der Lagerplatz des Hirten befand.
Doch nahm ihn dieser kaum noch wahr. Die knochigen Hände auf die linke Hälfte seines Brustkorbs gepresst, taumelte er zunächst nach links, dann wieder nach rechts. Es schien, als wolle er etwas sagen, aber alles, was aus seinem halb geöffneten, von Speichelfäden gesäumten Munde kam, war zusammenhangloses Gestammel, das sich zu wildem, stoßweise hervorgepresstem Keuchen steigerte.
Ein letztes Aufbäumen, weit aufgerissene Augen, deren Pupillen sich wild im Kreise drehten – und der alte Hirte stürzte wie ein gefällter Baum zu Boden.
Über das Gesicht des Kapuzenmannes, der die Szene beobachtet hatte, huschte ein verstohlenes Lächeln. Dann hob er die rechte Hand, schlug ein Kreuz und setzte seinen Weg fort. Kurz darauf war der Zug der Vermummten verschwunden.
Lorenzo indes war noch nicht tot. Mit einer Kraftanstrengung, die er sich selbst kaum zugetraut hätte, richtete er sich nochmals auf. Nur kurz, aber lange genug, um die Silhouette des Kapuzenmannes zwischen den Gräbern an der Via Appia wie eine Geistererscheinung verschwinden zu sehen.
Dann brach er zusammen und hauchte sein Leben aus, furchtlos und unverzagt, wie er in seinem schwindenden Bewusstsein registrierte.
Er hatte keine Angst mehr vor dem Tod, jetzt nicht mehr.
Er hatte den Tod gesehen.
*
»Wir sind da!«
Als die mitternächtliche Prozession die Kirche ›Sankt Sebastian vor den Mauern‹ erreichte, hob der Mann an der Spitze des Zuges die Hand. Er war knapp 50, groß, hager und mit einem dunklen Kapuzenmantel bekleidet. Rein äußerlich war er von den Gefährten somit nicht zu unterscheiden. Dies traf, wenn überhaupt, jedoch nur auf seine Kleidung zu. Die scharf geschnittenen, kantigen Züge, vor allem aber der durchdringende Blick verrieten den befehlsgewohnten Kurienkardinal. Ein Eindruck, der durch seinen barschen Tonfall bestätigt wurde: »Folgt mir!«, bedeutete er seinen Gefährten und hielt es nicht einmal für nötig, sich umzudrehen.
Nur ein paar Schritte, und die Prozession der Kapuzenmänner hatte ihr Ziel erreicht. Der Mann an der Spitze des Zuges reichte seine Fackel nach hinten, öffnete seinen Umhang und kramte einen Schlüssel hervor, mit dem er die schmiedeeiserne Pforte am Ende der Treppenflucht öffnete.
Die Tür sah unscheinbar aus, nicht viel anders als bei den Grabmälern, die es in dieser Gegend zu Dutzenden gab. Und doch führte sie nicht etwa in eine Gruft, sondern zum sichersten Versteck weit und breit. Kaum einer der Männer wusste davon, wenn überhaupt, dann vom Hörensagen.
Nicht so ihr Anführer, denn er war nicht zum ersten Mal hier. Die Gegend war ihm bestens bekannt, so vertraut wie die päpstliche Kurie, an der er seinen Dienst als Kardinaldiakon versah. Weit besser als über der Erde fand er sich allerdings in den Katakomben zurecht. Wenn nötig, sogar mit verbundenen Augen. Für seine Zwecke waren sie geradezu ideal, sicherer als Abrahams Schoß. Kein Winkel, den er nicht kannte, kein Stollen, den er nicht erkundet, kein Fluchtweg, den er nicht auf seine Tauglichkeit hin überprüft hätte. Über das Gesicht des Kardinaldiakons huschte ein zynisches Lächeln. Was immer am heutigen Abend geschah, kein Mensch würde je davon erfahren. Kein Mensch, schon gar nicht einer der Ohrenbläser, von denen es in Rom nur so wimmelte.
Und selbst wenn, dann wäre sein Leben verwirkt.
Der hagere Körper des Kardinaldiakons straffte sich. Dies war die Nacht, in der er seine Pläne in die Tat umsetzen würde. Die Nacht der Nächte. Das Ende monatelangen, nervenaufreibenden Wartens. Und somit auch der Anfang vom Ende all derjenigen, welche die Würde des Heiligen Stuhles mit Füßen traten. Nur noch ein paar Anweisungen an die Getreuen, eine aufrüttelnde Rede – und ein Sturm würde entfacht, der seinesgleichen suchte.
Ein diskretes Räuspern in seinem Rücken schreckte Kardinaldiakon Oddo di Colonna auf. Gewiss doch – die Tür! Ganz gegen seine Gewohnheit machte sich so etwas wie Nervosität in ihm breit, während der Schlüssel in dem eisenbewehrten Schloss zu quietschen und zu knarren begann.
Ein paar Augenblicke später war es geschafft. Nach außen hin die Ruhe selbst, trat der Kardinaldiakon zur Seite und ließ die Gefährten passieren. Kaum war dies geschehen, war die Pforte wieder geschlossen, verriegelt und der Schlüssel unter seinem Umhang verschwunden.
Den nach unten führenden, höchstens sieben Fuß hohen Gang vor Augen, holte der Kardinaldiakon tief Luft. Dann setzte er sich an die Spitze des Zuges und bedeutete den Gefährten, ihm zu folgen.
Je weiter er sich vorwagte, desto rascher verschwand seine anfängliche Nervosität. Umso erdrückender war aber auch der Geruch von Moder, Fledermauskot und Verwesung, der ihm von überall her entgegenschlug. Der Kardinallegat ließ sich jedoch nichts anmerken und setzte seinen Weg unbeirrt fort. Das Licht der Fackeln verzerrte seine hagere Gestalt auf groteske Weise und ließ ihn wie einen vielköpfigen, dem Erdreich entstiegenen Dämon erscheinen.
Er hatte sie getäuscht, alle miteinander. Mit List, Tücke und einem Ausmaß an Verschlagenheit, das ihn bisweilen selbst erstaunte. Er war rücksichtslos gewesen, gerissen bis zur Skrupellosigkeit. Hauptsache, seine Pläne würden Früchte tragen. Und wenn ihn nicht alles täuschte, sah es momentan ganz danach aus.
»Nach links!«, kommandierte der Kardinaldiakon in barschem Ton. Die Gefährten gehorchten ihm prompt und ohne Zögern. Auf sie, die Treuesten der Treuen, konnte er sich hundertprozentig verlassen. Egal, was passieren würde. Dessen war er sich absolut sicher.
Er hatte sie persönlich ausgesucht, jeden Einzelnen auf Herz und Nieren geprüft. Es hatte Rückschläge gegeben, aber am Ende hatte sich die Mühe gelohnt. Oddo di Colonna atmete befreit auf. Und das trotz der stickigen Luft, die sich wie Blei auf seine Lungen legte. Acht Gefährten, einander aufs Engste verbunden, Teil einer verschworenen Gemeinschaft, die nur darauf wartete, für den Heiligen Vater ins Feld zu ziehen. Was immer auch passieren würde, ihren Ehrentitel trugen sie völlig zu Recht: Milites Christi, Krieger des Herrn!
In derlei Gedanken vertieft, hatte der Kardinaldiakon sein Ziel erreicht, eine niedrige, kaum zehn Schritt im Quadrat große Grotte, in deren Mitte sich ein Sarkophag aus Granit befand. Die Luft war zum Schneiden dick, fast nicht zu ertragen. Doch Oddo di Colonna achtete nicht darauf, ebenso wenig wie auf die Grabnischen, welche ihn und die Gefährten umgaben.
Die Zeit drängte, und es gab viel zu tun. Er durfte sich keine Blöße geben. Trotz des Schauderns, das ihn unwillkürlich überkam. Schließlich war er es gewesen, der den Ort für das nun folgende Ritual ausgesucht hatte. Er und nicht etwa einer seiner Paladine, die sich heute, am Tage des heiligen Sebastian, zum ersten Mal trafen.
Und sich auf absehbare Zeit auch zum letzten Mal treffen würden.
Es war so weit. Der alles entscheidende Augenblick, die Stunde der Wahrheit war gekommen.
Ein Wink von Colonna, und die Kapuzenmänner scharten sich mit gesenktem Blick um den Sarkophag. Der Kardinaldiakon räusperte sich, sah sie der Reihe nach an und sprach: »Brüder in Christo, Krieger des Herrn! Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Hier, just an dem Ort, wo das Martyrium des heiligen Sebastian sein Ende fand, wird sich unser aller Schicksal erfüllen. Jeder Einzelne von euch weiß, was auf dem Spiel steht. Wenn auch keiner den anderen kennt oder mit ihm gesprochen hat. Habt ihr doch für die Dauer eurer Mission ein Schweigegelübde abgelegt, das es unter allen Umständen einzuhalten gilt!« Colonna pausierte, warf einen Blick auf seinen goldenen Ring und setzte seine Ansprache fort. »Doch nun zu eurer Mission: Jeder der hier Anwesenden trägt einen versiegelten Umschlag bei sich. Neben dem Ring, Zeichen unserer Bruderschaft, ist er euer wichtigstes Requisit. Er enthält den Namen der Stadt, in die ihr euch schnellstmöglich begeben werdet, den Namen der Herberge, wo euch ein Mitglied unserer Bruderschaft erwarten und instruieren wird, und nicht zuletzt den Decknamen, mit dem ihr euch vor Ort zu erkennen gebt. Erst dann, wenn wir auseinandergegangen sind, ist es euch gestattet, den Umschlag zu öffnen. Erst dann und keinen Augenblick früher! Und vor allem: Vernichtet ihn, sobald ihr euch seinen Inhalt eingeprägt habt! Seid auf der Hut, Brüder! Insbesondere, wenn ihr auf euch allein gestellt seid! Und noch etwas: Keiner von euch darf erfahren, was der andere tut, wo er sich aufhält und so weiter. Keiner von euch darf mit dem anderen sprechen, sonst ist sein Leben verwirkt! Keiner von euch darf überhaupt je des anderen Namen erfahren! Dies möge und muss auch weiterhin so bleiben, ist es doch nicht unsere armselige und nichtswürdige Person, die zählt, sondern die gemeinsame Sache, der wir uns mit Haut und Haaren verschrieben haben und der wir, falls nötig, bereitwillig unser Leben opfern werden. Bleibt stark im Glauben, Brüder, selbst dann, wenn sich die Aufgabe, die ich euch zugedacht habe, als schwierig und nahezu unlösbar erweist! Zweifelt nicht, wird doch bei allem, was ihr tut und noch tun werdet, des Herrn wohlgefälliges Auge auf euch ruhen! Fürchtet euch nicht, denn Gott der Herr wird bei euch sein, von nun an bis in alle Ewigkeit! Amen!«
»Amen!«, wiederholten seine Jünger wie aus einem Munde, so laut, dass es wie ein vielstimmiges Echo von den Wänden widerhallte. Der Kardinaldiakon atmete tief durch, während die Andeutung eines Lächelns auf seine Züge trat. Dann straffte er sich, entledigte sich seines Umhangs und sah die Gefährten der Reihe nach an: »Lasst uns daher unser Vorhaben mit einem heiligen Schwur besiegeln!«, sprach er, während sich sein stechender Blick in die Gesichter der Anwesenden bohrte. »Wir, die Milites Christi, Krieger des Herrn, der Mutter Kirche treu ergeben, und sollte dies mit unserem Martyrium enden, tun hier, am Grab des heiligen Sebastian, das Folgende kund: Wir wollen weder rasten noch ruhen, bis dass unsere Heilige Mutter Kirche vom Schmutz und Unrat unserer Zeit gesäubert, für den Kampf gegen das Böse und gegenüber den Anfeindungen ihrer Widersacher gewappnet ist. Mag dies Monate dauern oder gar Jahre, wir, die Krieger des Herrn, allzeit Hüter des Glaubens, sind zu allem bereit, und sei es, unsere Feinde auszutilgen mit Stumpf und Stiel. Denn es steht geschrieben: ›Und ich will mein Gericht über sie ergehen lassen um all ihrer Bosheit willen, dass sie mich verlassen und andern Göttern opfern und ihrer Hände Werk anbeten.‹ Für uns, Brüder in Christo, kann dies nur eines bedeuten: Zerschmettert die Symbole des Aberglaubens, vor allem diejenigen, welche man Reliquien nennt! Tilgt sie vom Angesicht dieser Erde, auf dass sie nie mehr in der Menschen Hände gelangen! Vor allem aber: Bestraft all diejenigen, welche sie anbeten, dem Aberglauben auf das Widerwärtigste verfallen!« Der Kardinaldiakon hatte sich förmlich in Rage geredet und fuhr mit dem Handrücken über die schweißnasse Stirn. Aber noch war er nicht am Ende, und während das Echo seiner Worte in den endlosen Gängen der Katakomben verhallte, schloss er die Augen, ballte die Faust und rief mit sich überschlagender Stimme: »Fluch über die Götzendiener, wo immer ihr sie auch trefft!«
»Wehe ihnen, denn sie sind verflucht!«, stießen die Kapuzenmänner mit rauer Stimme hervor. Für einen kurzen Moment war es still. Dann packte der Kapuzenmann zur Rechten des Kardinaldiakons sein Schwert, riss es aus der Scheide und reckte es zur rußfarbenen Decke empor. Einer nach dem anderen taten es ihm die Gefährten gleich. So lange, bis sich die Spitze ihrer Klingen über dem Sarkophag berührten.
»Fluch über all jene, welche Reliquien anbeten oder mit ihnen handeln um ihres Profites willen!«, skandierte Oddo di Colonna, das Gesicht zu einer Fratze des Hasses verzerrt.
»Wehe ihnen, denn sie sind verflucht!«, hallte es ihm von den Gefährten wie aus einem Munde entgegen.
»Fluch über all jene, welche Ablässe feilbieten um des schnöden Mammons willen!«
»Wehe ihnen, denn sie sind verflucht!«
»Fluch über die Frevler, welche Reliquien fälschen und sich damit an unser aller Mutter, der Kirche, auf das Schändlichste vergehen!«
»Wehe ihnen, denn sie sind verflucht!«, lautete die Antwort, bevor sich die Schwertspitzen der Krieger Christi auf den Sarkophagdeckel zu bewegten und auf dem verwitterten Kreuz an seinem Kopfende trafen.
Im gleichen Moment, gerade so, als ginge ihn das Ganze nichts mehr an, wandte sich der Kardinallegat ab und trat gemächlichen Schrittes den Rückweg an.
*
Als es vorüber war, dämmerte bereits der Morgen. Die Gefährten waren verschwunden. Getreu ihrem Gelübde hatten sie sich unweit des Eingangs zu den Katakomben ohne ein Wort des Grußes getrennt und kurz darauf in alle Winde verstreut.
Der hochgewachsene Mann Mitte 20 schlug seine Kapuze zurück, bewegte die steifen Glieder und blinzelte in die Sonne, die soeben am Horizont erschien. Der Ring an seiner Hand spiegelte sich darin, und die Andeutung eines Lächelns flog über sein Gesicht. Wie betäubt von den Ereignissen der letzten Stunden, überwand er seine Müdigkeit und schlug den Weg zur Via Appia ein. Von dort aus würde er sich schnellstmöglich in seine Herberge begeben, sein Pferd satteln und auf den langen Weg in die Heimat machen.
Als er den Leichnam des alten Hirten unweit der Straße auf dem freien Feld liegen sah, verlangsamte der junge Mann seinen Schritt, und ein Lächeln flog über das vom Fasten, den Exerzitien und Bußübungen ausgemergelte Gesicht. ›So wie ihm wird es allen gehen, die sich uns in den Weg stellen!‹, dachte er mit klammheimlicher Freude. Sich um die sterblichen Überreste des Alten zu kümmern, kam ihm nicht in den Sinn. Er hatte keine Zeit zu verlieren. Je früher er seine Mission erfüllte, umso besser.
Kurz vor dem Ziel, einer heruntergekommenen, übel beleumdeten Schenke in der Nähe des Kolosseums, wurde der junge Mann jäh aus den Gedanken gerissen. Eine Stimme, einschmeichelnd wie die Sünde, sprach ihn an, und als er den Kopf hob, fiel sein Blick auf eine üppige, grell geschminkte junge Dirne, die sich mit wiegendem Schritt auf ihn zu bewegte. Ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten blieb der junge Mann stehen, fingerte nervös an seinem Kragen herum und harrte der Dinge, die da kamen.
Kaum eine Viertelstunde später, als alles vorüber war, kannte sich der junge Erzdiakon selbst nicht mehr. All seinen Prinzipien und, weit schlimmer, dem Keuschheitsgelübde seiner Bruderschaft zum Trotz, hatte er das Lager mit einer hergelaufenen römischen Straßendirne geteilt.
Der junge Mann, Erzdiakon aus dem Land der Franken, schüttelte wie benommen den Kopf, selbst dann noch, als die Mauern Roms schon längst hinter ihm verschwunden waren.
2
Kanzlei des Erzbischofs von Mainz,
eine Woche vor Kiliani (1.7.1416)
Adolphus II. von Nassau, von Gottes Gnaden Erzbischof von Mainz, Erzkanzler des Heiligen Römischen Reiches und Kurfürst an
Johann von Brunn, Bischof von Würzburg und Herzog von Franken
Unseren kollegialen und im Geiste brüderlicher Verbundenheit entbotenen Gruß zuvor! Wir hoffen, Ihr befindet Euch wohl und erfreut Euch bester Gesundheit, dies umso mehr, als dass es mit der Heiligen Mutter Kirche nicht gerade zum Besten steht. Nicht genug damit, dass es landauf, landab von Ketzern, Aufrührern und falschen Propheten nur so wimmelt, steht Uns derzeit allerlei Ungemach ins Haus, der Grund, weshalb Wir Uns mit diesem Sendschreiben an Euch wenden.
Zuvor jedoch müssen Wir Euch dringend ermahnen, über das, worüber Wir Euch in diesem Brief berichten, absolutes Stillschweigen zu bewahren, ist es doch derart ungeheuerlich, dass Uns angst und bange wird, wenn Wir nur daran denken.
Wisset denn, Bruder im Amte und in Christo, dass es nicht nur in Unserer, sondern dem Vernehmen nach auch in der Diözese unserer Amtsbrüder zu Köln, Speyer und Straßburg zu einer Reihe von Vorfällen gekommen ist, die jedem rechtschaffenen Christenmenschen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Die Feder in Unserer Hand, welche Wir der Diskretion halber selbst führen, beginnt zu zittern, und stünde nicht Euer und unser aller Wohl auf dem Spiel, würden Wir sie beiseitelegen. Wisset denn, dass es just am heutigen Tage, dem ersten im Monat Julius, in aller Herrgottsfrühe zu einem Frevel gekommen ist, welcher in den Annalen Unseres Domes zu Mainz seinesgleichen sucht.
Das Reliquiar, in welchem Wir Kostbarkeiten von unschätzbarem Wert aufzubewahren pflegen, ist mit brachialer Gewalt aufgebrochen worden, sein Inhalt spurlos verschwunden. Eusebius, Domkapitular und mit der Aufsicht über die in der Ostkrypta aufbewahrten Reliquien betraut, wurde niedergestochen und kam nur knapp mit dem Leben davon. Selbst jetzt, etliche Stunden später, stockt Uns immer noch der Atem, und das Entsetzen über die abscheuliche Tat wird Uns wohl bis ans Ende Unseres Erdendaseins verfolgen.
Da Uns während der letzten Tage aus Köln, Speyer und sogar Straßburg just die gleichen oder ähnliche Nachrichten erreicht haben, wenden Wir uns in dieser Stunde tiefster Trauer und Seelenpein nun an Euch, Bruder im Amte, auf dass Ihr Vorkehrungen treffen möget, welche geeignet sind, diese oder ähnliche Vorfälle in Eurem Bistum zu verhindern.
Doch damit leider nicht genug. Was Unsere Person und die ihr anvertraute Herde angeht, können Wir Euch sagen, dass es in und um Mainz allein in den letzten paar Tagen zu nicht weniger als einem halben Dutzend Diebstählen gekommen ist. Bei den Bestohlenen handelt es sich ausschließlich um Leute, deren Broterwerb der Handel mit Reliquien ist. Bedauerlicherweise ist es Uns bis dato nicht gelungen, die Schuldigen ihrer gerechten Strafe zuzuführen, was Uns im Falle Unseres hoch geschätzten Domkapitulars mit besonders tiefem Schmerz erfüllt.
Möge Euch, Bruder im Amte und Christo zu Würzburg, in dieser Beziehung mehr Glück beschieden sein, auf dass denjenigen, welche sich an der Heiligen Mutter Kirche auf derart schändliche Weise vergehen, schnellstmöglich das Handwerk gelegt werden möge!
Adolphus, Erzbischof, Kurfürst und Kanzler des Reichs
Erster Tag
3
Würzburg am Main, Donnerstag vor Kiliani (2.7.1416)
Vielleicht lag es am Wein. Oder an der Aussicht auf raschen Gewinn. Jedenfalls ließ Agilulf, Reliquienhändler, Dieb und Hehler in einer Person, die gewohnte Vorsicht vermissen. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich bald herausstellen sollte.
Der Markt war vorbei, der Platz vor dem Dom fast leer. Was blieb, war die drückende Schwüle, selbst jetzt, kurz vor Sonnenuntergang. Der Geruch von Gewürzen, Backwaren und gebratenem Fleisch hing in der Luft und über allem der von Wein. Leider nicht die einzigen Düfte, die in Agilulfs empfindsame Nase stiegen. Denn wie üblich hielt der Markttag auch weniger angenehme Gerüche bereit. Je länger er hinter seinem Schragentisch ausharrte, umso durchdringender der Gestank nach Abfällen, verdorbenem Fisch und ranzigem Fett. Eine Mixtur, bei der sich ihm der Magen umdrehte.
Für heute jedenfalls hatte Agilulf genug. Mit 50 nicht mehr der Jüngste, setzte ihm die Hitze ordentlich zu. Schlimmer noch, die Geschäfte gingen ausgesprochen schlecht. Wahrscheinlich war dies einfach nicht sein Tag. Kein Wunder, dass Agilulf ausgiebiger als üblich dem Honigwein zusprach, den ihm Jan der Goldschmied in einem Anfall von Nächstenliebe kredenzte.
Dies war der Moment, als er den Fremden im schwarzen Umhang und der tief liegenden Kapuze zum ersten Mal sah. Es war kurz vor der Vesper, und am Himmel zogen dunkle Wolken auf. Jeder machte, dass er nach Hause kam, und als sogar das kleine Häuflein Bettler, Aussätzige und Vaganten die Stufen vor dem Domportal fluchtartig verließ, räumte Agilulf das Feld.
Es war so wie immer. Wäre der Fremde im dunklen Umhang nicht gewesen.
Agilulf war dabei, seine Siebensachen zu packen, als er plötzlich auftauchte. Mag sein, es lag am Donnergrollen, das die stickige Luft ringsumher vibrieren ließ. Aber Agilulf hatte ihn nicht kommen hören. Der Fremde, mehr als einen Fuß größer, noch dazu erheblich schlanker als er, ja geradezu hager, stand einfach neben ihm. Gerade so, als sei er dem Erdboden entstiegen. Vor Schreck wäre ihm die hölzerne Schatulle mit den kostbarsten Stücken aus seinem Sortiment fast aus den Händen gefallen.
Agilulf sah nicht auf, so sehr war ihm die Furcht in die Glieder gefahren. Der Fremde indes schien sich nicht daran zu stören. Mehr noch, er beachtete ihn zunächst kaum. Fast schien es, als sei Agilulf Luft für ihn. Doch dann, als sich der Reliquienhändler vom ersten Schreck erholt hatte, ergriff er plötzlich das Wort.
Solange sich Agilulf entsinnen konnte, hatte er noch nie eine derartige Stimme gehört. Fast ein Ding der Unmöglichkeit, die von ihr ausgehende Bedrohung in Worte zu kleiden: »Nicht gerade ideal für ein gutes Geschäft, nicht wahr?«, sinnierte der Fremde in einschmeichelndem, geradezu femininem Ton, und für einen Augenblick spielte Agilulf mit dem Gedanken, seine Siebensachen zu packen und ihn einfach stehen zu lassen. Der Gedanke, der ihm als Nächstes durch den Kopf schoss, war derart alarmierend, dass er diesem Impuls auch um ein Haar nachgegeben hätte: ›So und nicht anders hört sich der Teufel an!‹, dachte der Reliquienhändler, bestürzt, dass er im gleichen Moment wie Espenlaub zu zittern und ihm der Schweiß aus sämtlichen Poren zu schießen begann.
»Wollen sehen, was es hier so alles zu bestaunen gibt!«, murmelte der Fremde, nahm Agilulf die Schatulle aus der Hand und öffnete sie. Der Reliquienhändler war wie vom Donner gerührt, schritt jedoch nicht ein. Kein Wort, geschweige denn Widerspruch, kam ihm über die Lippen. Kein Tadel, kein Einwand – nichts. Agilulf kannte sich selbst nicht mehr. Er stand einfach nur da und harrte der Dinge, die da kommen sollten.
»Und wo hast du das alles her?«, fragte der Fremde in beiläufigem Ton. Agilulf fuhr zusammen und brachte kein einziges Wort hervor. Wozu überhaupt die Frage, was in aller Welt hatte der Kerl vor? »Ein besonders schönes Stück, in der Tat!«, wich er ihr so gut es ging aus, als er den Tuchfetzen in der Hand des Fremden bemerkte. »Stammt vom Tischtuch beim letzten Abendmahl des Herrn! Von geradezu unschätzbarem Wert! Oder hier – ein Streifen von seinem Grabtuch! Ebenfalls nicht mit Geld zu bezahlen! Wenn Ihr genau hinseht, Herr, könnt Ihr sogar noch Spuren seiner Wundmale …«
»Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich dich danach gefragt, vonwem du diese Reliquien hast, und nicht danach, woher sie stammen! Was ihre Echtheit betrifft, sind sie doch wohl über jeden Zweifel erhaben, oder?!«
Agilulf schluckte und sah sich Hilfe suchend um. Der Platz vor dem Dom war wie leer gefegt, weit und breit kein Mensch zu sehen. Donnergrollen erfüllte die Luft, und die Sonne war hinter einem pechschwarzen Wolkengebirge verschwunden. »Gewiss doch, Herr – wo denkt Ihr hin! Und zwar jedes einzelne Stück! So wahr ich Agilulf der Reliquienhändler bin!«
Der Fremde gab keine Antwort, sondern blickte nachdenklich vor sich hin. Agilulf trat von einem Bein aufs andere, wusste weder ein noch aus. Worauf wollte der Fremde hinaus? Dass seine Reliquien nicht echt waren, wusste doch jeder, der nicht mit Blindheit geschlagen war! Wozu also das Getue?
Je länger Agilulf nachdachte, umso wütender wurde er. Und als sich unweit des Maintores der erste Blitz in die Erde bohrte, war er mit der Geduld am Ende. Wenn er jetzt nicht Fersengeld gab, würde es ziemlich ungemütlich werden. Reliquien hin oder her!
»Mit Eurer Erlaubnis, Herr!«, machte er aus seiner Ungeduld keinen Hehl, raffte seine Siebensachen zusammen und verstaute sie in der Truhe, die direkt neben dem Schragentisch stand. Für den Fall, dass er es nicht mehr bis nach Hause schaffte, konnte er ja im Dom Zuflucht suchen.
Als Letztes klappte er den Schragentisch zusammen, und als er damit fertig war, hatte er den Fremden schon fast vergessen. Gerade wollte er die Truhe auf seinen Handkarren hieven, als er erneut seine Stimme vernahm. Nicht viel hätte gefehlt, und die Truhe wäre ihm aus der Hand gerutscht, so sehr fuhr ihm der Schreck in die Glieder: »Nicht gar so geschwind, Agilulf – du hast etwas vergessen!«, tönte die Stimme, und ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken.
»Was denn? Und überhaupt – woher kennt Ihr meinen Namen?«
»Nicht so wichtig!«, wiegelte der Fremde ab, sorgsam darauf bedacht, sein Gesicht zu verbergen. »Da – nimm!«
Agilulf unterdrückte einen Fluch, stellte die Truhe ab und griff nach dem Stofffetzen, den ihm der Fremde vor die Nase hielt.
Und erschrak fast zu Tode.
Die Hand, die sich ihm entgegenreckte, war schneeweiß. Und kalt wie Marmor. Die Klaue eines Toten mit einem Ring aus Gold.
Der Reliquienhändler rang um Fassung, griff aber nichtsdestoweniger zu. Eines seiner kostbarsten Stücke zu verlieren, konnte er sich einfach nicht leisten. »Habt Dank!«, murmelte er mit schwerer Zunge, wobei er den Blick des Fremden wohlweislich mied. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und machte sich auf den Nachhauseweg.
Weit kam er allerdings nicht. Er hatte noch keine zehn Schritte zurückgelegt, als Agilulf hinter sich eine einschmeichelnde Stimme sagen hörte: »Lust auf ein gutes Geschäft?! Sozusagen auf das Geschäft deines Lebens?«
Drauf und dran, dem Fremden eine Abfuhr zu erteilen, überlegte es sich der Reliquienhändler im letzten Moment anders. Zugegeben, der Unbekannte wirkte alles andere als vertrauenerweckend auf ihn. Und eigentlich hatte er ja auch eine Heidenangst. Aber da war plötzlich dieser Impuls in seinem Inneren, eine Art unkontrollierbarer Reflex, der ihn jegliche Vorsicht vergessen und sich dem Fremden auf Gedeih und Verderb ausliefern ließ. »Lasst hören!«, hörte sich der Reliquienhändler zu seinem Erstaunen sagen und hatte dabei das Gefühl, als dringe die eigene Stimme aus weiter Entfernung an sein Ohr. Nicht mehr Herr seiner selbst, stand Agilulf einfach nur da und ließ den Blick zwischen den Fußspitzen hin und her pendeln. Dass unweit von ihm der Blitz einschlug, nahm er nur am Rande wahr.
»Kennst du die Schenke ›Zum roten Hahn‹?«, raunte der Fremde und sah sich verstohlen um.
»Und ob! Wer kennt sie nicht!«, gab sich Agilulf locker und entspannt, ungeachtet des Fröstelns, das ihn in diesem Moment überkam.
»Umso besser! Dann werden wir uns dort in genau einer Stunde treffen. Pünktlich! Ich warte nämlich nicht gern!«
Agilulf öffnete den Mund, um zu protestieren, aber im gleichen Moment brach ein Gewitter los, wie es die Stadt nur selten erlebt hatte. Der Reliquienhändler ließ alles stehen und liegen und flüchtete in die nächstbeste Toreinfahrt. Gerade noch rechtzeitig, bevor Myriaden scharfkantiger Hagelkörner wie Geschosse vom Himmel prasselten.
Das Unwetter indes hielt nicht lange an. Kaum eine Viertelstunde verstrich, und alles war vorüber. Agilulf streckte den Kopf unter der Toreinfahrt hervor und warf einen Blick in die Runde. Auf der Domstraße, wo sich Hagelkörner, Abfälle und Pferdemist zu einem übelriechenden Gemisch vermengten, war kein Mensch zu sehen.
Aber das machte nichts. Hauptsache, er war noch einmal davongekommen.
Wieder ganz der Alte, konnte der Reliquienhändler seine Neugierde kaum noch im Zaum halten. Ein Geschäft – gut und schön! Aber was für eines? Und überhaupt: Wer war der Kerl eigentlich?
Während Agilulf seine Habseligkeiten zusammensuchte, beschlich ihn ein eigenartiges Gefühl, und als sei ihm der Unbekannte immer noch auf den Fersen, sah er sich auf dem Nachhauseweg ein Dutzend Mal um.
Doch sooft er dies auch tat, der Fremde mit dem Kapuzenmantel war und blieb verschwunden.
*
Schenke ›Zum roten Hahn‹, kurz nach Sonnenuntergang
»Sauwetter, verdammtes!«
Berengar von Gamburg, Vogt des Grafen von Wertheim, starrte mit verdrießlichem Blick aus dem Fenster der verrufenen Schenke hinaus, in die es ihn wegen des Unwetters verschlagen hatte. Er war klitschnass, sein Wams und das sündhaft teure Leinenhemd allenfalls noch zur Feldarbeit zu gebrauchen. Mit seinen Stiefeln, einst sein ganzer Stolz, sah es nicht viel besser aus. Glück im Unglück, dass der Wein in der Schenke halbwegs genießbar war. Sonst wäre es nicht zum Aushalten gewesen.
So aber schluckte er seinen Ärger hinunter, und in dem Maße, wie der Regen nachließ, begann sich seine Stimmung zu bessern. Käse, Frankenwein und Zwiebeln jedenfalls mundeten vorzüglich, obwohl er sich nicht gerade in bester Gesellschaft befand.
Der ›Rote Hahn‹, Treffpunkt von Münzfälschern, Beutelschneidern und allerlei zwielichtigen Figuren, war brechend voll. Berengar hätte ihnen am liebsten das Handwerk gelegt, hielt sich jedoch klugerweise zurück. Ärger hatte er nämlich schon genug am Hals. Und das ausgerechnet mit seiner Schwester. Der Vogt nahm einen kräftigen Schluck. Er kam zwar gut mit ihr aus, aber was zu viel war, war nun einmal zu viel. Die Wurzel allen Übels, sein Schwager, hatte wieder einmal große Reden geschwungen. Ein Gewürzhändler, noch dazu in seiner Familie! Dieser Pfeffersack konnte einem wirklich den letzten Nerv töten. Kein Wunder also, dass sie sich schon nach kurzer Zeit in die Haare geraten waren. Ein Wort gab das andere, und wäre seine Schwester nicht gewesen, hätte es einen handfesten Streit gegeben. Also nichts wie raus an die frische Luft!, hatte er gedacht. Dass er in das schlimmste Unwetter der letzten Jahre geraten würde, konnte er schließlich nicht ahnen.
Eigentlich hatte Berengar ja genug, aber da ihm der Leisten am heutigen Abend besonders gut schmeckte, trank er den Krug vollends leer. Der Vogt des Grafen von Wertheim fuhr mit dem Handrücken über den Mund und schnalzte genüsslich mit der Zunge. Zwei Tage noch bis zu dieser vermaledeiten Kindstaufe, bei der ihm die Rolle des Paten zugedacht war. Und dann nichts wie ab nach Hause!
Wie nicht anders zu erwarten, stieg ihm der Wein langsam in den Kopf, aber als der gedrungene, um die 50 Jahre alte Mann die Schenke betrat, war Berengar plötzlich hellwach. An jedem anderen Tag hätte er den Mann mit dem Filzhut, dem Rock aus grauem Wollstoff und den löchrigen Beinlingen auf Anhieb erkannt. An jedem anderen Tag, nur nicht heute. Kommt vom vielen Saufen!, gestand sich Berengar zähneknirschend ein, und bevor ihm einfiel, wo er ihn schon einmal gesehen hatte, war der Mann mit dem Filzhut wieder verschwunden.
»Noch einen Krug Wein, Herr?« In Gedanken immer noch bei dem ominösen Besucher, hatte Berengar den Schankwirt nicht kommen hören. Mit einem Lächeln, das so breit wie schmierig war, baute sich der widerliche Fettwanst mit der fleckigen Schürze vor Berengar auf. Seine Absicht war klar, nämlich den unbekannten, allem Anschein nach aber betuchten Besucher seiner Spelunke kräftig zur Ader zu lassen. Berengar verneinte, aber ein Schlitzohr wie ihn wurde man natürlich nicht so schnell los. »Darf es vielleicht etwas anderes sein?«, salbaderte der Wirt und fügte mit feuchter Aussprache hinzu: »Falls Euch gerade der Sinn danach steht – ich kenne ein paar Mägdelein, die nur darauf warten, Eure Bekanntschaft zu machen! Ihr müsst nur sagen, nach welcher meiner Dirnen Euch der Sinn steht, und schon werdet …«
»… werde ich zur Kasse gebeten, ich weiß!«, vollendete Berengar, der von derlei Vergnügungen nicht das Geringste hielt. »Habt Dank, Herr Wirt – aber wenn es Euch nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne meine Zeche begleichen! Und zwar sofort!« Der Wirt runzelte die Stirn, wagte jedoch keinen Einwand und zog sich kommentarlos hinter den Tresen zurück. Für einen Moment verstummten die Gespräche, aber da mit Berengar offenbar nicht gut Kirschen essen war, ließ es die versammelte Halbwelt nicht auf eine Messerstecherei mit dem Vogt ankommen und wandte sich wieder dem Würfelspiel zu.
Der hatte im Moment auch andere Probleme, da sich ein menschliches, nach mehreren Bechern Wein immer dringlicheres Bedürfnis bei ihm zu regen begann. Und so rappelte sich Berengar auf und schlug den Weg zur Latrine ein, die sich im rückwärtigen Teil des Anwesens befand. Mindestens ein halbes Dutzend Diebe, Dirnen und Bettler säumte seinen Weg, aber da ihm in Würzburg keinerlei Amtsgewalt zustand und er zudem auf sich allein gestellt war, ließ er sie einfach links liegen und durchquerte so schnell wie möglich den Raum.
Endlich an der frischen Luft, bekam er erst richtig zu spüren, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte, denn auf einmal wurde ihm so schwindelig, dass er beträchtlich ins Schlingern geriet. Dass Berengar die Latrine trotzdem fand, grenzte schon fast an ein Wunder. Als er sich auf den Rückweg machte, fühlte er sich immerhin schon ein wenig besser, und so hielt er inne und atmete ein paar Mal tief durch. Die vom Unwetter gereinigte Nachtluft tat ihm gut, weshalb er beschloss, sie noch einen Moment zu genießen. Wieder einigermaßen bei Kräften, ging er zum Brunnen, wusch sich das Gesicht und machte sich auf den Weg zurück ins Haus, mit der Absicht, die Zeche zu begleichen.
Dazu sollte es aber nicht mehr kommen.
Von jenseits der Mauer, die den Hinterhof der Schenke von der angrenzenden Gasse trennte, drangen plötzlich Stimmen an sein Ohr. An sich nichts Ungewöhnliches in einem Viertel, wo sich allerlei zwielichtige Gestalten herumtrieben. Berengar dachte sich nichts dabei und setzte seinen Weg fort. Dann aber, fast schon unter dem Türrahmen, blieb der Vogt wie angewurzelt stehen.
Ganz offensichtlich und unüberhörbar nahm der Tonfall auf der anderen Seite der Mauer an Schärfe zu. Die beiden Streithähne, allem Anschein nach zwei Halunken aus der Schenke, gerieten derart aneinander, dass Berengar fast jedes einzelne Wort verstehen konnte. Der Vogt zögerte, konnte jedoch seine Neugierde nicht unterdrücken und pirschte sich auf Zehenspitzen an die Mauer heran.
Mit das Erste, was ihm auffiel, war die Stimme eines der beiden Männer. Ein von Natur aus furchtloser, um nicht zu sagen hartgesottener Vertreter seiner Zunft, konnte sich Berengar eines Fröstelns nicht erwehren. »Willst du dir nun eine goldene Nase verdienen oder nicht?«, raunzte der Mann in einem Tonfall, der die von ihm ausgehende Bedrohung auch ohne die entsprechende Mimik mehr als deutlich werden ließ. »Wenn nicht, lass es mich wissen – sofort!«
Derjenige, dem diese Worte galten, blieb seinem Gegenüber die Antwort schuldig. Wahrscheinlich hatte er Skrupel, möglicherweise aber auch Angst. Geraume Zeit verstrich, ohne dass sich etwas rührte. Jenseits der Mauer war es totenstill. Berengar dachte schon, das Gespräch sei beendet, als er plötzlich die Stimme eines Mannes vernahm. Der Vogt des Grafen von Wertheim war wie vom Donner gerührt. Er kannte die Stimme, wenn er sie auch nicht auf Anhieb mit einem der ihm bekannten Galgenvögel in Verbindung bringen konnte: »Natürlich bin ich mit von der Partie!«, beteuerte der Mann, wobei deutlich zu spüren war, wie sehr ihm die Angst im Nacken saß. »Wo denkt Ihr hin!«
»Wo also ist dann das Problem?«, fragte sein Gegenüber in hochfahrendem Ton. »Außer vielleicht, du hättest auf einmal kalte Füße bekommen.«
»Hab ich nicht.«
»Hört sich aber so an.«
»Na, Ihr macht mir vielleicht Spaß! Die Kilianreliquien zu stehlen ist ja wohl beileibe kein Kinderspiel!«
Berengar schnappte nach Luft und ballte die Rechte zur Faust. Was er da eben gehört hatte, klang so ungeheuerlich, dass er einige Zeit brauchte, um es zu verdauen. Der Vogt wagte kaum zu atmen, und während er sich den Kopf darüber zerbrach, wie man den schlimmsten Frevel in den Annalen der Stadt vereiteln konnte, war auf der anderen Seite der Mauer Gelächter zu hören.
»Was ist denn daran so witzig?«, stieß der Mann, allem Anschein nach ausführendes Organ, in unwirschem Tonfall hervor. »Wenn ich schon meinen Kopf für Euch hinhalten soll, nehmt mich gefälligst ernst!«
Das Gelächter des mutmaßlichen Auftraggebers erstarb auf der Stelle, und eine Antwort ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten: »Du hast recht, Spaß beiseite!«, sprach er in einem Ton, der zeigte, wie ernst es ihm mit seinem Vorhaben war. »Und daher nochmals die Frage: Nimmst du den Auftrag nun an – ja oder nein?!«
»Ja, verdammt noch mal! Oder soll ich es etwa drei Mal sagen?!«
»Nicht nötig. Ich glaube es dir auch so.«
»Und die Bezahlung? Wenn ich schon Kopf und Kragen riskiere, solltet Ihr es Euch etwas kosten lassen!«
»Keine Sorge. Für dein Wohlergehen ist bestens gesorgt!«, entgegnete der vermeintliche Auftraggeber in gelassenem Ton. »Mein Wort darauf.«
»Das genügt mir nicht! Wie viel?!«
»Nun, ich denke, zehn Gulden dürften wohl mehr als …«
»100. Und keinen Pfennig weniger. Das ist mein letztes Wort.«
Auf der anderen Seite der Mauer erklang ein Lachen, bei dessen Klang es Berengar eiskalt den Rücken hinunterlief. »Also gut – 100! Die Hälfte jetzt, der Rest bei Lieferung. Zufrieden?«
Stille. Berengar spitzte die Ohren, konnte aber beim besten Willen nichts hören. Es war auch nicht weiter wichtig, denn die Erkenntnis, die ihm im selben Moment kam, war wertvoller als tausend Worte. Und nicht nur das. Gerade so, als schließe er gerade eine geheime Kammer auf, konnte er das Bild des Mannes auf der anderen Seite der Mauer plötzlich vor sich sehen.
Es war der Mann aus dem Schankraum, just derselbe, der ihm vor etwa einer Viertelstunde über den Weg gelaufen war. Doch damit nicht genug. Plötzlich fiel ihm wieder ein, woher er den Mann kannte.
Agilulf der Reliquienhändler. Ein Dieb, Hehler und Betrüger, der seinesgleichen suchte. Bekannt wie ein bunter Hund. Berengar kochte vor Wut, und das nicht ohne Grund. Vor knapp zwei Jahren, an Martini, war er ihm nur knapp durch die Lappen gegangen. Der Vorwurf: Münzfälscherei. Spurlos verschwunden ausgerechnet an dem Tag, als Berengar ihn hatte dingfest machen wollen. Wie und mit wessen Hilfe, war ihm immer noch ein Rätsel.
Er hatte noch eine Rechnung offen mit diesem Strolch. Und er würde sie begleichen.
Jetzt gleich.
Auf einen Schlag war alles vergessen. Der Wein, die Zeche, der Ärger zu Hause. Berengar kannte nur noch einen Gedanken: es diesem Agilulf nach Kräften heimzuzahlen.
Wenn nur das Hausschwein nicht gewesen wäre, das just in diesem Moment seinen Weg kreuzte.
Der Vogt spürte es mehr, als dass er es sah. Und da war es auch schon zu spät. Berengar geriet ins Taumeln, stieß einen unterdrückten Fluch aus – und landete kopfüber im Morast. Das Schwein hingegen trabte davon, als sei nichts gewesen.
Schneller als erwartet war Berengar jedoch wieder auf den Beinen, rannte zum Hintereingang und bahnte sich von dort aus einen Weg zur Tür. Und das trotz der Flüche, Rippenstöße und Schmähworte, die von allen Seiten auf ihn niederprasselten. Den Wirt, der sich ihm in den Weg stellen wollte, stieß er kurzerhand zur Seite. Dann riss er die Tür auf, stürmte ins Freie und bog wie von Furien gehetzt um die Ecke.
Doch er kam zu spät. Die Gasse, welche an die Schenke grenzte, lag in tiefem Dunkel. Entwischt! Berengar konnte es einfach nicht glauben.
Im Begriff, kehrtzumachen, hörte der Vogt plötzlich ein Geräusch. Zuerst dachte er, es rühre von den Ratten her, die unweit von ihm in einem Abfallhaufen wühlten. Doch wurde er eines Besseren belehrt.
Der Mann am anderen Ende der Gasse, dessen Konturen sich nur schemenhaft von der Dunkelheit abhoben, war groß, schlank und in einen dunklen Kapuzenmantel gehüllt. »He, du da – bleib stehen!«, stieß Berengar atemlos hervor. Eine Aufforderung, die der Fremde überraschenderweise befolgte.
Lag es an der Art, wie er sich umdrehte – lässig, graziös, als habe er alle Zeit der Welt? Oder war es die Kapuze, die sein Gesicht fast komplett verhüllte? Wie dem auch sei!, dachte Berengar, während er sein Schwert aus der Scheide zog. Hier hast du es mit einem verdammt gefährlichen Burschen zu tun!
Die Arme vor der Brust verschränkt, stand der Unbekannte einfach nur da und rührte sich keinen Zoll von der Stelle. Die Art und Weise, wie er dies tat, wirkte auf Berengar wie eine Provokation. Fast automatisch kochte die schwarze Galle in ihm hoch.
Einem angeborenen Instinkt folgend, drehte sich der Vogt auf dem Absatz um. Aber da war niemand. Gut möglich, dass Agilulf längst über alle Berge und der Mann am Ende der Gasse tatsächlich allein war.
Berengar umklammerte den Schwertknauf und ließ das flache Ende der Klinge in die Fläche der linken Hand fallen. Und das gleich mehrmals hintereinander. Bei dem Mann mit dem dunklen Umhang schien dies jedoch keinen Eindruck zu hinterlassen. Mehr noch, der Vogt hatte das Gefühl, dass sich sein Mund zu einem überheblichen Lächeln verzog.
Und so tat Berengar genau das, wozu ihn der Mann verleiten wollte. Er beschloss, die Herausforderung anzunehmen, und ging mit gezücktem Schwert auf ihn zu. Kaum mehr zehn Schritte von ihm entfernt, vernahm er plötzlich ein Geräusch. Es kam von hinten, aber so blitzschnell, dass er nicht mehr reagieren konnte.
Im gleichen Moment spürte er, wie ihn ein stumpfer Gegenstand am Hinterkopf traf. Dann wurde es finster, und Berengar stürzte wie ein gefällter Baum zu Boden.
*
›Haus der sieben Sünden‹, eine Stunde vor Mitternacht
Wie immer, wenn er seine Strafe empfangen hatte, lag er noch eine Weile regungslos am Boden, die Arme weit von sich gestreckt und den blutüberströmten Rücken von Striemen überzogen. Es war der Moment, nach dem er sich am meisten sehnte, mehr als nach irgendetwas anderem auf der Welt. Ließ der Schmerz erst einmal nach, würde er den gerechten Lohn für sein Martyrium empfangen. Dann, und nur dann, stellte sich bei ihm ein Wohlgefühl ein, das mit nichts auf der Welt zu vergleichen war. Dann hatte er das Gefühl, es mit jedermann aufnehmen zu können.
Wer immer es wagen würde, sich ihm in den Weg zu stellen, würde wie ein Insekt vom Angesicht der Erde getilgt. Genauso wie der tumbe Haudegen von vorhin, kein Gegner für jemanden wie ihn.
So wahr er ein Krieger des Herrn war.
Als die Tür seiner Kammer ins Schloss fiel, richtete er sich leise ächzend auf und kroch hinüber zum Bett. Die Wunden auf seinem Rücken schmerzten so heftig wie noch nie. Aber das spielte keine Rolle. Schließlich hatte er es so gewollt.
Unter Aufbietung all seiner Kräfte erreichte er schließlich sein Lager, ein paar löchrige Strohsäcke und eine Wolldecke, auf der es vor Läusen, Wanzen und anderem Ungeziefer nur so wimmelte. Alles andere als einladend, war es unter den gegebenen Umständen jedoch seine Rettung. Der knapp 24-jährige Mann mit der dunklen Maske biss die Zähne zusammen, klammerte sich an die Bettkante und richtete sich leise ächzend auf. Dann legte er die Handflächen aneinander und sprach ein Gebet. Erst danach hievte er sich mit letzter Kraft auf das Bett hinauf, streifte seine Maske ab und schlief sofort ein.
Als es Mitternacht schlug, wachte er plötzlich auf. In der Kammer nebenan war das laszive Kichern einer Frau und das schwerzüngige Lallen eines offenbar nicht mehr ganz nüchternen Mannes zu hören. Der junge Mann schloss die Augen und krallte sich so verbissen am Bettrahmen fest, dass er das sündhafte Treiben glatt vergaß.
Kurz darauf bemerkte er, wie sich die Türklinke langsam nach unten bewegte. Normalerweise wäre er auf der Hut gewesen, aber da er wusste, dass es nur eine Person gab, die sein Refugium im ›Haus der sieben Sünden‹ kannte, bestand kein Anlass zur Sorge.
»Bist du es, mein Sohn?«, hörte er eine brüchige, von Alter, Mühsal und Kummer kündende Stimme sagen.
»Ja, Mutter!«, antwortete er mit spürbarer Erleichterung. »Hier drüben – auf dem Bett!«
Er hörte das Klappern ihres Gehstocks, den schleppenden Gang ihrer Schritte. Fast vierundneunzig und so gut wie blind, fiel es ihr begreiflicherweise schwer, sich zurechtzufinden, und bis sie sein Lager erreicht hatte, verging eine halbe Ewigkeit. Aber dann, als er ihre knochigen Hände auf seiner Wange spürte, war auf einmal alles wieder gut.
Trotz ihres hohen Alters sank die Greisin in der Tracht der Benediktinerinnen von St. Afra zu Würzburg neben dem Bett auf die Knie und sprach ein Gebet. Dann umklammerte sie ihren Stock, richtete sich wieder auf und ließ sich mit einem lauten Seufzer auf der Bettkante nieder.
Die Ordensfrau sprach kein Wort. Wichtiger noch, sie stellte keinerlei Fragen. Sie war einzig und allein des jungen Mannes wegen hier. Für sie war er ihr Sohn, wenn schon nicht im wortwörtlichen, so doch im übertragenen Sinn. Seit fast 24 Jahren, quasi von Geburt an, hatte sie sich um ihn gekümmert. Und würde es auch weiterhin tun. Egal, was passierte.
Es dauerte nicht lange, und der junge Mann begann die heilende Kraft ihrer Hände zu spüren. Mit der Wundsalbe, welche sie nebst weiteren Arzneien, Tinkturen und Pulvern in der abgenutzten Ledertasche bei sich trug, wirkte die Greisin wahre Wunder, und die Lebensgeister ihres Patienten kehrten allmählich wieder zurück.
Nach getaner Arbeit, als die Schmerzen verebbt und die Wunden des Mannes mit Leinenbinden umwickelt waren, packte die Greisin wieder ihre Siebensachen. Jeder Handgriff saß, und dies, obwohl sie fast blind und das Refugium des jungen Mannes nur mehr notdürftig von einem qualmenden Klumpen Unschlitt erhellt worden war.
Wie immer tat Schwester Serafina ihre Pflicht, und am heutigen Tag tat sie mehr als das. Sie linderte die Qualen einer gepeinigten Seele, wenn auch nur für kurze Zeit. Das war sie ihrer inneren Stimme schuldig. Und dem Knaben, der vor mehr als zwei Jahrzehnten in ihre Obhut gegeben worden war.
»Warum hast du das getan, mein Sohn?«, fragte Schwester Serafina auf dem Weg zur Tür. Sie sagte dies fast beiläufig, ohne jeglichen Tadel.
»Ich habe gesündigt, Mutter!«, antwortete der junge Mann, die Stirn auf die verschränkten Arme gestützt. »Schwerer, als Ihr es Euch überhaupt vorstellen könnt.«
Während ihre gichtstarre Hand bereits auf der Türklinke ruhte, blieb die Alte noch einmal stehen. »Haben wir das nicht alle einmal – irgendwann?«, antwortete sie, wobei sie das letzte Wort ganz besonders betonte. Der Tonfall, in dem dies geschah, wirkte besänftigend, fast heiter, und wie um dies zu bekräftigen, glitt ein Lächeln über das verwitterte, von tiefen Furchen durchzogene Gesicht. Mit den Fallstricken des Erdendaseins bestens vertraut, war Schwester Serafina mit den Jahren immer nachsichtiger geworden, wie so viele, die an der Schwelle des Todes stehen.
»Mag sein, aber …«, wandte der junge Mann voller Bitterkeit ein, vollendete seine Antwort jedoch nicht.
Ohne ein Wort des Abschieds war Schwester Serafina wieder verschwunden, und der Klang ihres Gehstocks hallte noch lange in seinen Ohren nach, so lange, bis er es nicht mehr ertrug und die feingliedrigen Hände mit aller Kraft gegen die Ohrmuscheln presste.
Er hatte gesündigt, schlimmer als irgendwer sonst auf der Welt. Wider sein Gelübde, die Regeln seiner Bruderschaft und, schlimmer noch, gegen sich selbst. Ein schwerer, nicht wiedergutzumachender Fehler. Ein Fehler, welcher ihn das Leben kosten würde, und das vermutlich recht bald.
Das Fieber, welches ihn immer häufiger auf sein Lager zwang, würde ihn töten. Wann es so weit sein würde, war letztendlich egal. Er konnte seinem Schicksal nicht entrinnen. Das wusste er genau.
Als er an die billige römische Straßenhure dachte, bei der er sich angesteckt hatte, wich auch noch der letzte Funken an Menschlichkeit aus seinem Gesicht. Und als existierten die grässlichen Wunden auf seinem Körper nicht, richtete er sich leise ächzend auf, schwang die Füße aus dem Bett und streifte den dunklen Umhang über, der neben ihm auf dem Boden lag.
Während er so dasaß, von Schmerzen gepeinigt, fiel sein Blick auf den Ring an der rechten Hand, und ein Ruck ging durch seine gebeugte Gestalt.
Bevor er krepieren würde wie ein Tier, hatte er noch eine Mission zu erfüllen. Ohne Wenn und Aber. Egal, wie viele nichtswürdige Kreaturen ihm in den Tod vorausgehen würden.
So wahr er ein Krieger des Herrn war.
Amen.
*
Agilulfs Haus im Hauger Viertel, kurz nach Mitternacht
»Wo in aller Welt kommst du jetzt eigentlich her?!«, keifte Agilulfs Frau Hildegard den leicht angeheiterten Reliquienhändler an. »Kannst du mir erklären, was das soll?!«
»Da gibt’s nichts zu erklären!«, blaffte dieser zurück, in einem Ton, der die erhoffte Wirkung allerdings verfehlte. »Und jetzt hol mir Wein, aber ein bisschen plötzlich!«
Doch Hildegard, des langen Wartens überdrüssig, gab nicht so schnell auf. »Hol ihn dir doch selber!«, trumpfte sie mit entschlossener Miene auf. »Es sei denn, du sagst mir, wo du dich die ganze Zeit über rumgetrieben hast!«
»Auf dem Markt!«, gab Agilulf kleinlaut zurück, wohl wissend, wie einfallslos seine Entschuldigung klang.
»Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen!«, fuhr ihn die kleine, dafür aber umso energischere Frau mit den Luchsaugen an und baute sich drohend vor ihm auf. »Also: Wo bist du gewesen?!«
»Geld verdienen.«
»Das wäre zur Abwechslung ja mal was Neues.«
»Die einen brauchen ein halbes Leben, die anderen nur einen Tag!«, trumpfte Agilulf mit neu erwachtem Selbstbewusstsein auf.
»Was du nicht sagst! Wie ausgerechnet du so was hinkriegen willst, ist mir allerdings ein Rätsel.«
»Abwarten – wirst schon sehen!« Agilulf wusste, wie er seine Frau packen musste. Wenn man ihr einen Köder hinwarf, ebbte ihr Zorn nämlich meist ab. So auch dieses Mal, obwohl sie so wütend gewesen war wie noch nie.
»Raus damit – was geht in deinem Säuferhirn vor?«, wollte Hildegard wissen, die Stirn in Falten, aber deutlich milder gestimmt.
Agilulf atmete tief durch. Er hatte es wieder einmal geschafft, sie um den Finger zu wickeln. Der Spannung halber zog er es trotzdem vor, mit der Wahrheit noch eine Weile hinterm Berg zu halten. Nur noch kurze Zeit, und sie wäre wie Wachs in seinen Händen.
»Na komm schon, alter Hurenbock!«, forderte sie in neugierigem Ton. »Jetzt lass dich halt nicht so lange bitten!«
»Und wie steht’s mit dem Wein?«, gurrte Agilulf, der ein plötzliches Kribbeln in den Lenden verspürte.
Kaum hatte er geendet, hielt Agilulf seinen Schoppen in der Hand, den er ohne viel Federlesens leerte. Dann begann er zu erzählen. In der schäbigen Lehmhütte unweit des Spitaltores war es plötzlich mucksmäuschenstill. Agilulf war so sehr in seine Erzählung vertieft, dass er nicht bemerkte, wie seine Frau, rotwangig wie ein Apfel im Herbst, immer blasser wurde und sich am Ende seiner Erzählung auf den Hocker neben dem Rauchabzug setzte.
Als Agilulf fertig war, starrte ihn seine Frau Hildegard mit entgeisterten Augen an, die Handflächen auf die strammen Schenkel gestemmt. Sie war sprachlos, ein Zustand, in dem sie sich äußerst selten befand: »Kommt überhaupt nicht infrage!«, wehrte sie kategorisch ab. »Wer immer dieser Fremde ist und was immer er dir bietet – sei nicht so dumm und lass deine Hände aus dem Spiel!«
»Mit wem ich Geschäfte mache, geht ganz allein mich was an!«, konterte der Reliquienhändler mit einer Wut im Bauch, die selbst ihn überraschte. »Halt dich da raus, sonst –«
Lag es an der Art, wie ihn seine Frau ansah, am Blick, der ihn durchdrang wie Glas? Für seinen Teil war Agilulf jedenfalls so perplex, dass sein Jähzorn jäh verschwand. »Und warum, wenn man fragen darf?«, wandte er eher halbherzig ein.
»Weil das, wofür du dich einspannen lassen willst, eine Todsünde ist!«, erklärte seine Frau. »Die Gebeine der drei Frankenapostel zu stehlen – ich krieg’s einfach nicht in meinen Kopf! Das Mindeste ist, dass sie dich ins Verlies im Grafeneckart werfen und so schnell wie möglich aufs Rad flechten, wenn nicht, wirst du für immer in der Hölle schmoren! Und komm mir bloß nicht auf die Idee zu behaupten, ich hätte dich nicht gewarnt!«
»Dazu müssten sie mich erst einmal kriegen!«
Hildegard stemmte die Hände in die Hüften und baute sich trotzig vor Agilulf auf. »Glaubst du im Ernst, der Vogt gibt klein bei, wenn du ihm eins über den Schädel ziehst?! Wie ich den kenne, wird er keine Ruhe geben, bis er dich endlich am Wickel hat! Legt sich mit Berengar von Gamburg an! Was hast du dir eigentlich dabei gedacht?! Wo du doch von Glück sagen kannst, dass du ihm vorletztes Jahr durch die Lappen gegangen bist!«
Im Verlauf von Hildegards Schimpfkanonade war Agilulf immer nachdenklicher geworden, wenn auch keinen Deut klüger, wie die folgenden Worte bewiesen: »Hast du überhaupt eine Ahnung, was man für 100 Gulden alles kaufen kann?«, fragte er mit Blick auf sein alles andere als üppig möbliertes Domizil. Der Boden aus Lehm, die Fensterläden aus wurmstichigem Holz und Sackleinen statt Glas: Von einem richtigen Haus konnte einer wie er nur träumen. Ein Tisch, ein paar Stühle und die Truhe mit den wenigen Habseligkeiten waren alles, was er besaß. Schon allein deshalb wartete Agilulf eine Antwort seiner Frau gar nicht erst ab: »Schau dich doch in unserer Bruchbude um!«, fuhr er sie an. »Und dazu noch die ganzen Schulden! Wenn das noch eine Weile so geht, macht mir der Jude die Hölle heiß! Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht? Nein? Dann wird’s aber höchste Zeit!« Agilulfs Hand verschwand unter seinem Hemd, und kurz darauf tauchte ein Lederhalsband samt Beutel auf. »Und falls du’s noch nicht weißt!«, fuhr er fort, während er die prall gefüllte Börse tätschelte. »Das hier ist alles, was zählt! 50 Gulden jetzt, der Rest bei Lieferung! Da können mir die abgehackten Schädel von den drei irischen Wanderpredigern drüben im Neumünster doch glatt gestohlen bleiben! Also tu mir bitte den Gefallen und rede mir nicht mehr in meine Geschäfte rein!«
»Aber …«
»Nichts ›Aber‹!«, schnauzte Agilulf, einmal richtig in Fahrt, seine konsternierte Ehefrau an. »Wenn dir nichts Besseres einfällt, wie wir unsere Schulden loswerden, behalte dein Geschwätz in Zukunft für dich! So – und jetzt möchte ich in Ruhe schlafen!«
Agilulf leerte seinen Becher, knallte ihn auf die Tischplatte und richtete sich auf. Dann torkelte er auf das Strohlager zu, das sich auf der entgegengesetzten Seite des Raumes befand. »Dieses eine Mal noch, und wir haben ausgesorgt!«, machte er sich selbst Mut, zog den Vorhang zu und legte sich schlafen.
Anno Domini 689, an einem Ort, der später Würzburg hieß
Die drei Männer in den braunen Kutten starrten vor Schmutz. Es war ein anstrengender Tag gewesen, und sie waren müde und ausgelaugt. Für sie jedoch kein Grund, mit ihrem Schicksal zu hadern. Sie hatten zu essen und zu trinken und Stroh für ihr Nachtlager. Und das war im Moment das Wichtigste. Darüber hinaus hatten sie ein Dach über dem Kopf. Kein Grund zur Klage. Obwohl es bequemere Unterkünfte als den herzoglichen Pferdestall gab.
»Was meinst du – ob uns die Herzogin wohl vor die Tür setzen lässt?«, brach der Jüngste im Trio das Schweigen, während er sein Bündel entknotete, auf dem Boden ausbreitete und Brot, Schafskäse und Lauchstangen zutage förderte. »Oder ob sie uns bis zur Rückkehr des Herzogs in Ruhe lässt?«
»Keine Ahnung, Totnan!«, brummte sein Gefährte Kolonat in der Sprache der gemeinsamen Heimat Irland vor sich hin. »Kilian hat ihr halt ordentlich die Hölle heißgemacht. Zu sehr, wenn du mich fragst.« Der Mönch, ungleich stämmiger und um einiges älter als sein Freund, brach eine Lauchstange entzwei und sah den Gefährten achselzuckend an. »Ihr erster Mann ist nun mal tot. Soll sie doch heiraten, wen sie will. Selbst wenn es der eigene Schwager ist.«
Totnan schluckte, sagte aber nichts. Zumal sich der Dritte im Bunde, ein hagerer Endzwanziger, in unmittelbarer Nähe befand. »He, Kilian!«, rief er ihm deshalb aus purer Verlegenheit zu. »Abendmahl!« Dann brach er das Brot entzwei und füllte die Becher mit Wein.
Eine Antwort jedoch wurde ihm nicht zuteil. Das Kreuz im Blick, das sich eine Armlänge von ihm entfernt auf einem Strohballen befand, reagierte der inmitten von Mist und Dung und verdorrten Strohhalmen kniende Mönch mit keinem Wort. Die beiden anderen schien dies nicht sonderlich zu erstaunen. »So ist er nun mal!«, warf Kolonat entschuldigend ein. »Ein wahrer Heiliger, allzeit bereit zum Martyrium!«
Dann wandte er sich wieder seiner kärglichen Mahlzeit zu.
Zweiter Tag
4
Marienberg über Würzburg, Freitag vor Kiliani (3.7.1416)
»Mein Kompliment, Vogt!«, machte Fürstbischof Johann von Brunn aus seiner Belustigung kaum einen Hehl, als Berengar von Gamburg die Privatgemächer seiner Burg betrat. »Ihr müsst wahrhaftig einen Schädel aus Eisen haben!«
Der Vogt des Grafen von Wertheim hätte dem um etwa 15 Jahre älteren Mann mit der Trinkernase und den schlaff herabhängenden Wangen liebend gerne die passende Antwort erteilt, hielt sich jedoch angesichts der besonderen Umstände seines Besuches lieber zurück. Mit den hohen Herren, einem leibhaftigen Fürstbischof allzumal, war nun einmal nicht zu spaßen, und was man sich über den mit allen Wassern gewaschenen Johann II. von Brunn erzählte, war nicht dazu angetan, sein Misstrauen gegenüber den Mächtigen des Reiches zu entkräften.
»Wie geht es Eurem Herrn, dem Grafen?«, ließ sich der Fürstbischof vernehmen, während er in dem gepolsterten Lehnstuhl hinter dem Schreibtisch aus poliertem Eichenholz fast versank. »Befindet er sich wohl?«
Berengar deutete eine Verbeugung an und bejahte. Kaum war dies jedoch geschehen, verschwamm ihm der Blick vor den Augen, und er hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Mit seinem bandagierten Kopf kam er sich zudem reichlich lächerlich vor, zumal ihm der Schädel dröhnte wie schon lange nicht mehr.
Der Fürstbischof indes schien von alldem keine Kenntnis zu nehmen und sah ihn mit kaum verhohlener Schadenfreude an. »Doch nun zu Euch!«, mimte er den Besorgten, eine Rolle, die er nahezu perfekt beherrschte. »Wie ist das überhaupt passiert?«
Berengar hätte etwas dafür gegeben, ebenfalls Platz nehmen zu dürfen, aber da dies einem Vogt aus niederadeligem Hause in Gegenwart eines der mächtigsten Fürsten des Reiches nicht gestattet war, fasste er die Ereignisse vom Vorabend so präzise wie möglich zusammen und sah Johann von Brunn erwartungsvoll an. Zu seinem Leidwesen reagierte der Fürstbischof jedoch auf höchst ungewöhnliche Weise.
»Die Gebeine des heiligen Kilian? Stehlen?! Das glaubt Ihr doch wohl selbst nicht, mein Sohn!«, sprudelte es nur so aus dem Fürstbischof hervor. »Wer in aller Welt würde so etwas tun? Und weshalb? Bei aller Nachsicht für Eure prekäre Si-tuation – aber was diesen Agilulf und den mysteriösen Kapuzenmann angeht, glaube ich, Eure Fantasie hat Euch da einen derben Streich gespielt!«
Berengar war sprachlos. Da war er zusammengeknüppelt worden wie ein räudiger Hund, bis zum Morgen halbtot in der Gosse gelegen, wo ihn ausgerechnet sein Schwager fand – und jetzt dies! Der Vogt presste die Fläche seiner rechten Hand an die glühend heiße Stirn. Alles nur Einbildung? Hatte er da eben richtig gehört?
Als ginge ihn die ganze Angelegenheit nichts mehr an, richtete sich Fürstbischof Johann von Brunn auf, zupfte die von Goldfäden durchwirkte Tunika zurecht und wandte sich wieder den Dokumenten zu, die auf seinem Schreibtisch lagen. Das Kreuz aus reinem Silber, ein Geschenk des Königs, baumelte hilflos vor seiner Brust hin und her. »Sonst noch was?!«, fügte er nach einer Weile hinzu, ganz und gar nicht mehr so fürsorglich wie zuvor.
Berengar von Gamburg schüttelte den Kopf. Er hatte verstanden. Der Fürstbischof glaubte ihm nicht. Wahrscheinlich dachte er sogar, er wolle sich wichtigtun. Dabei hatte er nur eines im Sinne gehabt: ein Verbrechen zu verhindern, das – einmal angenommen, es hätte Erfolg – dem Ansehen des Fürstbischofs irreparablen Schaden zufügen würde.
»Wenn Fürstbischöfliche Gnaden erlauben, würde ich mich jetzt gerne empfehlen«, sprach Berengar von Gamburg mit tonloser Stimme, mehr denn je überzeugt, er habe hier nichts mehr zu suchen.
Fürstbischof Johann von Brunn, zumindest dem Anschein nach ganz in seine Akten vertieft, blickte kurz auf und nickte geistesabwesend mit dem Kopf. Dann wandte er sich wieder seinen Amtsgeschäften zu. »Ach, noch etwas, von Gamburg!«, rief er Berengar nach, als dieser sich anschickte, das mit flämischen Wandbehängen, Vorhängen aus Brokat und kostbaren Teppichen wahrhaft fürstlich ausstaffierte Gemach auf dem schnellsten Weg zu verlassen.
»Ja, Fürstbischöfliche Gnaden?«
»Gehe ich richtig in der Annahme, dass Ihr aus rein privaten Gründen nach Würzburg gekommen seid?«
Berengar drehte sich auf dem Absatz um. »Das bin ich, Herr!«, bekräftigte er, nicht sicher, worauf Johann von Brunn hinauswollte.