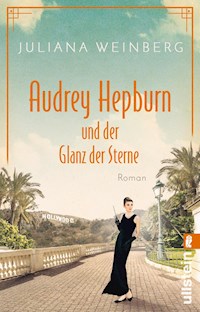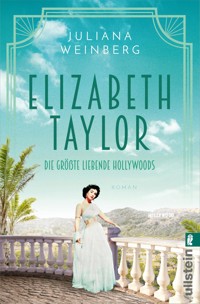11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Eine junge Frau kämpft um das Überleben ihrer hungernden Kinder Berlin, Westsektor, 1948. Nora schafft es kaum noch, ihre Kinder mit genügend Lebensmitteln zu versorgen, geschweige denn sich selbst. Westberlin ist abgeriegelt. Ihr Ehemann gilt seit Jahren als vermisst. Wird er je zu ihr zurückkommen? Noras Verzweiflung wächst mit jedem Tag, den ihre hungernden Kinder schwächer werden. Sie hört nicht auf zu kämpfen, bis sie endlich Arbeit als Übersetzerin bei den US-Alliierten am Flughafen Tempelhof findet. Dort trifft sie auf den amerikanischen Piloten Matthew, in den sie sich unerwartet und heftig verliebt. Hin- und hergerissen zwischen Schuldgefühlen gegenüber ihrem verschollenen Ehemann und der Hoffnung, ein besseres Leben für ihre Kinder zu ermöglichen, stellt sie sich ihren Gefühlen. Bevor sie Matthew ihre Entscheidung mitteilen kann, stürzt dieser mit seinem Rosinenbomber vom Himmel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Kinder der Luftbrücke
Die Autorin
JULIANA WEINBERG wurde in Neustadt an der Weinstraße geboren. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern im Pfälzer Wald. Neben dem Schreiben ist ihr Beruf als Lehrerin ihre große Erfüllung.
Von Juliana Weinberg sind in unserem Hause außerdem erschienen:Audrey Hepburn und der Glanz der SterneJosephine Baker und der Tanz des LebensMein Sommer mit Zelda - Mit den Fitzgeralds an der Riviera
Das Buch
Matthew strich Nora ein letztes Mal mit dem Zeigefinger sanft über die Wange, dann stieg er aus dem Flugzeug und half auch ihr heraus. ›Bis bald‹, flüsterte Matthew, und sie nickte. Den Weg ins Büro legte sie wie in Trance zurück. Und alles, was sie sah, der karge Asphalt, das nüchterne Gebäude, die mit Kisten beladenen Lastwagen, erschien ihr mit einem Mal schöner als die prächtigste Blütenlandschaft.
Juliana Weinberg
Die Kinder der Luftbrücke
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Mai 2023© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: © Jelena Simic Petrovic / Arcangel; www.buerosued.de Autorinnenfoto: © Fotostudio BackofenE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-2924-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Epilog
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Kapitel 1
Widmung
»Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien! Schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft und nicht preisgeben könnt! (…) Völker der Welt! Tut (…) eure Pflicht und helft uns in der Zeit, die vor uns steht, nicht nur mit dem Dröhnen eurer Flugzeuge, nicht nur mit den Transportmöglichkeiten, die ihr hierherschafft, sondern mit dem standhaften und unzerstörbaren Einstehen für die gemeinsamen Ideale, die allein unsere Zukunft und die auch allein eure Zukunft sichern können. Völker der Welt, schaut auf Berlin!«
Ernst Reuter, 9. September 1948, Rede vor dem Reichstag
Kapitel 1
Juni 1948
Die Schlange der Wartenden vor dem Gemischtwarengeschäft in der Dudenstraße rückte nur langsam voran. Nora Thalfang schaute ungeduldig an den vielen Köpfen und Hüten vorbei, um einen Blick in den Laden zu erhaschen, doch sie konnte nichts erkennen. An ihrem Arm baumelte der noch leere Stoffbeutel, ihr Portemonnaie mit den Lebensmittelmarken und den spärlichen Geldscheinen, über die sie verfügte, drückte sie fest an sich. Jörg, ihr Fünfjähriger, der mit ihrer Mutter zu Hause war, hatte einige Wünsche geäußert, bevor sie aufgebrochen war. Er sehnte sich nach Kuchen und Marmelade. Veronika, die mit ihren acht Jahren bereits recht vernünftig – vielleicht sollte man es auch ernüchtert nennen – war, hatte die Augen verdreht. Sie wusste, wie schwierig es war, genügend Lebensmittel für die ganze Familie zu bekommen. Obwohl der Krieg nun schon drei Jahre zurücklag, war das Leben in Berlin entbehrungsreich und hart.
Die Kunden in der Schlange bewegten sich ein kleines Stück nach vorne. Niemand murrte darüber, dass es so lange dauerte, Schlangestehen, Warten und Hoffen gehörten für die Berliner seit Langem zum Alltag.
Nora schob die Sorge, auch bei diesem Einkauf wieder kaum etwas ergattern zu können, weit von sich. Aber der Gedanke an ihre Kinder, an ihre ausgemergelten Körper, bei denen die Rippen scharf hervorstachen, ließ sich nicht einfach beiseitekehren. Veronika klagte oft darüber, dass sie sich in der Schule nicht konzentrieren konnte, weil der knurrende Magen sie vom Lernen abhielt.
»Frau Thalfang!«
Die Stimme ihrer Nachbarin, Emmi Brombach, die im Hochparterre des Mietshauses wohnte, in dem Nora sich mit ihrer Mutter und Schwester eine Wohnung teilte, riss sie aus ihren düsteren Gedanken.
»Guten Tag, Frau Brombach! Was meinen Sie, wird noch etwas für uns da sein, wenn wir den Laden erreicht haben?«
Die Antwort der Nachbarin, die Mitte sechzig sein musste, ging in einem röchelnden Husten unter. Besorgt musterte Nora sie. »Das hört sich aber nicht gut an. Waren Sie inzwischen beim Arzt?«
Emmi Brombach winkte unwirsch ab. »Ach was, zu diesem alten Quacksalber gehe ich nicht mehr. Der will mich nur wieder ins Spital schicken.«
Eine Horde kleiner Jungen, die in durchgescheuerten Lederhosen und geflickten Hemden steckten, rannte aus einem Nachbarhaus und begann mit einem wilden Fangenspiel. Lauthals johlten und lachten sie, und Nora wartete, bis sich der Lärm wieder gelegt hatte. Als die Jungen die Dudenstraße hinabgerannt waren, wandte sich Nora wieder an die Nachbarin. »Dann lassen Sie sich wenigstens von Hanna anschauen. Vielleicht kann sie Ihnen einen Rat geben.«
Noch immer laut schnaufend nickte Emmi Brombach. »Das hört sich schon besser an. Ihre Schwester ist wirklich ein Engel. Gut, dass wir eine Krankenschwester im Haus haben.«
Wieder rückten die Wartenden einen Schritt nach vorn. Nora reckte ungeduldig den Kopf, um zu sehen, welche Waren der Gemischtwarenhändler, Gernot Kluth, bereithielt. Bei ihrem letzten Einkauf hatte er die Wünsche der Kunden, die sich vor ihr in der Schlange befunden hatten, noch halbwegs erfüllen können, als sie an der Reihe war, war dann aber plötzlich Schluss gewesen, und sie hatte den Heimweg mit nur wenigen Gramm Zucker, Mehl und Milchpulver in ihrem Einkaufsbeutel angetreten. Sie spürte, dass Kluth Vorbehalte gegen sie hegte. Wie er stets seinen übellaunigen Blick über ihren blonden Haarschopf und ihre Figur schweifen ließ! Verunsichert überprüfte sie ihr Aussehen im halb zersplitterten Schaufenster des Nebenhauses, in dem sich vor dem Krieg ein Stoffgeschäft befunden hatte. Ihr volles Haar hing ihr, in adrette Wasserwellen gelegt, auf die Schultern – seit Hanna bei ihr eingezogen war, frisierten sie sich gegenseitig, denn ihre Schwester fand, dass man auch in schlechten Zeiten Wert auf sein Äußeres legen sollte. »Was nützt all das Jammern und Klagen und die ganze Trauer? Du musst dich zuerst mal um dich selbst kümmern, außer dir wird es nämlich niemand tun. Und stell dir vor, Joachim kehrt aus der Gefangenschaft zurück und sieht dich strähnig und verwelkt wie eine alte Blume. Das wirst du nicht wollen. Also, her mit den Lockenwicklern!«, hatte Nora die Stimme ihrer Schwester noch im Ohr.
Ach, Joachim, dachte Nora, und der altbekannte Druck meldete sich in ihrer Brust. Es war müßig, darüber nachzudenken, ob er noch lebte. Aber dennoch quälte diese Frage sie Tag und Nacht. Geistesabwesend zupfte sie den Gürtel ihres weißen, mit kleinen roten Blüten bedruckten Sommerkleides zurecht. Es war bereits mehrfach geflickt, doch das fiel kaum auf, denn kein Berliner verfügte im Moment über die Mittel, sich neu einzukleiden. Und selbst wenn sie unerwartet an Geld gekommen wäre, würden die Waren in den Geschäften fehlen.
Endlich war Nora an der Reihe, doch sie ließ Emmi Brombach vor. »Sie zuerst.«
Die Nachbarin legte ihr kurz die Hand auf den Arm. »Danke, mein Kind. Alter vor Schönheit.«
Während sie ihre Wünsche nannte, wanderte Noras Blick über die Auslagen hinter der Theke. Die meisten Waren bewahrte der Händler jedoch vor den Augen der Kunden verborgen unter dem Tresen auf.
»Das war’s. Eine alte Frau wie ich braucht ja nicht viel.« Emmi Brombach legte ihre Lebensmittelmarken und zwei Geldscheine neben die Kasse, bevor sie wieder bellend zu husten begann. Gernot Kluth musterte sie so angewidert wie eine störende Mücke, dann wandte er sich mit kaum freundlicherem Gesichtsausdruck Nora zu.
»Ja?« Er starrte sie an, während die Enden seines Schnurrbarts, die er kunstvoll gezwirbelt hatte, als stamme er noch aus Kaisers Zeiten, leise bebten. »Wonach steht der Frau Studienrätin der Sinn?«
Nora nahm ihre Lebensmittelmarken aus dem Geldbeutel. Im Gegensatz zu ihrer Nachbarin, die auf sie wartete, um mit ihr gemeinsam nach Hause zu gehen, verfügte sie über etliche der bunten Karten, hatte sie doch außer den Kindern und sich selbst ihre Mutter und ihre Schwester zu versorgen.
»Mehl, Zucker, Milch, Fleischkonserven, getrocknetes Gemüse und Kartoffeln, bitte.«
Kluths dunkle Augen verengten sich, als er sich bückte, um in den verborgenen Regalen unter der Kasse zu kramen. »Ob wir das noch haben?«, murmelte er, bemüht geschäftig Dosen und Verpackungen herumschiebend.
Noras Herz begann zu klopfen. Sie hoffte inständig, den Laden nicht schon wieder nur mit der Hälfte dessen, was sie brauchten, zu verlassen. Dass Kluth sich so lange Zeit ließ – bei den vorherigen Kunden war es viel schneller gegangen –, verursachte ihr ein Stechen im Magen. Schließlich richtete sich der Lebensmittelhändler mühsam wieder auf und knallte einige kleine Kartoffeln sowie je eine Fleisch- und Gemüsekonserve auf die Theke. »Mehr ist nicht da. Der Nächste bitte.«
Fassungslos betrachtete Nora die magere Ausbeute. »Aber … wo ist der Rest? Das sind Rationen für eine oder höchstens zwei Personen, ich habe aber Lebensmittelmarken für insgesamt fünf Personen … Und die Milch! Meine Kinder brauchen Milch.« Die Vorstellung, dass Veronika und Jörg auch heute wieder hungrig zu Bett gehen würden, ließ ihr die Tränen in die Augen schießen.
»Ich kann nur verkaufen, was ich geliefert bekomme. Beschweren Sie sich bei den Amerikanern«, antwortete Kluth mürrisch. »Und nun räumen Sie das Feld, es warten noch andere Kunden.«
»Das ist nicht Ihr Ernst, junger Mann«, mischte sich Emmi Brombach resolut ein und schlug mit der flachen Hand auf den Verkaufstresen. »Was sollen diese Sperenzchen? Geben Sie Frau Thalfang, was sie bestellt hat, sie hat fünf Mäuler zu stopfen!«
»Nicht mein Problem.« Kluth drehte an den Enden seines Schnurrbartes, als seien sie durch Emmi Brombachs Ausbruch in Unordnung geraten. Er versuchte kaum, seine Verachtung zu verbergen.
Mit brennenden Augen packte Nora die Konserven und die wenigen Kartoffeln in ihren Stoffbeutel und verließ an der Seite ihrer Nachbarin das Geschäft. Sie spürte die Blicke der anderen Kundinnen auf sich.
»So ein Mistkäfer!«, schimpfte Emmi Brombach, als sie nebeneinander die Dudenstraße entlanggingen. »Der alte Nazi hat noch nicht kapiert, dass neue Zeiten angebrochen sind. Woanders einkaufen müsste man!«
Nora nickte bedrückt, die Tasche mit den mageren Einkäufen an sich gedrückt. Auch sie vermutete schon lange, dass Kluth noch immer altem Gedankengut nachhing, so verpönt es im Nachkriegsdeutschland auch sein mochte. Hatte er überhaupt nichts verstanden? »Wenn nur das nächste Geschäft nicht so weit entfernt wäre«, sagte Nora bedrückt.
Der Nachhauseweg zeigte wie immer ein deprimierendes Bild. Sie passierten zerlumpte Gestalten, die in den Hauseingängen zerbombter Häuser saßen und ins Leere starrten. In Trümmerlandschaften spielten Kinder Verstecken, als handele es sich um Abenteuerspielplätze. Sie nahm sich vor, Jörg noch einmal zu ermahnen, sich von den Ruinen fernzuhalten, es war zu gefährlich, dort zu spielen. Doch zuerst musste sie den Kindern beibringen, dass es auch heute wieder nur eine sehr spärliche Mahlzeit geben würde …
»Kopf hoch, Kindchen«, tröstete Emmi Brombach sie. Trotz ihres Kummers brachte Nora diese Anrede zum Schmunzeln, immerhin hatte sie vor nicht allzu langer Zeit ihren dreißigsten Geburtstag gefeiert. »Ich geb Ihnen was ab. Hier, nehmen Sie die Karotten, auch wenn es nur eine Handvoll ist, aber ein paar Vitaminchen wären gut für Ihre Kleinen, nicht wahr? Und die Backhefe gebe ich Ihnen auch.«
Umständlich nahm sie die Waren aus ihrem Beutel heraus und hielt sie Nora hin, die abwehrend die Hände gehoben hatte. »Das kann ich nicht annehmen, Frau Brombach. Sie brauchen das Essen selbst.«
»Unsinn, wie gesagt, ich alte Frau brauche nicht viel. Unkraut vergeht nicht. Ihre Kinder haben es nötiger als ich.« Ungestüm stopfte sie die Waren in Noras Tasche. »Ihre Schwester könnte sich ja vielleicht tatsächlich meinen Husten angucken, eine Hand wäscht die andere.«
Nora seufzte. »Recht ist mir das nicht, aber … danke schön. Ich weiß es sehr zu schätzen.«
Ein Militärkonvoi, der dröhnend an ihnen vorbeifuhr, ließ sie verstummen. Nora beachtete sie kaum, denn die amerikanischen Besatzer waren seit Langem ein gewohnter Anblick im Stadtteil Tempelhof sowie in ganz Berlin. Dass die Stadt in drei westliche Zonen, die amerikanische, britische und französische, und einen östlichen Sektor, in dem die Russen herrschten, aufgeteilt war, empfand sie inzwischen als normal. Ihre Kinder kannten es gar nicht anders.
Sie bogen in die Burgherrenstraße ein, an deren Ende sich rechter Hand ihr Wohnhaus befand, ein hellgelb gestrichenes, fünfstöckiges Gebäude mit überdachten Balkonen, das hinter zwei Ahornbäumen verborgen lag und ehemals einen freundlichen Eindruck gemacht hatte. Damals – als die Welt noch in Ordnung gewesen war und sie mit Joachim eingezogen war, frisch verheiratet. Nun war das Haus vom Krieg gezeichnet, mehrere Scheiben fehlten, auch in Noras Küche ersetzte ein Stück Pappe das Fensterglas. An eine neue Scheibe war nicht zu denken, das Geld reichte ohnehin kaum aus. Und sie konnten sich glücklich schätzen: Wenigstens stand ihr Haus noch.
Jörg rannte Nora entgegen, als sie die Wohnung betrat, seine bereits reichlich abgenutzte Holzlokomotive in der Hand. »Mutti! Was hast du zu essen mitgebracht?«
Nora küsste ihn auf das blonde Haar und sah ihm in die erwartungsvollen Augen, die die Farbe von dunkelgrünen Tannennadeln hatten, so wie ihre eigenen auch. »Es tut mir leid, mein Schatz, leider nicht besonders viel.«
Schon wieder musste sie ihren Sohn enttäuschen. Es war grausam mitanzusehen, wie ihre Kinder unter dem Hunger litten. Auch sie selbst verspürte dieses hohle Gefühl im Magen und den leichten Schwindel, der sie manchmal überkam, so als hätte sie an einem Glas Champagner genippt, nur allzu oft. Wieder schweiften ihre Gedanken zu Joachim ab. Wann hatte sie zuletzt mit ihm Sekt getrunken? War es 1938 bei ihrer Hochzeit gewesen oder als er die begehrte Stelle als Sprachenlehrer an der Jungenschule in Dahlem ergattert hatte? Egal, es nützte nichts, ständig in der Vergangenheit zu schwelgen. »Ich habe ein paar Kartoffeln und Karotten. Daraus können wir einen Eintopf kochen.« Dass die Portionen alles andere als üppig ausfallen würden, verschwieg sie.
»Ist gut.« Sehr angetan wirkte Jörg nicht, hatte er doch auf Kuchen gehofft, doch er ließ sich auf die Knie hinab, um geräuschvoll seine Lokomotive in die Küche zu schieben, wo seine Großmutter, Noras Mutter Else, und seine Schwester Veronika am Tisch saßen.
»Können wir gleich essen?«, fragte Veronika, die ihre Zelluloidpuppe Christel auf dem Schoß hielt und Else beim Stricken zusah. Aus der Wolle eines aufgetrennten Pullovers, der Jörg zu klein geworden war, fertigte die Großmutter ein neues Puppenkleid an. Auch Veronikas Gedanken drehten sich hauptsächlich um Essen, wer konnte es den beiden verdenken?
Nora nickte und küsste auch ihre Tochter auf den blonden Scheitel. Ihr Kopf schien viel zu groß für den mageren Körper, um den das zerschlissene Baumwollkleid, das so kurz war, dass es kaum die Knie bedeckte, schlackerte. »Gleich, Püppchen.«
Während sie die spärliche Ausbeute auspackte und auf die Arbeitsfläche legte, trat ihre Mutter neben sie. Else Vogt war mit ihren zweiundfünfzig Jahren eine Schönheit, doch auch ihr sah man deutlich den Kummer der letzten Jahre an. Neben dem Schwiegersohn hatte der Krieg ihr ihren Mann Johannes und ihren kleinen Bruder Werner genommen. Aufgrund der Mangelernährung war ihr blondes Haar glanzlos und ausgedünnt, doch ihre Haltung war noch immer aufrecht und stolz. »Hat Kluth dich wieder leer ausgehen lassen? Für unsere Marken hätten wir doch viel mehr bekommen müssen! Und wo ist die Milch für die Kinder?«
Nora, die gerade einen Topf aus dem Schrank geholt hatte, hielt in der Bewegung inne und strich sich in einer hilflosen Geste die Haare aus dem Gesicht. In der Küche war es genauso warm wie draußen, zudem verdüsterte die Pappe, die die fehlende Fensterscheibe ersetzte, die Küche, sodass sie sich wie in einer stickigen Dunkelkammer fühlte. »Es gab angeblich keine mehr.«
»Unsinn!«, schnaubte Else und begann, die Karotten zu putzen. »Kluth, dieses alte Braunhemd, hat dir die Milch sicher wieder absichtlich vorenthalten, aus Rache wegen dieser unleidlichen Angelegenheit damals.«
»Das denke ich auch.« Niedergeschlagen nahm sich Nora ein zweites Messer und bearbeitete die Kartoffeln. Natürlich war Else im Bilde, was die Bekanntschaft zwischen Kluth und Joachim betraf. Sie waren Nachbarjungen gewesen, doch sie hatten sich entzweit, als Kluth in die NSDAP eingetreten war und Joachim mitziehen wollte. Dieser lehnte das rundheraus ab, als weltoffener und vernunftbegabter Mensch, der seinen Schülern Englisch und Latein beibrachte und zudem gerne fremde Länder bereiste, lag ihm nichts ferner als die starren und menschenfeindlichen Denkstrukturen der neuen Machthaber. Kluth hatte seine Absage, ihn zu den Parteiversammlungen zu begleiten, nicht gut aufgefasst, schien er doch zu vermuten, dass sich Joachims politische Ansichten sehr konträr zu seinen eigenen verhielten. Natürlich ging Joachim mit seiner Meinung nicht hausieren, als Lehrer versuchte er, den Schein des ideologiegetreuen Bürgers zu wahren, um keinen Repressalien ausgesetzt zu werden, womöglich gar seine Stelle zu verlieren oder seine Familie in Gefahr zu bringen.
»Das nächste Mal gehe ich zum Laden«, brummte Else und gab die wenigen Karottenscheiben in den Topf. »Er soll jemand anderen zum Narren halten.«
»Mutter«, seufzte Nora. »Er kennt unsere Familie, mit Sicherheit weiß er, dass Joachim dein Schwiegersohn ist. Ich glaube kaum, dass er sich bei dir anders verhält.«
»Hm. Das werden wir ja sehen.« Else schaltete den Gasherd an. Nora rieb sich die Stirn. Ihre Mutter hatte schon immer wie eine Löwin für die Familie gekämpft, aber auch sie würde Kluth nicht zwingen können, die Waren herauszugeben, wenn er es nicht wollte.
Doch bevor Nora ihre Mutter noch einmal darauf hinweisen konnte, öffnete sich die Haustür, und Hanna kam herein. In ihrer Schwesterntracht mit der gestärkten weißen Schürze und dem Häubchen, das auf ihren blonden, zu einer kecken Außenwelle gedrehten Haaren saß, sah sie sehr jung und frisch aus. Kein Wunder, mit ihren zweiundzwanzig Jahren war sie acht Jahre jünger als Nora, außerdem war sie seit einigen Monaten verliebt, was ihr rosige Wangen und ein Dauerlächeln bescherte.
»Eintopf, mal ganz was Neues«, bemerkte sie ironisch, zog sich die Nadeln aus den Haaren, um die Schwesternhaube abzunehmen, und hantierte gleichzeitig mit dem Wasserkessel, um sich eine Tasse ihres Muckefucks aufzubrühen, den sie nach ihrer Schicht zu trinken pflegte.
»Schweinelende mit Pilzen und Leberpasteten waren aus«, konnte Nora sich nicht verkneifen zu sagen, woraufhin Hanna ihr lachend einen Klaps auf den Arm gab. »Was du nicht sagst. Übrigens kommt Friedrich nachher noch vorbei, ich habe ihm aber gesagt, er soll erst nach dem Essen aufschlagen, denn es wird wahrscheinlich nicht für ihn reichen. Wir können ihn nicht auch noch durchfüttern.«
»Gut, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst«, erwiderte Else trocken. Sie gab ein paar Kräuter zu den Karotten und Kartoffeln, die sie in einem Blumentopf auf dem Fensterbrett zogen. »Aber das wird er von dir gewohnt sein.«
»Ganz recht. Kinder …«, Hanna wandte sich an Veronika und Jörg. »Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe.« Sie zog zwei in goldenes Stanniolpapier gewickelte Bonbons aus der Tasche ihrer Tracht, die sie ihrer Nichte und ihrem Neffen auf der offenen Handfläche hinhielt.
»Karamellbonbons!« Die Kinder hüpften vor Begeisterung auf und ab. »Woher hast du die, Tante Hanna?«
Nora beobachtete wehmütig, wie ihre Kinder die Bonbons auspackten; wann hatte sie ihnen zuletzt mit einer Leckerei eine Freude machen können? Jörg warf sein Bonbon sogleich in den Mund, während Veronika zuerst andächtig das knisternde Papier glatt strich und an dem Bonbon roch, als wolle sie sich den süßen, zuckrigen Duft für spätere Zeiten einprägen.
»Vor dem Sankt-Joseph-Krankenhaus standen ein paar amerikanische GIs herum. Der eine pfiff mir nach und schenkte mir die Bonbons«, erzählte Hanna freimütig. »Ich habe mir natürlich sofort gedacht, das wäre was für euch Zwerge.«
Es erstaunte Nora natürlich nicht, dass ihre bildhübsche Schwester den amerikanischen Soldaten ins Auge gefallen war.
»Hoffentlich stehen die Männer öfter vor deinem Krankenhaus herum«, sagte Veronika, genussvoll ihr Bonbon lutschend.
»Am besten fragst du sie das nächste Mal gleich nach Süßigkeiten. Du musst nicht warten, bis sie dir nachpfeifen«, warf Jörg eifrig ein.
Hanna lachte. »Wird erledigt. Ich weiß aber nicht, ob Friedrich so begeistert sein wird, wenn ich mit anderen Männern schäkere.«
Nach der Mahlzeit, die nur allzu bald aufgegessen war, zog sich Nora mit ihren Kindern in ihr Schlafzimmer zurück, den einzigen Raum, in dem sie als kleine Familie ungestört waren. Seit Noras Elternhaus, in dem Else mit Hanna gewohnt hatte, 1943 den Bomben der Alliierten zum Opfer gefallen war, zwängten sie sich zu fünft in der Wohnung der Thalfangs in der Burgherrenstraße zusammen. Nora teilte sich mit ihren Kindern ihr einstiges Schlafzimmer, Hanna schlief im Wohnzimmer, Else im ehemaligen Kinderzimmer. Die Küche galt als Gemeinschaftsraum, in dem sie aßen und zusammensaßen.
»Kommt her, meine Süßen.« Nora schob die Bettdecke von sich und breitete die Arme aus, um Veronika und Jörg an je eine Seite zu nehmen. »Lasst uns Das fliegende Klassenzimmer weiterlesen.«
Veronika drehte das Bild ihres Vaters auf dem Nachttisch so, dass es ihnen zugewandt war. »So kann Vati mithören«, verkündete sie wie jedes Mal, was Nora einen Stich versetzte.
Jörg stieß seine Schwester in die Rippen. »Wie soll er denn mithören, er ist doch gar nicht da.«
»Er … er spürt es bestimmt, dass wir gerade an ihn denken.« Veronika funkelte ihren Bruder böse an, doch der schnitt nur eine Grimasse. »Du sagst doch immer, dass Vati in unseren Herzen ist, nicht wahr, Mutti? Also ist er irgendwie dabei, auch jetzt beim Vorlesen.«
»Das stimmt.« Nora räusperte sich und schlug mit zitternden Fingern das Buch auf. Es war schwierig, den Kindern zu vermitteln, dass ihr Vater höchstwahrscheinlich gefallen war. Auf der anderen Seite – solange sie keine offizielle Todesnachricht erhielt, konnte sie sie kaum davon überzeugen, keine Hoffnung mehr zu haben. In ihr sah es anders aus, aber Veronika und Jörg waren zu klein, als dass sie mit ihnen über ihre Gefühle hätte sprechen können.
Die Kinder schmiegten die Köpfe an ihre Schultern und lauschten aufmerksam. Nora liebte diese tägliche Ruhestunde, wenn sie ihre Kinder ganz für sich hatte und sie der Gegenwart durch Geschichten ein wenig entfliehen konnten.
»War es falsch von Hanna, die Bonbons anzunehmen?«, unterbrach Veronika sie mitten im dritten Kapitel und sah Nora mit ihren großen braunen Augen an, die sie von Joachim geerbt hatte.
»Wieso sollte das falsch sein, die haben doch lecker geschmeckt«, krähte Jörg dazwischen und knuffte seine Mutter ungeduldig in die Seite, damit sie weiterlas.
Veronika streckte ihm die Zunge heraus. »Oma mag die Amerikaner nicht. Sie haben Bomben auf ihr Haus fallen lassen, und ihr Bruder wurde dabei getötet.«
Nora steckte das Lesezeichen, eine kleine Zeichnung ihrer Tochter, bedächtig zwischen die Seiten des Buches. »Die Deutschen haben im Krieg unglaublich Schlimmes angerichtet, und nun sind die Amerikaner in der Stadt, um uns beim Aufbau zu helfen. Sie habe Pläne, wie es mit uns wieder bergauf gehen soll, wie wir wieder Arbeit und mehr Essen bekommen. Sie sind nicht böse. Oma sagt das, weil sie noch immer traurig ist, dass ihr Bruder bei dem Bombenangriff getötet wurde.«
Es war schwer, mit den Kindern über den Krieg zu sprechen und ihnen die Ungeheuerlichkeit dessen, was vorgefallen war, verständlich zu machen. Sie hoffte, ihre kurze Erklärung würde vorerst genügen, und nahm sich vor, bald in Ruhe zu überlegen, was sie den beiden über die Zeit zwischen 1939 und 1945 erzählen würde. Veronika hatte damals einiges mitbekommen – das Geheul der Bomben, die Nächte in den Luftschutzbunkern des nahe gelegenen Flughafens Tempelhof, die Nachricht, dass ihr Vater in Russland vermisst sei. Jörg hingegen war noch ein Kleinkind gewesen, als der Krieg endete.
Sie las das Kapitel zu Ende, doch gerade als sie das nächste beginnen wollte, läutete es an der Haustür.
»Das ist Friedrich!« Jörg rollte sich vom Bett und rannte zur Tür. Veronika verzog das Gesicht. Sie hätte die Geschichte gerne noch zu Ende gehört. Nora lächelte. Sie wusste, wie sehr ihr Sohn Hannas Freund verehrte, war er doch die einzige männliche Bezugsperson, die er hatte.
In der Küche saß ihre Schwester bereits mit Friedrich zusammen, ihre Mutter werkelte im Hintergrund. Hannas Freund trug noch seine Arbeitshose, da er direkt aus der Schreinerei gekommen war, in der er angestellt war. Seine helle Haut unter den flammend roten Haaren war von den sommerlichen Temperaturen gerötet, und er kippte durstig das Glas Wasser hinunter, das Hanna ihm servierte.
»Wieso bist du heute so früh dran?« Hanna füllte sein Glas auf. »Du kommst doch normalerweise erst um achtzehn Uhr.«
»Wir haben kein Holz geliefert bekommen«, berichtete Friedrich düster. »Wir beziehen unsere Holzlieferungen aus dem Ostsektor, doch manchmal funktioniert das nicht.«
»Daran sind die Russen schuld.« Mit grimmiger Miene goss Else Wasser in die Kräutertöpfchen auf der Fensterbank.
Jörg schaute verständnislos von Friedrich zu seiner Großmutter. »Du sagst doch immer, die Amerikaner sind die Blöden. Sind es jetzt die Russen?«
Else ließ sich schwer auf einen Küchenstuhl fallen. »Was weiß ich, alle zusammen wahrscheinlich.«
Nora tauschte mit Hanna einen Blick aus; zu gerne erging sich ihre Mutter in Pauschalisierungen, die sie kaum zu begründen vermochte.
»Wie auch immer. In diesem Fall haben die Russen den Lastwagen mit unserer geplanten Lieferung nicht passieren lassen, angeblich wegen fehlender Papiere. Unsere Unterlagen waren einwandfrei, sagt der Chef. Das letzte Mal bekamen wir keine Materialien, weil die Russen in ihrer Zone den Schienenverkehr nach Westberlin gesperrt haben. Es seien dringende Reparaturmaßnahmen am Schienennetz nötig, hieß es. Wie soll eine Schreinerei ohne Holz arbeiten?« Friedrich hob hilflos die Schultern.
»Das sind nichts als Schikanen«, moserte Else.
»Ich frage mich, worauf die russischen Besatzer hinauswollen.« Hanna strich gedankenverloren über Friedrichs Hand. »Warum tun sie das alles? Die Amerikaner, Briten und Franzosen schaffen es doch auch, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.«
»Keine Ahnung, vielleicht strebt Stalin einen neuen Krieg an«, presste Friedrich hervor.
Nora wurde es eiskalt, fest drückte sie Veronika, die sich auf ihren Schoß gesetzt hatte, an sich, um ihr Zittern zu verbergen. Die Vorstellung eines neuen Krieges ängstigte sie, ja, der Gedanke, das Grauen der vergangenen Jahre noch einmal zu durchleiden, war so unerträglich, dass sie ihr Hirn fieberhaft nach unverfänglicheren Themen durchforstete.
»Na, hoffentlich wird der Verkehr morgen nicht behindert. Ich muss mit der Straßenbahn nach Mitte, ich habe ein Vorstellungsgespräch im Roten Rathaus.« Ihre Stimme klang selbst in ihren eigenen Ohren belegt.
Friedrich schaute sie zweifelnd an. »Na, ich würde mich nicht darauf verlassen, rechtzeitig dort anzukommen.«
Kapitel 2
Juni 1948
»Wieso machst du dich so schön, Mutti?« Jörg schob seine Holzeisenbahn um ihre Füße herum, die in schwarzen Pumps steckten. Die Schuhe waren zwar abgetragen, erfüllten aber mangels Alternativen ihren Zweck.
Nora zog die Kappe vom Lippenstift und trug äußerst sparsam etwas himbeerrote Farbe auf, die gut zu ihren blonden Haaren und dem butterblumengelben Kleid passte, das sie sorgfältig gebügelt hatte. Den Lippenstift besaß sie bereits seit Jahren, hatte ihn bisher aber nur selten verwendet, um ihn für besondere Gelegenheiten wie die heutige aufzuheben. »Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch«, erklärt sie ihrem Sohn.
»Was ist das?« Die Lokomotive kollidierte mit ihrem Absatz, als sie ein kleines Stück zur Seite trat. Da Veronika in der Schule war, langweilte sich Jörg und löcherte sie seit dem Aufstehen mit Fragen zu Gott und der Welt.
»Ich brauche dringend Arbeit, mein Schatz. Sei bitte etwas vorsichtig mit deinem Zug, nicht, dass du mir noch meine einzigen halbwegs guten Schuhe zerkratzt.« Nora steckte sorgfältig den Deckel auf die Lippenstifthülse und strich sich ein verirrtes Haar aus der Stirn. Außer ihrem Ehering trug sie ein Paar Perlenohrstecker, die Else ihr überlassen hatte, und sie hoffte, seriös genug zu wirken, um als Sekretärin für die Verwaltung des Roten Rathauses in Betracht gezogen zu werden. »Tante Hanna ist im Moment die Einzige, die eine Stelle hat, doch wir brauchen dringend mehr Geld. Im Roten Rathaus suchen sie neue Mitarbeiterinnen.«
»Kannst du mir dann eine Tafel Schokolade kaufen, wenn du Geld verdienst?«, fragte Jörg hoffnungsvoll und setzte Veronikas Puppe als Passagier auf die Eisenbahn.
»Vielleicht.« Zumindest auf dem Schwarzmarkt, dachte Nora, während sie hektisch überprüfte, ob sie alle erforderlichen Unterlagen in ihre Handtasche gesteckt hatte. Sie musste den Sekretärinnenposten einfach bekommen, ansonsten wusste sie nicht, wie sie ihre Kinder über den Winter bringen sollte. Erinnerungen an alte Zeiten huschten wie Gespenster durch ihre Gedanken, Bilder von sommerlichen Picknicks mit Joachim im Grunewald, von prall gepackten Körben voller Früchte und Backwaren, Geburtstagsfeiern mit selbst gebackenen Kuchen, auf denen Kerzen brannten.
Else kam aus der Küche hinzu und zupfte an Noras Kragen herum, obwohl er perfekt saß. Normalerweise hätte Nora über diese Geste mütterlicher Zuwendung geschmunzelt, doch heute war sie zu aufgeregt.
»Viel Glück. Wird schon schiefgehen.« Else sah offensichtlich ein, dass es nichts mehr am Erscheinungsbild ihrer Tochter zu verbessern gab, und nahm Jörg an die Hand. »Erzähl denen im Roten Rathaus, was du alles kannst, stell dein Licht auf keinen Fall unter den Scheffel, hörst du, Nora?«
Nora seufzte ergeben, zu oft schon hatte sie sich die Ermahnungen ihrer Mutter angehört, zu einer Arbeit verholfen hatten sie ihr bisher allerdings nicht.
»Sag ihnen, dass du Sprachen studiert und eine Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin gemacht hast! Das muss sie einfach beeindrucken!«
Nora biss sich auf die Lippen. »Ich habe aber nie in meinem Beruf gearbeitet, Mutter. Nach meiner Ausbildung habe ich doch sofort Joachim geheiratet und Veronika bekommen.«
Else ließ diesen Einwand nicht gelten. »Was spielt das für eine Rolle? Ein verheerender Krieg liegt hinter uns, die anderen Bewerberinnen werden sicherlich auch keine lückenlosen Lebensläufe haben. Die meisten werden wie du in einer Munitionsfabrik oder sonst wo zwangsverpflichtet worden sein.«
»Ich muss los.« Bevor Else zu sehr ausschweifte und sie an ihre Zeit als Hilfsarbeiterin im Flughafen Tempelhof, den man im Krieg zur Munitionsfabrik umgerüstet hatte, erinnern konnte, verabschiedete Nora sich lieber. Die Arbeit in der riesigen Halle, das Dröhnen und Hämmern der Maschinen, mit denen Kriegsgeräte hergestellt wurden, verfolgte Nora noch heute regelmäßig in ihren Träumen. Es war ihr zuwider gewesen, daran beteiligt zu sein, todbringende Waffen herzustellen. »Bis heute Mittag«, sagte sie und küsste Jörg zum Abschied.
In der U-Bahn-Station traf sie auf Emmi Brombach, die sich ebenfalls ausgehfein gemacht hatte und ihr erzählte, dass sie ihre alte Freundin Alma in Mitte besuchen wollte. »Eigentlich war der Besuch schon für Montag geplant, aber der gesamte Verkehr zwischen dem Ost- und dem Westsektor stand wieder einmal still. Die Russen, Sie wissen ja.« Bedeutungsschwer nickte sie Nora zu.
Diese konnte sich ein Schmunzeln gerade noch verkneifen, erheiterten sie doch die Parallelen zwischen ihrer Mutter und der Nachbarin, die beide die Schuld an allem, was schieflief, bei den Russen sahen. Allerdings hörte man immer häufiger, dass die russischen Verwaltungsbeamten im Osten der Stadt tatsächlich des Öfteren die Straßen und Schienen blockierten, aus Gründen, die niemand nachvollziehen konnte. Ein Blick auf die Uhr setzte Noras kurzem Anflug von Erheiterung ein Ende. Die U-Bahn hätte längst eintreffen sollen, wo blieb sie nur?
»Ich hoffe, die Bahn kommt bald, es wäre eine Katastrophe, wenn sie ausgerechnet heute Vormittag ausfallen würde«, murmelte sie und starrte in den dunklen U-Bahn-Schacht, aus dem keinerlei Geräusche zu hören waren. »Ich habe ein Vorstellungsgespräch im Roten Rathaus.«
»Ach du meine Güte.« Emmi Brombach sah sie mitleidig an, dann setzte jäh ihr Husten ein, und sie war eine Weile damit beschäftigt, wieder zu Atem zu kommen.
»Ich schicke Hanna heute Abend bei Ihnen vorbei, damit sie mal nach Ihnen schaut.« Nervös blickte Nora sich auf dem Bahnsteig um, der sich immer mehr mit Wartenden füllte. Hier und da wurde Unmut laut, denn sie war nicht die Einzige, die einen dringenden Termin hatte. Viele Berliner aus den Westzonen pendelten täglich nach Ostberlin, um dort zu arbeiten.
»Eine Schweinerei ist das!«, regte sich ein älterer Herr mit Aktentasche auf, der trotz der stickigen Wärme unter der Erde einen Trenchcoat trug. »Ständig komme ich zu spät oder am Ende überhaupt nicht zur Arbeit! Lange geht das nicht mehr, dann werde ich vor die Tür gesetzt.«
Emmi Brombach schnäuzte sich keuchend in ein großes Taschentuch, während Nora unruhig von einem Fuß auf den anderen trat, immer die Uhr im Auge behaltend. Natürlich war sie mit einem ordentlichen Puffer von zu Hause aufgebrochen, aber seit sie sich in der U-Bahn-Station befand, hätten mindestens vier Bahnen fahren müssen. Keine einzige war gekommen, die Menschenmenge wuchs, immer mehr wütende Stimmen waren zu vernehmen.
»Ich will aber zu Oma«, heulte ein kleines Mädchen, woraufhin die Mutter es ungeduldig zurechtwies. »Wenn die Russen die Bahnstrecke wieder gesperrt haben, klappt es halt nicht, daran kann ich nichts ändern!«
Nora wurde von einem Gefühl der Dankbarkeit durchströmt. Sie war froh, dass sie mit all ihren Lieben zusammenwohnte und nicht wie so manch anderer befürchten musste, von den Familienmitgliedern in anderen Sektoren abgeschnitten zu werden. Doch dann übermannte sie wieder die Sorge, es nicht zu ihrem Vorstellungsgespräch zu schaffen. Der Gedanke an den kommenden Winter und das Heizmaterial, das sie irgendwie würde bezahlen müssen, lähmte sie.
»Wird wohl nix mit Ihrem Vorstellungsgespräch, Kindchen«, bemerkte Emmi Brombach mitfühlend. Inzwischen warteten sie seit fast einer Stunde. Wenn nicht in spätestens zehn Minuten eine U-Bahn käme, würde sie ihren Termin versäumen, mochte sie auch noch so zeitig an der Haltestelle gewesen sein.
»Sieht so aus«, gab Nora gepresst zurück. Von allen Seiten wurde sie angerempelt, viele der Wartenden nahmen vor lauter Ärger nun keine Rücksicht mehr. Sie hatte so sehr gehofft, heute mit einer guten Nachricht nach Hause zurückzukehren, in ihren Tagträumen hatte sie sich bereits ausgemalt, von ihrem ersten Lohn eine kleine Überraschung für Veronika und Jörg zu kaufen, ein Spielzeug vielleicht oder tatsächlich einen Kuchen, mit Streuseln oder Marzipan.
»Ich gebe es auf.« Emmi Brombach seufzte vernehmlich. »Ich versuche in ein paar Tagen noch mal, mich zu meiner Freundin durchzuschlagen. Viel Glück bei der Arbeitssuche, Kindchen, vielleicht kommt ja demnächst eine U-Bahn.«
Nora wartete noch eine halbe Stunde, doch der letzte Rest Hoffnung verflüchtigte sich mehr und mehr. Scharenweise verließen auch die anderen Leute den U-Bahnhof, die Gesichter frustriert und ärgerlich. Schließlich beschloss auch sie, nach Hause zu gehen. Es hatte keinen Sinn mehr, noch länger im Untergrund herumzustehen – selbst wenn noch eine Bahn käme, wäre sie hoffnungslos zu spät für ihr Vorstellungsgespräch. Sicherlich hatten bereits Dutzende, wenn nicht Hunderte von Bewerberinnen mit einem unkomplizierten Anfahrtsweg im Roten Rathaus vorgesprochen, wahrscheinlich war die Stelle längst vergeben.
Die Enttäuschung hing über ihr wie ein schwerer Mantel, als sie in der milden Juniwärme nach Hause ging. Niedergeschlagen erzählte sie von ihrem Misserfolg.
Als Hanna am Abend von ihrer Schicht im Sankt-Joseph-Krankenhaus heimkehrte, aßen sie schweigend ein paar gekochte und zerdrückte Kartoffeln. Else hatte am Vormittag mit Jörg im Gemischtwarenladen von Gernot Kluth eingekauft, war jedoch kaum erfolgreicher gewesen als Nora am Vortag. Veronika saß blass zwischen ihrer Mutter und ihrer Großmutter, sie hatte berichtet, dass es ihr in der Schule erst flau im Magen, dann übel geworden war.
Nora gab ihr etwas von ihrer Portion ab, obwohl auch ihr Magen knurrte, und strich ihrer Tochter über die geflochtenen Zöpfe, doch ihr fiel nichts ein, womit sie die Kleine hätte trösten können.
»Du solltest dich bei der Air Force am Flughafen bewerben«, sagte Hanna. Sie nahm die Pappe aus dem scheibenlosen Fensterrahmen, um Licht und frische Luft hereinzulassen. Auf dem Hinterhof spielten einige Kinder mit einer Blechdose Fußball, ein lautes, metallenes Scheppern durchbrach die Ruhe der Straße. »Über eine Patientin habe ich gehört, dass dort Übersetzer oder Dolmetscher gesucht werden. Du kannst doch hervorragend Englisch, du wärst prädestiniert für solch eine Arbeit.«
Elses Augenbrauen schossen in die Höhe. »Bei den Amerikanern soll sie sich vorstellen? Warum nicht gleich bei den Russen?«
Nora ignorierte den bissigen Tonfall und wandte sich interessiert an ihre Schwester, klammerte sich wie stets an jeden noch so winzigen Hoffnungsschimmer. »Bist du sicher, Hanni? Finden Vorstellungsgespräche statt? Weißt du, wann und wo?«
»Leider nicht.« Hanna zuckte die Achseln. »Aber ich frage noch mal nach. Frau Bachmann – sie liegt mit Blinddarm auf der Inneren – hat es nämlich sehr eilig, das Spital wieder verlassen zu dürfen, da sie auch vorsprechen möchte.«
»Gut.« Nora nickte heftig. »Bitte frag sie morgen noch mal, ob sie mehr weiß.« Die Notwendigkeit, Arbeit zu finden, war so dringend, dass sie den Umstand beiseiteschob, dass sich die potenzielle Stelle im Flughafen Tempelhof befand, wo sie während des Krieges am Fließband gestanden hatte. Allein der Name des Flughafens verursachte ihr noch heute Gänsehaut und ein mulmiges Gefühl im Bauch, doch auf derlei Befindlichkeiten konnte sie keine Rücksicht nehmen. Ihre Kinder brauchten Lebensmittel und Kohle für den Winter, um nicht frieren zu müssen.
Else erhob sich und sammelte die Teller ein. »Du wirst bestimmt eine andere Arbeit finden, du musst nicht bei den Amerikanern zu Kreuze kriechen, Nora. Erst bombardieren sie unsere Städte, und dann geben sie uns Arbeit – ist das nicht aberwitzig?«
Nora blickte verstohlen zu Hanna, die entnervt mit den Augen rollte. Natürlich wussten sie beide, wie tief der Schmerz bei ihrer Mutter saß – während eines Bombardements durch die Amerikaner im Jahr dreiundvierzig war Elses Bruder Werner in den Trümmern ihres zusammengestürzten Hauses begraben worden. Der Rest der Familie hatte sich in einen der Luftschutzbunker des Flughafens retten können, doch da es Kranken untersagt war, sich dorthin zu begeben und womöglich die zahlreichen anderen Schutzsuchenden anzustecken, musste Werner, der an einer Grippe litt, zu Hause bleiben. Er starb zu Hause, in seinem Bett, aber auf welch einsame, grausame Weise, dachte Nora so manches Mal. Else hatte seinen Tod bis heute nicht verwunden.
»Ja, Mutter«, sagte Nora leise und hob Jörg auf ihren Schoß. »Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Amerikaner sind keine Feinde mehr – durch ihre Hilfspläne zeigen sie doch immer wieder, dass sie es gut mit uns meinen.«
»Außerdem, was hätten die Amerikaner im Krieg tun sollen?«, unterbrach Hanna sie ungeduldig. »Zusehen, wie Hitler die Welt mit Zerstörung und Hass überrollt?«
»Dann geh dich eben um Himmels willen bei den Amerikanern vorstellen.« Else war der Diskussion anscheinend müde und griff nach ihren Stricknadeln. »Auf eure alte Mutter hört ihr Mädchen sowieso nicht.«
Nora unterdrückte ein Lächeln und küsste ihre Mutter flüchtig auf die Wange. »Du hast es nicht leicht mit uns, ich weiß.«
»Ich fände es gar nicht schlecht, wenn du bei den Amerikanern arbeitest, Mutti«, warf Jörg schelmisch ein. »Dann bekommst du vielleicht ganz viele Bonbons und Kaugummi geschenkt. Erich bekam letztens sogar ein Stück Schokolade von einem Soldaten, der in einem Konvoi vorbeigefahren ist.«
»Vielleicht solltest du die ganze Sache ebenso pragmatisch sehen wie Jörg«, schlug Hanna ihrer Mutter vor, woraufhin sie alle lachten.
Nora war lediglich eine von vielen jungen Frauen, die wenige Tage später – Hanna hatte glücklicherweise den genauen Tag und die Uhrzeit herausfinden können – dem Flughafengebäude Tempelhof entgegenströmten. Ein Gutes hätte es, würde sie eine Stelle in den Büros der Air Force bekommen: Der Weg von der Burgherrenstraße bis zum Flughafen dauerte kaum fünf Minuten, das derzeitige Schienenchaos würde ihr nichts anhaben.
Sie drückte ihre Handtasche mit den Zeugnissen an sich, als sie sich dem Hauptgebäude näherte. Durch seine riesigen Ausmaße imposant, von der Architektur her nüchtern und zweckdienlich, schüchterte es sie wie eh und je ein wenig ein. Mit seinen Flügeln und Nebengebäuden und den schier endlosen Wiesen und Flugfeldern dahinter wirkte es wie eine eigene kleine Stadt, die man mitten in einem Wohngebiet aufgestellt hatte.
Ein Wegweiser führte sie und die anderen Bewerberinnen zu einer unauffälligen Tür am linken Flügel, wo ein amerikanischer Verwaltungsbeamter im Schatten des überdachten Steingangs an einem Tisch saß und die Namen der Bewerber notierte.
»Nora Thalfang«, sagte Nora und buchstabierte ihren Nachnamen, mit dem der Soldat seine Probleme hatte. Ein Blick über seine Schulter hinweg ließ ihr Herz sinken, denn im Korridor hinter ihm saßen dicht gedrängt mindestens hundert Frauen, die eine der wenigen ausgeschriebenen Stellen ergattern wollten. Alle waren genauso zurechtgemacht wie sie, hatten ihre besten Kleider gebügelt und geflickt, um zu verbergen, wie zerschlissen sie waren.
Als der GI sie durchwinkte, nahm sie auf einem der letzten freien Stühle Platz, atmete tief durch und ließ dann ihren Blick umherschweifen. Am Ende des langen Korridors befand sich eine Metalltür, hinter der wohl die Vorstellungsgespräche abgehalten wurden; von Zeit zu Zeit öffnete sich diese, spuckte eine junge Frau aus, deren Miene mal hoffnungsfroh, mal niedergeschlagen war, und schloss sich nur Sekunden später hinter einer weiteren Bewerberin. Noras Herz trommelte im Stakkato, doch wenigstens war es unter der hohen Decke angenehm kühl.
»Wenn es in diesem Tempo weitergeht, sitzen wir heute Abend noch hier«, wandte ihre Sitznachbarin sich in scherzhaftem Ton an sie, nachdem sie seit mindestens einer Stunde auf den unbequemen Stühlen ausgeharrt hatten. Vom leisen Gemurmel der anderen Wartenden summte es in dem engen Gang wie in einem Bienenstock. »Nicht, dass ich noch etwas anderes vorhätte.«
Nora lachte. »Na ja, ein Bad im Wannsee oder der Besuch einer Eisdiele wäre angenehmer.«
»Stimmt auch wieder. Ich bin Ella Roth.« Die junge Frau streckte ihr die Hand hin, die Nora sogleich erfreut ergriff.
»Ich bin Nora Thalfang.«
Ella schien noch recht jung zu sein, vielleicht Mitte zwanzig. Sie trug ein adrettes hellblaues Kleid mit weit schwingendem Rock, das von vor dem Krieg zu stammen schien, jedoch noch in tadellosem Zustand war. Ihre dunklen Haare, die der Nachkriegsmode entsprechend kinnlang waren, hatte sie wie die meisten anderen Anwesenden in große Wellen gelegt. Mit dem dunklen Lippenstift – ob sie ihren auch hütete wie einen Schatz? – und der hellen Haut ähnelte sie einem Hollywoodstar. Nicht, dass Nora sich damit auskannte, aber so einige Male hatte sie in der Warteschlange vor Kluths Laden das Titelbild einer Zeitschrift mit dem Porträt einer Schauspielerin darauf gesehen. Sie fand Ella gleich sympathisch.
»Ich habe gehört, nur eine Handvoll Bewerberinnen wird eingestellt«, vertraute Ella ihr an.
»Oje.« Nora seufzte. »So wenige? Bei den vielen Leuten, die hier herumsitzen, ist unsere Chance, genommen zu werden, dann wohl nicht besonders groß.«
»Abwarten.« Ella hob die Schultern. »Vielleicht sind wir beiden besser als die anderen und werden deshalb ausgewählt.«
Tatsächlich schienen sich manche der Bewerberinnen trotz unzulänglicher Englischkenntnisse eingefunden zu haben, denn als Nora bereits zwei Stunden mit Ella im Wartebereich geplaudert hatte, trat ein seriös und gewichtig wirkender Offizier aus der Metalltür zu ihnen in den Korridor und räusperte sich. Sofort verstummten alle und sahen teils beklommen, teils erwartungsvoll zu ihm auf. Der Gedanke, der Offizier möge sie alle vorzeitig nach Hause schicken, weil er seine offenen Stellen bereits vergeben hatte, schoss Nora unheilvoll durch den Kopf. Bitte nicht, dachte sie nun kläglich. Sie brauchte so dringend eine Arbeit, nicht schon wieder wollte sie unverrichteter Dinge nach Hause ziehen. Mittlerweile war es ihr gleich, ob sie mit dem Flughafengebäude unschöne Erinnerungen verband, die Vorzüge eines möglichen Arbeitsplatzes, der so nahe an ihrem Zuhause lag, erschienen ihr unschlagbar.
»Ladys«, sprach der Offizier nach einem kurzen Seitenblick auf zwei junge Frauen, die steif wie Stöcke in der Nähe der Tür saßen. »Bevor ich mit den Gesprächen fortfahre, eine Sache …« Sein amerikanischer Akzent war unverkennbar, auch wenn er völlig korrektes Deutsch sprach. Er war ein Hüne, was durch die graue, mit Orden geschmückte Uniform noch verstärkt wurde. »Ich weiß, die Not ist groß, aber bitte … bitte betreten Sie das Besprechungszimmer nur, wenn Sie wirklich gutes Englisch sprechen.«
Sein düsterer Blick glitt über die Köpfe der Versammelten hinweg, und manch eine der Angesprochenen senkte den Kopf.
»Sie verschwenden meine und auch Ihre Zeit, wenn Sie sich für einen Posten als Übersetzerin oder Dolmetscherin bewerben, ohne die Sprache zu beherrschen.«
Mit einem nachdrücklichen Nicken zog er die Tür hinter sich zu. Keine der Bewerberinnen rührte sich von der Stelle.
»Hoffentlich haben wir eine Chance«, flüsterte Ella. »Aber eigentlich muss ich mir keine Sorgen machen. Meine Großmutter war Engländerin, mit ihr habe ich immer nur Englisch gesprochen. Woher kannst du Englisch, Nora? Ich darf doch Du zu dir sagen?«
Nora erzählte von ihrer Ausbildung, dann warteten sie erneut. Die Zeit verging nur allzu langsam, vor dem kleinen Fenster am Ende des Korridors wich das gleißende Sonnenlicht bereits den milderen Orangetönen des späten Nachmittags.
Nora spürte ihren Körper kaum noch vom langen Sitzen, als Ella endlich aufgerufen wurde. Kaum fünf Minuten später kam sie wieder aus dem Zimmer heraus, vor Freude strahlend.
»Ich wurde genommen!«, raunte sie Nora zu, woraufhin sie von allen Seiten mit neidischen Blicken bedacht wurde. »Ich kann es kaum glauben! Hoffentlich hast auch du Glück! Ich warte draußen auf dich, einverstanden? Es wäre zu schön, wenn wir Kolleginnen werden würden.«
»Das finde ich auch«, bekundete Nora lächelnd. Doch im nächsten Augenblick wurde vorne an der Metalltür bereits ihr Name genannt, und sie schnellte auf, ihr Körper stand plötzlich unter Hochspannung, ein unangenehmes Ziehen meldete sich in ihrem Magen. Ihre Tasche an sich gedrückt, folgte sie dem jungen GI, der sie ins Besprechungszimmer führte, wo der Offizier hinter einem Berg von Unterlagen saß und sich müde die Stirn rieb. Jetzt, wo sie ihn von Nahem sah, konnte sie die Aufschrift auf seinem Namensschild entziffern, das an seiner Uniform befestigt war. Major James Bloom hieß er. Seine Augen waren grau wie Gewitterwolken, und er mochte wohl einige Jahre älter sein als sie.
»Miss Thalfang«, begann er, doch sie unterbrach ihn leise.
»Mrs.«
»Okay. Ist Ihr Mann einverstanden, dass Sie sich bei uns bewerben? Hat er selbst eine Arbeit?« Bloom schien ein wenig geistesabwesend, während er sprach, kritzelte er hastig eine Notiz in ein abgegriffenes Büchlein.
»Mein Mann wird seit fünf Jahren vermisst«, antwortete Nora leise.
»Das tut mir leid. Russland?« Offenbar war Bloom es gewohnt, knappe, präzise Fragen zu stellen, sein Tonfall war jedoch jetzt sanfter als vorhin, als er im Korridor gesprochen hatte.
Sie nickte nur und hoffte, er würde rasch das Thema wechseln. »Wie ist es um Ihre Englischkenntnisse bestellt? Wo haben Sie Englisch gelernt?«, hakte der Offizier nach.
»Ich habe Englisch studiert und ein Diplom zur Übersetzerin und Dolmetscherin erworben. Außerdem bin ich mit meinem Mann vor dem Krieg nach England gereist. Er war Sprachenlehrer, und wir hatten einige englische Bücher im Original zu Hause.« Die bereits vor langer Zeit als Brennmaterial zerstört worden waren, fügte sie im Geiste bitter hinzu.
»Das klingt nicht schlecht, zumindest nicht schlechter als das, was manche Ihrer Mitbewerberinnen heute bereits von sich gegeben haben.« Er seufzte und trank einen Schluck eines dunklen Gebräus. Nora fragte sich, ob es sich um echten Kaffee handelte. Die Amerikaner verfügten über viele Leckereien – sie ließen die Verpflegung für sich und ihre Angehörigen aus den USA einfliegen –, wahrscheinlich herrschte auch an Bohnenkaffee kein Mangel. »Nun gut, dann zeigen Sie mal, was Sie können. Aber bitte nicht diese abgedroschenen Phrasen, die ich heute bereits hundertfach gehört habe. My name is Lieselotte, I live in Berlin, I am twenty-three years old, bla, bla, bla. Überlegen Sie sich was Neues.« Erschöpft fuhr sich Bloom mit der Hand über die Stirn und spähte einen Moment lang aus dem Fenster in die hellgrünen Baumkronen, die vom Licht der Nachmittagssonne angestrahlt wurden.
Eine Schocksekunde lang zermarterte Nora sich das Gehirn. Um Himmels willen, was wollte der Major nur hören? Wie ein Zug im Schnelltempo ratterten Fragmente von Büchern oder Gedichten, die sie vor Jahren gelesen hatte, durch ihren Kopf, doch bei keinem erinnerte sie sich an den genauen Wortlaut. Doch!, schoss es ihr durch den Kopf. No man is an island von John Donne, ihr Lieblingsgedicht seit Schulzeiten, kannte sie auch nach all den Jahren noch auswendig.
»Ich hätte ein Gedicht, das ich aufsagen und übersetzen könnte«, begann sie stockend.
Major Bloom gab ihr mit einer vagen Handbewegung zu verstehen fortzufahren.
Erst leise, doch dann immer sicherer, gab sie das Gedicht zum Besten. »No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the maine …«
Nachdenklich trank der Major einen weiteren Schluck Kaffee. Er ließ sie das gesamte Gedicht rezitieren und unterbrach sie nicht, im Gegenteil, er schien ihren Vortrag ganz erbaulich zu finden, denn er gab seine steife Körperhaltung auf und lehnte sich entspannt zurück.
»Any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind. And therefore, never send to know for whom the bell tolls, it tolls for thee«, schloss Nora errötend. War es albern, während eines Vorstellungsgesprächs bei der US Air Force ein Gedicht vorzutragen? Vielleicht hätte sie doch besser etwas rein Sachliches erzählt? Nowadays, about three million people live all over Berlin …
»Sehr schön.« Nora erkannte die Andeutung eines Lächelns auf den Lippen des Majors. »Und wenn Sie das Ganze jetzt noch auf Deutsch übersetzen könnten?«
Nora hatte das Gedicht noch nie in einer Übersetzung gelesen, aber es gelang ihr, jede Zeile auseinanderzupflücken und ins Deutsche zu übertragen.
Bloom kritzelte erneut etwas in sein Büchlein. Nervös verfolgte sie seine Handbewegungen, konnte aber nichts entziffern. Einen Moment herrschte Stille, nur das Summen einer Fliege war zu hören. Nora knetete ihre feuchten Hände und bemühte sich, ruhig zu atmen.
Endlich erlöste Bloom sie von der bangen Warterei. Er schlug sein Büchlein zu und sah sie mit seinen gewittergrauen Augen intensiv an. »Beherrschen Sie auch Maschinenschreiben und Steno? Denn um ehrlich zu sein, müssten Sie nicht nur übersetzen oder das ein oder andere Gespräch dolmetschen, sondern manchmal auch als Sekretärin fungieren.«
»Das ist kein Problem für mich.« An der Sprachenschule hatte sie nebenher einen freiwilligen Sekretärinnenkurs absolviert.
»Sie haben den Job. Wann können Sie anfangen? Bei uns in der Air Force ist nämlich Not am Mann, aber das ist eigentlich immer der Fall. Gewöhnen Sie sich schon mal dran, dass alles schnell gehen muss.«
Nora fühlte sich, als wiche ihr mit einem Mal die angehaltene Luft aus den Lungen und sie fiele in sich zusammen vor Erleichterung. Sie versuchte, sich klarzumachen, dass sie recht gehört hatte, keiner Sinnestäuschung erlag: Sie hatte eine Arbeit, würde Geld verdienen, ihre Familie besser versorgen können.
»Ich könnte morgen anfangen.« Ihre Stimme bebte leise, ihre Worte klangen eher nach einer Frage statt einer Feststellung, so überwältigt war sie.
»Okay.« Bloom erhob sich zu seiner beeindruckenden Größe und reichte ihr die Hand. »Dann bis morgen. Melden Sie sich am Haupteingang, dann werden Sie zu Ihrem Büro gebracht.«
»Vielen Dank, Herr Major«, brachte sie noch heraus, bevor sie nach draußen taumelte, an den restlichen Wartenden vorbei. Im Freien saß Ella auf einem kleinen Mäuerchen und wartete wie versprochen auf sie.
»Und?«, fragte sie erwartungsvoll, die blauen Augen auf Nora gerichtet.
»Ich habe den Job«, flüsterte Nora. Noch vermochte sie es kaum zu fassen, dass sich ihre Lebensumstände nun tatsächlich bessern würden, noch stand sie so stark unter dem Eindruck der vergangenen Jahre, dass sie sich kaum vorstellen konnte, je wieder unbeschwert oder sorglos zu sein.
»Wunderbar!«, rief Ella erfreut. »Dann auf gute Zusammenarbeit, Nora! Ich denke, wir werden uns prächtig verstehen.«
Kapitel 3
Juni 1948
Am nächsten Morgen zog Nora wieder ihr butterblumengelbes Kleid an, in der Hoffnung, an ihrem ersten Arbeitstag im Flughafen Tempelhof einen adretten Eindruck zu hinterlassen. Die Kinder, die die Bedeutung der neuen Situation spürten – ihre Mutter würde nun ihre Tage in den Büros der amerikanischen Air Force verbringen, um Geld zu verdienen –, drängten sich um sie, als stünde ein Abschied für lange Zeit bevor.
»Ich komme doch heute Abend wieder«, tröstete Nora Jörg, während sie sich einen Hauch ihres himbeerroten Lippenstiftes auf den Mund tupfte. »Es ist ja nicht so, als würde ich nach Amerika reisen.«
»Das würde gerade noch fehlen«, brummte Else im Hintergrund. Sie hielt Veronika den Tornister hin, denn auch ihre Enkelin musste zur Schule aufbrechen. »Schlimm genug, dass du nun bei den GIs arbeitest. Pass bloß auf dich auf!«
»Mutti!« Nora verzog unwillig das Gesicht, die Unkerei ihrer Mutter bezüglich der Amerikaner wurde ihr allmählich zu viel. »Was hast du nur für Vorstellungen! Was soll mir im Flughafen schon passieren? Ich arbeite mit mehreren anderen Übersetzerinnen zusammen in einem Büro, weiter nichts.«
Veronika schmiegte traurig ihren Kopf an sie. »Schade, dass du nicht da bist, wenn ich von der Schule nach Hause komme. Wer hilft mir bei den Hausaufgaben?«
»Dafür ist Oma nun zuständig.« Nora griff nach der Bürste, die ihre Tochter ihr hinhielt, und kämmte ihr die weichen blonden Haare, um sie danach zu zwei straffen Zöpfen zu flechten. »Außerdem beginnen ja demnächst die Ferien, dann hast du den ganzen Tag frei. Und am Wochenende unternehmen wir etwas Schönes zusammen, das verspreche ich euch. Wir könnten mal wieder in den Zoo gehen.«
»Oh ja, zu den Affen!« Jörg begann, breitbeinig wie ein Affe durch die Wohnung zu hüpfen, und sprang mit einem Satz auf das Sofa, das Hanna als Schlafstätte diente, woraufhin das ohnehin bereits abgenutzte Möbelstück beängstigend quietschte. Als Jörg noch dazu schrille Urwaldlaute ausstieß, schob Else Nora sanft in Richtung Haustür. »Ab mit dir, bevor du glaubst, bereits jetzt im Zoo zu sein.«
Vor der Haustür atmete Nora tief durch; sie verspürte Lampenfieber vor ihrem ersten Tag, und der Kinderlärm, der noch immer aus der Wohnung schallte, trug nicht gerade dazu bei, ihre Nerven zu beruhigen. Auch wenn sie wusste, ihre Mutter würde sich gut um die Kleinen kümmern – während ihrer unfreiwilligen Zeit in der Munitionsfabrik hatte sie Veronika und Jörg, der damals noch ein Säugling war, auch liebevoll umsorgt –, schnitt es ihr doch ins Herz, dass sie die beiden von nun an nur mehr abends sehen würde. Die Kinder hatten bereits ihren Vater verloren, nun mussten sie noch von morgens bis abends auf die Mutter verzichten! Doch die Zeiten waren hart, und sie war Major Bloom unendlich dankbar, dass er ihr eine Chance gegeben hatte.
Wie Bloom ihr am Vortag geraten hatte, meldete sie sich am Haupteingang an und folgte dann einem jungen GI, der sie zwei Stockwerke nach oben führte. Dort erstreckte sich ein großer Raum vor ihr, in dem die Luft vor Geschäftigkeit nur so zu vibrieren schien. Eine Handvoll weiterer Übersetzerinnen, einige Gesichter waren ihr vom Vorstellungsgespräch am Vortag im Gedächtnis geblieben, richtete sich bereits an nagelneu wirkenden Schreibtischen ein, während andere Plätze noch frei waren.
»Hier, Nora!« Sie vernahm zunächst nur verwirrt ihren Namen, doch dann erkannte sie ihre gestrige Bekanntschaft, Ella Roth, die von einem der weiter hinten platzierten Schreibtische winkte. Lächelnd eilte sie ihr entgegen.
»Ich habe dir einen Schreibtisch freigehalten«, verkündete Ella, offenbar genauso froh, sie wiederzusehen.
»Danke, wie lieb von dir.« Nora legte ihre Tasche auf den angrenzenden Tisch und zog die Haube von der Schreibmaschine, einer Remington, deren Gehäuse so stark glänzte, als käme es frisch aus einer Fabrik in den USA. Was wahrscheinlich tatsächlich so war, dachte Nora beeindruckt. Es mutete seltsam an, mitten im noch immer von den Kriegsfolgen gebeutelten Berlin auf einer Art Insel gelandet zu sein, in der es alles im Überfluss zu geben schien.
Nach und nach füllte sich der Raum mit den weiteren neuen Kolleginnen, und Major Bloom erschien im Türrahmen. Alle Köpfe wandten sich ihm erwartungsvoll zu. Zufrieden – er schien heute weitaus entspannter zu sein als am Vortag – blickte er jeder neuen Mitarbeiterin kurz in die Augen und nickte ihr zur Begrüßung zu. »Ladys«, sagte er mit seiner sonoren Stimme, woraufhin eine junge Frau, die schräg vor Nora und Ella saß, sich umdrehte und verstohlen wisperte: »Klingt er nicht wie ein Filmstar? Und sieht er nicht aus wie der Zwillingsbruder von Cary Grant?« Sie selbst schien sich eher für einen Kino- oder Theaterbesuch aufgedonnert zu haben als für die Arbeit in einem Büro. Ihr üppiges blondes Haar trug sie zu einem Bienenstock auftoupiert, und ihr Kleid schimmerte bei jeder Bewegung silbrig.
Nora und Ella warfen sich einen belustigten Blick zu.
Falls Major Bloom registrierte, dass hinten in der Ecke getuschelt wurde, ließ er sich nichts anmerken. Gelassen fuhr er auf Englisch fort: »Ich begrüße Sie alle an Ihrem neuen Arbeitsplatz, und ich heiße Sie auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika willkommen.«
Nora spürte, wie sich auf ihren Armen trotz der warmen Luft, die durch die offenen Fenster strömte, eine Gänsehaut bildete. Die Vorstellung, sich auf fremdem Territorium zu befinden, war allzu aufregend und neu.
»Ich verteile gleich die ersten Berichte zum Übersetzen, denn Sie sind ja zum Arbeiten gekommen, nicht, um sich meine Vorträge anzuhören.«
Die blonde Frau mit der Bienenstockfrisur schüttete sich aus vor Lachen, so als habe der Major einen überaus geistreichen Scherz geäußert.
»Bitte denken Sie immer daran – alles, was Sie innerhalb dieser Mauern hören, lesen oder schreiben, unterliegt größter Geheimhaltung. Manche Übersetzungen, die auf Ihren Schreibtischen landen, werden überaus langweilig sein, andere könnten durchaus Informationen enthalten, die Sie draußen nicht herausposaunen sollten.«
Die Blondine vor Nora nickte so heftig wie ein Schulkind, das dem Lehrer durch besonderen Fleiß eine Freude machen wollte.
»Ladys, an die Arbeit.« Der Major ging durch die Reihen und verteilte Texte, und bald klapperten die Schreibmaschinen im Stakkato, wurden nur manchmal von den Kampfmaschinen übertönt, die über Tempelhof ihre Bahnen zogen. So verging der erste Arbeitsvormittag recht schnell, und kaum hatte Nora das Protokoll eines Gesprächs zwischen dem Bürgermeister Ernst Reuter und einem amerikanischen Gouverneur namens Clay fertig übersetzt, war es auch schon Zeit für die Mittagspause.
Nora betrat in Begleitung von Ella die Kantine und blieb erst einmal stehen. Das amerikanische Stimmengemurmel vermischte sich in ihren Ohren zu einer lebhaften Hintergrundmusik. Verlegen hielt sie ihre Hand über eine fadenscheinige Stelle in ihrem Kleid, bald würde der Stoff reißen und ein Loch hinterlassen. Hoffentlich sah niemand allzu genau hin. Stumm schlenderten sie dann in einigem Abstand an der Essensausgabe vorbei, vor der zahlreiche Piloten in Fliegeruniform, Offiziere und Beamten ihre Mahlzeiten bestellten, und bestaunten fast ehrfürchtig die üppigen Speisen, die angeboten wurden. Allein die Kuchentheke hätte Noras Kinder in Entzücken versetzt – so viel köstlich aussehendes Backwerk mit Sahne, bunten Streuseln und rosa Zuckerguss hatte sie noch nie auf einem Fleck gesehen. Sie war noch ganz in den Anblick ringförmiger Kuchen mit dickem Schokoladenüberzug vertieft, als Ella sie inmitten des Lärms leicht anstieß, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
»Wollen wir uns dahinten hinsetzen? Dort ist noch ein Tisch frei.«
Nora nickte nur, überwältigt von der fremden Welt, in der sie gelandet war. Schweigend wickelten sie kurz darauf ihre kargen Brote aus, die sie von zu Hause mitgebracht hatten.
»Was meinst du«, fragte Ella zaghaft, die sich nach allen Seiten hin umsah, »ob wir uns irgendwann auch mal in die Schlange an der Essensausgabe einreihen können? Unseren Lohn bekommen wir in Dollar, also müsste es möglich sein.«