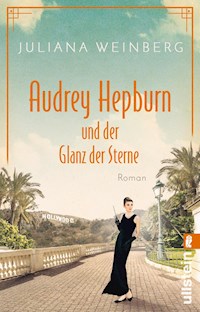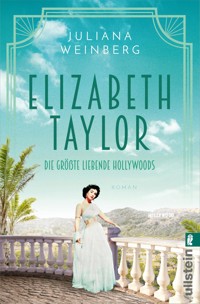11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein Einziger Tanz macht sie zur berühmtesten schwarzen Frau der Welt New York, 1924. Mit kleineren Auftritten als Tänzerin versucht Josephine ihre Familie zu unterstützen, als sie nach Paris eingeladen wird. Bei der »Revue Nègre« tanzt sie in vorderster Reihe. Schon bald ist Josephine ein gefeierter und erfolgreicher Star. Sie besitzt einen eigenen Klub in Paris, nimmt Songs auf, spielt in Filmen mit und tritt auf der ganzen Welt auf. Doch egal wo sie hinkommt, ihre Darbietungen bringen ihr Anbetung und Missachtung zugleich ein. Schließlich wird Josephine vor die schwierigste Entscheidung ihres Lebens gestellt. Kämpft sie für ihre Überzeugung oder ihre Liebe?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Ähnliche
Josephine Baker und der Tanz des Lebens
Die Autorin
JULIANA WEINBERG wurde in Neustadt an der Weinstraße geboren. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern im Pfälzer Wald. Neben dem Schreiben ist ihr Beruf als Lehrerin ihre große Erfüllung.
Von Juliana Weinberg ist in unserem Hause bereits erschienen:Audrey Hepburn und der Glanz der Sterne
Das Buch
Ein einziger Tanz macht sie zur berühmtesten Schwarzen Frau der Welt
New York, 1924. Josephine tanzt auf dem Broadway auf kleineren Bühnen, um sich und ihre Familie über Wasser zu halten. Doch sie träumt von etwas Größerem. Wegen einer ganz besonderen Darbietung von ihr wird sie zur „Revue Nègre“ nach Paris eingeladen. Sie kann sie ihr Glück kaum fassen. Sie steht dort in vorderster Reihe und ist schon bald ein gefeierter und erfolgreicher Star. Doch egal, wo sie hinkommt, ihre Vorstellungen bringen ihr Anbetung und Missachtung zugleich ein. Der zweite Weltkrieg überzieht Europa mit Schrecken und Josephine wird vor die schwierigste Entscheidung ihres Lebens gestellt: Bleibt sie ein Showstar oder schließt sie sich der französischen Résistance an?
Juliana Weinberg
Josephine Baker und der Tanz des Lebens
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage April 2021© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: © Bridgeman Images / CSU Archives/Everett Collection (Josephine Baker), © Alamy Stock Foto/ © Granger Historical Picture Archive (Woolworth Building), © www.buerosued.de (Landschaft)E-Book Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-8437-2490-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Teil I: Die schwarze Venus (1925–1936)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Teil II: Der heimliche Krieg (1939 – 1944)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Teil III: Die Kinder des Regenbogens (1945–1963)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Epilog
Anhang
Nachwort
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Prolog
St. Louis, Missouri, Juli 1917
Obwohl sie todmüde war, konnte Josephine nicht einschlafen. Es war stickig und heiß in der kleinen Kammer, und die Körperwärme ihrer Geschwister Richard, Margaret und Willie Mae, die das Bett mit ihr teilten, ließ sie noch mehr schwitzen. Vorsichtig, um die anderen nicht zu wecken, schob sie die dünne Decke von sich weg.
In einer Ecke des Zimmers raschelte es, und sie hob kurz den Kopf, um das Geräusch zu lokalisieren. Zwei Schatten huschten durch den schäbigen, mit billigen Möbeln ausgestatteten Raum und verschwanden kurz darauf unter dem Bett. Josephine ließ den Kopf wieder auf die durchgelegene Matratze sinken. Sie hatte keine Angst vor Ratten.
Ihr Bruder Richard stieß ihr im Schlaf den Ellenbogen in die Rippen, und im Nebenzimmer schnarchten ihre Mutter Carrie und ihr Stiefvater Arthur.
Josephine presste sich die Hände auf die Ohren. Sie lag bereits einige Stunden wach und wusste, dass sie so rasch wie möglich einschlafen musste, um noch etwas Erholung zu bekommen, bevor ihre Mutter sie um fünf Uhr wecken würde. Noch bevor die Schule am Morgen begann, musste sie für ein altes Ehepaar putzen, fegen, den Nachttopf ausleeren und Kartoffeln schälen. Zum Glück war der Weg nicht weit, denn das Ehepaar lebte wie sie und ihre Familie in Boxcar Town, einem Slum-ähnlichen Schwarzenviertel. Sie waren auf die paar Dollar angewiesen, die Josephine nach Hause brachte, um zu überleben.
»Du bist nun mal mit deinen elf Jahren die Älteste«, pflegte Carrie ungerührt zu sagen. »Das heißt, du hast Pflichten. Wir brauchen deine Mithilfe, vor allem, seit Arthur arbeitslos ist.«
Die kleine Willie Mae, die am Fußende des Bettes schlief, regte sich und murmelte im Schlaf etwas vor sich hin. Zudem glaubte Josephine, noch etwas anderes zu hören – irgendwelche Geräusche von draußen, vielleicht Rufe oder Geschrei? Sofort war sie wieder hellwach. Aber das waren gewiss Hirngespinste, Produkte ihrer Übermüdung. Josephine presste die Lider fest zusammen und versuchte, sich etwas Schönes vorzustellen, das sie in den Schlaf gleiten ließ. Ihr Leben war nicht einfach. Sie lebte mit ihrer gesamten Familie in einer kärglichen Baracke und musste hart für fremde Menschen arbeiten, die sie nicht immer gut behandelten. Das Einzige, das sie für ein, zwei Stunden aus ihrem Alltag entführte, waren die gestohlenen Stunden bei ihrer Großmutter, die ein paar Straßen weiter wohnte. Ihre Großmutter hatte eine Truhe voller alter Kleider und Hüte, und Josephine liebte es, sonntags in eine Robe zu schlüpfen, die ihr viel zu lang war, und einen altmodischen Federhut aus dem letzten Jahrhundert auf ihre wilden schwarzen Haare zu setzen, um der Nachbarschaft eine Vorführung zu bieten. Ausgelassen tanzte und alberte sie herum und sonnte sich in der Aufmerksamkeit und dem Beifall der belustigten Zuschauer. Diese Momente waren die einzigen, in denen sie wirklich glücklich war. Die einzigen, in denen sie das Gefühl hatte, etwas wert zu sein.
Ein lautes Geräusch ließ Josephine aus dem Halbschlaf schrecken. Es hatte wie ein Schuss geklungen, aber das hatte sie sich wahrscheinlich nur eingebildet. Boxcar Town war so arm, hier gab es keine Schusswaffen. Die Menschen hier konnten sich ja kaum ein paar Kartoffeln oder ein Stück Brot leisten. Sie setzte sich auf und horchte in die Dunkelheit. Und wieder Geräusche – dieses Mal unverkennbar Schreie. Ihr wurde heiß vor Angst.
Dann war es wieder still. Josephines laut pochender Herzschlag beruhigte sich. Die Menschen hier waren allesamt arm und lebten auf engstem Raum gedrängt; es war nicht ungewöhnlich, dass mal ein Streit ausbrach. Meistens beruhigten sich die Gemüter bald wieder.
Bevor sie wieder einschlief, versuchte sie, sich vorzustellen, wie sie in einem kostbaren Kostüm auf einer großen Bühne tanzte, umjubelt von unzähligen Zuschauern.
Im nächsten Moment wurde grob an ihrem Arm gerüttelt, und ihre kleinen Schwestern weinten, während sich ihr Bruder Richard ängstlich die Decke über den Kopf zog.
»Aufstehen!«, herrschte Carrie sie an. »Alle, sofort!«
Josephine versuchte mühsam, die Augen offen zu halten, und blinzelte ihre Eltern schlaftrunken an. »Was … was ist passiert …?«
Es waren tatsächlich unverkennbar Schüsse, die die Ruhe der Nacht zerrissen. Carrie antwortete nicht. Der ohrenbetäubende Lärm und das Geschrei vieler Menschen, das wie eine Woge aufbrandete, sprachen für sich. Ein Überfall auf das Viertel. Carrie zerrte Willie Mae aus dem Bett und setzte sie sich auf die Hüfte, Margaret zog sie am Arm hinter sich her. Ihr Stiefvater nahm Richard und Josephine mit eisernem Griff an die Hand und bugsierte sie zur Hintertür. Eine Ratte strich um Josephines nackte Füße.
»Raus, schnell raus, macht schon«, rief Carrie zitternd, und noch während sie sprach, kam eine brennende Fackel von der Straße durch das Fenster geflogen. Josephine blieb fassungslos stehen und starrte einen Moment auf die Flammen, die sich rasend schnell durch den Holzboden fraßen.
»Beeil dich, Tumpy«, drängte Carrie, Josephines Kosenamen aus ihrer frühen Kindheit benutzend, »bevor das ganze Haus lichterloh brennt.«
Josephine vermochte sich kaum von dem Feuer loszureißen. Kurz glaubte sie, ein weißes Gesicht, zu einer hassverzerrten Fratze verzogen, vor dem Fenster aufblitzen zu sehen. Ihre Eltern schoben sie und ihre Geschwister durch die Hintertür auf die vertrocknete Grasfläche hinter ihrer Baracke, wo sie sich zwischen dichten Büschen verbargen, und sie sahen schockiert, dass in der ganzen Straße Häuser brannten. Rauchschwaden hingen dick und beißend in der Nachtluft. Ihre Geschwister husteten und schluchzten abwechselnd. Nur Josephine weinte nicht. Entsetzt und stumm beobachtete sie mit weit aufgerissenen braunen Augen durch die Lücken der Häuser hindurch, wie der Mob aus unzähligen weißen Männern durch die Straße walzte. Die grölende Meute trug Fackeln und Gewehre. Überall flohen die Menschen aus ihren Behausungen und schrien um Hilfe, während Schüsse durch die Nacht peitschten. Vereinzelt heulten Menschen auf, als seien sie verwundet worden.
»Weiter«, keuchte Carrie und schlang schützend die Arme um ihre Kinder. »Wir müssen weiter, sonst entdecken sie uns.«
Halb zerrten, halb trugen sie und Arthur die jüngeren Kinder und führten sie tiefer in das Dickicht aus Bäumen und Büschen am Rand von Boxcar Town, um sich dort zu verstecken. Die Schritte ihrer nackten Füße raschelten im Gras, ebenso wie die von mehreren Nachbarn, die ebenfalls in dem kleinen Wäldchen Zuflucht suchten.
Josephine kam langsam hinterher. Immer wieder drehte sie sich zu dem Gemetzel um, das in ihrem Wohnviertel wütete. Die Flammen knisterten und knackten in den ärmlichen Holzhütten, Dächer fielen lautlos in sich zusammen. Die Behausungen von Hunderten von Nachbarn wurden unwiederbringlich zerstört. Das wenige Hab und Gut, das sie besaßen, vom Feuer verschlungen.
»Sie zerstören unser Haus …!« Margaret zitterte am ganzen Körper, so sehr schrie und weinte sie.
Carrie versuchte, sie zu beruhigen, indem sie sie nah an sich zog. »Pscht, Kleines, nicht so laut, sonst entdecken sie uns hier noch.«
»Warum?«, flüsterte Josephine. Sie fühlte sich wie gelähmt, unfähig, zu begreifen, was in dieser Nacht vor sich ging.
Arthur rieb sich mit seinen rußbedeckten Händen über das feuchte Gesicht. »Die Weißen hassen uns einfach. Als ob wir keine Menschen wie sie wären.«
Josephines Blick war noch immer starr auf die in Flammen aufgehenden Hütten geheftet. Sie spürte die Hitze des Feuers auf ihrer Haut und vernahm die verzweifelten Schreie derer, die ihre Wohnungen nicht rechtzeitig verlassen hatten oder von Schüssen getroffen zusammenbrachen. »Aber warum, Arthur?«
»Keine Ahnung«, antwortete ihr Stiefvater düster. »Vielleicht haben sie Angst, wir würden ihnen die Jobs wegnehmen. Dabei habe ich in den letzten Jahren überhaupt keine Arbeit gefunden.« Er sank auf die Knie, presste sich die Hände vor die Augen und begann, geräuschlos zu weinen.
Josephine schlang die Arme um sich, als würde sie trotz der sengenden Hitze der Flammen frieren. Wie durch einen Nebel hörte sie ihre Familie und ihre Nachbarn schluchzen und wehklagen. In ihr tobten Wut, Unverständnis und Angst, die so verzehrend wie das Feuer waren, so schwarz wie die Asche, die der leichte Wind zu ihr trug. Wieso wurden sie so verabscheut, als so minderwertig betrachtet? Sie gehörten doch ohnehin schon zu den Ärmsten der Armen; und heute Nacht waren ihnen das letzte bisschen Besitz und die Dächer über ihren Köpfen genommen worden. Das letzte bisschen Würde war im dicken Rauch um sie herum davongeschwebt.
Josephine war zwar erst elf Jahre alt, doch sie hatte die vage Ahnung, dass die Gräueltaten, die sie in dieser Nacht erlebte, sie noch lange in ihren Träumen verfolgen würden.
Teil I: Die schwarze Venus (1925–1936)
I ran away from home. I ran away from St. Louis, and then I ran away from the United States of America because of that terror of discrimination, that horrible beast which paralyzes one’s very soul and body.Ich bin von zu Hause weggelaufen. Ich bin aus St. Louis weggelaufen, und dann bin ich aus den Vereinigten Staaten von Amerika weggelaufen, wegen dieses Terrors der Diskriminierung, dieses schrecklichen Biests, das die ganze Seele und den Körper lähmt.Josephine Baker1
September 1925
Josephine saß nur mit Unterwäsche bekleidet auf dem zerschlissenen Teppich ihres Zimmers, das sie möbliert gemietet hatte. Neben ihr stand eine Schüssel mit Zitronensaft. Sie tränkte einen Baumwolllappen in der hellgelben Flüssigkeit und betupfte sich damit sorgfältig Arme, Beine, Dekolleté und Gesicht. Diese Prozedur, die sie seit Wochen allabendlich ausführte, nahm mindestens eine Dreiviertelstunde in Anspruch. Müssten nicht bald mal Erfolge zu sehen sein? Sie streckte beide Arme aus und hielt sie in das trübe Licht der Stehlampe.
»Immer noch genauso braun wie am Tag meiner Geburt«, murmelte sie missmutig vor sich hin. »Das ist wohl vergebene Liebesmüh.« Frustriert warf sie den nassen Lappen in die Schüssel, sodass der Zitronensaft aufspritzte, und gab den ausgepressten Zitronenschalen, die verstreut auf dem Teppich lagen, einen Tritt. Obwohl Zitronen eine bleichende Wirkung nachgesagt wurde, konnte sie tun, was sie wollte, ihre Haut wurde einfach nicht heller.
Draußen wurde es bereits dunkel, doch durch das offene Fenster drangen noch die Geräusche der Straße und die milde Luft herein. Es war Samstagabend, der Tag, an dem im New Yorker Stadtteil Harlem am meisten los war. Die Straße unter dem Backsteinhaus, in dem sie ihr Zimmer hatte, vibrierte vor Energie. Der Lärm der Automobile vermischte sich mit den aufgeregten Stimmen der Menschen, die sich ins Nachtleben stürzten. Noch ein, zwei Stunden, dann würde in den Klubs die Hölle los sein. Die Sänger, Jazzmusiker und Darsteller der exotischen Revuen, die gerade der letzte Schrei waren, würden von einem ausgelassenen Publikum gefeiert.
Josephine schaute flüchtig auf die Uhr. Sie hatte noch Zeit. Die Show, in der sie auftrat, würde erst gegen Mitternacht beginnen.
Sie warf sich einen Morgenmantel über und ging zum Tisch, auf dem ein angefangener Brief an ihre Familie in St. Louis lag. Sie tunkte den Füllfederhalter in die Tinte, kaute dann jedoch lediglich darauf herum, unschlüssig, was sie schreiben sollte.
»Ach, was soll’s. Mutter weiß, dass ich im Schreiben nicht gut bin«, dachte sie und verzichtete kurzerhand darauf, den Briefbogen mit ein paar persönlichen Zeilen zu füllen, und beschriftete ihn lediglich mit den Worten »von Josephine«. Zusammen mit ein paar Banknoten, die sie von ihrer Gage abgezweigt hatte, schob sie ihn in einen Umschlag. Ihre Handschrift war krakelig und ungelenk, denn sie hatte als Kind nur unregelmäßig die Schule besucht. Mit sieben Jahren hatte sie angefangen, bei einer streng dreinblickenden Frau am Rande von Boxcar Town in St. Louis als Haushaltshilfe zu arbeiten, bis diese ihr als Strafe für eine Unachtsamkeit – sie hatte versehentlich Wasser überkochen lassen – die Hand verbrüht hatte; mit acht Jahren hatte sie sich ein paar Dollar bei einem kinderlosen Ehepaar verdient, bei ihnen geputzt und gekocht, bis ihr der Mann zu nahe gekommen war und die Frau sie hinausgeworfen hatte.
Josephine riss sich aus ihren Kindheitserinnerungen und klebte den Brief zu; sie würde ihn auf dem Weg zum Plantation Club einwerfen. Ihre Familie, die noch immer bitterarm war, konnte jeden Cent gebrauchen.
»Josephine! Bist du so weit?« Ethel Waters, die im Zimmer nebenan wohnte und mit ihr zusammen im Klub auftrat, pochte an die Tür. Anders als Josephine war sie nicht nur Hintergrundtänzerin, sondern so etwas wie der Star der Show – sie durfte die Einzelnummern singen.
»Ja, ja, ich komme schon«, brummte Josephine und schlüpfte in ihr Kleid.
Als sie in den dämmrigen Flur trat, musterte Ethel sie neugierig. Sie war zehn Jahre älter als die neunzehnjährige Josephine und hatte viel mehr Bühnenerfahrung. »Sag mal, du riechst so … zitronig …?«
Josephine machte eine wegwerfende Handbewegung. »Mein Abendritual mit Zitronensaft, du weißt schon.«
Ethel kicherte. »Hast du es immer noch nicht aufgegeben? Ich glaube, du müsstest schon jeden Tag stundenlang im Saft baden, um eine winzige Nuance heller zu werden.«
»Lach du nur«, beklagte sich Josephine, während sie auf die Straße traten und in Richtung der 126. Straße gingen, wo sich der Plantation Club befand. »Du bist der Star des Klubs, für dich ist das wahrscheinlich alles nicht so wichtig. Aber ich bin lediglich die kleine Tänzerin aus der letzten Reihe … Niemand findet ein schwarzes Mädchen schön. Eine schöne Frau hat immer weiß zu sein.«
Ethel seufzte. »Ich weiß. Aber die Hautfarbe kann man nicht ändern.«
Bald hatten sie den Plantation Club erreicht. Tiefe Dunkelheit hatte sich herabgesenkt und sich wie ein Mantel über das biskuitbraune Backsteingebäude mit den Rundbögen über Türen und Fenstern gelegt. Die bunten Glasfenster strahlten hell von innen und wirkten warm und einladend wie ein Leuchtturm in der Nacht.
Josephine und Ethel steuerten gerade auf den Nebeneingang zu, der dem Personal vorbehalten war, als eine Gruppe junger weißer Leute, die bereits reichlich angeheitert schienen, sie anrempelte. Die jungen Frauen, typische Flapper mit kurzen Röcken, langen Perlenketten und stark geschminkten Gesichtern, sahen sie abfällig an. Eine junge Frau, die ihre kurzen blonden Haare in modische Wellen gelegt trug, blies Josephine den Rauch ihrer Zigarette ins Gesicht.
»Tom«, sagte sie schrill zu ihrem Begleiter, der in einem makellosen Smoking steckte. »Seit wann dürfen Neger in den Klub?«
Josephine verkrampfte sich innerlich, obwohl sie Szenen wie diese beinahe täglich erlebte. Als ob sie es tatsächlich darauf anlegte, ein solches Lokal als Gast zu betreten! Der Gedanke war abwegig, auch wenn es sie insgeheim wurmte, dass sie nicht die gleichen Rechte wie die Weißen besaß.
Der Begleiter der jungen Frau grinste. »Keine Angst, Honigschnute, die beiden arbeiten bestimmt nur hier. Vielleicht putzen sie.«
»Ach so. Du hast recht.« Die Gruppe lachte und polterte durch den Haupteingang.
Josephine stampfte hinter Ethel, die lediglich die Achseln zuckte, durch die Tür fürs Personal. Missmutig folgte sie ihrer Freundin in die Garderobe, in der sich bereits einige andere Tänzerinnen ihrer Truppe auf den Auftritt vorbereiteten, und setzte sich auf ihren üblichen Platz. Im Geiste ging sie mögliche deftige Antworten durch, die sie der blonden Frau hätte geben können, doch diese hätten nur zu einem Jobverlust geführt, das war ihr klar.
Mit hektischen Handbewegungen trug sie weißen Puder auf und klopfte ihn in ihre Gesichtshaut.
»Der Puder macht auch keine Weiße aus dir«, meinte Ethel amüsiert.
Josephine stellte die Puderdose so unsanft auf den Tisch, dass es nur so stäubte, und begann, Pomade in ihr kurzes schwarzes Haar einzuarbeiten, sodass es glatt an ihrem Kopf anlag. »Ich will auch gar nicht weiß sein. Aber etwas Respekt für uns wäre schön.«
Bessie, eine der anderen Tänzerinnen, die gerade in ihr knappes Bühnenkostüm schlüpfte, stieß einen erheiterten Laut aus. »Träum weiter, Kindchen.«
Josephine verdrehte die Augen. »Pass bloß auf, vielleicht wird mein Traum eines Tages Wirklichkeit. Was weißt du schon?«
»Nicht streiten, Mädels«, forderte Ethel sie auf, während sie sich die Wimpern schwarz tuschte. »Manche Dinge sind einfach, wie sie sind. Aber mal was ganz anderes: Denkt ihr bitte alle daran, nach der Show nicht einfach zu verschwinden? Der Boss hat uns angewiesen, uns alle noch mal in der Garderobe zu versammeln. Wir bekommen hohen Besuch.«
»Wer das wohl sein mag?« Josephine zupfte ihr leichtes Bühnenkostüm zurecht, das reichlich nackte Haut zeigte. Ihr machte das nichts aus, sie mochte es, wenn die Aufmerksamkeit des Publikums bewundernd auf ihren schimmernden, schlanken Beinen lag.
In diesem Moment erschien der Klubbesitzer George in der Tür, dem mafiöse Verbindungen nachgesagt wurden – was in dieser Branche nicht unüblich war –, und winkte die Tänzerinnen hektisch herbei. »Auf was wartet ihr, um Himmels willen? Ihr seid dran, das Publikum wird langsam ungeduldig. Ihr sitzt seelenruhig hier herum und schwatzt!«
»Reg dich ab, die Leute haben schließlich Geld bezahlt, um uns zu sehen.« Ungerührt ordnete Ethel die seidenen Bahnen ihres Kleides. »Dann werden sie es auch verkraften, ein paar Minuten zu warten.«
George knirschte mit den Zähnen, und Josephine kicherte in sich hinein. Wie immer war sie die Letzte in der Reihe der Revuegirls, die die Bühne betrat. Blendend helle Scheinwerfer richteten sich auf sie und die anderen Mädchen, sodass sie das elegante Interieur des Plantation Club mehr erahnen konnte, als dass sie etwas sah. Kellner im Smoking huschten mit voll beladenen Tabletts zwischen den mit edlen, weißen Tüchern gedeckten Tischen umher und versorgten das Publikum mit Getränken und Speisen.
Ethel begann zu singen, ihre dunkle, samtene Stimme erfüllte den Raum. Sofort erstarben sämtliche Gespräche an den Tischen, und die Zuhörer lauschten gebannt. Im Hintergrund tanzten die Revuegirls, schwangen im Rhythmus der Musik die Arme, ließen die Hüften kreisen und drehten die Knie abwechselnd nach innen und außen. Sinnlichkeit und Erotik hingen wie eine die Köpfe des Publikums vernebelnde schwere Wolke im Raum.
Josephine hatte darüber hinaus noch eine ganz besondere Rolle in der Truppe inne: die der Ulknudel. Ihre Position war stets am rechten Ende der aufgereihten Mädchen, wo ihre einstudierten Albernheiten nicht zu übersehen waren. Als Ethel ihr Lied beendet hatte und sich in die Tanzenden einreihte, die in rasantem Tempo den Charleston darboten, zog Josephine Fratzen, streckte dem Publikum die Zunge heraus, schielte lustig und stolperte hinter den anderen Mädchen her. Wie jedes Mal tobte das Publikum vor Begeisterung, quittierte ihre Darbietung mit Getrampel und ausgelassenem Gelächter. Josephine sog den Beifall auf wie süßen Nektar – hier auf der Bühne konnte sie sein, wie sie wirklich war, hier konnte sie zeigen, was in ihr steckte. Draußen auf der Straße war sie nichts weiter als eine unerwünschte Schwarze, die von den Weißen als wertlos und schmutzig angesehen, oft sogar beschimpft wurde. Bereits als kleines Mädchen, als sie in Großmutters alten Roben und Hüten für die Nachbarschaft aufgetreten war, wusste sie, dass dies ihr vorgezeichneter Weg war. Sie war geboren, um zu tanzen.
Nach der Show verließ sie trunken vom Beifall die Bühne und folgte Ethel und den anderen Tänzerinnen durch den düsteren Flur in Richtung der Garderobe. Im Schatten einer Tür lehnte ein weißer Gast, rauchte eine Zigarre und taxierte sie durch den dichten Qualm hindurch. Josephine spürte, wie seine Augen über ihren Körper hinwegglitten. Dann wandte er sich abrupt ab, murmelte, die Zigarre zwischen den Zähnen: »Negerschlampe«, und ging in den Gastraum zurück.
Mit trotzig erhobenem Kinn betrat sie die Garderobe und begann, sich mit unsanften Bewegungen abzuschminken. Mit Männern hatte sie bisher keine allzu guten Erfahrungen gemacht. Kurz wanderten ihre Gedanken zu den beiden männlichen Exemplaren zurück, die in ihrer Vergangenheit eine Rolle gespielt hatten. Trotz ihrer zarten neunzehn Jahre war sie bereits zweimal verheiratet gewesen. Mit dreizehn hatte sie den fast gleichaltrigen Willie Wells geheiratet. Ihre Mutter Carrie hatte der Verbindung zugestimmt, weil sie insgeheim auf bessere Lebensbedingungen für sie gehofft hatte; die kurze Ehe – die illegal gewesen war, da auch in Missouri Kinderehen verboten waren – endete mit einem gewaltigen Streit zwischen den beiden Halbwüchsigen, woraufhin Willie auf Nimmerwiedersehen verschwunden war. Mit fünfzehn hatte sie den Eisenbahnangestellten Willie Baker geehelicht, ihn aber bald verlassen, um nach New York zu gehen und es hier auf die Bühne zu schaffen. Von Willie war ihr nichts geblieben außer dem Nachnamen – Baker. Sie hatte ihre Ex-Ehemänner noch keinen einzigen Tag vermisst. Die Rolle der zurückhaltenden Hausfrau hatte sie nicht interessiert.
Sie schreckte aus ihren Gedanken auf, als Klubbesitzer George in die Mitte der Mädchen trat und in die Hände klatschte. Mit einem Mal herrschte Stille unter den Mädchen, und alle beobachteten neugierig die teuer gekleidete Weiße, die hinter ihm stand. In ihrem schwarzen Abendkleid mit kostbaren Perlen um den Hals strahlte sie eine natürliche Eleganz aus. Das musste der angekündigte hohe Besuch sein, schoss es Josephine durch den Kopf. Was wollte die so selbstbewusst wirkende Brünette, die wohl Mitte dreißig sein musste, inmitten der schwarzen Revuemädchen? Ihre Haut war zart und hell wie eine Perle.
»Mädchen«, verkündete George und klatschte nochmals in die Hände. »Darf ich euch unseren Gast vorstellen? Das ist die von mir überaus geschätzte Mrs Caroline Regan! Sie ist eine bekannte Förderin der Künste und verkehrt in den besten Häusern New Yorks! Und sie hat ein überaus verlockendes Angebot in der Tasche!«
Mrs Regans Lippen zuckten erheitert angesichts dieser euphorischen Worte. Josephine und die anderen Tänzerinnen musterten sie neugierig. Was verschlug diese offenbar gut situierte Frau in die stickige Garderobe des Plantation Club?
»Guten Abend, die Damen«, ergriff Caroline Regan leichthin das Wort. »Oder sollte ich besser Guten Morgen sagen, hinsichtlich der fortgeschrittenen Stunde? Ich habe mir mit meinem Mann die Show angesehen – und zwar nicht zum ersten Mal. Ihre Darbietung war wie immer grandios.«
Josephine spähte verstohlen auf die Uhr und gähnte verhalten. Es war drei Uhr in der Nacht. Hoffentlich kam diese Mrs Regan bald auf den Punkt, sie sehnte sich nach ihrem Bett.
»Mein Mann – er wartet draußen in unserer Limousine – ist als Handelsattaché in der amerikanischen Botschaft in Paris angestellt. Momentan verbringen wir unseren Urlaub zu Hause, doch wir brechen bald wieder nach Frankreich auf.« Während Caroline Regan sprach, ließ sie ihren Blick über die Tänzerinnen gleiten, so als wolle sie sie abschätzen. Diesen sah man zunehmend ihre Erschöpfung an. Ethel konnte sich kaum noch aufrecht halten und war auf ihrem Hocker zusammengesunken.
»Lange Rede, kurzer Sinn. Die Winter in Paris können schrecklich lang sein, wenn sich der eigene Ehemann vor lauter Arbeit kaum noch zu Hause aufhält. Deshalb habe ich mir ein Projekt in den Kopf gesetzt: Ich möchte in Paris eine schwarze Revue auf die Beine stellen. Die Revue Nègre! Ich liebe alles Dunkle, Exotische! Ein passendes Theater für die Vorführungen habe ich bereits gefunden. Mir fehlen nur noch schwarze Tänzerinnen! Tänzerinnen wie Sie!«
Mit einem Schlag schien alle Müdigkeit aus den Gesichtern der Revuegirls gewichen. Interessiert hingen sie an den Lippen der Mäzenin.
»Meine Güte!«, flüsterte Ethel beeindruckt. »Das ist ja mal ’ne Nummer.«
Caroline Regan lächelte, während sie einen Moment lang Josephine ansah. Sie hatte gemischte Gefühle. Eine Revue, in Paris? Wo lag Frankreich überhaupt genau? Sie war zu früh von der Schule abgegangen, um geografische Grundkenntnisse gewonnen zu haben, war sich aber sicher, dass Paris am anderen Ende der Welt lag.
»Das ist eine einzigartige Chance, Mädels«, ermunterte George die Gruppe. »Macht euch um den Klub keine Sorgen. Ich kann ein paar Monate ohne euch auskommen, an meiner Tür stehen jeden Tag neue Tänzerinnen Schlange und suchen ein Engagement.«
Caroline Regan ging ein paar Schritte durch den Raum und blieb vor Ethel stehen. »Sie singen die Soli, nicht wahr? Ihre Stimme ist wundervoll. Wie heißen Sie?«
»Ethel.«
»Ethel. Ich möchte Sie auf jeden Fall in Paris dabeihaben. Sie dürfen weiterhin die Solonummern singen.«
Aufgeregt verfolgten die restlichen jungen Frauen den Wortwechsel. Ethel bemühte sich sichtlich um ein Pokerface und fragte gelassen: »Wie viel springt dabei für mich heraus?«
»Dreihundert Dollar pro Woche.«
»Fünfhundert, und ich bin dabei.«
Josephine stockte der Atem über Ethels Kühnheit. Zwar war ihre Freundin im Plantation Club eine angesehene und beliebte Sängerin, aber stand es ihr zu, derart ungeniert Forderungen zu stellen?
Caroline Regan blieb genauso liebenswürdig wie zuvor. »So viel kann ich nicht zahlen, es tut mir leid, Ethel. Fünfhundert Dollar sprengen mein Budget.«
»Fein.« Ethel drehte der Besucherin den Rücken zu und fuhr in aller Seelenruhe fort, sich abzuschminken. Im Raum war nicht das leiseste Geräusch zu hören.
»Nun gut.« Mrs Regan wandte sich Josephine zu, die auf einmal ganz klamme Hände bekam. »Es hat mir gefallen, wie Sie den Clown gespielt haben …«
»Josephine.«
»Josephine. Ihr Auftritt war lustig und hat das Publikum begeistert. Ihre komödiantische Art kommt bestimmt auch in Paris gut an. Was meinen Sie?«
»Ich …« Ein Sturm verschiedenster Gedanken wirbelte durch Josephines Kopf. Offenbar war Frankreich sehr weit weg, und sie konnte kein Wort Französisch! Wie sollte sie da mit ihren neunzehn Jahren allein zurechtkommen? Sie würde noch weiter von ihrer Familie in St. Louis weg sein, als sie es jetzt schon war.
»Ich könnte Ihnen einhundertfünfzig Dollar die Woche zahlen«, schlug die Besucherin vor.
Noch immer sprudelten die Gedanken wild durch ihren Kopf. Sollte sie es wagen?
Caroline Regan schien ihr Zögern auf ihre Art zu interpretieren. »Na gut. Zweihundertfünfzig pro Woche, aber das ist das Ende der Fahnenstange. Einverstanden?«
»Einverstanden«, murmelte Josephine überrumpelt. Zweihundertfünfzig Dollar! Sie würde ihrer Mutter einen größeren Betrag schicken können als im Moment.
»Sie werden Frankreich lieben«, sagte Mrs Regan warm, bevor sie sich dem nächsten Mädchen zuwandte. »In Frankreich ist es ganz anders als hier in Amerika. Die Menschen sind viel offener und freier. Da interessiert es wenig, ob man weiß oder schwarz ist. Die Franzosen werden Sie herzlich willkommen heißen.«
Ganz langsam begriff Josephine, was dies für sie bedeuten könnte. In Frankreich würde sie frei sein, freier als in Amerika. Anscheinend schauten die Franzosen niemanden schief an, nur weil er eine dunkle Hautfarbe hatte. So ganz vermochte sie Caroline Regans Worten noch nicht zu glauben, aber sie war bereit, das Wagnis einzugehen.
»Wann ist die Abreise?«, fragte sie heiser.
»Willkommen in meiner Truppe, Josephine. In zehn Tagen legt unser Schiff ab.« Zufrieden wandte sich Mrs Regan den restlichen Mädchen zu. »Wer möchte noch Paris kennenlernen?«
Mit einer bunt zusammengewürfelten Schar aus fünfundzwanzig Tänzerinnen und Tänzern verließ die »Berengaria« zehn Tage später den Hafen von New York in Richtung Europa. Josephine stand mit Bessie, ihrer Mitstreiterin aus dem Plantation Club, und dem Tänzer Joe Alex, mit dem sie sich in Paris die Bühne teilen sollte, an Deck und zog sich ihr Umschlagtuch aus grober Baumwolle enger um die Schultern. Nicht nur die herbstliche Kühle und der scharfe Wind, der über das Wasser pfiff, verursachten ihr Gänsehaut, sondern auch die grün aufragende Freiheitsstatue. Majestätisch zog das riesige Passagierschiff daran vorüber. Josephine starrte das berühmte Monument gebannt an, dann wandte sie abrupt das Gesicht ab.
»Was nützt einem die Freiheitsstatue, wenn man als Schwarze nicht wirklich frei ist in diesem Land? Wenn mir die Türen der meisten Restaurants, Hotels und Geschäfte verschlossen bleiben, weil ich die Weißen nicht mit meinem dunklen Gesicht belästigen darf?«
Bessie versuchte, ihren Hut auf dem Kopf zu behalten, den eine Windbö in die Luft zu heben drohte, und legte Josephine ihre freie Hand auf den Arm. »Ich bin mir nicht sicher, ob man Mrs Regans Worten Glauben schenken darf, dass in Frankreich alles besser ist. Vielleicht war Ethels Entscheidung, in New York zu bleiben, die vernünftigere.«
»Wenn man nur immer im Voraus wüsste, was sich als richtig oder falsch erweisen wird«, murmelte Josephine. Einen Moment lang dachte sie an Ethel zurück. Der Abschied von der Kameradin und Zimmernachbarin war ihr nicht leichtgefallen.
Joe lehnte sich lässig an die Reling. »Bald werden wir selbst herausfinden, ob an ihren Worten was Wahres ist. Wie sieht’s aus, Mädels, wollen wir uns mal unsere bescheidenen Unterkünfte ansehen?«
Bevor Josephine ihm und Bessie auf das Zwischendeck folgte, wo sie untergebracht waren, schaute sie noch ein letztes Mal zum Festland, das sich langsam entfernte. Bald würde das Schiff nur noch von grauem Wasser und dem wolkenverhangenen Himmel umgeben sein, und Amerika würde zu einem Stück Vergangenheit verblassen, zu einer Erinnerung, die einen schalen Geschmack hinterließ.
2
September 1925
Da die »Berengaria« ein amerikanisches Schiff war, wurden die Passagiere an Bord strikt nach Hautfarbe getrennt. Caroline Regan und ihr Gatte bewohnten eine luxuriöse Suite mit Meerblick auf dem Oberdeck, während die ausnahmslos schwarzen Tänzerinnen im Zwischendeck, in das kein Funken Tageslicht hereindrang, in engen Kabinen zusammengepfercht waren. Josephine war während der gesamten Überfahrt übel von der stickigen Luft, und nachdem sie bei einem Rundgang verstohlen die Rettungsboote gezählt und festgestellt hatte, dass sie niemals für alle Passagiere reichen würden, plagten sie jede Nacht Albträume. Man brauchte nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass die wenigen Rettungsboote ausschließlich weißen Reisenden vorbehalten sein würden; diese Gewissheit ließ sie im Schlaf schreckliche Bilder von untergehenden Schiffen sehen, und ihr war, als hörte sie die Todesschreie von Ertrinkenden.
Außerhalb der Proben für die Revue Nègre, die Caroline Regan tagsüber auf dem Schiff abhielt, kauerte Josephine sich in ihrer Kabine auf dem schmalen Bett zusammen, schob die staubige graue Decke ans Fußende und las im trüben Licht in der abgenutzten Lesefibel aus ihrer Schulzeit. Unermüdlich fuhr ihr Zeigefinger an den Buchstaben und einfachen Wörtern entlang, während sie versuchte, sich die Schreibweise einzuprägen.
»Josephine!« Wie ein Wirbelwind stürmte Bessie, mit der sie ihr Lager teilte, herein.
Blitzschnell ließ Josephine die Fibel unter der mottenzerfressenen Decke verschwinden; niemand sollte sehen, mit was sie sich beschäftigte, denn es war ihr peinlich, dass ihre Schulbildung solche Lücken hatte. »Josephine! Das französische Festland ist in Sicht! Hast du gehört? Man kann Frankreich schon sehen!«
Josephine sprang von ihrem Bett auf. »Wirklich? Gott sei Dank habe ich alles gepackt.«
Bessie lachte. »Na ja, es dauert schon noch ein bisschen, das Schiff legt nicht gleich in den nächsten fünf Minuten an.«
Einige Stunden später bewegte sich die fünfundzwanzigköpfige Tänzerschar wie Entenküken hinter Caroline Regan und ihrem Gatten die Gangway herunter. Es war inzwischen Ende September, und die Luft roch herbstlich frisch. Möwen zogen schreiend ihre Kreise über dem normannischen Hafen. Josephine und Bessie sahen sich um und konnten kaum glauben, dass sie endlich in Frankreich waren. Sie fühlten sich nur schwer imstande, die vielen neuen Eindrücke und französischen Satzfetzen, die sie an jeder Ecke hörten, in sich aufzunehmen. Caroline Regan hatte für alle Taxis organisiert, die sie zum Bahnhof bringen sollten, von wo aus sie nach Paris weiterreisen würden.
»Taxis!«, flüsterte Josephine Bessie zu, während sie sich auf die Rückbank eines Wagens schoben. Es war das erste Mal überhaupt, dass sie in einem Auto fuhr. »Ich glaub, ich bin gestorben und im Himmel gelandet!«
Der Taxifahrer drehte sich zu ihnen um, schob seine Mütze höher und grinste sie an. »Mesdemoiselles …«
Als er ihnen noch zuzwinkerte, brach Bessie in albernes Gekicher aus, doch ein Rippenstoß von Josephine ließ sie verstummen. »Benimm dich nicht wie ein Schulmädchen.«
Doch auch sie war überwältigt, ja fassungslos. Sie, die sich in den USA nicht einmal auf eine Parkbank setzen durfte, an der ein Schild »Whites Only« prangte, wurde in Frankreich wie eine Königin im Taxi umhergefahren!
Es warteten an diesem Tag noch mehr Überraschungen auf sie. In Paris angekommen, hatte Mrs Regan für die ganze Gruppe Zimmer in einem Hotel reserviert. Als Josephine die Unterkunft, die sie sich mit Bessie teilen würde, betrat, war sie zum ersten Mal in ihrem Leben sprachlos. Es war ihr nicht leichtgefallen, das Hotel überhaupt zu betreten – in Amerika wäre sie als Schwarze sofort unsanft hinausbefördert worden –, aber die zwei Betten mit der weißen weichen Bettwäsche, die luftigen Gardinen vor den hohen Fenstern und die zierlichen Schränke jagten ihr einen Moment lang richtiggehend Angst ein. Angst, dass dieser Luxus sich als Traum entpuppen könnte, aus dem sie jeden Moment aufwachen würde.
Bessie, die ihren Koffer achtlos auf den Teppich geworfen hatte, begriff schneller, welche unerwartete Pracht sich ihnen darbot. »Himmlisch, Josie! Wir werden leben wie Gott in Frankreich! Zum Glück haben wir Mrs Regans Angebot ohne zu zögern angenommen. Wenn Ethel wüsste, was ihr hier entgeht.« Wie ein Wirbelsturm rotierte Bessie durch das Zimmer, und nachdem sie alle Schubladen inspiziert hatte, riss sie eine weiß gestrichene Tür auf, die zu einer angrenzenden Kammer führte.
»Ein Badezimmer!«, erklang ihr begeistertes Kreischen. »Eine Badewanne! Ich glaub’s nicht.«
Josephine folgte ihr neugierig. Beim Anblick der gusseisernen Badewanne drängten sich ihr Erinnerungen an ihre Kindheit in Missouri auf. Einmal wöchentlich – meistens samstags – hatte ihre Mutter Carrie in allen Töpfen, die sie besaßen, Wasser erhitzt, um es in den hölzernen Waschzuber zu gießen, den ihr Stiefvater Arthur in die Küche wuchtete. Allein das Erwärmen des Wassers hatte Stunden gedauert. Zuerst durften die Eltern darin baden, danach die jüngeren Geschwister und zu guter Letzt Josephine. Als ältestes Kind musste sie am längsten warten, was sie immer geärgert hatte.
Als sie nun ihre Hand über das kühle Metall der Badewanne gleiten ließ, gedankenversunken und andächtig, überkam sie immer mehr das diffuse Gefühl, es in ihrem kurzen Leben zu etwas gebracht zu haben. Sie durfte in Paris, einer sagenumwobenen europäischen Stadt, in einem luxuriösen Hotel wohnen, hatte ein Badezimmer zur Verfügung und ein bequemes Bett, das sie mit niemandem teilen musste. Noch dazu verdiente sie zweihundertfünfzig Dollar die Woche mit einer Arbeit, die sie liebte. Tanzen war ihr Leben.
So langsam dämmerte ihr, welch ein Glückspilz sie war, und in ihrem plötzlich wiederkehrenden jugendlichen Übermut sprang sie auf ihr Bett, dass die Federn nur so quietschten.
Zusammen mit Bessie brach sie in albernes Gekicher aus. Die Freundin ergriff eines der dicken Kissen und schleuderte es auf sie, und im Nu war eine ausgelassene Kissenschlacht im Gange.
»Wir werden leben wie zwei Prinzessinnen«, keuchte Josephine, als sie erneut ein Kissen mitten ins Gesicht traf.
»Und ob!«, quiekte Bessie. »Ich werde das Hotel nie wieder verlassen.«
Die Kissen flogen, bis es laut an die Tür klopfte. Erschrocken hielten beide inne. Die Furcht, wegen des Lärms vom Hotelpersonal in die Schranken gewiesen und hinausgeworfen zu werden, lähmte sie.
Schließlich kroch Josephine vom Bett und öffnete die Tür vorsichtig einen Spaltbreit. »Ach, du bist es nur, Joe«, murmelte sie erleichtert.
Ihr designierter Tanzpartner musterte die zerwühlten Bettdecken und die Kissen, die im ganzen Hotelzimmer verstreut lagen. »Manche Leute wissen, wie man sich amüsiert«, sagte er süffisant. »Ihr schreit das ganze Hotel zusammen, aber das scheint hier in Frankreich niemanden zu stören. Wie zwei Vögel, die zum ersten Mal das Nest verlassen haben.«
»Das sind wir ja auch!«, entgegnete Josephine, nur mühsam das Lachen unterdrückend, während Bessie erneut haltlos loskicherte.
Joe verdrehte die Augen. »Ihr solltet herunterkommen. Unten im Salon gibt es eine Stärkung, und danach geht’s ab ins Theater zur ersten Probe. Also los, schält euch aus den Decken.«
Eilig ordneten sich Josephine und Bessie ihre zerzausten Haare und zogen ihre Kleider zurecht, um Joe nach unten zu folgen. Und wieder wähnte sich Josephine wie in einem Film. Im Salon saß bereits ein Großteil der anderen Tänzerinnen an gedeckten Tischen und trank Kaffee aus zierlichen Porzellantassen. Auf silbernen Platten befanden sich köstliche Kuchenstücke.
Auf der Türschwelle blieb Josephine stehen, ihre Füße schienen wie festgewachsen. Joe gab ihr einen Stoß in die Seite. »Na los, worauf wartest du?«
»Aber …« Hilflos sah Josephine sich um, fast als rechnete sie damit, auf der Stelle von einem Ober des Raumes verwiesen zu werden. In Amerika wäre sie verjagt worden, sobald sie zu lange vor der Schaufensterscheibe eines edlen Cafés das bunte Gebäck betrachtet hätte. Da tauchte Mrs Regans wohlwollendes Gesicht vor ihr auf. Sie berührte Josephine am Arm und machte eine einladende Geste. »Kommen Sie nur herein, keine Scheu. Ich sehe Ihnen an, dass Sie gedanklich noch in Amerika sind. Machen Sie sich von allen Fesseln frei, die Sie zu Hause eingeengt haben.«
»Ja«, stammelte Josephine, »ich versuche es, aber es ist alles so ungewohnt für mich … In Amerika wäre es ein Skandal, wenn Schwarze in einem Hotel wohnen und ungeniert Kuchen essen würden …«
»Hier in Frankreich ist alles anders«, beruhigte Caroline Regan sie. »Die Franzosen sind ein lockeres, offenes Volk. Haben Sie schon einmal von dem Motto gehört, das von der Französischen Revolution herrührt? Liberté, Egalité, Fraternité.«
»Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit«, murmelte Joe, der dem Gespräch ebenfalls interessiert lauschte.
Caroline Regan schmunzelte. »Und nun ran ans Kuchenbuffet. Die Tarte aux pommes ist köstlich.«
Am späten Nachmittag begab sich die Gruppe erstmals zum Théâtre des Champs-Élysées in der Avenue Montaigne, wo die Revue Nègre in zehn Tagen ihre Premiere haben sollte. Die Straße wirkte prachtvoll, trotz des Regens, der lautlos auf die Erde fiel und die Verkehrsgeräusche der Automobile dämpfte. Caroline Regan wies die Tänzerinnen und Tänzer auf die mit weißem Marmor verblendete Fassade des Theaters hin, die trotz des regnerischen Wetters und des grau verhangenen Himmels aussah wie aus feinem Zucker. Hoch über ihren Köpfen befanden sich wunderschöne Statuen von halb nackten Männern und Frauen, mit Blättern umrankt. Die Gruppe staunte wie kleine Kinder, die in einem fernen Traumland gelandet waren – was für sie ja auch irgendwie der Wahrheit entsprach.
»Das ist schon ’ne andere Nummer als der gute alte Plantation Club in Harlem, was?«, flüsterte Josephine Bessie zu, die verzückt nach oben starrte, um jedes Detail ihres künftigen Arbeitsplatzes in sich aufzunehmen.
»Das ist wohl wahr, Josie. Obwohl das Plantation auf seine Art auch wirklich elegant ist.«
Auch das Innere des Theaters war beeindruckend. Eine prachtvolle Kuppel spannte sich über ihre Köpfe, und überall standen vergoldete Skulpturen. Mrs Regan ließ ihnen etwas Zeit, sich umzusehen, dann führte sie die Truppe in einen der großen Säle, wo sie bereits ein weißer dunkelhaariger Mann erwartete. Er war leger gekleidet und trug Gymnastikschuhe, so als wolle er gleich auf die Bühne springen und anfangen zu tanzen. Neugierig musterte er jedes einzelne Mitglied der Tanzgruppe und bedeutete ihnen, sich auf den blank gewienerten Boden der Bühne zu setzen.
»Bonjour, bonjour, mes chères danseuses et mes chers danseurs«, begann der Mann enthusiastisch. »Je suis si heureux que …«
Josephine starrte ihn nur verständnislos an, natürlich verstand sie kein einziges Wort Französisch. Auch den anderen waren Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Mrs Regan unterbrach den Wortschwall des Franzosen heiter. »Ich bin so frei und übernehme: Das ist Jacques Charles, euer Choreograf für die nächsten Wochen. Jacques ist sehr erfahren! Er hat unter anderem am viel beschworenen Moulin Rouge gearbeitet. Ich denke, zusammen mit Jacques werden wir eine grandiose Show auf die Beine stellen.«
Jacques hatte während ihrer Worte lebhaft genickt. »Exactement, ma chère Caroline. Bevor wir anfangen, die Regeln«, begann er mit starkem Akzent. »Ich erwarte totale Ergebenheit! Bedingungslosen Gehorsam! Keine Albernheiten! C’est clair?«
Josephine konnte nur mit Mühe ein Kichern unterdrücken, der Choreograf erschien ihr allzu komisch. »Haben Sie verstanden?«, donnerte er plötzlich, direkt vor ihr stehend.
Sie beeilte sich, beflissen zu nicken.
Caroline Regan verabschiedete sich, und Jacques teilte das Ensemble in mehrere Kleingruppen auf, die nacheinander Anweisungen erhielten und zum ersten Mal zusammen tanzen sollten. Josephine und Joe Alex sollten den Anfang machen. Mit baumelnden Beinen saßen sie auf dem Bühnenrand und versuchten, sich auf Jacques’ französisch-englischen Redeschwall zu konzentrieren. Der Choreograf wandte sich ihnen zu: »Sie spielen die Lustige, nicht wahr?«
Josephine zuckte die Achseln. »Ja schon, in Harlem war ich immer die Drollige am Ende der Reihe, die Fratzen geschnitten hat und alle zum Lachen brachte. Aber auf Dauer würde ich viel lieber singen, Monsieur … Meinen Sie, das geht? Könnte ich nicht nur tanzen, sondern auch singen?«
Josephine hörte, wie Joe an ihrer Seite scharf die Luft einsog, während der Choreograf sie anstarrte, als habe sie den Verstand verloren. »Mademoiselle Bakaire …«, begann er mit hochgezogenen Augenbrauen. »So heißen Sie doch, oder? Ich muss sagen, Ihr Wunsch ist schon ein bisschen ungeheuerlich. Für den Gesang haben wir la très belle Mademoiselle Maud de Forest – sie wird nachher zu uns stoßen. Eine begnadete Solokünstlerin. Sie dagegen sind … wie soll ich sagen? Der Clown.«
Josephine seufzte. »Na gut. Einen Versuch war es wert.«
Jacques wedelte unwirsch mit den Händen, so als sei er der Meinung, genug Zeit mit Unwichtigem verschwendet zu haben. »Mademoiselle Bakaire, Monsieur Alex – Ihr Part wird der Danse Sauvage sein. Der wilde Tanz.« Er drehte sich im Kreis, vollführte auf lasziv langsame sinnliche Art einige Tanzbewegungen, bis er schließlich mit einem katzenhaften Sprung wieder vor den beiden landete.
»Sehr exzentrisch«, bemerkte Joe. Josephine hörte die Ratlosigkeit, die aus seinen Worten sprach; wie sie konnte er mit dieser Art von Tanz nicht allzu viel anfangen.
»Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Das französische Publikum liebt das Exotische, wissen Sie?« Jacques wandte sich ab und wühlte in einer schweren Holzkiste, in der sich die Bühnenkostüme befanden. »Ich habe schon mal die Kostüme besorgt. Monsieur Alex – voilà.« Er reichte dem Tänzer nichts weiter als ein mit Federn geschmücktes Leinentuch. »Um die Hüften binden, genau. Die übrige Kleidung muss natürlich weg.«
Joe schlang sich das Tuch um und sah an sich herunter, als versuche er, sich vorzustellen, wie er gänzlich ohne Kleidung, nur mit dem Federtuch geschmückt, aussehen würde.
»Mademoiselle …« Jacques gab Josephine ein knappes Höschen, das kaum ihre Pobacken bedeckte und an dem Federn in schrillem Pink festgenäht waren.
Mit spitzen Fingern hielt sie das Teil in der Hand. »Ist das alles?«
Jacques nickte. »C’est tout.«
Hinter Josephines gerunzelter Stirn braute sich ein Sturm zusammen. Zunächst war sie sich nicht sicher, ob der Choreograf sie nicht veralbern wollte. Ein derart dürftiges Unterteil … Gab es ein Oberteil? Doch an seinem ernsten Ausdruck erkannte sie, dass sie wirklich dermaßen leicht bekleidet auftreten sollte. Ganz Paris würde ihren blanken Busen sehen! Doch das würde sie nicht mit sich machen lassen. Zwar war sie auch in New York alles andere als züchtig bekleidet aufgetreten, aber das hier war noch einmal etwas ganz anderes. Sie wäre praktisch nackt.
Hitze stieg ihr in den Kopf. Mit zitternden Lippen schleuderte sie das knappe Höschen auf den Boden, dass sich die rosa Federn aufstellten. »Das können Sie vergessen, Mr Charles. Nicht mit mir. Ich trete nicht splitternackt vor Hunderten oder Tausenden Zuschauern auf. Meine Mutter würde der Schlag treffen, wenn sie das wüsste.«
Sie spürte, wie Joe neben ihr nervös mit den Füßen scharrte, aber das war ihr egal.
»Ganz schön vorlaut, Mademoiselle«, murrte Jacques und sah sie missbilligend an. »Haben Sie vorhin nicht zugehört? Ich verlange Gehorsam von meinen Tänzern! Absolut und bedingungslos! Wenn ich mich ständig auf irgendwelche albernen Diskussionen einlasse, bringe ich nie eine Show zustande!«
»Ich mach das aber nicht«, murmelte Josephine und wandte sich ab, damit niemand die Tränen sah, die ihr vor lauter Frust in die Augen schossen. Halb nackt zu tanzen war eine abwegige Vorstellung für sie und noch dazu eine große Enttäuschung. Seit sie wusste, dass sie in einem altehrwürdigen Pariser Theater auftreten durfte, hatte sie insgeheim von wundervollen Roben aus Samt und Seide geträumt. Und nun das. Ihr ganzer Traum drohte, in sich zusammenzufallen wie ein Kartenhaus.
»Stell dich nicht so an«, raunte ihr Joe zu, doch sie verzog unwillig den Mund.
»Du hast gut reden. Deine wichtigen Teile sind durch das Tuch verhüllt. Meine nicht.«
»Also?«, fragte Jacques ungeduldig und tippte mit dem Fuß auf. »Entscheiden Sie sich, Mademoiselle Bakaire. Wollen Sie hier auftreten oder nicht? Oder soll Madame Regan Ihnen ein Billet für das nächste Schiff nach Amerika besorgen?«
»Ich …« Frustration und Bitterkeit schnürten Josephine die Kehle zu, gepaart mit Hilflosigkeit. Was sollte sie tun? Ihren Traum an dieser Stelle für gescheitert erklären und wie ein geschlagenes Hündchen nach Hause zurückkehren in der Hoffnung, wieder einen Tanzpart im Plantation Club zu ergattern? »Ich werde auf keinen Fall nackt tanzen, da können Sie sich auf den Kopf stellen, ich …«
Ihr unübersehbares Elend schien den Choreografen zu erweichen. »Versuchen wir doch Folgendes«, schlug er vor. »Sie hören auf mich, ziehen das Federkostüm an, das Ihnen bestimmt hervorragend steht, und proben den Danse Sauvage mit Ihrem Partner. Am zweiten Oktober ist die Premiere. Ich verlange nur eine einzige Performance von Ihnen. Eine einzige, am zweiten Oktober. Wenn es Sie dann immer noch so anwidert, Ihre makellose Figur zu zeigen, fahren Sie nach Hause.«
Jacques hob das Federhöschen vom Boden auf und reichte es Josephine, was ihr wie ein Friedensangebot erschien. Seufzend ergriff sie den dünnen Stoff. Was blieb ihr auch anderes übrig? Sich weiterhin zu weigern, halb nackt aufzutreten, hieße, all ihre Hoffnungen wie die Scherben einer zersplitterten Blumenvase zusammenzukehren und in den Müll zu werfen. Sie war zu weit gekommen, um das zu riskieren.
»Der ganze Saal ist brechend voll«, flüsterte Bessie, die bereits vollständig für die Bühne zurechtgemacht war und heimlich durch die dicken samtenen Vorhänge spähte. »Unzählige Leute … Männer wie Frauen, und sie sehen alle aus, als ob sie zu einem Ball gingen oder zu einer Gala, Josie. Die Männer tragen Smoking und die Frauen die teuersten Kleider …«
»Komm sofort hinter dem Vorhang hervor!«, wies Jacques Bessie zurecht, während er mit langen, nervösen Schritten im dunklen Raum hinter der Bühne auf und ab ging.
Caroline Regan lächelte beruhigend. »Es wird schon alles schiefgehen. Ihr habt zehn Tage lang geprobt und euer Bestes gegeben. Hals- und Beinbruch!«
»Danke«, murmelte Joe nicht sehr überzeugt und nahm Josephine bei der Hand. In wenigen Minuten würde die bekannte Sängerin Maud de Forest in Gesellschaft der Hintergrundtänzerinnen singen, danach wären Joe und Josephine mit ihrem Danse Sauvage an der Reihe. Josephine versuchte, tief Luft zu holen, um ihren schnellen Puls zu beruhigen. Noch stand sie im Dunkeln. Würde sie es schaffen, unbefangen auf die Bühne zu treten und sich in ihrer ganzen Nacktheit zu präsentieren? Sie hatte sich so gut es ging herausgeputzt. Ihre schlanken Glieder hatte sie mit Öl eingerieben, um sie zum Schimmern zu bringen, und ihre kurzen schwarzen Haare lagen wie ein glänzender Helm um ihren Kopf.
Wie benebelt bekam Josephine mit, wie Maud und die Revuegirls auf die Bühne traten, um zu performen. Danach brandete tosender Beifall auf, Maud und die Mädchen zogen sich in die Garderobe zurück. Nun war es an ihr und Joe, ins gleißende Scheinwerferlicht der Bühne zu treten.
»Viel Glück, Josie«, hörte sie Bessie noch flüstern, sowie ein gepresstes »Bonne chance« von Jacques.
Wie in Zeitlupe kletterte sie auf Joes Rücken und schlang die Beine um ihn, damit er sie wie in den Proben auf die Bühne trug. Die Musik aus dem Hintergrund war hypnotisch, fesselnd und ließ das gebannte Publikum in absoluter Stille zurück. Sie spürte jedes einzelne Augenpaar auf ihrer Haut ruhen.
In der Mitte der Bühne ließ Joe sie von seinem Rücken gleiten, sie kam leichtfüßig auf dem Boden auf, und gemeinsam versanken sie in den wilden, sinnlichen Rhythmen ihres Tanzes. Sie bewegten in schnellen, harmonischen Bewegungen Arme und Beine, Hände und Füße, alles an ihnen wurde hin- und hergeschwungen, ein Feuer entfesselter Erotik. Später würde Jacques ihnen erzählen, dass ein fasziniertes Raunen durch das Publikum gegangen war, das dergleichen noch nie gesehen hatte, dass Worte wie »Sensationell!« und »Grandios!« gerufen wurden; doch von alledem bekam Josephine nichts mit, sie tanzte und tanzte, vollführte den Tanz ihres Lebens, genoss es, im Mittelpunkt des Saales zu stehen und den Bann zu spüren, unter dem die Zuschauer standen. Ihre Nacktheit war ihr völlig gleichgültig, ja, sie fragte sich, wieso sie sich anfangs so dagegen gesträubt hatte. Sie fühlte sich wie eine Raupe, die ihr Leben lang in einem Kokon geschlummert hatte, um in dieser Nacht zu feurigem Leben zu erwachen.
»Bravo! Bravissimo!«, jubelten am Ende der Darbietung die Zuschauer. Viele erhoben sich sogar von ihren Plätzen und gaben ihnen stehende Ovationen. Völlig überwältigt verbeugte sich Josephine an Joes Hand wieder und wieder und starrte in die begeisterte Menge. Sie konnte kaum glauben, dass sie, Josephine Baker, ein armes Mädchen aus Boxcar Town in St. Louis, in der Weltstadt Paris solche Begeisterungsstürme hervorrufen konnte. Aber in dieser Nacht, so schien es ihr, war alles möglich, heute wurden Träume wahr.
Auch ihre komödiantische Nummer, die später am Abend folgte, kam beim Publikum gut an. Die Zuschauer grölten und klatschten begeistert, als sie schielend über die Bühne stolperte, die Knie nach außen und innen verdrehte, als hätte sie abwechselnd O- und X-Beine. Als sie die Bühne endlich alle verließen und sich in der Garderobe versammelten, wurde jedem ein Glas mit Champagner in die Hände gedrückt.
Jacques wirbelte Josephine herum, sodass ihr Champagner in alle Richtungen spritzte, und küsste sie auf ihre Haare. »Was habe ich gesagt, Joséphine? Du bist grandios angekommen, und alle lieben dich! Dein Federkostüm war ein voller Erfolg!«
»Ja, du hattest recht«, rief Josephine lachend, die Arme um seinen Hals geschlungen.
»Und, wie sieht es nun aus?«, fragte der Choreograf und sah sie mit blitzenden Augen an. »Wir hatten ja einen Deal. Eine Performance, habe ich gesagt, und wenn du noch immer nicht glücklich bist, kannst du nach Amerika zurückreisen.«
Josephine sah strahlend in die Runde, alle Gesichter waren erwartungsvoll auf sie gerichtet. »Quatsch nicht so viel, Jacques, füll lieber mein Glas noch mal auf.« Ringsum erklangen Gelächter und Beifallsrufe.
Die Truppe feierte die ganze Nacht, erst in den Morgenstunden, als Paris, bleich und von herbstlichem Dunst umgeben, endlich zur Ruhe kam, kehrten sie ins Hotel zurück. Nach wenigen Stunden Schlaf kamen Josephine und Bessie zu Croissants und Kaffee in den Speisesaal, wo Mrs Regan sie bereits mit einem Stapel Morgenzeitungen erwartete. Auch ihr war die lange Nacht anzusehen.
»Wir haben hervorragende Kritiken«, berichtete sie, und ihre sonst so blasse, zarte Haut war rosig vor Glück. »Man lobt uns über den grünen Klee. Mauds Gesang war himmlisch, schreiben die Zeitungen, und dein Tanz, Josephine, umwerfend.«
Josephine, die sich ihren Teller mit Croissants und Butter beladen hatte, setzte sich zu ihr und einigen anderen Mädchen an den Tisch. »Was schreiben die Kritiker genau?«
Mrs Regan sah sie voller Stolz an. »Sie schreiben, dass du weit mehr bist als nur die Ulknudel, die über ihre eigenen Füße stolpert und Grimassen schneidet. Ein Kritiker schreibt sogar, dass du dich durch deinen Tanz zu jener Schwarzen Venus erhoben hast, die der berühmte französische Schriftsteller Baudelaire in seinen Gedichten beschreibt. Die Schwarze Venus ist ein hinreißendes, zauberhaftes Wesen. So wie du.«
Bessie gab Josephine einen liebevollen Stoß in die Seite. »Das hättest du dir vor Jahren, als du in St. Louis den reichen Leuten ihren Küchenboden geschrubbt hast, nicht träumen lassen, oder?«
Josephine nickte mit vollem Mund. »Wahrhaftig nicht, da hast du recht. Noch vor einigen Wochen wurde ich in Harlem als Negerschlampe bezeichnet, und nun bin ich so was wie ein Star …« Verwundert, so als könne sie es selbst nicht glauben, hielt sie beim Kauen inne, ihr Blick verlor sich in der Ferne. Doch dann holte diese Welle heißen Triumphes sie wieder ein, schlug wie eine alles verschlingende Woge über ihr zusammen und trug sie, verloren in Tagträumen, davon. Die Gewissheit, dass sie unbesiegbar war, dass sie alles schaffen konnte, was sie sich vornahm, ergriff Besitz von ihr. Paris hatte sie wohlwollend aufgenommen, und sie würde alles daransetzen, alle Chancen zu nutzen, die sich ihr boten.