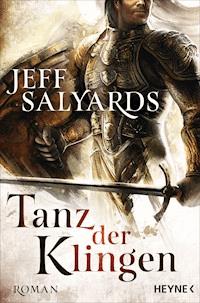13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Klingen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Captain Braylar Killcoin, der Anführer der berühmt-berüchtigten syldoonischen Söldnertruppe, ist ein Getriebener: Die Seelen der von ihm getöteten Männer verfolgen ihn ebenso wie die dunkle Magie, die ihm innewohnt. Doch es kommt für ihn noch schlimmer, als er mit seinen Männern an den Kaiserhof gerufen wird, um dem neuen Imperator Cynead die Treue zu schwören. Denn Cynead schmiedet seine ganz eigenen dunklen Pläne, und schon bald wird Braylar klar, dass das politische Parkett der Hauptstadt tödlicher ist als jedes Schlachtfeld …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 936
Ähnliche
Das Buch
Captain Braylar Killcoin, der Anführer der berühmt-berüchtigten syldoonischen Söldnertruppe, ist ein Getriebener: Tag für Tag suchen ihn die Seelen derjenigen heim, die er mit seiner mächtigen Waffe Blutrufer getötet hat. Die einzige, die ihn von seinem Fluch befreien könnte, ist seine Schwester Soffjian, eine mächtige Magierin – doch kann Braylar ihr wirklich vertrauen?
Eines Tages werden Braylar und seine Söldner nach Sonnenmatt, in die Hauptstadt des Reiches, zurückbeordert. Dort sollen sie dem neuen Kaiser Cynead, der die Macht mit unlauteren Mitteln an sich gerissen hat, die Treue schwören. Gleichzeitig schmiedet der abgesetzte Kaiser Thumaar einen Plan, um sich den Thron zurückzuholen. Einen Plan, für dessen Durchführung er Soffians und Braylars Hilfe benötigt. Und plötzlich ist Braylar, der kampferprobte Haudegen, mitten drin in einem Netz aus Lügen, Intrigen und Verrat. Ein Netz, das ihn das Leben kosten könnte …
Finstere Gestalten, dunkle Magie und ein packendes Abenteuer – mit Die Klinge des Königs setzt Jeff Salyards sein großes Fantasy-Epos fort.
Der Autor
Jeff Salyards wuchs in einem kleinen verschlafenen Ort nördlich von Chicago auf. Schon früh träumte er sich in laute und chaotische Welten voller unbezähmbarer Charaktere. Seine Faszination für die Fantastik hat er niemals verloren. Neben seinem Job bei der American Bar Association widmet er sich dem Schreiben fantastischer Abenteuer. Der Autor lebt mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in der Nähe von Chicago. Von Jeff Salyards ist bereits im Heyne Verlag erschienen: Tanz der Klingen.
JEFF SALYARDS
Die
Klinge
des
Königs
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
VEIL OF THE DESERTERS
Deutsche Übersetzung von Jürgen Langowski
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 01/2017
Redaktion: Rainer Michael Rahn
Copyright © 2014 by Jeff Salyards
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Umschlagillustration: Melanie Korte
Karte: William MacAusland
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-19082-8V003
www.heyne.de
Für Jane,die mich immer wie ihr eigen Fleischund Blut behandelt hat
1
Mein Ausflug zum Großen Jahrmarkt war von wundervollen Aromen, Düften und Anblicken begleitet gewesen. Der Rückweg zum Traurigen Hund fühlte sich dagegen an wie der Gang zum Schafott. Wenn man es recht bedachte, war der Vergleich gar nicht mal so falsch.
Auf dem Weg zum Basar hatte ich die kräftigen Düfte von Brot, Fleisch und Kochfeuern wahrgenommen. Auf dem Rückweg roch ich nur den Urin, nach dem die kleinen Gassen stanken. Anfangs war ich von der neu gefundenen Freiheit so begeistert gewesen, dass ich den abscheulichen Gestank überhaupt nicht wahrgenommen hatte. Federnden Schritts hatte ich den Syldooner verlassen und den Jahrmarkt erkundet. Auf dem Rückweg zum Traurigen Hund sah ich nur noch den Kot von Pferden und Hunden und schleimige Massen, die ich nicht näher bestimmen konnte. Obendrein war all das darauf aus, mir einen Schuh zu stehlen oder die Hose zu verschmutzen. Stinkender Treibsand, das war es.
Selbst die Gesichter und Stimmen veränderten sich. Auf dem Hinweg hatte ich Freude, Fröhlichkeit und Staunen gesehen, jetzt waren es die Gereiztheit eines Besuchers angesichts seiner stark erleichterten Börse, die Abscheu in der Miene eines Lehnsherren, dem die Untertanen im Gedränge unangenehm nahe kamen, die stumpfen Gesichter der Huren, die sich durch das Gedränge schoben und halbherzig versuchten, neue Freier in die Freudenhäuser zu locken, und hier und dort ertönte der schrille Schrei einer Mutter, die mit den ungehorsamen Kindern schimpfte.
Der Weg hin und zurück war der gleiche – in so kurzer Zeit hatte sich natürlich nicht viel verändert –, aber meine Stimmung und Wahrnehmung hätten kaum unterschiedlicher sein können. Es war erstaunlich, wie eine Kleinigkeit die Einstellung zur ganzen Welt derart ins Gegenteil verkehren konnte. Das zerschlagene Gesicht des jungen Hornmannes in der Menge, das gegenseitige Erkennen, seine blitzartige Flucht und die Einsicht, dass ich uns alle ins Verderben gestürzt hatte, als ich Braylar im Gras gebeten hatte, den Soldaten zu verschonen – es reichte aus, um mir den wunderschönen Tag zu verderben, und womöglich hatte ich auch dafür gesorgt, dass sowieso nicht mehr viele folgen würden, ob gute oder schlechte.
Es kostete mich viel Überwindung, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Jeder Schritt war schwerer als der vorige, ich hatte Angst, und mein Magen revoltierte und verkrampfte sich umso schlimmer, je näher ich meinem Ziel kam. Ich hatte mich entschlossen, zum Traurigen Hund zurückzukehren und dem Captain zu beichten, was ich gesehen hatte. Zweifellos würde er einen Wutanfall bekommen, dessen Ziel natürlich ich wäre. Das war durchaus verständlich. Aber die Alternativen waren noch unerquicklicher. Ich würde bestimmt nicht zum Baron laufen oder versuchen, aus Zechingen zu fliehen. Die Begegnung mit dem Captain würde nicht erfreulich verlaufen, aber die anderen Wege führten nur zu Schlimmerem. Ich dachte auch daran, überhaupt nichts zu sagen und so zu tun, als hätte ich den Hornmann nicht erkannt. Falls Braylar aber irgendwie herausfand, dass ich den Mann gesehen und geschwiegen hatte, so unwahrscheinlich dies auch sein mochte, würde mein Leichnam sehr bald zum gewaltigen Gestank in den Gassen beitragen.
Als ich mich dem Gasthof näherte, brachte ich es jedoch nicht über mich, auch die letzten paar Schritte zu gehen, und bog in eine Seitengasse ab. Ich hoffte, der Druck in der Brust ließe nach, und mein Herz, das wie ein aufgescheuchter Vogel im Käfig hüpfte, beruhigte sich endlich wieder. So beschloss ich, mich ein Stück weit mit der Menge treiben zu lassen und mit dem Strom zu schwimmen, wohin er mich auch tragen mochte, um all das eine Weile zu vergessen, so kurz die Spanne auch sein mochte. Ich war nicht bereit, jemandem zu erzählen, was ich gesehen hatte. Noch nicht. In Bewegung bleiben, das lenkte mich ab.
Nachdem ich den Weg zur Hauptstraße eingeschlagen hatte, sollte es nicht lange dauern, bis mein Wunsch erfüllt wurde. Fast sofort wurde ich mitgerissen. Ich hätte hungrig oder durstig sein müssen – ich hatte nicht einmal das Bier ausgetrunken und die Muscheln aufgegessen, an denen ich mich verschluckt hatte –, aber mir war der Appetit vergangen. Mein Magen rebellierte und zeigte sich unleidlich. So gab ich mich damit zufrieden, dem Strom der Menschen zu folgen, und achtete nicht mehr auf Wegweiser oder die abgeblätterten Emaillestreifen an den Wänden. Auch wenn ich kaum mehr als Wasser im Bauch hatte, würde es mir sicherlich schwerfallen, den Rückweg zum Traurigen Hund zu finden, aber das war mir in diesem Augenblick egal.
Ich wanderte umher und folgte der Menge. Wenn der Strom dünner wurde und mich in Seitenstraßen oder Wohnviertel spülte, machte ich kehrt und suchte ein Gedränge, das mich in eine andere Richtung schob. Obwohl viele Besucher in ihre Hütten und auf die Höfe zurückgekehrt waren und die ersten Straßenhändler die kleinen Baldachine aus Leder und verschossener Leinwand abbauten, waren immer noch sehr viele Menschen unterwegs. Deshalb war es nicht schwer, eine neue Menschentraube zu finden, die mich irgendwohin mit sich zog.
Als ich einen Platz erreichte, hörte ich ein wildes Durcheinander von Geräuschen – entzücktes Quietschen, vielleicht mischte sich auch Angst darunter, es war schwer zu erkennen, und viel Gemurmel. Die Art von Raunen, die entstand, wenn sich viele Leute zu den Nachbarn beugten und ihnen aufgeregt etwas erklärten, sich dabei aber bemühten, leise zu sprechen, weil sie zugleich beunruhigt und ergriffen waren. Eine einzelne, in solchen Dingen offenbar recht geübte Stimme übertönte den Lärm. In regelmäßigen Abständen vernahm ich noch etwas anderes. Es war ein fremdartiges Geräusch, eine Art durchdringendes Kreischen oder Brüllen, bei dem mir der Atem stockte und mein Bauch sich verkrampfte. Wenn es ertönte, verstummten alle anderen Geräusche vorübergehend und setzten erst nach einer kleinen Atempause wieder ein.
Mitten auf dem Platz hatten sich die Zuschauer zu einem dichten Kreis versammelt. Von einem Impuls getrieben, den ich selbst nicht recht verstehen konnte, drängte ich mich auf eine Art und Weise nach vorn, auf die Mulldoos stolz gewesen wäre. Allerdings fehlte es mir an Körpermasse, um die Leute rasch wegzuschieben, und ich bekam einige Flüche und böse Blicke ab, als die Leute erkannten, dass ich nur ein dürrer Bursche war, der sich vordrängen wollte. Geräusche wie diejenigen, die mitten auf dem Platz entstanden, hatte ich zwar noch nie gehört, aber trotzdem wusste ich irgendwie, woher sie kamen. Und als ich die obere Kante eines hohen Käfigs entdeckte, war ich sicher, dass ich richtiglag.
Freilich konnte mich diese Gewissheit nicht auf das vorbereiten, was ich dann sah.
Als Kind hatte ich mich immer gefragt, ob die Augen der Ungeheuer in den Märchen wie Laternen glühten, ob sie wie Mist oder sogar noch schlimmer stanken, welche Geräusche die Krallen machten, wenn die Ungeheuer über die Dielen des Gasthofs oder draußen direkt hinter mir über die Felder schlichen, und ganz besonders, wie ihr Brüllen und ihr Angriffsschrei klang. Nun verrenkte ich mir den Hals, um über die Leute vor mir hinwegzuspähen, und war drauf und dran, das erste Ungeheuer meines Lebens in Fleisch und Blut zu sehen.
Der hohe Käfig war gut zwanzig mal dreißig Schritte groß. In der hinteren Ecke führte ein Durchlass zu einer vergitterten Rampe, die ihrerseits mit einem stabilen Wagen verbunden war. Die Ladefläche war mit Eisenstangen gesichert und mit Holz überdacht. Zugtiere waren nicht angespannt. Ein Stück entfernt stand ein zweiter Wagen mit einer flachen Ladefläche, vor den sechs sichtlich nervöse Ochsen geschirrt waren.
An der Seite des Käfigs gab es ein fest verschlossenes Tor. Von dort aus führte ein kurzer gesicherter Gang zu einem kleinen rechteckigen Käfig, der sich innerhalb des größeren Gefängnisses befand. Nun erst sah ich auch das Wesen, das den kleineren Käfig in der Mitte umkreiste, der im Augenblick allerdings leer war.
Das Ungeheuer war ein riesiger Vogel, gut anderthalbmal so groß wie ein Mann, mit schwarz und gelb gesprenkeltem Gefieder und einem dicken, muskulösen Hals. Der Kopf war fast so groß wie der eines Pferds, vorne ragte ein kräftiger Schnabel hervor.
Genau wie Lloi es beschrieben hatte, besaß das Untier keine Flügel, sondern dünne gefiederte Gliedmaßen, die in drei Klauen ausliefen. Zwei davon waren sehr kurz, die dritte war viel länger und gekrümmt und trug am Ende eine sichelförmige rasiermesserscharfe Kralle. Die Beine waren kräftig und stämmig wie kleine Bäume, liefen ebenfalls in mächtigen Klauen aus und warfen den Staub hoch, wenn das Wesen im Käfig hin und her schritt. Die kleinen schwarzen Augen starrten böse die Gaffer an.
Auch der Schausteller lief im Kreis herum, allerdings außen vor dem Käfig. Er trug eine offene Weste. Seine Haut, das Haar und der Gabelbart waren gleichermaßen stark eingefettet. In Nase und Ohren trug er unzählige Ringe und Stecker, auf denen die untergehende Sonne blitzte. In einer Hand hatte er einen langen Treibstock. Zwei jüngere Versionen seiner selbst, die sich nur dadurch von ihm unterschieden, dass sie statt des Vollbarts lediglich Stoppeln im Gesicht hatten und weitere Hosen trugen, liefen am Rand der Menge entlang. Einer hatte einen Eimer mit Fleisch dabei, der andere eine Schale, um die Münzen einzusammeln.
Die Schausteller waren gewiss keine Grashunde, versuchten aber offenbar, deren Erscheinungsbild nachzuahmen. Der Vater rief: »Meine Damen und Herren, dies ist ein echter Reißer. Das gefährlichste Raubtier im Grünen Meer. Ich habe gesehen, wie er mit einem einzigen Hieb ein Pferd getötet und ihm die ganze Kehle herausgerissen hat.«
Er wartete, bis das erstaunte Murmeln der Menge abgeklungen war. »Jetzt bekommt Ihr die Gelegenheit, auf die Ihr schon lange gewartet habt. Für einen kleinen Beitrag könnt Ihr das Ungeheuer von draußen füttern.« Er deutete mit dem Treibstock auf den kleineren Käfig in der Mitte. »Die Mutigen unter Euch können auch erleben, wie es ist, dem Reißer sehr nahe zu kommen. Ihr könnt spüren, wie sich die letzten Augenblicke anfühlen, wenn man ihm als Beute dient und zerfleischt wird.« Mehrere Zuschauer keuchten, worauf er lächelte und ein paar silberne Zähne zeigte. »Nur keine Angst – das Ungeheuer mag stark und schnell sein, aber kein Reißer kann die Stangen zerbrechen oder verbiegen. Da drinnen seid Ihr völlig sicher und könnt trotzdem etwas erleben, das außer Euch noch niemand erlebt hat.« Er hob die Stimme noch weiter. »Wer unter Euch will nun das Ungeheuer füttern, dessen Blutdurst niemand stillen kann?« Er betrachtete den Reißer, dann wieder die Menge. »Und wer unter Euch wagt sich in den inneren Käfig? Du vielleicht?« Er zielte mit dem Treibstock auf ein verschrecktes Mädchen. »Oder Ihr?« Ein Mann, der ein paar Reihen weiter hinten stand. »Oder vielleicht Ihr, junger Herr?« Er deutete auf einen Bauern, dessen Mädchen sich eng an ihn schmiegte.
Nach kurzem Zögern lief ein Junge nach vorne und warf eine Münze in die Schale. Der Sohn des Schaustellers spießte mit einer langen Gabel ein Stück Fleisch auf und gab dem Jungen einige Anweisungen, die vermutlich vor allem darauf hinausliefen, ja keinen Arm in den Käfig zu stecken. Dann trat er zur Seite und machte dem Jungen Platz, der langsam zum Käfig ging und das Fleisch vor sich hielt, wenngleich nicht so hoch, dass ich es sehen konnte.
Einige Schritte vor dem Gitter blieb er stehen, das Fleisch ragte gerade eben hinein. Der Reißer ließ sich nicht zweimal bitten. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit machte er zwei rasche Schritte quer durch den Käfig. Der Junge fuhr zurück und ließ die Gabel fallen, worauf die Zuschauer lachten. Der Reißer störte die Belustigung, indem er den Schnabel hob und wieder ein schrilles Kreischen ausstieß, dass einem das Blut in den Adern stockte. Die Zuschauer murmelten untereinander, und der Schausteller ermunterte den Jungen, das Fleisch wieder in den Käfig zu halten. »Kind, die Stangen schützen dich! Beherrsche dich und füttere das Untier!«
Der Junge machte einen Schritt, in der Menge johlten ein paar andere Jungen. Er schob das Fleisch durch die Stangen, und der Reißer fuhr herum und riss es von der Gabel. Dabei hätte er fast das Werkzeug mitgezerrt.
Die Menge jubelte. Bleich und erschüttert hob der Junge den Arm, als hätte er einen gewaltigen Feind besiegt oder wäre dem sicheren Tod entronnen.
Dann marschierte ein Freund des Jungen, der ihn offenbar ausstechen wollte, zu dem Sohn des Schaustellers und fragte so laut, dass es alle hören konnten: »Was kostet es, nach drinnen zu gehen?«
Es wäre überzeugender gewesen, wenn dabei nicht seine Stimme gebrochen und die Augen nicht hinter dem zerzausten Haar verborgen geblieben wären, aber immerhin war es doch eine hübsche Angeberei. Ich weiß nicht, in welcher Situation solche Burschen dümmer sind: Wenn sie ihr eigenes oder das andere Geschlecht zu beeindrucken versuchen. Wie auch immer, die Menge applaudierte anerkennend, als wäre dies ein harmloses Puppentheater und kein Junge, der sich freiwillig in die gefährliche Nähe einer tödlichen Kreatur begab.
Der Schausteller klatschte zweimal in die Hände. »Sehr gut, sehr gut. Hier entlang, mein Junge, hier entlang!« Er führte ihn zu dem vergitterten Durchgang und schloss das Tor auf. Der Reißer achtete kaum auf den idiotischen Jungen, dem der Schausteller gerade eine lange Gabel mit einem großen Stück blutigen Fleischs gab. »Pass gut auf, Junge. Wenn du da drin bist, musst du den Stangen fernbleiben.«
Der Junge schnappte sich die Gabel. »Ich passe auf das auf, worauf ich aufpassen will, alter Mann. Du hast mir gar nichts zu sagen.«
Es war nicht zu erkennen, ob es nur das Spiel der Schatten war oder tatsächlich blitzschnell ein Anflug von Wut über das Gesicht des Schaustellers zog. Falls Letzteres zutraf, so sorgte die Gegenwart des zahlenden Publikums dafür, dass der Unmut rasch wieder verschwand. Er verneigte sich. »Wie Ihr wünscht, junger Herr. Trotzdem werden meine Söhne immer in der Nähe sein, also keine Angst.«
»Bestimmt nicht«, behauptete der Junge und machte ein paar Schritte in den gesicherten Korridor hinein. Die ersten beiden erfüllt von dem dummen Überschwang, den ein Jugendlicher jederzeit mühelos an den Tag legen konnte, den dritten zögernd, weil ihn der Reißer von der anderen Seite des Geheges aus neugierig beobachtete. Vielleicht auch abschätzend. Der Junge bemerkte es, spürte es und hielt inne.
Nun rief der Schausteller: »Mitten hinein, Junge, mitten hinein. Da ist es sicherer. Gehe mitten hinein und füttere ihn von dort aus.«
Als ihn der Reißer direkt anstarrte, die Augen so sanft wie geschmolzener Stein, dämmerte dem Jungen, worauf er sich eingelassen hatte, und er eilte weiter. Es kam ihm nicht mehr darauf an, irgendjemanden zu beeindrucken. Die Söhne des Schaustellers folgten ihm.
Der Reißer öffnete den riesigen Schnabel. Ich rechnete mit einem weiteren drohenden Kreischen, doch er stieß nur ein gedehntes leises Fauchen aus und verfolgte den Jungen, der sich jenseits der Gitter bewegte, weiter mit seinen Blicken. Schließlich stand der Junge mitten in dem geschützten Bereich und starrte das Wesen an, das ihm von dort aus sicherlich viel beeindruckender und gefährlicher erschien als vorher in der Gesellschaft der anderen dummen Jungen.
Der Schausteller wanderte wieder um den Käfig herum und rief: »Das Fleisch, Junge. Tritt an das Gitter heran. Nahe, aber nicht zu nahe, und halte es dem Ungeheuer hin. Hilf ihm, Askill.« Der Junge reagierte nicht, sondern blieb einfach in dem Käfig stehen, die Arme hingen an den Seiten herab, als wären sie festgebunden. Der größere Sohn des Schaustellers trat neben ihn und zeigte ihm, wie es weiterging, während der andere den Reißer beobachtete.
In der Menge ließen sich ein paar Freunde des Jungen vernehmen, aber es war schwer zu erkennen, ob es Ermunterung oder Spott war. Wahrscheinlich ein wenig von beidem.
Der Junge sah sich zum Publikum um. Er wirkte jetzt erheblich jünger als vorher und wünschte sich offenbar, er hätte den Mund gehalten und wäre draußen geblieben. Dann aber trat er näher an das Gitter heran und hörte Askill zu. Langsam hob er die Gabel und schob sie ein paar Handbreit weit hinaus. Am Ende baumelte das Fleisch.
Ich überlegte noch, welchem Tier das Fleisch einmal gehört haben mochte, da hob der Reißer den Kopf. Abwechselnd starrte das Untier den Jungen und das an, was in erreichbarer Nähe vor dem Gitter hing. Fast schien es, als beobachtete und berechnete das Wesen, um einzuschätzen, wie stark der Junge war. Oder wie schnell.
Das Wesen machte ein paar Schritte ins Zentrum des Käfigs und sah abermals den Jungen an, der die Gabel zwischen zwei Gitterstäben hinausstreckte. Und dann, als hätte es den Jungen mit einem Zauber an Ort und Stelle gebannt, machte es drei Schritte – so groß, unerwartet und blitzschnell, dass man es kaum glauben konnte. In einem Augenblick war er noch zwanzig Schritte von dem kleineren Käfig in der Mitte entfernt, im nächsten stand der Reißer vor dem Gitter und schnappte nach der Gabel.
Dann drehte das Ungeheuer den großen Kopf ruckartig zur Seite, aber statt loszulassen, wie man es ihm vermutlich eingeschärft hatte, hielt der Junge fest, wurde bis ans Gitter gezogen und prallte mit der Schulter dagegen. Als er endlich losließ, war es schon zu spät. Der Reißer schob die dünnen Arme zwischen den Stäben hindurch und packte das Handgelenk des Jungen mit den kleinen Klauen. Jetzt kreischte er. Die Söhne des Schaustellers stachen mit den Treibstöcken zu, waren aber nicht schnell genug. Der Reißer zog den Arm des Jungen durch die Stäbe, ließ die Gabel fallen und schnappte mit dem großen Schnabel nach dem Unterarm, den er mit den Klauen festhielt.
Askill und sein Bruder stachen dem Reißer die Stöcke in die Seite, doch einen wehrte er mit der sichelförmigen Kralle des freien Armes ab, und den zweiten ignorierte er ganz und gar. Askill sprang zurück, als der Reißer zweimal zubiss. Man hörte Knochen brechen und Fleisch zerreißen, während das Opfer aufschrie. Dann stürzte der Junge gegen den jüngeren Sohn des Schaustellers und stieß ihn und den Treibstock zurück. Aus dem verstümmelten Unterarm spritzte das Blut.
Der Reißer entfernte sich mit einem Sprung vom Käfig und war außer Reichweite der Treibstöcke. Zweimal kaute er die abgetrennte Hand im Schnabel, dann verschluckte er sie.
Abgesehen von gelegentlichen spöttischen Rufen einiger Jungen, hatte sich die Menge bisher eher ruhig verhalten. Jetzt aber waren überall Schreie zu hören. Viele Zuschauer verlangten lautstark nach der Stadtwache. Der Junge stieß einen letzten Klagelaut aus, ehe er zu Boden sank und das Blut anstarrte, das aus dem Armstummel spritzte. Askill rief nach dem Vater, der Bruder bedeckte unterdessen die Wunde mit dem Hemd und versuchte, die Blutung so gut wie möglich zu stillen. Dabei sah er sich Hilfe suchend um.
Als ich den Jungen betrachtete, der schockiert den verletzten Arm mit dem gesunden stützte, während sich die fehlende Hand im Bauch des Reißers auflöste, musste ich an Lloi denken, die in ihrer Jugend verstümmelt worden war. Ich fragte mich, wie ihre Familie das getan hatte und ob sie danach ebenso schockiert die blutigen kleinen Stummel angestarrt hatte, wo vorher die Finger gewesen waren. Auch wenn sie vermutlich schon lange mit dieser Strafe gerechnet hatte, konnte man denn wirklich darauf vorbereitet sein, dass einem ein Körperteil einfach abgehackt wurde? Hatte sie ihr Schicksal hingenommen oder sich gewehrt? Hatten sie diejenigen, die sie für ihre Verwandten gehalten hatte, am Ende fesseln müssen? Wenn ich Lloi richtig einschätzte, dann hatte sie sich vermutlich erbittert gewehrt und wahrscheinlich sogar einige Angehörige verletzt, ehe es vollendet war.
Was hätte sie wohl zu diesem gefangenen Reißer, dem Anjurier und seinen Söhnen gesagt, die das Ungeheuer von Stadt zu Stadt schleppten, um den Zuschauern einen billigen Nervenkitzel und eine gefährliche Attraktion zu bieten? Hätte sie ihn gehasst und ihm etwas Böses gewünscht? Wahrscheinlich nicht. Trotz der Misshandlungen hatte sie nicht einmal ihr eigenes Volk gehasst.
Das konnte mich freilich nicht besänftigen. Die Szene hatte mich wütend gemacht, und ich wollte den Schausteller anschreien, er sei ein Scharlatan und ein Schurke, und er selbst hätte es verdient, einen Arm zu verlieren. Fast war es, als hätte er den Jungen selbst verstümmelt. Auf jeden Fall zog er einen Nutzen daraus. Einen irren Augenblick lang überlegte ich, ob das Untier ihn angreifen würde, seinen Häscher und Peiniger, wenn es mir irgendwie gelänge, den Käfig zu öffnen. Oder würde es weglaufen oder vielleicht sogar einen Unschuldigen in der Nähe anfallen?
Da fiel mir ein, wie dumm es wäre, den Schausteller anzuschreien. Nicht nur, weil ich damit nichts erreichen würde, sondern auch, weil in diesem Getümmel sowieso niemand auf mich hören würde. Und selbst wenn, damit hätte ich nur unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. Gleich als Nächstes wurde mir bewusst, wie dumm ich mich ganz allgemein verhalten hatte.
Meine Bitte, Braylar möge den jungen Hornmann im Gras verschonen? Dumm. Nicht sofort zum Traurigen Hund zurückkehren, nachdem ich ihn auf dem Jahrmarkt erkannt hatte? Ungeheuer dumm. Und Flusstal mit den Syldoonern zu verlassen war vermutlich das Dümmste, was ich überhaupt jemals getan hatte. Aber es war zu spät, es war geschehen, ich konnte es nicht rückgängig machen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als zum Traurigen Hund zu laufen und zu versuchen, so gut wie möglich mit alledem zurechtzukommen.
Schweren Herzens und mit einem flatternden Gefühl im Bauch verließ ich den Platz und kehrte zum Gasthof zurück, ohne mich auch nur einmal über die Schulter umzusehen. Meine Füße waren schwer, obwohl ich mich endlich in die richtige Richtung bewegte.
2
Als ich endlich vor dem Vordereingang des Traurigen Hundes stand, konnte ich mich nicht überwinden, auch noch die letzten Schritte zu tun und das Haus zu betreten. Am liebsten hätte ich ein- oder zweimal das Gebäude umrundet, um Mut zu fassen, aber das kam mir albern vor. Also blieb ich stehen und machte mir zugleich Vorwürfe, weil ich mich nicht rührte. Es war nicht nur die Angst vor einem Rüffel. Auch wenn sich mein Mitgefühl jetzt als schrecklicher Fehler erwiesen hatte, der Captain würde kaum mehr tun, als mir eine Standpauke halten, und angesichts seiner eigenartigen Verfassung würde vielleicht nicht einmal dies geschehen. Zumindest vorläufig. Immerhin war er und nicht ich derjenige gewesen, der im Grünen Meer die Armbrust gehalten hatte. Er hatte entschieden, den Hornmann laufen zu lassen, auch wenn ich ihn irgendwie dazu überredet hatte. Eine Teilschuld musste er auf sich nehmen. Na ja, vielleicht doch nicht. Aber wie auch immer, es war nicht der zu erwartende Wutausbruch, der mich zögern ließ, sondern vielmehr die Befürchtung, ich könnte mit meinem Eingeständnis das bisschen Achtung verspielen, das er mir entgegenbrachte, nachdem ich ihm am Tempel das Leben gerettet hatte.
Zugleich ärgerte es mich, dass ich mir solche Sorgen machte, ich könnte die ohnehin begrenzte Anerkennung eines Mannes verlieren, der ein raffinierter Ränkeschmied war. Schließlich riss ich mich zusammen, trampelte den Kot und den Dreck von meinen Stiefeln, trat durch die Vordertür und stieg die Treppe hoch. Ich hatte mich entschlossen, Braylar zu unterrichten, und danach würde es eben kommen, wie es kommen musste. Mit Zaudern konnte ich nichts gewinnen.
Als ich den Gang hinunterlief, sah ich Mulldoos und Vendurro vor der Tür des Gemeinschaftsraums stehen. Sie steckten buchstäblich die Köpfe zusammen, und Mulldoos hatte Vendurro die riesige Pranke auf den Nacken gelegt, um ihn dicht an sich zu ziehen, während er leise auf den jüngeren Mann einredete. Die Worte konnte ich nicht verstehen, was vermutlich auch gut war, denn es handelte sich offensichtlich um ein vertrauliches Gespräch und verriet eine Zuneigung, die ich bei Mulldoos nie vermutet hätte. Ich wollte mich schon umdrehen und sie in Ruhe lassen, da nickte Vendurro zweimal, und Mulldoos klopfte dem kleineren Syldooner fest auf den Rücken. Dann drehte er sich um und bemerkte mich. Die Zärtlichkeit, die gerade noch da gewesen war, verschwand sofort hinter einer finsteren Miene.
Mulldoos sah Vendurro an und sagte: »Richte dem Cap aus, dass ich mich darum kümmere.« Dann humpelte er den schmalen Gang hinunter und erwartete offenbar von mir, dass ich ihm Platz machte, was ich wortlos tat. Als ich mich an die Wand gedrückt hatte, blieb er vor mir stehen und rückte sogar noch näher heran. Mir fiel ein, dass Vendurro sich bei unserer ersten Begegnung genauso verhalten hatte, nur dass er damals auf einem Pferd gesessen hatte. Mulldoos zu Fuß war doppelt so schrecklich. »Du hast eine Gabe, dort aufzutauchen, wo man dich nicht braucht, und dort nicht zu sein, wo du sein solltest. Ist das eine Kritzler-Sache, oder bist nur du so gut darin, andere Leuten zu piesacken wie ein brennender Pfeil im Arsch?«
Die Worte sprudelten heraus, ehe ich richtig darüber nachgedacht hatte. »Ich kann nicht für die ganze Zunft der Chronisten sprechen, also nehme ich an, dass es nur für mich gilt. Oder du bildest es dir vielleicht auch nur ein.« Auf der bleichen Stirn entstand eine Falte, er machte eine überraschte Miene und versetzte mir direkt unter dem Brustbein einen harten Stoß mit dem Ellenbogen. Ich krümmte mich und griff nach seinem Arm, um mich festzuhalten, aber auch das war ein Fehler, denn er zog sich zurück, und ich stürzte auf Hände und Knie und schnappte nach Luft, die ich nirgends finden konnte.
Er beugte sich vor. »Gless ist tot. Lloi ist tot. Hacker und ich und der Cap, wir sind alle verletzt. Was du jetzt gerade erlebst, diese komische Panik, die tränenden Augen, dieses Gefühl, das Knoblauchzeug käme gleich wieder aus dem Magen hervorgeschossen, das ist noch gar nichts.« Er tätschelte den Knauf des großen Falchions an der Hüfte. »Du kannst dich glücklich schätzen, Kritzler. Wirklich glücklich.«
Mulldoos lief die Treppe hinunter, während ich mir kniend den Bauch hielt. Offensichtlich wusste er genau, welche Stelle man treffen musste, denn er hatte die Symptome richtig beschrieben. Verschwiegen hatte er nur, dass mir alles vor den Augen verschwamm und ich vor Übelkeit und Schmerzen beinahe ohnmächtig wurde. Endlich füllte sich die Lunge wieder mit Luft.
Ich hustete einige Male und sah auf einmal eine Hand vor meinem Gesicht. Zuerst fürchtete ich, Mulldoos sei zurückgekommen und habe sich entschlossen, mich noch einmal zu beglückwünschen, aber als ich den Kopf hob, sah ich Vendurro vor mir stehen. Erleichtert schlug ich ein und ließ mich von ihm hochziehen.
»Ich habe schon öfter gesehen, wie er das gemacht hat. Mehr als einmal habe ich auch selbst etwas abbekommen. Kein Mann schlägt dich schneller nieder als Mulldoos. Er hat wirklich spitze Ellenbogen. Wirklich spitz.«
Ich versuchte, mich aufzurichten, worauf sich sofort wieder mein Magen verkrampfte. Fast hätte ich mich doch noch übergeben. Als der Anfall vorbei war, unternahm ich einen neuen Anlauf. Meine Rippen brannten, aber ich war sicher, keine dauerhaften Schäden davongetragen zu haben. »Warum …« Ich wartete noch etwas, bis ich freier atmen konnte. »Was habe ich getan? Warum ist er so wütend auf mich?«
Vendurro lächelte leicht. Es war nicht so breit und strahlend, wie ich es erwartet hatte, aber es war ein Lächeln. »Oh, ich denke nicht, dass es direkt mit dir zu tun hat. Jedenfalls nicht mehr als mit allen anderen Dingen und Menschen. Wenn der Leutnant auf eine Sache nicht wütend ist, dann ist er auf eine andere umso wütender. Im Augenblick würde ich sagen, dass es nicht so sehr um das geht, was du getan hast, sondern eher um das, was nicht geschehen ist. Du hattest keine Rüstung, du hattest keine Ausbildung, und trotzdem hast du den Kampf zwischen den dünnen Bäumen praktisch ohne einen Kratzer überstanden. Hackspeer hat gesagt, dass du dich da drin viel besser als erwartet geschlagen und ausgeharrt hast, als die meisten sich in die Hose gemacht und das Hasenpanier ergriffen hätten. Aber Mulldoos sieht nur jemanden, der überlebt hat, obwohl er nicht hätte überleben dürfen, während die anderen, die noch leben müssten, gestorben sind. Es ist nichts Persönliches.«
»Oh, richtig.« Endlich bekam ich ein paar Worte heraus, ohne meinen Magen wieder in Unruhe zu versetzen. »Es ist nichts Persönliches. Er wünscht sich nur, ich wäre tot, und nicht Tomner oder Gless …«
Vendurros Lächeln verschwand, als ich innehielt. Zu spät. Ich suchte nach etwas, das meine Worte abmildern konnte, aber ich konnte nur stottern: »Es tut mir leid, Vendurro. Ich wollte nicht … ich meine, ich …«
Er fuhr sich mit der Hand durch den dichten Haarschopf. »Schon gut, Buchmeister. Aber du hast es auf den Punkt gebracht. Der Cap ist nicht der Einzige, den die Verluste schmerzen. Damit meine ich nicht den Ausgang der Schlachten. Wir haben meist gewonnen oder wenigstens ein Unentschieden herausgeschlagen, je nachdem, wie man zählt. Aber die Männer, die Leute zu verlieren … das geht ihnen unter die Haut. Damals, als wir noch eine große Truppe waren, hatte ich ein paar Untergebene, zwei jüngere und zwei ältere. Allerdings haben wir keinen Krieg geführt und wurden nur in ein paar Scharmützel verwickelt, bei denen kaum jemand gefallen ist. Deshalb weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, wie das ist. Jetzt habe auch ich, genau wie die drei anderen Offiziere, erlebt, dass wir Männer verloren haben, und das ist eine harte, bittere Erfahrung. So ist das.«
Vendurro atmete gedehnt aus. »Deshalb ist es nicht persönlich gemeint. Es wurmt den Leutnant nur, dass du überlebt hast, während die Männer, die er ausgebildet hat und die er seit Jahren kannte, nicht zurückgekehrt sind.«
Es war nicht zu erkennen, ob er noch mehr sagen wollte oder ob er wünschte, er hätte überhaupt nichts gesagt. Ich hielt mich zurück, weil ich ihn nicht unterbrechen wollte, falls er wirklich weitersprach, aber ich wollte ihn auch nicht bedrängen. Tatsächlich fuhr er fort, und wenn man sah, wie zögernd die Worte herauskamen, hätte man meinen können, er wäre derjenige gewesen, der gerade einen Schlag in den Bauch bekommen hatte. »Ich will dir nicht raten, dass du besser den Mund hältst, wenn Mulldoos in der Nähe ist. Ich meine, das ist ein vernünftiger Ratschlag, aber ich weiß, dass du ihn sowieso nicht beherzigst, genau wie ich damals. Manchmal weiß ich heute noch nicht, wann es besser ist, die Klappe zu halten. Im Laufe der Jahre habe ich mir mit meinem losen Mundwerk eine Menge Ärger eingehandelt. Nur war es eben so, dass Gless mich immer herausgehauen hat, wenn mein Mund schneller gearbeitet hat als mein Gehirn. Er hat mir immer den Rücken freigehalten, darauf konnte ich mich jederzeit verlassen. Und das war sicher auch ein Grund dafür, dass ich manchmal so unüberlegt dahergeredet habe. Aber …«
Er ließ den Satz unvollendet. Ich brach das unbehagliche Schweigen. »Hat Mulldoos … als ich heraufgekommen bin, hatte ich den Eindruck, dass er mit dir über Glesswik gesprochen hat.«
Vendurro nickte langsam. »Ja, das hat er.«
Ich wartete schweigend und dachte, er würde schon weiterreden, wenn er ein gutes Gefühl dabei hatte. Vendurro starrte an mir vorbei den Flur entlang, als rechnete er damit, dass Mulldoos zurückkehrte. Oder vielleicht auch Glesswik. Als ich schon drauf und dran war, mich zu entschuldigen und Captain Killcoins Zimmer zu betreten, sagte Vendurro: »Es ist unvermeidlich, dass Soldaten immer wieder ihre Kameraden verlieren. Das ist einfach so. Man kann es nicht verhindern und nicht schönreden. Besonders gilt das natürlich für die Syldooner, die ständig im Einsatz sind. Immer auf einem Feldzug oder auf Streife, eine Invasion beginnen, den Feind zurückwerfen, der eine oder andere Auftrag. Da hat man nicht viel Zeit, dem Moos beim Wachsen zuzusehen, wenn du verstehst, was ich meine. Früher oder später – meistens wohl früher – siehst du, wie ein Turmkamerad oder gleich mehrere fallen. So ist es eben bei den Syldoonern. Du verlierst deine Brüder. Etwas Schlimmeres gibt es nicht, weil es in der bekannten Welt keine engere Gemeinschaft gibt als einen syldoonischen Turm. Es ist nie leicht, wenn so etwas passiert. Aber Gless und ich …« Er runzelte die Stirn. »Hast du Brüder?«
Meines Wissens hatte ich keine Geschwister, aber höchstwahrscheinlich lebten irgendwo welche, die ich noch nie gesehen hatte. Ich schüttelte den Kopf.
Er lächelte traurig. »Das ist schade. Jeder sollte ein oder zwei Brüder haben. Bei uns Syldoonern sind die anderen Jungs im Turm wie Brüder, wie leibliche Brüder. Vielleicht sogar noch wichtiger. Gless und ich standen uns sehr nahe. Ich hatte einfach nicht daran gedacht, dass auch er eines Tages fallen könnte. Das konnte ich mir nicht vorstellen.« Er brach ab und starrte wieder den Flur entlang.
Ich hatte das Gefühl, ich müsste ihm eine Hand auf die Schulter legen und ihn auf irgendeine Weise trösten, aber Gesten und Worte kamen mir leer und unbeholfen vor, selbst wenn sie aufrichtig gemeint waren. Um ihn wenigstens etwas von dem Kummer abzulenken, sagte ich: »Hat dir denn das, was Mulldoos gesagt hat, ein bisschen geholfen?«
Vendurro rieb sich den Nacken, als erinnerte er sich daran, dass Mulldoos ihn dort berührt hatte, und seine Augen wurden feucht. »Er hat mir gesagt, ich solle trauern, wenn ich traurig sei – daran sei nichts Falsches –, aber dann sollte ich die Sache begraben und mich bereit machen, weil meine Brüder meine volle Wachsamkeit brauchten. Uns gehen ja so langsam die guten Sergeanten aus.« Er lachte ein wenig, und dann, ganz unerwartet, lachte er noch einmal. »Mulldoos ist wirklich kein Mann, von dem man ausgefeilte Reden erwarten kann. Aber er sieht das völlig richtig.«
Beinahe hätte ich ihn darauf hingewiesen, dass es erst einen Tag her war und dass eine so frische Wunde Zeit brauchte, um sich zu schließen und abzuheilen, aber ich war natürlich kein Soldat, und vielleicht hatte Mulldoos ja recht. Wenn man ständig in Lebensgefahr schwebte, war es wohl keine gute Idee und der Sicherheit nicht förderlich, mit einem schweren, bekümmerten Herzen Dienst zu tun. Es stand mir nicht zu, ihm vorzuschlagen, er solle sich mehr Zeit zum Trauern nehmen.
Ich war froh, dass ich kein Soldat war. Das war eine harte, brutale Welt.
Schließlich legte ich ihm impulsiv doch noch die Hand auf die Schulter und sagte: »Ich kann nicht behaupten, ich wüsste, wie es ist, einen Bruder zu haben. Ganz zu schweigen davon, ihn zu verlieren.« Langsam zog ich die Hand zurück und fügte lahm hinzu: »Es tut mir leid.«
Vendurro lächelte wieder. »Danke, Arkamondos. Gless war ein gemeiner Dreckskerl und hat immer nach Wegen gesucht, sich vor unangenehmen Aufgaben zu drücken. Es sieht ihm ähnlich, dass er jetzt weg ist und ich seine Arbeit mit übernehmen muss.«
Ich nickte. »Du kannst mich Arki nennen. Vor dem Captain hat mich noch niemand so genannt, aber ich gewöhne mich daran, und das ist immer noch besser als Tintenaffe, Kritzler oder …« Das nächste Wort sprachen wir im Chor aus: »Pferdefotze.« Dann lachten wir.
Aber wie die Sonne von Wolken verdeckt wurde, verschwand die Fröhlichkeit so schnell, wie sie gekommen war. Und diese Wolken schienen düsterer zu sein und langsamer abzuziehen als die letzten. Wieder wollte ich ihn nicht bedrängen und schwieg, bis er von sich aus weitersprach.
Nachdem er eine Weile seine Füße angestarrt hatte, sagte Vendurro: »Ich hab dir doch gesagt, dass er ein beschissener Ehemann war, oder? Er war fast nie daheim, besonders in den letzten Jahren, als wir in ganz Anjurien unterwegs waren. Auch davor, als wir in Sonnenmatt stationiert waren, ist er anscheinend gerade mal lange genug zu Hause gewesen, um ein Kind zu zeugen.«
Vendurro fuhr sich mit den Fingern durch die Haare und trampelte von einem Fuß auf den anderen, dann lehnte er sich an die Wand und trat mit der Hacke dagegen. In diesem Moment, bei dieser Gelegenheit, kam er mir zehn Jahre jünger vor. Das änderte sich schlagartig, als er weitersprach. Auf einmal schien er viel älter. »Er hat eine gute Frau geheiratet. Oder jedenfalls keine schlechte. Sie heißt Mervulla und stammt aus Thurvacia. Die Turmkommandanten raten uns immer, einheimische Frauen zu nehmen und uns hübsch einzurichten. Wer kann schon sagen, was sie in dem Drecksack gesehen hat? Frauen sind so komisch wie Katzen.«
Er lehnte den Hinterkopf an das Holz und schloss die Augen. »Die Syldooner kümmern sich um sie. Um sie und ihr Kind, weil sie ja verheiratet war. Sie hatte auch ein eigenes Einkommen, weil ihnen ein paar Olivenbäume gehört haben. Sie haben das Land an die Arbeiter verpachtet. Da sie in der Hauptstadt lebt, wird sie das Land wohl nicht verkaufen. Wahrscheinlich kassiert sie immer noch die Pacht. Sie muss also nicht um Brot betteln oder anschaffen gehen. Aber trotzdem.«
»Um Brot betteln? Anschaffen gehen?«
»Genau. Viele Witwen haben keinen eigenen Lebensunterhalt und können von einem gewissen Alter an auch keinen mehr finden. Wenn sie die Männer verlieren, verlieren sie alles. Die einzigen Möglichkeiten sind dann, auf Almosen zu hoffen oder das zu verkaufen, was man hat. Syldoonische Witwen sind in der Hinsicht besser dran. Wir sorgen für unsere Leute. Trotzdem, und was sie auch für Gless empfunden hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihr gefällt, neuerdings eine Witwe zu sein. So was hört niemand gern, es sei denn, man hasst jemanden. Er war vielleicht ein Drecksack, aber er hatte auch seine guten Seiten. Insgesamt gesehen jedenfalls. Also wird es ihr wohl nicht gefallen, wenn sie es hört.«
»Und du … musst du ihr die Nachricht überbringen? Ist es deine Aufgabe, es ihr zu sagen?«
»Ob ich es muss?« Er schlug mit dem Hinterkopf gegen das Holz und starrte die Decke an. »Nein. Niemand muss so etwas tun. Aber ich kannte ihn besser als jeder andere, und sie kennt mich. Deshalb soll sie es von mir erfahren. Die traurige Neuigkeit und das mit der Witwenrente. Darum komme ich nicht herum.«
Ehe ich mir überlegt hatte, was ich überhaupt sagen wollte, sprudelten die Worte schon aus mir hervor. »Soll ich dich begleiten?«
Vendurro löste sich langsam von der Wand und sah mich an. »Würdest du das tun?«
Jetzt war es heraus, und ich wünschte mir, ich hätte vorher darüber nachgedacht. Es wurde sicherlich sehr peinlich und schwierig und … schmerzlich. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Also nickte ich, und er dachte eine Weile darüber nach, ehe er antwortete. »Ich kann das nicht von dir verlangen. Jedenfalls kannst du nicht bis zur Tür mitkommen. Sie kennt dich nicht und wüsste sofort, dass etwas nicht stimmt.« Auf einmal schien er wieder viel jünger zu sein. »Aber wenn du mich den größten Teil des Weges begleiten willst und wartest, damit wir später etwas trinken können … nein, wir werden eine Menge trinken. Das wäre schon, also, es wäre …«
»Natürlich. Ich begleite dich, so weit du willst, und ich gebe ein oder zwei Runden aus. Vorausgesetzt, der Captain zahlt mir den Sold etwas früher.«
Nach meinem Angebot und dem halbherzigen Scherz schien sich seine Stimmung tatsächlich etwas aufzuhellen. So ergriff ich die Gelegenheit und wechselte rasch das Thema. »Ach ja, der Captain – ist er in seinem Zimmer?«
»Ja, er ist da«, antwortete Vendurro. »Er ist vor einer Weile zurückgekehrt und hat mir aufgetragen, dafür zu sorgen, dass er nicht gestört wird. Wahrscheinlich kämpft er jetzt allein dagegen an, so gut er kann, weil ja Lloi ihn nicht mehr behexen kann. Er war auch nicht sehr erbaut darüber, wie das Gespräch mit dem Baron verlaufen ist. Du solltest ihm lieber etwas Zeit geben, falls du nicht ständig Krügen oder Tellern ausweichen willst.«
»Tja«, antwortete ich und wählte meine Worte mit Bedacht, »darauf bin ich wirklich nicht scharf. Aber es gibt da eine Sache … die seine Aufmerksamkeit erfordert. Ich glaube, er wird mir sogar dankbar sein, wenn ich ihn wachrüttele. Na ja, jedenfalls nachdem er alle möglichen Sachen nach mir geworfen hat.«
Vendurro überlegte kurz, dann holte er den Schlüssel aus dem Beutel am Gürtel. »Lieber du als ich. Hoffentlich hast du recht damit, dass es wichtig ist. In dieser Gegend gibt es vermutlich nicht sehr viele Schreiber, die man anheuern könnte.« Er ging zur Tür.
Ich hatte schon immer gern den Gang anderer Menschen beobachtet. Ihre Haltung, die Schritte, den Schwung der Arme, die Neigung des Kopfs, ob sie steif oder locker liefen oder einen Sichelfuß hatten. Die Haltung und der Gang verrieten mir eine Menge über das, was der Betreffende ertragen hatte, über seine Einstellung, seine Stimmung, seine Beweglichkeit und Schnelligkeit. Ein Humpeln wegen einer frischen Verletzung konnte ich meistens leicht von einem alten Leiden unterscheiden, an das sich der Betreffende so sehr gewöhnt hatte, dass es ihm kaum noch bewusst war.
Als ich Vendurro kennengelernt hatte, schritt er aus, als wollte jedes Bein das andere überflügeln. Es war ein federnder, ungestümer, jugendlicher Gang gewesen. Jetzt lief er, als wäre er um zwanzig Jahre gealtert, hätte seit Tagen nicht geschlafen und trüge bleierne Stiefel. Angesichts seines Verlusts war das nicht weiter überraschend. Fraglich war nur, ob er eines Tages die alte Spannkraft zurückgewinnen würde oder ob er nie wieder so unbefangen auftreten würde wie früher.
Vendurro schloss die Tür auf, ich bedankte mich bei ihm, und wir traten ein. Nachdem er von innen abgeschlossen hatte, setzte er sich neben der Tür auf einen Hocker und sah mir zu, als ich ein paar Schritte zur Kammer des Captains machte und wieder innehielt. Sobald ich Braylar gesagt hatte, was ich wusste, gab es kein Zurück mehr. Es war verlockend, stattdessen einfach in mein eigenes Zimmer zu gehen oder sogar wieder hinaus zum Jahrmarkt. Ich konnte behaupten, ich befolgte lediglich Vendurros Ratschlag, den Captain nicht zu stören. Doch wenn ich das tat, verlor ich womöglich den Mut, es dem Captain überhaupt noch zu erzählen. Also warf ich Vendurro einen raschen Blick zu. Er schüttelte den Kopf und tat so, als duckte er sich. Ich klopfte leise an die Tür des Captains.
Nichts. Keine heiseren Drohungen oder Beschimpfungen, nicht das kleinste Geräusch. Ich klopfte noch einmal, lauter, und wartete, hörte aber immer noch nichts. Dann drehte ich mich zu dem jungen Sergeanten um, der mit den Achseln zuckte. Schließlich versuchte ich, die Tür zu öffnen, und rechnete damit, dass sie verschlossen war, doch sie ging knarrend auf. Ich steckte den Kopf hinein und war darauf gefasst, mich sofort wieder zurückzuziehen, falls etwas geflogen kam. Drinnen war es finster, der schwere Vorhang verdeckte die Läden aus Hornschuppen und das schwindende Sonnenlicht dahinter. Es dauerte einen Augenblick, bis sich meine Augen umgestellt hatten.
Ich rief den Captain, und als ich immer noch nichts hörte, trat ich ganz ein und drückte hinter mir die Tür wieder zu. Er lag reglos auf dem Bett. Langsam näherte ich mich ihm. Es war zu dunkel, um viel zu erkennen, aber immerhin sah ich, dass sich seine Brust hob und senkte. Außerdem hielt er mit beiden Händen Blutrufer fest, der auf seinem Bauch lag, wie ein Betrunkener den Weinschlauch halten mochte, dem er seinen Zustand verdankte.
Wieder rief ich seinen Namen, wieder bekam ich keine Antwort. Anscheinend war er in seinen inneren Abgründen versunken, aber dieses Mal war keine Lloi zur Stelle, die ihn retten konnte. Müde setzte ich mich auf die Bank an der Wand, achtete nicht mehr darauf, dass sie laut knarrte. Captain Killcoin rührte sich nicht.
Im Grünen Meer hatte er gesagt, es verliefe jedes Mal anders, und es sei unmöglich, seine Reaktion auf die gestohlenen Erinnerungen einzuschätzen, die jetzt wieder auf ihn einstürmten. Vielleicht war seine Verfassung etwas Vorübergehendes. Es widerstrebte mir, in den Gemeinschaftsraum zurückzukehren und Vendurro hinzuzuziehen. Wahrscheinlich hatte er seinen Captain schon öfter so liegen sehen und wäre nicht sehr schockiert, aber freuen würde er sich über die Neuigkeit sicher auch nicht.
Nach meinen Erfahrungen in der Prärie war es allerdings auch keine Hilfe für den Captain, wenn ich einfach nur herumsaß. Ich hatte keinerlei Fähigkeiten, die ihm nützlich waren, und meine Gegenwart allein war sicherlich keine Linderung, sofern er mich überhaupt bemerkte. So saß ich eine Weile unschlüssig herum und wartete, während meine Ängste mit jeder Minute wuchsen. Obendrein hatte ich nicht viel, um mir die Zeit zu vertreiben. Braylars Zimmer war klein, und seit meinem letzten Besuch hatte sich nicht viel verändert. Irgendjemand, zweifellos ein verschreckter Laufbursche oder eine Magd, hatte – vermutlich auf Vendurros Geheiß – die zertrümmerte Kanne weggeräumt und das verschüttete Bier aufgewischt. Außer einigen Truhen und der Kleidung, die auf ihnen lag, sowie dem Tisch und den Stühlen am Bett befand sich in dem Zimmer nur noch der lange Kasten, den wir vor einigen Tagen heraufgeschleppt und verstaut hatten. Diese Kiste wollte der Captain anscheinend um jeden Preis in seiner Nähe haben.
Nicht zum ersten Mal betrachtete ich das Behältnis ungläubig und staunend. Selbst wenn man berücksichtigte, dass die Anjurier abergläubisch waren und großen Wert auf Zeremonien und Pomp legten, kam es mir mehr als eigenartig vor, dass sie das Fehlen der königlichen Gewänder derart beunruhigend fanden. Aus diesem Grund konnten doch kaum Unruhen oder Aufstände ausbrechen. Offensichtlich verfolgten die Syldooner in dieser Gegend mehrere Pläne gleichzeitig, und die gestohlenen Kleidungsstücke stellten nicht den Angelpunkt ihrer Machenschaften dar. Die List, auf die Baron Brune und Hohepriester Henlester hereingefallen waren, bewies dies ohne jeden Zweifel, und soweit ich es wusste, hatten die Syldooner noch weitere Eisen im Feuer.
Dennoch, es kam mir seltsam vor, dass sie solche Mühen auf sich genommen hatten, um etwas zu stehlen und zu transportieren, das für ihre Pläne bestenfalls von untergeordneter Bedeutung war. Meiner Ansicht nach würde dieses Manöver nicht viel Nutzen bringen, und ich war sicher, dass die syldoonischen Soldaten der gleichen Meinung waren. Der junge König hatte seine Regentschaft gegen viele Widerstände angetreten und war nicht sehr beliebt. Zwischen dem Monarchen und vielen Baronen gab es böses Blut; den Zwist hatte er von seinem kürzlich bestatteten Vorgänger geerbt. Vielleicht würden diejenigen, die ihm nicht wohlgesinnt waren, auf die fehlenden Statussymbole und Gewänder verweisen und dies als eines von vielen Zeichen dafür bewerten, dass der Junge nicht der richtige Herrscher sei oder dass seine Regentschaft mit einem Unglück enden werde. Ich war kein Experte für höfische Politik, aber das alles kam mir doch eher nebensächlich vor, auch wenn man dem Ritual der Thronbesteigung eine große Bedeutung beimaß.
Vielleicht musste man Anjurier sein, um das alles wirklich zu verstehen. Vielleicht waren die fehlenden Gewänder Grund genug, um die ohnehin schon fragwürdige Übergabe der Macht und des Titels vollends zu verwerfen. Wer konnte das schon sagen?
Ich hatte von solchen Machtwechseln bisher nur gelesen. Der alte König Xefron hatte mindestens vierzig Jahre lang geherrscht. Er hatte den Krieg gegen die Syldooner überstanden und einen Waffenstillstand ausgehandelt, aber nicht lange genug gelebt, um sicherzustellen, dass sein Nachfolger ein stabiles Königreich übernahm und klug und scharfsinnig genug war, um es auch zu führen. Ob die Gewänder sehr alt waren? Die Anjurier wollten doch sicher nicht einen neuen Monarchen mit zerlumpten, vergilbten und verblichenen Gewändern in der Öffentlichkeit auftreten lassen. Das war gewiss kein Bild, das den Untertanen Mut machte. Andererseits war dies vielleicht ein Teil der Zeremonie, und das zerschlissene Tuch, das so viele Vorfahren getragen hatten, galt als Beweis dafür, dass bei der Thronfolge alles mit rechten Dingen zuging. Wie alt waren die Gewänder überhaupt? Wer hatte sie als Erster getragen? Stil und Schnitt waren sicherlich völlig anders als die derzeitige höfische Mode.
Ich hatte es noch nicht richtig durchdacht, da kniete ich schon vor dem Behältnis und sah mich noch einmal rasch zu Braylars regloser Gestalt um, ehe ich das Segeltuch wegzog.
Ein Schloss. Natürlich war die Kiste abgeschlossen. Beinahe hätte ich mich wieder auf die Bank gesetzt, aber meine Neugierde war geweckt. Selbstverständlich war mir völlig bewusst, dass alles, was ich jetzt tat, eine Riesendummheit war, aber ich wollte mir die Kleidungsstücke unbedingt einmal ansehen, nur ein einziges Mal. Eine bessere Gelegenheit als diese würde sich vermutlich niemals bieten. Außerdem, so sagte ich mir, wusste ich ja schon, was sich darin befand. Deshalb konnte es doch nicht schaden, mir den Inhalt etwas genauer anzusehen. So ging ich zu den abgelegten Kleidungsstücken, fand Braylars Gürtel und Beutel und suchte denjenigen heraus, in dem der Schlüssel stecken musste.
Aufgeregt steckte ich den Schlüssel ins Schloss. Die Zuhaltungen waren gut geölt, klickten aber trotzdem recht laut. Hoffentlich war Vendurro noch mit seinem Kummer beschäftigt, und wenn jemand anders kam, hörte ich wahrscheinlich rechtzeitig die Stimmen.
Sobald ich das Schloss geöffnet hatte, klappte ich den Deckel hoch, der nicht ganz so gut geölt war und laut quietschte. Selbst im trüben Licht sah ich sofort, dass überhaupt keine Kleider in der Kiste lagen. Kein einziges Kleidungsstück, nicht einmal ein Fetzen. Vielmehr entdeckte ich unzählige Schriftrollen von unterschiedlichen Größen, einige umfangreich und mit kleinen Ketten zusammengehalten, andere dünner und mit Lederbändchen gesichert. Manche waren mit Streifen aus Seide zusammengebunden, und in mehreren rissigen Lederröhren steckten vermutlich ebenfalls Dokumente. Viele Schriftrollen waren auf dicke hölzerne Rundstäbe gewickelt, die ihrerseits ebenfalls sehr unterschiedlich aussahen. Manche waren schlicht und einfach, andere aufwendig mit Schnitzereien geschmückt, während das Holz unterschiedlich gefärbt war. Einige Dokumente bestanden anscheinend aus Papyrus, andere aus dickem und altem Pergament, das den Anschein erweckte, es könnte durch einen bloßen Atemstoß zu Staub zerfallen. Außerdem befanden sich Tafeln aus Ton und Wachs in dem Behälter.
Vorher hatte ich schnell geatmet. Jetzt setzte mein Atem beinahe aus. Anscheinend stammten diese Dokumente von verschiedenen Orten und aus verschiedenen Zeitaltern. Was hatte das zu bedeuten?
»Mir war gar nicht bewusst, dass der Jahrmarkt heute abgesagt wurde. Wie schade.«
Ich ließ den Deckel fallen und klemmte mir die Finger ein. Beinahe hätte ich vor Schmerzen laut aufgeschrien.
Nachdem er stundenlang nicht gesprochen hatte, klang die Stimme noch heiserer und rauer als sonst, aber es war nicht zu verkennen, dass Captain Killcoin wach und keineswegs in den gestohlenen Erinnerungen versunken war.
Ich befreite meine Finger, stand auf und drehte mich zu ihm um. Wieder einmal fühlte ich mich wie ein Kind, das die Mutter beim Diebstahl einer kleinen Münze aus der Börse ertappt hatte. Das Blut schoss mir ins Gesicht, der Herzschlag dröhnte in den Ohren, und ich empfand gleichzeitig schreckliche Verlegenheit, Angst und auch Zorn, weil man mich schon wieder getäuscht hatte. »Da sind gar keine königlichen Gewänder drin.«
Braylar richtete sich im Bett auf. Es war schwer, bei dem schlechten Licht seine Miene zu erkennen. Wie hatte er sich nur so leise bewegen können, und das auch noch, ohne die Ketten des Flegels klimpern zu lassen? Er legte Blutrufer auf das Bett und klatschte dreimal langsam in die Hände. »Oh, wie aalglatt du doch bist, Arki. Wirklich. Da habe ich dich auf frischer Tat ertappt, du hast dir die Finger eingeklemmt, was hoffentlich eine hübsche Prellung hinterlässt, und du besitzt die Frechheit, mich indirekt zu beschuldigen. Das ist eine hübsche Ablenkung. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung für dich.«
Meine Scham, die Angst und die Wut nahmen sogar noch zu. Ich bemühte mich, gleichmütig zu sprechen und meine Empfindungen zu verbergen. »Sagt Ihr überhaupt irgendwann einmal die Wahrheit?«
Darauf lachte er, gleich darauf musste er husten. »So selten, wie es nur irgend möglich ist, und auch nur dann, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Oder falls es meinen Absichten dient. Was selten genug vorkommt, aber immerhin denkbar ist.«
»Aber warum? Warum diese Geschichte, Ihr hättet Gewänder gestohlen? Warum habt Ihr mir überhaupt irgendetwas erzählt?«
Braylar stand langsam auf. Jetzt war offensichtlich, dass seine Benommenheit auf das Bier zurückzuführen war, denn er schwankte leicht. Anscheinend hatte er eine Menge im Bauch behalten, ohne sich zu übergeben. »Ich habe auch eine Frage, die viel dringender ist: Wo sind die Krüge? Ich habe sie nicht abräumen lassen. Hast du das veranlasst? Für dieses schreckliche Verbrechen musst du mit einer schlimmeren Bestrafung rechnen als für das Öffnen der verschlossenen Kiste. Oh ja, ich nehme den Schlüssel gleich wieder an mich, nachdem du abgeschlossen hast.«
Ich tat, was er verlangte, und ging langsam zu ihm. Inzwischen war auch ich nicht mehr ganz sicher auf den Beinen. Furcht war das Einzige, was ich jetzt noch empfand.
»Nun komm schon, ich bin kein brutaler Grashund, der dir die halbe Hand abhackt. Ehrlich gesagt, finde ich deine jüngsten Aktivitäten so erstaunlich – oder ich bin zu betrunken, was ich nicht endgültig entscheiden kann –, dass ich eher amüsiert als verärgert bin. Aber ich kann dir nicht versprechen, wie lange das anhalten wird.« Er schnippte mit den Fingern. »Den Schlüssel.«
Ich gab ihm den Schlüssel und war froh, die Hand und die Finger behalten zu dürfen.
»Was deine Frage angeht, so wollte ich feststellen, ob auf einmal ein Gerücht über gestohlene Kleidung die Runde macht oder ob du die Geschichte sogar selbst in unfreundliche Ohren geflüstert hast.«
»Also war es ein Test? Eine Falle?«
»Oh ja, eine böse Falle.«
»Dann habt Ihr mich beschatten lassen?«
»Tja, es wäre kein guter Test gewesen, wenn ich den Ausgang nicht überwacht hätte, oder?«
Benommen stand ich da und fragte mich, ob mein Verfolger auch den jungen Hornmann oder meine Reaktion auf ihn beobachtet hatte. »Und?«, fragte ich langsam und leise.
»Nun ja, wenn du zum guten Baron gerannt wärst, dann wäre diese Unterhaltung in einem ganz anderen Ton verlaufen. Ich hatte gehofft, dass du dich als loyal erweist, und das hast du getan. Jedenfalls bis du in meinen Sachen herumgeschnüffelt hast.«
Ich blickte zu der Kiste und fürchtete, meine Stimme könnte versagen. »Was sind das für Dokumente?«
Er steckte den Schlüssel in den Beutel und zog ihn zu. »Meine nachsichtige Stimmung verfliegt. Lass mich allein. Sofort. Und schick mir noch mehr Bier herein. Auf der Stelle.«
Mir brannten unzählige Fragen unter den Nägeln, aber mir war klar, dass ich den guten Willen des Captains vorerst aufgebraucht hatte. Eigentlich hatte ich sein Zimmer betreten, um ihn über den Hornmann zu unterrichten, aber das erschien mir jetzt wie der schlechteste Einfall, den ich überhaupt haben konnte.
Als ich gehen wollte, sagte Braylar mit seiner Reibeisenstimme: »Oh, und wenn du mir noch einmal etwas klaust, kannst du sicher sein, dass ich dich niederschlage, dir alle Rippen breche und dir ins heulende Gesicht spucke. Sofern ich mich nachsichtig fühle. Wenn nicht, wird es schlimmer. Hast du das verstanden?«
Ja, es war nicht der richtige Augenblick für irgendwelche Eingeständnisse. Anscheinend hatte Mulldoos damit recht gehabt, dass es mein Glückstag war. Ohne mich noch einmal umzudrehen, nickte ich und verließ den Captain und seine dunkle Kammer, so schnell mich die Füße tragen wollten.
3
Vendurro sah zu, wie ich hinter mir die Zimmertür des Captains schloss. »Keine Blutflecken. Anscheinend hat er dir auch nichts gebrochen, oder du hast tapfer die Schreie unterdrückt.« Er ließ den langen Dolch oder das Kurzschwert – was es war, wusste ich nicht genau – vor sich auf dem Tisch kreiseln.
Wahrscheinlich war es das Beste, möglichst nichts Verfängliches zu sagen und rasch das Thema zu wechseln. »Was ist das?« Ich deutete auf die Klinge. »Ich meine, es ist eine Waffe, aber ist das nun ein Dolch oder ein Kurzschwert? Aus meiner Sicht könnte es beides sein.«
Vendurro hörte damit auf, die Klinge zu drehen. »Das ist ein Suroka. Ich habe nie richtig darüber nachgedacht. Es reicht mir vollkommen zu wissen, wie man damit die Gegner ersticht.«
»Aha, also ein Suroka. Jetzt habe ich etwas gelernt. Wie auch immer, der Captain war nicht erfreut, dass sein Bier alle ist. Er lässt dich bitten, ihm etwas zu besorgen. Auf der Stelle, so hat er es ausgedrückt. Er war sehr ungehalten. So würde ich es ausdrücken.« Vendurro stand von seinem Hocker auf. Allein diese Bewegung ließ ihn schon wieder viel älter erscheinen. Er wollte hinausgehen, hielt aber noch einmal inne. »Hat der Cap gut ausgesehen? Ich meine, natürlich geht es ihm nicht sehr gut. Ich habe ja gesehen, wie er gegen diese Sache angekämpft hat, bevor er Lloi fand. Das ist ziemlich hässlich. Aber wie geht es ihm jetzt? Ist es schlimm?«
Ich schüttelte den Kopf und fragte mich, wie lange Braylar sich noch auf diese Weise betrinken konnte und was passieren würde, wenn er es nicht mehr tat. Würde Hackspeer das Kommando übernehmen? Oder Mulldoos? Bei diesem Gedanken schauderte ich. »Er ist gereizt und erteilt Befehle, also würde ich sagen, es geht ihm angesichts der Umstände so gut, wie man es erwarten kann.«
Damit gab sich Vendurro zufrieden, oder jedenfalls schien es so. Ganz sicher war ich nicht.
Ich kehrte in mein Zimmer zurück und staunte, wie grundlegend und radikal sich alles verändert hatte. Gestern hatten wir anscheinend noch die Pläne eines vermeintlich mordlustigen Priesters durchkreuzt und dabei das einzige Mitglied der Truppe verloren, das dem Captain bei seinem Leiden oder seinem Fluch helfen konnte, was auch immer es war, und heute entdeckte ich, dass so gut wie nichts von dem, was ich geglaubt hatte, der Wahrheit entsprach. Und wenn die Lügen aufgedeckt wurden und der Wahrheit wichen, kam mir auch diese fragwürdig vor. Lügen über Lügen. Der Baron war entweder an der Nase herumgeführt worden oder hatte uns an der Nase herumgeführt, und ich hatte einen Hornmann gesehen, der möglicherweise alle Pläne vereiteln konnte, die wir hier verfolgten. Wahrscheinlich waren wir schon so gut wie tot. Ich hatte die Gelegenheit verpasst, dem Captain zu berichten, was ich gesehen hatte. Nun hatte ich eine ganze Menge zu verdauen. In meinem Kopf drehte sich alles, als ich den Federkiel und die Tinte aus dem Schreibkasten holte. Als dann die Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand waren, überlegte ich, ob ich wieder zum Jahrmarkt gehen sollte, solange ich noch die Gelegenheit dazu hatte. Die Dämmerung hatte längst eingesetzt, und inzwischen beleuchteten Laternen die Stellen, die von der schwachen, schwindenden Sonne nicht mehr erreicht wurden. Die Besucher des Jahrmarkts bemühten sich vermutlich, auch noch das letzte bisschen an Vergnügen oder Zügellosigkeit mitzunehmen, oder was sie auch sonst in Zechingen zu finden hofften, ehe die Sperrstunde ausgerufen wurde. Ich hatte allerdings keine Ahnung, was der angeschlagene und verletzte Hornmann jetzt tun würde. Würde er mich seinen Vorgesetzten melden? Wahrscheinlich nicht, denn er musste damit rechnen, ausgepeitscht zu werden, weil er es nicht schon viel früher getan hatte. Hatte er große Angst? War er in seiner Unterkunft oder in einem eigenen Zimmer und durchdachte alle Möglichkeiten, genau wie ich?
Einen kleinen Augenblick lang spielte ich mit dem verrückten Gedanken, nicht etwa in den Strom der Jahrmarktbesucher einzutauchen, sondern vielmehr die Kaserne der Hornmänner aufzusuchen. Wenn ich mit dem jungen Soldaten sprach, konnte ich vielleicht … was denn eigentlich? Ihn an den Schwur erinnern, den er abgelegt hatte, als er so verängstigt gewesen war, dass er sich beinahe in die Hose gemacht hätte? Er würde ja keinesfalls auf die Idee kommen, mich auf der Stelle doch noch seinen Vorgesetzten zu melden, oder?
Nein, es wäre sehr dumm, den Traurigen Hund