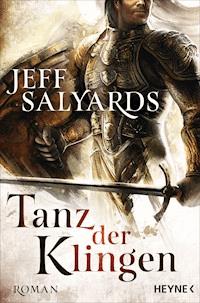
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Klingen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Von Captain Braylar Killcoin, dem ebenso raubeinigen wie rätselhaften Anführer einer syldoonischen Söldnertruppe, sagt man, er sei hinterhältig, blutrünstig und würde sogar seine eigene Mutter an den Teufel verscherbeln. Eines Tages heuert Killcoin den jungen Chronisten Arki an – er soll die Söldner auf einer geheimen Mission begleiten und ihre Taten schriftlich festhalten. Für Arki beginnt das größte Abenteuer seines Lebens. Ein Abenteuer, das er jedoch erst einmal überleben muss, bevor er es niederschreiben kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Ähnliche
Das Buch
Der junge Arkamondos, kurz Arki genannt, verdient seinen Lebensunterhalt als Schreiber: Er verfasst Briefe, führt die Bücher reicher Kaufleute und … er langweilt sich dabei zu Tode. Wie gerne würde er einmal richtige Abenteuer und Schlachten erleben – etwas, das niederzuschreiben sich lohnt. Als Arki eines Tages einer Truppe syldoonischer Söldner begegnet, lässt er sich kurzerhand von deren Anführer Braylar Killcoin als Chronisten für ihren nächste Mission anheuern, obwohl er den schlechten Ruf der Syldooner ganz genau kennt: kaltblütig und brutal, schrecken sie vor keiner Schandtat zurück. So sagt man. Und Killcoin sei der Schlimmste von allen. So sagt man. Arki ist noch nicht lange mit seinen neuen Reisegefährten unterwegs, als er begreift, dass die Syldooner noch viel schlimmer sind als ihr Ruf und dass seine naiven Träume von Abenteuer und Heldentum nichts mit der Realität zu tun haben. Denn das, was Killcoin und seine Männer vorhaben, könnte sie nicht nur alle den Kopf kosten, sondern das gesamte Königreich Anjurien zerstören …
Der Autor
Jeff Salyards wuchs in einem kleinen, verschlafenen Ort nördlich von Chicago auf. Schon früh träumte er sich in laute und chaotische Welten voller unzähmbarer Charaktere. Seine Faszination für die Fantastik hat er niemals verloren, die mit den Jahren dunkler und durchdachter wurde. Der Autor lebt mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in der Nähe von Chicago.
JEFF SALYARDS
TanzderKlingen
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
SCOURGE OF THE BETRAYER
Deutsche Übersetzung von Jürgen Langowski
Deutsche Erstausgabe 07/2016
Redaktion: Rainer Michael Rahn
Copyright © 2012 by Jeff Salyards
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Umschlagillustration: Melanie Korte
Karte: William MacAusland
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-19081-1V001
www.heyne.de
Für meine Mutter und meinen Vater
1
Mein neuer Herr stieg vom Planwagen. Seine dunklen Haare waren zurückgekämmt; sie sahen aus wie nasses Otterfell. Gleichmütig ließ er den Blick über den Stallhof wandern. Er verweilte kurz bei mir, ehe er sich weiter umsah, und wie schon hundertmal, seit ich die Stelle angenommen hatte, wurde mir bewusst, dass diese Aufgabe anders würde als jede Arbeit, die ich bisher verrichtet hatte.
Captain Braylar Killcoin winkte mich zu sich, während er mit einem jungen Berittenen sprach. Seit der ersten Einweisung vor einigen Tagen hatte ich den Captain nicht mehr gesehen. Da war er mir aufgeräumt und guter Dinge begegnet, jetzt war er müde und voller Straßenstaub.
Als ich zum Wagen ging, nickte der junge Soldat dem Captain zu und ritt mir entgegen. Obwohl es reichlich Platz zum Ausweichen gab, hielt er direkt auf mich zu. Ich wich bis an die Scheune zurück, doch er lenkte sein Reittier unbeirrt in meine Richtung und hielt erst an, als die mächtigen Schultermuskeln direkt vor meinem Gesicht zuckten. Ich umklammerte meinen Ranzen und bemühte mich, standhaft zu bleiben, obwohl mir die Hufe beinahe die Füße zertrampelten und mich die Schwertscheide des Burschen in die Seite knuffte. Der Soldat beugte sich vor, ein Bataillon von Sommersprossen rückte näher, das Kinn mit dem Quast hellblonder Haare war ein wenig drohend gereckt. »Ein guter Rat?«
Ich war nicht sicher, ob er den Rat erbat oder anbot. »Verzeihung?«
Er nickte in die Richtung des Wagens. »Was die Reise mit dem Captain angeht.«
Das schuf immer noch keine Klarheit, wer nun einen Rat zu geben hatte, aber ich nahm an, dass er mir etwas sagen wollte, und nickte, was ihn hoffentlich ermunterte, sein Pferd weiterlaufen zu lassen.
Breit grinsend zeigte er mir die Zähne. »Lass dich nicht umbringen.« Dann ruckte er an den Zügeln und verschwand um die Ecke.
Ja, dies war etwas ganz anderes, als die Geschichten von Müllern, Kaufleuten und kleinen Adligen aufzuzeichnen. Ich näherte mich Braylar, als eine Frau ihr Pferd um den Wagen herumführte. Beide, Frau und Tier, waren klein, stämmig und zottelig. Die kupferbraune Haut und das pechschwarze Haar wiesen sie auf den ersten Blick als Grashündin aus. Sie trug Hose und Hemd wie ein Mann. Ich fragte mich, was eine Nomadin in der Gesellschaft eines syldoonischen Kommandanten zu suchen hatte, während sie sich möglicherweise nicht ganz zu Unrecht Gedanken machte, warum nun auch ein Schreiber mit von der Partie war. Und niemandem hätte man Vorwürfe machen können, wenn er sich fragte, was der Syldooner in dieser Gegend trieb, ob er nun Nomaden und Schreiber bei sich hatte oder nicht. Das alles war höchst eigenartig.
Sie betrachtete mich, wie ein erfahrener Viehhirte eine Kuh mustern mochte. Entschlossen, mich nicht einschüchtern zu lassen, beäugte ich sie ebenfalls ausgiebig und hielt inne, als ich sah, dass die Finger und der Daumen der linken Hand amputiert waren. Nur die jeweils ersten Fingerglieder waren erhalten geblieben. Ich hatte nicht die Absicht, sie zu begaffen, und doch tat ich es. Sie wackelte mit den Stummeln vor meiner Nase. Es sah aus wie das Todeszucken eines dicken braunen Käfers, der auf dem Rücken lag. Ich schluckte und wandte den Blick ab.
»Dünn ist er«, sagte die Frau zum Captain.
»Das ist mir gar nicht aufgefallen.«
»Und zimperlich.«
»Das ist mir durchaus aufgefallen«, erklärte Captain Killcoin. »Egal. Dir fehlen Fingerglieder, ihm mangelt es an innerer Kraft, aber beide Mängel werden sich nicht als übermäßig gefährlich erweisen, Lloi. Sorge nur dafür, dass Vendurro Glesswik auch wirklich herholt. Die beiden sollen nicht in einem Fass ertrinken.«
Ich drehte mich um, als sie ging, und stieß beinahe mit dem Stallburschen zusammen, der Braylar Bericht erstattete. »Euer Mann da drinnen hat mir gesagt, ich solle den anderen Wagen herrichten, was ich getan habe. Er steht in der Scheune bereit. Der Wagen, meine ich. Wo Euer Mann ist, weiß ich nicht.« Der Junge verrenkte sich den Hals und betrachtete den Wagen hinter Braylar. »Ein schönes Fahrzeug habt Ihr da. Warum wollt Ihr jetzt das andere haben?«
Braylar schnippte mit den Fingern, um den Burschen zur Ordnung zu rufen. »Kennst du dich mit Pferden aus, Junge? Oder hat man dich nur eingestellt, weil du so gut Mist schaufeln kannst?«
»Es gibt keinen Besseren.«
»Mit den Pferden oder dem Mist?«
»Mit den Pferden, meine ich. Euer Mann sagte, ich solle bereit sein, wenn der Captain eintrifft. Wovon seid Ihr denn der Captain? Ihr seid kein Offizier der Hornmänner, so viel ist sicher, und das einzige Meer weit und breit ist hier dasjenige aus Gras. Also nehme ich an, Ihr habt gar kein Schiff. Es sei denn, es wäre ein Flusskahn, aber es wäre schon komisch, wenn sich da jemand Captain nennt. Die sind ja so klein. Seid Ihr …«
Braylar warf dem Jungen eine Silbermünze zu, die dieser aus der Luft schnappte. Er drehte sie herum, betrachtete die Prägung genauer und pfiff durch die Zähne. Die vorherigen Fragen hatte er völlig vergessen.
»Davon wartet noch eine auf dich, wenn du dich so gut um die Pferde kümmerst, wie du plapperst.«
Der Junge kniff die Augen zusammen. »Ehrlich?«
»Ehrlich. Aber ich erwarte die allerbeste Pflege. Hast du Äpfel?« Der Junge nickte. »Salz zum Lecken?« Wieder ein Nicken. »Klee?«
Der Bursche wollte nicken, hielt aber inne. »Ich glaube schon. Ich muss nachsehen. Eigentlich müsste etwas da sein.«
»Sehr gut. Kümmer dich um die Pferde, und nimm den beiden da hinten die Sättel ab. Bei der braunen Stute mit dem schwarzen Sattel musst du aufpassen. Sie heißt Grimm, und das aus gutem Grund. Sie mag überhaupt niemanden, was mich selbst einschließt. Pass auf, dass sie dich nicht ins Gesicht beißt. Wenn du Klee findest, verbessern sich deine Aussichten erheblich. Behandle die Tiere, als gehörten sie dem Baron persönlich, und du wirst deine Belohnung erhalten.«
Wieder betrachtete der Junge die Münze. »Den Baron habe ich ein- oder zweimal gesehen, wie er mit einer großen Gefolgschaft vorbeigeritten ist. Er hat nicht angehalten und mir keine Münzen gegeben.« Er sah Braylar an. »Ich behandle sie wie die Pferde des Königs, ja … als gehörten sie dem König selbst.« Das verkündete er mit einer beinahe erschreckenden Ernsthaftigkeit.
Als Braylar ihm auf die Schulter klopfte, fuhr der Junge auf wie von einer Wespe gestochen und rannte zum Wagen. Zwischen den Pferden bewegte er sich wieder vorsichtiger, berührte hier eines am Hals oder redete dort leise auf ein anderes ein. In der Gesellschaft der Tiere schien er sich viel wohler zu fühlen.
Lloi kehrte mit zwei Männern zurück. Der Reiter, der mich an die Scheunenwand gedrängt hatte, hieß vermutlich Vendurro. Der andere, der demnach Glesswik sein musste, hatte ein schmales Gesicht voller schmutziger Flecken und Pockennarben, als hätte man ihn in Brand gesteckt und das Feuer mit der Spitzhacke gelöscht. Er sagte: »Willkommen, Captain. Ich habe mich schon gefragt, ob dich die Hündin hier im Gras auf Abwege geführt hat.«
»Wenn ich dich an der Nase gepackt hätte, dann wären es wohl wirklich weitläufige Abwege geworden«, gab sie darauf zurück.
Braylars Mundwinkel zuckten, als hätte man sie bei einer Missetat erwischt, und zogen zwei winzige Narben mit. Dann verwandelte sich das Zucken in ein Lächeln. Oder in etwas Ähnliches. »Bringt alles zu dem neuen Wagen, und sorgt dafür, dass unser … Beutestück in eurem Zimmer verstaut wird. Schließt ja gut ab. Trödelt nicht, und zieht nicht die Aufmerksamkeit der Leute auf euch. Verstanden?«
Vendurro und Glesswik wollten gleichzeitig die Fäuste heben, doch Braylar winkte ab und sah sie mit finsterer Miene an. »Ist das etwa eure Vorstellung von diskretem Vorgehen? Habt ihr jedem Mädchen, bei dem ihr gelegen habt, erzählt, ihr wärt die Geißel von Syldoon?«
Vendurro errötete unter den Sommersprossen. »Entschuldigung, Cap. Die Macht der Gewohnheit.«
»Kümmert euch um die Wagen, ihr Trottel. Und ärgert mir nicht den Stallburschen, sonst bekommt ihr es mit mir zu tun.«
Sie unterdrückten den Impuls, noch einmal zu salutieren, und verzogen sich hinter den Wagen. Captain Killcoin ging unterdessen, von Lloi gefolgt, zur Schenke. Sie trug eine kleine Kiste, auf der eine Armbrust und ein Köcher balancierten. Ich beeilte mich, ihnen zu folgen.
Das Gebäude hatte zwei Stockwerke, die grauen Wände mussten dringend getüncht werden. Sonst wirkte es solide und gut unterhalten. Das Strohdach war anscheinend erst vor Kurzem erneuert worden, das Weidengeflecht und der Lehm waren intakt und ordentlich geflickt.
Ein Fass hielt die Tür des Gasthofs weit offen, um frische Luft hereinzulassen. Der Boden war mit Holz ausgelegt. Von den vielen Füßen, die ihn im Laufe der Jahre betreten hatten, war er abgewetzt und hell, besonders direkt vor der Theke. An den Wänden hingen einige eiserne Lampen, die im Augenblick nicht brannten, über dem kalten Kamin waren zwei große Fenster mit weit geöffneten Läden. Dank der Fenster und der offenen Tür war es in dem Schankraum außerordentlich sonnig. In den breiten Lichtbalken sah man die Staubflocken tanzen. Ringsherum waren ein Dutzend kleine runde und zwei lange Tische aufgestellt und mit Stühlen ausgestattet. Nur wenige waren besetzt.
Ich war in einer Schenke wie dieser aufgewachsen, sie hatte sich jedoch an der Straße zwischen Schwarzmoos und Alttal befunden und nicht mitten in einem Ort. Allerdings waren alle Schenken einander ähnlich – klebriger Boden, der Geruch von schalem Bier, schäbige Möblierung, Rauch- und Rußflecken an den Wänden und der Decke –, und in jeder, die ich betrat, kamen die gleichen hässlichen Gefühle in mir hoch.
Wir gingen zur Theke, wo Braylar den Wirt herbeirief. Das einzig Weiche an dem vierschrötigen Mann war die Knollennase.
Als er vor uns stand, sagte Braylar: »Ist das dein Junge da im Hof?«
Der Wirt schien betroffen. »Martiss. Was ist mit ihm? Was hat er jetzt schon wieder angestellt?«
»Man muss dich beglückwünschen. Er versteht sich darauf, mit Pferden umzugehen. So etwas findet man heute selten.«
»Damit habe ich nichts zu tun. Ich mag die Biester nicht. Aber er wohnt praktisch da draußen und sollte sich mit den verdammten Viechern auskennen.« Er wischte sich die Hände an der schmutzigen Schürze ab. »Ich bin Hobbins. Willkommen im Drei Fässer. Wollt Ihr essen? Trinken? Freie Zimmer haben wir nicht mehr, aber im Schankraum ließen sich vielleicht noch drei Schlafplätze finden, wenn Ihr bleiben wollt.«
»Wir brauchen keine neuen Zimmer«, erklärte Lloi. »Das ist schon geklärt. Ein stachliger Dreckskerl. Er muss schon ein paar Tage hier sein, du hast ihn bestimmt gesehen.«
Hobbins fuhr sich mit der Zunge über die unteren Schneidezähne und schürzte die Lippen. »Ein Kerl wie ein wilder Keiler und halb so freundlich?« Lloi nickte. »Jo, den habe ich gesehen.« Er wandte sich wieder an Braylar. »Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht gern Zimmer an Leute vermiete, die noch gar nicht da sind. Ich will sehen, wer unter meinem Dach schläft. Aber ich dachte, er würde gleich sein großes Hackmesser ziehen, deshalb habe ich eine Ausnahme gemacht.« Er blickte Lloi an und fügte trotz ihrer Klinge und der Armbrust hinzu: »Aber für ihresgleichen mache ich nicht gern Ausnahmen. Die Sorte beunruhigt die anderen Gäste.«
Lloi wollte etwas sagen, doch Braylar kam ihr zuvor. »Sie beunruhigt auch mich. Aber keine Sorge, sie wird nicht unter deinem Dach schlafen.«
Wenn Hobbins besänftigt war, dann ließ er es sich nicht anmerken. Es schien, als müsste er auf den nächsten Worten ein wenig herumkauen, ehe er sie über die Lippen brachte. »Also braucht Ihr wohl Essen und Getränke.«
»Genau. Gibt es vielleicht auch eine Badewanne, um den Straßenstaub abzuwaschen?«
»Wannen haben wir nicht. Hab keine Zeit, das Wasser aufzuwärmen. Kleine Familie, großer Gasthof. Hinten stehen aber ein paar Fässer mit Wasser. Klettert nur nicht hinein. Ich hab keine Zeit, kaputte Fässer zu reparieren.«
»Und Seife?«
»Natürlich haben wir Seife. Reicht aus, um sich die Haut abzuschrubben, ist aber nicht parfümiert oder so. Einfach nur gute Seife. Wenn Ihr essen wollt, müsst Ihr euch an einen Tisch setzen. An der Theke wird kein Essen serviert. Ich halte meine Theke so sauber wie ein Priester sein Spundloch.«
»Wie überaus gewissenhaft.«
Hobbins ließ sich nicht anmerken, ob er Braylars Sarkasmus überhaupt verstanden hatte. Er holte einen Schlüssel hinter der Theke hervor und gab ihn Braylar. »Das Zimmer ist die Treppe hinauf, das letzte auf der linken Seite. Setzt Euch an einen Tisch, wenn Ihr Euch gewaschen und eingerichtet habt. Syrie wird dann Eure Bestellungen aufnehmen.«
»Sehr gut. Und die Fässer, die ich keinesfalls mit Badewannen verwechseln darf?«
Hobbins streckte einen knochigen Finger aus. »Da hinten steht im Augenblick nur eins. Gleich da draußen.«
Wir gingen die Treppe hinauf und schlossen auf. Das Zimmer war nicht gerade üppig – zwei durchgelegene Betten, ein Tisch und eine Bank –, aber als Braylar sich an Lloi wandte, konnte man meinen, wir hätten uns in einer Leprakolonie eingenistet. »Kein Fenster? Ein Zimmer im ersten Stock, aber kein Fenster?«
Sie stellte die Kiste ab und sah sich um, ob sie nicht in einer Ecke vielleicht doch ein kleines Fenster übersehen hätte, dann zuckte sie mit den Achseln. »Wie du dich erinnern wirst, bin ich mit dir geritten und habe nicht deine Zimmer gemietet. Wenn du ein Problem damit hast, dann lass es an diesem Hurensohn von Mulldoos aus.«
»Als jemand, der in dieser Gegend sehr unbeliebt ist, solltest du nicht unbedingt den Einzigen piesacken, der dich hier zu beschützen geneigt ist.«
»Ich kann mich ganz gut selbst beschützen. Außerdem, wenn hier überhaupt irgendjemand irgendetwas beschützt, dann …«
»Genug, Lloi.« Es klang recht sanft, doch seine Miene ließ sie sofort innehalten.
Sie sah mich an, dann wieder ihn. »Na gut. Kein Piesacken mehr. Brauchst du mich jetzt noch für irgendetwas, Captain Schlinge?«
»Was ich dir gesagt habe, war ernst gemeint. Hüte heute Abend deine Zunge.«
Sie warf ihm einen undurchdringlichen Blick zu, sah noch einmal mich an und schwieg.
»Du reitest schon eine Weile mit uns. Lange genug, um mit ihm zurechtzukommen.«
»Oh, wir kommen hervorragend zurecht. Er hätte nichts dagegen, wenn meine Eingeweide auf dem Boden verstreut werden, und ich würde nicht sehr laut weinen, wenn es seine wären. Unsere Beziehung ist sehr einfach zu erklären.«
Seufzend holte Braylar ein frisches Hemd aus der Kiste. »Vergewissere dich, dass mein Pferd nicht den Stallburschen umgebracht hat.« Lloi ging zu den Stallungen, und wir begaben uns zu den Fässern hinaus. Sobald wir die Tür hinter uns geschlossen hatten, schnürte Braylar die Halbstiefel auf und sagte: »Halte jeden auf, der hier herauskommen will.«
Ich war unbewaffnet und sah aus wie ein Bücherwurm, der niemanden von irgendetwas abhalten konnte. Deshalb fragte ich ihn, wie ich das seiner Ansicht nach schaffen sollte.
Er antwortete: »Sage den Leuten, dein Herr sei außerordentlich prüde. Und gewalttätig.«
Also stand ich neben der Tür und sah Braylar zu, wie er die Waffen abschnallte. An der rechten Hüfte trug er einen sehr langen Dolch, links einen kleinen Stahlschild und seinen garstigen Flegel. Schon während unseres ersten Gesprächs war mir die Waffe seltsam vorgekommen, aber erst jetzt ergab sich die Gelegenheit, sie mir näher anzusehen. Die beiden Köpfe ähnelten monströsen Gesichtern, waren aber stilisiert – es gab jeweils einen Mund, der anscheinend wütend oder vor grässlichem Schmerz zusammengepresst war, und eine Art Nase, aber davon abgesehen weder Augen noch Ohren. Wo sie hätten sein sollen, befanden sich einfach nur Ringe von Dornen, die wie Haarkränze auf den Kugeln saßen. Die Köpfe waren auch nicht sehr groß, die Ausmaße entsprachen in etwa einer Kinderfaust, aber ich war sicher, dass sie erheblich härter treffen konnten.
Obwohl man diese Gesichter kaum noch zu sehen bekam – je nachdem, woher man stammte, waren sie verboten, geschmäht oder weitgehend vergessen –, erkannte ich sofort, dass die mit Dornen besetzten Köpfe die Fluchtgötter darstellten. Das war seltsam. Nicht so sehr, weil ein Syldooner eine Waffe mit heiligen Abbildern besaß, die bei den Gegnern Unruhe zu stiften vermochten – so etwas sah ihnen durchaus ähnlich –, sondern weil so ein Mann überhaupt irgendeinen mit derartigen Symbolen geschmückten Gegenstand besaß. Dass sie fromm waren, konnte man den Syldoonern gewiss nicht vorwerfen. Es hieß, selbst wenn sie von ihrem Geld zwölf Tempel bauen ließen, würden sie niemals auch nur einen einzigen davon betreten.
Der Captain nahm das Halstuch ab, und nun begriff ich, warum er einen Wächter brauchte. Die Tätowierung am Hals, die syldoonische schwarze Schlinge, war mehr als deutlich zu erkennen. Als er das Hemd über den Kopf zog, erkannte ich einen weiteren Grund dafür, dass er lieber ungestört baden wollte. Der ganze Oberkörper war eine wahre Landkarte von Narben jeglicher Art – lang und bleich, kurz und wellig. Da ich an diesem Tag schon einmal den Fehler begangen hatte, zu lange zu starren, richtete ich den Blick rasch auf die Tür.
Als einfacher Chronist, der niemals reichen Herren gedient hatte, war ich nicht an parfümierte Seife und Kupferbadewannen gewöhnt. Ich suchte gewöhnlich öffentliche Bäder auf und musste mich oft ganz hinten anstellen. Mit einem Fass hatte ich mich allerdings noch nie begnügen müssen. Ich fragte mich, warum sich ein syldoonischer Captain herabließ, in so einem Wirtshaus abzusteigen. Er hätte sich sicherlich eine bessere Bleibe leisten können. Diese Leute galten als prahlerisch und extravagant, und selbst wenn er seine Herkunft verschleiern wollte, hätte er sich für ein Wirtshaus mit einer richtigen Badewanne, ob aus Kupfer oder nicht, entscheiden können. Ich wurde neugierig.
Als ich zusah, wie sich das Wasser schwarz färbte, fragte ich mich, was er seit unserem letzten Gespräch getan hatte. Anscheinend war er weit und bis zur Erschöpfung geritten. Auch in dieser Hinsicht hielt ich lieber den Mund. Der Captain schien kein Mann zu sein, der bohrende Fragen duldete. Wahrscheinlich nicht einmal solche, die gar nicht bohrend waren.
Sobald er sich abgewaschen und trockengerubbelt hatte, zog er sich an und kehrte mit mir ins Zimmer zurück. Zu meiner Überraschung erwarteten uns zwei Leute, die ich ebenfalls für Syldooner hielt. Beide hatten die kleinen Kapuzen ihrer Umhänge mit gefärbten Schnüren zusammengerafft, sodass die Hälse bedeckt blieben.
Einer stand und hatte sich an einen Balken gelehnt. Die dunkle Haut hob sich kaum von dem Holz hinter ihm ab. Er war unglaublich groß und keineswegs schlank zu nennen und hatte einen zu vielen kleinen Zöpfen geflochtenen langen Bart, der bis auf die Brust reichte. Er sah mich an, musterte mich einen Moment lang kühl und nickte schließlich langsam. Die Geste war nicht unbedingt warm oder herzlich, aber doch zumindest recht freundlich. Ich war nicht sicher, aber ich glaubte zu erkennen, dass ein kleines Lächeln um seine Lippen spielte. Verglichen mit den anderen, die gedämpfte Erdfarben und einfach geschnittene Sachen trugen, wirkte er ausgesprochen fremdartig. Die schwarz-weiß gestreifte Hose hätte für sich genommen noch nicht sehr viel Aufmerksamkeit erregt, aber sie verschwand in grellroten ledernen Reitstiefeln, deren Stulpen über den Knien umgeschlagen waren. Die ebenfalls hellrote Kapuze fiel umso mehr auf, da sie mit allen möglichen Dingen, darunter sogar abgebrochene Zähne, geschmückt war. Hinten hing ein langer Streifen Tuch bis zum Kreuz hinunter. Auch der Streitkolben, den er an der Hüfte trug, war für ein Gerät, mit dem man jemanden zu Tode prügeln wollte, übermäßig geschmückt.
Der zweite Mann saß und war mit einem hässlich aussehenden Falchion ähnlich gut bewaffnet. Anscheinend legten die Syldooner die Waffen nie ab, selbst wenn nicht unmittelbar ein Kampf auszubrechen drohte. Offenbar hatte er gerade gesprochen und quittierte die Unterbrechung durch mich mit einem Blick, der sonst ausgesprochen großen Dunghaufen vorbehalten blieb. Sein Haar war kurz geschnitten und hellblond, beinahe schon weiß. Die Haut war hell, und nach dem Körperbau – breit und schwer und voller Muskeln – hielt ich ihn für Mulldoos. Alles an ihm wirkte hart, wenn man von den Augenbrauen absah, die eher zu einer zierlichen Frau gepasst hätten. Er wandte sich an Braylar und sagte etwas in einer Sprache, die ich nicht verstand.
Braylar antwortete: »Sprich bitte Anjurisch. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu sein.«
Er kniff die Augen zusammen und musterte mich noch einmal. Dann sagte er zu seinem Gefährten: »Was meinst du? Länger oder kürzer? Ich tippe auf kürzer.«
Als der andere Mann meine verwirrte Miene sah, lachte er. »Ich wette, der hier macht es erheblich länger als die anderen. Ich habe ein gutes Gefühl.«
Braylar sah mich an. »Die beiden sind meine Leutnants, wie du vielleicht schon vermutet hast. Der hellhäutige Keiler da ist Mulldoos Kleinbach. Er ist der Ansicht, wir brauchen keinen Chronisten, aber …«
Mulldoos fiel ihm ins Wort. »Der Kaiser befiehlt es, also brauchen wir einen. Ich habe nur Einwände gegen die Person. Ich meine nach wie vor, wir sollten einen Syldooner nehmen. Einen Mann im Ruhestand, er kann ruhig versehrt sein …«
Braylar ging nicht weiter darauf ein. »Du könntest versuchen, ihn für dich einzunehmen, aber das tust du auf eigene Gefahr. Der große Spaßvogel da ist Vatinos von Steineiche, genannt Hackspeer. Ob er dich mag oder nicht, liegt ganz bei dir. Hackspeer kümmert sich um Nachschub und Quartier. Das ist einfacher als früher, da unsere Truppe verkleinert wurde, damit wir uns diskret um … gewisse Dinge kümmern können. Mulldoos sorgt in unserer kleinen Truppe für Disziplin und Kampfbereitschaft. Beide beraten mich in strategischer Hinsicht.«
»Was du regelmäßig ignorierst«, sagte Mulldoos.
»Das sind die Privilegien eines Captains. Wie ihr zwei offenbar schon erraten habt, ist Arkamondos hier unser neuer Schreiber.«
Hackspeer nickte, Mulldoos reagierte nicht. Ich setzte mich auf eine Bank, während Braylar sich an die Leutnants wandte. »Sind wir jetzt bereit?«
Mulldoos schloss die Augen und lehnte sich auf dem Stuhl zurück. »Von mir aus ist alles klar.«
Hackspeer fügte hinzu: »Wir haben nur noch auf dich gewartet, Captain. Hast du …« Er hielt inne und warf mir einen kurzen Blick zu, ehe er weitersprach. »Hast du auf deiner Reise alles erledigen können, was du wolltest?«
»Das habe ich. Vendurro und Glesswik bewachen unsere neue Fracht. Sorgt dafür, dass sie ihre Sache gut machen.« Er sah Mulldoos scharf an. »Das schließt Nachschub wie Disziplin ein. Wir kommen gleich hinunter.«
Mulldoos stand auf und ließ den Kopf auf dem mächtigen Hals kreisen. Hackspeer folgte ihm hinaus.
Braylar setzte sich aufs Bett. Das Holz knarrte, als sich die Seile unter der Matratze straff spannten. Ich war nicht sicher, was ich tun sollte, also verhielt ich mich ruhig und wartete. Schließlich verschränkte er die Arme hinter dem Kopf und sah mich an. »Hast du deine Federkiele und das Pergament dabei?«
Ich nickte, und er fuhr halb im Scherz fort: »Ich weiß nicht, ob ich dich gut leiden kann, Arkamondos. Du bist mir ein wenig zu vorwitzig, aber irgendwie habe ich auch eine Schwäche für dich. Trotzdem, wir sollten hier etwas ganz unmissverständlich festhalten. Ich habe dich nicht angeheuert, weil du der kunstfertigste Schreiber bist, und ich habe dich gewiss nicht in Lohn und Brot genommen, weil du der größte Dichter bist. Vielmehr habe ich mich für dich entschieden, weil du angeblich nichts übersiehst. Es heißt, du seist aufmerksam und hättest einen flinken Verstand. Ich will, dass du alles erfasst, und du behauptest ja, du seist dazu imstande. Also … übersieh ja nichts. Zeichne alles auf. Ganz egal, wie widersinnig oder dumm es dir in dem betreffenden Moment erscheinen mag. Abschweifungen, Ausuferungen, Beobachtungen. Alles. Aber du sollst die Aufzeichnungen nicht mit Poesie besudeln. Das ist unsere Abmachung, so lautet unser Vertrag. Du bist angeheuert, um alles aufzuzeichnen. Also nimm deine Stifte und die Tinte und notiere über das heutige Treffen, was du willst.«
Er schloss die Augen und war schneller eingeschlafen, als ich es für möglich gehalten hätte, schon bevor ich meine Schreibutensilien hervorgeholt hatte. Eine Weile später, als mein Federkiel über die Seite kratzte, während ich meinen kurzen Bericht verfasste, schlug er die Augen wieder auf und richtete sich sofort auf. »Sehr gut. Nun denn, Arki, mein junger Schreiber, jetzt sollten wir aufhören und uns die Bäuche mit dem hiesigen Essen vollschlagen. Morgen geht es auf die Straße.«
Ich sah ihn an und blinzelte wahrscheinlich einige Male verdutzt. Dann fragte ich: »Die Straße?«
»Ja«, antwortete er. »Wir brechen auf. Wir fahren, wir reisen und verweilen nicht. Morgen nach dem Frühstück.«
»Aber … aber davon habt Ihr nichts gesagt. Unser Vertrag …«
»Du hast recht, davon habe ich nichts gesagt. Außerdem habe ich nicht erwähnt, wo unsere Gespräche stattfinden sollen. Du hast vermutlich angenommen, es solle alles hier in Flusstal geschehen. Wie unglücklich. Aber wenn du dich geirrt hast, dann musst du dir mindestens zum Teil auch selbst den Vorwurf machen, dass du keine genaueren Fragen gestellt hast. Du hast weder Frau noch Kinder, ja? Und so gut wie keine Freunde, wie ich vermute?«
Das war grob, aber ich protestierte nicht, als er fortfuhr. »Was du auch zurückzulassen glaubst, bedenke, was du gewinnen kannst. Du wirst für deine Dienste gut entlohnt, aber ich kann dir etwas noch Wichtigeres geben als Münzen. Ruhm. Ruhm, weil du der Archivar einer erstaunlichen Geschichte sein sollst. Ich hätte auch einen anderen Schreiber anstellen können, um sie aufzuzeichnen, aber ich habe mich für dich entschieden. Für dich unter vielen anderen. Du wirst die seltene Gelegenheit bekommen, aus erster Hand etwas ganz Außergewöhnliches festzuhalten. So viel kann ich dir im Augenblick schon sagen: Alle Reiche brechen zusammen, alle Grenzen verändern sich, alle Königreiche müssen sterben. Dort, wo ich dich hinführe, kannst du den Tod eines politischen Gebildes beobachten, den Niedergang einer Lebensart, die Neuzeichnung einer Karte. Etwas Einzigartiges und Unbezahlbares. Also erspar uns dein belämmertes Gesicht und lass uns ein wenig von Hobbins’ Schlempe essen. Mir knurrt schon der Magen.«
Der Captain hatte eine gute Entscheidung getroffen, auch wenn sein Tonfall und die Wortwahl beleidigend waren. Er hatte meine Bindung an Flusstal völlig richtig beschrieben – ich hatte keine Angehörigen, oder jedenfalls keine, die mich in den letzten Jahren als einen der Ihren bezeichnet hätten, und keine nennenswerten Freunde. Die Verheißung, an etwas beteiligt zu sein, das bedeutender war als mein Leben – das zugegebenermaßen bis zu diesem Punkt weder sinnvoll noch bemerkenswert verlaufen war –, fand ich aufregend, auch wenn ich mich darauf beschränken sollte, zu beobachten und alles niederzuschreiben. Wenigstens würde ich etwas erleben, das niederzuschreiben sich lohnte. Wenn ich noch einen Wälzer über das Wirken eines selbstgefälligen Händlers verfassen musste, würde ich mir einen Federkiel ins Auge stoßen.
Captain Killcoin ging zur Tür. Da das Gespräch offensichtlich beendet war, verstaute ich meine Sachen und folgte ihm.
2
Benommen stieg ich hinter meinem neuen Herrn die Treppe hinunter. Ich lebte schon eine Weile in Flusstal und war davon ausgegangen, mich könne höchstens der Mangel an Arbeit aus der Stadt treiben, aber gewiss nicht ein syldoonischer Kommandant, den ich bei einer geheimnisvollen Mission begleiten musste. Niemand folgte einem Mann wie diesem, wenn es irgendwie zu vermeiden war. Und doch stolperte ich nun hinter einem solchen Mann her. Er hatte sich das Halstuch wieder über die Tätowierungen gezogen – zweifellos wollte er verbergen, woher er kam. Am liebsten hätte ich es für alle im Gasthof unüberhörbar herausgeschrien: »Ich reise mit dem Syldooner!«
Ich hatte schon einige Male mit Soldaten zu tun gehabt – gelegentlich sogar schon als Knabe im Schreienden Schakal, wenn man mich in den Schankraum gelassen hatte, manchmal auch auf meinen späteren Reisen –, aber noch nie hatte ich einen von ihnen tatsächlich begleitet. Für sie schien Gewalt Frage und Antwort zugleich zu sein, und das machte mich ziemlich nervös. Da meine Nerven sowieso nicht die besten waren, mied ich die Krieger, soweit es überhaupt möglich war.
Obendrein war der Syldooner nicht einmal ein gewöhnlicher Soldat. Die Aussicht, längere Zeit für diesen Mann zu arbeiten und mich in seiner Gesellschaft zu befinden, war gleichermaßen aufregend wie beängstigend. Aufregend, weil sich mir eine einzigartige Gelegenheit bot. Auch wenn er in Bezug auf die Einzelheiten nicht gerade sehr offen war, begriff ich rasch, dass es um eine bedeutende Angelegenheit ging. Wenn ich mich als Chronist etablieren wollte, dessen Schriften man genau verfolgen musste, gab es keine bessere Möglichkeit, als einem Herrn zu folgen, der Großes vorhatte.
Beunruhigend war und blieb natürlich, dass er ein Syldooner war. Ich war zwar kein gebürtiger Anjurier und hatte keinerlei eigene Erfahrungen mit den Syldoonern, aber die Geschichten über ihre Grausamkeit und ihr verräterisches Wesen waren mir gut bekannt. Ich hielt das alles für übertrieben, weil solche Geschichten gewöhnlich von jedem Erzähler weiter ausgeschmückt wurden. Andererseits musste es auch einen wahren Kern geben, und selbst wenn nur ein kleiner Bruchteil davon der Wahrheit entsprach, musste man nachdenklich werden. Sehr nachdenklich sogar.
Meine Mutter hatte immer gesagt, den Syldoonern ginge man am besten aus dem Wege, und wenn man das nicht konnte, sollte man sie so gut wie möglich bei Laune halten. Abgesehen davon, dass sie im Schakal an einer der belebtesten Straßen in Vulmyria die Gäste bedient hatte, war sie natürlich nie weiter als fünf Meilen von der Hütte fort gewesen, in der sie geboren worden war. Deshalb kannte sie diese Leute kaum aus erster oder zweiter Hand. Und niemand hätte ihr vorwerfen können, besonders helle zu sein und das nicht einmal in Bezug auf die wenigen Dinge, mit denen sie sich wirklich auskannte.
Auch wenn ihre Weisheit in Bezug auf so vieles eher zweifelhaft war – praktisch jeder begegnete den Syldoonern mit Furcht, Hass oder mindestens einem gehörigen Misstrauen. Selbst wenn sie nur nachplapperte, was sie gehört hatte … meine Mutter hatte mit dieser Warnung sicherlich die Wahrheit ausgesprochen. Aber nun war ich das jüngste Mitglied im Gefolge eines Syldooners und auch noch eher freiwillig als zwangsweise zum Dienst verpflichtet. Das war schwer zu glauben.
Beinahe wünschte ich, sie hätte mich sehen können.
Es war zweifellos ermüdend, die langweiligen Geschichten der Kornhändler und der übersättigten Bürger aufzuzeichnen, aber es war wenigstens eine sichere Arbeit. Dabei gerieten mein Leib und Leben praktisch nie in Gefahr. Zugleich war dies aber auch das Problem – es war so unglaublich … sicher. Der »Tod eines politischen Gebildes« war offensichtlich etwas, das man am besten aus großer Entfernung oder wenigstens lange danach notierte. Davon war ich fest überzeugt. Doch die Aussicht, Ereignisse von wahrhaft historischer Bedeutung mit eigenen Augen zu beobachten und sie als Schreiber mit meinem Namen zu verknüpfen, dabei vielleicht sogar einen gewissen Ruhm zu erwerben … das war ungeheuer berauschend, und die Verlockung war geradezu unwiderstehlich.
Die meisten Chronisten lebten so ähnlich wie ich – sie zeichneten die weitgehend uninteressanten Einzelheiten des Lebens verschiedener Männer oder – gelegentlich – auch Frauen auf, die keinerlei dauerhafte Bedeutung besaßen. Langweilige, schwülstige Geschichten, fade und für alle bis auf engste Angehörige oder kriecherische Freunde völlig bedeutungslos. Vielleicht nicht einmal für diese. Das galt auf jeden Fall für diejenigen, die den mittleren oder unteren Kasten angehörten. Und selbst die Archivare, die bei edleren Wohltätern angestellt waren, klagten oft insgeheim darüber, dass niemals etwas wirklich Bedeutsames geschah.
Aus Gründen, die ich selbst nicht richtig verstand, arbeitete ich jetzt also für einen syldoonischen Kommandanten. Er war nicht einmal im Ruhestand oder erzählte ruhmreiche Geschichten aus früheren Zeiten, sondern es ging um ein Abenteuer, das erst beginnen sollte, um Taten, die womöglich weitreichende Konsequenzen nach sich zogen. Vielleicht war es nicht klug, mich so voreilig auf ein solches Unternehmen einzulassen. Vielleicht hätte ich länger darüber nachdenken und das Für und Wider sorgfältig abwägen sollen, um zu einem tragfähigen Urteil zu kommen …
Aber ob ich nun Vorbehalte hatte oder nicht, die Entscheidung war gefallen. Wenn es später zu gefährlich wurde, würde ich die Abmachung einfach aufkündigen. Ich würde gewiss nichts tun, was sich nicht wieder rückgängig machen ließ. Das hoffte ich jedenfalls.
Im Gasthof tummelten sich die üblichen Bergarbeiter, Zimmerleute, Flussschiffer und kleinen Lehnsherren. Besonders groß war der Schankraum freilich nicht, und selbst im schwachen Licht der Öllampen konnte ich Mulldoos und Hackspeer sofort entdecken. Sie saßen mit Vendurro und Glesswik neben dem kalten Kamin an einem langen Tisch. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Lloi uns Gesellschaft leisten würde, aber auch sie war da.
Als wir uns ihnen näherten, klirrte und klingelte Braylars Flegel an der Seite. Mehr als ein Gast hob den Kopf und sah sich nach dem Geräusch um, die meisten wandten sich aber schnell wieder ihren Unterhaltungen zu. Es war ohnehin zu dunkel, um die Fluchtgötter an den Enden der Ketten zu erkennen. Die einzige Ausnahme bildete der Tisch, an dem einige Hornmänner saßen. Wenn ein anderer Bewaffneter vorbeikam, wollten sie ihn zumindest einmal genau in Augenschein nehmen, ganz egal, wie die Waffe nun aussah. Dies umso mehr, als der Besitzer zu einem Tisch ging, an dem bereits ausschließlich bewaffnete Gäste saßen. Mulldoos hatte das Falchion, Hackspeer einen Streitkolben. Vendurro und Glesswik trugen Schwerter, Lloi hatte ebenfalls eine Klinge, die allerdings gekrümmt und kleiner war, wie es dem Brauch der Grashunde entsprach. Außerdem waren alle aus Braylars Gefolge mit einem Krug versorgt. Helles Bier und Waffen. Ja, Soldaten machten mich immer nervös.
Braylar setzte sich zu Hackspeer. Neben Mulldoos war zwar etwas Platz, aber ich hielt es für klüger, mich zwischen Vendurro und Lloi niederzulassen. Wie Hobbins versprochen hatte, tauchte Syrie fast sofort auf. Sie brachte den Hornmännern vier Krüge Bier, kam dann zu uns. Sie war ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, so groß wie er und von ähnlichem Körperbau, besaß aber gerade genug weibliche Rundungen, um die Kanten ein wenig auszupolstern. Die Arme waren nackt, die Schultern rund und mit kleinen Muskeln besetzt, nachdem sie ihr Leben lang Tabletts getragen hatte. Glücklicherweise hatte sie die Nase wohl von der Mutter geerbt.
Sie stellte das Tablett auf den Tisch und schob sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. »Ihr zwei seht durstig aus, habe ich recht? Was darf ich Euch bringen?« Dabei lächelte sie. Gewiss, sie war kein Mädchen, das auf der Stelle die Lenden in Glut versetzte, aber ich vermochte mir durchaus vorzustellen, dass man Begehren empfand, wenn sie auf diese Weise lächelte. Ich fragte mich, ob meine Mutter einmal ein ähnliches Lächeln gezeigt hatte. Gesehen hatte ich es jedenfalls nie.
Braylar sagte: »In der Tat, wir haben Durst, Mädchen. Was würdest du uns empfehlen?«
»Einen anderen Gasthof. Aber da Ihr schon einmal hier seid, würde ich Euch zu dem roten Bier raten. Es ist nicht gut, aber besser als alles andere, was der Stänker sonst braut.«
»Wer ist der Stänker?«, fragte ich.
Sie nickte in die Richtung ihres Vaters. »So nennt man ihn, weil er immer so fröhlich ist. Also zweimal das Rote?«
Braylar nickte. Beinahe hätte ich gefragt, ob sie auch Wein hatten, aber ich glaubte nicht, dass jemand, den man liebevoll als »Stänker« bezeichnete, einen guten von einem schlechten Tropfen zu unterscheiden verstand. Deshalb fragte ich nach Cider, was Mulldoos ein lautes Lachen entlockte. Syrie lächelte unverwandt weiter. »Der ist so dick wie Öl und schmeckt halb so gut, aber wenn du ihn wirklich haben willst, kann ich ihn dir bringen.«
So entschied ich mich ebenfalls für das Bier.
Braylar fragte: »Ist das Essen so gut wie die Getränke? Falls dem so ist, würde ich lieber auf eine Kostprobe verzichten.«
»Oh, der Stänker kocht so gut, wie er braut, aber heute Abend arbeitet mein Bruder hinten, und der versteht sein Handwerk. Heute gibt es Kapaunensuppe oder Hasenpfeffer. Das Bier passt zu keinem der Gerichte, also könnt Ihr nichts falsch machen.«
»Dann ein wenig von beidem, ja?«
»Also beides. Bin gleich wieder da.« Mit wippenden Röcken marschierte sie in die Küche.
Mulldoos kaute ein Stück Daumennagel ab und spuckte es auf den Boden. Dabei starrte er mich unverwandt an. »Es ist schon schlimm genug, dass wir deinen Hund am Tisch ertragen müssen, aber jetzt auch noch deinen Schreiberling? Da vergeht mir fast die Lust aufs Trinken.«
Hackspeer lachte. »Das würde nicht einmal das größte Heer der Welt fertigbringen. Ich bezweifle sehr, dass ein verstümmeltes Mädchen und ein dürrer Schreiber so etwas schaffen.«
Lloi beugte sich zu mir herüber. »Nimm es nicht persönlich, Buchmeister. Der Keiler kann weder Mensch noch Tier gut leiden, also befindest du dich in bester Gesellschaft.«
Ich war nicht sicher, ob es ihrer Absicht entsprach, es Mulldoos hören zu lassen, aber er bekam es mit. »Ihr wilden Leute solltet euch lieber die Zungen als die Finger abschneiden, damit würdet ihr uns allen einen Gefallen tun.«
Lloi wollte etwas antworten, doch da hob Braylar die Hand. Syrie kam mit unseren Krügen und stellte sie auf den Tisch. »Es ist Eure Sache, wie Ihr Euer Geld ausgebt, aber wenn Ihr noch länger trinken wollt, würde ich Euch die großen Kannen empfehlen. Sie sind auf Dauer billiger. Wenn es nach dem Stänker ginge, müsste ich Euch am liebsten leere Krüge servieren und das Doppelte berechnen, aber das hält mich nicht davon ab, meine Meinung zu sagen.«
»Ehrlichkeit, Anstand und Schönheit, und das alles in einem einzigen Mädchen vereint«, bemerkte Braylar.
Da war das hübsche Lächeln wieder da. »Ihr bezahlt meine Wahrheit mit Lügen, aber ich will es Euch nicht vorwerfen.« Sie zwinkerte und ging zu einem anderen Tisch.
Nachdem er einen Schluck gekostet hatte, rümpfte Braylar die Nase. »Es könnte tatsächlich sinnvoll sein, für einen leeren Krug das Doppelte zu bezahlen.«
Ich kostete ebenfalls. Das rot schimmernde Bier war wie bitterer Schlamm. Das hielt Vendurro aber nicht davon ab, den Krug zu heben, als enthielte er das schönste Elixier auf der Erde. Dann knuffte er mich. »Mit Leuten wie uns bist du wohl noch nie geritten, was?«
Als ich nickte, fuhr er fort: »Das Blutvergießen, nun ja, das wird deine Träume ein wenig verändern, bis es dir irgendwann gar nicht mehr auffällt. Was das Fluchen und Furzen angeht – und davon wirst du bestimmt genug sehen –, so kann das recht unerfreulich sein. Aber das Schwerste überhaupt ist es, sich an Bier zu gewöhnen, das schmeckt, als wäre es direkt aus einem Eselschwanz gezapft. Na ja, damit muss sich ein Soldat eben abfinden, Junge. Also gewöhn dich dran.« Er wischte sich etwas Schaum von den Lippen. »Dann hast du wohl auch noch nicht gesehen, wie der Captain diesen hässlichen Flegel eingesetzt hat, was?«
Hackspeer warf ihm einen ebenso warnenden wie zornigen Blick zu, doch Mulldoos kam ihm zuvor. »Halt lieber sofort den Mund, Junge.«
Vendurro hob beschwichtigend die Hände. »Immer mit der Ruhe. Ich wollte doch gar nichts über … über den widernatürlichen Teil sagen. Ich dachte nur an den Captain und seinen Flegel, der jeden Gegner zu blutigem Brei verarbeitet, mehr nicht. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Das ist doch kein Grund, so feindselig zu werden.« Er wandte sich an Glesswik. »Erinnerst du dich an Vortnall, Gless? Weißt du das noch?« Er klopfte auf den Tisch. »Das war eine Sache, was?«
»Grautorf.«
»Was?«
»Es war gar nicht Vortnall, sondern Grautorf.«
Vendurro war angetrunken und unsicher. »Ehrlich?«
»Grautorf.«
»Äh … ich hätte schwören können, dass es Vortnall war.« Wieder knuffte er mich. »Wir waren in einer Schenke – es war ein gutes Lokal mit den drallsten Bedienungen, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Der Hauptmann hat getrunken wie ein Mann, der fast verdurstet ist. Er hatte einen ordentlichen Zug, der für zwei gereicht hätte. Unsere Zimmer waren in einem Gasthof in einem anderen Stadtviertel.« Vendurro hielt inne und sah Glesswik an. »Bist du sicher, dass es Grautorf war? In Vortnall gab es doch diese engen Straßen, und ich erinnere mich, dass …«
Glesswik schlug ihm auf den Arm, dass Vendurro fast von der Bank gekippt wäre. »Nun erzähl schon deine verdammte Geschichte.«
»Hurensohn.« Vendurro fing sich wieder und lachte. »Also wir sind dann in den Gasthof zurückgekehrt. Alle bis auf den Captain. Mulldoos und Hackspeer, auch die anderen, sie waren alle schon da und hatten sich schlafen gelegt. Mulldoos hier sieht mich zum Gasthof zurückkommen, hält mich auf und sagt: ›Wo ist der Captain?‹ Ich sage: ›Er trinkt noch einen, glaube ich.‹ Da wird Mulldoos wirklich wütend, wie es manchmal passiert, und sagt: ›Hast du den Captain allein trinken lassen? Geh sofort los, und hol ihn.‹ Ich sage ihm, ein guter Captain muss doch nicht von einem wie mir geholt werden. Nein, man darf überhaupt keinen Mann einfach aus der Schenke holen. Aber Mulldoos dreht mich an den Schultern herum und tritt mich in den Hintern. ›Los, nun geh, und hol ihn, oder du hebst die nächsten zehn Tage Latrinen aus.‹ Da wir in einer Stadt waren, hätte ich ihn beinahe gefragt, ob ihm der Bürgermeister den Bau neuer Latrinen erlaubt hat, aber ich habe lieber den Mund gehalten.«
Glesswik rülpste und fügte hinzu: »Das war gut so. Sonst würdest du heute noch graben.«
»Gut möglich. Also bin ich losgezogen, aber ich wollte den Captain nicht alleine holen, deshalb habe ich Glesswik mitgenommen. Es war schon spät, nach der Sperrstunde, und die Straßen waren so gut wie verlassen. Die Wächter hätten patrouillieren sollen, aber wir haben niemanden gesehen. Wir kommen also kurz vor der Schenke um eine Ecke, und da sehen wir nicht weit vor uns vier Straßenräuber, die dem Captain den Weg versperren. Ich weiß ja nicht, wie es da ist, wo du herkommst, aber in Grautorf und den meisten Städten in dieser Gegend sind die Straßenräuber mit Schlagbällen bewaffnet. Das sind Lederriemen, die man sich ans Handgelenk schnallt, und am anderen Ende ist ein Gewicht befestigt. Manchmal ist es ein Stück Eisen, das wie ein Ei geformt ist, oder es ähnelt einem kleinen Mühlstein. Schnelle und leise Waffen und leicht zu verstecken. Damit kann man einem Mann schon ein paar Knochen brechen. Im Straßenkampf sind sie sehr nützlich, sonst aber kaum zu gebrauchen. Also, diese Straßenräuber holen fast gleichzeitig die Schlagbälle heraus, als hätten sie das jahrelang geübt, um die Opfer zu beeindrucken. Sie denken, sie haben einen leichten Gegner vor sich, einen einsamen torkelnden Mann. Aber der Captain beginnt zu lachen, als er die Gewichte an den Lederriemen sieht. Er lacht, als hätten sie Gänseblümchen aus den Ärmeln gezaubert. Er muss die Hände auf die Knie stützen, weil er so sehr lacht. Dann richtet er sich auf und sagt etwas, das wir nicht verstehen. Gless und ich rennen los, aber ehe wir da sind und ihm helfen können, nimmt der Captain diesen bösen Flegel von der Hüfte, dreht den Griff mit einer Hand und fängt ihn mit der anderen Hand auf. Normalerweise macht er das sehr elegant, aber an diesem Abend bleibt das Ding am Haken im Gürtel hängen. Der vorderste Räuber, er hatte wohl nicht mit großem Widerstand gerechnet, ist ein wenig langsam. Er wirbelt den Riemen mit dem Gewicht herum, aber der Captain weicht schon nach links aus, und der Schlag streift nur seine Schläfe. Dann zieht er den Flegel herum und schlägt dem Räuber die obere Hälfte des Kopfes weg. Der zweite Räuber dringt auf ihn ein, der Schlagball saust herab, aber der Captain unterläuft den Schlag, fängt das Leder mit dem freien Unterarm ab, und der Ball dreht sich im Kreis. Schon schlägt der Captain wieder fest mit dem Flegel zu. Das Schlüsselbein des Räubers bricht wie ein alter Besenstiel, und der Mann geht wie ein Stein zu Boden. Aber er hält den Riemen fest und zieht den Captain mit, der das Gleichgewicht verliert, ehe er dem Räuber den Riemen entreißen kann. Das wäre für die anderen beiden die richtige Gelegenheit, auf den Captain einzuprügeln, aber sie haben genug gesehen. Beide rennen in die Dunkelheit davon, die Lederriemen pendeln hinter ihnen wie Katzenschwänze. Auf einmal sehen sie gar nicht mehr so verwegen aus. Gless und ich erreichen endlich den Captain. Der Junge, den er geschlagen hat, sitzt im Dreck und hält sich die verletzte Schulter, er hat Schaum vor dem Mund und fleht um sein Leben, als würde ihm das etwas nützen. In den Augen flackert die Todesangst wie bei einem, der weiß, dass er gleich getötet wird. Der Captain starrt ihn an, den Flegel in einer Hand, und in den Augen hat er einen Ausdruck, den ich nicht verstehen kann. Gless fragt, ob wir den Jungen töten oder die anderen verfolgen sollen, und rechnet schon mit Zustimmung für eines oder beides. Der Captain denkt kurz nach, dann sagt er: ›Nein, lass sie laufen. Lass sie laufen.‹«
Vendurro imitierte Braylar recht gut. »›Und was den hier angeht …‹ Er beugt sich vor, und die bösen Köpfe seines Flegels pendeln direkt vor der Nase des Burschen, der die Augen schließt und ein Gebet murmelt oder so etwas. Der Captain drückt ihm die Kugeln auf das Gesicht, und der Bursche schreit, als hätte er den tödlichen Hieb empfangen. Als er die Augen wieder öffnet, marschiert der Captain bereits zum Gasthof. Gless muss sich beeilen, um Schritt zu halten. Ich sehe den armen Tropf an und kann es mir nicht verkneifen: ›Du hast mehr Glück gehabt, als ein Dreckskerl wie du es verdient hätte. Hättest du mich zu bestehlen versucht, dann wärst du jetzt mausetot.‹ Ich hole die beiden ein, Gless und ich nehmen den Captain in die Mitte, wir beobachten die Schatten, ob da noch jemand Ärger machen will, aber alles bleibt ruhig. Auf halbem Wege zum Gasthof fragt Gless den Captain, was er zu den Räubern gesagt hatte, bevor er den Flegel gezogen hatte, und ich muss zugeben, dass ich auch neugierig war. Der Captain hat sich das Blut von der Schläfe gewischt, aber jetzt hält er inne und sieht Gless an, als wäre der nicht ganz dicht. Und dann sagt er, ich weiß es noch genau – aber das kann doch der Captain selbst erzählen, was?«
Glesswik verdrehte die Augen. »Wie großmütig von dir.«
»Captain, weißt du noch, was du gesagt hast?«
Braylar schluckte herunter, ehe er antwortete. »Ich habe ihnen gesagt, dass ich noch nie so winzige Flegel gesehen habe.«
»Genau. Genau das hat er gesagt!«
Der ganze Tisch lachte, und als sich die Belustigung wieder gelegt hatte, sah Glesswik den Captain an. »Ich habe nie verstanden, warum du den Mann am Leben gelassen hast. Ich meine den, der am Boden lag. Mir schien … das schien nicht zu dir zu passen, wenn ich das so sagen darf.«
»Das ist aber unfreundlich, Sergeant Glesswik. Äußerst unfreundlich.«
»Oh, Captain, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Überhaupt nicht. Nein, eigentlich ist das sogar ein Kompliment. Du bist der härteste Kämpfer, den ich je gesehen habe. Eigentlich gar nicht böse, aber eben … hart, wie gesagt. Ich glaube, deshalb folgen wir dir auch alle. Jeder hier würde sofort sein Leben für dich hergeben, wenn es nötig ist.«
Hackspeer fuhr mit dem Finger über den Rand seines Krugs. »Ich glaube, der gute Sergeant will darauf hinaus, dass du bei den Männern nicht wegen deiner Liebenswürdigkeit oder deines unerschöpflichen Vorrats an Zoten beliebt bist, sondern weil du mit jedem, der sich dir in den Weg stellt, völlig erbarmungslos umgehst.«
Mulldoos schnaubte. »Zoten. Hat er das wirklich gesagt?«
»Verzeihung, Mulldoos. Ich vergaß deine Abscheu vor gut gewählten Worten.«
»Abscheu empfinde ich nur für Windmühlen wie dich.«
»Eine Windmühle dreht sich nicht einfach nur, um sich selbst zu hören. Sie leistet einen Dienst.«
Mulldoos antwortete: »Dann nehme ich das zurück. Zwischen dir und einer Windmühle gibt es keine Gemeinsamkeiten.«
Während Lloi sich meist zurückhielt, erzählten die Syldooner viele Geschichten, die oft von Flüchen, Knuffen und Husten unterbrochen wurden. Ich blickte zu den Hornmännern, die ein paar Tische entfernt saßen und sich kaum anders verhielten, womöglich sogar schlimmer. Dieses Benehmen galt wohl unter Soldaten, zumindest im bierseligen Zustand, als Ausdruck von Freundschaft.
Besonders ein Hornmann hatte offenbar mehr Krüge gekippt als die anderen. Er sprach schon etwas nuschelnd, und die Wangen und die Nase waren so rot, als hätte er sie angemalt. Vorher war mir aufgefallen, dass er sich beinahe mit einem seiner eigenen Leute geprügelt hätte. Jetzt kehrte er gerade zurück, nachdem er sich erleichtert hatte, und rempelte einen Mann an, der in die andere Richtung wollte. Es war recht harmlos, doch der Hornmann packte den anderen Gast bei den Schultern und presste ihn gegen die Wand.
ENDE DER LESEPROBE





























