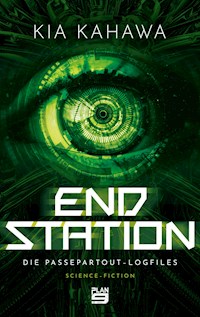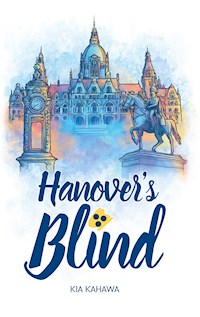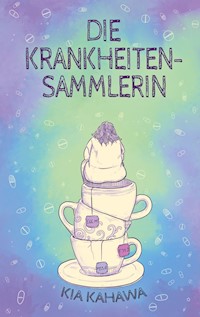
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Fiona ist eine unfreiwillige Sammlerin: Depressionen, Übergewicht, HWS-Syndrom, Selbstwertprobleme. Sie ist davon überzeugt, dass sie ihre Erkrankungen verdient hat. Auch mit den Menschen hat sie es schwer. Sie fühlt sich unter ihnen fehl am Platz, vergleicht sich ständig mit anderen und glaubt, all ihre Probleme allein lösen zu müssen. Sie träumt von einer gesunden, schlanken und erfolgreichen Version ihrer selbst. Nachdem eine weitere Diagnose Fionas Sammlung ergänzt, trifft sie eine Entscheidung. Sie macht eine Kehrtwende und will von heute auf morgen ein perfektes Leben führen. Koste es, was es wolle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Micha.
Inhaltsverzeichnis
Keep on waiting
Hi, ich bin Kia
Blinde tanzen nicht?
Keep on waiting.
Als ich in deinem Alter war, brauchte ich noch keinen Arzt.» Vor mir sitzt eine alte Dame mit zwei Stricknadeln und einem roten Wollknäuel, aus dem sich nach und nach ein Pullover, gerade groß genug für eine Babypuppe, formt.
Schweigen. Nur das Klappern der Stricknadeln und das Ticken der überdimensionalen Wanduhr sind zu hören. Es ist eine dieser Bahnhofsuhren, viel zu groß für den kleinen Raum, und besonders für Wartende nervenbetäubend.
Die langen Zeiger schreiten scheinbar in Zeitlupe voran. Ein Mahnmal der vergeudeten Zeit, ein Omen der quälenden Wartezeit, die mir noch bevorsteht. Je aufdringlicher die Uhr, desto gequälter der Patient. Somit hat mein Hausarzt immer genug zu tun.
«Damals war alles anders.» Die alte Dame auf dem Stuhl auf der anderen Seite des Raums blickt von ihrer Arbeit hoch, um zu überprüfen, ob ich zuhöre.
Wäre ich ehrlich, würde ich sagen, dass ich weder zuhören noch reden möchte, aber da stellen sich mir zwei Barrieren in den Weg: Erstens bin ich grundsätzlich nicht ehrlich und zweitens möchte ich wirklich nicht ein einziges Wort verlieren. Ich möchte nichts sagen, ihr auch nicht sagen, dass ich nicht sprechen will, und schweige die Fremde an.
«Damals haben wir zwölf Stunden auf dem Hof gearbeitet und nachts gefeiert», erzählt die Frau ihrem Strickwerk, «oder auf die Kinder aufgepasst, aber der Peter war ja nicht mehr da.»
Meine anerzogene Höflichkeit drängt mich zu einer Reaktion. Mein Instinkt lässt mich auf die Uhr schauen. «Stricken Sie für Ihren Enkel?», fragt mein Mund.
«Nicht ganz. Mein erster Urenkel wurde am Heiligen Abend geboren und soll einen schönen, warmen Pullover haben.» Die frischgebackene Urgroßmutter schaut nicht auf. Unbeobachtet fühle ich mich wohler.
Ich lehne mich zurück, um meine Haltung zu verändern. Verdammte Rückenschmerzen. «Na, dann herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs», höre ich mich zögerlich sagen.
«Du sprichst nicht viel, mein Kind. Dabei haben die anderen in deinem Alter doch immer diese kleinen Bildschirme vor der Nase.»
«Ich denke, Sie meinen Smartphones.»
Sie schaut vom unfertigen roten Pulli auf und sucht Blickkontakt. Ich vermeide es, sie anzusehen und hoffe, dass diese merkwürdige Situation so besser wird.
«Tablets oder E-Book-Reader…», ergänze ich.
«Genau! Diese Fremdwörter kann ich mir nie merken. Gibt es denn niemanden mehr, der für diese ganzen Erfindungen deutsche Namen verteilt?»
Die alte Dame wird für mich allmählich interessanter.
«Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Heute spricht doch jeder fließend Englisch.» Ich zucke kaum merklich zusammen. Vielleicht hätte ich das besser nicht gesagt.
Ich sitze ich in einem Wartezimmer, unterhalte mich widerwillig mit einer fremden Uroma, und meine Aussagen bieten unfreiwillig tiefgreifendes Gesprächsmaterial.
Widerwillig.
Unfreiwillig.
Meine Wohlfühlzone entfernt sich mit jedem Ticken der Uhr weiter von der Realität.
«Ich habe sieben Enkel und einen Urenkel. Und das ohne Englisch oder einen dieser neumodischen englischen Hochschulabschlüsse. Ich brauchte auch kein Diplom, um ein Haus zu bauen und meinen Mann bis zum Tode zu pflegen.»
«Das ist… beeindruckend», entgegne ich ihr widerwillig. Mein Blick wandert erneut auf die überdimensionale Uhr. Wer sagte nochmal, dass eine Minute neben einer hübschen Frau schneller vergehe als eine Minute auf einer heißen Herdplatte? Auch wenn das alte, strickende Mütterchen vor Jahren womöglich eine schöne Frau gewesen ist, fühle ich mich, als säße ich auf der besagten heißen Herdplatte. Die Zeit vergeht viel zu langsam und ich wünsche mir, ich hätte ein gutes Buch dabei, um mich meiner Außenwelt zu verschließen. Einen Blick auf das Smartphone möchte ich nicht riskieren, da stellt sich mir die anerzogene Höflichkeit in den Weg.
Genau diese nervige Höflichkeit zwingt mich dazu, mich zu rechtfertigen: «Es war noch nie eine Frage des Brauchens, wenn es um internationale Standards geht. Niemand braucht einen Bachelor oder ein Tablet, um eine gesunde Familie zu gründen. Das weiß ich und das wissen auch viele andere junge Menschen.» Ich komme mir alt vor, so etwas zu sagen. Ein paar Minuten vergehen, ohne dass jemand etwas sagt. Bin ich aus dem Schneider?
«Ach Kind», seufzt die Alte, «mach was aus dir! Du bist nicht auf den Kopf gefallen, das wusste ich sofort.»
Ich bin nicht aus dem Schneider. Das wäre zu schön gewesen. Die alte Dame kommt mir merkwürdig vor. Sie widmet sich wieder dem roten Urenkel-Pullover.
Draußen verdunkelt sich die Welt und der Feierabend der Praxis Dres. Oslek & Flamm rückt näher. Als würde die Dame ahnen, dass die Tür zum Wartezimmer in einigen Sekunden geöffnet wird, packt sie ihr Strickzeug ein und rutscht auf ihrem Stuhl nach vorne. Sie stützt sich mit beiden Händen an den Lehnen ihres Stuhls ab, verkrümmt ihren Körper und dreht den Rücken ein, um sich gemächlich aus dem Stuhl zu heben. Das sieht qualvoll aus und ich frage mich, ob auch mein Körper irgendwann so gebrechlich sein wird, dass mir das Aufstehen schwerfallen wird.
Plötzlich fühle ich mich, als hätte ich im warmen Bett einen Montagmorgen versehentlich für einen Sonntag gehalten. Bin ich dämlich! Wenn ich nicht auf den Kopf gefallen bin, warum helfe ich der alten Dame nicht beim Aufstehen? Aus der stillen Wohlfühlzone wurde innerhalb der letzten Minuten eine unbehagliche Unterhaltungshölle, und jetzt befinde ich mich in einer Peinlichkeit, die mir noch weniger gefällt. Ich bin Fiona, die unsoziale Tussi, die Omas beim Leiden zusieht. Mein Magen verkrampft sich.
«Ich bin jetzt gleich dran», krächzt die alte Dame angestrengt. «Das habe ich im Urin.» Und kaum hat sie die Stuhllehne losgelassen, um das eigene Gleichgewicht zu finden, öffnet sich die Tür.
Die Sprechstundenhilfe erscheint. «Frau Nebi – ach, da sind Sie ja schon.» Die Mittzwanzigerin mit dem strengen, dunklen Zopf hakt sich bei Frau Nebi unter, um sie zu stützen. Mit kleinen Schritten verschwinden die beiden Frauen aus dem Wartezimmer.
Allein mit der Uhr und den schmuddeligen, blaugrauen Wänden, die weder Gesundheit noch gute Laune versprechen, schaue ich mich um. Es ist eines dieser Wartezimmer, die schon mit dem ersten Anstrich vor zehn Jahren langweilig waren. Wie wohl das Farbkonzept entstanden ist? «Bitte richten Sie den Raum so ein, dass unsere Patienten eine Stunde vorkommt wie ein ganzer Monat.» – «Oh, das ist aber ein schöner Farbton. Wir mischen ihn am besten mit einem Sack Staub, dann passt er perfekt in unsere deprimierende Arztpraxis.»
Mich interessieren weder die Klatsch- noch die Motorsportzeitschriften im billigen Metallständer, die schon von weitem klebrig und abgegriffen aussehen. Der Kindertisch mit einseitig bedrucktem Schmierpapier und nicht ausreichend angespitzten Buntstiften reizt mich am meisten. Die Tatsache, dass ich alleine im Wartezimmer sitze und die Arztpraxis offiziell seit zehn Minuten geschlossen ist, lässt die Versuchung, am Kindertisch zu malen, ansteigen. Dann würde die Zeit schneller vergehen, und gemalt habe ich schon lange nicht mehr. Aber da ich nicht auf die Kinderstühle passe und die Sprechstundenhilfe den Anblick einer dicken Frau mit Wachsmalstiften am Miniaturtisch lächerlich finden würde, bleibe ich an Ort und Stelle sitzen. Starren statt spielen – das Leben der Erwachsenen.
Die Einrichtung des Sprechzimmers lässt vermuten, dass der hier behandelnde Arzt ein Naturbursche ist: Familienfotos, die allesamt in Wäldern, vor Blockhütten oder Campingwagen geschossen wurden, Mobiliar mit auffälligen Holzmaserungen und ein gerahmtes Kunstwerk aus Zweigen, Moos und etwas Schmierigem, dessen Herkunft ich nicht erfahren möchte.
Dr. Oslek öffnet die Tür und saust um den Schreibtisch herum, um sich seinem Bildschirm zu widmen. «Ich bin sofort für Sie da», begrüßt der Arzt seinen Computer.
«Ich habe Zeit», antworte ich wahrheitsgemäß. Innerhalb der letzten Monate ist das meine Standard-Antwort geworden. Ob es die blutjunge, zittrig-nervöse Kassiererin ist, die darüber nachdenken muss, aus welchen Münzen sich mein Wechselgeld zusammensetzen könnte oder ob es eine faltige, bösartige Sachbearbeiterin in einem Großraumbüro ist, für die ich nur eine Störung bei ihrer bedeutsamen Schreibtischarbeit darstelle, jeder bekommt von mir dieselbe Antwort: Ich habe Zeit. Aus dieser kleinen Geste gegen die Hektik des Alltags wurde nach und nach ein Lebensmotto. In den vergangenen Monaten musste ich mir nicht mehr oft entbehrungsreich Zeit nehmen, um Zeit zu haben.
Inzwischen habe ich täglich Zeit. Nicht, weil es weniger zu tun gibt, sondern weil ich weniger tue. So gesehen habe ich freie Stunden, aber keine Lust. Oder Freizeit, weil ich keine Lust habe. Manchmal aber habe ich keine Lust, weil ich zu viel Zeit habe. Dabei gäbe es so viel zu tun.
«So, Frau Alfons», Dr. Oslek dreht sich mit einer unangebracht feierlichen Stimme zu mir. «Mit Ihren Blutwerten ist vieles in Ordnung. Tatsächlich meine ich vieles, nicht alles. Eine latente Eisenmangelanämie ist Ihnen bekannt?»
Ich nicke.
«Bleiben Sie bei eisenhaltiger Nahrung und wir kontrollieren in zwei Monaten noch einmal, was das Blut so macht. Tabletten sind nicht nötig und werden wohl auch nicht nötig sein. Denn wir haben da einen anderen Störenfried gefunden.»
Mich ärgert sein lockerer Ton. Bestimmt ist er es als Vater von drei Kindern gewöhnt, ernste Nachrichten durch die Blume zu sagen, sodass er bei seinen Patienten keinen Unterschied macht.
In meinem Kopf kreisen die schlimmsten Diagnosen. Krebs und HIV schließe ich aus, da ich nicht auf einen Weltuntergang vorbereitet bin. Außerdem hat man mein Blut nicht darauf untersucht – zumindest wusste ich bis jetzt nichts davon.
Einen Diabetes schließt meine innere Diskussionsrunde ebenfalls aus, da Zucker nicht einfach so bei einer Routineuntersuchung des Blutes festgestellt werden kann. Oder etwa doch? Ich bekomme weiche Knie. Was ist, wenn ein Wert aus dem großen Blutbild so auffällig ist, dass der Arzt einen weiteren Test veranlasst hat, und daraus mein Todesurteil entsteht? Dann würde ich vermutlich darauf bestehen, dass ich bis zu meinem Begräbnis nie mehr über die Öffnungszeiten der Praxis hinaus im Wartezimmer sitzen möchte – schon gar nicht an einem meiner raren Urlaubstage.
Die Miene des Arztes verfinstert sich. Mein Herz rutscht in die Hose. Sicherlich bin ich zu zynisch und ein viel zu schlechter Mensch, um vom Schicksal verschont zu werden.
«Ihr TSH-Wert ist beunruhigend erhöht. Das heißt nicht, dass uns das beunruhigen sollte, man sieht nur eine deutliche Abweichung von der Norm», fährt Dr. Oslek fort. So nett er auch ist, seine unsichere Ausdrucksweise nervt mich tierisch. Wäre ich sein Chef, hätte ich ihn nicht eingestellt. Man muss den Patienten klar und deutlich sagen, ob dieser TSH-Wert nun tödlich erhöht ist oder man nur irgendwelche Tabletten für fünf Euro Zuzahlung in der Apotheke kauft und sie ein halbes Jahr schluckt und dann wieder geheilt ist. Doch bevor ich mir in meiner Gedankenwelt ein Vorstellungsgespräch zwischen meinem Arzt und mir zusammenreimen kann, hören Instinkt und Höflichkeit gleichzeitig Dr. Osleks TSH-Gerede zu.
«Sie haben eine Hypothyreose, eine Schilddrüsenunterfunktion. Das bedeutet, dass die Schilddrüse weniger arbeitet, als sie soll und dass Sie sich häufig abgeschlagen und antriebslos fühlen könnten. Das lässt sich auf die müde Schilddrüse zurückführen und auch Ihr – nennen wir das Kind beim Namen – bedenkliches Übergewicht kann durch die Hypothyreose bedingt sein.»
Ich merke auf. Abgeschlagen und müde bin ich seit Monaten. Doch meine Therapeutin sagte mir, dass Antriebslosigkeit und scheinbar unerklärliche Müdigkeit nichts anderes als die üblichen Symptome meiner Depression seien.
«Und wie kommt so eine Hypothe… Unterfunktion zustande?», erkunde ich mich unsicher.
«Das kann genetisch bedingt sein, aber auch einfach so durch Ihr Wachstum oder das Ende der Pubertät entstehen. In manchen Fällen kommt eine Hypothyreose auch durch Übergewicht zustande.»
«Aber ich dachte, es wäre genau umgekehrt?»
«Das kann so oder so sein. Aber das ist auch gar nicht wichtig für Sie. Das eine kann das andere begünstigen.» Wie sehr ich doch sichere und klare Aussagen eines Arztes liebe. Ich habe eine Krankheit, die etwas mit meinem Gewicht zu tun hat und meine Schilddrüse ermüden lässt. Irgendein Organ in meinem Körper funktioniert also nicht richtig. Passt hervorragend zu meinem Asthma! Und der Arzt erlaubt es sich, salopp darüber zu reden, dass diese Krankheit vielleicht schlimm ist, vielleicht aber auch nicht. Er sagt selbst, dass mein Übergewicht eine Belastung für meinen Körper sei, und ist nicht in der Lage, seiner Patientin genau zu sagen, inwiefern ihr Körper unter dieser Krankheit leidet. Ich koche innerlich. «Ich mache Ihnen einen Vorschlag», sagt Dr. Oslek und beugt sich über den Schreibtisch, als wolle er mir einen geheimen Deal vorschlagen. Einen Drogenhandel in der Sprechstunde abzuschließen – das bringt mich auf eine Idee für einen spannenden Krimi. Der kleine Gedankenausflug beruhigt mich.
«Wir kümmern uns medizinisch um die Schilddrüse und Sie kümmern sich durch Ihren Lebensstil um das Übergewicht.», der Doktor betont seine Worte, als wäre ihm dieser Einfall nach langem Überlegen gekommen und ein unschlagbares Tauschangebot für ihn und mich.
«Wie genau geht es denn jetzt weiter? Was muss ich tun und was macht man gegen diese Krankheit?», will ich wissen.
«Sie müssen jeden Morgen eine Tablette nehmen. In dieser Tablette ist das fehlende Hormon Thyroxin enthalten, das Ihre Schilddrüse nicht ausreichend produziert. Und in drei Monaten kontrollieren wir Ihre Werte und dann erhöhen wir vielleicht die Dosis, wenn das erforderlich sein sollte.»
Innerlich danke ich einem Gott, an den ich nicht glaube, für die Option, Tabletten zu nehmen und diesen dämlichen TSH-Wert schnell wieder in Ordnung zu bringen. Tief in mir finde ich diese Option doch besser als die Variante, bei der ich sehr bald sterben werde.
Die nächsten Minuten spricht Dr. Oslek von gesunder Ernährung, Bewegung und all den Sprüchen, die man zwischen Weihnachten und Silvester ohnehin zu häufig hört: Alle wollen mehr Sport machen, abnehmen und Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens haben. Dazu mehr Ausflüge mit Freunden und Familie, weniger Fernseh- und Smartphonekonsum, mehr Geld für weniger Arbeit, nie wieder rauchen, weniger Alkohol trinken und endlich konsequent sparen. Für Reisen, von denen sie dann genug Fotos für ihre Facebook-Profile schießen können, damit die Online-Freunde neidisch werden und sich vornehmen, selbst so schlank, reich, beliebt und entspannt zu werden. Aber in ein paar Tagen feiert die Welt Silvester und es beginnt wieder der Zyklus des Versagens. Täglich kommen immer mehr Menschen hinzu, die ihre guten Vorsätze aufgegeben haben und im grauen Alltag ersaufen.
«Mit Bewegung und gesunder Ernährung nehmen Sie bitte nicht mehr als ein halbes Kilo pro Woche ab», schließt Dr. Oslek seinen langweiligen Monolog. Mahnend sieht er mich an. Oder schaut er ernst? Besorgt? Ich habe keine Ahnung, denn ich denke bereits daran, wie es wäre, wenn ich zu viel abnehmen würde. Meine Knieprobleme würden verschwinden. Ich wäre nicht mehr depressiv, weil ich mich wohl fühlen würde in meinem Körper. Mein Selbstwert wäre auf dem höchsten Level und ich hätte keine Sorgen mehr um einen müden, trägen Körper mit Eisenmangel, Blutarmut, Unterfunktion und allem drum und dran. Ich müsste sich keine Mühe machen, zum Sport zu gehen, dort von Menschen ausgelacht zu werden oder weniger zu essen, als ich eigentlich möchte. Dann würde ich automatisch zu viel abnehmen, müsste ich mich, um meinen Körper zu schonen, auf die Couch legen und – einfach nichts tun. Am Computer chatten. Eine Runde schlafen. Damit mein Körper nicht zu schnell zu gesund und zu schön wird. Wie schön das wäre. Ich könnte ein Leben leben wie all diese Frauen, die von sich sagen, sie äßen wie ein Scheunendrescher, aber nie zunehmen könnten. Problematisch kann so etwas gar nicht sein, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung.
Ich will genau das.
Wir stehen auf, geben uns die Hand und Dr. Oslek begleitet mich an die Rezeption. Kurzerhand wache ich auf und finde mich in der Realität wieder. In einem trägen, schweren Körper, hässlich und demotiviert. Ich bekomme ein rosa Kassenrezept und eine Kopie der Blutwerte, die ich mir sowieso nie durchlesen werde. Es ist 19:03 Uhr, als ich die Praxis verlasse. Die Apotheke gegenüber hat seit drei Minuten geschlossen. Na toll. Noch dazu ist es aber furchtbar kalt und der Heimweg viel zu lang. Das Leben ist so furchtbar gerecht zu mir.
Meine Beine erfrieren genau an der Stelle, an der mein Trenchcoat abgeschnitten ist und der Wind nur einen kurzen Weg von der Hose an die Haut hat. Trotzdem schwitze ich beim Laufen und lehne mich leicht gegen den stürmischen Wind. Die Kopfhörer betäuben meine Ohren. Zu Hause wartet eine Kaffeemaschine auf mich, die mich heute Nacht wachbleiben lassen wird und mir den Genuss eines warmen Getränks in einer kalten Einzimmerwohnung schenken kann. Also gehe ich schneller. Und friere mehr. Schwitze mehr. Habe alles satt.
Die Bäume auf der linken Straßenseite, die Häuser auf der rechten Seite – alles war mir schon vor Jahren zuwider.
Ich bleibe stehen und schaue auf mein Smartphone. Eigentlich ist das der Moment, in dem man von Nachrichten erschlagen wird und sich vor Beliebtheit kaum retten kann, weil doch heutzutage jeder Mensch innerhalb einer halben Stunde vermisst wird. Nach einer Stunde Offline-Zeit soll es schon Suchanzeigen und Anrufe bei der Polizei gegeben haben. Mein Smartphone zeigt mir jedoch keine einzige neue Nachricht und schreit mich an: «Du bist allein!»
«Lass‘ mich in Ruhe!», motze ich und verlangsame meinen Gang.
«Niemand mag dich. Das weißt du schon seit Jahren. Und du weißt, dass das jeder weiß.» Auf der anderen Straßenseite geht ein Pärchen Hand in Hand in die entgegengesetzte Richtung. Die junge Frau wärmt sich an ihrem Freund. Er lacht, weil einer von beiden etwas Belustigendes gesagt haben muss.
«Schau doch, da wirst du wieder einmal ausgelacht. Du kriegst immer mal eine neue Diagnose, aber Spaß ist nur für andere da», lacht mein Smartphone. Prompt landet es auf dem kalten Boden. Eine Erleichterung! Das erleichterte Gefühl verschwindet sofort. Also hebe ich meinen Feind wieder auf und stecke ihn in meine Hosentasche.
Ich laufe schneller. Kurze Zeit später renne ich so schnell, wie ich kann. Eine Energie in meinem Körper zwingt mich dazu, mich zu fordern. Doch kaum habe ich meine Wut kanalisiert und etwas Kraft verschwendet, muss ich stehenbleiben, beuge mich nach vorn und stütze mich auf meinen Knien ab.
Das Atmen fällt schwer, meine Lunge weigert sich, sich vollständig zu füllen. Ich versuche, mein rasendes Herz zu beruhigen und richte mich dazu auf. Im Hohlkreuz strecke ich meinen Brustkorb, stelle mir vor, die Lunge könne sich aufblasen wie ein Luftballon. Das hilft mir immer, wenn ich diese furchtbare Beklemmung beim Atmen empfinde.
Der MP3-Player meldet durch abruptes Schweigen, dass der Akku geladen werden muss und dass das Gerät nun ausgeht. Die Stille verstärkt das Pochen des Herzens und das Sausen in meiner Lunge. Meine Gedanken schreien wild durcheinander, doch ich höre nichts Sinnvolles darunter und mache mich mit schleppenden Schritten weiter auf meinen Heimweg.
In meiner Wohnung riecht es nach den aufgewärmten Resten des Weihnachtsessens, wovon ich heute Mittag etwas auf dem Schreibtisch habe stehen lassen. Es ist spürbar wärmer als draußen, also werfe ich meine durchgeschwitzte Jacke in eine Ecke und lasse in einer anderen meine Tasche fallen. Die Schuhe ziehe ich stolpernd auf dem Weg zum Schreibtisch aus und lasse mich auf den Bürostuhl fallen.
Der Messenger öffnet sich und ich tippe, was ich sehr häufig tippe. «Thilo, bist du da?», erscheint auf dem Bildschirm neben meinem Nickname. Es dauert nur wenige Augenblicke, bis ich mit «Na klar, für dich doch immer» von meinem guten Freund lothi321 begrüßt werde.
Ich schreibe meiner virtuellen Bekanntschaft, dass ich Redebedarf hätte, weil mich alles und jeder störe. Mir scheint weder die Welt zu passen, noch scheine ich in diesen Momenten in mich selbst zu passen. Thilo erfährt innerhalb der nächsten Minuten alles über die Ablehnung meiner selbst.
Im Wartezimmer hätte ich lieber die Wand angestarrt, als mich mit der alten Frau zu unterhalten. Im Sprechzimmer fand ich es schrecklich, aber nicht überraschend, dass eines meiner Organe vielleicht – oder vielleicht auch nicht – an meinem missratenen Körper schuld ist. Mein Körper funktioniert, ebenso wie meine Psyche, schon seit Jahren nicht richtig, weil ich dazu bestimmt zu sein scheine, Krankheiten magisch anzuziehen und immer der Sündenbock für alles zu sein. Ich erzählte ihm von den Gedanken, die mich quälen sollten, aber beruhigen: Ich habe all das verdient. Ich bin der Fehler in der Welt, und all das Negative in meinem Leben ist mein eigenes Verschulden.
Durch das Tippen meiner Gedanken werde ich mir meiner Gefühle bewusst. Allmählich beginnen Probleme, die mir weder greifbar noch definierbar schienen, deutlicher und klarer zu werden. Trotz der Erleichterung durch ein gutes, tonloses Gespräch ohne die Mühe, den anderen anzusehen und die richtigen Worte mit richtiger Betonung und angemessener Mimik und Gestik zu formen, wächst gleichzeitig auch die gefühlslose Leere, die mich seit Monaten regelmäßig erfüllt.
Thilo lief mir vor etwa fünf bis sechs Jahren online über den Weg, als ich einige Nächte in einer Klinik verbringen musste. Von Ermüdungserscheinungen und Überforderung dahingerafft lag ich im Krankenhausbett und hatte nicht einmal mehr Freude daran, mit der elektrischen Steuerung des Bettes zu spielen. Von außen und in Filmen sieht so ein Bett mit Fernbedienung meist spaßiger aus, als es für den Patienten wirklich ist. Zumindest hat man keinen Spaß mehr daran, wenn man eigentlich nicht mehr leben möchte.
Die Depression wurde mir erst eineinhalb Jahre später diagnostiziert und auch da war Thilo für mich da, um mich zwischen Selbstzweifeln und -hass zu unterstützen. Das tat er meist durch Ablenkung, denn Rumblödeleien und Gedankenausflüge seien seiner Meinung nach die einzige Methode, mit einem Stimmungstief umzugehen. Meine Gedanken seien der Depression geschuldet, also keine echten Worte meiner selbst. Wenn eine Krankheit deine Gefühle bestimmt, sollte ich Thilos Meinung nach schlichtweg andere Emotionen in mein Leben lassen. Das probierte ich zwar, aber eigentlich immer kam die Depression durch, zog mich runter und erfüllte mich mit diesem ekelhaften Nichts. Es war, als zöge sie alles aus mir raus, und als würde Thilo mit seinen Ratschlägen unrecht haben.
Ich landete damals in einem Forum für Depressive und Angehörige. Eigentlich habe ich nur «Soforthilfe für Depressive» gegoogelt, weil ich einen dieser ganz akuten Tage hatte. Am liebsten wäre ich ins Krankenhaus gegangen, aber immer, wenn ich mich dazu entschließe, komme ich nicht einmal zur Haustür raus. Ich bin nicht suizidal. Und wenn man sich nicht umbringen will, ist die Depression nicht schlimm genug, schätze ich.
Und sowieso – würde ich ein paar Tage in der Klinik erholen und gut behandelt werden, bräche der Alltag danach wieder über mich herein. Die Depression käme zurück. Unheilbare Scheißerkrankung! Wie ein Messerstich in den Rücken tritt sie auf und versaut einem den ganzen Tag. Eine ganze Woche. Da das Internet nur Tipps wie Bewegung, gesunde Ernährung und Ablenkung für mich bereithielt, habe ich in diesem Forum einen Thread eröffnet und mir meinen Kummer öffentlich von der Seele geredet.
Thilo war sofort da. Er hat mir geantwortet, mir nach drei Forenbeiträgen seine persönlichen Kontaktdaten gegeben, und seitdem konnte ich endlich mit jemandem sprechen. Auch wenn ich mich zwischendurch furchtbar allein fühle, was im Alltag leider häufig der Fall ist.
«Wow, das ist eine Menge Holz», antwortet Thilo auf meinen ausführlichen Monolog. «Welche drei Dinge oder Ereignisse waren denn heute positiv?»
«Ich wurde nicht angegriffen oder ausgelacht», tippe ich entnervt. Hätte er nicht mehr auf meine Gedanken eingehen können? Bestimmt hat er nicht einmal gelesen, was ich geschrieben habe.
«Richtig positiv, meine ich.» Er fügt ein Emoticon an, das mit den Augen rollt. «Mein Tag war auch beschissen. Aber ich hatte ein super Mittagessen. Und das Wetter war schön. Also, es wurde erst scheiße, als ich wieder zu Hause war. Papa war nüchtern. Oder hat wenigstens so getan als ob.»
Thilo ist ein paar Jahre jünger als ich. Mit seiner bipolaren Störung ist er zumindest auf der depressiven Ebene mein Leidensgenosse und hat dafür im Gegensatz zu mir gute Gründe. Seine Kindheit war grauenhaft. Ein Elternteil miserabler als das andere, bis seine Familie auszusterben begann. Der Ärmste hat mit seinen zarten neunzehn Jahren bereits Mutter, alle Großeltern und einen Cousin verloren. Seinen Erzählungen zufolge ist er zu allem auch noch ein hochsensibler Mensch, empfindlicher als alle anderen. Und wird trotz allem noch weiter vom Leben geplagt.
Jetzt jobbt er viel und versucht, sich mit einem Säufer als Vater durchzuschlagen. Das Leben kann so hart sein, doch Durchhaltevermögen und echte Freundschaft haben Thilo zu dem widerstandsfähigen Menschen gemacht, der er jetzt ist. Wir lieben uns seit Jahren auf eine ganz besondere Weise. Es ist kein Körperkontakt notwendig und auch Bilder haben wir nie ausgetauscht. Auf sozialen Plattformen bleiben wir uns fremd und konzentrieren uns ausschließlich auf die inneren Werte des anderen. Wir sagen beide, dass nur die Persönlichkeit eines Menschen zählt. Dass meine Depression wohl durch all das Fett, das an meinem Körper hängt, ausgelöst wurde, kann ich Thilo natürlich nicht sagen. Es ist mir schon oft genug passiert, dass gute Internetbekanntschaften nach einem Outing meines Körpers von heute auf morgen geendet haben. Mit fetten Leuten will niemand etwas zu tun haben. Nicht, wenn sie so viel rumjammern wie ich.