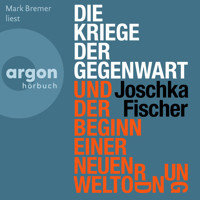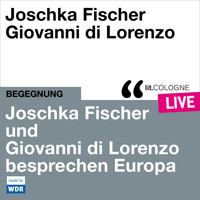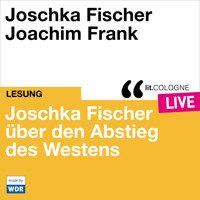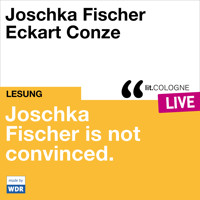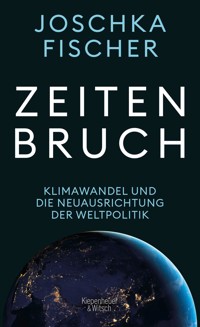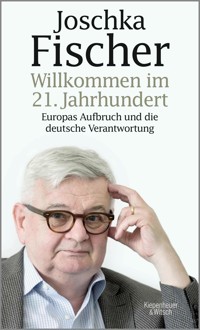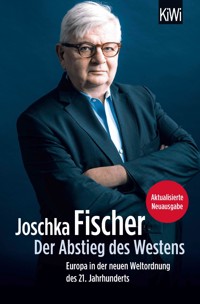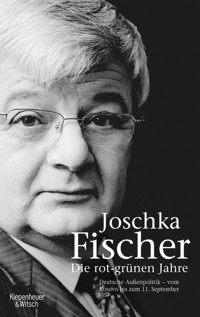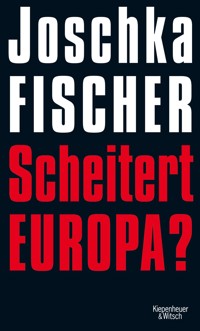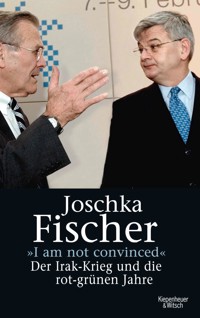19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Warn- und Weckruf des ehemaligen deutschen Außenministers Als im Morgengrauen des 24. Februar 2022 russische Truppen auf Befehl Wladimir Putins hin in die Ukraine einfielen, veränderte sich nicht nur Europa, sondern die gesamte Weltordnung: Der Krieg war nach Europa zurückgekehrt, der Krieg um Grenzen, um Herrschaftsansprüche und Machtfragen. Im Nahen Osten hat der Überfall der Hamas auf Israel gezeigt, welchen weltpolitischen Zündstoff verschleppte, teilweise uralte territoriale Konflikte wie jener um Palästina enthalten. Nimmt man Pekings Drohungen gegen Taiwan noch hinzu, lässt sich unschwer erkennen, wie instabil und brisant die Weltlage geworden ist. Hinzu kommt: Der globale Süden verlangt unwiderruflich sein Recht auf Mitsprache und Teilhabe. Neue Bündnisstrukturen entstehen, ohne und jenseits des Westens, der sich zunehmend auf sich selbst zurückgeworfen sieht, weltpolitisch an Bedeutung verliert und innerhalb Europas und der USA mit mächtigen nationalistischen und antidemokratischen Bewegungen konfrontiert ist. Und was wird schließlich aus Europa, wenn die USA sich nach den Präsidentschaftswahlen von ihren transatlantischen Verpflichtungen abwenden sollten? Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer beschreibt die Grundzüge dieser heraufziehenden neuen Ordnung und zeigt die Bedrohung und Herausforderung, die diese für die deutsche und europäische Politik bedeuten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Joschka Fischer
Die Kriege der Gegenwart und der Beginn einer neuen Weltordnung
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joschka Fischer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joschka Fischer
Joschka Fischer, geboren 1948 in Gerabronn. Von 1994 bis 2006 Mitglied des Bundestages, von 1998 bis 2005 Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. 2006/07 Gastprofessor an der Universität Princeton, USA. Joschka Fischer lebt in Berlin.
Im Verlag Kiepenheuer & Witsch sind bisher erschienen: »Risiko Deutschland« (1994), »Für einen neuen Gesellschaftsvertrag« (1998), »Die Rückkehr der Geschichte. USA, Europa und die Welt nach dem 11. September« (2005), »Die rot-grünen Jahre. Deutsche Außenpolitik – vom Kosovo bis zum 11. September« (2009), »I am not convinced« (2011), »Scheitert Europa?« (2014), »Der Abstieg des Westens« (2018), »Willkommen im 21. Jahrhundert« (2020).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als im Morgengrauen des 24. Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einfielen, veränderte sich nicht nur Europa, sondern die gesamte Weltordnung: Der Krieg war nach Europa zurückgekehrt, der Krieg um Grenzen, um Herrschaftsansprüche und Machtfragen.
Im Nahen Osten hat der Überfall der Hamas auf Israel gezeigt, welchen weltpolitischen Zündstoff verschleppte, teilweise uralte territoriale Konflikte wie jener um Palästina enthalten. Nimmt man Pekings Drohungen gegen Taiwan noch hinzu, lässt sich erkennen, wie instabil und brisant die Weltlage geworden ist. Hinzu kommt: Der globale Süden verlangt unwiderruflich sein Recht auf Mitsprache und Teilhabe. Neue Bündnisstrukturen entstehen, ohne und jenseits des Westens, der sich zunehmend auf sich selbst zurückgeworfen sieht, weltpolitisch an Bedeutung verliert und innerhalb Europas und der USA mit mächtigen nationalistischen und antidemokratischen Bewegungen konfrontiert ist. Und was wird schließlich aus Europa, wenn die USA sich unter der zweiten Präsidentschaft Trumps von ihren transatlantischen Verpflichtungen abwenden sollten?
Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer beschreibt die Grundzüge dieser heraufziehenden neuen Ordnung und zeigt die Bedrohung und Herausforderung, die diese für die deutsche und europäische Politik bedeuten.
Inhaltsverzeichnis
Nach der US-Präsidentschaftswahl / Donald Trump und die Folgen
Chaos als Ordnungsprinzip in der zukünftigen Staatenwelt
Der lange Schatten des Imperiums über Europa / Russland
Der 7. Oktober 2023 und seine Folgen / Nahost
Quo vadis, Amerika? / USA
Das Jahrhundert des Drachen? / China
Europa und seine ungelöste Machtfrage
Die nationalistische Herausforderung
Nach der US-Präsidentschaftswahl / Donald Trump und die Folgen
Amerika hat gewählt. Dieser amerikanische Wahltag, jener Dienstag, der 5. November 2024, darf wohl mit vollem Recht global als die wichtigste politische Entscheidung dieses Jahres bezeichnet werden. Denn in welche Richtung der mächtigste Staat der Welt, die letzte verbliebene Supermacht sich wendet, ist von weltweiter Bedeutung, ja, bestimmt die zukünftige Ordnung der Welt. Denn dies war eine Richtungsentscheidung zwischen liberaler, verfassungsbasierter Demokratie oder deren Transformation zu einer nur mühselig noch demokratisch kaschierten Oligarchie in der Innenpolitik und zwischen einem außenpolitisch isolationistischen Amerika und einem Amerika, das an seiner regelbasierten, sich auf Bündnisse stützenden außenpolitischen Tradition als globale Ordnungsmacht festhält.
Von der großen Mehrheit der veröffentlichten Meinung war vor dieser Wahl in den USA ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris vorausgesagt worden. Was dann in der Wirklichkeit der Wahlnacht folgte, war etwas ganz anderes, nämlich ein Erdrutschsieg Donald Trumps. Allein dieses Faktum wiegt schwer, da es die grundsätzlichen Veränderungen in der Gesellschaft der USA sichtbar macht. Diese werden wohl von Dauer sein. Trump eroberte mit klaren Mehrheiten alle wahlentscheidenden »swing states« und hatte recht schnell die für seine zweite Präsidentschaft notwendige Anzahl der Stimmen im »Electoral College« zusammen. Er konnte sich schon nach einer kurzen, aber eindeutigen Wahlnacht zum Sieger erklären.
Neben dem Weißen Haus eroberten die Trump-Republikaner auch die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses, und gemeinsam mit einer konservativen Mehrheit im Supreme Court wird Donald Trump zumindest für zwei Jahre, bis zu den nächsten »Halbzeitwahlen« des Kongresses, durchregieren können. Zudem bekam er, zum ersten Mal überhaupt, die landesweite Mehrheit (»public vote«) der Amerikanerinnen und Amerikaner, was den innen- wie außenpolitisch absehbaren radikalen Kurs- und Politikwechseln des neuen Präsidenten eine zusätzliche Legitimation verleihen wird. Denn diesmal war es kein mehr zufälliger Wahlsieg, keine Überraschung, wie bei seinem ersten Wahlsieg 2016 zum 45. Präsidenten der USA. Diesmal hat den 47. Präsidenten die Mehrheit der wahlberechtigten Amerikanerinnen und Amerikaner, wissend um seinen Charakter, seine mehrfach versuchten Verfassungsbrüche, seine sonstigen kriminellen Handlungen und wissend auch um die Gefahr, die dieser Mann für die amerikanische Demokratie darstellt, gewählt – und diesmal nicht trotz, sondern wegen dieser Eigenschaften!
Auch wenn es den Europäern schwerfällt, ihr traditionelles Bild von Amerika aufzugeben – der Leuchtturm der Demokratie und die immer präsente Schutzmacht des demokratischen Europas vor allen autoritären und totalitären Bedrohungen –, es führt für Europa kein Weg daran vorbei, diese neue Realität anzuerkennen: Der 5. November 2024 war eine schwere Niederlage für das liberale Amerika und seine, über die Jahrzehnte hinweg weltweit prägende liberale demokratische Kultur. Die USA waren für lange Zeit das demokratische und liberal-rechtsstaatliche Vorbild, und sie waren mit ihrer gewaltigen militärischen wie auch wirtschaftlichen Macht immer auch der machtpolitische und wirtschaftliche Garant für den gesamten liberalen Westen, vor allem auch auf der anderen, der europäischen Seite des Atlantiks.
Mit dem Wahlsieg Trumps wurde so auch das Ende des liberalen Westens insgesamt eingeläutet, und damit trägt jene stolze westliche Führungsmacht – und das ist bitter, feststellen zu müssen! – zum Untergang jener von ihr durch ihre hart erkämpften Siege in zwei heißen Weltkriegen und einem globalen Kalten Krieg geschaffenen regel- und rechtsbasierten Weltordnung bewusst und willentlich bei. Die USA sind vor allem aufgrund ihrer kontinentalen Größe, ihres Ressourcenreichtums und ihrer geopolitischen Lage, beschützt durch die beiden größten Ozeane der Erde, von außen nicht besiegbar. Sie können sich nur selbst besiegen, was sie tatsächlich mit China gemein haben. Seit der letzten Wahlnacht werden wir Zeugen eines schleichenden inneren Prozesses der amerikanischen Selbstzerstörung. Denn was ist der liberale Westen? Es sind die Demokratien und Rechtsstaaten im nordatlantischen Raum, mit Verfassungen, gründend auf den Menschenrechten und den Werten der Aufklärung, bisher angeführt und beschützt von den USA. Donald Trump wird dieses einmalige Bündnis aufkündigen, und man wird dann sehen, dass auch die mächtigen USA von diesem gemeinsamen nordatlantischen Werte- und Zivilisationsmodell erheblich profitiert haben.
Das alles ereignete sich in der Nacht vom 5. auf den 6. November, während Europa schlief.
Jetzt ist eingetreten, was aus europäischer Sicht nicht eintreten durfte, auch wenn es seit Langem absehbar war. Ein schwaches, altes Europa ist plötzlich allein zu Hause, mit einer imperialen Macht als Nachbar im Osten und deren Krieg an seinen Grenzen – und einer amerikanischen Schutzmacht im Westen, die sich für den Isolationismus entschieden hat und sich am liebsten in ihre eigene Hemisphäre zurückziehen würde. Auf längere Sicht kann dies für Europa der Beginn einer Entscheidung zwischen Transatlantismus und Eurasien bedeuten. Vor allem für das Land in der Mitte der EU, für Deutschland mit seiner späten Entscheidung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer für die Westbindung, würde diese Alternative zwischen Transatlantismus und Eurasien eine gefährliche Zerreißprobe mit sich bringen. Erneut würde dies das Land zu einem zwischen Ost und West schwankenden Kandidaten in der Mitte des Kontinents machen. Es wäre die Lage, in der das Land bis Adenauers Westintegration zu seinem Unglück immer gewesen war.
Das Drama unserer Tage spielt sich für Europa zwischen zwei Daten ab: der 24. Februar 2022, dem Tag des Beginns des militärischen Überfalls Russlands auf die Ukraine, und der 5. November 2024, der Tag des triumphalen Wahlsieges von Donald Trump und des amerikanischen Isolationismus. Dieser Tag beendete auch einen ganzen Zeitabschnitt in der Geschichte der USA, der unter der Präsidentschaft Franklin Delano Roosevelts mit dessen Eintritt in den Zweiten Weltkrieg begonnen hatte. Das Land wurde dadurch zur liberalen Ordnungsmacht auf dem Globus und schuf entsprechend seiner eigenen freiheitlichen Prinzipien eine sehr erfolgreiche Weltordnung, die nun durch ein instabiles System der Rivalität großer, miteinander konkurrierender Mächte abgelöst werden wird.
Die Wahl Trumps wird dafür als ein mächtiger Verstärker wirken. Die aktuelle Debatte um die Folgen der zweiten Wahl Donald Trumps fällt bisher sehr unterschiedlich aus, je nachdem, ob man bei dem Versuch einer prognostischen Bewertung vor allem auf der taktisch operativen Ebene verbleibt oder ob man darüber hinaus auch die strategisch-historische Dimension seiner Wahl mit einbezieht. Trump wird einem kruden amerikanischen Interessennationalismus folgen und sich wenig um die Auswirkungen dieser sehr grundsätzlichen Veränderung kümmern.
Aus europäischer Sicht ist dies gleichsam eine doppelte Zeitenwende! Denn zwischen diesen beiden Daten entwickelte sich für das demokratische Europa ein Albtraumszenario: Im Osten des Europäischen Kontinents führt ein neoimperiales Russland einen Angriffskrieg gegen einen Nachbarn und zielt damit auch auf eine grundsätzliche Veränderung der europäischen Ordnung, wie sie durch die Werte der EU verkörpert wird. Und im Westen macht sich Europas bisheriger zentraler Bündnispartner und Sicherheitsgarant daran, sich von und aus Europa zurückzuziehen. Das Aufwachen am 6. November war für Europa ernüchternd, und es zeigte sich angesichts der drohenden strategischen und historischen Veränderungen im transatlantischen Verhältnis, dass sich die von Trump angedrohten Strafzölle auf die europäischen Exporte in die USA, bei aller wirtschaftlichen Bedeutung, noch als das kleinste Problem darstellen werden. Denn der Verlust der Schutzmacht USA bedeutet für Europa, dass es im Interesse seiner eigenen Sicherheit selbst zur Macht werden muss, was eine fundamentale Erneuerung der EU notwendig macht, und dies ist ganz gewiss keine kleine Aufgabe!
Die amerikanischen Wahlen werden aber nicht nur heftige Auswirkungen für Europa haben, sie werden die gesamte Weltordnung erschüttern. Denn wenn die weltweite Führungsmacht ihren grundlegenden Kurs ändert, wird dies weltweite Folgen haben, es wird die Institutionen, auf denen diese Ordnung beruht, dramatisch schwächen und rivalisierende Großmächte in ihren Angriffs- und Interventionsfantasien bestärken und so das globale Chaos vergrößern. Ein schwacher Westen wird weltweit die autoritären Alternativen stärken und so die globale Instabilität bis hin zu einer allgemeinen Kriegsgefahr vergrößern.
Donald Trump ist gewiss nicht an der Stärkung der multilateralen Institutionen interessiert, die er aus grundsätzlicher Überzeugung heraus ablehnt. Eine auf multilateralen Institutionen und anerkannten Regeln basierende Weltordnung passt nicht in das Weltbild des kommenden Präsidenten der USA. Er denkt nicht multilateral, und allein diese Tatsache wird zukünftig große Verwerfungen bis hin zu tiefen Zerwürfnissen innerhalb des transatlantischen Verhältnisses mit sich bringen.
Gespannt darf man sein, wie Donald Trump den Erhalt der amerikanischen Führungsrolle als Weltmacht ausgestalten wird. Denn hier zeichnet sich bereits ein grundsätzlicher Widerspruch ab. Trump hat sich im Wahlkampf als »Friedenspräsident« dargestellt, er will den militärischen Interventionismus der globalen Supermacht beenden. Als Präsident werden ihn aber die ersten großen Herausforderungen vom ersten Tag seiner zweiten Präsidentschaft an beschäftigen. Es sind dies die beiden aktuellen Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten.
Putins Krieg in der Ukraine zielt ja nicht nur auf dieses Nachbarland, er hat viel weitergehende Ziele: Russlands Hegemonie über Europa durch die Zerstörung von EU und NATO und, mehr noch, die Beendigung der amerikanischen Weltordnung und die Etablierung einer autoritären, eurasisch dominierten Ordnung der Welt. Wie die USA unter Trump auf diesen Angriff auf den Westen reagieren werden – ob überhaupt und wenn ja, wie? – wird die entscheidende Frage in Trumps Außenpolitik sein. Man wird diese Frage recht schnell an seinem Umgang mit dem Krieg in der Ukraine beantworten können.
Werden Trump und die Seinen an der weiteren Unterstützung der Ukraine festhalten? Oder werden sie die Ukraine zu einem Waffenstillstand mit erheblichen territorialen Verlusten zwingen? Mit welchen Sicherheitsgarantien und durch wen? Und welche Auswirkungen hätte ein solcher Waffenstillstand für Europas Sicherheit, denn von der Garantie einer solchen Waffenstillstandslinie hinge dann auch Europas Sicherheit ab.
Und wie wird Trump den Krieg im Nahen Osten anpacken? An seiner Nähe zu Benjamin Netanjahu besteht kein Zweifel, aber auch dort stößt man zugleich auf einen ernsten Widerspruch. Nach der militärischen Niederlage von Hamas und Hisbollah und der signifikanten Schwächung der sogenannten »Achse des Widerstandes« unter Führung des Irans stellt sich für Netanjahu die Frage, ob er diese für Israel einmalig günstige Lage militärisch bis zum endgültigen Sieg über seine Feinde nutzen soll oder nicht, inklusive eines großen Krieges um das iranische Atomprogramm.
Wird Trump dem zustimmen und Netanjahu freie Hand vor allem gegenüber dem Iran gewähren oder auf eine Beendigung der Kampfhandlungen drängen, wie das die bisherige Regierung Biden getan hat. Netanjahus militärische Position ist stark, politisch aber ist sie schwach, da er keine Antwort für die Zukunft Gazas und die der Palästinenser im Allgemeinen hat. Die gegenwärtige israelische Regierung lehnt jede Form einer Zwei-Staaten-Lösung ab. Was aber dann? Diese Frage richtet sich ebenso an Donald Trump – über eine Antwort kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur spekulieren.
Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen haben so zur geopolitischen Unruhe und Instabilität, die das Thema der folgenden Kapitel sind, erheblich beigetragen. Die vor uns liegenden Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte werden besonders für Europas Sicherheit und seine Rolle in der Welt ganz entscheidend sein. Putin und Trump, jeder auf seine Art, stellen die Europäer vor die Machtfrage: Wie stark ist dieses Europa, wie einig auch? Wie anpassungsfähig an die neue Weltlage im 21. Jahrhundert?
Chaos als Ordnungsprinzip in der zukünftigen Staatenwelt
Chaos als Ordnungsprinzip, das klingt beim ersten Nachdenken wie ein Widerspruch in sich. Wenn sich jedoch eine bestehende geopolitische Ordnung beginnt aufzulösen und sich eine andere herausbildet, dann hat man es, das zumindest lehrt die historische Erfahrung, in der Regel mit einer chaotischen Phase des Übergangs zu tun, bis sich die neuen Machtverhältnisse durchgesetzt haben. Genau in einer solchen Situation befindet sich die Welt in unseren Tagen, allerdings mit dem wichtigen Unterschied zur Vergangenheit, dass aufgrund des Wachstums der technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse, der wirtschaftlichen Produktivkräfte und des quantitativen Wachstums der Menschheit wie auch des Wachstums der Bedürfnisse von mehr als acht Milliarden Menschen die Welt dabei ist, überfordert zu werden. Globale Zusammenarbeit müsste daher die Devise unserer Zeit angesichts dieser allenthalben feststellbaren Überforderungen lauten, stattdessen sieht es aber in der Geopolitik mehr nach einer Zunahme globaler Konfrontationen und Kriege aus. Statt eines echten Neubeginns, der eigentlich in unserer Zeit anhand der objektiven Fakten und der technologischen Veränderungen erforderlich wäre, scheint zumindest kurzfristig alles auf eine Verlängerung, ja sogar eine Rückkehr der Vergangenheit in der Geopolitik hinauszulaufen. Die wichtigsten Mächte scheinen, trotz fantastischer technologischer Neuerungen, Angst vor der Zukunft zu haben. Wie anders lässt sich ansonsten der allenthalben festzustellende geopolitische Rückschritt der Gegenwart erklären?
Uns Zeitgenossen lässt bei der Betrachtung der Weltläufte der Eindruck der Auflösung, eines globalen Ordnungsverlustes, die Ahnung eines sich daraus ergebenden, drohenden Chaos nicht los. Die Generationen von Europäern, die während des Kalten Krieges herangewachsen sind, erinnern sich noch gut an die unerbittlich starre, ja eiserne Ordnung auf unserem Kontinent, die der Kalte Krieg zwischen den beiden Hauptsiegermächten des Zweiten Weltkriegs, den USA und der Sowjetunion, hervorgebracht hatte. Das damalige Europa war zweigeteilt, Ost gegen West, riesige Armeen, ausgerüstet mit zerstörerischer konventioneller und thermonuklearer Waffentechnik, standen sich auf europäischem Boden gegenüber, getrennt lediglich durch einen Zaun, euphemistisch »eiserner Vorhang« (eine Wortschöpfung des früheren britischen Premierministers Winston Churchill) genannt, um die Einflusszone der jeweiligen Supermacht abzugrenzen und zu sichern.
Der Kalte Krieg in Europa griff recht schnell über den alten Kontinent hinaus, globalisierte sich und führte zu einer bipolaren Weltordnung in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, deren wichtigstes Kennzeichen »Stabilität« war, erzwungen durch die gegenseitige atomare Vernichtungsdrohung. In unserer heutigen Welt mit den Kriegen in der Ukraine und in Gaza, den marodierenden Huthis im Roten Meer, der noch längst nicht vergessenen Covidpandemie, der Kriegsgefahr um Taiwan und der Ausdehnung des Gaza-Kriegs zu einem regionalen Krieg im Nahen Osten, einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Iran und Israel, scheint Stabilität zu einer raren Ressource geworden zu sein.
1989 ereignete sich dann völlig unerwartet und unverhofft das »Wunder Gorbatschow«. Bis dahin Undenkbares geschah, Deutschland wurde wiedervereinigt, der Warschauer Pakt und die Sowjetunion verschwanden in der Folgezeit auf friedliche Weise, der Kalte Krieg war zu Ende, und die durch ihn hervorgebrachte bipolare Weltordnung löste sich auf. Mit diesen unerwarteten Ereignissen ging allerdings auch die Stabilität des Kalten Krieges dahin, wie wir heute wissen. Die Ursünde des Westens bestand im Rückblick damals darin, dass der Westen nicht wahrnehmen wollte, dass dieselben Ereignisse, die er als »Wunder« bezeichnete, in weiten Teilen der russischen politischen Elite als »Katastrophe« empfunden wurden. Aus verständlichen Gründen folgte der Westen einer idealistischen Interpretation des »Wunders Gorbatschow«, keiner realistischen. Denn Stabilität als geopolitische Kategorie war mit dem Ende des Kalten Krieges keineswegs überflüssig geworden, sondern hätte einer Erhaltung unter völlig veränderten geopolitischen Bedingungen bedurft. Das »Wunder Gorbatschow« hatte zu einer völlig veränderten Weltordnung geführt, deren inhärente Instabilität erst in unseren Tagen sichtbar wurde.
Für den Westen schien damals die Zeit der Verwirklichung von Utopien angebrochen zu sein, zumindest glaubte man dies auf dem europäischen Kontinent, vor allem im Zentrum des zu Ende gegangenen Kalten Krieges, in Deutschland. Der »Ewige Friede« des Königsberger Philosophen Immanuel Kant schien zum Greifen nah, schien machbar zu sein. Im Rückblick wissen wir, dass es die Zeit einer großen, einer schönen Illusion gewesen ist. In der harten Realität der Geopolitik entstand in Wirklichkeit die kurze Zeit einer unipolaren Weltordnung, der alleinigen Herrschaft der letzten verbliebenen Supermacht Amerika, die schon nach wenigen Jahrzehnten an neokonservativer Hybris im Zweistromland, seit alters her der »Friedhof der Imperien«, ihr Ende finden sollte. Amerika zog sich in seine westliche Hemisphäre zurück. Die Ausnahmen blieben die Präsenz in Europa durch die NATO und Ostasien mit Südkorea und Japan sowie seine mächtige Flottenpräsenz auf den Weltmeeren. Was daraufhin folgte, war ein schwankender Übergang zu einer multipolaren Weltordnung. Dies ist nichts anderes als ein verharmlosender Begriff für das Chaos, das die neu entstandene Rivalität mehrerer großer Mächte global verursachen sollte. Und damit sind wir in der Gegenwart angekommen, im Zeitalter der Rivalität mehrerer globaler Großmächte, angereichert noch durch eine epochale Zäsur – das langsame Verschwinden der mehrhundertjährigen westlichen Dominanz auf der Weltbühne zugunsten neu entstandener, historisch aber teilweise sehr alter Mächte aus dem globalen Süden wie China und Indien, aber auch Brasilien und Indonesien. Das Wiederaufleben alter Konflikte wie dem zwischen dem erneut seinem imperialen Fieber verfallenen Russland und dem Westen haben den Eroberungskrieg, das gewaltsame Verschieben von Grenzen und die Eroberung von Territorien als Bestandteil der Geopolitik zurückgebracht. Der Betrachter kann sich dabei mehr an das späte neunzehnte und frühe zwanzigste Jahrhundert erinnert fühlen als an die Zeiten der bipolaren Blockkonfrontation während des Kalten Krieges. Bedeutet diese Entwicklung, der Übergang von einer regelbasierten zu einer machtbasierten Weltordnung, die wir Zeitgenossen im Westen als eine chaotische Entwicklung empfinden, eine Rückkehr in die Vergangenheit ständiger kriegerischer Auseinandersetzungen konkurrierender Mächte? In der globalen Politik scheint dies so zu sein. In welcher Weltordnung werden mehr als acht Milliarden Menschen zukünftig leben? Ohne Ordnung, im Chaos der Rivalität mehrerer großer Mächte und deren widerstreitender Interessen, Wertesysteme und irrationaler Ambitionen, allerdings, im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten, ausgerüstet mit Atomwaffen, digitaler Technik und künstlicher Intelligenz?
In welcher Zeit leben und denken eigentlich der russische Präsident Wladimir Putin und die Seinen im Kreml? Lebt man dort mental in der Gegenwart oder eher im zaristischen Russland des neunzehnten Jahrhunderts unter Nikolaus I.? Die gemeinsame Gegenwart, das Jahr 2024, scheint sich durch die Rückkehr mehrerer Vergangenheiten aufzusplittern: Putins russische Zeit, Xi Jinpings neomaoistische Zeit in der chinesischen KP und Donald Trumps US-amerikanische Retrozeit mit seinem »Make America Great Again!«. Hinzu kommen noch die vielfältigen Vergangenheiten in den Fantasien der neonationalistischen Rechten in den europäischen Nationalstaaten, all diese imaginierten Zeiten kehren als politische Untote zurück und versuchen sich an einer Art Retrogestaltung der Zukunft. Der Isolationismus unter Donald Trump in den USA, der Neonationalismus im Europa der EU stehen neben einem wegen seiner Größe und inneren Widersprüche beständig vom Zerfall bedrohten Imperium namens Russland, das bis heute immer noch nicht weiß, als was es sich eigentlich selbst sehen soll – als Nationalstaat der Gegenwart oder als Imperium, gefangen in einer imaginierten, glorreichen Vergangenheit. Dazu kommt die Wiederkehr einer Zweiteilung der Welt in Demokratien und Autokratien. Ordnung, eine belastbare, nachhaltige Friedensordnung gar, kann in diesem Spukschloss namens Gegenwart kaum entstehen. Dabei tritt unsere Welt durch die Entwicklung der Hochtechnologie soeben in ein völlig neues Zeitalter ein, geprägt von der künstlichen Intelligenz. Geopolitisch aber haben wir es ganz aktuell mit bedrohlichen Schatten der Vergangenheit zu tun.
In der Konkurrenz um die Rolle der globalen Nummer eins spielt Russland im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht mehr mit, denn dazu reichen seine wirtschaftlichen, militärischen und technologischen Fähigkeiten nicht aus. Ihm bleibt nur seine dauerhafte Bindung als Juniorpartner an China, gewissermaßen die freiwillige Unterwerfung unter eine Art zweites »mongolisches Joch«. Es sei nicht vergessen, Russland wurde – unter Napoleon und Hitler – zweimal im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert von Westen her angegriffen. Rechnet man den Ersten Weltkrieg noch hinzu, dann geschah dies sogar dreimal. Es wurde jedoch niemals von dort aus erobert. Dies gelang allein den Mongolen im Winter 1237/38 von Osten kommend, und diese Tatsache sollte für die russische Geschichte weitreichende Folgen haben.
Die geopolitische Hauptachse des einundzwanzigsten Jahrhunderts wird durch die Beziehungen der USA zu China gebildet werden, den beiden heute bereits absehbaren Supermächten dieses Jahrhunderts in Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Militär. Die beiden Mächte stellen einen diametralen Gegensatz in ihrer Geschichte und Philosophie dar. Amerika ist, verglichen mit der fünftausendjährigen ununterbrochenen staatlichen Kontinuität Chinas und seiner ganz Ost- und Südostasien prägenden Zivilisation, die das Allgemeininteresse der Gesellschaft dem Individuum und seiner individuellen Freiheit überordnet, ein politisch noch junges Land, gegründet 1776 im Zeitalter der Aufklärung von europäischen Auswanderern, die vor allem auf individuelle Freiheit und Eigenverantwortung setzten. Ein System von »Checks und Balances« sollte die Macht des entstehenden Staates von Anfang an begrenzen, und dieser Wille fand seinen institutionellen Niederschlag in der US-amerikanischen Verfassung. Das kaiserliche wie auch das kommunistische China dagegen konzentrierte alle Macht in einer Person, war und ist hyperzentralisiert, die USA sind ein dezentralisierter Bundesstaat. Beiden so unterschiedlichen Staaten gemein aber ist ihr enormes Machtpotenzial im einundzwanzigsten Jahrhundert, das deren Beziehung zu einer höchst widersprüchlichen Angelegenheit macht – Rivalen und Partner zur selben Zeit.
Wird dieses Verhältnis auf Kooperation gründen, werden sich diese beiden Supermächte verstehen und zusammenarbeiten – was ich trotz aller aktuellen Spannungen und Verwerfungen zwischen den beiden Mächten keineswegs für ausgeschlossen halte –, dann werden die Chancen auf eine friedliche Zukunft in unserem Jahrhundert sehr viel besser sein. Das gilt auch für die Bewältigung der neu entstandenen globalen Herausforderungen, wahre Menschheitsaufgaben, wie etwa der Klimaschutz und die Kontrolle der weiteren Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Und wenn nicht, wenn Konfrontation und feindliche, gegeneinander gerichtete Bündnisse das chinesisch-amerikanische Verhältnis dominieren werden, so wird das Gegenteil gelten. Russland dagegen wird lediglich die Rolle eines zwar wichtigen Juniorpartners und Rohstofflieferanten spielen und aufgrund seiner imperialen Träume und Sehnsüchte ein andauerndes Sicherheitsrisiko und damit auch, als direkter Nachbar, ein dauerhaftes europäisches Problem bleiben.
Ob dies für das Selbstverständnis der russischen Machteliten, für ihr Selbstbild von Russland als Weltmacht auf Dauer und für den territorialen Zusammenhalt des riesigen Landes reichen wird, darf bezweifelt werden. Die zukünftigen Konflikte in dieser aktuellen nordasiatischen Allianz von China und Russland sind, vor allem bedingt durch die Westausdehnung Chinas nach Zentralasien hinein, in ein altes traditionell russisches Einflussgebiet also, bereits heute abzusehen.
Worin wird Europas Rolle in dieser multipolaren Welt bestehen? Die Antwort darauf wird stark davon abhängen, ob Europa im Ukrainekrieg bestehen und die Ukraine als souveräner Staat überdauern wird. Denn dies hieße auch ein Sieg für die europäischen Grundprinzipien, auf denen die EU