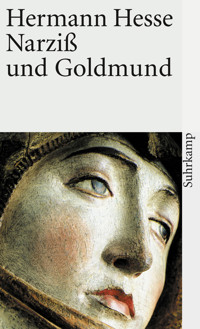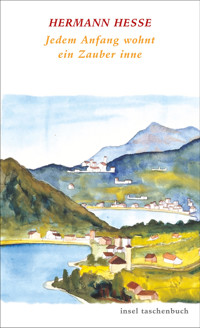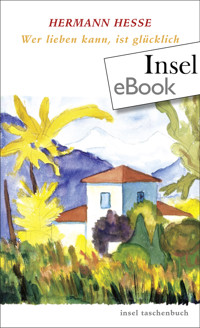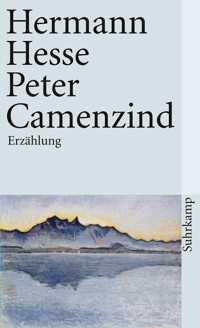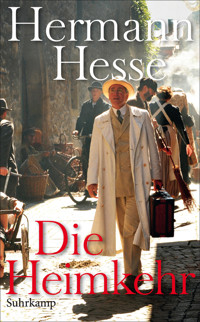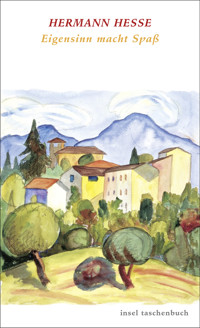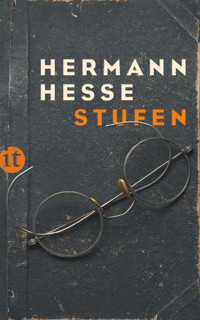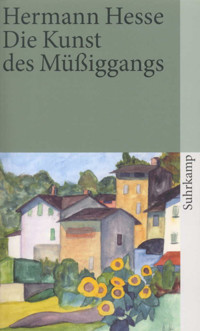
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das thematische Spektrum der hier chronologisch nach ihren Entstehungsdaten oder dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen Publikation angeordneten Texte reicht von der Schilderung der Rüge Hesses während der Pionierzeit der Luftfahrt im Flugzeug oder im Luftschiff des Grafen Zeppelin über die prophetische Karikatur der zur stereotypen Öde perfektionierten Ferienparadiese des kommerziellen Tourismus bis hin zur Parodie der naiven Fortschrittshörigkeit einer Leistungsgesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hermann Hesse
Die Kunst des Müßiggangs
Kurze Prosa aus dem Nachlaß Herausgegeben und mit einem Nachwort von Volker Michels
Suhrkamp
Inhalt
Die Kunst des Müßiggangs
Über das Reisen
Der Hausierer
Eine Rarität
Septembermorgen am Bodensee
Winterglanz
Das erste Abenteuer
Schlaflose Nächte
Am Gotthard
Liebe
Brief eines Jünglings
Eine Sonate
In der Augenklinik
Gubbio
Liebesopfer
Wolken
Zu Weihnachten
Fragment aus der Jugendzeit
Die Hinrichtung
Vom Naturgenuß
Aus dem Briefwechsel eines Dichters
Auf dem Eise
Doktor Knölges Ende
Das Nachtpfauenauge
Spazierfahrt in der Luft
Im Flugzeug
Poetische Grabreden
In Kandy
Winterausflug
Ein Reisetag
Vor einer Sennhütte im Berner Oberland
Der Brunnen im Maulbronner Kreuzgang
Der Traum von den Göttern
Musik
Der innere Reichtum
Der Maler
Die Stimmen und der Heilige
Heimat
Die Frau auf dem Balkon
Gang im Frühling
Kirchen und Kapellen im Tessin
Tanz
Notizblatt von einer Reise
Exotische Kunst
Das verlorene Taschenmesser
Was der Dichter am Abend sah
Die Fremdenstadt im Süden
Ausflug in die Stadt
Abendwolken
Aquarell
Winterferien
Unzufriedene Gedanken
Sommerliche Eisenbahnfahrt
Klage um einen alten Baum
Bei den Massageten
Schaufenster vor Weihnachten
Wiedersehen mit Nina
Gegensätze
Wenn es Herbst wird
Floßfahrt
Einst in Würzburg
Luftreise
Verregneter Sonntag
Rückkehr aufs Land
Zinnien
Nach der Weihnacht
Abstecher in den Schwimmsport
Bilderbeschauen in München
Virtuosen-Konzert
Lektüre im Bett
Wahlheimat
Feuerwerk
Bücher-Ausklopfen
Ein Traum
Eduards des Zeitgenossen zeitgemäßer Zeitgenuß
Falterschönheit
Basler Erinnerungen
Über einen Teppich
Nicht abgesandter Brief an eine Sängerin
Musikalische Notizen
Das gestrichene Wort
Der Sprung
Chinesische Legende
Nachwort
Nachweise
Zeittafel
Wenn ich nicht im Grunde ein sehr arbeitsamer Mensch wäre, wie wäre ich je auf die Idee gekommen, Loblieder und Theorien des Müßiggangs auszudenken. Die geborenen, die genialen Müßiggänger tun dergleichen niemals.
Hermann Hesse (1928)
Von mir aus betrachtet, stellen diese gelegentlichen Aufsätze, die sich wissentlich und absichtlich jener plaudernden Form bedienen, die man »Feuilleton« nennt, erstens einen nur unwesentlichen Teil meiner Arbeit dar, zweitens haben diese etwas spielerischen, häufig ironisch gefärbten Gelegenheitsäußerungen für mich einen gemeinsamen Sinn: den Kampf nämlich gegen das, was ich in unserer Öffentlichkeit den verlogenen Optimismus nenne ... [den] Kampf gegen die europäisch-amerikanische Modereligion vom souveränen modernen Menschen, der es so weit gebracht hat ... gegen die zwar kindliche, aber tief gefährliche Selbstgefälligkeit des glaubens- und gedankenlosen Massenmenschen in seinem Leichtsinn, seiner Überheblichkeit, seinem Mangel an Demut, an Zweifel, an Verantwortlichkeit. Die Worte dieser Art ... sind nicht an die Menschheit gerichtet, sondern an die Zeit, an die Leser von Zeitungen, an eine Masse, deren Gefahr nach meiner Überzeugung nicht im mangelnden Glauben an sich selbst und die eigene Herrlichkeit besteht. Häufig genug habe ich auch mit der allgemeinen Mahnung an die Grundlosigkeit dieser menschlichen Hybris die unmittelbare Mahnung an die Ereignisse unserer jüngsten Geschichte verbunden, an die Ahnungslosigkeit und den großsprecherischen Leichtsinn, mit dem wir in den Krieg gezogen sind, an die Abneigung der Völker wie der Einzelnen, die Mitschuld daran bei sich selbst zu suchen.
Hermann Hesse (1932)
Die Kunst des Müßiggangs
Ein Kapitel künstlerischer Hygiene
Je mehr auch die geistige Arbeit sich dem traditions- und geschmacklosen, gewaltsamen Industriebetrieb assimilierte, und je eifriger Wissenschaft und Schule bemüht waren, uns der Freiheit und Persönlichkeit zu berauben und uns von Kindesbeinen an den Zustand eines gezwungenen, atemlosen Angestrengtseins als Ideal einzutrichtern, desto mehr ist neben manchen anderen altmodischen Künsten auch die des Müßigganges in Verfall und außer Kredit und Übung geraten. Nicht als ob wir jemals eine Meisterschaft darin besessen hätten! Das zur Kunst ausgebildete Trägsein ist im Abendlande zu allen Zeiten nur von harmlosen Dilettanten betrieben worden.
Desto wunderlicher ist es, daß in unseren Tagen, wo doch so viele sich mit sehnsüchtigen Blicken gen Osten wenden und sich mühsam genug ein wenig Freude aus Schiras und Bagdad, ein wenig Kultur und Tradition aus Indien und ein wenig Ernst und Vertiefung aus den Heiligtümern Buddhas anzueignen streben, nur selten einer zum Nächstliegenden greift und sich etwas von jenem Zauber zu erobern sucht, den wir beim Lesen orientalischer Geschichtenbücher uns aus brunnengekühlten maurischen Palasthöfen entgegenwehen spüren.
Warum haben eigentlich so viele von uns an diesen Geschichtenbüchern eine seltsame Freude und Befriedigung, an Tausendundeine Nacht, an den türkischen Volkserzählungen und am köstlichen »Papageienbuch«, dem Decamerone der morgenländischen Literatur? Warum ist ein so feiner und originaler jüngerer Dichter wie Paul Ernst in seiner »Prinzessin des Ostens« diesen alten Pfaden so oft gefolgt? Warum hat Oscar Wilde seine überarbeitete Phantasie so gern dorthin geflüchtet? Wenn wir ehrlich sein wollen und von den paar wissenschaftlichen Orientalisten absehen, so müssen wir gestehen, daß die dicken Bände der Tausendundeine Nacht uns inhaltlich noch nicht ein einziges von den Grimmschen Märchen oder eine einzige von den christlichen Sagen des Mittelalters aufwiegen. Und doch lesen wir sie mit Genuß, vergessen sie in Bälde, weil eine Geschichte darin der anderen so geschwisterlich ähnlich ist, und lesen sie dann mit demselben Vergnügen wieder. Wie kommt das? Man schreibt es gern der schönen ausgebildeten Erzählerkunst des Orients zu. Aber da überschätzen wir doch wohl unser eigenes ästhetisches Urteil: denn wenn die seltenen wahren Erzählertalente unserer eigenen Literatur bei uns so verzweifelt wenig geschätzt werden, warum sollten wir dann diesen Fremden nachlaufen? Es ist also auch nicht die Freude an erzählerischer Kunst, wenigstens nicht diese allein. In Wahrheit haben wir für diese ja überhaupt sehr wenig Sinn; wir suchen beim Lesen, neben dem grob Stofflichen, eigentlich nur psychologische und sentimentale Reize auf.
Der Hintergrund jener morgenländischen Kunst, der uns mit so großem Zauber fesselt, ist einfach die orientalische Trägheit, das heißt der zu einer Kunst entwickelte, mit Geschmack beherrschte und genossene Müßiggang. Der arabische Geschichtenerzähler hat, wenn er am spannendsten Punkt seines Märchens steht, immer noch reichlich Zeit, ein königliches Purpurzelt, eine mit Edelsteinen behängte gestickte Satteldecke, die Tugenden eines Derwisches oder die Vollkommenheiten eines wahrhaft Weisen bis in alle Einzelheiten und Kleinigkeiten zu schildern. Ehe er seinen Prinzen oder seine Prinzessin ein Wort sagen läßt, beschreibt er uns Zug für Zug das Rot und den Linienschwung ihrer Lippen, den Glanz und die Form ihrer schönen weißen Zähne, den Reiz des kühn flammenden oder des schämig gesenkten Blickes und die Geste der gepflegten Hand, deren Weiße untadelhaft ist, und an welcher die opalisierenden, rosigen Fingernägel mit dem Glanze kleinodbesetzter Ringe wetteifern. Und der Zuhörer unterbricht ihn nicht, er kennt keine Ungeduld und moderne Lesergefräßigkeit, er hört die Eigenschaften eines greisen Einsiedlers mit demselben Eifer und Genusse schildern, wie die Liebesfreuden eines Jünglings oder den Selbstmord eines in Ungnade gefallenen Veziers.
Wir haben beim Lesen beständig das sehnsüchtig neidische Gefühl: Diese Leute haben Zeit! Massen von Zeit! Sie können einen Tag und eine Nacht darauf verwenden, ein neues Gleichnis für die Schönheit einer Schönen oder für die Niedertracht eines Bösewichts zu ersinnen! Und die Zuhörer legen sich, wenn eine um Mittag begonnene Geschichte am Abend erst zur Hälfte erzählt ist, ruhig nieder, verrichten ihr Gebet und suchen mit Dank gegen Allah den Schlummer, denn morgen ist wieder ein Tag. Sie sind Millionäre an Zeit, sie schöpfen wie aus einem bodenlosen Brunnen, wobei es auf den Verlust einer Stunde und eines Tages und einer Woche nicht groß ankommt. Und während wir jene unendlichen, ineinander verflochtenen, seltsamen Fabeln und Geschichten lesen, werden wir selber merkwürdig geduldig und wünschen kein Ende herbei, denn wir sind für Augenblicke dem großen Zauber verfallen – die Gottheit des Müßiggangs hat uns mit ihrem wundertätigen Stabe berührt.
Bei gar vielen von jenen Unzähligen, welche neuerdings wieder so müde und gläubig an die heimatliche Wiege der Menschheit und Kultur zurück pilgern und sich zu Füßen des großen Konfutse und des großen Laotse niederlassen, ist es einfach eine tiefe Sehnsucht nach jenem göttlichen Müßiggang, die sie treibt. Was ist der sorgenlösende Zauber des Bacchus und die süße, schläfernde Wollust des Haschisch gegen die abgrundtiefe Rast des Weltflüchtigen, der auf dem Grat eines Gebirges sitzend, den Kreislauf seines Schattens beobachtet und seine lauschende Seele an den stetigen, leisen, berauschenden Rhythmus der vorüberkreisenden Sonnen und Monde verliert? Bei uns, im armen Abendland, haben wir die Zeit in kleine und kleinste Teile zerrissen, deren jeder noch den Wert einer Münze hat; dort aber fließt sie noch immer unzerstückt in stetig flutender Woge, dem Durst einer Welt genügend, unerschöpflich, wie das Salz des Meeres und das Licht der Gestirne.
Es liegt mir fern, dem die Persönlichkeiten fressenden Betrieb unserer Industrie und unserer Wissenschaft irgend einen Rat geben zu wollen. Wenn Industrie und Wissenschaft keine Persönlichkeit mehr brauchen, so sollen sie auch keine haben. Wir Künstler aber, die wir inmitten des großen Kulturbankrotts eine Insel mit noch leidlich erträglichen Lebensmöglichkeiten bewohnen, müssen nach wie vor anderen Gesetzen folgen. Für uns ist Persönlichkeit kein Luxus, sondern Existenzbedingung, Lebensluft, unentbehrliches Kapital. Dabei verstehe ich unter Künstlern alle die, denen es Bedürfnis und Notwendigkeit ist, sich selber lebend und wachsend zu fühlen, sich der Grundlage ihrer Kräfte bewußt zu sein und auf ihr nach eingeborenen Gesetzen sich aufzubauen, also keine untergeordnete Tätigkeit und Lebensäußerung zu tun, deren Wesen und Wirkung nicht zum Fundament in demselben klaren und sinnvollen Verhältnis stünde, wie in einem guten Bau das Gewölbe zur Mauer, das Dach zum Pfeiler.
Aber Künstler haben von jeher des zeitweiligen Müßigganges bedurft, teils um neu Erworbenes sich klären und unbewußt Arbeitendes reif werden zu lassen, teils um in absichtsloser Hingabe sich immer wieder dem Natürlichen zu nähern, wieder Kind zu werden, sich wieder als Freund und Bruder der Erde, der Pflanze, des Felsens und der Wolke zu fühlen. Einerlei ob einer Bilder oder Verse dichtet oder nur sich selber bauen, dichten und schaffend genießen will, für jeden sind immer wieder die unvermeidlichen Pausen da. Der Maler steht vor einer frisch grundierten Tafel, fühlt die nötige Sammlung und innere Wucht noch nicht gekommen, fängt an zu probieren, zu zweifeln, zu künsteln und wirft am Ende alles zornig oder traurig hin, fühlt sich unfähig und keiner stolzen Aufgabe gewachsen, verwünscht den Tag, da er Maler wurde, schließt die Werkstatt zu und beneidet jeden Straßenfeger, dem die Tage in bequemer Tätigkeit und Gewissensruhe hingehen. Der Dichter wird vor einem begonnenen Plane stutzig, vermißt das ursprünglich gefühlte Große darin, streicht Worte und Seiten durch, schreibt sie neu, wirft auch die neuen bald ins Feuer, sieht klar Geschautes plötzlich umrißlos in blassen Fernen schwanken, findet seine Leidenschaften und Gefühle plötzlich kleinlich, unecht, zufällig, läuft davon und beneidet gleicherweise den Straßenfeger. Und so weiter.
Manches Künstlerleben besteht zu einem Drittel, zur Hälfte aus solchen Zeiten. Nur ganz seltene Ausnahmemenschen vermögen in stetigem Flusse fast ohne Unterbrechung zu schaffen. So entstehen die scheinbar leeren Mußepausen, deren äußerer Anblick von jeher Verachtung oder Mitleid der Banausen geweckt hat. So wenig der Philister begreifen kann, welche immense, tausendfältige Arbeit eine einzige schöpferische Stunde umschließen kann, so wenig vermag er einzusehen, warum so ein verdrehter Künstler nicht einfach weiter malt, Pinselstriche nebeneinander setzt und seine Bilder in Ruhe vollendet, warum er vielmehr so oft unfähig ist, weiterzumachen, sich hinwirft und grübelt und für Tage oder Wochen die Bude schließt. Und der Künstler selbst wird jedesmal wieder von diesen Pausen überrascht und getäuscht, fällt jedesmal in dieselben Nöte und Selbstpeinigungen, bis er einsehen lernt, daß er den ihm eingeborenen Gesetzen gehorchen muß und daß es tröstlicherweise oft ebenso sehr Überfülle als Ermüdung ist, die ihn lahmlegt. Es ist etwas in ihm tätig, was er am liebsten heute noch in ein sichtbares, schönes Werk verwandelte, aber es will noch nicht, es ist noch nicht reif, es trägt seine einzig mögliche, schönste Lösung noch als Rätsel in sich. Also bleibt nichts übrig als warten.
Für diese Wartezeiten gäbe es ja hundert schöne Zeitvertreiber, vor allem die Weiterbildung im Kennenlernen von Werken bedeutender Vorgänger und Zeitgenossen. Aber wenn du eine ungelöste dramatische Aufgabe wie einen Pfahl im Fleische mit dir herumträgst, ist es zumeist eine mißliche Sache, Shakespeare zu lesen, und wenn das erste Mißlingen eines Bildentwurfes dich plagt und elend macht, wird Tizian dich vermutlich wenig trösten. Namentlich junge Leute, deren Ideal der »denkende Künstler« ist, meinen nun, die der Kunst entzogene Zeit am besten aufs Denken zu verwenden und verrennen sich ohne Ziel und Nutzen in Grübeleien, skeptische Betrachtungen und andere Grillenfängereien.
Andere, welche noch nicht dem auch unter Künstlern neuerdings erfolgreich werdenden heiligen Krieg wider den Alkohol beigetreten sind, finden den Weg zu Orten, wo man einen Guten schenkt. Diese haben meine volle Sympathie, denn der Wein als Ausgleicher, Tröster, Besänftiger und Träumespender ist ein viel vornehmerer und schönerer Gott, als seine vielen Feinde uns neuestens glauben machen möchten. Aber er ist nicht für jedermann. Ihn künstlerisch und weise zu lieben und zu genießen und seine schmeichlerische Sprache in ihrer ganzen Zartheit zu verstehen, dazu muß einer so gut wie zu anderen Künsten von Natur begabt sein, und auch dann noch bedarf er der Schulung und wird, wo er nicht einer guten Tradition folgt, es selten zu einiger Vollkommenheit bringen. Und wäre er auch ein Auserwählter, so wird er doch gerade in den unfruchtbaren Zeiten, von denen wir reden, selten die zum wahren Kult eines Gottes notwendigen Denare in der Tasche haben.
Wie findet sich nun der Künstler zwischen den beiden Gefahren – der unzeitigen, lustlosen Arbeit und der grüblerischen, entmutigenden Leere – mit heiler Haut und heiler Seele hindurch?
Geselligkeit, Sport, Reisen usw. sind alles Zeitvertreiber, die in solchen Lagen nicht dienen, zum Teil auch nur für Wohlhabende in Betracht kommen und zu diesen zu zählen ist nie ein Künstlerehrgeiz gewesen. Auch die Schwesterkünste pflegen einander in bösen Zeiten meist im Stich zu lassen: der Dichter, der an einer ungelösten Aufgabe leidet, wird nur selten beim Maler oder der Maler beim Musiker seine Ruhe und Balance wiederfinden. Denn tief und völlig genießen kann der Künstler nur in den klaren, schöpferischen Zeiten, während jetzt in seinen Nöten alle Kunst ihm entweder schal und blaß oder aber erdrückend übermächtig erscheint. Den zeitweise Entmutigten und Hilflosen kann eine Stunde Beethoven ebenso leicht vollends umwerfen als heilen.
Hier ist der Punkt, an welchem ich eine durch solide Tradition befestigte und geläuterte Kunst des Faulenzens schmerzlich vermisse und wo mein sonst unbefleckt germanisches Gemüt mit Neid und Sehnsucht nach dem mütterlichen Asien hinüber äugt, wo eine uralte Übung es vermocht hat, in den scheinbar formlosen Zustand vegetativen Daseins und Nichtstuns einen gewissen gliedernden und adelnden Rhythmus zu bringen. Ich darf ohne Ruhmrednerei sagen, daß ich an die experimentierende Beschäftigung mit dem Problem dieser Kunst viel Zeit gewendet habe. Meine dabei gewonnenen Erfahrungen müssen einer späteren, besonderen Mitteilung aufbehalten bleiben – es genüge meine Versicherung, daß ich es annähernd gelernt habe, in kritischen Zeiten das Nichtstun mit Methode und großem Vergnügen zu pflegen. Damit jedoch etwaige Künstler unter den Lesern sich nicht, statt nun selber an die Arbeit des methodischen Faulenzens zu gehen, enttäuscht wie von einem Scharlatan abwenden, gebe ich noch in wenigen Sätzen einen Überblick über meine eigene erste Lehrlingszeit im Tempel dieser Kunst.
1. Ich holte eines Tages, von dunkler Ahnung getrieben, die vollständigsten deutschen Ausgaben von Tausendundeiner Nacht und den »Fahrten des Sajid Batthal« von der Bibliothek, setzte mich dahinter – und fand, nach anfänglichem kurzem Vergnügen, etwa nach Tagesfrist beide langweilig.
2. Den Ursachen dieses Mißerfolges nachdenkend, erkannte ich schließlich, daß jene Bücher durchaus nur liegend oder doch am Boden sitzend genossen werden dürfen. Der aufrechte abendländische Stuhl beraubt sie aller Wirkung. Nebenher ging mir dabei zum ersten Male ein Verständnis für die völlig veränderte Anschauung des Raumes und der Dinge auf, die man im Liegen oder Kauern gewinnt.
3. Bald entdeckte ich, daß die Wirkung der orientalischen Atmosphäre sich verdoppelte, wenn ich mir, statt selber zu lesen, vorlesen ließ (wobei es jedoch erforderlich ist, daß auch der Vorleser liege oder kauere).
4. Die nun endlich rationell betriebene Lektüre erzeugte bald ein resigniertes Zuschauergefühl, das mich befähigte, nach kurzer Zeit auch ohne Lektüre stundenlang in Ruhe zu verharren und meine Aufmerksamkeit mit scheinbar geringen Gegenständen zu beschäftigen (Gesetze des Mückenfluges, Rhythmik der Sonnenstäubchen, Melodik der Lichtwellen usw.). Daraus entsprang ein wachsendes Erstaunen über die Vielheit des Geschehens und ein beruhigendes, völliges Vergessen meiner selbst, womit die Basis eines heilsamen, niemals langweilenden far niente gewonnen war. Dies war der Anfang. Andere werden andere Wege wählen, um aus dem bewußten Leben in die für Künstler so notwendigen und schwer zu erreichenden Stunden des Selbstvergessens unterzutauchen. Sollte meine Anregung einen etwa vorhandenen abendländischen Meister des Müßigganges zur Rede und Mitteilung seines Systems verlocken, so wäre mein heißester Wunsch erfüllt.
(1904)
Über das Reisen
Als mir nahegelegt wurde, etwas über die Poesie des Reisens zu schreiben, schien es mir im ersten Augenblicke verlockend, einmal von Herzen über die Scheußlichkeiten des modernen Reisebetriebes zu schimpfen, über die sinnlose Reisewut an sich, über die öden modernen Hotels, über Fremdenstädte wie Interlaken, über Engländer und Berliner, über den verschandelten und maßlos teuer gewordenen badischen Schwarzwald, über das Geschmeiß von Großstädtern, die in den Alpen leben wollen wie zu Hause, über die Tennisplätze von Luzern, über Gastwirte, Kellner, Hotelsitten und Hotelpreise, verfälschte Landweine und Volkstrachten. Aber als ich einmal in der Bahn zwischen Verona und Padua einer deutschen Familie meine diesbezüglichen Ansichten nicht vorenthielt, wurde ich mit kühler Höflichkeit ersucht, zu schweigen; und als ich ein andermal in Luzern einen niederträchtigen Kellner ohrfeigte, wurde ich nicht ersucht, sondern tätlich gezwungen, das Haus mit unschöner Eile zu verlassen. Seither lernte ich mich beherrschen.
Auch fällt mir ein, daß ich doch im Grunde auf allen meinen kleinen Reisen überaus vergnügt und befriedigt war und von jeder irgend einen großen oder kleinen Schatz mitgebracht habe. Wozu also schimpfen?
Über die Frage, wie der moderne Mensch reisen solle, gibt es viele Bücher und Büchlein, aber meines Wissens keine guten. Wenn jemand eine Lustreise unternimmt, sollte er doch eigentlich wissen, was er tut und warum er es tut. Der reisende Städter von heute weiß es nicht. Er reist, weil es Sommers in der Stadt zu heiß wird. Er reist, weil er im Wechsel der Luft, im Anblick anderer Umgebungen und Menschen ein Ausruhen von ermüdender Arbeit zu finden hofft. Er reist in die Berge, weil eine dunkle Sehnsucht nach Natur, nach Erde und Gewächs ihn mit unverstandenem Verlangen quält; er reist nach Rom, weil es zur Bildung gehört. Hauptsächlich aber reist er, weil alle seine Vettern und Nachbarn auch reisen, weil man nachher davon reden und damit großtun kann, weil das Mode ist und weil man sich nachher zu Hause wieder so schön behaglich fühlt.
Das alles sind ja begreifliche und honette Motive. Aber warum reist Herr Krakauer nach Berchtesgaden, Herr Müller nach Graubünden, Frau Schilling nach Sankt Blasien? Herr Krakauer tut es, weil er so viele Bekannte hat, die auch immer nach Berchtesgaden gehen, Herr Müller weiß, daß Graubünden weit von Berlin liegt und in Mode ist, und Frau Schilling hat gehört, in Sankt Blasien sei die Luft so gut. Alle drei könnten ihre Reisepläne und Routen vertauschen, und es wäre ganz dasselbe. Bekannte kann man überall haben, sein Geld kann man überall loswerden, und an Orten mit guter Luft ist Europa unermeßlich reich. Warum also gerade Berchtesgaden? Oder Sankt Blasien? Hier liegt der Fehler. Reisen sollte stets Erleben bedeuten, und etwas Wertvolles erleben kann man nur in Umgebungen, zu welchen man seelische Beziehungen hat. Ein gelegentlicher hübscher Ausflug, ein fideler Abend in irgend einem Wirtsgarten, eine Dampferfahrt auf einem beliebigen See sind an sich keine Erlebnisse, keine Bereicherungen unseres Lebens, keine mit stetiger Kraft fortwirkenden Anregungen. Sie können dazu werden, aber kaum für die Herren Krakauer und Müller.
Vielleicht gibt es für diese Leute überhaupt keinen Ort auf der Erde, zu welchem sie tiefere Beziehungen haben. Es gibt für sie kein Land, keine Küste oder Insel, keinen Berg, keine alte Stadt, von der sie mit Ahnungskraft gezogen werden, deren Anblick ihnen Lieblingsträume erfüllt und deren Kennenlernen ihnen ein Schätzesammeln bedeutet. Trotzdem könnten sie glücklicher und schöner reisen, wenn doch einmal gereist sein muß. Sie müßten vor der Reise, sei es auch nur auf der Landkarte, sich wenigstens flüchtig über das Wesentliche des Landes und Ortes, wohin sie fahren, unterrichten, über das Verhältnis, in welchem seine Lage, seine Bodengestalt, sein Klima und Volk zur Heimat und gewohnten Umgebung des Reisenden steht. Und während des Aufenthaltes am fremden Orte müßten sie versuchen, sich in das Charakteristische der Gegend einzufühlen. Sie müßten Berge, Wasserfälle, Städte nicht nur im Vorbeigehen als Effektstücke anstaunen, sondern jedes an seinem Orte als notwendig und gewachsen und darum als schön erkennen lernen.
Wer hierzu den guten Willen hat, kommt leicht von selber auf die schlichten Geheimnisse der Reisekunst. Er wird nicht in Syrakus Münchener Bier trinken wollen und es, wenn er es je dort bekommt, schal und teuer finden. Er wird nicht in fremde Länder reisen, ohne deren Sprache einigermaßen zu verstehen. Er wird nicht Landschaft, Menschen, Sitten, Küche und Weine der Fremde nach dem Maßstabe seiner Heimat messen und den Venetianer schneidiger, den Neapolitaner stiller, den Berner höflicher, den Chianti süßer, die Riviera kühler, die Lagunenküste steiler wünschen. Er wird versuchen, seine Lebensweise dem Brauch und Charakter des Ortes anzupassen, er wird in Grindelwald früh und in Rom spät aufstehen usw. Und er wird namentlich überall versuchen, sich dem Volke zu nähern und es zu verstehen. Er wird also nicht in internationaler Reisegesellschaft verkehren und nicht in internationalen Hotels wohnen, sondern in Gasthöfen, deren Wirte und Angestellte Einheimische sind, oder noch besser bei Privatleuten, in deren häuslichem Leben er ein Bild des Volkslebens hat.
Man würde es unsäglich lächerlich finden, wenn ein Reisender in Afrika sich mit Gehrock und Zylinder aufs Kamel setzen wollte. Aber man findet es selbstverständlich, in Zermatt oder Wengen Pariser Kostüme zu tragen, in französischen Städten deutsch zu reden, in Göschenen Rheinwein zu trinken und in Orvieto dieselben Speisen zu essen wie in Leipzig. Wenn du diese Art von Reisenden nach dem Berner Oberland fragst, so sprechen sie entrüstet über die hohen Fahrpreise der Jungfraubahn, und wenn du sie auf Sizilien zu sprechen bringst, so erfährst du, daß es dort keine heizbaren Zimmer gebe, daß man aber in Taormina eine vorzügliche französische Küche antreffe. Fragst du nach dem dortigen Volk und Leben, so erzählen sie dir, man trage daselbst unendlich komische Trachten und rede einen völlig unverständlichen Dialekt.
Genug davon. Ich wollte ja von der Schönheit des Reisens reden, nicht von der Unvernunft der meisten Reisenden.
Die Poesie des Reisens liegt nicht im Ausruhen vom heimischen Einerlei, von Arbeit und Ärger, nicht im zufälligen Zusammensein mit anderen Menschen und im Betrachten anderer Bilder. Sie liegt auch nicht in der Befriedigung einer Neugierde. Sie liegt im Erleben, das heißt im Reicherwerden, im organischen Angliedern von Neuerworbenem, im Zunehmen unseres Verständnisses für die Einheit im Vielfältigen, für das große Gewebe der Erde und Menschheit, im Wiederfinden von alten Wahrheiten und Gesetzen unter ganz neuen Verhältnissen.
Dazu kommt das, was ich speziell die Romantik des Reisens nennen möchte: das Mannigfache der Eindrücke, das beständige heitere oder bängliche Warten auf Überraschungen, vor allem aber das Köstliche des Verkehres mit Menschen, die uns neu und fremd sind. Der musternde Blick des Portiers oder Kellners ist in Berlin derselbe wie in Palermo, aber den Blick des rhätischen Hirtenknaben, den du auf einer abseitigen Graubündener Weide überraschtest, vergißt du nicht. Du vergißt auch nicht die kleine Familie in Pistoja, bei der du einmal zwei Wochen gewohnt hast. Vielleicht entfallen dir die Namen, vielleicht erinnerst du dich der kleinen Schicksale und Sorgen jener Menschen nimmer deutlich, aber du wirst nie vergessen, wie du erst den Kindern, dann der blassen kleinen Frau, danach dem Manne oder dem Großvater in einer glücklichen Stunde näher kamst. Denn du hattest mit ihnen nicht über wohlbekannte Dinge zu reden, nicht an Altes und Gemeinsames anzuknüpfen, du warst ihnen so neu und fremd wie sie dir und du mußtest das Konventionelle ablegen, aus dir selbst schöpfen und auf die Wurzeln deines Wesens zurückgehen, um ihnen etwas sagen zu können. Du sprachst mit ihnen vielleicht über Kleinigkeiten, aber du sprachst mit ihnen als Mensch zu Menschen, tastend und fragend, mit dem Wunsche, diese Fremden ein wenig verstehen zu lernen, dir ein Stück ihres Wesens und Lebens zu erobern und mit dir zu nehmen.
Wer in fremden Landschaften und Städten nicht lediglich dem Berühmten, Auffallendsten nachgeht, sondern Verlangen trägt, das Eigentliche, Tiefere zu verstehen und mit Liebe zu erfassen, in dessen Erinnerung werden meistens Zufälligkeiten, Kleinigkeiten einen besonderen Glanz haben. Wenn ich an Florenz denke, sehe ich als erstes Bild nicht den Dom oder den alten Palast der Signorie, sondern den kleinen Goldfischteich im Giardino Boboli, wo ich an meinem ersten Florentiner Nachmittag ein Gespräch mit einigen Frauen und ihren Kindern hatte, zum erstenmal die Florentiner Sprache vernahm und die mir aus so viel Büchern vertraute Stadt zum erstenmal als etwas Wirkliches und Lebendes empfand, mit dem ich reden und das ich mit Händen fassen konnte. Der Dom und der alte Palast und alles Berühmte von Florenz ist mir darum nicht entgangen; ich glaube es besser erlebt und mir herzlicher zu eigen gemacht zu haben, als viele fleißige Baedekertouristen, es wächst mir aus lauter kleinen, nebensächlichen Erlebnissen sicher und einheitlich heraus, und wenn ich ein paar schöne Bilder der Uffizien vergaß, so habe ich dafür die Erinnerung an Abende, die ich mit der Hauswirtin in der Küche, und an Nächte, die ich mit Burschen und Männern in kleinen Weinschenken verplauderte, und an den gesprächigen Vorstadtschneider, der mir unter seiner Haustüre die zerrissenen Hosen auf dem Leibe flickte und mir dazu feurige politische Reden, Opernmelodien und fidele Volksliedchen zum besten gab. Solche Bagatellen werden oft zum Kern wertvoller Erinnerungen. Dadurch, daß ich dort einen Faustkampf mit einem in die Wirtstochter verliebten Burschen bestand, ist mir das hübsche Städtchen Zofingen trotz der Kürze meines Dortseins – es waren zwei Stunden – unvergeßlich. Das reizende Dorf Hammerstein, südlich vom badischen Blauen, stände mir nicht mit allen Dächern und Gassen so klar und schön vor der Erinnerung, wenn ich es nicht einst spät am Abend nach einer langen, schlimmen Irrwanderung im Wald unvermutet erreicht hätte. Ich sah es ganz plötzlich und unvermutet, da ich um einen Bergvorsprung bog, in der Tiefe unter mir liegen, still und schläfernd und Haus an Haus geschmiegt, und dahinter stand der eben aufgehende Mond. Wäre ich auf der bequemen Landstraße hingekommen und durchgewandert, so wüßte ich nichts mehr davon. So war ich nur eine Stunde dort und besitze es als ein schönes, liebes Bild für Lebenszeit. Und mit dem Bilde dieses Dörfleins besitze ich die lebendige Vorstellung einer ganzen, eigenartigen Landschaft.
Wer je in jungen Jahren mit wenig Geld und ohne Gepäck ein gutes Stück gewandert ist, kennt diese Eindrücke wohl. Eine im Kleefeld oder im frischen Heu verbrachte Nacht, ein in entlegener Sennhütte erbetteltes Stück Brot und Käse, ein unvermutetes Eintreffen im Wirtshaus bei einer dörflichen Hochzeit, zu deren Mitfeier man eingeladen wurde, das bleibt fest im Gedächtnis. Allein es soll über dem Zufälligen nicht das Wesentliche, über der Romantik nicht die Poesie vergessen werden. Sich unterwegs treiben lassen und auf den lieben Zufall vertrauen, ist gewiß eine gute Praxis, aber einen festen, bestimmten Inhalt und Sinn muß jede Reise haben, wenn sie erfreulich und im tieferen Sinn ein Erlebnis sein soll. Aus Langeweile und fader Neugierde in Ländern umher zu bummeln, deren inneres Wesen einem fremd und gleichgültig ist und bleibt, ist sündlich und lächerlich. Ebenso wie eine Freundschaft oder Liebe, die man pflegt und der man Opfer bringt, wie ein Buch, das man mit Bedacht auswählt und kauft und liest, ebenso muß jede Vergnügungs- oder Studienreise ein Liebhaben, Lernenwollen, Sichhingeben bedeuten. Sie muß den Zweck haben, ein Land und Volk, eine Stadt oder Landschaft dem Wanderer zum seelischen Besitz zu machen, er muß mit Liebe und Hingabe das Fremde belauschen und sich mit Ausdauer um das Geheimnis seines Wesens bemühen. Der reiche Wursthändler, der aus Protzerei und Bildungsmißverstand nach Paris und Rom fährt, hat nichts davon. Wer aber lange, heiße Jugendjahre lang die Sehnsucht nach den Alpen oder nach dem Meere oder nach den alten Städten Italiens in sich getragen und endlich Reisezeit und Reisegeld sich knapp erspart hat, der wird jeden Meilenstein und jede sonnige, von Kletterrosen überhangene Klostermauer und jeden Schneegipfel und Meeresstrich der Fremde mit Leidenschaft an sich reißen und nicht vom Herzen lassen, ehe er die Sprache dieser Dinge verstand, ehe ihm das Tote lebendig und das Stumme redend geworden ist. Er wird in einem Tage unendlich viel mehr erleben und genießen als ein Modereisender in Jahren, und er wird für Lebenszeit einen Schatz von Freude und Verständnis und beglückender Sättigung mitbringen.
Wer Geld und Zeit nicht zu sparen braucht und Lust am Reisen hat, dem müßte es ein treibendes Bedürfnis sein, die Länder, in welchen er für sein Auge und Herz Begehrenswertes ahnt, Teil für Teil sich zu eigen zu machen und in langsamem Lernen und Genießen sich ein Stück Welt zu erobern, in vielen Ländern Wurzel zu schlagen und aus Ost und West Steine zum schönen Gebäude eines umfassenden Verständnisses der Erde und ihres Lebens zu sammeln.
Ich verkenne nicht, daß die Mehrzahl unserer heutigen Lustreisenden aus ermüdeten Städtern besteht, die kein anderes Verlangen haben, als für eine Weile die erfrischende und tröstende Nähe des Naturlebens zu fühlen. Von »Natur« reden sie gern und haben eine gewisse halb ängstliche, halb gönnerhafte Liebe zu ihr. Aber wo suchen sie sie und wieviele finden sie?
Es ist ein sehr verbreiteter Irrtum, zu meinen, man brauche nur an einen schönen Ort zu reisen, um der »Natur« nahe zu sein und ihre Kräfte und Tröstungen zu kosten. Es ist ja klar, daß dem seinen heißen Straßen entlaufenen Großstädter die Kühle und Reinheit der Luft am Meer oder in den Bergen wohl tun muß. Damit begnügt er sich. Er fühlt sich frischer, atmet tiefer, schläft besser und kehrt dankbar heim im Glauben, er habe die »Natur« nun so recht genossen und in sich gesogen. Er weiß nicht, daß er nur das Flüchtigste, Unwesentlichste davon aufgenommen und verstanden hat, daß er das Beste unentdeckt am Wege liegen ließ. Er versteht nicht zu sehen, zu suchen, zu reisen.
Der Glaube, es sei viel einfacher und leichter, ein Stück Schweiz oder Tirol oder Nordsee oder Schwarzwald in sich aufzunehmen als etwa eine gediegene Vorstellung von Florenz oder Siena zu erwerben, ist grundfalsch. Die Leute, welchen von Florenz nichts als der Turm des palazzo vecchio und die Domkuppel in der Erinnerung haften blieb, werden auch von Schliersee nur den Umriß des Wendelstein und von Luzern nichts als ein Bild des Pilatus und einen Dunst von Seebläue mitnehmen und nach wenig Wochen an echtem Seelenbesitz so arm sein wie zuvor. Die Natur wirft sich einem so wenig vor die Füße wie Kultur und Kunst und fordert gerade vom ungeschulten Stadtmenschen unendliche Hingabe, ehe sie sich entschleiert und ihm zu eigen gibt.
Es ist schön, mit der Bahn oder im Postwagen über den Gotthard, Brenner oder Simplon zu reisen und es ist schön, die Riviera entlang von Genua bis Livorno oder im Lagunenschiff von Venedig nach Chioggia zu fahren. Aber ein sicherer Besitz bleibt von solchen Eindrücken selten zurück. Nur hervorragend feine und durchgebildete Menschen sind fähig, das Charakteristische einer größeren Landschaft im flüchtigen Vorüberstreifen zu erfassen und festzuhalten. Den meisten bleibt nur ein allgemeiner Eindruck von Meerluft, Wasserblau und Uferumrissen, und auch der ist bald verwischt wie die Erinnerung an ein Theaterbild. Fast allen Teilnehmern an den beliebten Gesellschaftsreisen durchs Mittelmeer geht es so.
Man muß nicht alles sehen und kennen wollen. Wer zwei Berge und Täler der Schweizer Alpen gründlich durchstreift hat, kennt die Schweiz besser als wer mit einer Rundkarte in derselben Zeit das ganze Land bereiste. Ich war wohl fünfmal in Luzern und Vitznau und hatte den Vierwaldstätter See noch immer nicht innig begriffen und erfaßt, bis ich nicht sieben Tage einsam im Ruderboot auf ihm zubrachte, jede Bucht befuhr und jede Perspektive ausprobte. Seither gehört er mir, seither kann ich in jeder beliebigen Stunde, ohne Bilder und Karten jeden seiner kleinsten Teile mir untrüglich vorstellen und von neuem lieben und genießen: Form und Vegetation der Ufer, Gestalt und Höhe der Berge, jedes einzelne Dorf mit Kirchturm und Schifflände, die Farben und Spiegelungen des Wassers zu jeder Tagesstunde. Auf Grund dieser sinnlich deutlichen Vorstellung erst ward es mir dann möglich, auch die dortigen Menschen zu verstehen, Gehaben und Mundarten der Uferdörfer, typische Gesichter und Familiennamen, Charakter und Geschichte der einzelnen Städtchen und Kantone zu unterscheiden und zu verstehen.
Und die venezianische Lagune wäre mir, trotz meiner eifrigen Liebe für Venedig, noch heute eine fremde, sonderbare, unbegriffene Kuriosität, wenn ich nicht einst, des blöden Hinstarrens müde, für acht Tage und Nächte das Boot und Brot und Bett eines Fischers von Torcello geteilt hätte. Ich ruderte an den Inseln entlang, watete mit dem Handnetz durch die braunen Schlammbänke, lernte Wasser, Gewächs und Getier der Lagune kennen, atmete und beobachtete ihre eigentümliche Luft, und seither ist sie mir vertraut und befreundet. Jene acht Tage hätte ich vielleicht für Tizian und Veronese verwenden können, aber ich habe in jenem Fischerboot mit dem goldbraunen Dreiecksegel Tizian und Veronese besser verstehen gelernt als in der Akademie und im Dogenpalast. Und nicht nur die paar Bilder, sondern das ganze Venedig ist mir nun kein schönes banges Rätsel mehr, sondern eine viel schönere, mir zugehörende Wirklichkeit, an die ich das Recht des Verstehenden habe.
Vom trägen Anschauen eines goldenen Sommerabends und vom lässig wohligen Einatmen einer leichten, reinen Bergluft bis zum innigen Verständnis für Natur und Landschaft ist noch ein weiter Weg. Es ist herrlich, auf einer sonnenwarmen Wiese hingestreckt, träge Ruhestunden zu verliegen. Aber den vollen, hundertmal tieferen und edleren Genuß davon hat nur der, dem diese Wiese samt Berg und Bach, Erlengebüsch und fernragender Gipfelkette ein vertrautes, wohlbekanntes Stück Erde ist. Aus einem solchen Stücklein Boden seine Gesetze zu lesen, die Notwendigkeit seiner Gestaltung und Vegetation zu durchschauen, sie im Zusammenhang mit der Geschichte, dem Temperament, der Bauart und Sprechweise und Tracht des dort heimischen Volkes zu fühlen, das fordert Liebe, Hingabe, Übung. Aber solche Mühen lohnen sich. In einem Lande, das du dir mit Eifer und Liebe vertraut und zu eigen gemacht hast, gibt dir jede Wiese und jeder Fels, an dem du rastest, alle seine Geheimnisse her und nährt dich mit Kräften, die er anderen nicht gönnt.
Ihr sagt, es könne doch nicht jedermann den Fleck Erde, auf dem er eine Woche lebt, als Geolog, Historiker, Dialektforscher, Botaniker und Ökonom studieren. Natürlich nicht. Es liegt am Fühlen, nicht am Namenwissen. Wissenschaft hat noch niemand selig gemacht. Wer aber das Bedürfnis kennt, keine leeren Schritte zu tun, sich beständig im Ganzen lebend und im Weben der Welt einbegriffen zu fühlen, dem gehen überall schnell die Augen auf für das Charakteristische, Echte, Bodenständige. Er wird überall in Erde, Bäumen, Bergformen, Tieren und Menschen eines Landes das Gemeinsame herausfühlen und sich an dieses halten, statt Zufälligkeiten nachzulaufen. Er wird finden, daß dieses Gemeinsame, Typische sich noch in den kleinsten Blumen, in den zartesten Luftfärbungen, in den leichtesten Nuancen der Mundart, der Bauformen, der Volkstänze und Lieder äußert, und je nach seiner Veranlagung wird ihm ein volkstümliches Witzwort oder ein Laubgeruch oder ein Kirchturm oder ein kleines rares Blümlein zur Formel werden, welche für ihn das ganze Wesen einer Landschaft knapp und sicher umschließt. Und solche Formeln vergißt man nicht.
Hiemit genug. Nur das möchte ich noch sagen, daß ich an ein spezielles »Talent zum Reisen«, von dem man oft reden hört, nicht glaube. Die Menschen, denen auf Reisen Fremdes schnell und freundlich vertraut wird und die ein Auge fürs Echte und Wertvolle haben, das sind dieselben, welche im Leben überhaupt einen Sinn erkannt haben und ihrem Stern zu folgen wissen. Ein starkes Heimweh nach den Quellen des Lebens, ein Verlangen, sich mit allem Lebendigen, Schaffenden, Wachsenden befreundet und eins zu fühlen, ist ihr Schlüssel zu den Geheimnissen der Welt, welchen sie nicht nur auf Reisen in ferne Länder, sondern ebenso im Rhythmus des täglichen Lebens und Erlebens begierig und beglückt nachgehen.
(1904)
Der Hausierer
Der krumme alte Hausierer, ohne den ich mir die Falkengasse und unser Städtchen und meine Knabenzeit nicht denken kann, war ein rätselhafter Mensch, über dessen Alter und Vergangenheit nur dunkle Vermutungen im Umlauf waren. Auch sein bürgerlicher Name war ihm seit Jahrzehnten abhanden gekommen, und schon unsre Väter hatten ihn nie anders als mit dem mythischen Namen Hotte Hotte Putzpulver gerufen.
Obwohl das Haus meines Vaters groß, schön und herrschaftlich war, lag es doch nur zehn Schritt von einem finsteren Winkel entfernt, in welchem einige der elendesten Armutgassen zusammenliefen. Wenn der Typhus ausbrach, so war es gewiß dort; wenn mitten in der Nacht sich betrunkenes Schreien und Fluchen erhob und die Stadtpolizei zwei Mann hoch langsam und ängstlich sich einfand, so war es dort; und wenn einmal ein Totschlag oder sonst etwas Grausiges geschah, so war es auch dort. Namentlich die Falkengasse, die engste und dunkelste von allen, übte stets einen besonderen Zauber auf mich aus und zog mich mit gewaltigem Reize an, obwohl sie von oben bis unten von lauter Feinden bewohnt war. Es waren sogar die gefürchtetsten von ihnen, die dort hausten. Man muß wissen, daß in Gerbersau seit Menschengedenken zwischen Lateinern und Volksschülern Zwiespalt und blutiger Hader bestand, und ich war natürlich Lateiner. Ich habe in jener finsteren Gasse manchen Steinwurf und manchen bösen Hieb auf Kopf und Rücken bekommen und auch manchen ausgeteilt, der mir Ehre machte. Namentlich dem Schuhmächerle und den beiden langen Metzgerbuben zeigte ich öfters die Zähne, und das waren Gegner von Ruf und Bedeutung.
Also in dieser schlimmen Gasse verkehrte der alte Hotte Hotte, sooft er mit seinem kleinen Blechkarren nach Gerbersau kam, was sehr häufig geschah. Er war ein leidlich robuster Zwerg mit zu langen und etwas verbogenen Gliedern und dummschlauen Augen, schäbig und mit einem Anstrich von ironischer Biederkeit gekleidet; vom ewigen Karrenschieben war sein Rücken krumm und sein Gang trottend und schwer geworden. Man wußte nie, ob er einen Bart habe oder keinen, denn er sah immer aus, als wenn er sich vor einer Woche rasiert hätte. In jener üblen Gasse bewegte er sich so sicher, als wäre er dort geboren, und vielleicht war er das auch, obwohl er uns immer für einen Fremden galt. Er trat in all diese hohen finstern Häuser mit den niedrigen Türen, er tauchte da und dort an hochgelegenen Fenstern auf, er verschwand in die feuchten, schwarzen, winkligen Flure, er rief und plauderte und fluchte zu allen Erdgeschoß- und Kellerfenstern hinein. Er gab allen diesen alten, faulen, schmutzigen Männern die Hand, er schäkerte mit den derben, ungekämmten, verwahrlosten Weibern und kannte die vielen strohblonden, frechen, lärmigen Kinder mit Namen. Er stieg auf und ab, ging aus und ein und hatte in seinen Kleidern, Bewegungen und Redensarten ganz den starken Lokalduft der lichtlosen Winkelwelt, die mich mit wohligem Grausen anzog und die mir trotz der nahen Nachbarschaft doch seltsam fremd und unerforschlich blieb.
Wir Kameraden aber standen am Ende der Gasse, warteten, bis der Hausierer zum Vorschein kam und schrien ihm dann jedesmal das alte Schlachtgeheul in allen Tonarten nach: Hotte Hotte Putzpulver! Meistens ging er ruhig weiter, grinste auch wohl verachtungsvoll herüber; zuweilen aber blieb er wie lauernd stehen, drehte den schwerfälligen Kopf mit bösartigem Blick herüber und senkte langsam mit verhaltenem Zorn die Hand in seine tiefe Rocktasche, was eine seltsam tückische und drohende Gebärde ergab.
Dieser Blick und dieser Griff der breiten braunen Hand war schuld daran, daß ich mehreremal von Hotte Hotte träumte. Und die Träume wieder waren schuld daran, daß ich viel an den alten Hausierer denken mußte, Furcht vor ihm hatte und zu ihm in ein seltsames, verschwiegenes Verhältnis kam, von welchem er freilich nichts wußte. Jene Träume hatten nämlich immer irgend etwas aufregend Grausiges und beklemmten mich wie Alpdrücken. Bald sah ich den Hotte Hotte in seine tiefe Tasche greifen und lange scharfe Messer daraus hervorziehen, während mich ein Bann am Platze festhielt und mein Haar sich vor Todesangst sträubte. Bald sah ich ihn mit scheußlichem Grinsen alle meine Kameraden in seinen Blechkarren schieben und wartete gelähmt vor Entsetzen, bis er auch mich ergreifen würde.
Wenn der Alte nun wiederkam, fiel mir das alles beängstigend und aufregend wieder ein. Trotzdem stand ich aber mit den anderen an der Gassenecke und schrie ihm seine Übernamen nach und lachte, wenn er in die Tasche griff und sein unrasiertes, farbloses Gesicht verzerrte. Dabei hatte ich heimlich ein heillos schlechtes Gewissen und wäre, solange er um den Weg war, um keinen Preis allein durch die Falkengasse gegangen, auch nicht am hellen Mittag.
Vom Besuch in einem befreundeten gastlichen Landpfarrhause zurückkehrend, wanderte ich einmal durch den tiefen schönen Tannenforst und machte lange Schritte, denn es war schon Abend, und ich hatte noch gute anderthalb Stunden Weges vor mir. Die Straße begann schon stark zu dämmern und der ohnehin dunkle Wald rückte immer dichter und feindseliger zusammen, während oben an hohen Tannenstämmen noch schräge Strahlen roten Abendlichtes glühten. Ich schaute oft hinauf, einmal aus Freude an dem weichen, schönfarbigen Lichte und dann auch aus Trostbedürfnis, denn die rasche Dämmerung im stillen tiefen Walde legte sich bedrückend auf mein elfjähriges Herz. Ich war gewiß nicht feig, wenigstens hätte mir das niemand ungestraft sagen dürfen. Aber hier war kein Feind, keine sichtbare Gefahr, – nur das Dunkelwerden und das seltsam bläuliche, verworrene Schattengewimmel im Waldinnern. Und gar nicht weit von hier, gegen Ernstmühl talabwärts, war einmal einer totgeschlagen worden.
Die Vögel gingen zu Nest; es wurde still, still, und kein Mensch war auf der Straße unterwegs außer mir. Ich ging möglichst leise, Gott weiß warum, und erschrak, so oft mein Fuß wider eine Wurzel stieß und ein Geräusch machte. Darüber wurde mein Gang immer langsamer statt schneller, und meine Gedanken gingen allmählich ganz ins Fabelhafte hinüber. Ich dachte an den Rübezahl, an die »Drei Männlein im Walde«, und an den, der drüben am Ernstmühler Fußweg umgekommen war.
Da erhob sich ein schwaches, schnurrendes Geräusch. Ich blieb stehen und horchte – es machte wieder rrrr – das mußte hinter mir auf der Straße sein. Zu sehen aber war nichts, denn es war unterdessen fast völlig dunkel geworden. Es ist ein Wagen, dachte ich, und beschloß, ihn abzuwarten. Er würde mich schon mitnehmen. Ich besann mich, wessen Gäule wohl um diese Zeit hier fahren könnten. Aber nein, von Rossen hörte man nichts, es mußte ein Handwagen sein, nach dem Geräusch zu schließen, und er kam auch so langsam näher. Freilich, ein Handkarren! Und ich wartete. Vermutlich war es ein Milchkarren, vielleicht vom Lützinger Hof. Aber jedenfalls mußte er nach Gerbersau fahren, vorher lag keine Ortschaft mehr am Wege. Und ich wartete.
Und nun sah ich den Karren, einen kleinen hochgebauten Kasten auf zwei Rädern, und einen Mann gebückt dahinter gehen. Warum bückte sich wohl der so schrecklich tief? Der Wagen mußte schwer sein.
Da war er endlich. »Guten Abend«, rief ich ihn an. Eine klebrige Stimme hüstelte den Gruß zurück. Der Mann schob sein Wägelchen zwei, drei Schritt weiter und stand neben mir.
Gott helfe mir – der Hotte Hotte Putzpulver! Er sah mich einen Augenblick an, fragte: »Nach Gerbersau?« und ging weiter, ich nebenher. Und so eine halbe Stunde lang – wir zwei nebeneinander durch die stille Finsternis. Er sprach kein Wörtlein. Aber er lachte alle paar Minuten in sich hinein, leise, innig und schadenfroh. Und jedesmal ging das böse, halb irre Lachen mir durch Mark und Bein. Ich wollte sprechen, wollte schneller gehen. Es gelang mir nicht. Endlich brachte ich mühsam ein paar Worte heraus.
»Was ist in dem Karren da drin?« fragte ich stockend. Ich sagte es sehr höflich und schüchtern – zu demselben Hotte Hotte, dem ich hundertmal auf der Straße nachgehöhnt hatte. Der Hausierer blieb stehen, lachte wieder, rieb sich die Hände, grinste mich an und fuhr langsam mit der breiten Rechten in die Rocktasche. Es war die hämisch häßliche Geste, die ich so oft gesehen hatte, und deren Bedeutung ich aus meinen Träumen kannte – der Griff nach den langen Messern!
Wie ein Verzweifelter rannte ich davon, daß der finstere Wald widerhallte, und hörte nicht auf zu rennen, bis ich verängstigt und atemlos an meines Vaters Haus die Glocke zog.
Das war der Hotte Hotte Putzpulver. Seither bin ich aus dem Knaben ein Mann geworden, unser Städtlein ist gleichfalls gewachsen, ohne dabei schöner geworden zu sein, und sogar in der Falkengasse hat sich einiges verändert. Aber der alte Hausierer kommt noch immer, schaut in die Kellerfenster, tritt in die feuchten Flure, schäkert mit den verwahrlosten Weibern und kennt alle die vielen ungewaschenen, strohblonden Kinder mit Namen. Er sieht etwas älter aus als damals, doch wenig verändert, und es ist mir seltsam zu denken, daß vielleicht noch meine eigenen Kinder einmal ihn an der Falkenecke erwarten und ihm seinen alten Übernamen nachrufen werden.
(1904)
Eine Rarität
Vor einigen Jahrzehnten schrieb ein junger deutscher Dichter sein erstes Büchlein. Es war ein süßes, leises, unüberlegtes Gestammel von blassen Liebesreimen, ohne Form und auch ohne viel Sinn. Wer es las, der fühlte nur ein schüchternes Strömen zärtlicher Frühlingslüfte und sah schemenhaft hinter knospenden Gebüschen ein junges Mädchen lustwandeln. Sie war blond, zart und weiß gekleidet, und sie lustwandelte gegen Abend im lichten Frühlingswalde, – mehr bekam man nicht über sie zu hören.
Dem Dichter schien dieses genug zu sein, und er begann, da er nicht ohne Mittel war, unerschrocken den alten, tragikomischen Kampf um die Öffentlichkeit. Sechs berühmte und mehrere kleinere Verleger, einer nach dem andern, sandten dem schmerzlich wartenden Jüngling sein sauber geschriebenes Manuskript höflich ablehnend zurück. Ihre sehr kurz gefaßten Briefe sind uns erhalten und weichen im Stil nicht wesentlich von den bei ähnlichen Anlässen den heutigen Verlegern geläufigen Antworten ab; jedoch sind sie sämtlich von Hand geschrieben und ersichtlich nicht einem im voraus hergestellten Vorrat entnommen.
Durch diese Ablehnungen gereizt und ermüdet, ließ der Dichter seine Verse nun auf eigene Kosten in vierhundert Exemplaren drucken. Das kleine Buch umfaßt neununddreißig Seiten in französischem Duodez und wurde in ein starkes, rotbraunes, auf der Rückseite rauheres Papier geheftet. Dreißig Exemplare schenkte der Autor an seine Freunde. Zweihundert Exemplare gab er einem Buchhändler zum Vertrieb, und diese zweihundert Exemplare gingen bald darauf bei einem großen Magazinbrande zugrunde. Den Rest der Auflage, hundertsiebzig Exemplare, behielt der Dichter bei sich, und man weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Das Werkchen war totgeboren, und der Dichter verzichtete, vermutlich vorwiegend aus Erwägungen ökonomischer Art, einstweilen völlig auf weitere poetische Versuche.
Etwa sieben Jahre später aber kam er zufällig einmal dahinter, wie man zügige Lustspiele macht. Er legte sich eifrig darauf, hatte Glück und lieferte von da an jährlich seine Komödie, prompt und zuverlässig wie ein guter Fabrikant. Die Theater waren voll, die Schaufenster zeigten Buchausgaben der Stücke, Bühnenaufnahmen und Porträts des Verfassers. Dieser war nun berühmt, verzichtete aber auf eine Neuausgabe seiner Jugendgedichte, vermutlich weil er sich ihrer nun schämte. Er starb in der Blüte der Mannesjahre, und als nach seinem Tode eine kurze, seinem literarischen Nachlaß entnommene Autobiographie herauskam, wurde sie begierig gelesen. Aus dieser Autobiographie aber erfuhr die Welt nun erst von dem Dasein jener verschollenen Jugendpublikation.
Seither sind jene zahlreichen Lustspiele aus der Mode gekommen und werden nicht mehr gegeben. Die Buchausgaben findet man massenhaft und zu jedem Preise, meist als Konvolute, in den Antiquariaten. Jenes kleine Erstlingsbändchen aber, von welchem vielleicht – ja sogar wahrscheinlich – nur noch die dreißig seinerzeit vom Autor verschenkten Exemplare vorhanden sind, ist jetzt eine Seltenheit ersten Ranges, die von Sammlern hoch bezahlt und unermüdlich gesucht wird. Es figuriert täglich in den Desideratenlisten; nur viermal tauchte es im Antiquariatshandel auf und entfachte jedesmal unter den Liebhabern eine hitzige Depeschenschlacht. Denn einmal trägt es doch einen berühmten Namen, ist ein Erstlingsbuch und überdies Privatdruck, dann aber ist es für feinere Liebhaber auch interessant und rührend, von einem so berühmten eiskalten Bühnenroutinier ein Bändchen sentimentaler Jugendlyrik zu besitzen.
Kurz, man sucht das kleine Ding mit Leidenschaft, und ein tadelloses, unbeschnittenes Exemplar davon gilt für unbezahlbar, namentlich seit auch einige amerikanische Sammler danach fahnden. Dadurch wurden auch die Gelehrten aufmerksam, und es existieren schon zwei Dissertationen über das rare Büchlein, von welchen die eine es von der sprachlichen, die andere von der psychologischen Seite beleuchtet. Ein Faksimiledruck in fünfundsechzig Exemplaren, der nicht neu aufgelegt werden darf, ist längst vergriffen, und in den Zeitschriften der Bibliophilen sind schon Dutzende von Aufsätzen und Notizen darüber erschienen. Man streitet namentlich über den mutmaßlichen Verbleib jener dem Brand entgangenen hundertsiebzig Exemplare. Hat der Autor sie vernichtet, verloren oder verkauft? Man weiß es nicht; seine Erben leben im Auslande und zeigen keinerlei Interesse für die Sache. Die Sammler bieten gegenwärtig für ein Exemplar weit mehr als für die so seltene Erstausgabe des »grünen Heinrich«. Wenn zufällig irgendwo einmal die fraglichen hundertsiebzig Exemplare auftauchen und nicht sofort von einem Sammler en bloc vernichtet werden, dann ist das berühmte Büchlein wertlos und wird höchstens noch zuweilen neben andern lächerlichen Anekdoten in der Geschichte der Bücherliebhaberei flüchtig und mit Ironie erwähnt werden.
(1905)
Septembermorgen am Bodensee
Die Nebelmorgen haben nun wieder begonnen, schon mit Anfang September. In den ersten Tagen waren sie beengend, düster und traurig machend, solange man noch das leuchtende Blau und Rotbraun der Hochsommermorgen frisch im Gedächtnis hatte. Sie schienen kalt, stumpf, freudlos, vorzeitig herbstlich, und erweckten jene ersten, halb unbehaglichen, halb sehnsüchtigen Gedanken an Stubenwärme, Lampenlicht, dämmerige Ofenbank, Bratäpfel und Spinnrad, die jedes Jahr allzu früh kommen und die ersten Herbstschauer sind, ehe die fröhlichen und farbigen Wochen der Obst- und Weinlese sie wieder vertreiben und in ein nachdenkliches, erwärmendes Ernte- und Ruhegefühl verwandeln.
Nun ist man schon wieder an die Seenebel gewöhnt und nimmt es für selbstverständlich hin, daß man vor Mittag die Sonne nicht zu sehen bekommt. Und wer Augen dafür hat, genießt diese grauen Vormittage dankbar und aufmerksam mit ihrem feinen, verschleierten Lichterspiel, mit ihren an Metall und Glas erinnernden Seefarben und ihren unberechenbaren perspektivischen Täuschungen, die oft wie Wunder und Märchen und fabelhafte Träume wirken. Der See hat kein jenseitiges Ufer mehr, er verschwimmt in meerweite, unwirkliche Silberfernen. Und auch diesseitig sieht man Umrisse und Farben nur auf ganz kleine Entfernungen, weiter hinaus ist alles in Wolke, Schleier, Duft und feuchtes Licht grau aufgelöst. Die ernsten, einzelstehenden, überaus charaktervollen Pappelwipfel schwimmen matt als fahle Schatteninseln in der nebeligen Luft, Boote gleiten in unwahrscheinlichen Höhen geisterhaft über den dampfenden Wassern hin, und aus unsichtbaren Dörfern und Gehöften dringen gedämpfte Laute – Glockengeläute, Hahnenrufe, Hundegebell – durch die feuchte Kühle, wie aus unerreichbar fernen Gegenden herüber.
Heute früh, da ein leichter Nordostwind ging, steckte ich das hohe, schmale Dreiecksegel auf meinen kleinen Nachen, stopfte mir eine Pfeife und trieb langsam seeabwärts durch den Nebel. Die Sonne mußte schon überm Berg sein, denn das frühmorgendliche Bleigrau des Wasserspiegels verwandelte sich langsam in klares Silber, beinahe so wie bei schwachem Mondlicht. Von den sonst so freundlich nahen, laubigen oder schilfbestandenen Ufern war nichts zu sehen, und da ich keinen Kompaß besitze, segelte ich wie durch völlig fremde, uferlose Gewässer und Wolkenmeere dahin und konnte nicht einmal über die Geschwindigkeit meiner Fahrt irgend welche Schätzung aufstellen. Doch untersuchte ich nach einer Weile die Tiefe und da ich keinen Boden fand, warf ich eine Schwemmschnur mit Hechtlöffel auf 20 Meter Tiefe aus und zog sie gemächlich hinter mir her.
So trieb ich vielleicht eine Stunde lang weiter, im Steuersitz zusammengekauert, immer im weißen Nebel. Es war kühl. Die linke Hand, in der ich die Segelleine führte, war mir steif und gefühllos geworden, und ich ärgerte mich, daß ich keine Handschuhe mitgenommen hatte. Dann begann ich träumerische Halbgedanken zu spinnen. Ich dachte an einen merkwürdigen Verwandtenmord, der zur Zeit des Konstanzer Konzils im Schlosse meines Dörfchens Gaienhofen geschehen war und mich durch manche Umstände interessierte, und dachte an jene ganze, seltsame, erregte Zeit, in der unser stilles Seeufer ein Mittelpunkt der Welt und Kultur und die Bühne für große geschichtliche Einzelschicksale gewesen ist. Es unterhielt und befriedigte mich, die hinter Nebeln verborgenen, wohlbekannten Ufer mit den Bildern jener lang verschwundenen Menschen, ihrer Geschicke und Leidenschaften zu bevölkern. Einer Erbschaft wegen bringt ein Baron seinen Bruder um, Beziehungen zu fernen Ländern spielen ahnungsvoll herein, und von dem mit vornehmen Konzilgästen, Pomp und Luxus überfüllten Konstanz her glänzt verlockend der Reiz einer üppig reichen Kultur ...
Ein sich überstürzender, schrill schnurrender Laut schreckte mich auf, während noch meine Phantasie bemüht war, sich die Kostüme und Waffen jener süddeutschen Barone und welschen Gäste zu Beginn des 15. Jahrhunderts vorzustellen. Hastig kehrten meine Sinne zum gegenwärtigen Augenblick zurück; in der Erregung des Jagdglücks faßte ich nach dem Haspel, zog vorsichtig an und fühlte einen kräftigen Fisch am Haken, der sich mit verzweifelter Leidenschaft zur Wehr setzte. Langsam ziehend, förderte ich einen schönen Hecht an die Oberfläche und brachte ihn im Hamen ein. Darauf setzte ich die Schnur mit Eifer von neuem aus, während der gefangene Fisch im Kasten wütend schlug und plätscherte. Dabei mußte ich das Steuer loslassen und ein plötzlicher Windstoß schlug mir, da das Boot sich gedreht hatte, die Segelstange und das flatternde Segel kräftig um die Ohren. Der Richtung ungewiß, ließ ich dem Wind das volle Segel und trieb mit zunehmender Schnelligkeit gerade aus, bis der schattenhafte Umriß einer mit alten Nußbäumen bestandenen Landzunge sichtbar wurde. Von den undeutlich auftauchenden, grau verschleierten Rebhügeln krachten da und dort die Flintenschüsse der Weinbergwächter. Ich zog mein Segel ein und ruderte langsam uferwärts, denn die allmählich wärmer werdende Luft roch stark nach nahem Regen. So suchte ich denn die nächste Schifflände, fand sie auch nach kurzer Fahrt, und während ich mein Boot ans Land zog und mich nach dem Namen des kleinen thurgauischen Dorfes erkundigte, begann es erst dünn und gleichsam widerwillig, dann immer kräftiger und ausgiebiger zu regnen.
Auch wenn nicht allen Anzeichen nach zum Nachmittag helles Wetter zu erwarten gewesen wäre, hätten mich der Regenguß und die kurze Verbannung in ein unbekanntes Dorfwirtshaus durchaus nicht betrübt. Ohnehin gebe ich auf sogenanntes »schönes Wetter« gar nichts, denn jedes Wetter ist schön, wenn man Augen und Seele aufmacht; und dann gehört es für mich zu den bevorzugten kleinen Wanderfreuden, unerwartet vom Wetter in Winkel und zu Menschen getrieben zu werden, die ich sonst wohl nie aufgesucht und gesehen hätte. Es ist immer eigen und sehr oft köstlich, für Augenblicke oder Stunden als ungemeldeter Gast in einer fremden Stube bei Unbekannten zu sitzen, ein Stück kleines Leben zu sehen und eine Weile in Gesichter zu blicken, die man nie zuvor sah, die einem oft in wenigen Augenblicken vertraut und unvergeßlich werden und die man vielleicht nie wieder sieht.
Es war kühl in der halbdunklen Schankstube, draußen stürzte der Regen immer heftiger herab und troff in Bächen an den Fensterscheiben nieder. Der Wein, natürlich der unvermeidliche sogenannte Tiroler, war verzweifelt herb und machte mich frösteln. Am großen tannenen Tisch saß ein einziger Gast, ein struppiger alter Fischer mit verdrießlichem Trinkergesicht, und hatte eine Quinte Schnaps vor sich stehen.
Das alles war nicht sehr beglückend. Ich fing schließlich an, die gestrige Steckborner Zeitung zu lesen – Beratungen des Ausschusses über Vergrößerung der Badeanstalt, Fischmarktbericht, ein Scheunenbrand, Stand der Reben, bevorstehende Erhöhung der Zuckerpreise usw. Und es regnete immer lauter mit einer zähen und erbitterten Leidenschaftlichkeit, in oft wechselndem Takte, der etwas ebenso Aufregendes und Trostloses hatte. Ich war nahe daran, meine von zu Hause mitgebrachte und durch den Hechtfang noch erhöhte schöne Morgenfreudigkeit zu verlieren. Da hörte ich, während ich mir die Pfeife frisch stopfte, daß der Wirt den verdrießlichen Alten als Jaköbeli anredete, und beim Klange des Namens fielen mir allerlei Geschichten ein. Vom Jaköbeli hatte ich viel reden hören. Er war ein thurgauischer Fischer, den man weit herum im Volke kannte, ein Sonderling und Trinker, mit einem Stich ins Verrückte und einer merkwürdig glücklichen Hand beim Fischen. Er wisse alle Wetterregeln und Kalendersachen unfehlbar auswendig, hatte ich sagen hören, und vielleicht auch noch manche Künste, die nicht jeder verstehe. Je länger ich nun den Alten betrachtete, desto fester war ich überzeugt, er müsse der Jaköbeli sein. Also warf ich ihm ein paar Bemerkungen übers Wetter hin, über diesen ungewöhnlich heißen Sommer, die frühen Septembernebel und die Aussichten für den heurigen Wein.
Jaköbeli ließ mich eine Weile reden, äugte ernsthaft zu mir herüber und räusperte sich ein paarmal. Dann machte er plötzlich, indem er sein Gläschen beiseite schob, eine großmütige, abwinkende und Gehör erbittende Gebärde wie ein alter Prophet und begann zu reden.
»Dieser Sommer«, sagte er, »jawohl mein Herr, ist ein besonderer Sommer gewesen, und ich sage gar nichts, aber man wird schon sehen, was alsdann kommen wird, mein Herr. Viel Nuß und Haselnuß, das gibt einen strengen Winter, und viel Bucheln und Eicheln, das gibt große Kälte. Es heißt auch:
Ist St. Dominik trocken und heiß,
So wird der Winter lange weiß.
So ist’s wirklich und wahrhaftig. Aber das will ja noch wenig sagen. Das nächste Jahr dagegen, wenn man daran denkt, was ich sage, das wird ein Hungerjahr, ein heißes Jahr. Frucht und Obst wird verbrennen und dörren, desgleichen Gras und Kartoffel, aber viel Kirschen.«
»Warum denn?« fragte ich. Er winkte verächtlich ab. »Wie ich sage, mein geehrter Herr. Das nächste Jahr wird ein Sonnenjahr heißen, und die Sonne führt ein gutes Regiment, aber zu trocken und heiß. Auch der Winter wird alsdann noch strenger werden. Wie es vor dreihundert Jahren geschehen ist, daß der Rhein Grundeis gehabt hat und Kinder erfroren in der Wiege.«
Es folgten noch mehrere Wetterreime, die ich leider vergessen habe. Darauf ein zarter Versuch, mich zum Zahlen eines weiteren Schnapses zu veranlassen: ich überhörte ihn freundlich. Nun klagte er über Nebel und Kühle, schlechten Fischfang und Gliederreißen, nochmals auf die Zuträglichkeit eines wärmenden Schnapses hinweisend, den er sich auch bestellte, und den ich schließlich, seinem flehenden Blick gehorchend, zu bezahlen versprach. Auf das hin wurde er fröhlich, rückte mitteilsam nahe zu mir her und begann fidele Geschichten zu erzählen, meistens von ungeheuerlichen Trinkereien oder fabelhaften Fischzügen. Die beste war folgende: Einmal hatte er in Horn am Zeller See Fische verkauft und das ganze Geld dafür sofort vertrunken. Als er wieder abfahren wollte, war er so bezecht, daß ihn die Strandzöllner nicht ins Boot steigen lassen wollten, denn er war der Ruder nimmer mächtig und der See war unruhig und hatte Schaum. Er fuhr aber trotzdem ab, versuchte eine Strecke zu rudern, sank dann ermüdet ins Boot und schlief ein. Und als er wieder erwachte, trieb sein Nachen gerade an die Schifflände von Steckborn, die er hatte erreichen wollen. Aber noch besser! Zufällig war, was er im Rausche nicht beachtet hatte, seine Schwemmschnur noch ins Wasser gehängt, und wie er sie nun einholen will, muß er aus Leibeskräften ziehen, denn es hängt ein vierzehnpfündiger Hecht daran. Natürlich verkaufte er den Fisch sogleich und konnte sich noch zu Nacht einen zweiten Rausch leisten.
Ich gab dem Jaköbeli zu verstehen, diese Sorte von Geschichten sei nicht die schönste und er sei doch eigentlich zu alt für solche Streiche. Da streckt er wieder mit großartiger Bewegung die Hand gegen mich aus, streicht sich den Bart und beginnt wieder Hochdeutsch zu reden. (Die Geschichten hatte er im Dialekt erzählt.)
»Zum Fischen, mein guter Herr, gehört einfach Glück, nichts als Glück. Da kann einer dreimal mit Segeln fahren, silberne Hechtlöffel kaufen und solches Zeug, das hilft alles nichts. Es kann einer den größten Heidenrausch haben und fängt doch mehr. Nämlich, der eine hat Glück und der andere hat keins. Es ist nur, daß man in einem guten Stern- und Himmelszeichen geboren ist, verstehen Sie?«
Ich verstand. Aber als er mich nun herausfordernd überlegen anblickte, und nochmals einen Schnaps bezahlt haben wollte, fand er mich unerbittlich. Eine gute Weile schwieg er feindselig und spuckte häufig auf den Boden, dann aber begann er, zum Wirt gewendet, anzügliche Reden zu führen. »Du hast ja neuerdings scheint’s großen Fremdenverkehr – hm – fremde Herrschaften, ja – hm. Früher ist man da drinnen noch unter sich gewesen – jawohl, sag’ ich, unter sich gewesen. Könntest ja auch noch Hotelier werden, du, wenn’s so weitergeht. Weißt, für so fremde Herren, so feine. Jawohl, Hotelier, da wird noch Geld verdient. –«