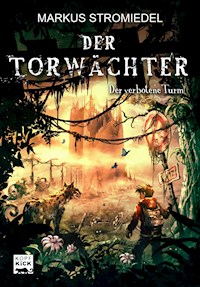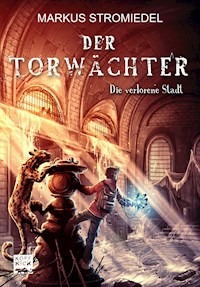6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der junge Militärpolizist Vincent Höfler wird im Winter des Jahres 2035 wird von seinen Vorgesetzten auf eine mysteriöse Mission in den deutschen Osten geschickt. Auf einem streng bewachten ehemaligen Flughafen ist die Leiche eines erfrorenen alten Mannes gefunden worden. Es scheint, als hätte der Alte ganz in der Nähe in einem luxuriösen Wellness-Resort für Senioren, einem gigantischen Kuppelbau, gelebt. Aber wie kam er von dort auf das hoch gesicherte Militärgelände? Bei seinen Nachforschungen stößt Vincent auf dubiose Machenschaften der europäischen Regierung. Schon bald merkt er, dass es lebensgefährlich ist, zu viel zu wissen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Markus Stromiedel
Die Kuppel
Thriller
Knaur e-books
Über dieses Buch
Im Winter des Jahres 2035 wird der junge Militärpolizist Vincent Höfler von seinen Vorgesetzten auf eine mysteriöse Mission in den deutschen Osten geschickt. Auf einem streng bewachten ehemaligen Flughafen ist die Leiche eines erfrorenen alten Mannes gefunden worden. Es scheint, als hätte der Alte ganz in der Nähe in einem luxuriösen Wellness-Resort für Senioren, einem gigantischen Kuppelbau, gelebt. Aber wie kam er von dort auf das hoch gesicherte Militärgelände? Bei seinen Nachforschungen stößt Vincent auf dubiose Machenschaften der europäischen Regierung. Schon bald merkt er, dass es lebensgefährlich ist, zu viel zu wissen …
Inhaltsübersicht
»Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes.«
Salvador Dalí
Prolog
War das der Tod?
Um ihn herum war nichts. Absolute Stille, absolute Dunkelheit. Er stand nicht, lag nicht, kein Reiz erreichte die Sinneszellen seiner Haut. Nur die Angst, die ihn erfüllte und die sein Herz klopfen ließ, zeigte ihm, dass es ihn noch gab.
Wo war er?
Der Alte spürte Panik in sich aufsteigen. Er zwang sich zur Ruhe, konzentrierte sich, ballte seine Hände zur Faust. Erleichtert fühlte er, wie die Kuppen seiner Finger die Handflächen berührten.
Ein leises Geräusch ließ ihn aufmerken, ein Trippeln, das sich näherte, bis es direkt über ihm stoppte. Der Alte hob den Kopf. Im gleichen Augenblick explodierte ein Lichtblitz auf seiner Netzhaut, und er verlor das Bewusstsein.
Als er wieder zu sich kam, spürte er etwas: Kälte. Einem Raubtier gleich umstrich sie ihn lauernd, ein klirrender Schmerz, der behutsam in sein Bewusstsein drang und plötzlich zupackte. Erschrocken schnappte er nach Luft. Schnee knirschte unter seinen Fußsohlen. Er stolperte verblüfft und blieb stehen.
Es war dunkel, doch anders als zuvor stand ein Mond am Himmel, blass und wolkenverhangen. Sein Licht erhellte eine öde Schneelandschaft. Erstaunt sah der Alte sich um. Wie kam er hierher? Er stand im Schatten einer großen, mit riesigen Stahltoren verschlossenen Halle, daneben duckten sich flache, von Büschen zugewucherte Gebäude in den Schnee. Kein Mensch war zu sehen.
»Hallo! Ist hier jemand?«
Seine Stimme verhallte ungehört.
Zitternd stolperte der Alte durch die Nacht. Sein Kopf schmerzte, er war benommen. Als der eisige Ostwind ihn erfasste, begriff er, dass er nackt war.
Was war geschehen?
Ein Licht leuchtete in der Dunkelheit, ein heller Schein hinter schneebedeckten Bäumen. Es war eine Kuppel, oszillierend und warm. Im gleichen Augenblick erinnerte sich der Alte, und er begann zu laufen, dem Licht entgegen.
Plötzlich hörte er leises Hundegebell. Er drehte sich um und sah zurück: Die Lichtkegel von Taschenlampen tanzten durch die Dunkelheit, sie kamen rasch näher. Der Alte spürte Angst in sich aufsteigen. Eilig rannte er weiter, der Kuppel entgegen.
Er bemerkte den Zaun nicht, der seinen Fluchtweg querte. Schmerzhaft prallte er auf das kalte Metall, taumelte zurück, stürzte zu Boden. Das Hundegebell wurde lauter. Hastig rappelte der Alte sich auf und blickte die Einfriedung entlang. Nirgendwo war eine Öffnung zu sehen. Sein Körper zitterte, als er über den Zaun zu klettern begann, Stück für Stück zog er sich hinauf. Zu spät sah er, dass eine mit messerscharfen Klingen bestückte Drahtrolle den oberen Rand des Zaunes begrenzte. Es war unmöglich, ihn unverletzt zu überwinden.
Ein Schatten hetzte über die Schneefläche, Momente später war der Hund unter ihm. Knurrend und zähnefletschend schnappte er nach seinen Füßen. Der Alte zog die Beine an, ängstlich darauf bedacht, die Krone des Zaunes nicht zu berühren. Die Lichtkegel der Taschenlampen näherten sich, und er erkannte zwei uniformierte Männer, die über die Wiese liefen.
»Da ist er!«
Das Licht einer der Taschenlampen erfasste ihn.
»Los, hol ihn da runter!«
Ein Schuss ertönte, gedämpft, kaum mehr als ein leises Ploppen. Im gleichen Moment fühlte der Alte einen Stich in seinem Rücken. Eine Welle aus Hitze überflutete ihn, und er spürte, wie er die Kontrolle über seinen Körper verlor. Seine Muskeln erschlafften, seine Finger glitten aus dem Drahtgeflecht. Hilflos stürzte er zu Boden. Sofort war der Hund über ihm, der Alte spürte den feuchten Atem des Tiers in seinem Nacken.
»Zurück! Hierher!«
Er hörte, wie der Hund sich entfernte. Dann knirschte der Schnee, Schritte näherten sich, ein Stiefelpaar stellte sich in sein Blickfeld.
»Wer ist das?«
»Keine Ahnung.«
Der Alte wollte aufstehen, etwas sagen, doch seine Muskeln verweigerten ihm ihren Dienst. Er fühlte, wie ihm der Speichel aus dem Mund floss.
»Sollen wir ihn wieder reinbringen?« Das war die Stimme des Ersten.
»Nein. Die Scanner haben ihn längst erfasst.«
»Und jetzt?«
»Wir lassen ihn hier.«
Der Alte wollte protestieren, er wollte schreien, vergeblich, sein Körper reagierte nicht.
Eine Stiefelspitze schob sich unter seinen Rumpf, er spürte, wie er umgedreht wurde, bis er auf dem Rücken lag.
»Schaff ihn raus!«
»Was soll ich tun?« Die Stimme des Ersten klang erstaunt.
»Frag nicht so blöd! Und zieh ihm was an!«
Das Stiefelpaar verschwand aus dem Blickfeld des Alten, Schritte entfernten sich. Für eine Weile hörte er noch das Hecheln des Hundes, dann ertönte ein kurzer Pfiff, und das Hecheln wurde leiser.
Hilflos lag er im Schnee, die Gliedmaßen verrenkt, das Gesicht dem Zaun zugewandt. Unfähig, sich zu bewegen, starrte der Alte die Kuppel an, zu der er hatte fliehen wollen. Sie war nahe, er brauchte nur aufzustehen, den Zaun zu überqueren und hinüberzugehen.
Er spürte, wie die Kälte in seinen Körper kroch.
Dann verlosch das Licht.
Um ihn herum war nur noch Nacht.
1
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, wann meine Geschichte beginnt. Vor vier Wochen, als ich zu einer Besprechung ins Hauptquartier gebeten wurde? Im letzten Sommer, als das First Resort eröffnet wurde? Vor sechzig Monaten bei einer Krisensitzung im Büro des Europäischen Präsidenten? Oder vor siebzig Jahren, als Millionen von Europäern nichts Besseres zu tun hatten, als miteinander ins Bett zu steigen und einen Haufen Kinder zu zeugen, voller Hoffnung auf eine großartige Zukunft, während die beiden Supermächte ihre Atomraketen gegeneinander in Stellung brachten?
Bis vor kurzem war ich ahnungslos gewesen, so wie es die meisten immer noch sind. Nicht der schlechteste Zustand. Manchmal frage ich mich, was geschehen wäre, wenn ich den Auftrag abgelehnt hätte.
An jenem Tag, an dem der Alte erfroren im Schnee gefunden wurde, am Zaun einer gottverlassenen Kaserne im Osten Deutschlands, war ich in der Wüste des Libanon unterwegs. Ich saß hinter dem Steuer eines Geländewagens, ein sandbraunes gepanzertes Ungetüm, gekennzeichnet mit dem Emblem der Europäischen Streitkräfte, denen ich seit knapp zwei Jahren angehöre.
Um das gleich klarzustellen: Es war nie mein Wunsch, Soldat zu sein, und schon gar nicht ist es eine Berufung. Okay, die Ausgehuniform sieht cool aus, und die erste Zeit hat es mir Spaß gemacht, in den Clubs Frauen abzuschleppen, die auf so etwas stehen. Aber je länger ich in der Kaserne festhing und in fensterlosen Räumen für den Cyberwar ausgebildet wurde, desto mehr bereute ich meine Unterschrift auf dem Meldeformular.
Ich hatte mich freiwillig gemeldet: zum einen, weil es meinen Vater ärgerte, und zum anderen, weil ich mir einen Studienplatz an der Uni der Streitkräfte erhoffte. Mein Abitur, das ist jetzt bald neun Jahre her, war bestenfalls mäßig gewesen, nirgendwo hatte es gereicht, um zugelassen zu werden: Die Ausbildungsplätze an den staatlichen Universitäten sind rar, und dort, wo sie nicht rar sind, an den privaten Hochschulen, sind sie teuer. Unbezahlbar für mich. Mit jedem Jahr, das ich auf einen Studienplatz wartete, sank meine Zuversicht, und so schien mir die Werbung, die an einem besonders frustrierenden Tag in meiner W-NET-Community aufpoppte und mir eine strahlende Karriere in der europäischen Armee versprach, meine Rettung zu sein.
Besser, ich hätte auf meinen Vater gehört.
Man sicherte mir, als ich mich für den Dienst in der Truppe meldete, einen Platz an der Universität der Streitkräfte in Brüssel zu.
Erst sehr viel später habe ich begriffen, dass an der Uni der europäischen Armee weder Philosophie noch Geschichte gelehrt wird. Man bot mir stattdessen nach meiner Grundausbildung einen Studienplatz im Fach Militärrobotik an, danach, als ich ablehnte, einen Platz im Studiengang Strategische Mathematik. Ich zog es vor, die Strategie meiner Schulzeit anzuwenden und das Angebot auszuschlagen, um fortan auf Sparflamme meinen Dienst zu schieben und zu sehen, wie ich schadlos die Zeit, für die ich mich verpflichtet hatte, überstehen konnte.
Anna sagt, während ich diese Zeilen schreibe, ich solle mich nicht mit selbstbezogenen Betrachtungen aufhalten, sondern die Geschichte erzählen, die wir erlebt haben.
Sie hat recht, ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt.
2
An jenem Tag vor vier Wochen also saß ich hinter dem Steuer eines Geländewagens und war auf dem Weg nach Beirut. Gleißend stand die Sonne über der staubtrockenen Landschaft, und die Luft flirrte vor Hitze. Der Weg, der sich vor mir durch das mit Felsbrocken übersäte Tal schlängelte, war menschenleer, nichts regte sich in der Glut, die sich über das Land gelegt hatte. Selbst die Zikaden waren verstummt.
Ich wischte mir den Schweiß aus dem Nacken und sah auf die Uhr: Vor vier Stunden war ich in Jezzine gestartet, einem Kaff inmitten der umkämpften Gebiete. Mein Ziel war die Hauptstadt des Libanon. Innerhalb von fünf Stunden, so lautete meine Aufgabe, musste das auf dem Beifahrersitz liegende Päckchen im Hauptquartier der Internationalen Schutztruppen abgegeben werden.
Ich regelte die Klimaanlage höher und lenkte den Geländewagen einen Hügel hinauf. Die Reifen des gepanzerten Fahrzeuges krallten sich in den sandigen Untergrund. Staub wirbelte auf. Ein ausgebranntes Autowrack lag quer auf der Straße, ein Stück weiter verblichen die Trümmer eines Snappers, dessen Raupenketten von einer Sprengfalle zerfetzt worden waren. Der Körper des sandgrauen Kampfroboters war ausgeweidet. Vorsichtig umfuhr ich die Hindernisse und folgte weiter dem gewundenen Fahrweg, bis ich die Kuppe der Anhöhe erreicht hatte. Mit einem leisen Jaulen erstarb der Motor.
Langsam legte sich die Staubwolke, die der Wagen aufgewirbelt hatte. Ich wartete, bis die Sicht wieder klar war, dann stieg ich aus und sah mich um. Die Hügelkette, die ich überquert hatte, war die letzte vor der Küste, von hier aus waren es nur noch wenige Kilometer bis zum Mittelmeer. Schmutzig blau lag das Wasser unter der Sonne. Im Norden der Küstenlinie flimmerten die Hochhaustürme Beiruts im Wüstenwind, davor war der Sperrgürtel zu sehen, der die Stadt vom Rest des Landes abgrenzte. Noch eine knappe halbe Stunde Fahrt und ich würde am Ziel sein.
Plötzlich, ich wollte gerade wieder einsteigen, ließ mich eine Bewegung stutzen. Ein alter, weißhaariger Mann kam den Weg herauf, er hatte offenbar mit seinem Esel im Schatten einer verdorrten Zeder Rast gehalten. Jetzt winkte er mir zu, während er mir entgegenhumpelte, den Esel samt Karren hinter sich. Rumpelnd holperte das primitive Gefährt über den steinigen Weg. Das schneeweiße lange Gewand des Alten bauschte sich im Wind.
Misstrauisch sah ich ihn näher kommen. Der Alte wirkte harmlos, fast vertraut, doch ich wusste, ich durfte mich nicht von meinem ersten Eindruck leiten lassen. Ich holte meine Waffe, die ich auf den Beifahrersitz gelegt hatte, und entsicherte sie. Dann setzte ich den Helm auf, der mich als Mitglied der Internationalen Schutztruppe identifizierte.
»Stop! Don’t move! Show me your ID card!«
Der Alte schien mich nicht zu verstehen. Er rief etwas, kam gestikulierend auf mich zu. Ich legte meine Waffe an und wiederholte meine Aufforderung. Er stutzte kurz, dann hob er seine Hände und zeigte seine leeren Handflächen. Langsam ging er weiter, während er das Tuch löste, das er um den Kopf gewunden hatte.
Ich schob den Sicherungshebel zurück. Die Einsatzregeln verlangten, den Alten noch einmal anzurufen, dann würde ich, sollte er erneut nicht reagieren, gezielt schießen müssen.
Das Tuch um den Kopf des Alten glitt herab und blieb auf seinen Schultern liegen. Ich zuckte zurück, starrte verblüfft den Alten an. Das konnte nicht sein! Der Mann, begriff ich, ähnelte meinem Vater. Nein, korrigierte ich mich in derselben Sekunde, es war mein Vater! Aber das konnte unmöglich sein! Mein Vater war nicht hier, er war kein Libanese, sprach kein Arabisch und zog schon gar nicht mit einem Eselskarren durch eine verdammte Wüste im Nahen Osten.
Überfordert von der Situation, ließ ich die Waffe sinken. Der Alte kam lächelnd näher. Freundlich streckte er eine Hand aus.
Zu spät sah ich, wie die Plane auf dem Eselskarren hinter ihm beiseitegeschlagen wurde. Ein Mann richtete sich auf, hob eine Panzerfaust auf seine Schulter, richtete sie auf mich. Dann betätigte er den Abzug.
Erschrocken taumelte ich zurück. Ich versuchte noch, meine Waffe hochzureißen und zu schießen, doch es war zu spät: Zischend löste sich der Gefechtskopf aus der Panzerfaust und schoss, einen Feuerschweif hinter sich herziehend, auf mich zu. Ich warf mich zur Seite, wollte mich im Inneren des Geländewagens in Sicherheit bringen, doch es war zu spät: Das Projektil jagte heran, traf mich, und im gleichen Moment spürte ich, wie die Explosion meinen Körper zerriss.
Entsetzt schrie ich auf. Voller Panik zog ich mir das Datenband vom Kopf. Im selben Augenblick verschwamm das Bild der libanesischen Wüste vor meinen Augen, und eine nüchterne Halle tauchte wie aus dem Nichts um mich herum auf. Zitternd stürzte ich zu Boden. Ich würgte, während ich nach Luft rang. Schritte eilten heran, ein Notfallkoffer wurde neben mir auf den Boden gestellt. Jemand nahm mir die Brille ab, dann spürte ich, wie eine Atemmaske auf mein Gesicht gepresst wurde. Eine Injektionsnadel durchstieß den Stoff meiner Uniform und bohrte sich in meine Haut. Momente später fühlte ich, wie sich mein Herzschlag beruhigte.
»Geht’s wieder?«
Die Ärztin, die sich über mich gebeugt hatte, sah mich mitleidig an.
Ich nickte und schob die Atemmaske zur Seite.
Die Ärztin reichte mir ihre Hand und half mir hoch. »Keine Sorge«, raunte sie mir zu, »das geht den meisten so. Diese Simulation schafft kaum einer.« Sie lächelte aufmunternd, dann klappte sie ihren Koffer zusammen und verließ die Halle.
Benommen sah ich ihr nach, hob dann, ohne einen Blick zu der verspiegelten Glasfläche in der Seitenwand der Halle zu werfen, das Datenband vom Boden auf und legte es auf die Ladestation.
Sie hatten meinen Vater in die Simulation eingespielt!
Ich wusste, was mich erwarten würde, als ich heute hierhergekommen war. Schon häufiger hatte man mich während meines Lehrganges in das Trainingszentrum der Streitkräfte am Rande Brüssels abkommandiert. Hier, in dieser schlichten unauffälligen Halle, erschuf ein Hochleistungsrechner komplexe Szenarien, um die Elite der Armee auf ihren Einsatz in den Kriegsgebieten vorzubereiten. Dass ich nicht zu dieser Elite gehören wollte, hatte ich hinlänglich bewiesen. Dass sie mich dennoch – oder gerade deshalb – in eine solche Simulation schicken würden, damit hatte ich nicht gerechnet. Meine Zuneigung zu meinem Arbeitgeber sank auf den absoluten Nullpunkt.
Eine Tür öffnete sich in der verspiegelten Glasfläche, die die Steuerungszentrale von der Halle trennte, und der Ausbildungsoffizier betrat den Raum. Er musterte mich kühl.
»Sie wollen zur Polizeieinheit der Europäischen Streitkräfte aufrücken? Ihre Ausbildung an der Akademie ist zu teuer, als dass Sie sich im Ernstfall einen solchen Fehler erlauben können.«
Ich verkniff mir die Antwort, dass ich, sollte ich den Lehrgang wie von mir geplant abschließen, als Unteroffizier der Militärpolizei niemals die Wüste des Libanon zu Gesicht bekommen würde, geschweige denn die Kampfgebiete am Horn von Afrika. Meine Testergebnisse reichten allenfalls für einen Einsatz in Europa aus, für niedere Dienste wie Verkehrsüberwachung oder Objektschutz von Militäreinrichtungen. Ich hatte mich genau erkundigt. Diesmal wollte ich keinen Fehler machen – Krieg führen, das sollten die anderen.
Der Ausbildungsoffizier griff in die Tasche seiner Uniform und holte eine Fernbedienung hervor. Auf der verspiegelten Glasfläche kristallisierte sich ein Bild. Ich erkannte es sofort, es war der Stadtrand von Jezzine, jener Ort, an dem ich vor vier Stunden meine Reise begonnen hatte. Ich sah mich selbst vor dem Geländewagen, gerade reichte mir ein Soldat ein kleines Päckchen.
Der Ausbildungsoffizier startete die Wiedergabe. »Gehen wir Ihren Einsatz noch einmal Schritt für Schritt durch …«
Ein Räuspern unterbrach ihn, dann ertönte eine tiefe, sonore Stimme. »Ich denke, das hat Zeit.« Der Kommandant der Ausbildungseinheit hatte die Halle betreten. Ich nahm Haltung an, und auch der Ausbildungsoffizier, der herumgefahren war, streckte den Rücken durch und legte die rechte Hand an seine Stirn. Der Kommandant wandte sich an mich. »Melden Sie sich unverzüglich im Hauptquartier! Sie werden dort erwartet.«
3
Draußen war es warm, als ich das Trainingszentrum der Akademie der Streitkräfte verließ. Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik hatte die arktische Kälte, die Brüssel in den vergangenen Wochen umklammert hatte, gen Norden gedrängt und Platz gemacht für das milde Winterklima, das gewöhnlich in der Hauptstadt herrschte. Der Südwestwind trug feinen Sand aus den Wüstengebieten Spaniens heran, ein fieser Staub, der durch die Luft trieb und in jede Ritze kroch, die sich ihm darbot.
Ich schlug den Kragen meiner Uniformjacke hoch und ging zum Tor des Kasernengeländes. Der angekündigte Wagen, der mich in das Stadtzentrum bringen sollte, wartete neben dem Torhaus, der Fahrer lehnte lässig in der geöffneten Tür. Die Gläser seiner verspiegelten Sonnenbrille blinkten mir entgegen.
Ich hätte misstrauisch sein müssen. War es schon seltsam genug, dass man mich im Hauptquartier sehen wollte, so war es absolut ungewöhnlich, dass der Kommandant der Ausbildungseinheit persönlich eine solche Information überbringt. Doch erst später am Abend, als ich Brüssel bereits verließ, begann ich darüber nachzudenken, warum für einen angehenden Unteroffizier der Militärpolizei ein solcher Aufwand betrieben wurde.
Der Fahrer nahm Haltung an und öffnete, als ich den Wagen erreicht hatte, die hintere Tür der Limousine. Ich sank in die Polster. Kurz darauf verließen wir das Industrieareal, in dem sich die Ausbildungskaserne befand, und fuhren entlang des Willebroek-Kanals Richtung Süden ins Stadtzentrum. Brüssel lag da wie im Nebel, mühsam kämpfte sich die Sonne durch den Dunst aus Wüstensand, der in den Straßen hing. Die bunten Fassaden der Häuser, die in den letzten Jahren auf den Brachflächen ehemaliger Industrie- und Hafenanlagen entstanden waren und wie an Perlenschnüren aufgereiht den Kanal säumten, waren von einer feinen Sandschicht überzogen, genau wie das Eis, das sich in den vergangenen Wochen auf dem Wasser gebildet hatte. Der Sand machte es für Schlittschuhläufer unbrauchbar, einige wenige stolperten verdrossen über die mit schlammigen Pfützen bedeckte Fläche.
Knapp zwanzig Minuten später hatten wir unser Ziel erreicht. Der Hauptsitz des Europäischen Streitkräfte ist in einem historisierenden Prachtbau aus der Zeit Leopolds II. untergebracht, im Herzen von Brüssel direkt neben dem Ministerium für Verteidigung. Ich war zum ersten Mal hier, bislang kannte ich nur die Kasernen am nördlichen Stadtrand und die nüchternen Zweckbauten in der Rue de Loi, in denen seit der Gründung der europäischen Armee die Verwaltung der Streitkräfte ihre Büros hat. Das imposante Hauptquartier im historischen Stadtzentrum dient vor allem Repräsentationszwecken, um die Bedeutung der noch relativ jungen Truppe zu unterstreichen.
»Herr Höfler, bitte hierher!« Der Sicherheitsbeamte in der stucküberladenen Eingangshalle des Gebäudes winkte mich zu sich. Für einen Augenblick war ich überrascht, dass man mich mit meinem Namen ansprach, dann sah ich mein Foto und persönliche Angaben auf dem Bildschirm neben der Kontrollschleuse: In Sekundenschnelle hatte mich die Optik des Sicherheitssystems erfasst und abgetastet und meine biometrischen Merkmale mit den im Zentralspeicher abgelegten Daten verglichen.
Ich bestätigte meine Identität mit der ID-App meines Perso-Taggers und trat in die Kontrollschleuse. Surrend umkreiste der Röntgenkopf des Scanners meinen Körper. Danach schnallte ich meinen Tagger ab und nahm im Austausch die Kennkarte entgegen, die der Sicherheitsbeamte mit meinen Daten personalisiert hatte.
»Der Weg zu Ihrem Gesprächspartner wird Ihnen angezeigt«, sagte er und wies auf die Bildschirmfolie, die in die Karte eingelassen war. Ein grüner sich drehender Pfeil war auf dem Monitorfeld erschienen, richtete sich aus und wies nun auf die Glaswand, die die Eingangshalle in der gesamten Breite teilte und in der sich lautlos ein Durchgang geöffnet hatte.
Ich dankte dem Beamten und folgte dem Pfeil in das Gebäude.
Der Generalleutnant erwartete mich in seinem Arbeitszimmer, einem dunkel getäfelten Raum im ersten Stockwerk. Matt blinzelte die Wintersonne durch die vom Sand trüben Fenster. Das Parkett knarrte leise, als ich in die Mitte des Raumes ging, stehen blieb und salutierte.
Der Generalleutnant musterte mich aus stahlblauen Augen, und für einen Moment hatte sein schlanker, fast magerer Körper etwas Lauerndes. Ich stand regungslos, den Blick auf einen Punkt rechts oberhalb seines akkuraten Scheitels gerichtet. Er forderte mich auf: »Rühren!« Dann wies er auf einen Stuhl, ein mit Schnitzereien verziertes Ungetüm, das mittig vor den Schreibtisch gerückt worden war. Ich setzte mich.
Der Adjutant, der mich im Vorzimmer in Empfang genommen und misstrauisch beäugt hatte, zog sich zurück und schloss leise die Tür.
Mit einer routinierten Bewegung klappte der Generalleutnant den in die Arbeitsfläche seines Schreibtisches eingelassenen Bildschirm hoch und rief eine Akte auf. Eine Weile las er konzentriert, dann betrachtete er mich über den Rand des Monitors. »Sie sind in Deutschland geboren.« Es war keine Frage, sondern eine Feststellung.
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, also schwieg ich.
»Aufgewachsen in der Nähe von Aachen«, fuhr er fort, während er weiter in meiner Dienstakte las. »Dann, nach Scheidung der Eltern, mit sechs Jahren Umzug nach London. Sie sind bei Ihrer Mutter aufgewachsen.«
Ich räusperte mich. »Jawohl, das ist richtig.«
Der Generalleutnant lehnte sich zurück und betrachtete mich interessiert. »Was wissen Sie über Ihre alte Heimat?«
Ich war erstaunt angesichts der Frage. »Das, was ich in der Schule gelernt habe.«
»Sie waren nach der Scheidung Ihrer Eltern nicht wieder dort?« Der Generalleutnant schien verblüfft.
»Doch, immer in den Sommerferien, bis ich fünfzehn war. Ansonsten ist mein Vater nach London gekommen.«
»Sie sprechen Deutsch?«
Ich nickte.
»Gut. Wir möchten Sie nämlich nach Deutschland schicken.« Der Generalleutnant klappte den Bildschirm zurück in den Schreibtisch.
Verblüfft starrte ich ihn an. »Ich werde versetzt?«
»Wir wollen Sie nicht versetzen, wir haben einen Auftrag für Sie. Als Militärpolizist.« Er stand auf und ging im Raum umher, während er mir erklärte, worum es ging. Vor einer abgelegenen Kaserne im Osten Deutschlands war ein Toter gefunden worden, ein alter Mann, er war erfroren. Offenbar war er bei dem Versuch, auf das Kasernengelände zu gelangen, vom Zaun abgestürzt und bei Eiseskälte bewusstlos geworden. »Das Gelände ist militärischer Bereich«, fuhr der Generalleutnant fort. »Wir möchten, dass Sie als Vertreter der Militärpolizei die Ermittlungen des örtlichen Kriminalbeamten begleiten.«
Ich schwieg überrascht. Mir gefiel der Gedanke, der Enge der Ausbildungskaserne zu entkommen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was ich bei einer solchen Ermittlung tun sollte. »Mein Lehrgang endet erst in sechs Wochen«, wandte ich ein.
»Sie werden freigestellt. Betrachten Sie den Auftrag als Abschluss Ihrer Schulung.«
Ich war verblüfft von dem Angebot. Dennoch zögerte ich. »Darf ich offen sein?«
Der Generalleutnant bedeutete mir weiterzusprechen.
»Warum haben Sie gerade mich für diesen Auftrag ausgewählt?«
Der Generalleutnant lächelte. »Wenn auch Sie mir Offenheit erlauben … Wir können es uns im Moment nicht erlauben, für eine solche relativ unwichtige Angelegenheit einen erfahrenen Ermittler einzusetzen. Der Krieg am Horn von Afrika bedarf unserer vollsten Aufmerksamkeit, dafür brauchen wir jeden guten Mann.«
Für einen Moment war ich verärgert: Hatte er mir tatsächlich gerade zu verstehen gegeben, dass er mich für unwichtig genug hielt, um den Fall zu übernehmen? Ich rief mich zur Ordnung: Hatte ich mich nicht selbst als mittelmäßig inszeniert? Jetzt darüber beleidigt zu sein wäre nur lächerlich.
Der Generalleutnant, der mich schweigend gemustert hatte, setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. »Ich denke, Sie nehmen den Auftrag an. Nach erfolgreicher Mission werden Sie direkt in die Militärpolizei aufgenommen.«
Ich nickte stumm. Ich wusste, es war keine wirkliche Alternative, die Bitte abzulehnen, außer ich hatte vor, für den Rest meiner Dienstzeit Toiletten zu putzen.
Der Generalleutnant nahm einen Memorychip aus einer Schublade und schob ihn mir zu. »Das hier ist die Akte, darin finden Sie alle wichtigen Informationen. Melden Sie sich bis morgen Mittag beim Kommandanten der Kaserne in Laage. Er erwartet Sie.«
Wortlos stand ich auf, nahm den Chip, dann salutierte ich und verließ nach einer zackigen Drehung das Büro.
Als ich kurze Zeit später den Ausgang des Gebäudes erreicht hatte und noch einmal zurückblickte, bemerkte ich, dass der Generalleutnant am Fenster stand, neben ihm ein zweiter Mann, in Zivil, mit weißem Haar und exakt gestutztem Backenbart. Schweigend sahen die beiden mir nach.
4
Die grauhaarige Dürre lag immer noch auf dem Boden im Flur, als ich meine Wohnung betrat. Sie hob ihren Kopf, als sie mich sah, und begann prompt zu jammern. »Bitte helfen Sie mir! Mein Bein tut so weh!«
Ich beachtete sie nicht und ging zur Garderobe, um meine Jacke aufzuhängen.
Die Grauhaarige kroch auf mich zu. »Mein Bein … es tut so weh! Bitte helfen Sie mir!«
Ich schüttelte ihre Hand ab, die nach meinem Fußknöchel getastet hatte, und stieg über ihren mageren Körper, um zur Küche zu gelangen.
»Eddy!« Ungehalten öffnete ich die Küchentür und sah suchend in den Raum, dann ging ich hinüber zum Wohnzimmer. »Eddy, wo steckst du?«
Das Rauschen der Toilettenspülung ertönte, kurz darauf öffnete sich eine Tür, und mein Mitbewohner kam aus dem Bad. Er grinste.
Ärgerlich wies ich auf die alte Frau auf dem Flurboden. »Sie liegt ja immer noch hier.«
»Stört sie dich?« Spöttisch blickte Eddy zu der Grauhaarigen, die uns mit schmerzverzerrtem Gesicht ansah.
Sein Grinsen machte mich nur noch wütender. »Du wolltest sie doch wegschaffen! Ich kann ihr Gejammer nicht mehr hören.«
»Jetzt stell dich nicht so an!«
»Warum hilft mir denn keiner?«, wimmerte die Alte.
»Wir hatten eine ganz klare Absprache«, erinnerte ich Eddy, ohne die Grauhaarige zu beachten. »Was du in deinem Zimmer machst, ist deine Sache. Aber die Küche und der Flur sind tabu.«
Eddy verzog beleidigt das Gesicht. »Was ist dir denn über die Leber gelaufen?« Er griff in seine Hosentasche und holte eine Fernbedienung hervor. Momente später erschlaffte der Körper der Alten, und ihr Jammern erstarb. Eddy kniete neben ihr nieder, öffnete ihre Bluse und schaltete den Prozessor aus, der im Inneren ihres Körpers eingebaut war. »Ich hab eine biometrische Software in ihren Memristor geladen. Das nächste Mal erkennt sie dich wieder, wenn sie dich sieht.« Stolz schloss er die Serviceklappe im Rumpf der Puppe und schob die Haut zurück über die Öffnung.
Ich antwortete nicht und ging in mein Zimmer, um meine Tasche zu packen.
Eigentlich mochte ich ihn. Es war eine gute Entscheidung gewesen, ihn als Mitbewohner in meine Wohnung einziehen zu lassen, nicht nur wegen der Miete, die wir uns teilten, sondern auch wegen des hohen Unterhaltungswertes, den Eddy aufwies. Saßen wir nicht in der Küche und blödelten oder redeten uns bei einer Flasche Rotwein die Köpfe heiß, hockte Eduard, wie er eigentlich hieß, in seinem Zimmer und programmierte einen dieser Patientensimulatoren, an denen Medizinstudenten und Pflegepersonal ausgebildet wurden. Am Anfang hatte es mich irritiert, wenn ich auf einen seiner stöhnenden Humanoiden gestoßen war, doch mit der Zeit hatte ich mich daran gewöhnt, verdammt echt aussehende Kranke auf Eddys Arbeitstisch zappeln zu sehen. Nur einmal hatte ich ihn gebeten, die Werkstatt eines Kollegen zu benutzen, als er den Auftrag hatte, das Programm für einen im Gefecht verletzten Soldaten zu schreiben. Die Schreie des von Bombensplittern zerfetzten Gefreiten, den der Humanoide darstellen sollte, gingen mir tagelang nicht aus dem Kopf.
Es klopfte an der Tür, dann trat Eddy ein, zwei Flaschen Stout in der Hand. Er reichte mir eine. »Was ist los? Du hast doch was.«
Ich nahm die Flasche, trank einen Schluck und zuckte mit den Schultern. »Ich muss weg aus Brüssel. Ich hab einen Einsatz.«
Eddy erschrak. »Du musst nach Afrika?«
»Nein. Nach Deutschland.«
»Und deshalb bist du schlechter Laune?«
Ich wusste selbst nicht, warum ich so schlecht drauf war. Immerhin hatte man mir angekündigt, dass ich ohne Abschlussprüfung in den Dienst der Militärpolizei aufgenommen werden könne – und die Prüfung, die am Ende der Ausbildung stand, war berüchtigt.
»Aber das ist doch super!« Eddy war fassungslos, dass ich nicht voller Begeisterung durch die Wohnung steppte. »Was Besseres konnte dir doch gar nicht passieren!«
Ich nickte, er hatte recht. Es war idiotisch, sagte ich mir, einem irrationalen Gefühl nachzuhängen, anstatt sich einfach zu freuen. Wir stießen an und tranken.
»Es geht heute schon los. In einer Stunde bin ich weg.« Ich erzählte meinem erstaunten Mitbewohner, dass ich auf einen Flugtransfer verzichtet hatte und einen Dienstwagen für die Fahrt nach Deutschland benutzte. Die Transportmaschinen der Streitkräfte seien laut und unbequem, behauptete ich, außerdem wollte ich endlich mal wieder hinter dem Steuer eines Autos sitzen, ein Luxus, den sich nicht mehr viele leisten konnten. Eddy verstand das sofort.
Der wahre Grund, warum ich mit dem Wagen fahren wollte, war aber ein anderer: Seit meinem virtuellen Ausflug in die Wüste des Libanon ging mir mein Vater nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, nach ihm sehen zu müssen. Das Dorf, in dem er lebte, lag in der Nordeifel, eine knappe halbe Stunde von Aachen entfernt, und der direkte Weg von Brüssel in den Osten Deutschlands führte an Aachen vorbei. Allerdings war ich mir nicht so sicher, ob es gut war, zu meinem Vater zu fahren: Das letzte Mal, als ich ihn besucht hatte, war ich heftig mit ihm aneinandergeraten. Eine Neuauflage des Streits war das Letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte.
Von Brüssel waren es eineinhalb Stunden bis Aachen, bis ich dort war, würde ich mir darüber im Klaren sein, ob ich bei ihm vorbeifahren sollte oder nicht.
Eddy hob seine Flasche und streckte sie mir entgegen. »Auf Unteroffizier Vincent Höfler, den schärfsten Ermittler, den die Truppe aufbieten kann!«
Ich grinste und stieß erneut mit ihm an. Dann holte ich meine Reisetasche aus dem Schrank und begann zu packen.
Eine knappe Stunde später stand ich in der Garage der Kfz-Verwaltung und nahm die Fahrzeugpapiere entgegen. Man hatte mir einen Kleinwagen zugeteilt, eine müde Krücke mit Hybridmotor, mit der es kaum möglich sein würde, irgendeine Geschwindigkeitsbegrenzung zu überschreiten. Die Vergabe der Dienstwagen in der Truppe folgte der unausgesprochenen Regel, dass die Stärke des Motors in direktem Verhältnis zu Dienstgrad und Wichtigkeit stand. Der Wagen, den man mir zur Verfügung gestellt hatte, zeigte mir ganz klar, wo ich mich in der Hierarchie befand: ganz unten. Ich verstaute mein Gepäck und stieg ein.
Die Straßen Brüssels waren dicht befahren, Fahrräder und kleine solargetriebene Elektroflitzer beherrschten das Bild. Ich hupte einen Booster zur Seite und fädelte mich in das Gesurre und Gezirpe der Fahrzeuge ein, um endlich – ich freute mich schon die ganze Zeit darauf – das Gaspedal durchzutreten. Stotternd sprang der Verbrennungsmotor an, bis er rundlief und aufheulte, ein echt scharfes Geräusch, ich liebe diesen Moment. Ärgerliche Blicke trafen mich. Ungerührt aktivierte ich die Tarnlackierung, die meinen Wagen als Truppenfahrzeug kennzeichnete. Zwar konnte das die Eiferer, die immer noch auf einen Rückgang des Klimawandels hofften, nicht beruhigen, mir aber unnötige Diskussionen mit der Verkehrsüberwachung ersparen: Die Streitkräfte hatten dem Klimakommissariat eine Ausnahmeregelung abgerungen, als in den Ballungszentren und Großstädten Europas Fahrzeuge mit traditionellen Verbrennungsmotoren verboten worden waren.
Ich genoss die Fahrt. Die Autobahn, die ich bald erreichte, war frei, ein angenehmer Nebeneffekt der in ganz Europa erhobenen Maut. Die hohen Preise für Strom, Diesel und Wasserstoff taten ihr Übriges, die Straßen zu leeren. Zufrieden lehnte ich mich zurück und trat das Gaspedal durch. Die Vorstellung, dass gerade ein Vielfaches meines Monatssoldes zum Auspuff hinausschoss, war pervers, aber sie gefiel mir.
Nach einer Weile kehrte die Unruhe, die mich beim Verlassen des Hauptquartiers befallen hatte, zurück. Es war nicht allein der Blick des Generalleutnants und seines unbekannten Gastes, der mein ungutes Gefühl schürte. Warum, fragte ich mich, hatten sie gerade mich ausgewählt, die Sache zu untersuchen? Gab es nicht genug Militärpolizisten in Deutschland, die diese Aufgabe hätten übernehmen können? Ich dachte an Eddy, musste grinsen und schob meine Gedanken beiseite. Das Leben ist viel zu kurz, um schlechte Laune zu haben, war einer seiner Wahlsprüche, und ich fand, er hatte recht. Ich schaltete das Radio ein, das zum Glück nicht der Sparwut eines Bürokraten in der Militärverwaltung zum Opfer gefallen war. Der Sender spielte die aktuellen Charts, dazwischen ein paar Songs aus meiner Sturm-und-Drang-Zeit in den zwanziger Jahren. Ich drehte die Musik lauter und blinzelte in die untergehende Sonne.
Eine knappe Stunde später näherte ich mich Aachen. Es dämmerte, und die zersiedelte, von schmutzig grauem Schnee bedeckte Landschaft begann mit der Nacht zu verschmelzen. Lagerfeuer flackerten auf. Wie überall in Europa kündeten auch hier Zeltstädte und Barackenlager von der nahen Großstadt, illegale Siedlungen, in denen Billiglöhner und Arbeitslose lebten. Gerade spuckte ein Schulbus eine Horde von Kindern aus, die auseinanderstoben und in dem Gewirr von Zelten, Wohnwagen und Holzschuppen ihr Zuhause suchten.
Noch immer wusste ich nicht, ob es richtig war, meinen Vater zu besuchen. Ich mochte ihn, und ich hatte an ihn gute Erinnerungen aus der Zeit, als ich klein war. Doch mein Vater und ich waren grundverschieden, und wenn wir uns trafen, gab es häufig Streit, den wir beide lieber vermieden hätten.
Anna meint übrigens, es sei falsch, was ich schreibe: Mein Vater und ich seien uns im Gegenteil sehr ähnlich. Vielleicht stimmt das sogar, aber eigentlich ist es egal, denn letztlich zählt nur das Ergebnis unserer Begegnungen, und die waren in der Vergangenheit häufig sehr unerfreulich gewesen.
Ein dröhnendes Hupen holte mich aus meinen Gedanken, dann blendete eine riesige Batterie Scheinwerfer hinter mir auf. Erschrocken riss ich das Lenkrad herum. Mein Wagen brach aus und schoss auf die Standspur, ich trat auf die Bremse, kam schlingernd zum Stehen. Im gleichen Augenblick donnerte laut hupend ein Achtzigtonner an mir vorbei und verschwand in der Nacht.
Regungslos, die Hände um das Lenkrad gekrallt, saß ich hinter dem Steuer und blickte den Rücklichtern des sich entfernenden Ungetüms nach. Ich hatte unbewusst mein Tempo verlangsamt und war so zu einem Hindernis für einen der Asphaltcowboys geworden, die in ihren aufgemotzten Tera-Linern lebten und arbeiteten und für einen Hungerlohn Waren transportierten. Zeit war für sie im wahrsten Sinne des Wortes Geld, sie bekamen umso weniger für einen Transport, je später sie an ihrem Ziel eintrafen. Ein langsamer Kleinwagen störte da nur.
Ich ließ den Motor, den ich abgewürgt hatte, wieder an und lenkte den Wagen zurück auf die Fahrbahn. Im Licht meiner Scheinwerfer leuchtete ein Hinweisschild auf, es kündigte die Abfahrt an, die ich nehmen musste, wenn ich zu meinem Vater wollte. Kurzerhand entschloss ich mich, ihm tatsächlich einen Besuch abzustatten.
Mein Vater lebte seit bald dreißig Jahren in einem kleinen Kaff in der Eifel, in einer trostlosen und einsamen Gegend im Westen Deutschlands, die allenfalls Eremiten begeistert. Ich hatte nie verstehen können, wieso meine Eltern seinerzeit freiwillig hierhergezogen waren. Die Dörfer, die ich jetzt passierte, waren dunkel, nur in wenigen Häusern brannte Licht. Je weiter ich Richtung Süden fuhr, desto trauriger wurde es. Manche Ortschaften waren gänzlich unbewohnt, die Häuser verfielen zu Ruinen. Außer ein paar Alten, die an ihrer Heimat hingen, lebte kaum jemand noch hier.
Seit Jahren weigerte sich mein Vater beharrlich, sein Dorf zu verlassen, obwohl ich ihm sicherlich eine bezahlbare Wohnung in Brüssel hätte besorgen können: Die Menschen, sagte er, brauchten seine Hilfe; er sei der letzte Arzt, den es im Umkreis von sechzig Kilometern noch gebe. Und so fuhr er Tag für Tag mit seinem altersschwachen Kombi über die Dörfer und versorgte die verbliebenen Einwohner, die hier ausharrten. Dabei hätte er selbst, wie ich fand, Hilfe gebraucht, gebrechlich, wie er war. Doch das hätte er niemals zugegeben, wir hatten erst kürzlich am Telefon wieder darüber gestritten.
Ich erreichte das Dorf, eine Ansammlung verfallener Häuser, nach einer knappen halben Stunde. Es war stockdunkel, hinter keinem der Fenster brannte ein Licht. Der Weg zum Haus meines Vaters schlängelte sich von der Hauptstraße eine Anhöhe hinauf. Er hatte das Fachwerkhaus gemeinsam mit meiner Mutter kurz vor meiner Geburt gekauft. Über der jahrelangen Sanierung des maroden Gebäudes zu einem pittoresken Eifelhof war die Ehe meiner Eltern zerbrochen.
Ich verlangsamte das Tempo, um die Zufahrt nicht zu verpassen, dann bog ich ab und lenkte den Wagen vorsichtig den löcherigen Weg hinauf. Für einen Augenblick hatte ich das Gefühl, ein Fahrzeug mit abgeblendeten Scheinwerfern folgte mir, doch als ich noch einmal in den Rückspiegel sah, waren die Lichter verschwunden. Wenig später hatte ich das Eingangstor erreicht. Ich hielt auf dem kopfsteingepflasterten Hof und stieg aus.
Die Stille, die mich plötzlich umgab, war drückend. Nur das gleichmäßige Surren des Windrades auf dem kleinen Hügel hinter der Scheune zerschnitt das Schweigen der Nacht. Die Fenster in der Fachwerkfront des Hauses waren dunkel, so als wäre der Hof verlassen, doch der Wagen meines Vaters stand vor der Garage, und das Kabel, mit dem die riesigen altertümlichen Akkumulatoren im Kofferraum des Kombis geladen wurden, war an seinem Platz.
Ich sog die Nachtluft ein, schloss die Augen und dachte mich zurück in meine Vergangenheit. Für einen Augenblick verschwand das bedrückende Gefühl, das mich erfasst hatte, als ich wieder an den Ort meiner Kindheit kam. Zwar habe ich an meine ersten Jahre auf dem Hof meines Vaters keine Erinnerung, doch die Sommerferien, die ich nach der Scheidung meiner Eltern jedes Jahr hier verbrachte, sind mir lebhaft im Gedächtnis. Die Wochen inmitten der Natur hatte ich immer als beglückend empfunden, als großes Abenteuer voller Aufregung und Staunen, zumindest bis zum Beginn meiner Pubertät, in der sich meine Bedürfnisse deutlich verschoben.
Mein Vater, glaube ich, hat mir nie verziehen, dass ich erwachsen geworden bin.
Ein heiseres Bellen ertönte in der Scheune, es schepperte, dann wurde die Tür ein Stück aufgestoßen, und ein großer Hund kam heraus. Ich ging ihm entgegen. Der Hund, ein lohfarbener English Setter, erkannte mich sofort. Er war blind und schon sehr alt, aber mein Geruch reichte ihm.
»Benno, wer ist da?« Leise tönte die Stimme meines Vaters aus dem Haus.
Der Hund jaulte einmal, leckte mir die Hand und schleppte sich zum Eingang.
Das Licht neben der Tür flammte auf, dann war das Geräusch eines Riegels zu hören, und mein Vater betrat den Hof.
Zögernd begrüßte ich ihn. »Hallo, Papa!«
Mein Vater sah mich überrascht an. »Vincent!« Er kam auf mich zu, zog mich an sich und umarmte mich.
Die Bilder von meinem virtuellen Einsatz in der Wüste des Libanon standen mir vor Augen, der Anblick des alten Mannes in dem weißen Gewand, kurz bevor mich das Geschoss traf und tötete.
Als würde er meine Gedanken spüren, ließ mein Vater mich los und sah mich forschend an. »Was ist passiert? Warum bist du hier?«
Ich gab mich unbekümmert. »Bin auf der Durchreise.«
»Und warum hast du nicht angerufen? Du hast Glück, dass ich da bin.«
»War nicht geplant, dass ich vorbeikomme.«
»Klar, ein Besuch bei mir ist ja nie eingeplant.« Mein Vater lächelte schnell, um seinem reflexartig geäußerten Vorwurf die Spitze zu nehmen. Ich merkte dennoch, wie ich ärgerlich wurde. Dreißig Sekunden, das war Rekord.
Eilig ergriff mein Vater meine Hand und zog mich ins Haus, redete dabei auf mich ein, als wollte er mir keine Zeit lassen, der schlechten Stimmung, die sich zwischen uns auszubreiten drohte, nachzugeben.
Das Kaminfeuer in der winzigen Stube glomm. Er klappte die Glasscheibe vor der Öffnung zurück und warf ein Holzscheit in die Glut. Dann ging er in die Küche, um Tee zu kochen. Wenig später saßen wir auf den Kissen vor dem Feuer und wärmten unsere Finger an den Tassen. Mein Vater zog eine Flasche Rum hervor, bot sie mir an und goss, als ich ablehnte, einen kräftigen Schuss in seinen Tee. Er trank einen Schluck und sah mich forschend über den Rand der Tasse an. »Irgendwas ist passiert.«
Ich antwortete nicht, trank schweigend.
»Haben sie dich rausgeworfen?« In seinen Augen blitzte es hoffnungsvoll.
Ich schüttelte den Kopf. Dann erzählte ich ihm von meinem Erlebnis in der Wüste des Libanon.
Schweigend hörte mein Vater zu, wartete geduldig, bis ich schloss. Er war empört. »Diese Schweine!« Wütend sah er mich an. »Ich hab’s dir immer gesagt, geh da nicht hin!«
Ich schaltete auf Abwehr. »Ist das alles, was du zu sagen hast?«
»Findest du es denn richtig, was sie tun? Sie programmieren meine biometrischen Daten in eine Simulation und verlangen, dass du auf mich schießt. Das ist doch abartig!«
Er hatte recht, doch ich fühlte mich, durch unzählige Streitgespräche mit ihm konditioniert, zur Gegenrede herausgefordert. »Das ist Teil der Ausbildung. So was kann dir irgendwann mal dein Leben retten.«
»Blödsinn!« Ungehalten wischte er meine Bemerkung beiseite. »Wer sich so etwas ausdenkt, ist krank, und das weißt du.« Er griff nach einem Schürhaken und stocherte wütend im Feuer herum. »War dir wenigstens bewusst, dass du in einer Simulation bist?«
Ich nickte, ohne ihm zu sagen, dass ich es in jenem entscheidenden Moment vergessen hatte.
Mein Vater wandte sich ab und schwieg.
Ich glaubte zu wissen, wo er mit seinen Gedanken war. Ich hätte, wäre es nach seinen Vorstellungen gegangen, protestieren und mich auflehnen müssen, anstatt zu schweigen, mich »durchzuschummeln«, wie er meine Strategie immer nannte. Ich schien so anders als er zu sein, und das hielt er nicht aus.
Mein Blick suchte das vergilbte Foto an der Wand neben der Tür. Es zeigte meine Eltern in der ersten Reihe einer Demonstration von Globalisierungsgegnern anlässlich eines Treffens längst vergessener Regierungschefs in einem Seebad an der deutschen Ostseeküste. Bis heute war mein Vater in der Protestbewegung aktiv, er war einer der wenigen alten Kämpfer der ersten Stunde und mischte immer noch mit, allerdings nur via Computer und W-NET. Meine Mutter hat mich mal gefragt, ob meine angepasste Art, über die mein Vater sich stets aufregte, nicht auch eine Form des Protestes sei, nämlich ein Protest gegen die Eltern. Und wenn das wahr sei, hatte sie gefolgert, wäre es dann nicht endlich an der Zeit, damit aufzuhören?
Ich sah zu meinem Vater und wollte etwas sagen, doch er winkte hastig ab und legte seinen Zeigefinger über den Mund. Erst jetzt hörte ich, dass Benno draußen auf dem Hof leise knurrte. Mit etwas Mühe erhob sich mein Vater von seinem Kissen und löschte die Lampen, bis nur noch das Flackern des Feuers den Raum erhellte. Dann schob er eine bereitliegende Metallplatte vor die Kaminöffnung. Das Zimmer war nun komplett dunkel. Behutsam zog er den Vorhang eines Fensters zurück und sah hinaus. Angespannt winkte er mich zu sich.
»Dort unten, am Wegrand. Dreißig Meter vor der Hofeinfahrt.«
Jetzt erkannte ich, was Benno und meinen Vater alarmiert hatte: Ein Wagen stand dort mit ausgeschalteten Scheinwerfern, kaum zu erkennen im blassen Licht des Mondes. Er schien verlassen. Doch dann leuchtete die Glut einer Zigarette hinter der Windschutzscheibe auf.
»Wer ist das?« Fragend sah ich zu meinem Vater. »Was suchen die hier?«
»Schätze, die wollen mir auf die Finger sehen. Oder glaubst du, die sind wegen dir hier?« Er musste lächeln bei dem Gedanken.
Ich schwieg nachdenklich.
Ohne zu zögern, griff mein Vater zum Telefon, um die Notfallnummer einzutippen.
Ich war erstaunt. »Was hast du vor?«
»Ich ruf die Polizei.« Er grinste. »Die werden zwar nicht kommen, aber unsere Freunde da draußen werden, wenn ich mich nicht irre, die Meldung mithören und sich verdrücken.«
Zwei Minuten später war das leise Sirren eines Elektromotors zu hören, und der Wagen fuhr, ohne die Scheinwerfer einzuschalten, davon.
Erleichtert zog mein Vater den Vorhang wieder zu. »In drei Wochen ist der G5-Gipfel in Peking. In der Zeit vorher sind sie immer nervös.« Er lachte schmerzlich. »Als ob ich mit meinen müden Knochen noch irgendetwas verändern könnte!«
Ich war erstaunt, eine solche Bitterkeit hatte ich noch nie an ihm wahrgenommen. Da ich nicht wusste, was ich antworten sollte, nahm ich die Teetassen und brachte sie in die Küche.
Zehn Minuten später stieg ich in das Bett im Gästezimmer, das mir mein Vater schweigend bereitet hatte, bevor er mir eine gute Nacht wünschte.
Schlaflos lag ich unter meiner Decke und starrte in das Mondlicht, das durch das kleine Fenster fiel. Was war, wenn mein Vater sich irrte und die Unbekannten draußen nicht seinetwegen gekommen waren? Kaum hatte ich den Gedanken gedacht, musste ich über mich selbst lachen: Warum sollte man mich beobachten? Was sollte an dem, was ich zu tun hatte, so wichtig sein?
Unruhig schlief ich ein.
5
Ich erwachte am nächsten Morgen, als es hell wurde. Mein Vater war schon auf. Er versorgte die Tiere, die er sich hielt und die wiederum ihn versorgten, mit Milch, Eiern, Wolle und Fleisch. Er legte großen Wert darauf, so weit wie möglich autark zu leben. Nur einmal im Monat fuhr er in das zentrale Einkaufslager der Region, um sich mit jenen Dingen zu versorgen, die er nicht selbst herstellen konnte.
Durch das Fenster sah ich ihm zu, ohne dass er es bemerkte: Die Arbeit fiel ihm zunehmend schwer, und häufig hielt er inne, um zu verschnaufen. Ich ging zu ihm hinaus, um ihm zu helfen. Das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, nahm er meine Hilfe ohne ein Wort der Gegenrede an.
Später, beim gemeinsamen Frühstück, aßen wir schweigend, und jeder hing seinen Gedanken nach. Schließlich nahm ich mir ein Herz und erzählte ihm von meinem Auftrag.
Ich hatte erwartet, dass er ärgerlich werden könnte oder dass ich seinen Spott zu spüren bekäme, doch er hörte mir nur stumm zu. Nachdem ich geendet hatte, war es eine Weile still in der kleinen Küche.
Ich sah auf, suchte seinen Blick.
Er war besorgt. »Trau ihnen nicht!« Das war alles, was er sagte. Dann ging er hinaus, um seinen Arztkoffer fertig zu machen.
Unser Abschied war kurz, er fiel uns beiden schwer, keiner wollte den Moment länger als nötig hinausziehen. Im Rückspiegel sah ich, wie er mir nachschaute. Dann drehte er sich um und ging ins Haus.
Nach etwa dreißig Minuten war ich zurück in der Zivilisation. Ich fuhr einige Stunden auf der Autobahn weiter Richtung Norden, bis ich an einer Raststätte hielt, um einen Kaffee zu trinken. Das Restaurant war edel eingerichtet; wer hier einkehrte, hatte ein Auto, und wer ein Auto hatte, hatte viel Geld. Wer nicht hierherkam, das waren die Lastwagenfahrer und Asphaltcowboys, sie trafen sich am Imbiss hinten auf dem Lkw-Parkplatz gleich neben dem schäbigen Waschhaus. Vielleicht hätte ich besser dorthin gehen sollen, zwischen den elegant und teuer gekleideten Gästen des Restaurants kam ich mir fehl am Platz vor.
Das Leitsystem war wieder einmal ausgefallen, also lenkte ich selbst und folgte der A 1 weiter bis Lübeck, dann bog ich ab auf die A 20, eine heruntergekommene Autobahn, die noch aus der Zeit nach der sogenannten Wende in Deutschland Ende des vergangenen Jahrhunderts stammt. Der warme Wind aus den Wüstengebieten im Süden Europas war noch nicht bis hier oben vorgedrungen, die Landschaft, durch die ich fuhr, war kalt, weiß und leer. Endlose Brachflächen streckten sich bis zum Horizont, dazwischen lag ab und an wie hingespuckt ein Dorf, dem man nicht ansehen konnte, ob es noch bewohnt war oder schon verlassen. Kurz vor Rostock passierte ich eines der Lager für Klimaflüchtlinge, es war schwer gesichert, Militär patrouillierte an den Zäunen. Ich wusste von den Camps, da man mir vor einigen Monaten angeboten hatte, einen Sonderlehrgang für die Bewachung der Flüchtlinge zu absolvieren. Der Personalbedarf war groß: Überall bewarben sich die strukturschwachen Regionen Europas um die Aufnahme in das Klimafluchtprogramm der Vereinten Nationen, das auf Druck Chinas verabschiedet worden war. Alle hofften auf UN-Gelder und vor allem auf junge Arbeitskräfte, denn die Heimatlosen durften in ihren Gastländern zu den Bedingungen ihrer überfluteten oder verdorrten Herkunftsländer arbeiten. Auch neben diesem Lager waren die Straßen des Gewerbegebietes schon asphaltiert.
Dreißig Kilometer vor meinem Ziel kam mir die Erkenntnis, dass es höchste Zeit war, mich über meinen Auftrag zu informieren. Mit etwas Mühe fummelte ich den Memorychip, den mir der Generalleutnant mitgegeben hatte, aus meiner Uniformjacke und schob ihn in den Slot des Bordcomputers. Das Deckblatt einer Ermittlungsakte tauchte auf dem Bildschirm auf. Ich ignorierte den Warnhinweis und projizierte die Akte auf die Windschutzscheibe. Die Autobahn war leer, und ich hatte keine Lust anzuhalten.
Was ich las, war wenig erhellend: Gestern Morgen hatte eine Militärstreife vor dem Zaun des ehemaligen Fliegerhorstes Laage einen alten Mann erfroren aufgefunden. Niemand konnte sich erklären, warum der Alte hierhergekommen war und wo er hinwollte. Sicher schien, dass der Mann versucht hatte, den Zaun zu überwinden, um auf das Truppengelände zu gelangen. Möglicherweise war er dabei abgestürzt und bewusstlos liegen geblieben, so dass er keinen Hilferuf absetzen konnte. Da der Zaun zum Militärgebiet gehörte, fiel die Angelegenheit in die Zuständigkeit der Militärpolizei, die jedoch die Ermittlungen wenige Stunden nach dem Fund der Leiche in die Hand der örtlichen Polizeibehörden gelegt hatte. Ich war also, begriff ich, nur Staffage, ich hatte klug zu schauen und ansonsten die ermittelnden Polizeibeamten machen zu lassen.
Doch die Skepsis meines Vaters hatte meine Unruhe verstärkt. Ich löschte die Projektion und nahm den Chip aus dem Computer, gerade als ich die Abfahrt Laage erreichte. Warum hatten sie mich ausgewählt? Erwarteten sie, dass ich mich zurückhalten und der Polizei die Arbeit überlassen würde? So wie ich mich auch bisher nicht durch größeres Engagement ausgezeichnet hatte?
Die Worte meines Vaters klangen in meinem Kopf nach. »Trau ihnen nicht!«
Kurz entschlossen suchte ich, nachdem ich die Mautstelle passiert hatte, aus der Akte die Koordinaten des Fundortes der Leiche heraus und gab sie in das Navigationssystem ein. Warum sollte ich nicht der Anweisung meiner Vorgesetzten folgen und in dem Fall tatsächlich ermitteln?
Das Navigationssystem führte mich in einem großen Bogen südlich um das Militärgebiet herum. Das Gelände war weiträumig umzäunt, alte Flugzeughallen und verlassene Truppengebäude waren zwischen den Bäumen zu erkennen. Nirgendwo war ein Mensch zu sehen.
Die letzten Meter bis zu meinem Ziel bestanden aus einem unbefestigten Feldweg. Er führte an einem Haus vorbei, das in Blickweite des Zaunes am Rande einer Weidefläche stand. Ich stellte den Wagen am Wegrand ab und ging zu Fuß weiter, ich wollte nicht riskieren, das Auto abseits der Straße festzufahren.
Die Hände in den Taschen vergraben, ging ich durch den Schnee auf das Haus zu. Es wirkte heruntergekommen und schien unbewohnt, doch dann begann im Inneren ein Hund zu kläffen. Kurz überlegte ich, die Bewohner zu befragen, vielleicht hatten sie etwas beobachtet. Doch als trotz des Hundegebells niemand ans Fenster kam, ging ich, ohne anzuhalten, weiter.
Der Ort, an dem der tote Alte aufgefunden worden war, lag etwas abseits des Weges auf einer von Disteln und Strauchwerk durchsetzten Brachfläche, das Navigationstool meines Perso-Taggers führte mich an den genauen Punkt.
Ich blieb stehen und sah mich um. Stimmten die Koordinaten, hatte der Alte direkt vor dem Zaun gelegen, einem vier Meter hohen Geflecht aus gehärtetem Stahl, bewehrt mit einer Krone aus rasiermesserscharfen Klingen und mit Infrarotkameras und ID-Scannern bestückt, die in Abständen entlang der Umzäunung montiert worden waren. Der Schnee am Fundort war zertreten, Reifenspuren führten hinüber zum Feldweg, ein schweres geländegängiges Fahrzeug hatte die Erde aufgewühlt. Wenn es hier jemals verwertbare Spuren gegeben haben sollte, waren sie durch den beherzten Einsatz der Soldaten, die den Alten gefunden und abtransportiert hatten, zerstört worden.
Ich sah auf. Das Bellen des Hundes war verstummt. Eine Gestalt stand am Fenster des Hauses und schaute zu mir herüber. Ich winkte und wollte zu dem Gebäude gehen, als hinter mir eine Waffe entsichert wurde.
»Stehen bleiben! Heben Sie die Hände!« Die Stimme klang entschlossen.
Ich folgte der Anweisung und drehte mich langsam um.
Eine Militärstreife stand auf der anderen Seite des Zaunes, einer der beiden Soldaten hatte sein Schnellfeuergewehr auf mich angelegt. Ein Hund war in ihrer Begleitung.
Ich versuchte ein Lächeln. »Ich bin Unteroffizier Vincent Höfler. Ich bin hier im Einsatz.« Obwohl mit der Sprache vertraut, hatte ich einen Moment Mühe, Deutsch zu sprechen, es kam mir fremd und unpassend vor. Dabei war ich es, der hier fremd war.
Der eine Posten trat an den Zaun, während der andere, seine Waffe in der Hand, mich nicht aus den Augen ließ. »Zeigen Sie mir bitte Ihren Dienstausweis!«
Jede hastige Bewegung vermeidend, aktivierte ich die ID-App auf dem Display meines Taggers und hielt ihn vor das Lesegerät, das der Soldat mir durch den Zaun entgegenstreckte. Mit einem Fiepen quittierte das Gerät den Empfang der Daten. Der Soldat las die übertragenen Informationen auf dem Display. »Hier steht, Sie haben die Anweisung, sich beim Kasernenkommandanten zu melden.«
Ich nickte und gab mich hilflos. »Hab die Abfahrt verpasst. Mein Navigationssystem ist ausgefallen.«
Der Soldat, ein Hauptgefreiter, wie ich an seiner Schulterklappe sah, musterte mich misstrauisch, dann wandte er sich ab und holte ein Funkgerät hervor. Sein Kamerad hielt unverdrossen die Waffe auf mich gerichtet.
Zehn Minuten später rumpelte ein offener Geländewagen über den Feldweg und stoppte vor mir. Ein Hauptfeldwebel sprang vom Beifahrersitz, schneidig und kaum älter als ich.
Ich salutierte.
»Ist er das?« Fragend sah der Hauptfeldwebel die beiden Soldaten an, als gäbe es hier Hunderte von Männern, die mit einer Waffe in Schach gehalten wurden.
Der Hauptgefreite nickte.
»Wenn ich das aufklären darf«, fing ich an, um die Angelegenheit zu beschleunigen. »Ich bin aus Brüssel hierhergeschickt worden, vom Hauptquartier der Streitkräfte. Ich soll den Tod des alten Mannes aufklären.«
Der Hauptfeldwebel betrachtete mich schweigend. Dann wies er mit dem Kopf auf den Wagen. »Kommen Sie mit!«
Als ich einstieg, sah ich noch einmal zu dem einsamen Haus. Die Gestalt hinter dem Fenster war verschwunden.
Fünf Minuten später hatten wir den Haupteingang der Kaserne am Rand des ehemaligen Fliegerhorstes erreicht. Die Zufahrt war schwer gesichert, Wachen mit schussbereiten Schnellfeuergewehren standen vor dem Tor und überprüften jeden Wagen. »Gefährdungsstufe Charlie« informierte ein Schild im Fenster des Wachhäuschens. Das Hauptquartier in Brüssel hatte in der Nacht die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen: Es gab Hinweise auf geplante Anschläge der »Saif al-Islam«, einer militanten Widerstandsgruppe aus Somalia, die angekündigt hatte, den Krieg am Horn von Afrika nach Europa zu tragen. Der Wachposten erinnerte mich daran, dass ich, wenn ich alleine außerhalb des Militärgeländes unterwegs war, keine Uniform tragen durfte.
Die Begegnung mit dem Kasernenkommandanten, zu dem man mich brachte, verlief vollkommen anders als erwartet. Der ranghöchste Soldat der kleinen Einheit, ein schlanker Oberstleutnant mit blasser, teigiger Haut, war seltsam uninteressiert an den Umständen meiner Ankunft. Er begrüßte mich zuvorkommend, sicherte mir seine Unterstützung zu und gab mich in die Obhut des Soldaten, der mich hergebracht hatte: Hauptfeldwebel Harms würde mir jede Frage, die ich hätte, beantworten. Meinen Besuch am Fundort der Leiche erwähnte der Kommandant mit keiner Silbe.
Verwirrt verließ ich das Kasernengebäude. Ich hatte erwartet, gerügt und entsprechend meinem Dienstrang behandelt zu werden, doch es wirkte fast so, als wäre ich ein Gast und kein Mitglied der Truppe – eine Situation, für die ich in diesem Moment keine Erklärung hatte.
Der Hauptfeldwebel stand an seinem Geländewagen und wartete auf mich, offenbar hatte der Kommandant ihn zwischenzeitlich in Kenntnis gesetzt. Er winkte ab, als ich salutieren wollte, und öffnete stattdessen die Beifahrertür. »Wohin?« So zackig, wie er sich bewegte, stellte er seine Frage.
Ich überlegte kurz, dann bat ich ihn, mir den Stützpunkt zu zeigen.