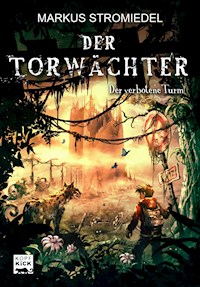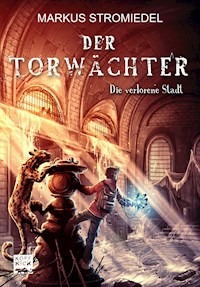Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kick-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Selig
- Sprache: Deutsch
Eine Vergangenheit, die dich nicht loslässt: Kommissar Seligs dritter Fall - ein packender Berlin-Krimi Jetzt das eBook Einführungsangebot sichern! Markus Stromiedel, der "Vater" des Kieler Tatort-Kommissars Klaus Borowski, legt mit "Nachtfrost" den dritten hoch spannenden Polit-Krimi um Kommissar Selig vor, der auch als Psychodrama überzeugt. Der alte Mann, der zu Hauptkommissar Paul Selig ins Büro kommt, hat ein ungewöhnliches Anliegen: Er habe einen Mord zu melden, das Mordopfer sei er selbst. Und den Täter kenne er bereits: Erhard Lasnik, einen angesehenen Berliner Bürger. Er vertraue darauf, dass Selig ihn als Mörder zur Strecke bringen werde. Selig glaubt an einen Scherz, doch einen Tag später liegt der Alte tot in einer Wohnung im Norden Berlins. Die Spuren, die Selig und seine Kollegen am Tatort finden, führen tatsächlich zu Lasnik, die Beweise sind eindeutig. Lasnik wird verhaftet, der Fall scheint abgeschlossen. Doch Selig ist diese Lösung einfach zu glatt. Er zweifelt an den Ergebnissen und ermittelt weiter. Seine Hartnäckigkeit fördert mehr als überraschende Zusammenhänge aus der jüngsten deutschen Vergangenheit zutage … "Selig hat ein bisschen was von Monk, ein bisschen was von Tabor Süden - ein Gewinn, dieser neue Polizist, der so sympathisch und smart ist." Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Stromiedel
Nachtfrost
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Vergangenheit, die dich nicht loslässt: Kommissar Seligs dritter Fall – ein packender Berlin-Krimi
Der alte Mann, der zu Hauptkommissar Paul Selig ins Büro kommt, hat ein ungewöhnliches Anliegen: Er habe einen Mord zu melden, das Mordopfer sei er selbst. Und den Täter kenne er bereits: Erhard Lartnik, einen angesehenen Berliner Bürger. Er vertraue darauf, dass Selig ihn als Mörder zur Strecke bringen werde.
Selig glaubt an einen Scherz, doch einen Tag später liegt der Alte tot in einer Wohnung im Norden Berlins. Die Spuren, die Selig und seine Kollegen am Tatort finden, führen tatsächlich zu Lartnik, die Beweise sind eindeutig. Lartnik wird verhaftet, der Fall scheint abgeschlossen.
Doch Selig ist diese Lösung einfach zu glatt. Er zweifelt an den Ergebnissen und ermittelt weiter. Seine Hartnäckigkeit fördert mehr als überraschende Zusammenhänge aus der jüngsten deutschen Vergangenheit zutage …
Inhaltsübersicht
Vorwort
Prolog
Zwei Tage zuvor
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Epilog
Danksagung
Hätte man ihm am Morgen gesagt, er würde an diesem Tag sterben, er wäre nicht überrascht gewesen. Zu oft hatte man ihn mit dem Tod bedroht. Zu oft hatte man ihn gewarnt, vorsichtig zu sein.
Er hatte sich fest vorgenommen, dem Unvermeidlichen gefasst entgegenzutreten.
Doch jetzt, da er spürte, wie sich sein Blickfeld verengte und seine Nase zu laufen begann, wie der Schweiß aus den Poren seiner Haut drängte und ihm der Speichel aus dem Mund floss, wie er nach Atem rang und seine Muskeln unkontrolliert zuckten, wie er sich erbrach und sich sein Schließmuskel öffnete, da flutete Panik seinen sterbenden Körper. Keine Zeit mehr, an sein Kind zu denken. Keine Zeit mehr, von seinen Freunden Abschied zu nehmen. Keine Zeit mehr, sich einzureden, dass ihr Kampf sinnvoll gewesen war. Sein Bewusstsein löste sich auf, bis er nur noch Schmerz war, Todesangst, Verzweiflung.
Prolog
Ein letztes Mal blitzte die Sonne hinter einem der Wolkentürme hervor, dann sank die Maschine hinab in den Nebel aus Wassertröpfchen, der sich unter ihnen bis zum Horizont wie eine dicke Schicht aus Watte ausbreitete. Schlagartig wurde es in der Kabine dunkel. Milchige Fetzen huschten an den Fenstern vorbei, Gespenstern gleich, die das Flugzeug umtanzten, als wollten sie es in das Reich der Toten locken. Der Körper des Jets zitterte.
Jeff Farsell hatte für das Schauspiel vor den Kabinenfenstern der Embraer 190 kein Auge. Er trank den letzten Schluck seines Mineralwassers, dann zerknüllte er den Pappbecher in seiner Hand und stopfte ihn in die Tasche des Vordersitzes. Angespannt lehnte er sich zurück.
Sie hatten stundenlang zusammengesessen, in einem kleinen, unauffälligen Hotel am Stadtrand von Zürich. Keine Sympathisanten reckten vor dem Eingang ihre Transparente, keine Reporter belagerten das Foyer, keine Groupies warteten vor der Zimmertür. Niemand kannte sie an diesem Ort, hier waren sie ungestört, und das war wichtig in diesen Stunden.
Was sie herausgefunden hatten, war unglaublich. Sie wurden benutzt. Jemand schob ihnen manipulierte Daten zu. Jemand missbrauchte ihren Namen und ihre Reputation, um mit gefälschten Informationen Politik zu betreiben. Und sie hatten es nicht bemerkt.
Es war ein Zufall gewesen, dass er auf die Log-Datei gestoßen war. Eine Zeile in dem Protokoll war ihm ins Auge gefallen, eine winzige Ziffernfolge, die nicht zum angeblichen Ursprung des Programms passte. Erneut spürte Farsell den Ärger, der tief in ihm brodelte und den er die vergangenen zwölf Stunden zurückgedrängt hatte. Jetzt, allein mit sich und seinen Gedanken, ließ er seine Wut zu. Warum hatte er nicht selbst den Hack betreut? Es war ein Fehler gewesen, sich aus der operativen Arbeit zurückzuziehen und stattdessen als Kopf ihrer Gruppe in die Öffentlichkeit zu gehen. Zwar hatte Hardy recht behalten: Seit er ihrem Anliegen ein Gesicht gab, waren ihre Bekanntheit und auch ihr Einfluss gewachsen, auch wenn er nicht recht verstand, warum seine umjubelten Auftritte wie zuletzt bei der TED Conference in Vancouver ihrer Arbeit mehr Gewicht verleihen sollten. Entscheidend waren die Informationen, die sie bereitstellten, und nicht die in den Blogs und Newsfeeds diskutierte Frage, ob er cool auf den Fotos wirkte, wenn er sich in Turnschuhen und T-Shirt am Rande einer Sicherheitskonferenz mit dem ehemaligen US-Präsidenten traf.
Ihnen allen war klar, dass sie viel zu verlieren hatten. Ihre NGO galt als führende unter den non-governmental organisations, die sich der Dokumentation und Aufklärung von Regierungsverbrechen verschrieben hatten. Ihr Ruf als brillante und unbestechliche Idealisten war untadelig. Private Geldgeber finanzierten den schlanken Apparat, den er aufgebaut hatte, um ihre Unabhängigkeit von staatlichen Stellen zu wahren. Und gerade ihnen musste so etwas passieren.
Noch einmal ging Farsell in Gedanken durch, was sie besprochen hatten. Sie würden, bevor sie die Öffentlichkeit unterrichteten, alle Informationen prüfen müssen, die sie in den vergangenen Monaten auf ihrer Webseite online gestellt hatten, jedes Dokument, jedes Programm, jede Tondatei, jedes Video. Sie würden die Kanäle checken, über die sie die Informationen erhalten hatten. Und sie würden die Dateien selbst noch einmal unter die Lupe nehmen, um sie Byte für Byte zu untersuchen. Von seinen IT-Forensikern wusste er, dass es unmöglich war, keine Spuren zu hinterlassen. Sie würden den Täter finden.
Eine Hand legte sich auf seine Schulter, es war die seines Bodyguards, der in der Reihe direkt hinter ihm saß. »Wir landen in zehn Minuten.«
Farsell nickte und ließ den Verschluss seines Sicherheitsgurts einrasten.
Von Böen getrieben, sank der Jet tiefer. Schneeregen setzte ein, prasselte hart auf die Aluminiumhülle der Kabine. Das Licht über den Sitzen flammte auf, gerade als ein heftiger Windstoß das Flugzeug erfasste und in die Tiefe drückte. Einige Passagiere stöhnten erschrocken auf. Im Schneetreiben draußen waren die Lichter der nahen Stadt kaum zu erkennen. Nur das beruhigend gleichmäßige Blinken der Positionslichter an den Flügelspitzen verriet den Fluggästen, dass sie der Zivilisation entgegenflogen und nicht dem Schlund der Hölle.
Farsell blickte aus dem Fenster. Das schlechte Wetter, in dem sie gerade flogen, war nichts gegen den Sturm, der vor ihnen lag. Wie ein Orkan würde die Nachricht von dem Verrat durch die Szene toben, und sie würden sich gut vorbereiten müssen, um nicht mitgerissen zu werden. Nur wenn sie die Hintermänner fanden, hatten sie eine Chance, die Scharte, die sie geschlagen hatten, auszuwetzen. Und er würde sie finden, schwor er sich. Und wenn es das Letzte wäre, was er in seinem Leben tat.
Sein Bodyguard hatte eine Flughafenlimousine des VIP-Services bestellt, sie wartete schon draußen auf dem Rollfeld, als die Embraer gelandet war und ihrer Parkposition entgegenrollte. Während die Passagiere nach vorne aus der Kabine drängten und durch den Schneeregen zu dem bereitstehenden Flughafenbus hasteten, stieg Farsell, begleitet von seinem Bodyguard, die hintere Gangway hinab und ließ sich kurz darauf in die Sitzpolster der Limousine sinken.
»Können Sie uns direkt in die Stadt bringen?« Farsell hatte Englisch gesprochen, so wie er es immer tat, überall und ohne nachzudenken.
Der Fahrer schüttelte bedauernd den Kopf, bevor er antwortete. »Ich fahre Sie nur auf dem Flughafengelände. Aber mein Kollege steht schon am Ausgang bereit.« Sein Englisch hatte einen harten slawischen Akzent. »Vorher müssen Sie noch durch die Passkontrolle.«
Farsell nickte nur.
Der Fahrer startete den Motor und suchte sich seinen Weg durch das Schneetreiben. Wenig später hatten sie das Terminal erreicht. Ein Grenzbeamter erwartete sie am Eingang, er warf einen kurzen Blick in Farsells Pass, dann öffnete er die Glastür zur warmen, hellen Empfangshalle. Zwei Verkehrsmaschinen waren direkt vor ihnen gelandet, die Gepäckbänder kreisten, Reisende liefen durcheinander und wuchteten Koffer auf Gepäckwagen. Farsell beachtete das Treiben nicht weiter: Ohne zu zögern, steuerte er den Gang an, der zum Ausgang führte. Es war nicht sein erster Besuch in Krakau, und dank seines fotografischen Gedächtnisses erinnerte er sich an jeden Ort genau, war er einmal dort gewesen.
Ein Ruf ließ ihn stutzen. Auch sein Bodyguard drehte sich zu der Gestalt um, die schnell zu ihnen aufschloss.
Es war nicht mehr als ein Hauch, eine fast zärtliche Berührung, als sich die ölige Flüssigkeit, zerstäubt zu einem feinen Nebel, über sein Gesicht legte. Auch seinen Bodyguard erfasste eine winzige Wolke. Sie blinzelten erstaunt. Dann, wie ein einschlagender Blitz, schoss der Schmerz in ihre Nervenbahnen. Farsell stolperte, Hilfe suchend den Arm ausgestreckt. Doch niemand half ihm, sein Bodyguard war schon zu Boden gegangen, er lag dort zusammengekrümmt, mit zuckenden Gliedmaßen, die Augen angstvoll aufgerissen. Und während die Gestalt davonhastete und das Gift in ihnen seine Wirkung entfaltete, während Farsell zitternd auf den polierten Steinplatten des Fußbodens kniete und sein Körper sich aufzulösen begann, begriff er, dass er seinen Schwur gehalten hatte: Er hatte den Täter gefunden. Er wusste jetzt, wer hinter allem steckte. Es war das Letzte, was er in seinem Leben getan hatte.
Sein Körper bäumte sich auf, während ihm dieser Gedanke durch den Kopf ging.
Dann gab er sich dem Schmerz hin, der Todesangst, der Verzweiflung.
Zwei Tage zuvor
1
Kriminalhauptkommissar Paul Selig stand am Fenster seines Büros und starrte hinaus in das Dämmerlicht. Es war einer der Tage, an denen die Nacht nicht enden wollte. Schwere, schneegefüllte Wolken hingen über den Häusern, sie verhüllten die Sonne und hielten die Dunkelheit am Boden zurück. Wie Irrlichter tanzten die Scheinwerfer der Autos durch die Straßen und formten grobkörnige Schattenrisse aus den Menschen, die durch den Graupel hasteten.
Selig seufzte. Er hatte in der Nacht zuvor kaum geschlafen und fühlte sich schon den ganzen Tag, als säße der Alb, der auf seiner Brust gehockt und ihm den Schlaf und den Atem genommen hatte, noch immer auf ihm. Nach einem letzten Blick hinunter auf die Straße ließ er die Jalousie herabgleiten, bevor er mit müden Schritten zurück zu seinem Schreibtisch ging.
Die Akten, die Maria ihm am Mittag gebracht hatte, lagen ungeöffnet vor ihm. Er hatte sie akkurat ausgerichtet und danach nicht mehr angefasst. Er wusste, was in ihnen stand, und er wusste auch, was Maria von ihm erwartete. Er würde sie enttäuschen müssen, er konnte nicht aus seiner Haut und spürte, dass er es auch nicht wollte. Zu oft hatte er getan, was man von ihm erwartet hatte.
Was Lisa von ihm erwartet hatte.
Maria Garcia Fernandez war die jüngste Kollegin in Seligs kleinem Team. Er mochte sie. Sie war eine wache, schlanke Frau mit spanischen Wurzeln und einem Temperament, das ihn immer wieder verblüffte und nicht selten überforderte. Maria vereinte all das in sich, was er vermisste, seit Lisa, seine Zwillingsschwester, nicht mehr bei ihm war. Der Gedanke versetzte ihm einen Stich, und im selben Atemzug schob Selig ihn wieder von sich. Ihm war klar: Maria war nicht Lisa, nur weil sie selbstbewusst und selbstbestimmt war und sich von niemandem etwas sagen ließ, auch nicht von ihm. Lisa gehörte zu seiner Vergangenheit, sie war Teil einer Zeit, die hinter ihm lag. Maria hingegen war Teil seines neuen Lebens.
Er mochte sie sehr, wenn er ehrlich zu sich war. Trotzdem erlaubte er sich nicht, diesem Gefühl in ihm nachzugehen, zumindest nicht an Tagen wie diesen.
Es klopfte, dann streckte Maria ihren Kopf durch den Türspalt. Sie betrachtete ihn prüfend. »Wann geht es los?«
Selig tat, als wüsste er nicht, worauf sie anspielte. »Was soll losgehen?«
»Soll ich das SEK informieren, oder machen Sie das?« Maria schloss die Tür hinter sich und blickte ihn erwartungsvoll an.
Selig warf einen Blick auf die Akten vor sich. Er griff sie und reichte sie Maria. »Brennauer soll das mit seinen Leuten übernehmen.«
Maria runzelte die Stirn. »Das KK 12? Das ist eine andere Abteilung.«
»Ich weiß, wo Brennauer arbeitet.«
»Aber das sind unsere Ermittlungen! Das ist unser Erfolg!«
»Wichtig ist, dass der Verdächtige gefasst wird. Wer das übernimmt, spielt keine Rolle.«
Maria starrte ihn perplex an. »Ist das dein Ernst?« Sie duzte ihn immer, wenn sie ärgerlich auf ihn war. »Wir arbeiten monatelang an der Sache, und wenn die Beweise gerichtsfest sind und wir zugreifen können, gibst du den Fall ab?«
Selig zuckte mit den Schultern, während er sich abwandte und seine Jacke nahm.
Sie hielt ihn am Arm fest. Selig spürte den festen Griff ihrer Hand durch den dicken Stoff. Als er aufsah, schaute er in ihre dunklen, schönen Augen. Sie funkelten wütend.
»Das ist jetzt das dritte Mal. Die Kollegen lästern schon. Warum bringst du nicht einmal zu Ende, was du angefangen hast?«
Selig begegnete ruhig ihrem Blick. Er fand ihre Reaktion angebracht, und ihm imponierte der Nachdruck, mit dem sie ihre Frage stellte. Er merkte, dass Maria ihm leidtat. Denn er würde ihr keine befriedigende Antwort geben können.
Wie sollte er ihr etwas verständlich machen, das er sich selbst nicht erklären konnte?
Es war so, seit er zurückdenken konnte: Der Gedanke, ohne Not aus der Unauffälligkeit herauszutreten, ließ seinen Magen krampfen, und die Idee, sich mit seinen Erfolgen zu brüsten, sich gar selbst zu loben, ließ Übelkeit in ihm aufsteigen. Er machte seine Arbeit, und wenn sie erledigt war, sollten sich andere um den Rest kümmern.
»Sehen Sie zu, dass Brennauer die Akten sofort bekommt. Er soll niemanden außer seinem Team einweihen, bis Schrader gefasst ist.« Er versuchte ein Lächeln. »Wenn Sie möchten, können Sie die Festnahme als Abgesandte unserer Ermittlungsgruppe begleiten.«
Maria hob an, zu widersprechen, doch Selig ließ sie nicht zu Wort kommen. »Das ist eine Dienstanweisung, Frau Fernandez. Bitte leisten Sie ihr Folge.«
Maria zuckte zurück, als Selig ihren Nachnamen nannte. Sie starrte ihn an, dann nickte sie mit unterdrückter Wut. Wortlos verließ sie das Büro.
Selig seufzte.
Er wusste, Maria meinte es gut mit ihm. Sie war die Letzte, die an sich dachte oder an ihre Karriere, sie dachte an ihn, und das machte es so schwer, sie zurückzuweisen. Doch ihm fehlte die Kraft, sich ihr zu öffnen, vor allem an Tagen wie diesem.
Er löschte das Licht an seinem Schreibtisch.
Volker Haussner blickte von seinem Leuchttisch auf, als Selig das Labor betrat. »Na, was vergessen? Ich dachte, ihr habt alle Beweise zusammen.«
Selig nickte nur und zog sich einen Hocker heran, um auf der anderen Seite des Tisches Platz zu nehmen. Eine Weile saß er stumm da.
Haussner schob die Folie, an der er gearbeitet hatte und auf der Stofffasern und Haare klebten, zur Seite und blickte Selig forschend an.
Selig winkte ab. »Bitte nicht. Diesen Blick sehe ich schon den ganzen Tag bei meiner Kollegin.«
»Bei Maria?« Ein leises Lächeln spielte um Haussners Mundwinkel. »Falls du sie loswerden möchtest …« Haussner musterte Selig spöttisch. Es war ein Spiel zwischen ihnen, das Haussner mit Genuss spielte. »Ein Wort von dir, und ich stelle den Antrag, dass sie ins LKA und in meine Abteilung wechselt.« Er klopfte gegen die Front der Tischschublade. »Ich habe das Formular schon hier.«
Zu Haussners Verblüffung reagierte Selig nicht wie sonst mit Protest. Haussner betrachtete ihn prüfend, dann stand er auf und holte eine große runde Box mit Lakritz aus dem Schrank, um sie Selig entgegenzustrecken. Seit ihm der Arzt Alkohol verboten hatte, drückte Haussner sein Mitgefühl mit Süßigkeiten statt mit Kräuterschnaps aus, was seiner Leber guttat, aber nicht seinem Hüftumfang, denn in seinem Job brauchten viele Kollegen Mitgefühl.
Selig winkte dankend ab. »Lass gut sein. Ist alles in Ordnung.«
»So siehst du aber nicht aus.« Haussner spähte in die Box und fischte sich eine Lakritzstange aus der Mischung. »Du hast doch was. Oder bist du gekommen, um mich eine Runde anzuschweigen?«
Selig musste lächeln. »Eigentlich wollte ich dich fragen, ob wir heute Abend ein Bier trinken gehen.« Er sah auf die Plastikbox auf dem Tisch. »Oder zusammen ein Lakritz essen.«
Haussner warf ihm einen skeptischen Blick zu. »Du willst was unternehmen?«
»Wieso?« Selig tat erstaunt. »Ist doch ganz normal.«
»Ja, klar, für fünfundneunzig Prozent aller Kollegen. Aber nicht für dich. Wann hast du das letzte Mal in einer Kneipe gesessen oder in einem Restaurant? Außer wenn du zur Arbeit musst oder mit deinem Jungen zum Baumarkt fährst, verlässt du dein Haus doch nicht.«
»Gibt eben zu Hause immer was zu tun. Außerdem frage ich dich doch gerade.«
Haussner antwortete nicht, in ihm arbeitete es. Er betrachtete Selig mit gerunzelter Stirn. »Sag bloß, es ist wegen …« Er stockte.
Selig seufzte.
Haussner holte sein Smartphone hervor und rief den Kalender auf, um sich zu vergewissern. Dann klappte er schweigend die Schutzhülle wieder zu und steckte das Gerät in die Innentasche seiner Jacke, die über der Lehne seines Stuhls hing.
Entschuldigend hob Selig die Schultern.
Nun war es an Haussner, zu seufzen. »Findest du nicht, dass mal Schluss ist mit den trüben Gedanken?«
»Ich such mir das nicht aus.«
»Aber das alles ist über dreißig Jahre her.«
Selig wusste nicht, was er antworten sollte. Er konnte nichts für seine Vergangenheit und schon gar nicht für seine Gefühle, die immer wieder zu ihm krochen und an ihm zerrten, wenn er am Ufer des Wannsees saß und über das Wasser starrte.
Haussner sah Selig bedauernd an. »Es tut mir leid, es geht nicht. Ich bin nachher bei meinen Eltern. Ich kann das nicht absagen, ich habe den beiden meinen Besuch schon vor einer Woche versprochen.«
Haussners Eltern lebten in einem kleinen Seniorenstift in Schöneiche östlich von Berlin und starrten Tag für Tag schweigend auf die Tannen vor dem Fenster, bis ihr Sohn sie aus ihrem Zimmer holte und ins nahe Eiscafé brachte oder mit ihnen zu einem Einkaufszentrum fuhr.
»Hast du nicht Lust, mitzukommen?«
Selig schüttelte den Kopf.
»Wird bestimmt lustig!« Haussner musste bei seinen eigenen Worten lachen. »Na ja, zumindest nicht so traurig wie in deiner alten Bruchbude. Wir könnten Skat spielen, das kann mein Vater immer noch.«
»Lass gut sein, Volker. Ich komme schon klar.«
Zweifelnd sah Haussner ihn an. »Sicher?«
Selig zwang sich zu einem Lächeln. »Hab’s bisher immer überstanden.«
»Was ist mit deinem Jungen? Ist er nicht zu Hause?«
Selig wusste es nicht. »Tobias ist seit ein paar Tagen unterwegs. Eigentlich wollte er noch kommen.« Er stand auf und zog seine Jacke zurecht. »So, und jetzt ist Schluss. Bin schon viel zu lange hier. Außerdem halte ich dich von der Arbeit ab.«
»In der Tat.« Haussner zog spöttisch die Augenbrauen hoch. »Du redest heute wie ein Wasserfall. Bin ich gar nicht gewohnt.«
Selig grinste. »Tja, Menschen können sich ändern.«
»Das bezweifle ich.«
Selig nickte ernst. »Ich leider auch.«
2
Mit schnellem Schritt verließ die Bundeskanzlerin den Sitzungssaal des Kanzleramtes, gefolgt vom Innenminister Martin Wachoviak, der ihr die Tür aufhielt und nach ihr auf den Gang trat. Susanne Bergstedt beherrschte sich, bis sie außer Hörweite der anderen waren. »Ich dachte, Sie hätten Ihre Länderkollegen vorbereitet! Das Geschacher gerade eben war erbärmlich.«
Hilflos hob der Innenminister die Schultern. Wachoviak war als Nachfolger seines geschassten Vorgängers Weyland ins Amt gekommen und agierte seither unauffällig und mit wenig Fortune auf seinem Posten. »Mein Staatssekretär hatte alles ausgehandelt. Ich weiß auch nicht, was da gerade eben passiert ist.«
»Das kann ich Ihnen genau sagen. Ihr bayerischer Kollege hat sich auf Ihre Kosten profiliert. Der starke Mann von der Isar räumt in Berlin auf! Ich wette, der rennt gerade zu der Pressekonferenz, die er längst vorbereitet hat, und verkündet der Welt, was für ein harter Kerl er ist.« Ärgerlich durchschritt die Kanzlerin den Gang. Sie hasste Machtspiele wie jenes, das sie gerade erlebt hatte, obwohl sie das Politiker-Schach inzwischen selbst perfekt beherrschte. Der bayerische Innenminister war ein Meister in dieser Disziplin, ein schmieriger Populist, der den Wählern nach dem Mund redete, seit Jahren um den Job des Ministerpräsidenten buhlte und jeden Posten, den er ergattern konnte, als das Sprungbrett zum ersehnten Karriereziel ansah.
Vor der Tür ihres Bürovorzimmers blieb Susanne Bergstedt stehen. »Bringen Sie das in Ordnung. Ich brauche keine Angstmacher aus München, die um ihre Wählerstimmen fürchten. Ich will, dass die Initiative bei uns bleibt. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist viel zu wichtig, um ihn dem innenpolitischen Gezappel der Bayern zu überlassen.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sich die Kanzlerin um und ließ den Innenminister im Gang stehen.
Ihre Büroleiterin erwartete sie bereits. Bea Traub war seit mehr als dreizehn Jahren ihre rechte Hand und einer der wenigen Menschen, denen Susanne Bergstedt wirklich vertraute. Dankend nahm sie die Tasse, die ihr Bea Traub reichte, und lauschte, am Tee nippend, dem knappen Bericht, mit dem ihre Büroleiterin die wichtigsten Nachrichten der vergangenen dreißig Minuten referierte. Die Kanzlerin delegierte die Aufgaben zügig, es reichte eine halbe Tasse Darjeeling, dann hatten sechs Abteilungen eine neue Aufgabe, und eine Armada von Menschen würde sich daransetzen, die strategischen Überlegungen der Kanzlerin mit Fakten und Inhalten zu füttern, als Basis für eine endgültige Entscheidung.
Der Kanzleramtsminister saß wartend in einem der Besuchersessel und deutete an, aufzustehen, als die Kanzlerin den Raum berat. Sie winkte ab, zog sich einen Stuhl heran und setzte sich ihm gegenüber. Erwartungsvoll schaute sie ihn an.
Lars Steiner war einer der wenigen unabhängigen Geister, die Susanne Bergstedt um sich herum erlaubte. Nach dem Desaster mit dem vorherigen Innenminister war die Kanzlerin dazu übergegangen, die zentralen Posten der Regierung und des Parteiapparates mit Menschen zu besetzen, die nicht brillant waren, dafür aber solide arbeiteten und ihr nicht gefährlich werden konnten. Überraschungen brauchte sie nicht, insbesondere nicht in der Innenpolitik, die Welt draußen war unberechenbar genug. Bei Steiner machte sie eine Ausnahme. Der Chef des Kanzleramtes war nicht berechenbar, er hatte, wusste die Kanzlerin, das Potenzial, ihr den Posten an der Spitze der Partei streitig zu machen. Aber noch war er nicht so weit, bisher agierte er effektiv und im Hintergrund, und er verhielt sich loyal, so wie er es ihr bei seiner Berufung versprochen hatte.
»Also? Wie sieht es aus?«
Steiner schüttelte den Kopf. »Keine neuen Informationen von den Partnerdiensten. Sie wissen nur, dass ein terroristischer Angriff unmittelbar bevorsteht. Aber nicht, wo.«
Susanne Bergstedt verschränkte ihre Hände ineinander. Selbst hier, in der Sicherheit ihres Büros, erlaubte sie sich nicht, emotional auf Situationen wie diese zu reagieren. Gefühle zogen Energie ab, sie raubten dem rationalen Denken den Raum, und das war das Letzte, was passieren durfte.
Hatten sie irgendetwas vergessen? Hatten sie irgendeinen Punkt übersehen?
Steiner kam ihr zuvor. »Wir haben getan, was wir tun konnten.« Die Ausstattung der Terrorabwehr sei auf dem geplanten Stand, referierte er, eine Ausweitung würde den übrigen Sicherheitsapparat noch weiter schwächen, mehr, als es schon jetzt der Fall war. »Wenn die Innenminister der Länder ihre Zusagen einhalten, dann haben wir einen effektiven Schutzwall gegen mögliche weitere Attentate aufgestellt.«
Ungeduldig unterbrach die Kanzlerin Steiners Vortrag. Sie wusste, was sie getan hatten, und brauchte keine bestätigende Rede, die ihr keine neuen Fakten brachte. Nachdenklich stand sie auf, ging ein paar Schritte, dann wandte sie sich zu Steiner um. »Halten Sie engen Kontakt zu Wachoviak. Der Innenminister soll mich sofort informieren, wenn etwas passiert. Und die Fachabteilungen sollen die Liste der möglichen Gefährder noch einmal durchgehen. Ich will nicht noch einmal ein Attentat wie das auf dem Alexanderplatz erleben und hinterher verkünden müssen, dass wir die Täter längst kannten.«
Der Kanzleramtsminister erhob sich und verließ das Büro.
Für einen Moment stand Susanne Bergstedt stumm im Raum, nachdem der Minister die Tür hinter sich geschlossen hatte.
Ihr ungutes Gefühl blieb, obwohl sie wusste, dass Steiner recht hatte: Sie hatten getan, was sie konnten.
»Frau Bergstedt?« Bea Traub streckte ihren Kopf durch den Türspalt. »Ihr Termin beim Bundespräsidenten.«
Susanne Bergstedt nickte. Zwar hatte sie den Präsidenten selbst in sein Amt gehoben, aber er war jetzt der erste Mann im Staat und verdiente deshalb Respekt. Sie würde pünktlich sein.
3
Es war still in den Straßen, als sich die Schranke hinter seinem Wagen gesenkt hatte und er den Hügel hinauffuhr. Obwohl die Sonne hinter der Wolkendecke noch über dem Horizont stehen musste, waren die Villen links und rechts der Allee hell erleuchtet, angestrahlt von versteckten Scheinwerfern, die den Reichtum der Besitzer illuminierten und den nassen Schnee auf den Büschen und Bäumen hell erstrahlen ließen. Seligs Haus auf der Kuppe war eines der wenigen, das nicht in der Dämmerung leuchtete, es duckte sich wuchtig und dunkel unter die mächtigen Eichen, die das Grundstück auf der Straßenseite säumten und mit ihren ineinander verwobenen Baumkronen auf Besucher wie ein Bollwerk wirkten.
Selig parkte den Wagen auf dem Grundstück vor dem Eingang, dann schwenkte er das rostige Tor wieder vor die Einfahrt. So wie immer, nutzte er nicht den säulenbewehrten Haupteingang, um die Villa zu betreten, sondern ging um das Haus herum zur hinteren Tür, die in die Küche führte, den gemütlichsten Platz im Haus und Ort guter Kindheitserinnerungen. Marga hatte ihr Zimmer hier im Anbau der Villa gehabt, Tante Marga, ihr Kindermädchen, und in den Nächten, in denen er schlecht geträumt hatte, war er zu ihr gelaufen und in ihr Bett geklettert. Seine Schwester war stets eifersüchtig gewesen, wenn seine Bettdecke am Morgen kalt und klamm auf dem zerwühlten Laken lag.
Doch anders als sonst fühlte sich Selig nicht zu Hause und angekommen, als er Tante Margas einstiges Reich betrat. Diesmal schien die bleierne Schwere, die über den Räumen des Erdgeschosses lag, bis in den Küchenanbau zu reichen. Selig zögerte. Kurz entschlossen, ohne seine Jacke auszuziehen, kochte er sich einen Kakao und füllte ihn in einen dickwandigen Becher. Das dampfende Gefäß in der Hand, verließ er das Haus und stapfte durch den Schnee den Hang hinunter, bis er am Steg stand und über den See blicken konnte.
Nur noch wenige Schneeflocken tanzten durch die Luft. Die Wolkendecke, die auf der Stadt gelastet hatte, war etwas lichter geworden, der rötliche Schein der Sonne ließ sie von innen aufglühen. Selig blieb am Seeufer stehen und blickte in den Abendhimmel. Die Tasse in seiner Hand wärmte seine Finger, und der süße Duft stieg in seine Nase. Der Kakao erinnerte ihn an Tante Marga, so wie er es sich erhofft hatte, und das Gefühl vertrieb die Kälte, auch jene in seinen Gedanken.
Selig musste an Maria denken. Sie meinte es gut mit ihm, das spürte er. Er verstand selbst nicht, wieso er sie immer wieder brüskierte. Er dachte an die Momente zurück, in denen sie sich nahe gewesen waren. Verblüffenderweise, überlegte Selig, waren das genau jene Augenblicke gewesen, in denen er sich am verletzlichsten gefühlt hatte. Eigentlich Momente wie heute.
Bedrückt wandte er sich um und sah zum Haus hinauf. Dunkel und verlassen thronte die Villa auf der Hügelkuppe.
Seine Finger tasteten nach dem Telefon in seiner Tasche. Er bräuchte sie nur anzurufen.
Und dann? Was sollte er ihr sagen?
Selig schloss die Augen und schüttelte sich innerlich. Er würde, sagte er sich, jetzt zur Villa gehen, die Küche betreten und dann in der dunklen Halle am Arbeitszimmer seines Vaters vorbei hinauf in den ersten Stock steigen. Dort lebte er mit seinem Sohn, es war ein ganz normaler Tag, er war erwachsen, und die Ereignisse seiner Kindheit lagen weit zurück. Sie hatten ihren Platz in seinem Leben gefunden. Nur weil sich ein Datum auf einem Kalender jährte, würde er sich nicht den dunklen Gedanken hingeben, die mit der Dämmerung aus dem See krochen und ihn zu fassen suchten. Der Tod seines Vaters war allein die Sache seines Vaters gewesen, und niemand außer ihm trug die Verantwortung für das, was hier im Haus geschehen war.
Ein leises Tuckern schallte über den See, ein mit Lichtpunkten durchsetzter Schatten näherte sich, es war eines der Ausflugsschiffe, die auch jetzt im Winter über den Wannsee fuhren und Berlintouristen zum Eventgasthof am anderen Seeufer brachten. Wie auf Kommando brach die Wolkendecke auf, die tief stehende Sonne erhellte die Wasseroberfläche und das Seeufer, eine perfekte Illumination für die Urlauber, die im Bauch des Schiffes vorglühten.
Ein Lichtblitz auf dem dunklen Oberdeck des Schiffes ließ Selig stutzen. Etwas hatte das Licht der Sonne reflektiert, vielleicht das Glas eines Objektivs oder das eines Feldstechers. Selig starrte zum Schiff hinüber. Stand dort jemand und beobachtete ihn? Im Abendlicht war jetzt schemenhaft eine Gestalt auf dem dunklen Aussichtsdeck des Schiffes zu erkennen. Erneut blinkte etwas auf, ein Lichtreflex, war sich Selig jetzt sicher. Jemand machte ein Foto. Von ihm?
Selig musste über sich selbst lachen. Warum sollte jemand seinetwegen dort draußen in der Dunkelheit stehen? Das war wahrscheinlich ein Tourist, der den Abendhimmel fotografierte. Dort oben schnappte jemand nach Luft so wie er hier am Seeufer.
Selig trank den letzten Schluck seines Kakaos und wandte sich zum Haus um. Im Licht der Abendsonne wirkte es dunkel, aber nicht mehr bedrohlich. Selig atmete tief durch und stapfte durch den knirschenden Schnee entlang seiner Fußspuren zurück den Hügel hinauf.
Wütend knallte Maria die Tür zu und ließ sich auf ihren Schreibtischstuhl fallen. »Hast du sein Gesicht gesehen? Der hat gegrinst wie eine Katze, der man einen Hering hinlegt.«
»Katzen grinsen nicht. Das müsstest du doch wissen.« Wagner öffnete das Seitenfach seines Schreibtisches und holte die Box mit den Teedosen hervor. Er wählte sorgfältig, griff sich schließlich den Behälter mit der ayurvedischen Kräuterteemischung. »Soll ich dir auch einen machen? Schätze, du kannst ihn gebrauchen.«
Maria fauchte unwillig: »Glaubst du wirklich, mir ist nach Teetrinken, wenn die Kollegen ein Stockwerk tiefer die Champagnerkorken knallen lassen? Wir haben denen Schrader auf dem Silbertablett serviert! Den meistgesuchten Wirtschaftsbetrüger der letzten Monate! Selbst Interpol wird aufhorchen, wenn man ihn festnimmt.«
»Was regst du dich so auf?« Wagner tat, als verstünde er Marias Reaktion nicht.
»Schrader war seit Jahren abgetaucht! Und wer hat ihn gefunden? Wir! Und die anderen ernten die Lorbeeren.«
»Von Lorbeeren kannst du dir auch nichts kaufen.«
Maria fuhr herum. Wütend starrte sie Wagner an. »Sag mal, wie blöd bist du eigentlich?«
»Hey, das reicht jetzt!«
Doch Maria war viel zu erbost, um sich zurückzuhalten. »Hast du überhaupt mal eine Sekunde lang nachgedacht? Was, glaubst du, sehen die Leute außerhalb unserer Abteilung? Dass wir monatelang die Arbeit machen? Oder dass die anderen mit großem Auftritt die Zielpersonen festnehmen? Denkst du, Brennauer stellt sich hin und sagt, ich bin nur der Handlanger und arbeite im Auftrag von Selig und seinem Team? Der heftet sich selber den Orden an die Brust! Und wir dürfen zusehen.«
»Du weißt doch, wie Selig tickt.«
»Ja, und ich weiß auch, wie das Haus hier funktioniert! Sieh dir mal die anderen Leiter der Kommissariate an. Die achten sorgfältig darauf, dass bekannt wird, wie gut sie arbeiten. Weil das ihren Job erhält. Von uns weiß niemand, was wir tun.«
Wagner hatte Wasser in den Kocher gefüllt, das Gerät begann leise zu rauschen. »Selbst wenn du recht hast, ist es vollkommen sinnlos, hier wie Rumpelstilzchen rumzuhüpfen und sich zu ärgern. Selig ist, wie er ist. Leb damit, oder geh.«
»Was soll denn der Spruch?« Maria funkelte Wagner ärgerlich an.
»Ist doch so. Du kannst Selig nicht ändern. Der ist ein einsamer Wolf. Und Wölfe heulen gern alleine den Mond an. Du kannst froh sein, dass er überhaupt mit dir redet.«
Irritiert bemerkte Maria, wie ihr Wagners Worte einen Stich versetzten. Sie wusste, dass Wagner im Grunde recht hatte, und doch wehrte sich etwas in ihr, seine Äußerung unkommentiert stehen zu lassen. »Wölfe sind Rudeltiere.«
»Ja, nur weiß Selig nichts davon. Vergiss ihn einfach und mach deinen Job. Es gibt wirklich genug andere Dinge, über die man nachdenken kann.«
»Nachdenken! Dass du so ein Wort überhaupt kennst.«
Wagner ließ Marias Spott an sich abperlen. »Das Leben ist zu kurz, um sich zu ärgern. Da werde ich nicht heute damit anfangen.« Entspannt nahm er den dampfenden Kocher vom Sockel und goss den Tee auf. Brodelnd wirbelte das Wasser die grob zerriebenen Blätter herum. Ein süßlich herber Duft stieg auf. Wagner seufzte genießerisch, beugte sich über die Kanne und sog mit geschlossenen Augen die Luft durch seine Nase.
Maria betrachtete ihn ärgerlich. Es war einer der Momente, in denen Wagner sie zur Weißglut brachte, und ihre Wut kochte umso höher, je entspannter er sich gab. Sie selber war anders. Ihre spanischen Wurzeln ließen sie laut sein, sie kämpfte für die Dinge, die sie wichtig fand, und immer wieder kam es vor, dass sie mit ihrer offenen und direkten Art Kollegen irritierte oder gar verletzte. Wagner und sie, das waren weit voneinander entfernte Pole, verbunden durch ihren Job, doch in fast allen Dingen komplett unterschiedlich.
Und trotzdem: Obwohl Wagner sie aufregte, wünschte sich Maria manchmal, sich ein Stück von ihm abschneiden zu können. Auch wenn seine Entspanntheit von einer satten Portion Desinteresse am Leben anderer Menschen herrührte, beeindruckte Maria immer wieder, mit welcher Nonchalance Wagner Probleme weglächelte und sie tatsächlich zu vergessen schien. Der wichtigste Mensch im Leben Wagners war er selbst, dann kamen sein britischer Sportwagen und seine Sammlung ausgesuchter Tees und dann lange nichts. Maria wusste nicht, ob es etwas gab, das Wagner wirklich etwas bedeutete.
Sie stand auf und nahm schweigend die Teetasse, die er ihr reichte. Vorsichtig roch sie an der heißen Flüssigkeit. Die ätherischen Öle legten sich beruhigend auf die Schleimhäute ihrer Nase.
Maria seufzte. Wieso ging ihr Selig nicht aus dem Kopf? Sie fühlte sich zu ihm hingezogen, obwohl er überhaupt nicht dem Bild des Prinzen entsprach, von dem sie als Jugendliche immer geträumt hatte und der sie aus dem Haus ihrer Eltern hatte retten sollen, auf einem weißen Pferd und einem Sonnenuntergang entgegenreitend. Der Prinz war nicht gekommen, Maria hatte sich selbst retten müssen, und vielleicht hatte genau das ihre Seele geöffnet und ihr die Fähigkeit gegeben, hinter die Fassaden der Menschen zu schauen und Wertvolles zu entdecken, auch wenn die Oberfläche nicht glänzte wie bei ihrem Kollegen Wagner. Selig war still, aber nicht leer wie viele andere, er war manchmal ängstlich, aber empfindsam und empathisch, er war unsicher, aber zugleich auf eine beeindruckende Weise gradlinig und selbstbewusst. Hatte Selig ein Ziel ins Auge gefasst, steuerte er es an, koste es, was es wolle, selbst wenn der Preis seine eigene Gesundheit, vielleicht sogar sein Leben sein sollte. So als wäre er ein verkleideter Prinz, der aus dem Schutz der Unscheinbarkeit heraus für die gute Sache kämpfte. Und manchmal blitzte die glänzende Rüstung durch die unscheinbare Hülle hindurch; Maria hatte es selbst erlebt während ihrer gemeinsamen Arbeit, und es hatte sie fasziniert.
Doch wenn sie ehrlich zu sich war, kannte sie Selig trotz der gemeinsamen Jahre genauso wenig wie Wagner oder die anderen Kollegen in den Nachbarbüros. Sie wusste, dass er geschieden war und sein inzwischen achtzehnjähriger Sohn bei ihm wohnte. Sie wusste, dass Selig in einem Haus direkt am Wannsee lebte, eine heruntergekommene Villa, in der er mit seiner Zwillingsschwester aufgewachsen war und die viele Jahre leer gestanden hatte, bis Selig mit seinem Sohn dort eingezogen war. Selig erzählte nur sehr selten davon, was während seiner Kindheit in dem Haus geschehen war, doch Maria war sich sicher, dass es ihn bis heute prägte und belastete.
Nachdenklich trank sie den heißen Tee.
Sollte sie sich darüber ärgern, dass sie so viel über Selig nachdachte? Er war ein Kollege, nichts weiter, und er lebte sein eigenes Leben, und genau an dem Punkt könnte sie aufhören, sich über ihn Gedanken zu machen. Aber dass er sie ärgerte, zeigte ihr, dass er ihr nicht egal war. Wobei: Auch Wagner ärgerte sie, und bei ihm war sie sich sicher, dass sie keine Lust hatte, länger als nötig über ihn nachzusinnen.
Marias Telefon klingelte, Wagner ging an den Apparat. Er horchte in den Hörer und versprach, die Nachricht seiner Kollegin auszurichten. Als er aufgelegt hatte, sah er sie neugierig an: »Der Polizeipräsident will dich sprechen. Hab ich irgendetwas verpasst?«
Maria setzte sich auf. Sie war genauso erstaunt wie Wagner. »Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen.« Sie trank einen letzten Schluck und gab ihm die Tasse zurück. »Danke. Von Tee hast du echt Ahnung.«
»Nicht nur von Tee. Ich hab auch für andere Dinge ein Händchen.« Er zwinkerte ihr zu.
Maria runzelte die Stirn »War das etwa ein Anmachspruch?«
»Wie lautet die richtige Antwort?«
»Ich denke, das weißt du.«
»Ich würde niemals wagen, dich anzumachen.«
Maria lächelte zufrieden. »Siehst du? Das ist der Beweis. Menschen können sich ändern. Selbst du.«
Wagner lachte. »Menschen sind lernfähig, selbst ich. Wer sich einmal an einer heißen Herdplatte verbrannt hat, fasst nicht noch einmal drauf.« Er ging zur Tür und öffnete sie für Maria. »Na los, Señorita, beeil dich. Den Chef lässt man nicht warten.«
Mit einem leisen Brummen setzte die Pumpe ein und drückte das perfekt temperierte Wasser durch das frisch gemahlene Kaffeemehl. Ein feinherber Duft breitete sich im Raum aus. Der Polizeipräsident wartete geduldig, bis die beiden Espressotassen zu einem Drittel gefüllt waren und die Pumpe sich abschaltete. Tropfend versiegte der Kaffeestrahl.
»Zucker?«
Maria schüttelte den Kopf.
Der Polizeipräsident reichte Maria eine der Tassen und stellte sich selbst die zweite bereit. Dann ließ er sich in seinen Schreibtischsessel fallen. Er schnupperte an seinem Espresso, trank genussvoll einen Schluck und betrachtete Maria über den Rand der Tasse hinweg.
»Mögen Sie Ihren Beruf?«
Maria überraschte die Frage. Sie hatte mit allem gerechnet: mit Lob für ihren Erfolg oder mit Tadel über Seligs Umgang damit, einem Auftrag für ihre Ermittlungsgruppe oder einem Angebot, auf eine neue Stelle in eine andere Abteilung zu wechseln.
Sie runzelte die Stirn. »Sie meinen, ob ich zufrieden bin mit meiner Position?«
»Nein. Mich interessiert, ob Sie gerne Polizistin sind.«
Maria überlegte kurz. »Ja. Ich mag meinen Beruf.«
»Und warum?«
Erneut zögerte Maria. Sie musste sich eingestehen, über diese Frage noch niemals wirklich nachgedacht zu haben. Polizistin zu sein war schon als Kind ihr sehnlichster Berufswunsch gewesen, und ihre Arbeit als Kommissarin war, abgesehen von der nervigen Schreibarbeit, für sie perfekt. »Die Mischung macht es. Eine anspruchsvolle Aufgabe, viel Abwechslung, berufliche Sicherheit, gesellschaftliche Anerkennung.« Sie zögerte kurz, dann ergänzte sie: »Die Arbeit mit netten und fähigen Kollegen.«
Der Polizeipräsident nahm den Ball, den sie ihm zuwarf, auf.
»Sind Ihre Kollegen fähig?«
»Das wissen Sie doch. Selig hat gerade Schrader aufgespürt.«
»Matthias Schrader?« Der Präsident stutzte und suchte mit seinem Blick seinen Schreibtisch ab. »Ich dachte, Brennauer und sein Team nehmen ihn fest.«
»Nachdem Selig, Wagner und ich die ganze Arbeit gemacht haben.«
Der Polizeipräsident fand, was er suchte: eine kleine handgeschriebene Notiz. »Hier steht nichts von Selig.«
»Das kann ich mir denken.« Maria war ärgerlich. »Brennauer ist gut darin, sich die Erfolge anderer an seine Brust zu heften.« Sie berichtete dem Polizeipräsidenten von ihrer Arbeit in den vergangenen fünf Monaten, die mit der Verhaftung Schrader in diesen Stunden abgeschlossen wurde.
Nachdenklich legte der Polizeipräsident die Notiz auf die Schreibtischplatte und lehnte sich zurück. »Sie meinen also, dass Selig ein guter Ermittler ist?«
»Ja, natürlich. Und Sie wissen das auch.«
Der Präsident seufzte. »Natürlich weiß ich, dass Selig gut ist. Das hat er in der Vergangenheit oft genug bewiesen.«
Maria musterte den Polizeipräsidenten prüfend. »Das ist ein Aber-Satz.«
Der Polizeipräsident musste lachen. »Ja, Sie haben recht. Es gibt ein Aber.«
»Und das lautet?«
»Wir müssen sparen.«
Maria runzelte die Stirn. »Was hat das mit uns zu tun?«
»Mir sitzt der Innensenator im Nacken. Ich muss Stellen einsparen. Führungspositionen. Der Senator will gemeinsam mit seinen Länderkollegen den Kampf gegen den internationalen Terrorismus intensivieren.«
»Und dazu braucht er Seligs Stelle.«
»Soll ich Brennauers Abteilung dichtmachen? Nachdem er Schrader verhaftet hat, den meistgesuchten Wirtschaftsverbrecher der letzten Jahre?«
»Ich dachte, es kommt darauf an, was man leistet, und nicht darauf, wie man sich darstellt.« In ihrem Ärger hatte ihre Stimme mehr Schärfe, als Maria es eigentlich wollte.
Der Polizeipräsident seufzte erneut. »Ich schätze Sie, Frau Fernandez. Ihr Einsatz mit dem Jungen aus dem Brandhaus war sehr unkonventionell, aber hat uns gute Presse gebracht.« Er lächelte entschuldigend, als er ihre gerunzelte Stirn sah. »Ab einer bestimmten Position kommt es nicht mehr nur darauf an, was passiert, sondern auch, wie es in der Öffentlichkeit wirkt.«
»Und da ist Selig nicht sehr erfolgreich.«
»Nicht mehr, nein. Ich denke, seine Zeit ist gekommen. Sprechen Sie mit ihm. Ich könnte mir eine Übergangsregelung bis zum Vorruhestand vorstellen. Dann kann er ungestört seinen Interessen nachgehen. Ich zähle auf Sie, Frau Fernandez, ich möchte die ganze Angelegenheit ruhig über die Bühne bekommen. Es wird nicht zu Ihrem Schaden sein.«
Maria schwieg, während sich ihre Gedanken überschlugen. Sie wusste, es war sinnlos, mit dem Polizeipräsidenten zu diskutieren. Sie konnte es sich sparen, ihn darauf hinzuweisen, dass Selig einer der klügsten Köpfe war, den die Berliner Kriminalpolizei hatte, oder dass es absolut idiotisch und uneffektiv wäre, ihn freizustellen, mehr als zwnazig Jahre vor dem Ende seiner regulären Dienstzeit, nur weil die Übergangsgehälter und Vorruhestandszahlungen aus einem anderen Budget gespeist wurden als das für die Gehälter der Führungskräfte.
Der Polizeipräsident sprach weiter. »Ich weiß, dass Sie das nicht verstehen. Aber es ist ganz einfach. Ich muss fünf Führungspositionen frei machen für die neue Behörde. Also greife ich dort ein, wo es am wenigsten wehtut.«
Maria nickte schweigend.
»Also? Kann ich mich auf Sie verlassen?« Der Polizeipräsident stand auf, als Zeichen, dass das Gespräch beendet war.
Auch Maria erhob sich. »Geben Sie mir drei Wochen.«
»Wofür?«
»Sie möchten doch, dass die Sache geräuschlos über die Bühne geht. Überzeugungsarbeit braucht Zeit.«
Der Polizeipräsident musterte sie nachdenklich. »Ich gebe Ihnen drei Tage. Dann will ich Seligs Gesuch auf dem Tisch haben, den Polizeidienst zu verlassen.«
Maria zwang sich zu einem Lächeln. »Ich werde sehen, was ich tun kann.«
4
Sein Telefon klingelte, als Selig gerade aus der Dusche kam. Mozarts erstes Hornkonzert füllte die Räume im ersten Stockwerk der Villa, Selig hatte die CD eingelegt, bevor er ins Bad gegangen war. Musik half ihm dabei, sich im Hier und Jetzt zu fühlen, sie verdrängte die drückende Stille und verlieh den Räumen, die er sich im ersten Stock der Villa zurechtgemacht hatte, eine heimelige Atmosphäre fernab der Vergangenheit, die in diesem Haus immer präsent war.
Selig nahm das Gespräch an, während er in sein Wohnzimmer eilte und die Lautstärke der Hi-Fi-Anlage herunterregelte. Er freute sich, als er die Stimme seines Sohnes erkannte. »Tobias! Ist alles in Ordnung?«
Tobias’ Stimme klang verlegen. »Na ja … eigentlich schon.«
»Was heißt eigentlich? Du wolltest doch heute Abend hier sein.«
»Wollte ich ja auch. Ich bin auch fast da. Wir stehen am Spandauer Damm.« Tobias berichtete, dass sie mit ihrem Transporter liegen geblieben waren. »Wir brauchen deine Hilfe.«
»Wir?«
»Ich und ein paar Kumpels. Kannst du kommen? Du musst uns abschleppen.«
Selig fand die Vorstellung, nachts und auf schneeglatter Straße einen fahrunfähigen Wagen durch die Stadt zu ziehen, nicht sehr verlockend. »Soll ich nicht lieber ein Abschleppunternehmen anrufen?«
»Genau das wollen wir nicht.« Tobias zögerte. »Unsere Ladung ist … sensibel.«
Selig horchte auf. »Gibt es da etwas, das ich wissen muss?«
»Nein. Frag nicht. Du weißt, was wir tun.«
Tatsächlich wusste Selig ziemlich genau, in welchen Kreisen sein Sohn verkehrte, seit Tobias und seine Freunde ihm geholfen hatten. Selig hatte sie nicht verraten, und dieser Vertrauensbeweis hatte ihn mit seinem Sohn enger zusammenrücken lassen – so eng es mit einem achtzehnjährigen freiheitsliebenden Dickkopf überhaupt möglich war.
»Okay. Ich komme.«
»Bitte mach schnell!«
Selig versprach es.
Der Schneepflug des privaten Serviceunternehmens schob gerade den Graupel von den Straßen der Siedlung, als Selig das Haus verließ und das Tor zur Straße aufzog. Der Schlepper näherte sich mit dröhnendem Motor und holperte rumpelnd über eine Bordsteinkante, während er den Schneematsch von der Fahrbahn kratzte. Selig wartete, bis der Pflug das Haus passiert hatte, dann startete er den Wagen und fuhr den Hügel hinab zur Ausfahrt der bewachten Wohnanlage.
Selig war als einer der wenigen Hausbesitzer dagegen gewesen, die Villensiedlung am Ufer des Wannsees einzuzäunen und von einem privaten Unternehmen überwachen zu lassen. Doch obwohl an diesem Ort noch nie etwas Bedrohliches geschehen war, fürchtete die Mehrheit um ihre Sicherheit, und da viele der Bewohner in Politik und Gesellschaft Einfluss hatten, war das Gebiet am Südwestrand der Stadt eines der ersten gewesen, die aus der Hoheit der Stadtverwaltung herausgenommen und der privaten Obhut der Bewohner übergeben worden waren. Inzwischen hatte Selig sich daran gewöhnt, hinter Gittern zu leben. So sehr anders als vorher, fand er, war das Gefühl ohnehin nicht.
Der Wachmann an der Pforte schaltete seine Taschenlampe ein und leuchtete in den Wagen, als Selig stoppte. Geblendet blinzelte Selig in das Licht. Der Uniformierte erkannte ihn, tippte mit dem Finger an den Schirm seiner Mütze und ging in das Wachhäuschen, um die Schranke zu öffnen. Mit einem leisen Summen hob der Elektromotor die stahlverstärkte Absperrung an und machte den Weg frei.
Selig passierte die Ausfahrt. Er war in Gedanken bei dem Telefonat mit Tobias und fragte sich gerade, ob sein Versprechen, ihm und seinen Freunden zu helfen, wirklich eine gute Idee gewesen war. Egal, wie sinnvoll er fand, was Tobias’ Freunde taten, und egal, wie sehr er selber von ihrer Arbeit profitiert hatte: Es war illegal, was die Gruppe trieb, und ihnen in seinem Haus Unterschlupf zu gewähren war nicht ohne Risiko. Denn dass Tobias mit seinen Freunden nicht zu ihm kam, um zu chillen oder eine Party zu feiern, war Selig klar.
Selig bemerkte nicht die Limousine, die aus einer Parklücke am Straßenrand glitt und ihm nachfuhr.
Wenig später hatte er die Avus erreicht. Er beschleunigte seinen Wagen und wollte ihn gerade auf die Fahrbahn lenken, als er sah, dass sich mit hohem Tempo zwei Sportwagen näherten, nebeneinander, beide Spuren der schnurgeraden Autobahn nutzend. Schneematsch aufwirbelnd, rasten die Wagen heran. Im Bruchteil einer Sekunde begriff Selig, dass ein Unfall unvermeidlich wäre, würde er jetzt seinen Wagen auf die Autobahn lenken. Er riss das Steuer herum und bremste abrupt, der Wagen schlitterte mit hämmerndem Antiblockiersystem, Selig hielt ihn mit Mühe in der Spur, bis er am Ende der durch ein Baustellenschild begrenzten Beschleunigungsspur stoppte. Mit heulenden Motoren kamen die beiden Sportwagen näher. Auch die Limousine, die ihm seit der Siedlung gefolgt war, näherte sich jetzt schnell. Selig sah im Rückspiegel zwei Scheinwerfer rasch größer werden, schaltete eilig die Warnblinkanlage an und presste in Erwartung des Aufpralls seinen Kopf gegen die Kopfstütze.
Doch kurz bevor die Limousine auffuhr, riss der Fahrer hinter ihm sein Lenkrad nach links. Mit aufheulendem Motor schoss das schwere Fahrzeug an Seligs Wagen vorbei auf die Fahrbahn der Avus, genau in dem Moment, als die beiden das Rennen ausfahrenden Autos an ihnen vorbeirasten. Knirschend touchierte der vordere Kotflügel der Limousine das Heck eines der beiden Sportwagen. Das tiefergelegte Coupé schleuderte herum und rotierte wie ein Kreisel auf der abgestreuten, aber immer noch glatten Fahrbahn. Selig hielt den Atem an. Schneematsch zur Seite fegend, schlitterte der Sportwagen weiter, verfehlte dabei wie durch ein Wunder sowohl seinen davonrasenden Renngegner als auch die Leitplanken am Straßenrand und kam hundert Meter weiter entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.
Einen Moment saß Selig regungslos hinter dem Steuer und starrte auf die Szene, unfähig, zu reagieren. Dann merkte er, dass er noch immer die Luft anhielt. Er atmete aus und zwang sich, seine Hände vom Lenkrad zu lösen, um das mobile Blaulicht unter dem Sitz hervorzuholen und auf das Wagendach zu stellen. Das blaue Flackern gab der Szenerie den dramatischen Anstrich, den sie verdiente. Vorsichtig lenkte Selig sein Auto auf die Fahrbahn und stoppte hinter der Limousine, die still und mit abgeblendeten Scheinwerfern auf der rechten Fahrspur stand.
Der Sportwagen wendete eilig, als das Blaulicht aufflammte, und verschwand mit durchdrehenden Reifen in der Dunkelheit.
Selig schaltete den Motor ab und stieg aus, lief zur Limousine und klopfte an das Fenster. Der Fahrer, ein alter Mann mit schneeweißen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren, drehte den Kopf und sah zu ihm herauf.
»Ist alles klar mit Ihnen?«
Der Alte kurbelte die Scheibe herunter. Selig wiederholte seine Frage. Der Alte nickte.
»Lenken Sie Ihren Wagen auf die Seite. Wir müssen die Fahrbahn frei machen.«
Der Alte nickte erneut und ließ den Motor an.
Die ersten Wagen stauten sich hinter ihnen und passierten mit niedrigem Tempo die Unfallstelle. Auch auf der Gegenfahrbahn verlangsamte sich der Verkehr, Selig sah die neugierigen Blicke der Gaffer, die auf eine Sensation hofften und fast enttäuscht schienen, dass nicht mehr passiert war.
Der weißhaarige Fahrer war schon ausgestiegen und stand an der Leitplanke, als Selig hinter dem Unfallwagen auf dem Standstreifen stoppte. Schweigend starrte der Alte auf den vorbeifahrenden Verkehr. In weißen Wolken stieg sein Atem in die Nacht. Dem Schaden, den der Unfall an seinem betagten, aber gepflegten Wagen hinterlassen hatte, widmete er keinen Blick.
Selig betrachtete den Fahrer genau. Der Mann wirkte ruhig, fast entspannt, so als mache er eine Pause am Straßenrand. Kein Zittern verriet einen Schock, kein Zucken die innere Anspannung. Doch Selig wusste, die Ruhe konnte täuschen.
»Geht es Ihnen gut?«
Der Weißhaarige nickte. »Ist das nicht absurd? Eine Sekunde früher, und alles wäre vorbei gewesen.« Er suchte Seligs Blick. »Alles, wofür ich mein Leben lang gekämpft habe, bis zu diesem Moment. Nur weil zwei Idioten ein Rennen fahren.«
Selig wusste nicht, was er antworten sollte. »Kommen Sie, ich fahre Sie in ein Krankenhaus.«
»Das ist nicht nötig.«
»Sind Sie sich sicher?«
»Natürlich. Es ist ohne Bedeutung.«
»Das sehe ich anders. Wir sichern Ihren Wagen, und dann kommen Sie mit mir.«
Fast unwillig wehrte der Weißhaarige die Aufforderung ab. »Glauben Sie mir, ich weiß, was für mich gut ist. Und das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein Krankenhaus.«
»Dann bringe ich Sie zur nächsten Polizeidienststelle. Die Kollegen können alles aufnehmen, für Ihre Versicherung.« Selig warf einen Blick auf den eingedrückten Kotflügel. Die Achse schien unversehrt, die massive, um die Wagenkante herumgezogene Stoßstange der Limousine hatte die Wucht des Aufpralls abgefangen.
»Nein, danke, ich möchte das nicht.« Die Stimme des Alten klang bestimmt.
»Aber Sie müssen das melden.«
»Ich gehe morgen zur Polizei«, entgegnete der Weißhaarige. »Aber jetzt würde ich gerne weiterfahren.«
Selig spürte, er würde den Fahrer nicht umstimmen können. Kurz überlegte er, selbst Meldung zu machen, aber etwas in der Stimme des Alten ließ ihn zögern. Schließlich griff er in seine Jackentasche und holte eine Visitenkarte hervor. »Geben Sie den Kollegen meinen Namen, wenn Sie Anzeige erstatten. Dann kann ich eine Zeugenaussage abgeben.«
Der Alte nahm die Karte und blickte darauf. »Paul Selig …«
»So heiße ich, ja. Sie versprechen mir, morgen zur Polizei zu gehen?«
Der Weißhaarige nickte.
»Gut. Dann passen Sie auf sich auf. Und fahren Sie vorsichtig.« Selig nickte dem Alten ein letztes Mal zu, bevor er zurück zu seinem Wagen ging und das Blaulicht ausschaltete. Dann startete er den Motor und fuhr auf die Autobahn, vorbei an dem Weißhaarigen, der ebenfalls wieder eingestiegen war.
Im Rückspiegel sah Selig die Limousine noch am Rand der Autobahn stehen. Für einen Moment dachte er darüber nach, ob es ein Fehler gewesen war, den Alten dort zurückgelassen zu haben. Dann verschluckte der stärker werdende Verkehr die beiden leuchtenden Punkte am Straßenrand, und Selig konnte die Scheinwerfer des Unfallwagens nicht mehr von denen der anderen Autos unterscheiden.
Der Weißhaarige saß hinter dem Lenkrad seiner Limousine und blickte auf die Visitenkarte in seiner Hand. Er rührte sich nicht, war in Gedanken, wie erstarrt. Erst als ein Wagen hinter ihm anhielt und den Warnblinker einschaltete, kam Leben in den Alten. Sorgfältig verstaute er die Karte in seiner Hosentasche und ließ den Motor an. Vorsichtig, den Verkehr im Rückspiegel beobachtend, fuhr er an und lenkte die Limousine zurück auf die Fahrspur der Autobahn.
5
Selig verließ die Avus kurz hinter dem Funkturm, um auf den Spandauer Damm hinunterzufahren. Er war nachdenklich, die Begegnung mit dem Alten klang in ihm nach. Ihn ärgerte es, weder den Namen des Fahrers noch dessen Nummernschild notiert zu haben. Manchmal verhielt er sich dilettantisch wie ein Anfänger, tadelte er sich. Kurz überlegte er, jetzt noch die Kollegen vom Streifendienst zu informieren, doch dann ließ er es. Es war dafür zu spät, der Alte war mit Sicherheit schon davongefahren. Die Kollegen der Nachtschicht hatten genug zu tun, wusste Selig, sie mussten nicht auch noch von ihm überflüssige Aufgaben bekommen, nur damit er sich besser fühlte.
Der Transporter von Tobias und seinen Freunden, ein rostzerfressener Barkas B1000, stand in Sichtweite des Charlottenburger Schlosses am Straßenrand. Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht hatte hinter dem liegen gebliebenen DDR-Transporter gestoppt, die beiden uniformierten Beamten standen gerade am Fahrerhaus und blätterten in den Papieren, die ihnen aus dem Fenster hinausgereicht worden waren.
Selig schaltete sein mobiles Blaulicht ein und wendete auf der Fahrbahn, um vor dem Barkas zu stoppen. Er holte tief Luft, dann stieg er aus und ging auf die beiden Uniformierten zu. »Danke, Kollegen, ich übernehme das hier.« Selig mühte sich um ein Lächeln und hoffte, souveräner zu wirken, als er sich fühlte.
Die beiden Beamten warfen einen kurzen Blick auf Seligs Dienstausweis, den er ihnen entgegenhielt, bevor sie ihm die Papiere reichten, froh darüber, wieder in den warmen Streifenwagen steigen zu können.
Zum ersten Mal war Selig erleichtert darüber, dass sein Sohn den Nachnamen seiner Mutter trug und nicht den seinen.
Angespannt sah Tobias den davonfahrenden Polizisten nach. »Scheiße, war das knapp. Mann, wo warst du?« Ärgerlich sah er Selig an. »Ich hatte doch gesagt, dass es eilig ist.«
»Glaub mir, ich habe mich beeilt. Und jetzt bin ich ja da.« Selig warf einen Blick auf die drei Ausweiskarten, die ihm der uniformierte Kollege gegeben hatte. »Ihr könnt schon mal alles fürs Abschleppen vorbereiten.«
Tobias stieg aus, auch seine beiden Begleiter verließen den Wagen. Selig kannte sie beide, sie hatten ihm geholfen, als er von der Antiterroreinheit des Innenministers gesucht und fast gefunden worden war. Der Dunkelhaarige mit dem perfekt getrimmten Bart hieß Paolo, und der Name des Blonden war Sven, wie Selig nach dem Blick auf seinen Ausweis nun wusste.
Sven grinste Selig an, als er die Ausweiskarte entgegennahm. »Wow, cool. Der Mann, der die Sicherheitsgesetze zu Fall gebracht hat. War ein lässiger Auftritt gerade eben.« Der Blonde hob seine Hand zur Begrüßung, Selig schlug ein, froh darüber, dass Tobias ihm vor einiger Zeit das aktuell angesagte Begrüßungsritual der Szene gezeigt und mit ihm ausprobiert hatte. Auch Paolo begrüßte Selig, er reichte ihm schlicht die Hand.
Selig bemerkte aus den Augenwinkeln Tobias’ Erleichterung, dass ihn sein Vater vor den Augen seiner Freunde nicht blamierte.
Zehn Minuten später hatten sie das Abschleppseil aus dem Ladekoffer des Transporters sowohl an der Abschleppöse unter der Stoßstange des Barkas als auch an der von Seligs Wagen befestigt und fuhren langsam zurück in den Süden der Stadt.
Tobias saß neben ihm. Er warf seinem Vater einen Seitenblick zu. »Entschuldigung, dass ich dich vorhin angemacht habe. Ich war total im Stress.«
Selig nickte. Er betrachtete seinen Sohn prüfend, bevor er sich wieder auf die Straße konzentrierte. Eine Weile schwiegen sie gemeinsam, beide hingen ihren Gedanken nach. Dann brach Selig die Stille zwischen ihnen. »Ich mache mir Sorgen, Tobias.«
»Das musst du nicht.«
»Das sagst du immer.«
»Weil es stimmt.«
Selig war nicht überzeugt. »Was habt ihr vor?«
Tobias zögerte.
»Ich frage dich noch einmal: Gibt es etwas, das ich wissen muss?«
Stumm schüttelte Tobias den Kopf.
»Ich mag deine Freunde«, setzte Selig nach, »und im Grunde finde ich auch richtig, was ihr tut. Aber vieles davon ist gegen das Gesetz, und ich bin Polizist. Selbst die Aktion heute Abend mit den Kollegen von der Streife war grenzwertig.«
»Wieso? Du schleppst uns ab. Was ist daran falsch?«
»Ich hätte ihnen sagen müssen, dass ich dein Vater bin. Ich bin mir sicher, sie wollten eure Personalien überprüfen.«
Tobias starrte eine Weile schweigend aus dem Fenster.
»Was ist in dem Transporter, Tobias?«
»Unsere Computer. Das komplette Equipment.«
Jetzt verstand Selig, warum Tobias so nervös war. »Ihr habt euer Hauptquartier verlassen?«
Tobias nickte. »Wir haben den Hauptrechner abgebaut. Das Netz im Osten der Stadt bricht immer wieder zusammen. Aber bei uns in der Siedlung sind die Leitungen stabil.«
»Moment mal: Heißt das, ihr wollt eure Ausrüstung in meinem Haus aufbauen? Das geht nicht!«
Tobias’ Gesichtszüge verhärteten sich. »Ich wohne dort. Es ist meine Sache, wen ich zu mir einlade.«
»Und was ist mit der Datenleitung? Die läuft auf meinen Namen! Glaubst du, ich habe nach allem, was geschehen ist, Lust darauf, dass irgendwann der Staatsschutz bei uns vor der Tür steht?«
»Entspann dich. Die finden uns nicht. Die suchen uns seit Jahren und haben unser Hauptquartier niemals entdeckt. Außerdem tun wir nichts Illegales.«
»Und das kannst du mir garantieren?«
Tobias schwieg.
»Was habt ihr vor?«
Tobias antwortete nicht.
Selig betrachtete ihn nachdenklich. Er wusste, Tobias würde nichts mehr sagen, also drang er nicht weiter in ihn. Schweigend fuhren sie durch die Stadt.
Endlich erreichten sie die Siedlung, der Posten öffnete die Schranke, als er Selig erkannte. Zügig lenkte Selig ihr Gespann den Hügel hinauf. Doch es reichte nicht, auf halber Strecke blieben sie mit durchdrehenden Reifen an der Schräge hängen. Der Barkas war zu schwer und die Straße zu glatt.
Selig schaltete den Motor ab und stieg aus. »Ich hole Hilfe. Warte hier.« Zügig ging er zurück zum Pförtnerhäuschen, nachdem er Paolo und Sven kurz über den Stand der Dinge informiert hatte.