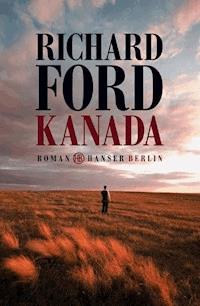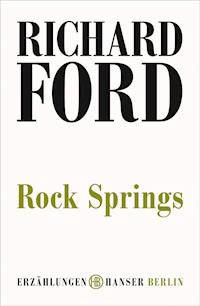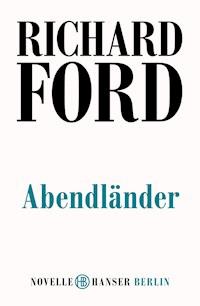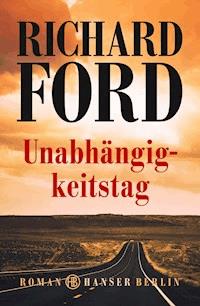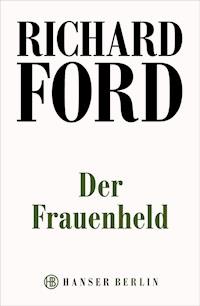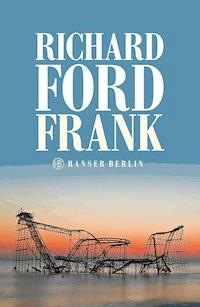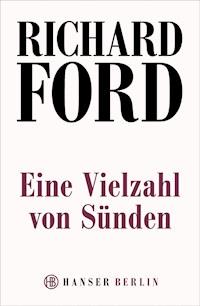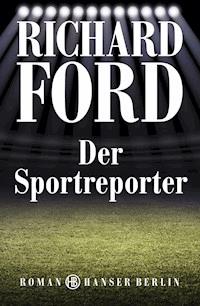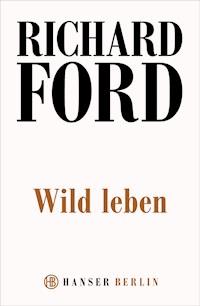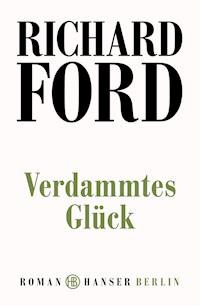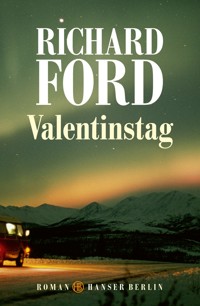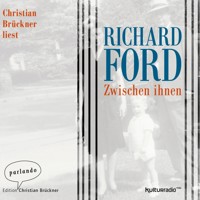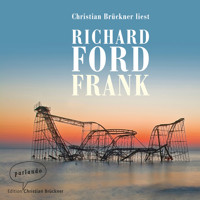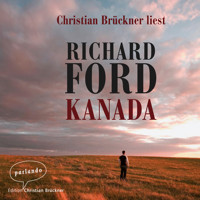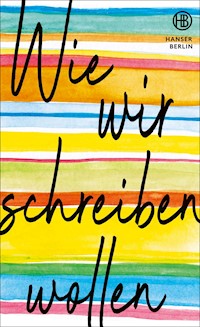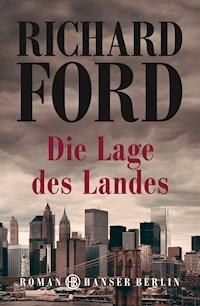
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sportreporter, Makler, Ehemann und Vater – Frank Bascombe hat im Laufe seines Lebens schon einige Rollen übernommen. Mittlerweile 55 Jahre alt, freut er sich mit seiner zweiten Ehefrau Sally auf den nächsten, ruhigeren Lebensabschnitt im gemeinsamen Haus am Strand. Franks Hoffnung auf eine beginnende "Permanenzphase" wird jedoch ein jähes Ende bereitet, als Sallys totgeglaubter erster Ehemann auftaucht und er selbst eine verheerende Diagnose erhält. Ein reicher, nachdenklicher, aber auch grotesk komischer Roman von Richard Ford über einen Mann in den vermeintlich besten Jahren und ein Amerika, dessen Sicherheit sich nach George Bushs "gestohlener" Präsidentenwahl als trügerisch erweist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1055
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser Berlin E-Book
Richard Ford
DIE LAGE DES LANDES
Roman
Aus dem Englischenvon Frank Heibert
Hanser Berlin
Die Originalausgabe erschien 2006
unter dem Titel The Lay of the Land bei Alfred A. Knopf, New York
ISBN 978-3-446-25105-2
© Richard Ford 2006
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
©Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2015
Cover: Peter-Andreas Hassiepen. München, unter Verwendung eines Fotos von © Songquan Deng / Thinkstock
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Kristina
Bist du bereit, deinem Schöpfer zu begegnen?
Letzte Woche habe ich in der Asbury Press eine Geschichte gelesen, die noch immer in mir brennt wie eine Nessel. Eigentlich war es eine typische Nachricht, wie wir sie jeden Morgen lesen, sie versetzt uns einen tiefen, sich ausbreitenden Stich des Schocks und Grauens, und wir starren eine Weile in den Himmel, dann wendet sich das Auge anderen Themen zu – Prominentengeburtstagen, Sportmeldungen, Todesanzeigen, neuen Immobilienangeboten –, was uns zu anderen Sorgen bringt, und am Spätvormittag haben wir sie schon vergessen.
Diese Story aber berichtete unter der verkrüppelten Schlagzeile »Pflegetode in Tex« detailliert von einem ansonsten normalen Tag am Fachbereich Krankenpflege des staatlichen Lehrer-Colleges San Ysidro (Paloma-Playa-Campus) in Südtexas. Ein frustrierter Pflegestudent (diese Leute sind immer Männer) betrat das Gebäude durch den Vordereingang und suchte den Kursraum auf, wo er gerade hätte am Unterricht teilnehmen sollen, genauer gesagt, an einem Test, der schon im Gange war. Reihenweise über die Arbeit gebeugte Studentenköpfe. Die Dozentin, Professor Sandra McCurdy, starrte aus dem Fenster und dachte an wer weiß was – eine Pediküre, einen Angelausflug, den sie mit ihrem Mann vorhatte (sie waren seit einundzwanzig Jahren verheiratet), ihre Gesundheit. Der Kurs hieß, ja, so plattfüßig und unsubtil kann das Schicksal sein, »Sterben und Tod – Ethik, Ästhetik, Vorbereitung«. Worüber das Pflegepersonal ja Bescheid wissen muss.
Don-Houston Clevinger, der frustrierte Student – Navy-Veteran und Vater zweier Kinder –, hatte schon beim Test zur Semesterhalbzeit schlecht abgeschnitten und musste sich wohl auf eine schlechte Note und die Rückfahrkarte nach McAllen gefasst machen. Dieser Clevinger betrat den stillen Kursraum voller ehrfürchtiger Prüflinge und ging zwischen den Tischen hindurch nach vorn, wo Ms McCurdy mit verschränkten Armen sinnierend, vielleicht lächelnd am Fenster stand. Er richtete eine 9-mm-Glock auf den Punkt zwischen ihren Augen, etwa eine Handbreit entfernt, und fragte: »Bist du bereit, deinem Schöpfer zu begegnen?« Ms McCurdy, die sechsundvierzig war, eine überdurchschnittlich gute Lehrerin und Canasta-Spielerin, und die außerdem bei der Operation Wüstensturm in einem fliegenden Lazarett gedient hatte, blinzelte nur zweimal neugierig mit ihren immergrünen Augen und sagte: »Ja. Ja, ich glaube, ja.« Woraufhin dieser Clevinger sie erschoss, sich langsam den verblüfften Krankenschwestern in spe zudrehte und mit einem Schuss an ungefähr dieselbe Stelle umbrachte.
Als ich das las, wollte ich mich gerade hinsetzen, in mein verglastes Wohnzimmer mit Blick über die grasige Düne, den Strand und die schläfrige Schindel des Atlantiks. Es ging mir übrigens insgesamt ziemlich gut. Es war sieben Uhr an einem Donnerstagmorgen in der Woche vor Thanksgiving. Um zehn hatte ich einen Vertragsabschluss mit einem »glücklichen Klienten« im Maklerbüro hier in Sea-Clift, was der Verkäufer und ich nachher im Bump’s-Roh-Kost feiern wollten. Meine gesundheitlichen Beschwerden der letzten Zeit – ich hatte mir in der Mayo-Klinik die Prostata mit sechzig radioaktiven Smart Bombs aus titaniumumhüllten »Schrotkugeln« namens Jod-Seeds beschießen lassen – schienen auf dem Weg der Besserung zu sein (Systeme laufen, Waffen geladen und gesichert). Meine Thanksgiving-Pläne für ein halbfamiliäres Treffen zu Hause hatten mir noch nicht die Laune verdorben (Stress ist schlecht für die Halbwertzeit der strahlenden Jod-Seeds). Und ich hatte seit einem halben Jahr nichts mehr von meiner Frau gehört, was unter den Umständen ihres neuen und meines alten Lebens erklärlich, wenn auch nicht ideal war. Mit anderen Worten, alles, was das Lebensgefühl mit fünfundfünfzig ausmacht, lag um mich her verstreut wie Mohnblüten.
Meine Tochter Clarissa Bascombe schlief noch, das Haus lag still und leer, abgesehen von den üblichen Kaffeearomen und dem angenehmen Hauch Feuchtigkeit in der Luft. Doch als ich Ms McCurdys Antwort auf die Frage ihres Mörders las (ich bin mir sicher, selber hatte er nie darüber nachgedacht), stand ich sofort auf, mein Herz hämmerte plötzlich, meine Hände, meine Finger waren kalt und kribbelten, die Kopfhaut spannte um meinen Schädel, als führe gerade ein Zug zu nah vorbei. Und ich sagte laut, obwohl mich keiner hören konnte: »Verdammt noch mal! Woher wusste sie das bloß?«
Überall die mittlere Küste rauf und runter (die Press ist die maßgebliche Zeitung an den Ufern von New Jersey) muss es von Haushalt zu Haushalt Hunderte Male solches Grummeln, solche unhörbar läutenden Alarmglocken gegeben haben, als die Leser über Ms McCurdys letzte Worte nachgrübelten. Wie ferne Detonationen, die sich bei den Empfindsamen erst als Erstaunen niederschlagen und dann als Unruhe. Elefanten spüren den todbringenden Tritt des Wilderers auf hundert Meilen Entfernung. Katzen huschen aus dem Raum, wenn Austern geöffnet werden. Und so weiter und immer so weiter. Das Unsichtbare existiert und hat Eigenschaften.
»Würde ich das jemals sagen?«, war natürlich der Sinn meiner Frage im Klartext, einer Frage, die sich von Highlands bis Little Egg vermutlich jeder bedrückt gestellt hatte. Und mit der, so ist es nun mal, uns das Leben in der Vorstadt nicht regelmäßig konfrontiert. Das Leben in der Vorstadt tut stattdessen so ziemlich das Gegenteil.
Obwohl, wer weiß.
Angesichts von Mr Clevingers Frage und unter Zeitdruck hätte ich bestimmt angefangen, lautlos all die Dinge aufzulisten, die ich noch nicht getan hatte – mit einem Filmstar vögeln, vietnamesische Waisenzwillinge adoptieren und sie auf ein edles College wie Williams schicken, den Appalachian Trail entlangwandern, Hilfsaktionen für ein leidgeprüftes, überschwemmtes afrikanisches Land organisieren, Deutsch lernen, zum Botschafter in einem Land ernannt werden, wo keiner hinwill außer mir. Die Republikaner wählen. Ich hätte überlegt, ob mein Organspenderausweis unterschrieben, ob die Liste meiner Sargträger auf dem neuesten Stand war, ob in meinem Nachruf auch keine wichtigen neuen Details fehlten – ob ich, mit anderen Worten, meine Botschaft richtig rübergebracht hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte ich also, während die Herbstbrise zu den Fenstern im hellen Paloma Playa hereinwirbelte und die Pflegestudentinnen ihren süßen Kaugummiatem anhielten, um meine Antwort zu hören, zu Mr Clevinger gesagt: »Wissen Sie, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Noch nicht ganz.« Woraufhin er mich trotzdem erschossen hätte (sich selbst womöglich aber nicht).
Je mehr ich mich gedanklich in das traurige, schreckliche Rätsel vertiefte, desto weniger interessierte mich meine übliche Morgenroutine – die fünfzig Sit-ups, die vierzig Liegestütze, ein paarmal Nackendehnen, eine Schüssel Müsli mit Obst, ein erleichterndes Intermezzo auf der Toilette. Stattdessen hatte die Geschichte von Ms McCurdys unglücklichem Ende das Bedürfnis nach einem schroffen, stimulierenden, den Kopf durchlüftenden Sprung in die See ausgelöst. Es war der 16. November, genau eine Woche vor Thanksgiving, und der Atlantik war polierter Zinn, so glatt und kalt und still wie das Herz des alten Neptun. (Wenn man sich am Meer einkauft, ist man anfangs fest davon überzeugt, dass man jeden Morgen reinspringen wird und ein entsprechend glücklicheres und längeres Leben geschenkt bekommt, dass man fröhlicher wird und der alten Pumpe noch mal eine Generalüberholung gönnt, während viele andere gerade die ersten Symptome ihres Herzinfarkts spüren. Nur dass man es dann nicht tut.)
Aber wir alle können ergriffen sein, wenn wir Glück haben. Wie ich – über Ms McCurdy. Sodass es erforderlich schien, mit dem Plötzlichen und dem Eigentlichen in Kontakt zu treten. Und nicht, dass ich – beim Griff nach meiner Badehose in der Schublade, beim Umziehen und beim Weg barfuß zur Seitentür hinaus und die sandigen Stufen hinunter in die scharfe Luftigkeit am Strand – ernstlich verängstigt gewesen wäre von der kleinen Episode. Der Tod und sein heimtückischer Hinterhalt machen mir keine große Angst. Nicht mehr. Letzten Sommer habe ich im rasengepflegten, genormten, vorschriftsmäßigen Rochester, Minnesota, den Tod mit großem T offiziell, zügig und ein für alle Mal überwunden. Hab das Ewigkeitskonzept aufgegeben. Ich werde meine Hypothek ebenso wenig überleben wie mein Dach (noch fünfundzwanzig Jahre), vielleicht nicht mal mein Auto. Weil die So-lala-Gene meiner Mutter – Brustkrebsgene, die eine schleichende Ausbreitung von Prostatakrebsgenen anstießen, die als Nächstes wer weiß was anstießen – allmählich die Oberhand gewannen. Das traurige Schicksal der Flüchtlinge in Gaza, die Debatte um den zukünftigen Euro, die abschmelzende Eiskappe am Pol, das lang gefürchtete Riesenerdbeben, das auf die Bucht von San Francisco zurumpelt wie eine Flotte Harley-Davidsons, das Schwermetall in der Muttermilch – all das erschien mir furchtbar, doch, doch, aber von meinem Ende des Teleskops aus, ehrlich gesagt, erträglich.
Es war schlicht so: Ergriffen, wie ich war, und in Erwartung einer Woche voller Überraschungen und altbekannter Feiertagsmorbiditäten wollte ich mit allen Sinnen daran erinnert werden, dass ich am Leben war. In den schwindenden Wochen dieses Jahres 2000, für das ich mir vorgenommen hatte, einiges zu vereinfachen (für das ganze Jahrhundert eigentlich, doch bis jetzt hatte es noch nicht ganz geklappt), musste ich dringend reinen Tisch machen, so gründlich wie Ms McCurdy bei ihrem Abgesang oder zumindest beinahe, damit ich, falls ich mit so etwas wie ihrer Frage konfrontiert werden sollte, auch so etwas wie ihre Antwort geben konnte.
Barfuß, Rücken, Brust und Beine entblößt und prickelnd im kalten Wind, tappte ich unbeholfen über die grobsandige Strandböschung, durch den Strandhafer und hinaus auf den überraschend kalten Sand. Der weiße Hochsitz des Rettungsschwimmers stand vornehm, aber unbemannt am Strand. Die Ebbe legte eine schwarz glitzernde feuchte, abschüssige Sandebene frei. Irgendjemand hatte das Strandschild zerbrochen, für Feuerholz wohl, sodass an dem Pfosten nur EIGENE GEFAHR in roten Blockbuchstaben übrig war. Sea-Clift, mitten an der Küste New Jerseys, mitten im November, das kann der ideale Ort für einen idealen Tag sein. Jeder von uns 2300, die ganzjährig hier leben, kann Ihnen das bestätigen. Das Gefühl, dass hier Leute das Leben genießen, es verschlunzen, es schlendernd auf sich zukommen lassen, herrscht überall. Nur die Leute selber sind weg. Auf dem Heimweg – nach Williamsport und Sparta und Demopolis. Nur die einsam wirkenden Winterbewohner, die Langsamjogger, die Einzelhundgassigeher, die dünnen Männer mit den Metalldetektoren (deren Frauen, John Grisham lesend, im Van warten), die sind hier. Aber auch nicht um sieben Uhr früh.
In beiden Richtungen war der Strand fast leer. Ein Containerschiff, Meilen vom Land entfernt, folgte langsam der flachen Horizontlinie. Gewitterwolken, die es nie bis zur Küste schaffen würden, hingen am östlichen, heller werdenden Himmel. Ich warf einen Vergewisserungsblick zurück auf mein Haus – lauter verspiegelte Fenster, kleine Erker, Kupferkappen, ein Wetterhahn auf dem höchsten Giebel. Ich wollte nicht, dass Clarissa aufstand, sich streckte und kratzte, dann freudig aufs Meer schaute und plötzlich annehmen musste, ihr Dad hätte sich allein zum Sprung ins Vergessen aufgemacht. Zum Glück sah ich aber niemanden, der mich beobachtete – nur die erste Sonne, die die Fenster wärmte und tiefrot und heißgold färbte.
Natürlich werden Sie sich denken können, was mir durch den Kopf ging. Liegt ja nahe. Man kann nicht zu einem morgendlichen Verjüngungs- und Selbstverwirklichungsbad losziehen, gierig auf eine Prise Unwiderlegbarkeit, Undifferenziertheit und natürlicher Zwangsläufigkeit, ohne sich neugierig zu fragen, ob man in geheimer Mission unterwegs ist. Oder? Einige müssen doch, dachte ich, als der saukalte Atlantik matt an meinen Oberschenkeln emporstieg, ich den cremig-flachen Sand unter den Zehen spürte und meine Weichteile sich in Panik zurückzogen – einige müssen doch ganz friedlich über die Reling des Vergnügungsdampfers gehen (wie angeblich der Dichter) oder viel zu weit in den Abend hinausschwimmen, bis das Land träumerisch versinkt. Aber sie sagen vermutlich nicht: »Ups, oje, Mist, guck dir das an. Jetzt sitze ich aber wirklich in der Patsche, was?« Ich wüsste wirklich gerne, was zum Teufel sie tatsächlich sagen, während sie im Vorzimmer des Todes warten, während die Lichter des sich entfernenden Schiffes schwächer werden, das Wasser kälter und kabbeliger als erwartet. Vielleicht sind sie ein bisschen überrascht über sich selbst und darüber, wie endgültig die Dinge plötzlich aussehen können. Obwohl man mit dieser Information dann auch nicht mehr viel anfangen kann.
Aber das ist eigentlich keine Überraschung. Und während ich bis zur Taille hineinwatete, heftig zitternd, Salzgeschmack auf den Lippen, wurde mir klar, dass ich nicht hier war, gleich hinter dem Rand des Kontinents, um einen übereilten Abgang hinzulegen. O nein. Ich war aus dem einfachen Grund hier, dass ich wusste, ich hätte Don-Houston Clevingers fatale Frage niemals so beantwortet wie Sandra McCurdy: weil es immer noch etwas gab, das ich wissen musste und noch nicht wusste, etwas, das ich unbedingt noch herausfinden wollte, wie mir die Wucht des Ozeans mit seinem energischen Heben und Ziehen spürbar zu erkennen gab, und das mich glücklich machen konnte. Laut den Akademikern ist freilich ein Ja auf die schreckliche Frage des Todes dasselbe wie ein Nein und alles, was verschieden aussieht, in Wahrheit identisch – nur unsere Bedürftigkeit trennt den Weizen von der Spreu. Natürlich ist es ihr abgestorbenes Leben, das sie so denken lässt.
Doch als ich spürte, wie das Meer anstieg und über meine Brust leckte, wie mein Atem kurz und flach wurde und meine Arme anfingen, gegen die Strömung ins Nirgendwo anzukämpfen, da wusste ich, dass der Tod anders war und dass ich ihm jetzt ein Nein entgegenhalten musste. Und mit dieser Gewissheit und dem Ufer hinter mir, wo die Sonne das langsame Erwachen der Welt glanzvoll begrüßte, tat ich den Sprung und schwamm ein Stück, um mein Leben zu spüren, bevor ich an Land zurückkehrte, zu all dem, was dort lag und auf mich wartete.
Teil 1
1
Toms River, auf der anderen Seite der Barnegat Bay, liegt wimmelig vor mir im eisigen morgendlichen Sturmwind und der hohen Herbstsonne eines amerikanischen Thanksgiving-Dienstags. Wenn man von der Brücke in Richtung Sea-Clift blickt, lässt die Sonne das Wasser unter den Gitterträgern diamanten glitzern. Zwischen den weißen Schaumkronen ist aus der Entfernung nur ein einzelner Jet-Skifahrer mit nassem Anzug zu erkennen, der vor sich hin pflügt und hoppelt, festgeklammert an seiner Teufelsmaschine, die von einer stählernen Welle zur nächsten hüpft. »Nass und eisig ist schlecht für den Zeisig«, sangen wir in der Sigma-Chi-Studentenverbindung, »trocken und warm, wird er groß wie ein Arm.« Na, Babyarm. Ich werfe einen schnellen Blick zurück, ob unser Schild NEW JERSEYS BESTGEHÜTETES GEHEIMNIS die Touristensaison überlebt hat – die jetzt vorbei ist. Jeden Sommer empfängt die langgezogene, der Barnegat Bay vorgelagerte Halbinsel, deren Südspitze Sea-Clift praktisch bildet, sechstausend Besucher pro Meile, und viele davon sind ganz wild auf eine Runde Sun & Fun-Vandalismus und schweren Diebstahl aus Imponiergehabe. Unser Schild, das der Maklerzirkel bezahlte, als ich sein Vorsitzender war, landete regelmäßig jenseits vom Haupteingang der Rutgers-Unibibliothek oben in New Brunswick. Heute steht es erfreulicherweise da, wo es hingehört.
Neue Reihen von dreistöckigen Apartmenthäusern in Weiß und Rosa säumen auf dem Festland die Küste, nördlich wie südlich. Weiter oben, nicht weit von Silver Bay und den staatlichen Sümpfen, wo es Weißkopf-Seeadler gibt, steht der niedrige blassgrüne Ytongbau des Stammzellenlabors, das einer Supermarktkette gehört, und daneben eine weiße Kondomfabrik, deren Besitzer Saudis sind. Aus dieser Entfernung sehen sie beide so unschuldig aus wie ein Sears-Kaufhaus. Und sie gehören auch zu der gutnachbarlichen Sorte Industrie, deren Angestellte und Führungskräfte höfliche Kinder in die hiesigen Schulen und Gebetshäuser schicken, deren Leitung sich streng und finanzstark gegen Drogen und Pädophilie einsetzt und gute Landschaftsgestalter und Sicherheitsdienste beschäftigt. Außerdem stabilisieren diese sauberen Industriezweige die Steuerbemessungsgrundlage und liefern den Einheimischen ein paar gute Igitt-Anlässe.
Von der Brücke aus kann ich das Yachtbecken von Toms River erkennen, einen Wald leerer Masten, die sich im Wind wiegen, und weiter nördlich einen glatten grünen Wasserturm hinter der Hülle eines alten Atomkraftwerks, das zum Verkauf steht und 2002 stillgelegt werden soll. Das ist unsere Aussicht aufs Festland, vom Verwaltungsbezirk Sea-Clift aus Richtung Westen – so könnte ein Positivist beschreiben, wozu die meisten Landschaften am Meer in der Vielzweckgesellschaft mittlerweile geworden sind.
Heute Morgen bin ich mit dem Auto unterwegs von Sea-Clift, wo ich seit zehn Jahren lebe, über die 65-Meilen-Hinterlandstrecke nach Haddam, New Jersey (wo ich die zwanzig Jahre davor war), vor mir ein Tag mit vielfältigen Verpflichtungen – einige ernüchternd, einige beängstigend, eine ausschließlich hoffnungsvoll. Um halb eins will ich in einem Bestattungsunternehmen von meinem Freund Ernie MacAuliffe Abschied nehmen, der am Samstag gestorben ist; später, um vier, soll ich meine Exfrau Ann Dykstra auf ihren Wunsch in der Uni, wo sie arbeitet, »treffen«, was bei mir lauter Hochspannungsängste in Bezug auf die möglichen Anlässe ausgelöst hat – meine Gesundheit, ihre Gesundheit, unsere beiden erwachsenen (Sorgen-)Kinder, eventuell (Überraschung!) ein neuer Verehrer in ihrem Leben (solche Ereignisse teilen Exfrauen gern mit). Dann will ich einen kurzen Zwischenstopp bei meinem Zahnarzt einlegen, damit er mir auf die Schnelle meine Nachtschiene anpasst (die ich dabeihabe). Außerdem habe ich um zwei eine Sponsors-Verabredung – das ist der hoffnungsvolle Teil.
»Sponsors« ist ein Netzwerk von Bürgern vor allem aus dem mittleren New Jersey – Männern und Frauen –, die einfach nur anderen Leuten helfen wollen (die Frauen behaupten, ihr Ansatz sei eher humanistisch/mütterlich, aber aus eigener Erfahrung kann ich das nicht bestätigen). Der Grundgedanke von Sponsors ist, dass viele Menschen mit Problemen ab und zu einen kleinen vernünftigen Rat brauchen, mehr nicht. Dafür würde man keinen Therapeuten bezahlen, Medikamente schlucken oder an einem von der Krankenkasse mitfinanzierten »Programm« teilnehmen. Es ist einfach irgendetwas, womit man nicht klarkommt und das sich nicht von selbst erledigt, aber wenn man mit irgendwem darüber ein reelles Gespräch führte, ginge es einem sofort um Klassen besser. Ein Beispiel: Angenommen, Sie besitzen ein Segelboot, können aber nicht besonders gut segeln. Nach einer Weile merken Sie, dass Sie das verdammte Ding kaum noch betreten, aus Angst, damit irgendeinen Felsen zu rammen, Ihr Leben aufs Spiel zu setzen, Ihr investiertes Geld zu verlieren und der Verbitterung anheimzufallen, weil alles so peinlich ist. Währenddessen liegt es im atemberaubend teuren Trockendock von Brad’s Marina in Shark River, verzieht sich schon ein bisschen, weil es so lange nicht im Wasser war, und Sie werden zur Zielscheibe getuschelter Blöder-Anfänger-Sprüche und Beleidigungen durch das Bootspersonal. Schließlich fahren Sie nicht mal mehr hin, wenn Sie Lust dazu haben, und ertappen sich dabei, dass Sie jeden Gedanken an Ihr Segelboot verdrängen, als hätten Sie vor Jahrzehnten einen Mord begangen, für den Sie nur deshalb nicht bestraft wurden, weil Sie in einen anderen Staat gezogen sind und eine neue Identität angenommen haben, aber allmorgendlich um vier wachen Sie schweißgebadet auf und fühlen sich grässlich.
Sponsors-Gespräche drehen sich um genau solche Probleme, oftmals um die schwächende Wirkung von unklugen Spontankäufen oder falschen persönlichen Entscheidungen bezogen auf Besitz oder Dienstleistungen. Als Makler weiß ich eine Menge von solchen Dingen. Ein anderes Beispiel. Was sagen Sie zu Ihrer holländischen Haushälterin Bettina, die, statt zu putzen, inzwischen den ganzen Tag in Ihrer Küche sitzt, Kaffee trinkt, raucht, fernsieht und Auslandsgespräche führt, aber Sie wissen nicht, was tun, damit sie wieder spurt oder, im äußersten Fall, die Koffer packt. Ein Sponsors-Rat wäre genau das, was ein Freund Ihnen empfehlen würde: Stoßen Sie das Boot ab oder nehmen Sie nächsten Frühling ein paar Privatstunden im Yachtclub. Wahrscheinlich steht es noch gar nicht so schlimm um das Boot – die werden doch dafür gebaut, dass sie lange halten. Oder ich schreibe ein paar deutliche Worte auf, die Sie Bettina direkt sagen oder als Nachricht in der Küche hinterlegen können, und das wird sie, zusammen mit einem ordentlichen Scheck, schnurstracks in Bewegung setzen. Wahrscheinlich ist sie illegal im Land und selber unglücklich.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!