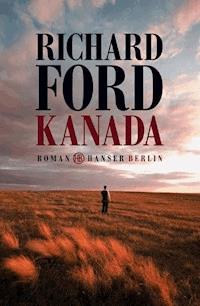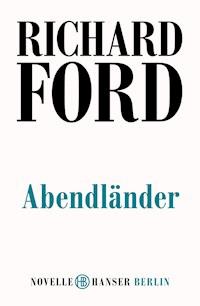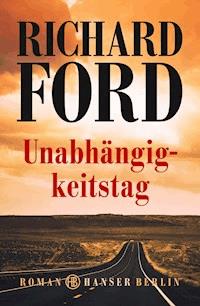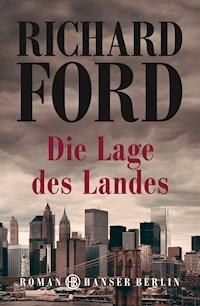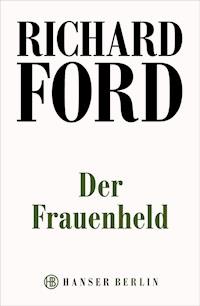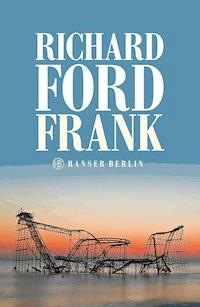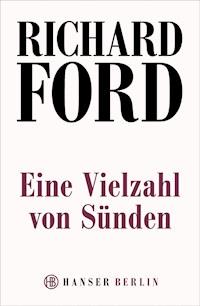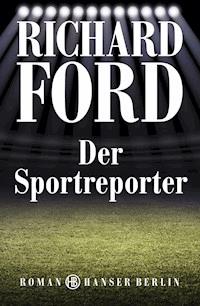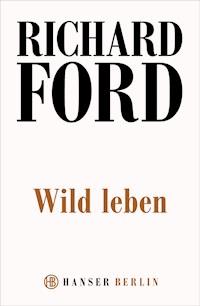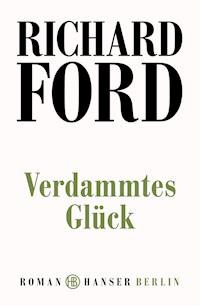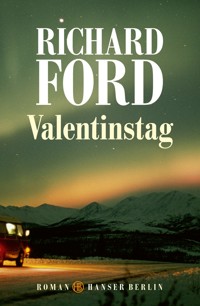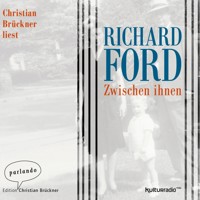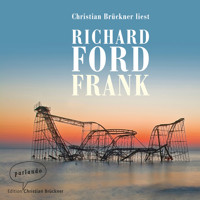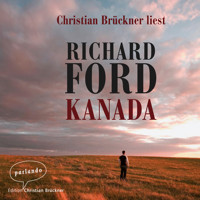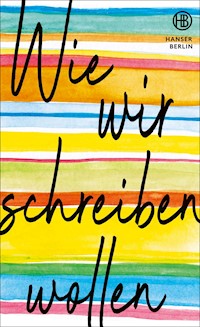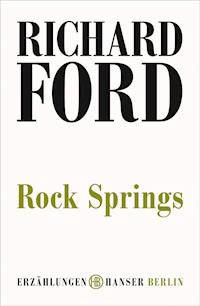
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die karge Landschaft Montanas, ziellose Fahrten auf den Highways, flüchtige Beziehungen, Seitensprünge. Väter, die für ihre Verbrechen büßen, Mütter, die sich für immer davonmachen, Kinder, die das Vertrauen in die Eltern verlieren. In seinem berühmten Erzählband "Rock Springs" schildert Richard Ford Menschen, die unermüdlich versuchen, die Scherben ihres Lebens zu kitten, einen Rest von Sinn und Sicherheit zu finden. Es braucht schon die Meisterschaft eines Richard Ford, um ganz ohne Schwermut von Einsamkeit und Heimatlosigkeit im Mittleren Westen der USA zu erzählen. Mit der Leichtigkeit und Präzision, die seinen Ton auszeichnet, entstehen Geschichten voller Empathie – und sogar so etwas wie Trost.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Männer, die gerade aus dem Gefängnis entlassen sind oder ihre Strafe antreten müssen, Frauen, die ihre Familien verlassen, Kinder und Heranwachsende, die das Zerbrechen der Ehen ihrer Eltern erleben – das sind die Gestalten in Richard Fords Rock Springs. Es sind Menschen, die versuchen, die Scherben ihres Lebens zusammenzukitten, einen Rest von Sinn und Sicherheit zu finden, immer am Rande des Verbrechens, der Heimatlosigkeit, und am schlimmsten, der Einsamkeit. In Richard Fords Geschichten gibt es stets ein Geschehen, eine Spannung, die aus der Handlung entsteht. In »Optimisten« ist es ein Mord, in »Winterbeute« geht es um einen Fischzug in der Dunkelheit, in anderen Erzählungen um Fälschung und Betrug, um Unehrlichkeit und Untreue – immer aber versuchen die Gestalten, den brutalen Zufällen ihres Lebens und den eigenen Unzulänglichkeiten zu entkommen und die Sicherheit zu finden, die sich im letzten Augenblick doch wieder als Illusion erweist.
Hanser Berlin E-Book
Richard Ford
Rock Springs
Erzählungen
Aus dem Amerikanischen von Harald Goland
Hanser Berlin
Die Originalausgabe erschien 1987unter dem Titel Rock Springs bei The Atlantic Monthly Press, New York
ISBN 978-3-446-25333-9
© Richard Ford 1987
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2015
Umschlag: © Peter-Andreas Hassiepen
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de.
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Kristina
Inhalt
Rock Springs
Great Falls
Sweethearts
Kinder
Vor die Hunde gehen
Das Reich
Winterbeute
Optimisten
Feuerwerk
Kommunist
Rock Springs
Edna und ich kamen von Kalispell herunter, wir fuhren nach Tampa-St. Pete, wo ich noch ein paar Freunde aus den guten alten Tagen hatte, die mich nicht gleich zur Polizei schleppen würden. Ich war in Kalispell mit dem Gesetz aneinandergeraten, weil ich ein paar faule Schecks ausgestellt hatte – dafür geht man in Montana in den Knast. Und ich wußte, daß Edna sich schon länger die Karten legte und darüber nachdachte, woanders hinzuziehen, weil es nicht das erste Mal war, daß ich Schwierigkeiten mit der Polizei hatte. Sie hatte selbst auch schon einiges hinter sich. Sie hatte ihre Kinder verloren, und sie hatte alle Hände voll zu tun, ihren früheren Mann, Danny, daran zu hindern, bei ihr einzubrechen und ihre Sachen zu klauen, während sie zur Arbeit war. Deshalb war ich überhaupt nur bei ihr eingezogen, deshalb und auch, weil ich meiner kleinen Tochter Cheryl das Leben ein bißchen leichter machen wollte.
Ich weiß eigentlich nicht, was zwischen Edna und mir war, wahrscheinlich nicht mehr, als daß wir beide auf ähnliche Weise gestrandet waren. Aber Liebe ist schon auf schlechterem Boden gewachsen, das weiß ich nun wirklich. Und als ich an dem Nachmittag nach Hause kam und sie einfach fragte, ob sie mit mir nach Florida gehen wollte, hier alles stehen- und liegenlassen, sagte sie: »Warum nicht? Mein Terminkalender ist nicht gerade überfüllt.«
Edna und ich waren seit acht Monaten zusammen, mehr oder weniger Mann und Frau, einige Zeit davon war ich arbeitslos gewesen, und einige Zeit hatte ich auf der Hunderennbahn gearbeitet, hatte die Hunde in die Startboxen geführt und konnte bei der Miete ein bißchen helfen und versuchen, Danny zur Vernunft zu bringen, wenn er auftauchte. Danny hatte Angst vor mir, weil Edna ihm erzählt hatte, ich hätte in Florida gesessen, weil ich einen Mann umgebracht hatte, aber das stimmte nicht. Ich bin mal in Talahassee im Knast gewesen, weil ich Reifen geklaut hab und in eine Schlägerei auf einer Farm verwickelt war, bei der ein Mann ein Auge verlor. Aber ich hatte niemanden verletzt, und Edna machte die Geschichte wilder, als sie war, weil sie Danny unter Druck setzen wollte, damit er sich nicht aufführte wie ein Verrückter und sie die Kinder wieder nehmen mußte, jetzt, da sie sich daran gewöhnt hatte, sie nicht bei sich zu haben, und ich hatte ja schon Cheryl bei mir. Ich bin kein gewalttätiger Mann und würde nie jemandem das Auge ausschlagen, schon gar nicht jemanden umbringen. Meine frühere Frau, Helen, war sogar aus Waikiki Beach angereist, um das vor Gericht auszusagen. Ich hab sie nie geschlagen, und ich würde immer auf die andere Straßenseite gehen, um Ärger auszuweichen. Aber das wußte Danny nicht.
Wir waren halb durch Wyoming und fuhren auf die I-80 zu und waren bester Stimmung, als die Öllampe in dem Wagen, den ich geklaut hatte, anfing zu blinken. Ich wußte sofort, daß es ein schlechtes Zeichen war.
Ich hatte uns einen guten Wagen besorgt, einen preiselbeerroten Mercedes. Er stand auf dem Parkplatz vor der Praxis eines Augenarztes. Ich nahm ihn, weil ich glaubte, daß er für eine lange Fahrt bequem wär, und weil ich glaubte, daß er nicht so viel verbrauchte. Tat er auch nicht. Außerdem hatte ich im Leben noch kein gutes Auto gehabt, nur alte Schrottkisten, Chevies und gebrauchte Trucks aus der Zeit, als ich jung war und mit Kubanern Citrussträucher beschnitt.
Der Wagen hatte uns den ganzen Tag lang begeistert. Ich spielte mit den elektrischen Fensterhebern rum, und Edna erzählte uns Witze und schnitt Gesichter. Sie konnte sehr lebhaft sein. Ihr Gesicht strahlte dann wie ein Leuchtturm, und man konnte sehen, wie schön sie war – wenn auch nicht schön im gewöhnlichen Sinn. Das alles machte mich ein bißchen übermütig, und ich fuhr ganz durch bis Bozeman, dann durch den Park bis Jackson Hole. Im Quality Court Motel in Jackson nahm ich die Brautsuite, und wir warteten, bis Cheryl und ihr kleiner Hund Duke eingeschlafen waren, und fuhren dann zu einem Restaurant und tranken Bier und lachten bis nach Mitternacht.
Es war ein ganz neuer Anfang, wir ließen die schlechten Erinnerungen hinter uns und fuhren auf einen neuen Horizont zu. Ich fühlte mich so gut, daß ich mir eine Tätowierung auf den Arm machen ließ. Darauf stand ALLES BESTENS, und Edna kaufte sich einen Baily-Hut mit einer Indianerfeder und ein kleines silbernes Armband mit Türkisen für Cheryl. Wir liebten uns im Auto auf dem Parkplatz des Motels, gerade als die Sonne brennend über den Snake-River stieg, und alles war wie am Ende des Regenbogens.
Und weil ich so übermütig war, behielt ich den Wagen einen Tag länger, statt ihn in den Fluß zu fahren und einen anderen zu klauen, was ich hätte tun sollen und früher auch schon getan hatte.
Als der er Wagen kaputtging, war keine Stadt und kein Haus in Sicht, nur eine niedrige Hügelkette vielleicht sechzig Kilometer vor uns oder vielleicht hundert, ein Stacheldrahtzaun in beide Richtungen, platte Prärie und ein paar Raubvögel, die sich von der Abendbrise tragen ließen und Insekten schnappten.
Ich stieg aus, um mir den Motor anzugucken, und Edna stieg mit Cheryl und dem Hund aus, um sie Pipi machen zu lassen. Ich sah nach, ob er noch Wasser und Öl hatte, und beides war völlig in Ordnung.
»Was bedeutet die Lampe, Earl?« sagte Edna. Sie war herangekommen und stand mit ihrem Hut neben dem Wagen. Sie versuchte, sich einen Reim auf die Situation zu machen.
»Wir sollten eigentlich nicht weiterfahren«, sagte ich. »Stimmt was nicht mit’m Öl.«
Sie sah sich nach Cheryl und dem kleinen Duke um, die nebeneinander auf dem Asphalt Pipi machten wie zwei Püppchen, blickte dann zu den Bergen hinüber, die in der Entfernung schwarz und verloren aussahen. »Was machen wir?« sagte sie. Noch machte sie sich keine wirklichen Sorgen, aber sie wollte wissen, was ich davon hielt.
»Ich versuch’s noch mal.«
»Gute Idee«, sagte sie, und wir stiegen alle wieder ein.
Als ich den Motor anließ, sprang er sofort an, und das rote Licht blieb weg. Ich konnte keine ungewöhnlichen Geräusche in der Maschine hören. Ich ließ den Motor ein bißchen leerlaufen, gab dann kräftig Gas und sah auf die rote Lampe. Sie blieb aus, und ich dachte schon, ich hätt’s mir vielleicht nur eingebildet oder die Sonne wär durch den Chrom am Fenster darauf gelenkt worden. Vielleicht hatte ich auch vor irgendwas Angst und wußte es nicht.
»Was hat er, Daddy?« sagte Cheryl vom Rücksitz. Ich drehte mich um und sah sie an. Sie trug das kleine Armband und Ednas Hut, den sie ganz auf den Hinterkopf zurückgeschoben hatte, und der kleine schwarzweiße Hund lag in ihrem Schoß. Sie sah aus wie ein kleines Cowgirl im Film.
»Nichts, Süße, alles in Ordnung«, sagte ich.
»Duke hat Pipi gemacht, wo ich Pipi gemacht hab«, sagte Cheryl und kicherte.
»Ihr paßt gut zusammen«, sagte Edna und guckte sich nicht um. Edna war gewöhnlich sehr gut mit Cheryl, aber jetzt war sie müde. Wir hatten nicht viel Schlaf bekommen, und sie wurde immer ein bißchen gereizt, wenn sie nicht richtig schlief. »Wir sollten die verdammte Karre bei der ersten Gelegenheit loswerden«, sagte sie.
»Wo ist die erste Gelegenheit?« fragte ich. Ich wußte, daß sie auf die Karte gesehen hatte.
»Rock Springs, Wyoming«, sagte Edna mit Nachdruck. »Dreißig Meilen die Straße runter.« Sie deutete mit dem Finger nach vorn.
Eigentlich hatte ich mir gewünscht, mit dem Wagen wie ein reicher Protz in Florida anzukommen. Aber ich wußte, daß Edna recht hatte, daß wir kein so verrücktes Risiko eingehen sollten. Für mich war das mein Wagen gewesen und nicht der des Augenarztes, und das war genau die Art, wie man sich in so ’ner Sache verfing.
»Dann ist es meine feste Überzeugung, daß wir nach Rock Springs gehen und uns ein neues Auto erstehen sollten«, sagte ich. Ich wollte nicht, daß wir die gute Laune verloren. Es sollte alles gut weiterlaufen.
»Großartige Idee«, sagte Edna, und sie beugte sich zu mir herüber und küßte mich fest auf den Mund.
»Großartige Idee«, sagte Cheryl. »Laß uns auf der Stelle hier wegfahren.«
Ich erinnere mich an den Sonnenuntergang an diesem Tag. Er war der schönste, den ich je gesehen hab. Als die Sonne den Rand des Horizonts gerade berührte, feuerte sie auf einmal nach allen Seiten Juwelen und leuchtende rote Brillanten in die Luft. So etwas hatte ich noch nie vorher gesehen und auch seitdem nicht mehr. Die Sonnenuntergänge im Westen sind die schönsten, sogar schöner als in Florida, wo es zwar flach ist, aber meistens Bäume im Weg sind.
»Cocktail-Zeit«, sagte Edna, nachdem wir eine Weile gefahren waren. »Wir sollten was trinken und irgendwas feiern.« Sie fühlte sich besser, seit sie wußte, daß wir den Wagen bald loswerden würden. Die Sache mit der Öllampe war undurchsichtig und etwas, das man besser hinter sich ließ.
Edna holte die Whiskeyflasche heraus und versuchte, auf der Handschuhfachklappe zwei Pappbecher genau gleich hoch zu füllen. Sie trank gerne, besonders im Auto. Das war etwas, woran man sich in Montana gewöhnte, wo es nicht verboten war, wo man aber, seltsam genug, wegen eines faulen Schecks ein Jahr im Deer-Lodge-Gefängnis landete.
»Hab ich dir erzählt, daß ich mal ’nen Affen hatte?« fragte Edna und setzte meinen Drink auf das Armaturenbrett, wo ich ihn mir nehmen konnte, wenn ich soweit war. Sie war schon wieder besserer Stimmung. So war sie, mal gutgelaunt und eine Minute später ganz runter.
»Ich glaub nicht«, sagte ich. »Wo war das?«
»Missoula«, sagte sie. Sie stemmte ihre nackten Füße gegen das Armaturenbrett und stützte den Becher auf die Brust. »Ich arbeitete als Serviererin in einem Veteranenklub. Das war noch, bevor wir uns kennengelernt haben. Eines Tages kam ein Typ mit einem Affen rein. Einem Klammeraffen. Ich hab ’n Witz gemacht und gesagt: ›Ich würfel mit dir um den Affen.‹ Und er sagt: ›Nur einen Wurf?‹ Und ich sag: ›Okay.‹ Er setzte den Affen auf die Bar, nahm den Becher und warf ein Paar Sechsen und ’ne Zwei. Ich nahm den Becher und warf drei Fünfen. Und ich stand da und sah den Typ an. Er war einfach jemand, der da durchkam, ein Vet, nehm ich an. Er bekam einen seltsamen Gesichtsausdruck – bestimmt nicht so seltsam wie meiner in dem Moment –, aber er sah ein bißchen traurig und überrascht und gleichzeitig auch zufrieden aus. Ich sagte: ›Komm, wir können nochmal würfeln.‹ Aber er sagte: ›Nein, ich würfel nie zweimal um irgendwas.‹ Und er saß da und trank ’n Bier und redete über alles mögliche, über den Atomkrieg und darüber, sich in den Bergen irgendwo einen Bunker zu bauen, während ich nur immer den Affen ansah und mir überlegte, was ich mit ihm machen sollte, wenn der Mann verschwand. Und ziemlich bald stand er auf und sagte: ›Na denn, leb wohl, Chipper‹ – das war natürlich der Name von dem Affen. Und dann ging er, bevor ich irgendwas sagen konnte. Und der Affe saß den ganzen Abend auf der Theke. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt daran gedacht hab, Earl. Es ist irgendwie verrückt. Ich hab so rumgeträumt.«
»Das macht überhaupt nichts«, sagte ich. Ich trank etwas. »Ich würd mir nie ’n Affen zulegen«, sagte ich nach einer Minute. »Sie sind mir irgendwie zuwider. Aber Cheryl hätte bestimmt gern einen, stimmt’s Süße?« Cheryl lag auf dem Rücksitz und spielte mit Duke. Sie hatte früher oft über Affen geredet. »Was hast du denn bloß mit dem Affen gemacht?« fragte ich und achtete auf den Tacho. Wir mußten jetzt langsamer fahren, weil das rote Lämpchen immer wieder aufflackerte. Nur wenn ich langsamer fuhr, erlosch es. Wir hatten etwa sechzig drauf, und es war nur noch eine Stunde bis zum Dunkelwerden, und ich hoffte, daß Rock Springs nicht mehr weit war.
»Willst du’s wirklich wissen?« fragte Edna. Sie warf mir einen kurzen Blick zu, sah dann auf die leere Wüste zurück, als müßte sie darüber nachdenken.
»Sicher«, sagte ich. Ich versuchte immer noch so zu tun, als wär ich bester Stimmung. Ich dachte, ich könnte meine Sorge um den Wagen für mich behalten und zur Abwechslung mal die anderen glücklich sein lassen.
»Ich hab ihn eine Woche gehabt.« Und sie erschien mir plötzlich sehr düster, als sähe sie etwas in der Geschichte, was ihr zuvor nie aufgefallen war. »Ich nahm ihn mit nach Haus und dann immer mit mir hin und her, wenn ich zur Arbeit in den Klub fuhr. Er machte mir überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich machte ihm einen Stuhl zurecht, auf dem er hinter der Bar sitzen konnte, und die Leute mochten ihn. Er gab so leise schnalzende Laute von sich. Wir tauften ihn in Mary um, weil der Barmann herauskriegte, daß er ein Mädchen war. Aber ich fühlte mich nie richtig wohl, wenn er bei mir im Haus war. Er beobachtete mich zuviel. Dann kam eines Tages ein Typ zu mir, der in Vietnam gewesen war und immer noch seine Kampfjacke trug. Und der sagte: ›Weißt du nicht, daß ’n Affe dich umbringen kann? Er hat mehr Kraft in den Fingern als du in deinem ganzen Körper.‹ Er sagte, in Vietnam wären Leute von Affen getötet worden, von Horden von Affen, die sich auf einen stürzten, wenn man schlief, sie bringen einen um und bedecken die Leiche mit Blättern. Ich hab ihm kein Wort geglaubt, aber als ich nach Haus kam und mich auszog, mußte ich immer wieder zu Mary rübergucken, die im Dunkeln auf ihrem Stuhl saß und mich beobachtete. Sie war mir richtig unheimlich geworden. Und nach ’ner Weile stand ich auf und ging zum Auto raus und holte ein Stück Plastikwäscheleine und band sie an Marys kleines Silberhalsband und das andere Ende an die Türklinke. Dann ging ich wieder ins Bett und versuchte zu schlafen. Und ich muß geschlafen haben wie eine Tote – obwohl ich mich nicht erinnern kann –, denn als ich aufstand, sah ich, daß Mary über die Stuhllehne gefallen war und sich an der Wäscheleine erhängt hatte. Ich hatte sie zu kurz gemacht.«
Die Geschichte schien Edna sehr mitzunehmen, und sie rutschte so weit in ihrem Sitz zurück, daß sie nicht mehr über das Armaturenbrett gucken konnte. »Ist das nicht eine schreckliche Geschichte, Earl, was mit dem armen kleinen Affen passiert ist?«
»Ich seh ’ne Stadt, ich seh ’ne Stadt!« rief Cheryl vom Rücksitz, und der kleine Duke fing sofort an zu bellen, und im Wagen war ein Höllenlärm. Aber sie hatte tatsächlich etwas gesehen, was mir nicht aufgefallen war, und das war Rock Springs, Wyoming, in einer Senke vor uns, ein kleiner leuchtender Edelstein in der Wüste. Die I-80 führte nördlich daran vorbei, und dahinter breitete sich die dunkle Wüste aus.
»Stimmt, Süße«, sagte ich. »Da wollen wir hin, und du hast es zuerst gesehen.«
»Wir haben Hunger«, sagte Cheryl. »Duke möchte ein bißchen Fisch, und ich möchte Spaghetti.« Sie legte mir die Arme um den Hals und umarmte mich.
»Dann werden wir dir das mal einfach kaufen«, sagte ich. »Du kannst haben, was du willst. Und Edna auch und der kleine Duke auch.« Ich sah Edna lächelnd an, aber sie starrte mit wütenden Augen zurück. »Was ist los?« sagte ich.
»Dir ist anscheinend ganz egal, was mir damals passiert ist.« Sie preßte die Lippen zusammen, und ihre Augen schossen wütend immer wieder zu Cheryl und Duke zurück, als hätten die beiden sie die ganze Zeit gequält.
»Natürlich nicht«, sagte ich. »Ich finde das furchtbar.«
Ich wollte nicht, daß sie unglücklich war. Wir waren fast da, und bald würden wir in einem Restaurant sitzen und ein richtiges Abendessen zu uns nehmen und nicht daran denken, daß irgend jemand verletzt sein könnte.
»Willst du wissen, was ich mit dem Affen gemacht hab?« sagte Edna.
»Sicher«, sagte ich.
»Ich hab ihn in einen grünen Müllsack gesteckt, ihn in den Kofferraum gelegt, bin zur Müllkippe gefahren und hab ihn da hingeworfen.« Sie starrte mich düster an, als wäre ihr die Geschichte sehr wichtig, als bedeutete sie etwas, das nur sie und sonst niemand auf der Welt verstehen konnte.
»Ja, das ist entsetzlich«, sagte ich. »Aber du hättest wirklich nichts anderes tun können. Du wolltest ihn ja nicht umbringen. Dann hättest du’s anders gemacht. Und dann mußtest du ihn ja irgendwie loswerden, und ich finde, dir blieb gar nichts anderes übrig. Ihn so wegzuwerfen, mag anderen vielleicht hart erscheinen, aber mir nicht. Manchmal kann man einfach nicht mehr tun, und man sollte sich nicht soviel Sorgen darüber machen, was andere denken.« Ich versuchte, sie anzulächeln, aber das rote Lämpchen leuchtete, wenn ich überhaupt nur das Gaspedal berührte, und ich versuchte abzuschätzen, ob wir bis Rock Springs rollen würden, wenn der Motor jetzt ganz ausfiel. Ich sah Edna wieder an. »Was kann ich sonst dazu sagen?« sagte ich.
»Nichts«, sagte sie und starrte wieder auf die dunkle Straße hinaus. »Ich hätte wissen müssen, daß du so was denkst. Irgendwo fehlt was in deinem Charakter, Earl. Ich weiß das schon lange.«
»Und trotzdem bist du hier«, sagte ich. »Und es geht dir gar nicht so schlecht. Es könnte viel schlechter sein. Zumindest sind wir alle zusammen.«
»Es gibt immer noch was Schlechteres«, sagte Edna. »Du könntest morgen auf den elektrischen Stuhl kommen.«
»Genau«, sagte ich. »Und irgendwo wird irgendwer darauf sitzen. Nur, du wirst es nicht sein.«
»Ich hab Hunger«, sagte Cheryl. »Wann essen wir? Laß uns ein Motel suchen. Ich hab keine Lust mehr zu fahren. Der kleine Duke hat auch keine Lust mehr.«
Als der Wagen ausrollte, waren wir immer noch ein wenig von der Stadt entfernt, aber man konnte die klare Linie des Interstate Highways sehen, der auf einer Autobahnbrücke unsere Straße überquerte, und dahinter war der helle Himmel über Rock Springs. Man konnte hören, wie die schweren Lastwagen über die Träger der Überführung donnerten und wie die Motoren für den langen Anstieg in die Berge hochgejagt wurden.
Ich schaltete die Scheinwerfer aus.
»Was machen wir jetzt?« sagte Edna gereizt und warf mir einen bitteren Blick zu.
»Ich denk grade drüber nach«, sagte ich. »Schlimm kann’s nicht werden, wie auch immer. Du brauchst nichts zu tun.«
»Will ich auch hoffen«, sagte sie und sah weg.
Auf der anderen Seite der Straße und etwa hundert Meter hinter dem ausgetrockneten Bett eines Flusses lag etwas, das aussah wie eine riesige Stadt aus Wohnwagen mit einer Fabrik oder Raffinerie, die voll erleuchtet war, offenbar in Betrieb. In vielen der Wohnwagen brannte Licht, und man sah ein paar Autos auf einer Stichstraße, die etwa eine Meile hinter der Highwayüberführung in unsere Straße mündete. Das Licht in den Wohnwagen wirkte freundlich, und ich wußte sofort, was ich tun konnte.
»Steigt aus«, sagte ich und öffnete meine Tür.
»Gehn wir zu Fuß?« sagte Edna.
»Wir schieben.«
»Ich schieb nicht.« Edna drückte den Knopf herunter, um ihre Tür zu verriegeln.
»Gut«, sagte ich, »dann Steuer wenigstens.«
»Du schiebst uns nach Rock Springs, was, Earl? Es sind ja auch nur vier Kilometer oder so.«
»Ich schieb mit«, sagte Cheryl vom Rücksitz.
»Nein, Süße. Daddy schiebt. Du steigst mit Duke aus und läufst nicht vor das Auto.«
Edna sah mich drohend an, als hätte ich versucht, sie zu schlagen. Aber als ich ausgestiegen war, rutschte sie hinters Steuer. Sie starrte wütend nach vorn in die trockenen Weidensträucher.
»Edna kann das Auto nicht fahren«, sagte Cheryl aus der Dunkelheit heraus. »Sie fährt es in den Graben.«
»Nein, sie kann fahren, Süße. Edna kann genausogut fahren wie ich. Wahrscheinlich besser.«
»Kann sie nicht«, sagte Cheryl. »Kann sie gar nicht.« Und ich dachte, sie würde anfangen zu weinen, aber sie tat es nicht.
Ich sagte Edna, daß sie die Zündung eingeschaltet lassen mußte, damit das Lenkschloß nicht einschnappte, und daß sie den Wagen in die Weidensträucher lenken sollte. Sie sollte das Standlicht einschalten, damit sie etwas sehen konnte. Und als ich anfing zu schieben, steuerte sie den Wagen geradewegs in die Sträucher, bis wir etwa zwanzig Meter weit drin waren. Die Reifen sanken in den weichen Sand, die Sträucher verdeckten den Wagen, und von der Straße aus war nichts mehr zu sehen.
»So, und nun?« fragte sie und blieb hinter dem Lenker sitzen. Ihre Stimme war müde und hart, und ich wußte, daß sie gut etwas zu essen gebrauchen konnte. Sie war an sich sehr gutmütig, und ich war mir klar, daß dies hier mein Fehler war und nicht ihrer. Ich wünschte mir nur, daß sie nicht so hoffnungslos wäre.
»Ihr bleibt hier, und ich geh rüber zu dem Wohnwagenpark da und ruf uns ’n Taxi«, sagte ich.
»Was für’n Taxi?« sagte Edna und verzog den Mund, als hätte sie noch nie im Leben was von einem Taxi gehört.
»Es wird ja wohl Taxis geben«, sagte ich und versuchte zu lächeln. »Taxis gibt’s überall.«
»Was willst du ihm sagen, wenn er hier ist? Unser geklautes Auto ist kaputtgegangen, und er soll uns irgendwo hinbringen, wo wir ein neues klauen können? Großartig, Earl!«
»Laß mich mit ihm reden«, sagte ich. »Hört ihr mal zehn Minuten Radio und geht dann an die Straße, als ob nichts wär. Und sei nett zu Cheryl. Sie braucht das mit dem Wagen nicht zu wissen.«
»Als ob nichts wär? Wir sind auch so schon verdächtig genug, nicht?« Edna sah aus dem erleuchteten Wagen heraus zu mir auf. »Du denkst irgendwie falsch, Earl, ist dir das eigentlich klar? Du denkst, die ganze Welt ist dumm und du bist schlau. Aber so ist das nicht. Du tust mir leid. Du bist vielleicht mal was gewesen, aber irgendwo ist bei dir was schiefgelaufen.«
Ich mußte an den armen Danny denken. Er war im Krieg gewesen und verrückt wie ein Huhn, und ich war froh, daß er nicht in dieser Situation steckte. »Hol nur die Kleine wieder ins Auto«, sagte ich. Ich versuchte, geduldig zu sein. »Ich bin genauso hungrig wie du.«
»Ich hab das alles satt«, sagte Edna. »Wär ich bloß in Montana geblieben.«
»Du kannst ja morgen früh zurückfahren«, sagte ich. »Ich kauf dir die Fahrkarte und bring dich zum Bus. Aber vor morgen früh geht’s nicht.«
»Nun mach schon, Earl.« Sie ließ sich in den Sitz rutschen und machte mit einem Fuß das Standlicht aus und mit dem anderen das Radio an.
Eine so große Ansammlung von Wohnwagen hatte ich noch nie gesehen. Sie hatten ganz offensichtlich etwas mit der Fabrik zu tun, denn ich sah immer mal wieder ein Auto aus den Straßen zwischen den Wohnwagen kommen, auf die Fabrik zusteuern und dann langsam hineinfahren. Alles an der Fabrik war weiß, und auch die Wohnwagen waren weißlackiert. Sie sahen alle gleich aus. Ein tiefes Summen kam von der Fabrik her, und als ich näher herankam, dachte ich, daß ich an einem solchen Ort nie würde arbeiten wollen.
Ich ging direkt auf den ersten Wohnwagen zu, der erleuchtet war, und klopfte an die Metalltür. Kinderspielzeug lag auf dem Kiesboden vor den niedrigen Holzstufen, und ich hörte Stimmen aus dem Fernseher, die plötzlich verstummten. Eine Frau sagte etwas, und dann ging die Tür weit auf.
Eine große schwarze Frau mit einem breiten freundlichen Gesicht stand in der Tür. Sie lächelte mich an, und sie machte einen Schritt nach vorn, als wollte sie zu mir heraustreten, aber dann blieb sie auf der obersten Stufe stehen. Dicht hinter ihr stand ein kleiner Junge und sah mich neugierig an ihren Beinen vorbei mit halbgeschlossenen Augen an. Man hatte das Gefühl, daß sonst niemand in dem Wohnwagen war, ein Gefühl, das ich kannte.
»Entschuldigen Sie, daß ich störe«, sagte ich. »Aber ich hab heut abend ein bißchen Pech gehabt. Mein Name ist Earl Middleton.«
Die Frau sah mich an, dann in die Nacht hinaus in Richtung auf die Straße, als könnte sie dort sehen, was mir passiert war. »Was für’n Pech?« fragte sie und sah wieder auf mich herunter.
»Mein Wagen ist kaputtgegangen«, sagte ich. »Ich kann’s allein nicht reparieren, und ich wollte Sie bitten, mich telefonieren zu lassen.«
Die Frau lächelte mich wissend an. »Ohne Autos können wir nicht leben, nicht?«
»Das kann man wohl sagen«, sagte ich.
»Sie sind wie unsere Herzen«, sagte sie. Ihr Gesicht glänzte im Schein der Birne, die neben der Tür brannte. »Wo haben Sie Ihren Wagen?«
Ich drehte mich um und sah in die Dunkelheit hinaus, aber ich konnte nichts sehen. »Er ist da drüben«, sagte ich. »Sie können’s jetzt im Dunkeln nicht sehen.«
»Sind Sie allein?« fragte die Frau. »Oder haben Sie Ihre Frau bei sich?«
»Sie ist mit meiner kleinen Tochter und unserem Hund im Wagen«, sagte ich. »Meine Tochter schläft, sonst hätte ich sie mitgebracht.«
»Sie hätten sie nicht allein im Dunkeln lassen sollen«, sagte die Frau und runzelte die Stirn. »Es passiert heutzutage soviel Unerfreuliches da draußen.«
»Ich geh ja gleich wieder zurück.« Ich versuchte, aufrichtig zu wirken, denn alles, außer daß Cheryl schlief und Edna meine Frau war, stimmte. Die Wahrheit soll einem ja helfen, wenn man sie nur läßt, und ich brauchte diese Hilfe jetzt. »Ich geb Ihnen das Geld für den Anruf«, sagte ich. »Wenn Sie mir den Apparat an die Tür bringen, telefonier ich von hier aus.«
Die Frau sah mich wieder an, als suchte sie nach einer eigenen Wahrheit, und blickte dann wieder hinaus in die Nacht. Sie war vielleicht in den Sechzigern, aber ich war mir nicht sicher. »Sie werden mich doch nicht berauben, Mr. Middleton?« Sie lächelte, als wäre das ein Witz zwischen uns beiden.
»Nicht heute abend«, sagte ich und lächelte diesmal wirklich. »Heut abend fühl ich mich überhaupt nicht danach. Vielleicht später mal.«
»Dann können Terrel und ich Sie wohl unser Telefon benutzen lassen, was, Terrel? Auch wenn Daddy nicht hier ist. Das ist mein Enkel, Terrel junior, Mr. Middleton.« Sie legte dem Jungen die Hand auf den Kopf und sah auf ihn hinunter. »Terrel redet nicht. Aber wenn er was sagen könnte, würd er Ihnen sagen, daß Sie das Telefon benutzen können. Er ist ein süßer Junge.« Sie öffnete die Fliegengittertür, damit ich hineinkonnte.
Es war ein großer Wohnwagen mit einem neuen Teppich, einer neuen Couch und einem Wohnzimmer, das so groß war wie in einem richtigen Haus. Etwas Gutes, süßlich Riechendes war in der Küche auf dem Herd, und man hatte das Gefühl, daß dies ein wirkliches Heim war und nichts nur Vorübergehendes. Ich hab selbst schon in Wohnwagen gewohnt, aber das waren kleine Schneckenhäuschen mit einem Raum und ohne Toilette, und man fühlte sich in ihnen immer verkrampft und unglücklich – aber vielleicht lag’s auch an mir, daß ich in ihnen unglücklich war.
Da stand ein großer Sony-Fernseher, und eine Menge Spielzeug lag auf dem Boden herum. Ich erkannte einen Greyhoundbus wieder, den ich Cheryl auch mal gekauft hatte. Das Telefon stand auf einem Tisch neben einem neuen Leder-Recliner, und die schwarze Frau bedeutete mir mit einer Handbewegung, mich hinzusetzen und zu telefonieren. Sie gab mir das Telefonbuch. Terrel nahm eine seiner Spielsachen in die Hand und fummelte daran herum, und die Frau setzte sich auf die Couch und sah mir lächelnd zu, während ich telefonierte.
Drei Taxiunternehmen waren im Telefonbuch, sie unterschieden sich nur durch eine Zahl voneinander. Ich wählte eine Nummer nach der anderen, aber nur bei der dritten nahm jemand ab und meldete sich mit dem Namen des zweiten Unternehmens. Ich sagte, daß ich mich auf der Straße vor der Highwaybrücke befände und daß meine Familie und ich in die Stadt gefahren werden wollten. Für den Abschleppdienst würde ich später sorgen. Während ich unseren genauen Standort angab, sah ich im Buch noch nach dem Namen eines Abschleppunternehmens, falls der Fahrer später danach fragte.
Als ich einhängte, saß die schwarze Frau da und sah mich mit demselben Blick an, mit dem sie in die Dunkelheit gestarrt hatte, ein Blick, als suchte sie die Wahrheit. Aber sie lächelte zugleich. Irgend etwas machte ihr Freude, und ich erinnerte sie daran.
»Sie haben hier ein schönes Heim«, sagte ich und lehnte mich in dem Rechner zurück, es war ein Gefühl wie im Fahrersitz des Mercedes. Ich wär gerne darin sitzengeblieben.
»Das ist nicht unser Haus, Mr. Middleton«, sagte die schwarze Frau. »Es gehört der Gesellschaft. Sie gibt es uns umsonst. Unser eigenes Haus ist in Rockford in Illinois.«
»Schön«, sagte ich.
»Es ist nie schön, wenn man nicht zu Haus sein kann, Mr. Middleton, auch wenn wir erst drei Monate hier sind. Es wird leichter werden, wenn Terrel junior auf seine besondere Schule geht. Wissen Sie, unser Sohn ist im Krieg gefallen, und seine Frau ist davongelaufen und hat Terrel junior einfach zurückgelassen. Keine Sorge, er kann uns nicht verstehen. Ihn kann das nicht in seinen kleinen Gefühlen verletzen.« Die Frau faltete die Hände im Schoß und lächelte ihr zufriedenes Lächeln. Sie war eine attraktive Frau und trug ein blau-rosa geblümtes Kleid, das sie dicker erscheinen ließ, als sie war. Sie paßte genau zu der Couch, auf der sie saß. Sie war das Bild der Gutmütigkeit überhaupt, und ich war froh für sie, denn sie hatte es nicht leicht. Sie lebte mit dem kleinen hirngeschädigten Jungen an einem Ort, wo niemand, der klar denken konnte, auch nur eine Minute hätte leben wollen. »Wo wohnen Sie, Mr. Middleton?« fragte sie höflich, immer noch mit demselben sympathischen Lächeln.
»Ich ziehe gerade mit meiner Familie um«, sagte ich. »Ich bin Augenarzt, und wir ziehen nach Florida zurück. Ich komme von da. Ich will in einer kleinen Stadt da unten, wo es das ganze Jahr warm ist, eine Praxis aufmachen. Ich weiß noch nicht genau, wo.«
»Florida ist wunderschön«, sagte die Frau. »Ich glaub, Terrel würd’s da gefallen.«
»Darf ich Sie etwas fragen?« sagte ich.
»Aber sicher dürfen Sie das«, sagte die Frau. Terrel hatte begonnen, seinen Greyhound über den TV-Schirm zu schieben, und machte eine Schramme, die niemand übersehen konnte, der fernsehen wollte. »Laß das, Terrel junior«, sagte die Frau ruhig. Aber Terrel schob den Bus weiter über das Glas, und sie lächelte mich wieder an, als verstünden wir beide etwas Trauriges. Nur daß ich wußte, daß Cheryl niemals einen Fernsehapparat beschädigen würde. Sie hatte Achtung vor guten Dingen, und es tat mir für die Frau leid, daß Terrel nicht so war.
»Was wollten Sie fragen?« sagte die Frau.
»Was machen die in der Fabrik oder was immer das ist dahinten hinter den Wohnwagen, wo all die Lichter brennen?«
»Gold«, sagte die Frau und lächelte.
»Was?« sagte ich.
»Gold«, sagte die schwarze Frau und lächelte, wie sie fast die ganze Zeit, seit ich da war, gelächelt hatte. »Das ist eine Goldmine.«
»Dahinten bauen die Gold ab?« sagte ich und deutete mit dem Finger dahin.
»Jeden Tag und jede Nacht.« Sie lächelte freudig.
»Arbeitet Ihr Mann da?« fragte ich.
»Er ist Prüfer«, sagte sie. »Er kontrolliert die Qualität. Er arbeitet drei Monate im Jahr, und den Rest der Zeit wohnen wir zu Hause in Rockford. Wir haben lange darauf gewartet, so leben zu können. Wir sind glücklich, unseren Enkel bei uns zu haben, aber ich kann nicht sagen, daß ich traurig sein werde, wenn er in das Heim geht. Wir wollen noch einmal neu anfangen.« Sie lächelte erst mich und dann Terrel breit an, der sie trotzig vom Fußboden aus ansah. »Sie sagten, Sie haben eine Tochter«, sagte die schwarze Frau. »Und wie heißt sie?«
»Irma Cheryl«, sagte ich. »Nach meiner Mutter.«
»Das ist schön. Und sie ist gesund. Das seh ich Ihrem Gesicht an.« Sie sah voller Mitleid auf Terrel junior.
»Ja, ich glaub, ich hab Glück gehabt«, sagte ich.
»Bis jetzt ja. Aber Kinder machen einem Kummer, genauso wie sie einen glücklich machen. Wir waren lange sehr unglücklich, bis mein Mann diesen Job in der Goldmine kriegte. Wenn Terrel jetzt in seine Heimschule geht, werden wir wieder jung sein.« Sie stand auf. »Sie verpassen Ihr Taxi, Mr. Middleton«, sagte sie und ging zur Tür. Es war aber kein Hinauswurf, dazu war sie zu höflich. »Wenn wir Ihren Wagen nicht sehen können, wird’s der Taxifahrer erst recht nicht können.«
»Da haben Sie recht.« Ich erhob mich aus dem Sessel, in dem ich so bequem gesessen hatte. »Wir haben noch nicht gegessen, und der Essensgeruch hier macht mir klar, wie hungrig wir wahrscheinlich alle sind.«
»In der Stadt gibt es sehr gute Restaurants, und Sie werden sie leicht finden«, sagte die schwarze Frau. »Es tut mir leid, daß sie meinen Mann nicht kennengelernt haben. Er ist ein wunderbarer Mann. Er ist mein ein und alles.«
»Sagen Sie ihm bitte, daß ich für das Telefonieren danke«, sagte ich. »Sie haben mich gerettet.«
»War nicht schwer, Sie zu retten«, sagte die Frau. »Dafür sind wir auf der Erde, um Leute zu retten. Ich hab Sie nur an das weitergegeben, was noch auf Sie zukommt.«
»Hoffen wir, daß es was Gutes ist«, sagte ich und trat wieder in die Dunkelheit.
»Ich hoff es für Sie, Mr. Middleton. Terrel und ich werden beide für Sie hoffen.«
Ich winkte ihr zu, als ich durch die Dunkelheit zu dem in der Nacht verborgenen Wagen ging.
Das Taxi war schon da, als ich ankam. Ich sah das kleine rotgrüne Licht auf seinem Dach über das trockene Flußbett hinweg, und ich war ein wenig besorgt, daß Edna schon etwas gesagt hatte, das uns in Schwierigkeiten bringen könnte, etwas über den Wagen oder woher wir kamen, etwas, das uns verdächtig machte. Ich überlegte mir dann, daß ich die Dinge eigentlich nie gut genug plante. Immer gab es eine Lücke zwischen meinen Plänen und dem, was geschah, und ich reagierte nur auf die Dinge, die auftauchten, und hoffte, irgendwie durchzukommen. Aus der Sicht des Gesetzes war ich ein Verbrecher. Aber ich dachte immer anders, ich dachte immer so, als wäre ich kein Verbrecher, und ich hatte wirklich nicht die Absicht, einer zu sein, das war die Wahrheit. Aber wie ich einmal auf einer Serviette gelesen hatte, liegt zwischen Absicht und Tat ein ganzes Königreich. Und ich hatte es immer schwer mit meinen Taten, die oftmals Vergehen waren, und meinen Absichten, die so gut waren wie das Gold, das sie dort, wo die Lichter so hell strahlten, abbauten.
»Wir warten schon auf dich, Daddy«, sagte Cheryl, als ich die Straße überquerte. »Der Taximann ist schon hier.«
»Das seh ich, Süße«, sagte ich und nahm sie in die Arme. Der Fahrer saß im erleuchteten Wagen und rauchte. Edna stand hinten zwischen den Schlußlichtern an den Wagen gelehnt. Sie trug ihren Baileyhut. »Was hast du ihm gesagt?« sagte ich, als ich bei ihr war.
»Nichts«, sagte sie. »Was ist da zu sagen?«
»Hat er den Wagen gesehn?«
Sie sah zu den Sträuchern hinüber, hinter denen der Mercedes versteckt war. In der Dunkelheit war nichts zu sehen, aber ich hörte den kleinen Duke, der im Unterholz auf der Spur von irgendwas herumlief, sein kleines Halsband klingelte. »Wo fahren wir hin?« fragte sie. »Ich hab so’n Hunger, ich fall gleich in Ohnmacht.«
»Edna hat schlechte Laune«, sagte Cheryl. »Sie hat mit mir geschimpft.«
»Wir sind alle müde, Süße«, sagte ich. »Versuch, lieb zu sein.«
»Sie ist nie lieb«, sagte Cheryl.
»Lauf und hol Duke«, sagte ich. »Und komm schnell wieder her.«
»Meine Fragen werden hier wohl gar nicht mehr beantwortet, was?« sagte Edna.
Ich legte den Arm um sie. »Das ist nicht wahr.«
»Hast du in den Wohnwagen eine gefunden, mit der du lieber zusammen wärst? Du warst ja lang genug weg.«
»So was solltest du nicht sagen«, sagte ich. »Ich hab nur versucht, die Dinge richtig darzustellen, damit wir nicht im Knast landen.«
»Damit du nicht im Knast landest, meinst du.« Edna stieß ein kurzes Lachen hervor, das ich nicht gerne hörte.
»Das stimmt. Damit ich nicht im Knast lande«, sagte ich. »Mich würd’s erwischen.« Ich starrte auf die große erleuchtete Ansammlung von weißen Gebäuden hinaus und auf die Lichter in der Wohnwagenstadt. Weiße Rauchpilze stiegen in den herzlosen Himmel von Wyoming, der ganze Gebäudekomplex sah aus wie eine unglaubliche Burg, die in einem verzerrten Traumbild vor sich hin summte. »Weißt du, was all die Gebäude da drüben sind?« sagte ich zu Edna, die sich nicht bewegt hatte und die aussah, als hätte sie keine Lust, sich jemals wieder zu bewegen.
»Nein. Aber es ist mir auch völlig egal. Es ist kein Motel und auch kein Restaurant.«
»Es ist eine Goldmine«, sagte ich und starrte auf die Goldmine, die, wie ich jetzt wußte, weiter entfernt war, als es schien, denn gegen den kalten Himmel wirkte sie riesig und nah. Ich fand, daß sie eigentlich von einer Mauer umgeben sein sollte, nicht nur von einem beleuchteten Zaun. Es schien, als könnte jeder hinein und sich nehmen, was er wollte, genauso, wie ich zu dem Wohnwagen der Frau gegangen war und das Telefon benutzt hatte. Aber das war offensichtlich nicht richtig.
Da begann Edna zu lachen. Nicht die gemeine Lache, die ich nicht mochte, sondern ein Lachen mit Gefühl, ein volles Lachen wie über einen guten Witz, das Lachen, das sie lachte, als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte, 1979 in der East Gate Bar in Missoula. Es war ein Lachen, das wir oft geteilt hatten, als Cheryl noch bei ihrer Mutter war und ich den Job beim Hunderennen hatte und keine Autos klaute und Kaufleuten keine faulen Schecks unterschob. Das war eine bessere Zeit. Aus irgendeinem Grund ließ ich mich von ihrem Lachen anstecken, und wir standen beide hinter dem Taxi im Dunkeln und lachten über die Goldmine. Ich hatte immer noch den Arm um sie gelegt, und Cheryl versuchte, den kleinen Duke aus dem Gebüsch herauszuscheuchen, und der Fahrer rauchte im Wagen, und unser gestohlener Mercedes Benz, mit dem ich in Florida hatte Eindruck machen wollen, steckte bis zu den Achsen im Sand, und ich würde ihn nie wiedersehen.
»Ich hab mich immer gefragt, wie eine Goldmine aussieht«, sagte Edna und wischte sich eine Träne aus den Augen.
»Ich auch«, sagte ich. »Ich war auch immer neugierig darauf.«
»Wir sind zwei Dummköpfe, was, Earl?« sagte sie und konnte nicht aufhören zu lachen. »Wir passen gut zusammen.«
»Ist aber vielleicht ’n gutes Zeichen«, sagte ich.
»Wieso das? Ist ja nicht unsere Goldmine. Sie verteilen da nichts.« Sie lachte immer noch.
»Wir haben sie gesehen«, sagte ich und deutete darauf. »Da drüben ist sie. Vielleicht bedeutet es, daß wir schon näher dran sind. Es gibt Leute, die sehen nie so was.«
»Das kann man nicht sehen nennen, Earl«, sagte sie. »Das ist keine richtige Goldmine, und wir haben sie nicht richtig gesehen.«
Und sie drehte sich um und stieg ins Taxi.
Der Fahrer fragte nicht nach unserem Wagen oder wo er war, und er schien nichts Merkwürdiges zu bemerken. Das gab mir das Gefühl, daß wir von dem Wagen glatt weggekommen waren und uns nichts mit ihm in Verbindung bringen konnte, bis es zu spät war, wenn überhaupt jemals. Der Fahrer erzählte uns eine Menge von Rock Springs, während wir in die Stadt fuhren. Wegen der Goldmine waren viele Leute hierhergezogen, in nur sechs Monaten, Leute von überallher, sogar von New York, und die meisten von ihnen wohnten in den Wohnwagen. Prostituierte aus New York, die er »B-Girls« nannte, waren auf der neuen Welle der Wohlhabenheit in die Stadt gekommen, und Cadillacs mit Nummernschildern aus New York fuhren nachts durch die kleinen Straßen, voller Schwarzer mit breitkrempigen Hüten, die die Frauen für sich laufen ließen. Er erzählte uns, daß alle, die jetzt in sein Taxi stiegen, wissen wollten, wo die Frauen waren, und als er unseren Anruf bekommen hatte, wär er fast nicht gekommen, weil einige der Wohnwagen Bordelle waren, die von der Gesellschaft für die Ingenieure und die Computerleute, die weit weg von zu Hause hier arbeiteten, eingerichtet worden waren. Er sagte, daß er es müde sei, nur für so widerliche Geschäfte raus- und reinzufahren. Sogar die Fernsehsendung 60 Minutes habe einmal über Rock Springs berichtet, aber an der Situation würde sich nichts ändern, bis der Boom vorbei sei. »Das sind die Früchte des Reichtums«, sagte der Fahrer. »Ich will lieber arm bleiben, und das ist mein Glück.«
Er sagte, daß all die Motels wahnsinnig teuer seien, aber da wir eine Familie seien, würde er uns eins zeigen, das man noch bezahlen könne. Aber ich sagte ihm, daß wir ein erstklassiges Motel wollten, in dem sie auch Tiere zuließen, und daß der Preis mir egal sei, wir hätten einen harten Tag hinter uns und wollten uns jetzt was Gutes tun. Außerdem wußte ich, daß die Polizei in den billigen Motels nach einem suchte. Die Leute, die ich kannte, wurden immer in billigen Hotels und Touristenmotels mit Namen, die man noch nie gehört hatte, verhaftet. Nie in Holiday Inns oder TraveLodges.
Ich bat ihn, uns ins Stadtzentrum zu fahren, damit Cheryl den Bahnhof sehen konnte, und während wir dort waren, sah ich einen rosa Cadillac mit einem New Yorker Nummernschild und TV-Antenne, den ein Schwarzer mit einem großen Hut langsam eine schmale Straße hinunterfuhr, in der es nur Bars und ein China-Restaurant gab. Es war ein seltsamer Anblick, etwas, das man hier nie erwartet hätte.
»Das sind einfach Kriminelle«, sagte der Fahrer, und er schien wirklich traurig darüber zu sein. »Es tut mir leid, daß Leute wie Sie so was mitansehen müssen. Dies ist eigentlich eine gute Stadt, aber hier gibt’s ein paar Leute, die ruinieren sie. Früher wußten die Leute noch, wie man mit solchem Abschaum und mit Kriminellen umgeht, aber das ist lange her.«
»Das können Sie laut sagen«, sagte Edna.
»Lassen Sie sich davon nicht so deprimieren«, sagte ich zu ihm. »Es gibt hier bestimmt mehr Leute wie Sie als solche. Und so wird’s immer sein. Sie sind die beste Reklame für diese Stadt. Ich weiß, daß Cheryl sich an Sie erinnern wird und nicht an den Mann, stimmt’s, Süße?« Aber Cheryl schlief schon. Sie hielt Duke auf dem Rücksitz im Taxi in den Armen.
Der Fahrer brachte uns zu einem Ramada Inn am Interstate Highway, nicht weit von der Stelle, wo unser Auto kaputtgegangen war. Mir tat es ein wenig leid, daß wir vor dem überdachten Eingang zum Inn nicht mit unserem Mercedes vorfuhren, sondern in einem zerbeulten alten Chrysler mit einem alten nörgelnden Mann am Steuer. Aber ich wußte ja, es war besser so. Wir waren ohne den Wagen besser dran; jeder andere Wagen war besser als der, in dem die Warnlampe angegangen war.
Ich schrieb mich mit einem falschen Namen ein und bezahlte sofort in bar, damit keine Fragen gestellt wurden. Unter »Beruf« trug ich »Augenarzt« ein und setzte einen Dr. vor den Namen. Es sah gut aus, obwohl es gar nicht mein Name war.
Als wir unser Zimmer betraten, das, wie ich verlangt hatte, nach hinten hinaus lag, steckte ich Cheryl in eins der Betten und legte Duke neben sie. Sie hatte nichts zu essen bekommen, aber sie würde dafür nur am Morgen um so hungriger sein, und dann konnte sie alles haben, was sie wollte. Ein paar verpaßte Mahlzeiten schaden einem Kind nicht. Ich hab viele verpaßt, und ich bin ja kein ganz schlechter Kerl geworden.
»Komm, wir essen Brathähnchen«, sagte ich zu Edna, als sie aus dem Bad kam. »In den Ramadas haben sie gute Hähnchen, und ich hab gesehen, daß der Speiseraum noch offen ist. Cheryl ist hier sicher, bis wir zurückkommen.«
»Ich glaub, ich hab gar keinen Hunger mehr«, sagte Edna. Sie stand am Fenster und starrte in die Dunkelheit hinaus. An ihr vorbei konnte ich am Himmel ein gelbliches, nebliges Glühen sehen. Einen Augenblick dachte ich, es wär die Goldmine, die den Himmel in der Ferne erhellte, aber es war nur die Autobahn.
»Wir können uns was raufschicken lassen«, sagte ich. »Was du willst. Da ist ’ne Speisekarte auf dem Telefonbuch. Du kannst ja einen Salat essen.«
»Iß du ruhig«, sagte sie. »Ich hab meinen Appetit verloren.« Sie saß neben Cheryl und dem kleinen Duke auf dem Bett und sah die beiden ganz gerührt an und legte die Hand an Cheryls Wange, als ob sie Fieber hätte. »Du kleine Süße«, sagte sie. »Alle haben dich lieb.«
»Was willst du jetzt machen?« fragte ich. »Ich würd wirklich ganz gerne was essen. Vielleicht laß ich mir Hähnchen raufkommen.«
»Ja, tu das doch«, sagte sie. »Du magst das doch so gerne.« Und sie lächelte mich an.
Ich setzte mich auf das andere Bett und rief den Service an. Ich bestellte Hähnchen, grünen Salat, eine Kartoffel und ein Brötchen, dazu ein Stück heißen Apfelkuchen und Eistee. Mir wurde klar, daß ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Als ich einhängte, sah ich, daß Edna mich beobachtet hatte, weder liebevoll noch böse, sondern einfach so, als verstünde sie etwas nicht und wollte mich danach fragen.