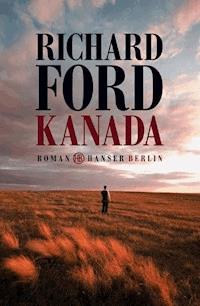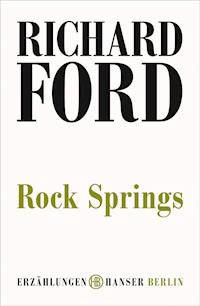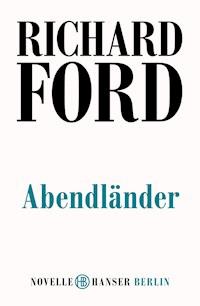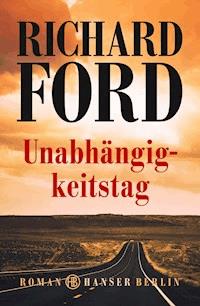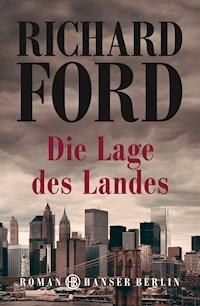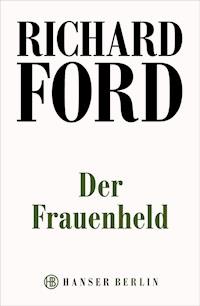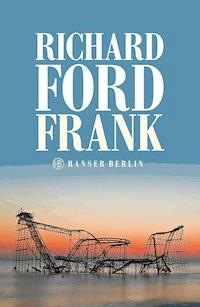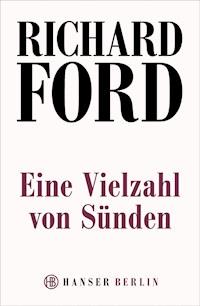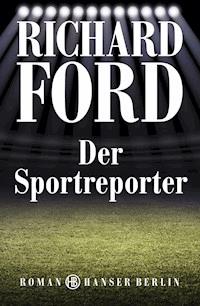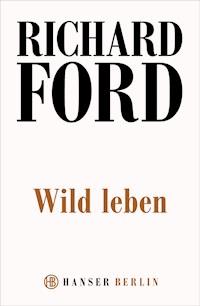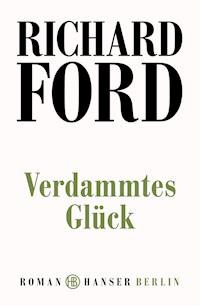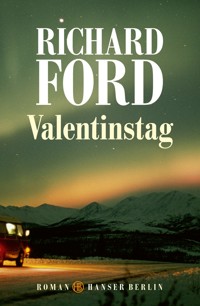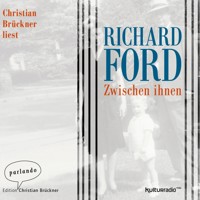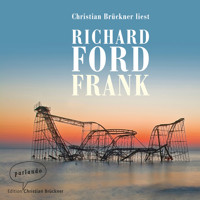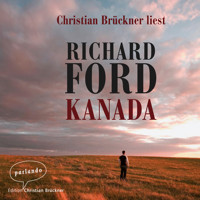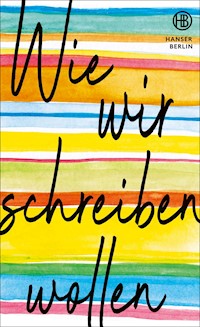
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie wollen wir schreiben, fragen sich zehn unserer Autorinnen und Autoren, sie fragen einander, wann sie schreiben, wo sie schreiben, um welchen Preis und für wen sie schreiben. Sie fragen sich, ob Frauen unter anderen Bedingungen schreiben als Männer und wie wichtig der Leistungsdruck für das Schreiben ist. Schreibend kommen sie miteinander ins Gespräch, stimmen sich zu, ergänzen und widersprechen sich. Und mit jedem Essay wird klarer, was wirklich alles auf dem Spiel steht, wenn jemand versucht, das Glück im Schreiben zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 63
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wie wollen wir schreiben, fragen sich zehn unserer Autorinnen und Autoren, sie fragen einander, wann sie schreiben, wo sie schreiben, um welchen Preis und für wen sie schreiben. Sie fragen sich, ob Frauen unter anderen Bedingungen schreiben als Männer und wie wichtig der Leistungsdruck für das Schreiben ist. Schreibend kommen sie miteinander ins Gespräch, stimmen sich zu, ergänzen und widersprechen sich. Und mit jedem Essay wird klarer, was wirklich alles auf dem Spiel steht, wenn jemand versucht, das Glück im Schreiben zu finden.
Richard Ford ∙ Julia von Lucadou ∙ Daniel Schreiber ∙ Doris Knecht ∙ Katja Kullmann ∙ Susan Neiman ∙ Mathias Enard ∙ Jan Wagner ∙ Yael Inokai ∙ Dmitrij Kapitelman
Wie wir schreiben wollen
Hanser Berlin
Richard Ford
Wer das tut, was ich tue — Romane schreiben —, redet selten darüber, wie er oder sie sich verbessern könnte. Wenn ich sage, dass ich besser werden möchte, klingt das vielleicht ein bisschen danach, als wäre ich beim letzten Mal, als ich die Aufmerksamkeit und Zustimmung der Welt suchte, nicht so gut gewesen, wie ich hätte sein sollen. Aber das entspricht nicht meinem Denken. Besser ist für mich kein Verrat am gut. Aus besser spricht immer der Optimist.
In den 1970er-Jahren, als ich erst zwei Romane geschrieben und veröffentlicht hatte — die beide kein großes Lesepublikum anzogen (obwohl ich sie bis heute für sehr gut halte) —, wurde mir klar: Wenn diese beiden Bücher als Medien des künstlerischen Ausdrucks Mängel aufwiesen, dann war ich vielleicht daran gescheitert (Triggerwort!), mit ihnen ein Gefäß zu erschaffen, das geräumig genug für meine sämtlichen (angenommenen) schriftstellerischen Fähigkeiten war. Die meisten jungen Romanschriftsteller:innen wissen, wenn sie anfangen, noch nicht, wie das Romanschreiben eigentlich geht. Wir lesen viele Romane, wir lesen viele Interviews mit berühmten Autor:innen — die oft voller Lügen sind. Irgendwann fangen wir dann eher blindlings mit dem Schreiben an. Manchmal werden es Meisterwerke, manchmal eher nicht. Wenn wir einen Roman geschrieben haben, der nicht so abwechslungsreich und gehaltvoll geworden ist, wie wir es uns eigentlich zutrauen, dann liegt das oft daran, dass wir nicht »alles reingekriegt« haben, was wir können. Als der majestätische John Updike vor zehn Jahren starb, schrieb der Essayist Adam Gopnik in einem Nachruf auf ihn, eine seiner großen Leistungen sei gewesen, dass er es geschafft habe, »alles reinzukriegen«. Nach meinem Verständnis hatte Updike also dafür gesorgt, dass seine Bücher und Erzählungen und Gedichte und Essays alle auf der Höhe seiner Bestleistung waren, weil sie auf alles verwiesen oder zurückgriffen, was er für relevant hielt. Das kann man als ehrgeizig bezeichnen. Praktisch gesprochen heißt es einfach nur, jedes Mal sein Bestes zu geben. Alles, was man hat.
Ich hatte das Gefühl — aber ohne Selbstzerfleischung —, dass es mir in meinen ersten Romanen nicht gelungen war, zu einem Schreiben zu finden, eine Struktur zu bauen, einen Stil zu entwickeln, einen Ton zu treffen, einen Rahmen zu schaffen, in dem für mich alles, was ich wusste und leisten und in mein Buch packen konnte, zugänglich war und zündete. Vor allem war es mir nicht gelungen, diese Romane sowohl ernsthaft als auch witzig zu machen — wobei meine Lieblingsromane eigentlich immer werthaltige dramatische Fracht enthielten, und meiner Meinung nach verfügte ich auch ganz natürlich über dramatisches Rohmaterial. »Witzig« schreiben hat mir schon immer gelegen. Und was »ernsthaft« war, wusste ich schon, wenn ich es vor mir hatte (wenn es um Leben oder Tod ging). Aber mir schwante — wohl auch, weil der große Durchbruch auf sich warten ließ —, dass ich, wollte ich einen Roman schreiben, der sich am gelebten Leben messen lassen konnte, und ein wirklich guter Schriftsteller werden, mehr tun musste, mehr fragen, mehr einbeziehen, ehrgeiziger und gründlicher arbeiten; ich musste alles, worüber ich verfügte, in mein Buch hinein bekommen und auf diese Weise als Schriftsteller besser werden.
Ich war siebenunddreißig, und das waren einschüchternde Aussichten. Warum auch nicht? So zu denken war der Weg mitten ins Herz meiner gewählten und gleichermaßen einschüchternden Berufung.
Wenn ich daran denke, was ich tatsächlich machte — und jetzt seit elf Büchern und vierzig Jahren in wechselnden Gelingensgraden mache —, ist schon die Vorstellung, es zu beschreiben, ermüdend. Also versuche ich es zusammenzufassen. Ich bin immer schon ein Notizenmacher gewesen. Ich schreibe mir praktisch alles auf, was ich sehe oder denke und was mir dabei auch nur vorübergehend interessant vorkommt, und bewahre es dadurch. Wahrscheinlich machen das viele so, die schreiben, und sogar viele, die nicht Schriftsteller sind. Wie Psychologen dieses Vorgehen bewerten, kann leicht unwürdig klingen; aber für mich hat so ein Notizbuch den Vorteil, dass es mich immer daran erinnert, wozu ich auf Erden bin — um von Dingen Notiz zu nehmen. Dadurch wird auch viel gelebte Erfahrung einer ständigen Einschätzung unterworfen — zugegeben, das kann zäh sein. Aber diese Einschätzung ermöglicht auch, Nutzen aus etwas zu ziehen, was ansonsten vielleicht unbemerkt an mir vorbeigezogen wäre — Nutzen für mein Schreiben.
Ich blättere gewohnheitsmäßig in meinen vielen Notizbüchern und suche auf gut Glück nach etwas, das vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdient, das vielleicht für eine Story oder eine längere Erzählung »genutzt« werden könnte. Das Vorhaben, eine sehr lange Erzählung — einen Roman mithin — zu schreiben, kommt mir erst in den Kopf, wenn einige hektische Lebenskräfte zusammenfließen: Weiß ich überhaupt noch, was ein Roman ist? Habe ich gerade mindestens zwei Jahre übrig? Bin ich in meinen Notizen auf etwas gestoßen, das eine solch übermäßige Aufmerksamkeit trägt? Hat das Ergebnis — das, was ich schreiben würde — irgendeine Chance, nach den Sternen guter Literatur zu greifen? Das sind für mich ernsthafte Fragen. Und wenn auch nur eine davon mit »Nein« oder »Vielleicht nicht« beantwortet wird, suche ich mir lieber etwas anderes.
Aber wenn bei allen Fragen die Antwort »Ja« lautet, dann setzen die Methoden des Romanciers ein — die ich mit siebenunddreißig noch nicht hatte, als ich Romane schrieb, indem ich blindlings drauflosarbeitete. Damals, als der stetige Prozess, mein Schreiben zu verbessern, noch nicht eingesetzt hatte.
Ich tue Folgendes — diese Methode habe ich mir ausgedacht, um besagten Prozess zu ermöglichen: Ich nehme mir ein Jahr, mindestens ein Jahr. Und dann lebe ich mit dem Vorhaben dieses Romans, der irgendwo in meinem Schädel vor sich hin glimmt, während ich mühselig die Notizbücher der letzten zehn Jahre durchkämme (manchmal auch mehr als zehn Jahre davon) und daraus abschreibe und notiere (und vermutlich überdenke), was ich früher aufgeschrieben habe und was heute noch interessant auf mich wirkt. Mit »interessant« meine ich aber nicht, dass ich immer erkennen kann, wo das eine oder andere Element schön in ein großes Schema eines Romans reinpasst. Überhaupt nicht. Interessant