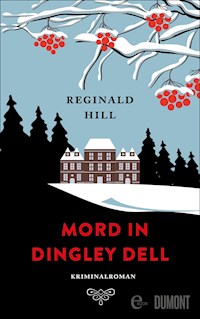6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Tod ist ein Possenspieler. Er trifft seine Wahl, wie es ihm beliebt, und verschont weder die Guten noch die Gerechten. So jedenfalls scheint es Chief Inspector Peter Pascoe. Vor Jahren hat er Franny Roote wegen Mordes hinter Gitter gebracht. Doch jetzt ist der notorische Kriminelle frei und verwaltet den Nachlass eines geheimnisvollen viktorianischen Dichters. Ein durch die Literatur geläuterter Mörder? Oder sind es nicht doch neue Morde, die Roote in seinen Briefen an Pascoe verschlüsselt gesteht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Reginald Hill
Die Launen des Todes
Roman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Tod ist ein Possenspieler. Er trifft seine Wahl, wie es ihm beliebt, und verschont weder die Guten noch die Gerechten. So jedenfalls scheint es Chief Inspector Peter Pascoe. Vor Jahren hat er Franny Roote wegen Mordes hinter Gitter gebracht. Doch jetzt ist der notorische Kriminelle frei und verwaltet den Nachlass eines geheimnisvollen viktorianischen Dichters. Ein durch die Literatur geläuterter Mörder? Oder sind es nicht doch neue Morde, die Roote in seinen Briefen an Pascoe verschlüsselt gesteht?
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorbemerkung
Motto
1. Kapitel
Imaginierte Szenen aus
2. Kapitel
1. Brief, erhalten: Samstag, 15. Dez., per Post
1. Brief 1, Fortsetzung
3. Kapitel
2. Brief, erhalten: Montag 17. Dez., per Post
3. Brief, erhalten: Montag 17. Dez., per Post
4. Kapitel
5. Kapitel
4. Brief, erhalten: Dienstag, 18. Dez., per Post
6. Kapitel
7. Kapitel
5. Brief, erhalten: Montag, 24. Dez., per Post
6. Brief, erhalten: Dienstag, 27. Dez., per Post
8. Kapitel
7. Brief, erhalten: Montag, 31. Dez., per Post
9. Kapitel
10. Kapitel
8. Brief, erhalten: Montag, 7. Jan., per Post
9. Brief, erhalten: Freitag, 18. Jan., per Post
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Imaginierte Szenen aus
Für Julia die niemals Rabatz macht. Danke
Die den dreizehn Teilen des Romans vorangestellten Holzschnitte stammen aus dem Totentanz von Hans Holbein dem Jüngeren. Die Initialen zu Beginn jeden Kapitels sind dem Totentanz-Alphabet desselben Künstlers entnommen.
Mehr als das Leben ist der Tod »ein Schwank«, verstehen Sie,
Vertrautheit schafft rasch Ekel, Antipathie.
Diese Weisheit verdanke ich der Anatomie.
T. L. Beddoes, Zeilen an B. W. Proctor
… dicke Männer können keine Sonette schreiben
T. L. Beddoes, The Bride’s Tragedy I.ii
1
Der Arzt
Imaginierte Szenen aus
Clifton, Glos., Juni 1808
»Genau, Mann. Halt er ihren Kopf, halt er ihren Kopf. Um Gottes willen, er da hinten, stemm er die Schulter dagegen. Mach schon, Mädel, mach schon.«
Der diese Anweisungen schreit, ein stämmiger Mann um die fünfzig mit kurz geschorenem Haupthaar und gebieterischem Antlitz, steht mitten auf einer breiten, geschwungenen Treppe. Einige Stufen unter ihm spreizt sich ein Bauer, dessen von Natur aus gesunde Gesichtsfarbe durch die Anstrengung noch röter leuchtet, wie der Ankermann beim Tauziehen in die Treppe und zerrt mit aller Kraft an einem Seil, dessen unteres Ende um den Hals einer großen braunen Kuh gebunden ist.
Hinter dem Vieh wedelt ein sichtlich nervöser Lakai ermunternd mit den Händen. Unten in der mit Marmor ausgelegten Eingangshalle sehen eine Haushälterin und ein Butler mit empörtem Missfallen zu, während oben, die Arme voller Laken, zwei Hausmädchen an der Balustrade des Treppenabsatzes lehnen und sich, alle Zucht und Ordnung fahren lassend, der ungetrübten Freude ob dieser seltenen Belustigung hingeben, wobei besonders die Verlegenheit des Lakaien sie in ihren Bann schlägt.
Zwischen ihnen kniet ein kleiner Junge mit ernstem Gesicht, er hält das vergoldete schmiedeeiserne Geländer umfasst und betrachtet die Szene mit interessiertem, aber keineswegs überraschtem Blick.
»Schieb er an, Mann, schieb er an, sie beißt ihn schon nicht!«, brüllt der Stämmige.
Der Lakai, gewohnt zu gehorchen und vielleicht auch der Blicke der Hausmädchen gewahr, lehnt sich mit beiden Händen gegen die Hinterbacken der Kuh.
Und das Vieh, als würde es durch den Druck stimuliert, schwingt den Schwanz nach oben und entleert sein Gedärm. Der Lakai, vom verderblichen Strahl mitten auf die Brust getroffen, taumelt nach hinten, die Mädchen kreischen, der kleine Junge lächelt ob des Spaßes, und die Kuh, angetrieben von ihrer überschwänglichen Eruption, galoppiert mit solcher Geschwindigkeit die noch verbliebenen Stufen hinauf, dass sowohl der Bauersmann wie der Stämmige nur unter Mühen sicher den Treppenabsatz erreichen.
Unten vergewissern sich derweil Butler und Haushälterin, dass der beschmutzte Lakai unverletzt ist. Dann hastet die Frau die Treppe hoch, ihr Gesicht feuerrot vor Entrüstung, worauf die Mädchen vor ihrem Anblick eilends den Rückzug antreten.
»Dr. Beddoes!«, schreit sie. »Das geht über jedes Maß hinaus!«
»Kommt, Mrs. Jones«, sagt der stämmige Mann. »Ist die Gesundheit Eurer Herrin nicht der kleinen Mühe mit Besen und Kehrichtschaufel wert? Führ er sie weiter, George.«
Der Bauersmann lotst die nun völlig eingeschüchterte Kuh über den Treppenabsatz zu einer halb offen stehenden Tür. Der Mann folgt ihm, einen Schritt dahinter der kleine Junge.
Mrs. Jones, die Haushälterin, der nichts Rechtes auf den Tadel des Arztes einfallen will, ändert ihre Stoßrichtung.
»Ein Krankenzimmer ist kein Ort für Kinder«, ruft sie aus. »Was würde seine Mutter nur sagen?«
»Seine Mutter, Ma’am, eine Frau mit Verstand, die sich ihrer Pflichten bewusst ist, würde sagen, dass es sein Vater am besten weiß«, gibt der Arzt spöttisch zu Bedenken. »Die Augen eines Kindes sehen die simple Natur der Dinge. Es sind erst die Fantasiegebilde alter Weiber, die jener den Anschein des Schrecklichen verleihen. Mein Junge hat ungerührt Dinge erblickt, die so manchen strammen Studenten der Medizin zum Rinnstein haben taumeln lassen. Es wird ihm von Nutzen sein, wenn er dem Vorbild seines Vaters folgt. Komm jetzt, Tom.«
Mit diesen Worten nimmt er den Jungen an der Hand, schiebt sich an der Kuh und ihrem Hüter vorbei und drückt die Tür zum Schlafzimmer auf.
Es ist ein großer Raum, erbaut im zeitgemäßen, luftigen Stil, allerdings von schweren Vorhängen verdunkelt, die vor den Fenstern hängen, und nur von einer einzigen Wachskerze beleuchtet, in deren fahlem Schein die Umrisse einer Gestalt erkenntlich sind, die in einem großen, rechteckigen Bett liegt. Es handelt sich um eine Frau, sie ist alt, mit eingefallenen Wangen, geschlossenen Augen, so blass wie das Wachs der Kerze, und sie zeigt nicht das geringste Anzeichen von Leben. Neben ihrem Bett kniet ein hagerer, ganz in Schwarz gekleideter Mann, der aufblickt, als die Tür sich öffnet, und sich daraufhin langsam erhebt.
»Ihr kommt zu spät, Beddoes«, sagt er. »Sie wurde bereits von ihrem Schöpfer abberufen.«
»Das ist von Berufs wegen Eure Meinung, nicht wahr, Padre?«, sagt der Arzt. »Gut, dann wollen wir mal sehen.«
Er geht zum Fenster, zieht die Vorhänge zur Seite und lässt den hellen Strahl der Sommersonne herein. In ihrem Licht begibt er sich ans Bett, sieht auf die alte Frau, seine Hand ruht leicht an ihrem Hals.
Dann dreht er sich um und ruft: »George, trödel er nicht, Mensch. Führ er sie herein.«
Der Bauersmann kommt mit der Kuh.
Der Pfaffe schreit auf. »Nein, Beddoes, wie unschicklich, das geziemt sich nicht! Sie ruht in Frieden, sie ist schon bei den Engeln.«
Der Arzt beachtet ihn nicht. Mit Hilfe des Bauersmanns, im Beisein seines Sohnes, der mit großen, weit aufgerissenen Augen zusieht, manövriert er den Kopf der Kuh über die reglose Gestalt im Bett. Dann drückt er dem Vieh leicht gegen den Magen, sodass es sein Maul aufsperrt und einen ausgiebigen Schwall seines grasigen Odems der Frau direkt ins Gesicht atmet. Einmal, zweimal, dreimal tut er dies, und beim dritten Mal schleckt die Kuh mit ihrer langen, feuchten Zunge leicht über das bleiche Antlitz.
Die Frau schlägt die Augen auf.
Vielleicht erwartet sie Engel oder Jesus oder vielleicht sogar den unbeschreiblichen Heiligenschein der Gottheit selbst zu erblicken.
Was sie stattdessen undeutlich zu Gesicht bekommt, ist ein aufgerissenes Maul, darüber breite, zuckende Nasenlöcher, die von zwei gebogenen spitzen Hörnern gekrönt werden.
Sie stößt einen Schrei aus und sitzt aufrecht im Bett.
Die Kuh weicht zurück, der Arzt legt der Frau stützend den Arm um die Schulter.
»Ich darf Euch wieder willkommen heißen, My Lady. Wollt Ihr eine kleine Stärkung zu Euch nehmen?«
Ihr Blick klärt sich, der Schreck schwindet aus ihrer Miene, schwach nickt sie, und der Arzt lässt sie wieder auf ihre Kissen nieder.
»George, führ er Betsy hinaus«, sagt Beddoes. »Sie hat ihre Pflicht erfüllt.«
Und zu seinem Sohn sagt er: »Jetzt siehst du, wie das ist, junger Tom. Der Pfaffe predigt Wunder. Aber es liegt an uns geringeren Menschen, sie zu bewirken. Mrs. Jones, ein wenig Kraftbrühe für Eure Herrin, wenn Ihr die Güte hättet.«
Clifton, Glos., Dezember 1808
Ein anderes Schlafzimmer, ein anderes Bett, darin eine andere reglose Gestalt, die Arme auf der Brust verschränkt, blinde Augen, die an die Decke starren. Doch hier liegt keine alte Frau, die von Krankheit und Altersschwachsinn in ein Abbild des Todes geworfen wurde. Der Gnade Gottes und den Darreichungen ihres Arztes sei Dank ist sie noch am Leben, Thomas Beddoes Sr. allerdings, erst achtundvierzig Jahre alt und von so kräftigem, resoluten Aussehen wie eh und je, ist seiner alten Patientin nun ins Grab vorausgehüpft.
Zwei Frauen stehen am Bett, eine, deren Gesicht so sehr von Schmerz gezeichnet ist, dass sie aussieht, als müsste sie statt ihres Ehemannes auf die Totenbahre gelegt werden; die andere, einige Jahre älter, den Arm um die Hüfte der Frau gelegt, spendet Trost.
»Anne, lass dich vom Schmerz nicht niederringen«, drängt sie. »Denk an die Kinder. Du musst ihnen nun eine Stütze sein, und sie werden dir eine Stütze sein.«
»Die Kinder … ja, die Kinder«, sagte Anne Beddoes abwesend. »Man muss es ihnen sagen … sie müssen ihn sehen und Abschied nehmen …«
»Nicht alle«, sagt die andere mit sanfter Stimme. »Tom soll es stellvertretend für die anderen tun. Er ist für sein Alter sehr verständig und wird am besten wissen, wie er es den anderen zu erzählen hat. Soll ich ihn jetzt holen, Schwester?«
»Bitte, ja, wenn du meinst …«
»Zuerst aber seine Augen … sollen wir ihm nicht die Augen schließen?«
Sie betrachten das starrende Gesicht.
»Der Priester hat’s versucht, aber er konnte die Lider nicht nach unten drücken«, sagt Anne. »Er war im besten Alter, noch voller Tatendrang … ich glaube nicht, dass er schon bereit war, die hiesige Welt zugunsten der jenseitigen zu verlassen …«
»Es ist ein großer Verlust, für dich, für uns alle, für die Armen in Bristol, die Welt der Wissenschaft. Sammle dich ein wenig, Schwester, dann hole ich den kleinen Tom.«
Sie verlässt den Raum, muss aber nicht weit gehen.
Der kleine Thomas Lovell Beddoes sitzt auf der obersten Treppenstufe und liest ein Buch.
»Tom, mein Lieber, komm mit«, sagt sie.
Der Junge hebt den Blick und lächelt. Er mag seine Tante Maria. Für die Welt ist sie Miss Edgeworth, die berühmte Romanschriftstellerin. Als er ihr sagte, dass er eines Tages ebenfalls gern Bücher schreiben würde, hat sie ihn nicht ausgelacht, sondern ernstlich erwidert: »Und das wirst du auch, Tom, sonst wärst du nicht der Sohn deines Vaters.«
Sie erzählt ihm auch Geschichten. Gute Geschichten, fein strukturiert, doch fehlt es ihnen an jener Buntheit und Exaltation, die er schon jetzt an einer Erzählung so gern mag. Doch das spielt keine Rolle, denn wenn er sie seinen Brüdern und Schwestern wiedergibt, ist er durchaus in der Lage, selbst genug von diesen Elementen beizusteuern, damit sie Albträume bekommen.
Er steht auf und fasst seine Tante an der Hand.
»Geht es Vater wieder gut?«, fragt er.
»Nein, Tom, auch wenn er jetzt an einem Ort ist, wo es allen gut geht«, sagt sie. »Er hat uns verlassen, Tom, er ist jetzt im Himmel. Du musst nun deine liebe Mama trösten.«
Der kleine Junge runzelt die Stirn, sagt aber nichts mehr, als Tante Maria ihn ins Schlafzimmer führt.
»O Tom, Tom«, schluchzt seine Mutter und umarmt ihn so heftig, dass er kaum noch Luft bekommt. Doch während sie seinen Kopf gegen ihre Brust presst, ist sein Blick auf die reglose Gestalt im Bett gerichtet.
Seine Tante löst ihn von der schluchzenden Frau und sagt: »Jetzt verabschiede dich von deinem Vater, Tom. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, dann in einer besseren Welt als dieser.«
Der Junge geht an die Bettstatt. Er steht eine Weile davor, schaut mit ebenso unbewegtem Blick in die starren Augen. Dann beugt er sich vor, als wollte er dem Toten einen Kuss auf die Lippen drücken.
Doch statt zu küssen, bläst er. Einmal, zweimal, dreimal, jedes Mal fester schickt er seinen warmen Lufthauch zum blassen Mund und den geweiteten Nasenflügeln.
»Tom!«, ruft seine Tante. »Was machst du?«
»Ich bring ihn zurück«, sagt der Junge, ohne aufzublicken.
Wieder bläst er. Die Gewissheit, die bislang in seiner Miene lag, beginnt zu schwinden. Er ergreift die rechte Hand seines Vaters, drückt die Finger und sucht nach einem Gegendruck.
Seine Tante stürzt zu ihm.
»Tom, hör auf damit. Du regst deine Mama auf. Tom!«
Sie packt ihn, er wehrt sich, bläst nicht mehr, sondern schreit, und sie muss ihn mit roher Gewalt von dem Leichnam wegziehen. Seine Mutter steht daneben, die Faust gegen den Mund gepresst, sprachlos vor Entsetzen in Anbetracht dieser unerwarteten Wendung.
Und während er von seiner Tante aus dem Schlafzimmer und über den Treppenabsatz und die Stufen hinuntergezerrt wird, verklingen seine Schreie wie die Rufe einer Schleiereule über dem sich verdunkelnden Moor; Schreie, die noch lang in der Erinnerung nachhallen, obwohl sie dem Ohr längst verstummt sind.
»Holt die Kuh … holt die Kuh … holt die Kuh …«
2
Der Dieb
1. Brief, erhalten: Samstag, 15. Dez., per Post
Freitag, 14. Dez. Wohnung des Quästors
Lieber Mr. Pascoe,
Cambridge! St. Godric’s College! Wohnung des Quästors!
Bin ich nicht grandios? Bin ich nicht die beste Werbung für das Innenministerium und die resozialisierende Kraft unseres britischen Strafrechtssystems?
Aber wer bin ich, muss Ihnen durch den Kopf gehen. Oder hat Ihnen das Ihre sensible Intuition, für die Sie zu Recht berühmt sind, bereits zugeflüstert?
Wie auch immer, ich möchte allen Spekulationen ein Ende setzen und Ihnen ersparen, dass Sie an das Ende dieses Briefes blättern müssen, der doch recht lang werden könnte.
Geboren wurde ich in einem Dorf namens Hope, und ich mache mir gern einen kleinen Spaß daraus, dass, sollte ich zufällig im Lake Disappointment in Australien ertrinken, die Inschrift auf meinem Grabstein lauten würde:
Hier liegt
Francis Xavier Roote
Geb. in
HOPE
Gest. in
DISAPPOINTMENT
Genau, Mr. Pascoe, ich bin’s, und da ich mir ausmalen kann, wie Sie darauf reagieren, wenn Sie Post von jemandem erhalten, den Sie, wie man so schön sagt, für die besten Jahre seines Lebens eingebuchtet haben, lassen Sie mich eiligst versichern:
Dies ist kein Drohbrief!
Ganz im Gegenteil, dies ist ein vertrauenschaffender Brief.
Und keiner, von dem ich auch nur im Traum daran gedacht hätte, ihn zu schreiben, hätten die Ereignisse des vergangenen Jahres nicht deutlich gezeigt, wie sehr Sie dieses Vertrauens bedürfen. Was auch für mich gilt, insbesondere nachdem mein Leben eine solch unerwartete Wendung zum Besseren erfahren hat. Statt mich weiter in meinem kleinen, erbärmlichen Apartment abzuplagen, residiere ich nun im Luxus der Quästoren-Wohnung. Und für den Fall, dass Sie meinen, ich müsse dort eingebrochen sein, lege ich das Programm der Jahreskonferenz der Romantic and Gothic Studies Association bei (abgekürzt RAGS!). Auf der Liste der Teilnehmer findet sich auch mein Name. Und wenn Sie unter Samstag, neun Uhr, nachsehen, werden Sie ihn erneut finden. Plötzlich habe ich eine Zukunft, ich habe Freunde; aus der Verzweiflung heraus habe ich den Weg zurück zur Hoffnung gefunden, und es sieht so aus, als steuerte ich trotz allem doch nicht auf die kalten Wasser des Lake Disappointment zu!
Wie es der Zufall wollte, teilte ich diesen kleinen makabren Scherz einer meiner neuen Freunde mit, Linda Lupin, der Abgeordneten des Europäischen Parlaments, als sie mich gerade mit einem weiteren meiner jetzigen Freunde bekannt machte, Frère Jacques, dem Begründer der Third-Thought-Bewegung.
Er kam mir nämlich in den Sinn, als wir auf den Ländereien der Abbaye du Saint Graal standen, des Cornelianischen Klosters, als dessen hoch angesehenes Mitglied Jacques sich rühmen darf. Einzig durch einen mäandrierenden, von Kresse erstickten Bachlauf abgegrenzt, öffneten sich die Ländereien zu einem Soldatenfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg, dessen weiße Kreuzreihen sich zu einer niedrigen Anhöhe erstreckten, sodass die einzelnen Kreuze immer kleiner wurden, bis die entferntesten nicht größer erschienen als die etwa ein Zentimeter großen Exemplare, die Linda und ich an Silberketten um den Hals trugen.
Linda lachte laut auf. Der äußere Eindruck kann täuschen (wer weiß das besser als Sie?), und die Erkenntnis, dass Linda einen ausgeprägten Sinn für Humor besitzt, war ein wichtiger Schritt in unserer Beziehung. Auch Jacques grinste. Nur Frère Dierick, der sich Jacques als eine Art Amanuensis angeschlossen hatte und durchaus gewillt war, sich in seinem Boswellschen Status zu gefallen, spitzte aus Missfallen über diese unangebrachte Leichtfertigkeit die Lippen. Mit seiner hageren, fleischlosen Gestalt sah er aus wie der Tod in Mönchskutte, in Wirklichkeit aber war er bis über beide Ohren mit flämischem Phlegma gesegnet. Glücklicherweise hat Jacques, obwohl er groß und blond ist und etwas vom überschwänglichen Wesen eines Skilehrers an sich hat, sehr viel mehr gallisches Gebaren und Feuer in sich, außerdem ist er ein unverbesserlich anglophiler Zeitgenosse.
»Mal sehen«, sagte Linda, »ob wir Sie nicht etwas weiter südlich in Australien loswerden können, Fran. Ich glaube nämlich, dort gibt es einen Lake Grace. In Gnade gestorben, darum geht’s beim Third Thought doch, nicht wahr, Bruder?«
Dierick riss seine knochige Nase hoch, als er hörte, wie die Bewegung auf einen Scherz reduziert wurde, doch bevor er etwas sagen konnte, lächelte Jacques und meinte: »Das gefällt mir so an euch Engländern. Ihr macht euch über alles lustig. Je ernster die Sache, umso mehr reißt ihr Witze darüber. Das nenne ich köstlich kindisch. Nein, das ist nicht das Wort. Kindlich. Ihr seid die kindlichste Nation in ganz Europa. Das ist eure Stärke und kann eure Rettung sein. Euer großer Dichter Wordsworth wusste, dass die Kindheit ein Zustand der Gnade ist. Der heranwachsende Junge wird dann mehr und mehr von den Schatten der Gefängnismauern umfangen. Nur das Kind allein weiß, wie heilig die Empfindungen des Herzens sind.«
Jacques, alter Bruder, da bringst du deine Romantiker durcheinander, dachte ich mir und versuchte herauszufinden, ob die Sache mit den Schatten der Gefängnismauern nicht ein Seitenhieb auf mich war. Aber ich glaube nicht. Nach allem, was man wusste, hatte es Jacques in der Vergangenheit selbst so bunt getrieben, dass er andere dafür kaum zurechtweisen konnte. Außerdem ist er nicht der Typ dafür.
Aber es ist schon seltsam, wie sensibel man auf solche Dinge wie ein Vorstrafenregister reagiert. Ich weiß, heutzutage haben es einige Ex-Knackis zu einer höchst profitablen Profession gemacht, dass sie eben Ex-Knackis sind. Ihnen und Ihren Kollegen muss das doch sicherlich sauer aufstoßen. Aber ich gehöre nicht dazu. Alles, was ich will, ist, meine Zeit drinnen zu vergessen und mein Leben weiterzuführen, meinen Garten zu bestellen, sozusagen.
Was ich recht erfolgreich und letztlich auch im Sinne des Wortes getan habe, bis Sie durch die Hecke brachen, die ich zu meinem Schutz und zur Wahrung meiner Privatsphäre errichtet hatte.
Nicht ein-, nicht zwei-, sondern dreimal.
Zuerst, weil Sie argwöhnten, ich würde Ihre getreue Ehefrau belästigen!
Dann, weil Sie den Verdacht hegten, ich würde Ihrem werten Selbst nachstellen!!
Und schließlich, weil Sie mich anklagten, ich wäre in eine Reihe brutaler Morde verwickelt!!!
Was der Hauptgrund ist, warum ich Ihnen schreibe. Die Zeit ist gekommen, dass wir ein offenes Wort miteinander reden – nicht um uns gegenseitig zu beschuldigen, sondern damit wir beide im Anschluss daran unser Leben fortführen können, Sie in der Gewissheit, dass weder Sie noch jene, die Sie lieben, Schaden durch mich zu befürchten haben, und ich im sicheren Wissen, dass ich, nachdem mein Leben nun diese abrupte Wendung zum Besseren genommen hat, mich nicht mehr darum sorgen muss, dass die zarten Samen in meinem Garten das Gewicht Ihrer trampelnden Füße zu spüren bekommen.
Alles, was dazu erforderlich ist, scheint mir vollkommene Offenheit zu sein, eine Rückkehr zu dieser kindlichen Ehrlichkeit, die wir alle besitzen, bevor die Schatten der Gefängnismauern uns umfangen. Und vielleicht kann ich Sie dann davon überzeugen, dass ich während meiner Zeit im Chapel Syke Prison, Yorkshires Antwort auf die Bastille, niemals auch nur einen Gedanken daran verschwendet habe, an meinen teuren alten Freunden Mr. Dalziel und Mr. Pascoe Rache zu üben. Gewiss habe ich mich mit Rache beschäftigt, doch nur in der Literatur und unter Anleitung meines weisen Mentors und geliebten Freundes Sam Johnson.
Wie Sie wissen, ist er, Sam, jetzt tot, und das Gleiche gilt für den Mann, der ihn getötet hat, möge Gott seine Seele verdammen. Es sei denn, Sie schenken Charley Penn noch irgendwelche Beachtung. Der zweifelnde Charley! Der niemandem traut und nichts glaubt.
Doch selbst Charley kann nicht leugnen, dass Sam tot ist. Er ist tot.
Wenn du das weißt, dann weißt du, welch verkohlter Schlackehaufen diese Welt doch ist.
Ich vermisse ihn jeden Tag, umso mehr, da sein Tod so viel zu jenem dramatischen Umschwung in meinem Leben beigetragen hat. Seltsam, nicht wahr, wie aus der Tragödie Triumph erwachsen kann? In diesem Fall allerdings aus zwei Tragödien. Hätte der arme Student von Sam letzten Sommer in Sheffield nicht eine Überdosis erwischt, wäre Sam nicht nach Mid-Yorkshire gegangen, und er wäre nicht dem monströsen Wordman zum Opfer gefallen. Und wäre das nicht geschehen, könnte ich mich nun hier am God’s (so, habe ich erfahren, nennen die Illuminati das St. Godric’s!) nicht im Glanz meiner gegenwärtigen Annehmlichkeiten und des versprochenen Erfolgs sonnen.
Aber zurück zu Ihnen und Ihrem dicken Freund.
Ich sage nicht, dass ich Ihnen beiden besonders tiefe Zuneigung oder Dankbarkeit entgegenbringe für das, was Sie mir angetan haben. Wenn ich an Sie überhaupt dachte, dann in konventionellen Begriffen: guter Bulle, schlechter Bulle; das Knie, das einem in die Eier gerammt wird, die Schulter, an der man sich ausheulen kann; natürlich sind Sie beide Ungeheuer, aber von der Sorte, auf die eine solide Gesellschaft nicht verzichten kann, sind Sie doch die Bestien, die unsere Tore bewachen und uns sicher in den Betten schlafen lassen.
Außer wir sind im Gefängnis. Dann können Sie uns nicht beschützen.
Mr. Dalziel, das eierzermalmende Knie, würde wahrscheinlich sagen, wir hätten ja auf Ihren Schutz verzichtet.
Aber nicht Sie, lieber Mr. Pascoe, mit Ihrer von Tränen aufgeweichten Schulter. Was ich in den Jahren seit unserem ersten Zusammentreffen gehört und gesehen habe, lässt mich glauben, dass Sie mehr sind als nur jemand, der eine Rolle zu erfüllen hat.
Ich vermute, Sie haben so Ihre Zweifel an dem Strafrechtssystem in seiner jetzigen Form. Ich vermute sogar, dass Sie an sehr vielen Aspekten unserer brüchigen Gesellschaft zweifeln, aber als Karrierepolizist fällt es Ihnen natürlich schwer, dies offen auszusprechen. Was allerdings Ihre werte Lady nicht davon abhält, es zu tun, die liebe Mrs. Pascoe, Ms. Soper, wie sie noch in jenen lang zurückliegenden Zeiten hieß, als ich ein junger, freier und ungebundener Student am Holm Coultram College war. Wie erfreut war ich doch, als ich hörte, Sie beide hätten geheiratet! Neuigkeiten wie diese lassen selbst durch die feuchten, grauen Mauern des Chapel Syke ein wenig Wärme und Freundlichkeit sickern. Manche Verbindungen scheinen im Himmel geschlossen worden zu sein, nicht wahr? Wie die von Marilyn und Arthur, von Woody und Mia, Charles und Di …
Gut, kann ja nicht alles klappen, oder? Was jedoch das Überdauern Ihrer Ehe anbelangt, könnte sie die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Gut gemacht!
Aber wie ich bereits sagte, hinter diesen Mauern kann noch nicht einmal ein netter, besorgter Polizist wie Sie viel ausrichten, um die Rechte eines jungen und verletzlichen Häftlings wie mich zu schützen.
Selbst wenn ich daher geplant hätte, Rache zu nehmen, hätte ich nicht die Zeit dazu gefunden.
Ich war allzu sehr damit beschäftigt, mich um mein eigenes Überleben zu kümmern.
Ich brauchte Hilfe, denn eines war mir sehr schnell klar:
Im Gefängnis kann man allein nicht überleben.
Wie Sie sehr wohl wissen, bin ich nicht ganz schutzlos. Meine Zunge ist meine wichtigste Waffe, und lässt man mir genügend Raum, kann ich mich misslichen Lagen meist hurtig entziehen.
Doch biegt dir ein widerlicher Häftling die Arme auf den Rücken, während dir ein zweiter seinen Schwanz in den Mund steckt, erweist sich eine gewisse Zungenfertigkeit als eher kontraproduktiv.
Das war mein mutmaßliches Schicksal, falls ich ins Syke geschickt werden sollte, wie es mir ein Kerl, der mit mir in Untersuchungshaft saß, genüsslich ausmalte. Ein gut aussehender, blonder, blauäugiger Junge von schlanker Gestalt wäre dort sehr willkommen, versicherte er mir und fügte mit bitterem Lachen hinzu, dass er selbst einst ein gut aussehender, blonder, blauäugiger Junge gewesen sei.
Es fiel mir schwer, das zu glauben, als ich sein vernarbtes, hohlwangiges Gesicht mit der gebrochenen Nase und den zerklüfteten Zahnreihen betrachtete. Etwas in seiner Stimme aber verlieh seinen Worten eine gewisse Überzeugungskraft. Dieselbe besaß auch jene seines Richters, denn das nächste Mal begegneten wir uns, als wir gemeinsam im Chapel Syke eingeliefert wurden.
Er gehörte dort zu den erfahrenen Insassen, und obwohl ich schnell herausfand, dass er in der Hackordnung viel zu weit unten stand, um als Beschützer in Betracht zu kommen, quetschte ich, wenn wir uns an die den Neuankömmlingen zugeteilte Aufgabe des Scheißhausputzens machten, alles aus ihm heraus, was er über den Laden wusste.
Der Obermacker war ein zu zehn Jahren verurteilter Insasse namens Polchard, Vorname Matthew, von seinen Kumpel nur Matt genannt. Er machte äußerlich nicht viel her, war spindeldürr, glatzköpfig und so weiß im Gesicht, dass man glaubte, man könne den Schädelknochen unter der Haut erkennen. Sein Status aber zeigte sich darin, dass er während der »Freizeit« im überfüllten »Gemeinschaftsraum« immer einen Tisch für sich hatte. Dort saß er dann, brütete über einem Schachbrett (Matt: kapiert?) und studierte ein Büchlein, in dem er sich gelegentlich etwas notierte, bevor er den nächsten Zug ausführte. Hin und wieder brachte ihm jemand eine Tasse Tee. Wollte man mit ihm reden, stellte man sich geduldig einige Schritte vom Tisch entfernt auf, bis er sich dazu herabließ, einen wahrzunehmen. Und wenn, was sehr selten vorkam, man etwas sagte, was sein Interesse weckte, wurde man dazu eingeladen, einen Stuhl heranzuziehen und sich zu setzen.
Polchard selbst hatte mit Sex nicht viel am Hut, unterrichtete mich mein »Freund«, seine Statthalter allerdings hielten immer nach neuen Talenten Ausschau, und wenn er ihnen sein Einverständnis signalisierte, würde mir nichts anderes übrig bleiben, als meine Zehen zu umklammern und an Gott und Vaterland zu denken.
Kurzfristig allerdings, fuhr er fort, hätte ich mehr von einem Freiberufler wie Brillo Bright zu befürchten. Sie sind ihm und seinem Zwillingsbruder Dendo vielleicht schon mal begegnet. Weiß Gott, woher sie ihre Namen hatten, allerdings habe ich gehört, dass Brillo seinen bekam, nachdem er einige Zeit in einer Gummizelle verbracht hatte (Brillo-Seifenkissen, okay?). Irgendwann hatte Brillo beschlossen, dass es der Schönheit seines Antlitzes sehr zugute komme, wenn er sich auf seine Plätte und buschigen Brauen einen Adler mit ausgebreiteten Schwingen tätowieren lasse, dessen Klauen sich um die Augenhöhlen legten. Wahrscheinlich hatte er damit Recht. Was sich dadurch auf jeden Fall verbesserte, war die Wahrscheinlichkeit, erkannt zu werden, wenn er seinem auserkorenen Beruf des bewaffneten Raubüberfalls nachging. Dadurch lässt sich vermutlich erklären, warum er die Hälfte seiner etwa dreißig Jahre im Gefängnis verbrachte. Verglichen mit ihm, und nur verglichen mit ihm, war sein Bruder Dendo ein Intellektueller, ansonsten eher ein unberechenbarer hinterhältiger Schläger. Die Brights waren die einzigen Insassen, die gegenüber Polchard eine gewisse Unabhängigkeit genossen. Oberflächlich betrachtet waren sie alle Kumpel, tatsächlich aber waren sie für Polchard viel zu labil, als dass er riskieren wollte, sich auf eine unwägbare Konfrontation mit ihnen einzulassen. So existierten sie ähnlich wie die Isle of Man, vor der Küste gelegen, mit engen Verbindungen zum Mutterland, aber in vielem doch eigenen Gesetzen gehorchend.
Wenn sich Brillo und Dendo daher zu einem leckeren Novizen verhalfen, hätten sie ihre Unabhängigkeit unter Beweis stellen können, ohne Gefahr zu laufen, dadurch den Obermacker zu provozieren.
Wollte ich überleben, musste ich es schaffen, mich unter Polchards Schutz zu stellen, ohne dabei unter einem seiner Jungs zu liegen zu kommen. Nicht dass ich ernstliche Vorbehalte gegen eine gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehung hätte, doch aufgrund gewisser Anekdoten und meiner Beobachtungen wusste ich, dass man ganz unten im Haufen fixiert wurde, als wäre man mit einer Drahtklemme durch den Bauchnabel an den Boden geheftet, wenn man sich im Gefängnis zum Centrefold machen ließ.
Als Erstes musste ich klarstellen, dass mit mir nicht zu spaßen war.
Also schmiedete ich meine Pläne.
Einige Tage später wartete ich, bis ich Dendo und Brillo in den Duschraum gehen sah, dann folgte ich ihnen.
Brillo sah mich an wie ein Fuchs, der soeben ein Hühnchen erblickt hatte, das in seinen Bau geschlendert kam.
Ich hängte mein Handtuch auf und trat, die Shampooflasche aus Plastik in der Hand, unter die Dusche.
Brillo sagte etwas zu seinem Bruder, der daraufhin lachte, dann kam er auf mich zu. Für einen so großen Kerl wie ihn war er etwas schwächlich bestückt, doch das, was da war, zeigte sich sehr erfüllt von feiner Vorfreude.
»Hallo, Mädel«, sagte er. »Soll ich dir den Rücken schrubben?«
Ich schraubte die Shampooflasche auf und sagte: »Hast du deswegen dieses Huhn auf deinem Kopf sitzen, damit jeder gleich weiß, dass du Rühreier im Hirn hast?«
Es dauerte eine Weile, bis er den Satz ganz durchdrungen hatte, doch dann traten ihm vor Wut die Augen hervor, was mir nur recht war, verdoppelte sich dadurch doch meine Zielfläche.
Als er auf mich losstürzte, hob ich die Flasche, drückte ab und schickte einen Strahl Kloreiniger, womit ich die Flasche gefüllt hatte, ihm genau in die Augen.
Er schrie, rieb sich mit den Knöcheln die Augen, während ich einen weiteren schnellen Strahl auf die gehäutete Spitze seines aufgerichteten Schwanzes folgen ließ. Nun wusste er nicht, wohin mit den Händen. Ich beugte mich vor, riss ihm den linken Fuß weg und trat zurück, während er vornüberfiel und mit dem Schädel mit solcher Wucht gegen die Wand krachte, dass eine Kachel zu Bruch ging.
All das geschah innerhalb weniger Sekunden. Dendo, der bislang nur ungläubig dagestanden hatte, kam nun auf mich zu. Ich fuchtelte mit der Shampooflasche vor den beiden herum. Er blieb stehen.
»Entweder du bringst das Vogelgehirn hier zu einem Arzt, oder du wirst ihm einen weißen Stock kaufen müssen«, sagte ich.
Dann nahm ich mein Handtuch und verzog mich.
Sie sehen, ich gebe mich in Ihre Hände, mein lieber Mr. Pascoe. Ich gestehe einen tätlichen Angriff mit schwerer Körperverletzung und Todesfolge. Denn es stellte sich heraus, dass Brillo für einen so dicken Mann einen überraschend dünnen Schädel hatte. Seine Verletzung führte zu verspätet diagnostizierten meningealen Problemen, die wiederum zu seinem Ableben führten. Wahrscheinlich könnten Sie, obwohl bereits viel Zeit verstrichen ist, noch eine Untersuchung in die Wege leiten. Der Beifall der Behörden im Syke dürfte Ihnen allerdings kaum gewiss sein. Sie leierten schon damals eine Untersuchung an, doch Bruder Dendo, der sich selbst unter Umständen wie diesen nicht dazu überwinden konnte, mit dem Gesetz zu kooperieren, verlor die Selbstbeherrschung, als einer der Schließer es seinem toten Bruder gegenüber an gehörigem Respekt mangeln ließ, weshalb er ihm den Kiefer brach.
Sehr zu meiner Erleichterung schafften sie ihn fort. Unter den Knastbrüdern wusste natürlich jeder, was vorgefallen war, doch ohne Polchards Zustimmung plauderte keiner etwas aus. Und da sich die Schließer bei Brillos Tod ein gewisses Maß an Nachlässigkeit vorwerfen mussten und deshalb froh waren, ihn und die Affäre begraben zu können, wurden nur sehr wenige Fragen gestellt.
Das war Stufe eins. Auch Polchard war vermutlich kaum betrübt über den vorzeitigen Abgang der Brights. Allerdings gab es noch eine ganze Menge anderer Insassen, die nur allzu bereit waren, Dendo einen Gefallen zu erweisen; der Schutz eines Topmanns war also nach wie vor unabdingbar.
Damit zu Stufe zwei.
Beim nächsten Aufenthalt im Gemeinschaftsraum näherte ich mich seinem Tisch und stellte mich in gehöriger Entfernung davor, wie sie mir für ein Bittgesuch als angemessen erschien.
Er ignorierte mich völlig, er sah unter seinen buschigen Augenbrauen noch nicht einmal auf. Die Gespräche und Aktivitäten im Raum wurden weitergeführt, doch über allem lag diese unwirkliche gedämpfte Stimmung, die vorherrscht, wenn alle nur so tun als ob.
Ich studierte das Schachbrett, während er sich den nächsten Zug überlegte. Er hatte ganz offensichtlich mit einer orthodoxen Damenbauer-Eröffnung begonnen und sie mit einer Abwandlung der Slawischen Verteidigung gekontert. Gegen sich selbst zu spielen ist eine Übung, bei der der Top-Spieler seine Grundfertigkeiten entwickeln kann, die eigentliche Prüfung aber kommt natürlich immer erst dann, wenn man gegen einen gleichwertigen oder überlegenen Spieler antritt.
Schließlich, nach wohl zwanzig Minuten, wobei uns nur noch fünf Minuten im Gemeinschaftsraum blieben, führte er seinen Zug aus.
Dann, ohne aufzublicken, sagte er: »Was?«
Ich trat vor, nahm den schwarzen Läufer und schlug seinen Springer.
Im Raum wurde es still.
Natürlich war es eine Falle gewesen, den Springer dem Läufer auszuliefern. Eine, die er sich selbst gestellt hatte und auf die er selbst nicht hereingefallen wäre. Aber ich war darauf hereingefallen. Was er nun wissen wollte, war: Hatte ich es aus reinem Unvermögen getan oder verfolgte ich einen eigenen Plan?
Jedenfalls hoffte ich, dass er das wissen wollte.
Nach einer langen Minute, in der er noch immer nicht aufblickte, sagte er: »Stuhl.«
Ein Stuhl wurde mir gegen die Kniekehlen geschoben, ich setzte mich.
Die restliche Zeit verbrachte er mit dem Studium des Schachbretts.
Als die Klingel uns in unsere Zellen zurückrief, sah er mir zum ersten Mal ins Gesicht und sagte: »Morgen.«
Und so, Mr. Pascoe, ließ ich die erste Stufe meiner Gefängniskarriere, die auch die gefährlichste ist, hinter mir. Hätte ich nur dagesessen und Rachepläne gegen Sie geschmiedet, wäre ich zu diesem Zeitpunkt bereits vergewaltigt, wahrscheinlich verstümmelt, sicherlich jedoch zum Fußabstreifer degradiert worden, den jeder nach Lust und Laune treten und demütigen konnte. Nein, ich musste pragmatisch sein, um mit der bestehenden Situation, so gut ich konnte, zurechtzukommen. Genau so verhält es sich auch jetzt. Ich mache keinen Hehl daraus. Ich will nicht ständig über die Schulter blicken und Angst haben müssen, dass Sie, angetrieben von Ihren eigenen Ängsten, hinter mir her sind.
Vielleicht werden wir beide eines Tages zu der Erkenntnis kommen, dass die Flucht vor einer Sache, die wir fürchten, sich nicht so sehr von dem Streben nach jener unterscheidet, die wir lieben. Falls und wenn dieser Tag kommt, dann, hoffe ich, mein lieber Mr. Pascoe, werde ich Ihnen ins Gesicht sehen und Ihre ausgestreckte Hand ergreifen und Sie sagen hören: »
esus, Maria und Josef!«, sagte Peter Pascoe.
»Ja, ich weiß, es ist die Jahreszeit«, sagte Ellie Pascoe, die auf der anderen Seite des Frühstücktisches saß und ohne allzu großen Enthusiasmus den Packen Umschläge durchsah, in denen zweifellos Weihnachtskarten steckten. »Aber ist es gerecht, einem radikalen jüdischen Agitator und seiner Bagage die Schuld dafür zuzuschieben, dass der westliche Kapitalismus seinen angeblichen Geburtstag zum Vorwand nimmt, um den großen Reibach zu machen?«
»Dieser aufgeblasene Kotzbrocken!«, rief Pascoe aus.
»Ah, ein Ratespiel«, sagte Ellie. »Okay. Das Schreiben stammt vom Königshaus und teilt dir mit, dass die Königin beabsichtigt, dich auf ihrer Neujahrs-Ehrungsliste zur Herzogin zu machen. Nein? Okay, ich geb’s auf.«
»Es stammt vom vermaledeiten Roote. Er ist, Gott steh uns bei, in Cambridge!«
»Der vermaledeite Roote? Du meinst Franny Roote? Den Studenten? Den Kurzgeschichtenschreiber?«
»Nein, ich meine Roote, diesen Ex-Häftling. Den Psycho-Kriminellen.«
»Ach, den Roote. Und, was schreibt er?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der Dreckskerl verzeiht mir.«
»Das ist doch schön«, gähnte Ellie. »Wenigstens ist das interessanter als diese dämlichen Karten. Was macht er in Cambridge?«
»Er nimmt an einer Konferenz teil, Studien zur Romantik im frühen neunzehnten Jahrhundert«, sagte Pascoe mit Blick auf das dem Brief beigelegte Programmheft.
»Schön für ihn«, sagte Ellie. »Dann muss es ihm gut gehen.«
»Er ist nur wegen Sam Johnson dort«, sagte Pascoe ausweichend. »Hier ist es ja. Neun Uhr morgens. Mr. Francis Roote trägt einen Aufsatz des verstorbenen Dr. Sam Johnson vor, Titel: Die Suche nach dem Lachen in Death’s Jest-Book. Klingt ausnehmend spaßig. Worum zum Teufel geht’s da?«
»Death’s Jest-Book? Um die Possen des Todes. Du erinnerst dich noch an Thomas Lovell Beddoes, mit dessen Leben Sam sich vor seinem Tod beschäftigt hat? Na ja, Death’s Jest-Book heißt das Stück, an dem Beddoes sein Leben lang schrieb. Ich hab’s nicht gelesen, aber soweit ich weiß, ist es ein ziemliches Schauerstück. Und es geht um Rache.«
»Um Rache. So, so.«
»Stell keine Verbindungen her, die nicht da sind, Peter. Lass mal den Brief sehen!«
»Ich bin noch nicht fertig. Das verdammte Ding scheint kein Ende zu nehmen.«
»Gut, dann reich uns den Teil, den du schon gelesen hast. Und lass dir mit dem Rest nicht zu viel Zeit. Die Zeit und unsere Tochter stehen nämlich nicht still.«
Es hatte eine Zeit gegeben, in der ein dienstfreier Samstag die Aussicht bereithielt, dass er lange schlafen, frühstücken oder, wenn das Glück ihm ganz hold war, noch genüsslichere Häppchen im Bett vernaschen konnte. Damit war es vorbei, seitdem seine Tochter Rosie ihre musikalische Ader entdeckt hatte.
Ob irgendeine kompetente Autorität auf dem Gebiet diese Entdeckung bestätigen würde, vermochte Pascoe nicht zu sagen. Er verfügte zwar über ein gewisses Gespür für Musik, sein Verständnis der Materie aber ging nicht so weit, um beurteilen zu können, ob die stockenden, schrillen Noten, die sogar in diesem Moment ihre Klarinette ausstieß, jenen des präpubertären Benny Goodman glichen oder ob sie damit bereits den Höhepunkt ihrer musikalischen Schaffenskraft erreicht hatte.
In der Zwischenzeit, während er darauf wartete, dies herauszufinden, musste Rosie Unterricht bei der besten verfügbaren Lehrerin nehmen, das hieß bei Ms. Alicia Wintershine von der Mid-Yorkshire Sinfonietta, deren Vortrefflichkeit schon von der Tatsache unterstrichen wurde, dass sie lediglich eine freie Stunde anbieten konnte (und das auch nur, weil eine andere knospende Virtuosin für sich die Ponys entdeckt hatte), nämlich am Samstagmorgen, neun Uhr.
Damit hatte es sich mit dem Frühstück im Bett und so.
Doch ein Mann ist, wenn schon nicht Herr über sein Haus, Herr über seinen Kopf, und Pascoe butterte sich eine weitere Toastscheibe und machte sich daran, den Schluss von Rootes Brief zu lesen.
1. Brief 1, Fortsetzung
Verzeihen Sie mir wegen des Aussetzers!
Ich wurde durch die Ankunft eines ganzen Zugs von Gepäckträgern gestört, die so viele Koffer schleppten, dass sie für einen längeren Staatsbesuch der Königin von Saba gereicht hätten. Hinter ihnen folgte ein kleiner, schlanker, athletischer Mann mit braun gebrannter Haut, sodass sein blonder Haarschopf fast weiß wirkte. Von Schutzumschlagfotos erkannte ich ihn sofort als Professor Dwight S. Duerden von der Santa Apollonia University, California (oder St. Poll Uni, CA, wie er sich ausdrückte). Er schien ein wenig verstimmt, als er feststellte, dass er die Quästoren-Wohnung mit mir zu teilen hatte, obwohl ich in aller Bescheidenheit das kleinere der beiden Schlafzimmer belegt hatte.
(Sie dürften mittlerweile bestimmt selbst draufgekommen sein, dass ich nicht der Quästor – wer immer das sein mag – des God’s bin, sondern lediglich ein zeitweiliger Logisgast, der während der Konferenz in dessen Räumlichkeiten einquartiert wurde. Der Quästor selbst, habe ich gehört, führt eine Gruppe hellenophiler Reiseteilnehmer auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff durch die Ägäis. Ein Aspekt seiner Arbeit, der auf seltsame Weise mein Interesse weckt!)
Professor Duerden und der Großteil seines Gepäcks sind nun endlich in seinem Schlafzimmer verschwunden. Falls er beabsichtigt, alles auszupacken, dürfte er dazu eine Weile brauchen. Ich werde daher fortfahren.
Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, mitten in einem Abschnitt, der Gefahr lief, zu einer ermüdenden philosophischen Abschweifung auszuufern, lassen Sie mich daher zu meiner Erzählung zurückkehren.
Am darauf folgenden Tag erreichte ich im Spiel gegen Polchard ein Remis. Ich glaube, ich hätte ihn schlagen können, will es aber nicht beschwören. Außerdem erschien mir für den Anfang ein Remis als das Beste.
Danach spielten wir jeden Tag. Anfangs hatte er immer Weiß, nach unserem dritten Remis aber drehte er das Brett um, und danach wechselten wir ständig ab. Das sechste Spiel gewann ich. Im Raum herrschte Grabesstille, nicht im Gedenken an dieses denkwürdige Ereignis, sondern mehr in Erwartung, nun gleich Zeuge einer Opferung zu werden. Als ich zu meiner Zelle zurückging, wandten die Männer, die in den vorangegangenen Wochen mir gegenüber immer freundlicher aufgetreten waren, sich von mir ab. Ich schenkte ihnen keine Beachtung. Für sie war Polchard der Rattenkönig, für mich war er der Großmeister. Es macht keinen Spaß, gegen jemanden zu spielen, der nicht gut genug ist, um einen zu schlagen, und noch weniger, der zwar gut genug, aber zu verängstigt dazu ist. Mein langfristiger Überlebensplan beruhte darauf, zwischen uns eine Art Gleichberechtigung herzustellen.
Das hatte ich mir ausgemalt, wusste aber, dass ich mich täuschen konnte. In jener Nacht träumte ich, ich befinde mich in jener Szene in Bergmans Das siebente Siegel, in der der Ritter und der Tod miteinander Schach spielen. Schweißgebadet wachte ich auf und glaubte, einen schrecklichen Fehler begangen zu haben.
Am nächsten Tag aber wartete er bereits mit den aufgestellten Figuren, und ich wusste, ich war die Sache richtig angegangen.
Nun musste ich nur noch einen Weg finden, ihn gewinnen zu lassen, ohne dass er es bemerkte.
Aber nicht sofort, dachte ich. Das wäre zu offensichtlich. Schlimmer als ständig zu gewinnen wäre es gewesen, wenn er mich dabei ertappte, dass ich absichtlich verlor. Kurz darauf zog Polchard dreimal schneller als sonst, und als ich das Brett studierte, erkannte ich, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte. Seine einsamen Übungsstunden hatten ihn zu einem hervorragenden Defensivspieler werden lassen. Nun, das wird man unweigerlich, wenn man sich der Gambits zu erwehren hat, die man sich selbst ausdenkt. Doch der Hurensohn hatte sich alle Einzelheiten meiner Spielweise eingeprägt und ging plötzlich zum offenen Angriff über. Und ich geriet in Schwierigkeiten.
Es wäre ein Leichtes gewesen, vor seiner Überrumpelung alles hinzuwerfen, doch das tat ich nicht. Ich wand und bog mich, versuchte mich zu entziehen und zu entschlüpfen, und als ich schließlich meinen König flachlegte, wussten wir beide, dass er fair und ehrlich gewonnen hatte.
Er lächelte, als er die Figuren erneut aufstellte. Wie kräuselnde Wellen auf einem dunklen Teich.
»Schach, Krieg, Job«, sagte er. »Alles das Gleiche. Bring sie dazu, das eine zu glauben, und dann machst du das andere.«
Kein schlechter Schlachtplan, vermute ich, wenn man ein Berufsverbrecher ist.
Danach machte ich mir keine Sorgen mehr wegen der Ergebnisse.
Alle waren jetzt wieder meine Freunde, aber ich machte nicht viel Aufhebens darum. Ich wollte als Gleicher akzeptiert, nicht als Günstling beneidet werden. Ich wusste, solange ich meine Karten und meine Figuren richtig spielte, hatte ich einen Freifahrtschein in der Tasche, um so komfortabel wie möglich meine Zeit hinter mich zu bringen.
Doch so komfortabel man sich in einem lärmenden, stinkenden, überfüllten, vor Eisengittern starrenden Gefängnis aus dem neunzehnten Jahrhundert auch einrichtet, es bleibt, verdammt noch mal, ein Gefängnis.
Es war an der Zeit, die Energien auf mein nächstes Projekt zu konzentrieren: dort rauszukommen.
Sie sehen, ich hatte keine Zeit für den Luxus, mich mit Racheplänen zu beschäftigen! Ich hatte einen heiklen Drahtseilakt zu vollführen, musste Polchards Freund bleiben und gleichzeitig mir den Ruf eines reformierten Insassen erwerben, damit ich in den freundlichen offenen Strafvollzug verlegt wurde. Trotz des gegenteiligen Anscheins befleißigt sich die Staatsgewalt des rührenden Glaubens, dass Bildung und Tugend miteinander korrelieren. Ich schrieb mich daher an einer Fernuniversität ein und entschied mich für ein starkes soziologisches Element, um die Staatsgewalt mit meinem wiedererwachten Sinn für staatsbürgerliche Verantwortung zu beeindrucken. Außerdem ist das Zeug denkbar einfach. Jeder, der nur halbwegs bei Verstand ist, bekommt in zehn Minuten mit, welche Knöpfe zu drücken sind, damit die Tutoren über deine Essays zu gurren beginnen. Man verrühre einige sentimentale linke Meinungen zu einem weichen Schaum, gebe als Bindemittel Statistiken zum sozialen Niedergang bei, und schon ist man auf der sicheren Seite – oder im völligen Abseits, wenn es nach den alten, nicht reformierten Thatcher-Anhängern gehen würde. Nachdem jene beiseite geräumt waren, begann ich einen MA-Kurs. Meine Abschlussarbeit behandelte das Thema Schuld und Sühne, was mir die Möglichkeit eröffnete, mich großspurig als geläutertes Mitglied der Gesellschaft zu gerieren. Nur leider war es geradezu tödlich langweilig.
Es wäre alles in Ordnung gewesen, hätte ich nur die Wahrheit über meine Mithäftlinge erzählen können, für die das Verbrechen ein Job wie jeder andere war, nur dass es das Problem mit der Arbeitslosigkeit nicht gab. Es ist völlig sinnlos, das Gefängnis als Weiterbildungseinrichtung zu betrachten, wenn man mit Leuten zu tun hat, die sich selbst nicht als arbeitslos, sondern als aus dem Verkehr gezogen betrachten. Es wäre besser, wenn man sie mit Steuergeldern auf Urlaub ins Ausland schicken würde, in der Hoffnung, dass sie sich dort eine Lebensmittelvergiftung oder die Legionärskrankheit zuziehen. Aber ich war mir völlig darüber im Klaren, wenn ich solche Theorien ausarbeitete, würde mir das kaum universitären Ruhm eintragen. Daher sonderte ich den üblichen Quatsch von Sozialisierung und Rehabilitation ab, und als die Zeit reif dafür war, wurde aus mir Francis Roote, MA.
Aber ich war noch immer im Syke, trug mich allerdings mit der Hoffnung, nun meinen Weg zum Butlin geebnet zu haben, Yorkshires neueste und luxuriöseste offene Haftanstalt am Rande des Peak District.
Ich konnte nicht verstehen, dass ich keinerlei Fortschritte in diese Richtung erzielte. Okay, ich spielte mit Polchard Schach, gehörte aber im strengen Sinn nicht zu seinem Gesindel. Ich legte die Sache einem der Schließer vor, mit dem ich durch Süßholzgeraspel auf halb-vertraulichem Fuß stand.
»Ihr könnt mir das doch nicht verweigern, nur weil ich Schach spiele«, protestierte ich.
Er zögerte, bevor er sagte: »Vielleicht sind es gar nicht wir, die dir das verweigern.«
Und das war’s dann. Aber es genügte.
Es war Polchard, der dafür sorgte, dass ich nicht verlegt wurde.
Er wollte nicht den einzigen Typen im Flügel, vielleicht sogar im ganzen Syke verlieren, der ihm auf dem Schachbrett was bot für sein Geld. Um mich dazubehalten, musste er die Schließer nur wissen lassen, dass es ihn und damit alle anderen sehr, sehr unglücklich machte, wenn er mich verlieren würde.
Da ich keine Möglichkeit sah, das zu ändern, musste ich mir Gegenmaßnahmen einfallen lassen.
Ich brauchte einige schwere Puncher in meiner Ecke. Aber wo sie finden?
Der Gefängnisleiter war zu sehr damit beschäftigt, seinen Hintern gegen politische Gutmenschen zu verteidigen, um sich mit individuellen Fällen zu befassen, während der Kaplan ein altmodischer Whisky-Priester war, dessen alkoholisierte Liebenswürdigkeit so vereinnahmend war, dass er sich sogar für Dendo Bright einsetzte, der Gott sei Dank in einen weit entfernten Hochsicherheitstrakt verlegt worden war.
Was meine nahe liegendste Wahl anbelangte, den Gefängnis-Psychiater, so war er ein fröhlicher kleiner Mann mit dem nicht sehr vertrauenerweckenden Spitznamen Plemplem, bei dem sich alle einig waren, dass man in der Tat verrückt sein musste, wenn man ihn konsultierte. Doch dann wurde die Anstalt einer staatlichen Inspektion unterzogen, was zu einer zeitweiligen Verbesserung des Speiseplans und, unter dem Mantel der Verschwiegenheit, zur permanenten Entfernung des ungerührt lächelnden Plemplem führte.
Kurz darauf stellte jeder im Gefängnis die Ohren und andere Dinge steif, als verkündet wurde, dass ein neuer Seelenklempner zugewiesen wurde – eine Frau!
Professor Duerden hat mich erneut unterbrochen.
Ich habe seine Reaktion, als wir uns das erste Mal begegneten, wohl missinterpretiert. Nicht die Tatsache, dass er die Quästoren-Wohnung mit mir zu teilen hat, hatte ihn verdattert, sondern dass er sie mit jemandem teilt, den er noch nie gesehen und von dem er noch nie gehört hat.
Ein Engländer hätte sich bei dem Thema gewunden, auch manche Amerikaner können um den heißen Brei herumreden, er jedoch gehört zu jenen, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
»Na, mein Junge, wo arbeiten Sie denn?«, fragte er mich.
»An der Mid-Yorkshire University«, erwiderte ich.
»Wirklich? Dann helfen Sie mir mal auf die Sprünge, wer leitet denn im Moment Ihren Fachbereich?«
»Mr. Dunstan«, sagte ich.
»Dunstan?« Er wirkte verwirrt. »Ist das vielleicht Tony Dunstan, der Mediavist?«
»Nein, es ist Jack Dunstan, der Obergärtner«, sagte ich.
Nachdem er seine Überraschung darüber, was ihn nicht wenig amüsierte, überwunden hatte, gab es für mich keinen Grund, nicht vollkommen offen zu ihm zu sein. Ich erklärte, dass mir Sam Johnson einen Job in der Gärtnerei besorgt hatte, und da ich nicht nur sein Student war, sondern auch ein enger Freund von ihm, war es mir durch die guten Dienste seiner Schwester zugefallen, als sein literarischer Nachlassverwalter zu fungieren.
»Sam sollte einen Vortrag bei der Konferenz halten«, schloss ich meine Ausführungen, »und als das Programmkomitee mich kontaktierte und fragte, ob ich sein Referat in loco praeceptoris vortragen wolle, fühlte ich mich seinetwegen verpflichtet zuzusagen. Ich nehme an, dass man daraufhin seinen Namen generell durch meinen ersetzt hat, wodurch ich in die Quästoren-Wohnung einquartiert wurde.«
»Ja, so wird’s wohl gewesen sein«, sagte er, aber ich befürchte, er schätzte noch nicht einmal Sam hoch genug ein, damit dieser es verdient gehabt hätte, sein Mitbewohner zu sein.
Tatsächlich machte ich mir bereits selbst darüber Gedanken, und ich glaube, ich weiß, woher der Wind weht. Im Programmheft wird Sir Justinian Albacore, dem Dekan des St. Godric’s, unter dessen Auspizien wir an der Universität zu Gast sind, besonderer Dank erwiesen. Bei dem Namen klingelt’s bei mir. Könnte es sich um jenen J. C. Albacore handeln, dessen Abhandlung über die dunkle romantische Seele, Die Suche nach Nepenthe, Sie wahrscheinlich kennen? Ich habe das Buch nie gelesen, aber oft gesehen, war es doch unter das gebrochene Sofabein in Sam Johnsons Arbeitszimmer geschoben. Denn niemanden hasste Sam in seinem Leben mehr als diesen Mann. Sam zufolge hatte er Albacore bei der Abfassung der Nepenthe sehr geholfen, und dieser hatte es ihm gedankt, indem er ihm sein Beddoes-Projekt vor der Nase wegschnappte! Sam schöpfte Verdacht, als er feststellte, dass jemand vor ihm in einigen nur selten aufgesuchten Archiven gewühlt hatte. Schließlich wurde publik, dass Albacore an einer kritischen Beddoes-Biographie arbeitete, die 2003 erscheinen soll, zum zweihundertsten Geburtstag von TLB. Und kurz vor seinem Tod spuckte Sam Gift und Galle, als er das Gerücht aufschnappte, Albacores Verleger wolle das Buch bereits Ende 2002 veröffentlichen, um als Erster auf dem Markt zu sein.
Ich bezeichnete mich Dwight gegenüber als Sams literarischen Nachlassverwalter, was nicht ganz stimmt. In Wirklichkeit, Sie haben wahrscheinlich davon gehört, beschloss Linda Lupin, Abgeordnete des Europaparlaments, Sams Halbschwester und einzige Erbin, in ihrer Großzügigkeit, Sams Forschungsarbeiten in meine Hände zu geben. Wahrscheinlich wird es Sie nicht überraschen, wenn Sie hören, dass der Verleger, bei dem Sams Biographie erscheinen soll, davon nicht gerade begeistert war.
Ich kann seinen Standpunkt verstehen. Wer bin ich denn? Literarisch ein Nichts, obwohl meine »bunte« Vergangenheit etwas ist, was den Vertrieb sehr wohl angekurbelt hätte, wäre nur keine Konkurrenz erwachsen. Doch nachdem Albacores Buch bereits als die »definitive« Biographie vermarktet wurde, kamen sie zu dem Schluss, dass sie dem schlechten Geld noch gutes nachwerfen würden, wenn sie mich Sams Arbeit hätten fortsetzen lassen.
Also, tut uns Leid, Kumpel, keinen Vertrag für das große Buch, auf das Sam abgezielt hatte.
Sie machten jedoch einen Alternativvorschlag.
Da Beddoes’ Leben kaum dokumentiert ist, hatte Sam in sein Skript Abschnitte eingeflochten, die er ganz klar als »imaginierte Szenen« bezeichnete. Diese, wie er in der ersten Fassung des Vorworts erklärt, tragen nicht den Anspruch, ausführliche Beschreibungen tatsächlicher Ereignisse zu sein. Manche basieren zwar auf gesicherten Fakten, andere allerdings sind lediglich fantasievolle Projektionen, erfunden, um dem Leser ein Gespür für die realen Gegebenheiten von Beddoes’ Leben zu vermitteln. Viele von ihnen, so vermute ich, wären in der Endfassung noch stark überarbeitet oder ganz gestrichen worden.
Was, wurde ich gefragt, würde ich denn dazu sagen, wenn ich den größten Teil des literaturkritischen Zeugs rauslasse, mir noch einige dieser »imaginierten Szenen« ausdenke, sie mit knisterndem Sex und handfester Gewalt würze und eine dieser Pop-Biographien produziere, die sich in den vergangenen Jahren so gut verkauft haben?
Die Bedenkzeit, die sie mir dafür einräumten, benötigte ich nicht.
Ich sagte ihnen, sie könnten sich das alles sonst wohin stecken. Ich sei Sam zu wesentlich mehr verpflichtet.
Und während sich mir im Kopf noch alles drehte nach dieser Ungerechtigkeit, kam die Einladung, bei dieser Konferenz Sams Platz einzunehmen.
Für mich war unbesehen klar, dass die Konferenzplaner damit einem wertgeschätzten Kollegen posthum ihren Tribut zollten und sich dabei gleichzeitig ersparten, ihr Programm umzuwerfen. Aber das erklärte nicht, warum ich wie die Mehrzahl der Vortragenden nicht in irgendeiner Studentenbude untergebracht wurde, sondern zusammen mit Dwight Duerden in der Q-Wohnung residierte. Es musste ein anderes Motiv dahinterstecken. Als ich dann Albacores Namen entdeckte, argwöhnte ich, dass er sich wohl Hoffnungen machte, mir Sams Forschungsarchiv über Beddoes abschwatzen zu können.
Vielleicht bin ich paranoid. Doch in den Hainen der Akademe tummeln sich zahllose Raubvögel, das hat Sam mir immer eingetrichtert. Wie auch immer, ich werde das besser beurteilen können, wenn ich die Gastgeber der Konferenz kennen gelernt habe, was bei der Begrüßungs- und Einführungsveranstaltung in einer Viertelstunde geschehen wird.
Nun, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei der neuen Psychologin. Ihr Name, stellen Sie sich nur vor, lautete Amaryllis Haseen!
Neckische Schattenspielereien mit Amaryllis, Sie erinnern sich, gehörten neben der Abfassung von Gedichten zu den Dingen, die Miltons höchst unpuritanische Vorstellungskraft ihm eingaben. Mir selbst ist die Blume nur in Form der aufdringlich fleischigen Exemplare bekannt, die manchmal zu Weihnachten auftauchen. Nun, verglichen mit ihnen entsprach Ms. Haseen ihrem Namen vollkommen und wurde von den meisten der sexuell ausgehungerten Knastbrüder als vorgezogenes Weihnachtspräsent betrachtet. Wie einer von Polchards Top-Kumpel verträumt sagte: »’nem Zuckerpüppchen wie dem kann man seine ganzen sexuellen Fantasien auftischen, das ist noch besser, als seinen Pimmel über Women on Top abzuwedeln.«
Jeder unter uns entwickelte daraufhin psychologische Probleme. Ms. Haseen allerdings war nicht dumm. Sie übernahm die Beratungsstelle im Chapel Syke, um Material für ein Buch über die psychologischen Auswirkungen der Einkerkerung zu sammeln, das, hoffte sie, ebenso ihrem Renommee wie ihrem Bankkonto zugute kam. (Es erschien letztes Jahr, heißt Dunkle Zellen und bekam viele nette Kritiken. Ich bin übrigens Inhaftierter XR, S. 193-207.) Die Wichser sortierte sie schnell aus. Als Polchards Adjutant sich beschwerte, dass er rausgeworfen wurde, während ich zweimal in der Woche zur Sitzung erscheinen durfte, lächelte ich und sagte: »Du musst ihr das Gefühl geben, dass sie dir helfen kann, das heißt, du kannst ihr nicht einfach, wie du es tust, deine Latte hinhalten und sagen, so, jetzt besorg es mir mal rundherum!« Das brachte sogar Polchard zum Lächeln, und wenn ich von nun an von meinen Sitzungen zurückkehrte, wurde ich mit obszönen Fragen bestürmt, wie weit ich auf dem Weg in ihre Unterwäsche schon vorangeschritten sei.
Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich glaube, ich hätte es geschafft, aber ich habe es noch nicht einmal versucht. Auch wenn mir Erfolg beschieden gewesen wäre, was hätte ich dafür bekommen?
Einige mittelmäßige Momente gedankenlosen Vergnügens (unter den gegebenen Umständen wäre nicht mehr drin gewesen, als sich wackelige Knie zu holen) und eine Koda postkoitaler Trauer, die sich jahrelang hinziehen kann!
Ich musste Realist bleiben. Auch wenn ich Amaryllis zu neckischen Spielereien im Schatten hätte verführen können, so wäre sie doch, wenn sie durch das Haupttor des Sykes wieder in den hellen Sonnenschein hinaus zu ihrer viel versprechenden Karriere und glücklichen Ehe schritt, vor Scham und Angst erschaudert und möglichen zukünftigen Vorwürfen meinerseits zuvorgekommen, indem sie mich als einen gefährlichen Fantasten gebrandmarkt hätte. (Sie meinen, ich sei zu zynisch? Lesen Sie weiter.)
Also richtete ich mein Augenmerk darauf herauszufinden, was sie von mir in ihrer beruflichen Rolle wollte, und sorgte dafür, dass sie es bekam.
Und noch eine andere Gefahr lauerte hier. Sie verstehen, was sie wirklich wollte, war herauszufinden, wie ich tickte. Das Problem war, dass dieses Thema mich ebenfalls faszinierte.
Ich habe immer gewusst, dass ich nicht so bin wie die anderen. Wie sich dieses Anderssein jedoch manifestiert, hat sich mir immer entzogen. Basiert es auf einem Zuviel oder einem Zuwenig? Habe ich etwas, was anderen fehlt, oder fehlt mir etwas, was andere haben?
Mit anderen Worten, bin ich unter den Sterblichen ein Gott oder nur ein Wolf unter Schafen?
Die Versuchung, ihr alles offen auf den Tisch zu legen, um dann zu sehen, was sie mithilfe ihres fachkundigen Verstandes mit diesem faszinierenden Durcheinander anstellte, war groß. Das Risiko allerdings war noch größer. Angenommen, sie käme zu dem Schluss, dass ich ein unheilbarer Soziopath sei?usatz
Bedauerlicherweise musste ich mir also die Freuden vollkommener analytischer Ehrlichkeit für später aufheben und sie auf einen Zeitpunkt verschieben, an dem ich die Sitzung aus eigener Tasche und nicht mit meiner Freiheit bezahlen konnte.
Ich lenkte meine Energien daher ganz darauf, Amaryllis das finden zu lassen, was für uns beide am vorteilhaftesten war – eine leicht zerrissene Persönlichkeit, die in ihrem Buch einen interessanten Absatz abgeben könnte.
Es machte viel Spaß. Ich war bemüht, die nachprüfbaren Fakten meiner Vergangenheit nicht zu ändern. Darüber hinaus aber waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt; wie Dorothy nach dem Wirbelsturm verließ ich die Schwarzweiß-Welt von Kansas und trat in die grellen, bunten Farben von Oz ein. Wie die meisten Seelenklempner war sie auf meine Kindheit fixiert, und ich amüsierte mich köstlich, wenn ich absurde Geschichten über meinen lieben alten Dad erfand, der in Wirklichkeit so früh aus seinem und meinem Leben geschieden war, dass ich keinerlei Erinnerungen an ihn habe. Die meisten davon finden Sie in ihrem Buch. Ich wusste, dass ich ein Talent für die Fiktion habe, lange bevor ich den Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen habe.
Gleichzeitig war mir bewusst, dass Amaryllis keineswegs auf den Kopf gefallen war. Ich musste davon ausgehen, dass sie meinen Plan, mir selbst zu helfen, indem ich anscheinend ihr half, durchschaute. Ich musste also, wie bei den Schachpartien, auf mehreren Ebenen spielen.
Es waren nicht viele Sitzungen nötig, bis ich dachte, ich hätte alles unter Kontrolle.
Doch dann gelang es ihr, mich vollends zu überraschen. Sie begann mit der Frage: »Welche Gefühle bringen Sie jenen entgegen, die Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich sind, dass Sie ins Syke gesteckt wurden?«
»Sie meinen die außer mir?«, sagte ich.
Es schien mir eine gute Antwort zu sein, sie grinste mich jedoch nur an, als wollte sie sagen, »hören Sie schon auf damit!«.
Also lächelte ich zurück und sagte: »Sie meinen die Polizisten, die mich verhaftet und die Indizien gegen mich zusammengetragen haben?«
»Wenn Sie sie für verantwortlich halten«, sagte sie.
»Da fühle ich gar nichts«, sagte ich. »Ich habe seit dem Prozess noch nicht einmal an sie gedacht.«
»Sie haben keinen Gedanken an Rache verschwendet? Keine kleinen Fantasien, um sich nächtens die Zeit zu vertreiben?«
Es war witzig, seit Wochen hatte ich ihr Lügen und Halbwahrheiten aufgetischt, und nun, als ich ihr ohne Ausflüchte und Verdrehungen erzählte, wie es ist, bekam ich von ihr ein ungläubiges Grinsen.
»Lesen Sie es mir von den Lippen ab«, sagte ich betont. »Rachegedanken haben weder meinen Schlaf gestört noch mich tagsüber umgetrieben. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer, küsse die Bibel und schwöre beim Grab meines Vaters.«
Ich meinte es genauso, wie ich es sagte, jedes Wort. Bis heute.
»Wie erklären Sie sich dann das Thema für Ihre Dissertation?«, fragte sie.
Mir blieb die Luft weg, aus zwei Gründen.
Erstens: Woher zum Teufel kannte sie den Gegenstand meiner Arbeit?
Und zweitens: Wie sollte ich es ihr erklären.
Das Thema der Rache im englischen Drama.
Konnte es sein, dass tief in mir ein bitterer, Ränke schmiedender Zorn sein Unwesen trieb und ich von Rachegedanken gegen Sie und Mr. Dalziel besessen war, während ich die ganze Zeit über glaubte, ich würde gänzlich rational, ungerührt, gleichmütig und gefasst meine Zukunft gestalten?
Nun, ich hatte seitdem viel Zeit, um darüber nachzudenken, und ich kann die Hand aufs Herz legen und ehrlichst verkünden, dass mir kein Gedanke an Sie oder Mr. Dalziel durch den Kopf schwirrte, als ich das Thema für meine Dissertation auswählte.
Wie ich bereits sagte, ich war zu Tode gelangweilt von dem soziologischen Mist, den ich für mein Studium wegzuschaufeln hatte. Ich wollte etwas anderes. Ich wollte etwas, was mit wirklichen Menschen, wirklichen Leidenschaften zu tun hatte. Deshalb musste ich mich von der Soziologie ab- und der Literatur zuwenden, und dort vor allem dem Theater. Ich erinnerte mich an einen alten Englischlehrer, der immer sagte, dass es im Drama drei Handlungstriebfedern gebe – Liebe, Ehrgeiz und Rache –, von denen die Rache die stärkste sei. Daher begann ich die elisabethanischen und jakobäischen Autoren zu lesen und stellte schnell fest, dass er Recht gehabt hatte. Hinsichtlich der dramatischen Energie erwies sich nichts produktiver als die Rache. Die Liebe bewegt, der Ehrgeiz treibt an, die Rache aber explodiert! Ich wusste, ich hatte mein Thema gefunden. Allerdings war es eine ästhetische, akademische, autotelische Wahl, die nichts mit äußeren Faktoren wie meine eigene Situation zu tun hatte.
Aber ich verstand, wie dies auf Amaryllis mit ihrem scheelen freudianischen Blick wirken musste.
Ich setzte bereits zu einer Erwiderung an, wollte ihr meine Argumente darlegen, beschloss dann aber, dass es die falsche Taktik sei, und sagte stattdessen: »Großer Gott, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Und wenn ich’s recht bedenke … nein, nein, nie.«
Soll sie doch sehen, wie ich dummes Zeug sülze, dachte ich mir. Soll sie doch meinen, alles unter Kontrolle zu haben.
Währenddessen überlegte ich fieberhaft, woher sie von meinem Thema wusste. Ich hatte es ihr gegenüber nie erwähnt. Ich hatte es selbst erst die Woche zuvor zusammengestellt und es an die für Fernstudien zuständige Abteilung der Universität von Sheffield geschickt, die noch nicht geantwortet hatte …