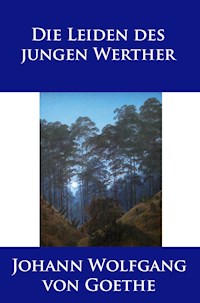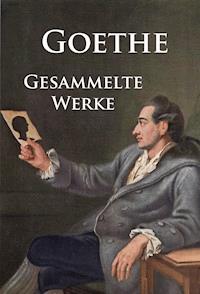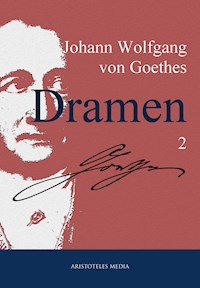Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Einer der erfolgreichsten Romane der Geschichte: Goethes berühmter Briefroman über eine tragische Liebe. Bei einem Ball lernt der junge Werther Lotte kennen – und er verliebt sich in sie. Doch Lotte ist schon vergeben und heiratet kurz danach ihren Verlobten. Enttäuschte Liebe und Eifersucht machen Werther das Leben unerträglich, und für ihn scheint es scheint nur einen Ausweg zu geben.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johann Wolfgang von Goethe
Die Leiden des jungen Werther
Mit vier Illustrationen
Saga
Die Leiden des jungen WertherCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1774, 2019 Johann Wolfgang von Goethe und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726373103
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Erste Abteilung
Noch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten,
Hervor dich an des Tages Licht,
Begegnest mir auf neubeblümten Matten
Und meinen Anblick scheust du nicht;
Es ist, als ob du lebtest in der Frühe,
Wo uns der Tau auf einem Feld erquickt,
Und nach des Tages unwillkommner Mühe
Der Scheidesonne letzter Strahl entzückt;
Zum Bleiben ich, zum Scheiden du erkoren,
Gingst du voran und hast nicht viel verloren.
Des Menschen Leben scheint ein herrlich Los,
Der Tag, wie lieblich! so die Nacht, wie gross!
Und wir, gepflanzt in Paradieses Wonne,
Geniessen kaum der hocherlauchten Sonne,
Da kämpft sogleich verworrene Bestrebung
Bald mit uns selbst und bald mit der Umgebung,
Keins wird vom andern wünschenswert ergänzt,
Von aussen düstert’s, wenn es innen glänzt,
Ein glänzend Äussres deckt mein trüber Blick,
Da steht es nah, und man verkennt das Glück.
Nun glauben wir’s zu kennen! Mit Gewalt
Ergreift uns Liebreiz weiblicher Gestalt,
Der Jüngling, froh, wie in der Kindheit Flor,
Im Frühling tritt als Frühling selbst hervor,
Entzückt, erstaunt, wer dies ihm angetan?
Er schaut umher, die Welt gehört ihm an;
Ins Weite zieht ihn unbefangne Hast,
Nichts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Palast,
Wie Vögelschar an Wäldergipfeln streift,
So schwebt auch er, der um die Liebste schweift,
Er sucht vom Äther, den er gern verlässt,
Den treuen Blick, und dieser hält ihn fest.
Doch erst zu früh, und dann zu spät gewarnt,
Fühlt er den Flug gehemmt, fühlt sich umgarnt.
Das Wiedersehn ist froh, das Scheiden schwer,
Das Wieder-Wiedersehn beglückt noch mehr,
Und Jahre sind im Augenblick ersetzt;
Doch tückisch harrt das Lebewohl zuletzt.
Du lächelst, Freund! gefühlvoll wie sich’s ziemt:
Ein grässlich Scheiden machte dich berühmt,
Wir feierten dein kläglich Missg-schick,
Du liessest uns zu Wohl und Weh zurück;
Dann zog uns wieder ungewisse Bahn
Der Leidenschaften labyrinthisch an,
Und wir, verschlungen wiederholter Not,
Dem Scheiden endlich — Scheiden ist der Tod. —
Wie klingt es rührend, wenn der Dichter singt,
Den Tod zu meiden, den das Scheiden bringt!
Verstrickt in solche Qualen, halbverschuldet,
Geb’ ihm ein Gott, zu sagen, was er duldet.
Am 4. Mai.
Wie froh ich bin, dass ich weg bin! Bester Freund, was ist das Herz des Menschen! Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war, und froh zu sein! Ich weiss, Du verzeihst mir’s. Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um ein Herz wie das meinige zu ängstigen? Die arme Leonore! Und doch war ich unschuldig. Konnt’ ich dafür, dass, während die eigensinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, dass eine Leidenschaft in dem armen Herzen sich bildete? Und doch — bin ich ganz unschuldig? Hab’ ich nicht ihre Empfindungen genährt? hab’ ich mich nicht an den ganz wahren Ausdrücken der Natur, die uns so oft zu lachen machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ergötzt? hab’ ich nicht — O, was ist der Mensch, dass er über sich klagen darf! Ich will, lieber Freund, ich versprech Dir’s, ich will mich bessern, will nicht mehr das bisschen übel, das uns das Schicksal vorlegt, wiederkäuen, wie ich’s immer getan habe; ich will das Gegenwärtige geniessen, und das Vergangene soll mir vergangen sein. Gewiss, Du hast recht, Bester, der Schmerzen wären minder unter den Menschen, wenn sie nicht — Gott weiss, warum sie so gemacht sind! — mit so viel Emsigkeit der Einbildungskraft sich beschäftigten, die Erinnerung des vergangenen Übels zurückzurufen, eher als eine gleichgültige Gegenwart zu ertragen.
Du bist so gut, meiner Mutter zu sagen, dass ich ihr Geschäft bestens betreiben, und ihr ehestens Nachricht davon geben werde. Ich habe meine Tante gesprochen, und bei weitem das böse Weib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere heftige Frau, von dem besten Herzen. Ich erklärte ihr meiner Mutter Beschwerden über den zurückgehaltenen Erbschaftsanteil; sie sagte mir ihr Gründe, Ursachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre alles herauszugeben, und mehr als wir verlangten. — Kurz, ich mag jetzt nichts davon schreiben; sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gefunden, dass Missverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Irrungen in der Welt machen, als List und Bosheit. Wenigstens sind die beiden letztern gewiss seltener.
Übrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauss von Blüten, und man möchte ein Maikäfer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben, und alle seine Nahrung darin finden zu können.
Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen rings umher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grafen von M . . . . einen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannigfaltigkeit sich kreuzen und die lieblichsten Täler bilden. Der Garten ist einfach und man fühlt gleich bei dem Eintritte, dass nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier geniessen wollte. Schon manche Träne habe ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Kabinettchen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war, und auch meines ist. Bald werde ich Herr vom Garten sein; der Gärtner ist mir zugetan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei befinden.
Am 10. Mai.
Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süssen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen geniesse. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken, dass meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und ich bin nie ein grösserer Maler gewesen, als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bach liege, und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mückchen, näher an meinem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält; mein Freund, wenn’s dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhn, wie die Gestalt einer Geliebten; dann sehne ich mich oft und denke: ach könntest du das wieder ausdrücken, könntest dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, dass es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes! — Mein Freund — aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen.
Am 12. Mai.
Ich weiss nicht, ob täuschende Geister um diese Gegend schweben, oder ob die warme, himmlische Phantasie in meinem Herzen ist, die mir alles ringsumher so paradiesisch macht. Da ist gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melusine mit ihren Schwestern. — Du gehst einen kleinen Hügel hinunter, und findest Dich vor einem Gewölbe, da wohl zwanzig Stufen hinabgehen, wo unten das klarste Wasser aus Marmorfelsen quillt. Die kleine Mauer, die oben umher die Einfassung macht, die hohen Bäume, die den Platz ringsumher bedecken, die Kühle des Orts; das hat alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht kein Tag, dass ich nicht eine Stunde da sitze. Da kommen dann die Mädchen aus der Stadt und holen Wasser, das harmloseste Geschäft und das nötigste, das ehemals die Töchter der Könige selbst verrichteten. Wenn ich da sitze, so lebt die patriarchalische Idee so lebhaft um mich, wie sie alle, die Altväter, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohltätige Geister schweben. O, der muss nie nach einer schweren Sommertagswanderung sich an des Brunnens Kühle gelabt haben, der nicht das mit empfinden kann.
Am 13. Mai.
Du fragst, ob Du mir meine Bücher schicken sollst? — Lieber, ich bitte Dich um Gottes willen, lass mir sie vom Halse! ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert sein; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstät hast Du nichts gesehen, als dieses Herz. Lieber! brauch’ ich Dir das zu sagen, der Du so oft die Last getragen hast, mich vom Kummer zur Ausschweifung, und von süsser Melancholie zur verderblichen Leidenschaft übergehen zu sehen? Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es gibt Leute; die mir es verübeln würden.
Am 15. Mai.
Die geringen Leute des Ortes kennen mich schon, und lieber mich, besonders die Kinder. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundlich fragte über dies und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich liess mich das nicht verdriessen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entfernung vom gemeinen Volke halten, als glaubten sie durch Annäherung zu verlieren; und dann gibt’s Flüchtlinge und üble Spassvögel, die sich herabzulassen scheinen, um ihren Übermut dem armen Volke desto empfindlicher zu machen.
Ich weiss wohl, dass wir nicht gleich sind, noch sein können; aber ich halte dafür, dass der, der nötig zu haben glaubt vom sogenannten Pöbel sich zu entfernen, um den Respekt zu erhalten, ebenso tadelhaft ist, als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.
Letzthin kam ich zum Brunnen und fand ein junges Dienstmädchen, das ihr Gefäss auf die unterste Treppe gesetzt hatte, und sich umsah, ob keine Kamerädin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helfen. Ich stieg herunter und sah sie an. Soll ich ihr helfen, Jungfer? sagte ich. — Sie ward rot über und über. O, mein Herr! sagte sie. — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf.
Den 17. Mai.
Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiss nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muss; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da tut mir’s immer weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke miteinander geht. Wenn Du fragst, wie die Leute hier sind? muss ich Dir sagen: wie überall! Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den grössten Teil der Zeit um zu leben, und das bisschen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden. O Bestimmung des Menschen!
Aber eine rechte gute Art Volks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden geniesse, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit aller Offen- und Treuherzigkeit sich herumzuspassen, eine Spazierfahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, das tut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muss mir nicht einfallen, dass noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenützt vermodern, und die ich sorgfältig verbergen muss. Ach das engt das ganze Herz so ein. — Und doch! missverstanden zu werden, ist das Schicksal von unsereinem.
Ach, dass die Freundin meiner Jugend dahin ist! ach, dass ich sie gekannt habe! — Ich würde sagen, du bist ein Tor, du suchst, was hienieden nicht zu finden ist; aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die grosse Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sein als ich war, weil ich alles war, was ich sein konnte. Guter Gott! blieb da eine einzige Kraft meiner Seele ungenützt? Konnt’ ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur umfasst? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der seinsten Empfindung, dem schärfsten Witze, dessen Modifikationen, bis zur Unart, alle mit dem Stempel des Genies bezeichnet waren? Und nun! — Ach ihre Jahre, die sie voraus hatte, führten sie früher ans Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren festen Sinn und ihre göttliche Duldung.
Vor wenig Tagen traf ich einen jungen V . . . an, einen offenen Jungen, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Akademien, dünkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Auch war er fleissig, wie ich an allerlei spüre; kurz, er hatte hübsche Kenntnisse. Da hörte er, dass ich viel zeichnete, und Griechisch könnte (zwei Meteore hier im Lande), wandte er sich an mich und kramte viel Wissens aus, von Batteux bis zu Wood, von de Piles zu Winkelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Teil, ganz durchgelesen, und besitze ein Manuskript von Hennen über das Studium der Antike. Ich liess das gut sein.
Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, den fürstlichen Amtmann, einen offenen, treuherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreude sein, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht er viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem Fürstlichen Jagdhofe, anderthalb Stunden von hier, wohin er, nach dem Tode seiner Frau zu ziehen die Erlaubnis erhielt, da ihm der Aufenthalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh tat.
Sonst sind mir einige verzerrte Originale in den Weg gelaufen, an denen alles unausstehlich ist, am unerträglichsten ihre Feundschaftsbezeugungen.
Lebwohl! der Brief wird Dir recht sein, er ist ganz historisch.
Am 22. Mai.
Dass das Leben des Menschen nur ein Traum sei, ist manchen schon so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ansehe, in welche die tätigen und forschenden Kräfte des Menschen eingesperrt sind, wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit da hinaus läuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern, und dann, dass alle Beruhigung über gewisse Punkte des Nachforschens nur eine träumende Resignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man gefangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt: — das alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich kehre in mich selbst zurück, und finde eine Welt! wieder mehr in Ahnung und dunkler Begier, als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt alles vor meinen Sinnen, und ich lächle dann so träumend weiter in die Welt.
Dass die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul- und Hofmeister einig; dass aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtaumeln und, wie jene, nicht wissen, woher sie kommen, und wohin sie gehen, ebenso durch Biskuit und Kuchen und Birkenreiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dünkt, man kann es mit Händen greifen.
Ich gestehe Dir gern, denn ich weiss, was Du mir hierauf sagen möchtest, dass diejenigen die Glücklichsten sind, die, gleich den Kindern, in den Tag hinein leben, ihre Puppen herumschleppen, aus- und anziehen, und mit grossem Respekte um die Schublade umherschleichen, wo Mama das Zuckerbrot hinein verschlossen hat, und wenn sie das Gewünschte endlich erhaschen, es mit vollen Backen verzehren und rufen: Mehr! — das sind glückliche Geschöpfe. Auch denen ist’s wohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen, oder wohl gar ihren Leidenschaften prächtige Titel geben, und sie dem Menschengeschlechte als Riesenoperationen zu dessen Heil und Wohlfahrt anschreiben. — Wohl dem, der so sein kann! Wer aber in seiner Demut erkennt, wo das alles hinausläuft, wer da sieht, wie artig jeder Bürger, dem es wohl ist, sein Gärtchen zum Paradiese zuzustutzen weiss, und wie unverdrossen auch der Unglückliche unter der Bürde seinen Weg fortkeucht, und alle gleich interessiert sind, das Licht dieser Sonne noch eine Minute länger zu sehen: — ja der ist still, und bildet auch seine Welt aus sich selbst, und ist auch glücklich, weil er ein Mensch ist. Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das süsse Gefühl der Freiheit, und dass er diesen Kerker verlassen kann, wann er will.
Am 26. Mai.
Du kennst von altersher meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Ort ein Hüttchen aufzuschlagen, und da mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen angetroffen, das mich angezogen hat.
Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den sie Wahlheim 1 ) nennen. Die Lage an einem Hügel ist sehr interessant, und wenn man oben auf dem Fusspfade zum Dorf herausgeht, übersieht man auf einmal das ganze Tal. Eine gute Wirtin, die gefällig und munter in ihrem Alter ist, schenkt Wein, Bier, Kaffee; und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren ausgestreckten Ästen den kleinen Platz vor der Kirche bedecken, der ringsum mit Bauernhöfen, Scheuern und Höfen eingeschlossen ist. So vertraulich, so heimlich hab’ ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden, und dahin lasse ich mein Tischchen aus dem Wirtshause bringen und meinen Stuhl, trinke meinen Kaffee da, uno lese meinen Homer. Das erstemal, als ich durch einen Zufall an einem schönen Nachmittage unter die Linden kam, fand ich das Plätzchen so einsam. Es war alles im Felde; nur ein Knabe von ungefähr vier Jahren sass an der Erde, und hielt ein anderes, etwa halbjähriges, vor ihm zwischen seinen Füssen sitzendes Kind mit beiden Armen wider seine Brust, so dass er ihm zu einer Art Sessel diente, und ungeachtet der Munterkeit, womit er aus seinen schwarzen Augen herumschaute, ganz ruhig sass. Mich vergnügte der Anblick: ich setzte mich auf einen Pflug, der gegenüber stand und zeichnete die brüderliche Stellung mit vielem Ergötzen. Ich fügte den nächsten Zaun, ein Scheunentor und einige gebrochene Wagenräder bei, alles wie es hintereinander stand, und fand nach Verlauf einer Stunde, dass ich eine wohlgeordnete, sehr interessante Zeichnung verfertigt hatte, ohne das mindeste von dem meinen hinzuzutun. Das bestärkte mich in meinem Vorsatze, mich künftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den grossen Künstler. Man kann zum Vorteile der Regeln viel sagen, ungefähr was man zum Lobe der bürgerlichen Gesellschaft sagen kann. Ein Mensch, der sich nach ihnen bildet, wird nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, der sich durch Gesetze und Wohlstand modeln lässt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bösewicht werden kann; dagegen wird aber auch alle Regel, man rede was man wolle, das wahre Ges fühl von Natur und den wahren Ausdruck derselben zerstören! Sag’ Du, das ist zu hart! sie schränkt nur ein, beschneiden die geilen Reben usw. — Guter Freund, soll ich Dir ein Gleichnis geben? Es ist damit, wie mit der Liebe. Ein junges Herz hängt ganz an einem Mädchen, bringt alle Stunden seines Tages bei ihr zu, verschwendet alle seine Kräfte, all sein Vermögen, um ihr jeden Augenblick auszudrücken, dass er sich ihr ganz hingibt. Und da käme ein Philister, ein Mann der in einem öffentlichen Amte steht und sagte zu ihm: Feiner junger Herr! lieben ist menschlich, nur müsst ihr menschlich lieben! Teilet eure Stunden ein, die einen zur Arbeit, und die Erholungsstunden widmet eurem Mädchen. Berechnet euer Vermögen, und was euch von eurer Notdurft übrig bleibt, davon verwehr’ ich euch nicht, ihr ein Geschenk, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts- oder Namenstage usw. — Folgt der Mensch, so gibt’s einen brauchbaren jungen Menschen, und ich will selbst jedem Fürsten raten, ihn in ein Kollegium zu setzen, nur mit seiner Liebe ist’s am Ende, und wenn er ein Künstler ist, mit seiner Kunst. O meine Freunde! warum der Strom des Genies so selten ausbricht, so selten in hohen Fluten hereinbraust, und Eure staunende Seele erschüttert? — Lieben Freunde, da wohnen die gelassenen Herren auf beiden Seiten des Ufers, denen ihre Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Krautfelder zugrunde gehen würden, und die daher in Zeiten mit Dämmen und Ableiten der künftig drohenden Gefahr abzuwehren wissen.
Am 27. Mai.
Ich bin, wie ich sehe, in Zückungen, Gleichnisse und Deklamationen verfallen, und habe darüber vergessen, Dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ist. Ich sass ganz in malerische Empfindung vertieft, die Dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die sich indes die Zeit nicht gerührt hatten, mit einem Körbchen am Arm, und ruft von weitem: Philipps, Du bist recht brav. Sie grüsste mich, ich dankte ihr, stand auf, trat näher hin und fragte sie, ob sie Mutter von den Kindern wäre? Sie bejahte es, und indem sie dem Ältesten einen halben Weck gab, nahm sie das Kleine auf und küsste es mit aller mütterlichen Liebe. — Ich habe, sagte sie, meinem Philipps das Kleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Ältesten in die Stadt gegangen, um Weissbrot zu holen, und Zucker, und ein irden Breipfännchen. — Ich sah das alles in dem Korbe, dessen Deckel abgefallen war. — Ich will meinem Hans (das war der Name des Jüngsten) ein Süppchen kochen zum Abende; der lose Vogel, der Grosse, hat mir gestern das Pfännchen zerbrochen, als er sich mit Philippsen um die Scharre des Breis zankte. — Ich fragte nach dem Ältesten, und sie hatte mir kaum gesagt, dass er sich auf der Wiese mit ein paar Gänsen herumjagte, als er gesprungen kam, und dem Zweiten eine Haselgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit dem Weibe, und erfuhr, dass sie des Schulmeisters Tochter sei, und dass ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Vetters zu holen. — Sie haben ihn darum betrügen wollen, sagte sie, und ihm auf seine Briefe nicht geantwortet; da ist er selbst hineingegangen. Wenn ihm nur kein Unglück widerfahren ist, ich höre nichts von ihm. — Es ward mir schwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jedem der Kinder einen Kreuzer, und auch fürs Jüngste gab ich ihr einen, ihm einen Weck zur Suppe mitzubringen, wenn sie in die Stadt ginge, und so schieden wir voneinander.
Ich sage Dir, mein Schatz, wenn meine Sinne gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Anblick eines solchen Geschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den engen Kreis seines Daseins hingeht, von einem Tag zum andern sich durchhilft, die Blätter abfallen sieht, und nichts dabei denkt, als dass der Winter kommt.
Seit der Zeit bin ich oft draussen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt, sie kriegen Zucker, wenn ich Kaffee trinke, und teilen das Butterbrot und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags fehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat. die Wirtin Order, ihn auszuzahlen.
Sie sind vertraut, erzählen mir allerhand, und besonders ergötze ich mich an ihren Leidenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe sich versammeln.
Viel Mühe hat mir’s gekostet, der Mutter ihre Besorgnis zu nehmen: sie möchten den Herrn inkommodieren.
Am 30. Mai.
Was ich Dir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiss auch von der Dichtkunst; es ist nur, dass man das Vortreffliche erkenne und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigen viel gesagt. Ich habe heute eine Szene gehabt, die, rein abgeschrieben, die schönste Idylle von der Welt gäbe; doch was soll Dichtung, Szene und Idylle? muss es denn immer gebosselt sein, wenn wir Teil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?