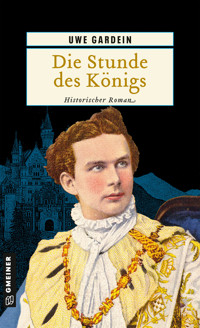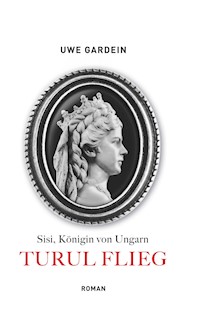Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Die Lebensgeschichte der Maria Anna Schwegelin - Deutschlands letzte Hexe. Kempten, im April 1775. Fürstabt Honorius von Schreckenstein, der ganz im Zeichen der neuen Zeit eine aufgeklärte Kirche zu forcieren versucht, steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens: Das Volk will die Landstreicherin Maria Anna Schwegelin auf dem Scheiterhaufen brennen sehen. Nach ihrem Geständnis, mit dem Teufel Unzucht getrieben zu haben, scheint ein Hexenprozess und damit ihr Todesurteil unabwendbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Gardein
Die letzte Hexe – Maria Anna Schwegelin
Historischer Roman
Zum Buch
Kempten, im April 1775Fürstabt Honorius von Schreckenstein, der ganz im Zeichen der neuen Zeit eine aufgeklärte Kirche zu forcieren versucht, steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens: Das Volk will die Landstreicherin Maria Anna Schwegelin auf dem Scheiterhaufen brennen sehen. Nach ihrem Geständnis, mit dem Teufel Unzucht getrieben zu haben, scheint ein Hexenprozess und damit ihr Todesurteil unabwendbar.
Uwe Gardein lebt in Unterhaching. Er ist Autor von Büchern, Drehbüchern, Theaterstücken und Zeitungsartikeln. 1989 erhielt er das Förderstipendium für Literatur der Landeshauptstadt München. Er hält regelmäßig Vorträge über bayerische Geschichte und ist Literaturrezensent der Reihe »Reden über Bücher«.
Impressum
Bibliografische Information
der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
4. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von Giampietrino: Salome (Detail)
ISBN 978-3-8392-3068-8
1
Der Wind trägt den Frostgeruch von den Eisgletschern der Alpen durch das Tal der Iller hinab zu den Menschen. Der Wald steht erstarrt und die Tiere in ihm heben aufmerksam die Köpfe. In der Dunkelheit hält eisige Kälte die Füße an der Erde fest. Da erschüttert ein Schrei aus Schmerz und Elend die Luft. Dann ist es wieder still. Kurz darauf ein erneutes Kreischen, wieder der Schrei und ein entsetzliches Röcheln, als läge einem Menschen der zugezogene Strick um den Hals.
Die Frau in der Dunkelheit stemmt sich mit beiden Armen und all ihrer Kraft gegen eine Eiche. Sie steht breitbeinig da, etwas vorgeneigt, und atmet kurz und pfeifend. Für diese kalte Nacht ist sie völlig unzureichend bekleidet. Nur ein geflicktes Wollkleid, dicke Strümpfe und ein Leinentuch um den Kopf trägt sie. Sie denkt nicht an die Kälte. Ihr einziger Gedanke gilt dem Schmerz, der endlich aufhören soll. Es ist genug. In dem Gedanken liegt ein Vorwurf. Sie ist es, die den Schmerz zu ertragen hat, und sie ist es, die ihn nun nicht mehr will. Nie hatte sie es ausgesprochen, doch von nun an, das schwört sie bei der Heiligen Maria Mutter Gottes, würde sie es tun. Er war es, ihr Mann, der immer wieder an sie heranrückte und ihr in das Ohr flüsterte: »Ach komm, ach komm.« Nun hat er sie wieder einmal fortgeschickt, damit sie das gesegnete Haus mit ihrem Blut der Sünde nicht beschmutzen kann.
»Geh, Frau«, hatte er gerufen, »verdirb die Burschen nicht, geh!«
»Gott steh mir bei«, antwortete sie, »dieses Kind werde ich dir noch geben, aber ich flehe dich an, lass es dann genug sein.«
Sie hatte ihre Kinder geküsst und war gegangen.
Es ist sehr kalt zwischen den Bäumen. Die Luft scheint das Eis der hohen Gletscher in den Wald zu tragen. Vom Schrei der Eule und den Rufen der Tiere der Nacht vernimmt sie nichts. Sie dreht sich um, verlässt den Baum und kämpft sich durch das Unterholz. Gefrorene Zweige schlagen ihr ins Gesicht und zerbrechen. Sie folgt ihrem Instinkt, denn es ist die Hand vor den Augen nicht zu erkennen. Angst kommt in ihr auf. Hoffentlich ist es nicht schon zu spät und sie muss mitten im Wald niederkommen. Wo soll sie nur hin? Wenn ihr die Kraft verloren geht, sind sie und das Kind dem Tod ausgeliefert. Sie bleibt stehen und tastet nach ihren zerrissenen Strümpfen. Nun geht sie langsamer und versucht, nicht zu tief einzuatmen, weil ihr sonst die beißende Kälte zusätzliche Schmerzen verursacht. Als sie ein Geräusch hört, bleibt sie stehen. Sie versucht, die Ursache des Geräusches zu ergründen, aber es gelingt ihr nicht. Das Geräusch kam unerwartet von der Seite, dann von hinten und war wieder vor ihr. Mit einem Mal sieht sie die gelb glühenden Augen aus der Nachtschwärze auf sich gerichtet. Erstarrt vor Angst, rührt sie sich nicht vom Fleck. Wenn sie sich nicht bewegt, bewegen sich auch die glühenden Augen nicht. Ich muss beten, denkt sie. Sie umfasst ihre Hände und versucht, nicht vornüber zu stürzen. Ihr Herz hämmert in ihrer Brust. Trotz der eisigen Kälte beginnt sie zu schwitzen. Sie spürt den Schweiß auf ihrer Haut und wagt einen vorsichtigen Schritt zurück. Die glühenden Augen bleiben an der gleichen Stelle in der Dunkelheit. Noch einen kleinen Schritt riskiert sie, dann beginnen ihre Beine zu schlottern. Sie presst ihre Lippen aufeinander, damit ihr kein Schrei entfährt. Was ist das nur, was sie so durchdringend anstarrt? Schnell wagt sie noch zwei, drei Schritte zurück und prallt mit Wucht gegen die schorfige Haut eines Baumes. »Gott vergib mir!«, stammelt sie hilflos.
Die drohend auf sie gerichteten gelben Augen verformen sich. Aus den runden Augen werden plötzlich scharfe Pfeilspitzen.
»Du gehörst nicht hierher!«, schreit sie aus Leibeskräften. »Fort mit dir, du gehörst hier nicht her!«
Dann bricht sie auf die Knie und beginnt zu beten: »Heilige Mutter Gottes, Jungfrau Maria, hilf mir. Ich schwöre, wenn ich und das Kind am Leben bleiben, dann werde ich das Kind mit deinem Namen schützen, gleichgültig, ob es ein Bub oder ein Mädel wird. Amen.«
Sie hebt den Kopf in den Nacken und schaut direkt in die glühenden Augen, die sie noch immer scharf fixieren.
Dann töte mich endlich, denkt sie, aber quäle mich nicht länger.
Sie hat das Gefühl, eine Hand legt sich um ihre Kehle und drückt ganz langsam zu. Ohne Gegenwehr lässt sie es geschehen.
Die gelben Augen verschwinden so, wie die Nacht verschwindet. Ein weiches Licht tut sich auf und aus der beißenden Kälte wird ein wärmender Frühlingstag. Jemand lacht. Während sie aufhört zu atmen und ihr Herz aussetzt, lacht etwas schrill und teuflisch. Dann geschieht es. Ihr Hals ist zermalmt und am Himmel dreht sich ein buntes Feuerrad. Schwarz ist der Tod, wie die Untiefen der Nacht. Der folgt ein Rot von sprühender Kraft und Wärme. Grün bläst der Wind über die Felder. Azur und grell brennt das Licht des Himmels über dem Fluss, dass sie die Hände schützend vor die Augen legen muss. Eine Hand schlägt ihr auf den Rücken. Wieder ertönt ein schriller Schrei, danach ist es still. Der Teufel ist gegangen.
Als sie die Augen aufschlägt, hat sie das bunte Feuerrad und das Licht vergessen. Sie hört einen Hund bellen. Es ist immer noch sehr kalt neben dem Baum auf dem Boden. Sie schaut in ein schwankendes Licht direkt vor ihrem Gesicht und riecht den verbrennenden Tran. Dann hört sie, wie jemand ihren Namen sagt.
»Anna. Anna, hörst du nicht? So steh doch auf!«
Sie hebt müde ihre Arme und lässt sie schlaff wieder fallen. Schlafen will sie, nur noch schlafen.
»Anna, du wirst erfrieren, wenn du nicht sofort hochkommst.«
Sie spürt, wie kräftige Frauenarme an ihr ziehen und heftig an ihr rütteln. Aus dem Mund der Frau kommt kräftiger Zwiebelgeruch. Jetzt begreift sie, dass sie wieder im Leben ist.
»Tröscherin, bist du das?«
Sie steht auf zittrigen Beinen, und sie versucht, sich bei der Angesprochenen festzuhalten. Es gelingt ihr nicht und sie beginnt zu schwanken.
»Halt dich, Anna! Du musst einen Fuß vor den anderen setzen. Lass uns gehen, es ist nicht weit.«
Die Tröscherleute bewohnten eine Hütte direkt am Waldrand. Weil der alte Tröscher ein begehrter Treiber bei den Jagden der Herrschaften war, hatte man der Familie erlaubt, dort zu wohnen. Die Tröscherin hatte acht Kinder geboren, von denen nur noch zwei lebten.
Anna lässt sich mehr ziehen, als aus eigener Kraft voranzugehen. Ihr kommen die gierigen gelben Augen wieder in den Sinn, aber sie schweigt lieber. Hatte sie den Teufel gesehen? Er soll Feuer speien können und eine behaarte Zunge haben. Es ist ihr gleichgültig, denn im gleichen Moment kommen die Schmerzen zurück.
»Oh Gott«, sagt sie nur und atmet zischend aus.
Sie bleibt stehen und versucht, einen raschen Blick auf das Gesicht der Tröscherin zu werfen. Vielleicht täuscht sie der Teufel in Gestalt der Nachbarin und führt sie direkt ins Verderben. Sie hatte davon gehört, dass Hexen Blut von ungeborenen Kindern trinken. Sie schreit auf.
»Nicht doch«, flüstert die Tröscherin. »Mein Alter wird dich noch hören.«
Anna kann das Gesicht der Nachbarin nicht sehen. Die Tranfunzel beleuchtet nur spärlich den gefrorenen Boden, mehr kann sie in der Dunkelheit nicht erkennen. Der ziehende Schmerz in ihrem Leib lenkt sie nur kurz ab von ihren Gedanken. Der Teufel könnte ein Wolf mit gelben Augen gewesen sein und sich nun in die Nachbarin verwandelt haben. Wenn er eine behaarte Zunge hatte, könnte er auch einen Pelz tragen und Hauer besitzen, die sich in ihren Nacken bohren könnten. Als sich das Kind in ihr bewegt, kommt ihr der Gedanke, dass es direkt aus der Hölle in sie hineinkam. Bei keinem der Burschen, die sie geboren hatte, gab es diese Umstände. War sie verrückt geworden? Sie braucht einen klaren Kopf. Es gibt nichts, was sie an ein Fegefeuer oder des Teufels Hölle erinnert. Nur ihre Qualen sind da und die Tröscherin.
»Nun komm, Anna, du bist schon kalt wie ein Eiszapfen.«
Sie denkt an das Sterben. Viele Frauen sterben an ihren Kindern. Sie sieht das Gesicht von Johannes, als sie zur Tür gegangen ist. Ihre Burschen lagen auf dem Stroh und schliefen. Johannes hatte sie nicht mehr angesehen. Gesagt hatte er auch nichts. Nun sollte noch ein Esser in die armselige Bretterbude kommen, wo es durch alle Ritzen zog, Mäuse und Ratten herumliefen, und sie selbst täglich kämpfen musste, dass etwas Essbares in den Topf kam. Was also soll sie am Leben halten?
Sie hat einen kranken Mann, das weiß sie. Eines Tages wird er auf dem Feld zusammenbrechen. Johannes ist ein ständig hustendes Skelett. Wozu leben sie eigentlich?
»Anna, du bist keine Salzsäule, also spute dich!«, schimpft die Tröscherin.
Anna denkt an das, was die alte Fischerin ihr einmal über den Teufel erzählte, den sie auf dem brachen Feld hockend Eier legen gesehen hatte, die so groß waren wie Kindsköpfe. Die Fischerin hatte das bei allen Heiligen geschworen. Es soll am hellgrauen Morgen gewesen sein, kurz vor Allerheiligen.
»Wir dürfen keinen Lärm machen«, sagt die Tröscherin.
Sie wäre jetzt lieber alleine gewesen, wollte der Tröscherin aber keinen Vorwurf machen, denn schließlich kümmerte sie sich um sie, was sonst keiner der Nachbarinnen in den Sinn gekommen war. Wenn sie ihren Bauch betrachtet und zu wissen versucht, ob das da drin leben soll, dann ist es doch besser, dass sie nicht alleine ist. Ihr ist zumute, als müsse sie einen langen Weg mit schweren Holzscheiten auf dem Rücken hinuntergehen, und am Ende ihres Lebens angekommen, lauert ihr jemand auf, der ihr alles rauben würde. Sie muss sich wieder zwingen weiterzugehen.
Im fahlen Licht der Ölfunzel erkennt sie den Vorratsschuppen der Tröschers. Der alte Tröscher hatte ihn zwischen Büschen und Bäumen errichtet, damit er nicht so leicht zu entdecken war. Jetzt war alles Grün dahin und der Schuppen stand ungetarnt am Waldrand.
Sie müssen einige Holzstufen hinaufgehen, um an die Tür zu gelangen. Zu ihrem Erstaunen ist die nur angelehnt. Als die Tröscherin sie öffnet, knarzen die Scharniere und sie hält einen Moment inne.
»Komm jetzt, Anna!«
Sie schlurft über die glitschigen Bretter, die uneben auf dem Boden liegen, und muss sich vorsehen, dass sie nicht stolpert und hinfällt. Gleich neben der Tür steht angebunden eine Ziege. An den Wänden hängen Käfige mit ein paar Hühnern. Neben der Ziege hat die Tröscherin Stroh aufgehäuft, dazu wirft sie noch einige Hand voll Heu und legt dann ein Kuhfell darüber.
»Hock dich hin, Anna«, sagt sie freundlich.
Sie wundert sich, dass die Tröschers noch so viel an Vorrat haben. Sogar eine Ziege gibt es, die ihnen Milch und Käse beschert. Als sich das Kind wieder mit heftigen Tritten meldet, legt sie sich bereitwillig auf das gemachte Lager und schaut auf die Funzel, die nun direkt über ihrem Bauch von der Decke baumelt. Die Schmerzen kommen zurück und sie bekommt keine Luft mehr. Schwer atmend hält sie inne. Sie spürt, dass sie mit der Tröscherin nicht alleine ist. Die Tür ist nicht verschlossen, und niemand lässt seine Wintervorräte ungeschützt. Was hat die Tröscherin mit ihr vor, was wird geschehen? Erneut tritt das Kind hart gegen ihre Bauchdecke. Sie zuckt zusammen und will gleichzeitig die Augen offen halten. Aber es ist zu dunkel, trotz der Funzel, neben die soeben eine weitere gehängt worden ist. Sie kann die schweren Hände der Tröscherin sehen, wie sie sich an den Funzeln zu schaffen macht. Sie beginnt, sich zu fürchten. Etwas in ihr warnt sie. Doch sie kann nicht aufstehen und davonlaufen. Sie beginnt zu zittern und sie spürt, wie der Schweiß auf ihrer Haut kalt wird. Ihr fällt ein, wie die Tröscherin einst von der Zubereitung der Hexensalbe erzählt hat. Sie waren mit den Frauen der Familien des Dorfes im Wald beim Beerenpflücken und Bucheckern suchen, als sie plötzlich davon angefangen hatte. Ganz genau konnte sie sich daran erinnern, denn sie hatten eine ertragreiche Stelle im tiefen Wald gefunden, wo es ihr allerdings auch recht unheimlich gewesen war. Dort hatte die Tröscherin davon erzählt, dass ihr eine alte Frau einmal berichtet habe, sie sei einmal von einer Hexe entführt worden und die habe das Fett eines toten Säuglings gekocht und diesen Sud mit Alraunwurzeln, Bilsensamen, Belladonna und noch vielen Zutaten ergänzt und daraus, unter Anwendung von Fledermäusen und kleinen Schlangen, auch einer Menge Schmalz, eine Salbe hergestellt. Am Abend wären dann viele andere Hexen gekommen und hätten sich an allen Stellen eingeschmiert, an denen ihre Körper Haare hatten. Danach haben sie mit viel Lärm um ein Feuer getanzt und hätten nach dem Teufel gerufen. Plötzlich habe es dann furchtbar gestunken und mitten im Feuer habe ein großer Ziegenbock gestanden, der in einer fremden Sprache mit den Hexen gesprochen hat. Die Erzählerin sei daraufhin in Ohnmacht gefallen und erst wieder aufgewacht, als ihr Mann sie am alten Mühlbach liegend gefunden habe. Sie sei halb tot gewesen und hätte danach niemals wieder richtig leben und arbeiten können.
Mit heftigen Stößen macht sich das Kind erneut bemerkbar. Ihr Zittern wird noch stärker als zuvor, weil sie nun der Überzeugung ist, dass die Tröscherin mit den Hexen im Bunde ist und ihr Kind für den Kochtopf der bösen Frauen bereithalten wird. Jetzt will sie nicht erleben, dass das Kind aus ihr herauskommt. So viele Vorräte hat die Tröscherin, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
Die ganze Zeit der Schwangerschaft bekam sie keine Gefühle zu diesem Kind in ihr. Nun aber, in dieser bedrohlichen Situation, fühlt sie, dass sie um ihr Kind kämpfen will. Ohne Gegenwehr wird sie es den verdammten Hexen nicht überlassen. Wäre sie nur nicht so kraftlos und würden ihr die Schmerzen nicht so zusetzen, sie würde einfach aufstehen und davonlaufen. Ihre Augen gewöhnen sich an das Zwielicht und sie spürt etwas.
Sie sieht, da ist eine weiße Frau. Aus der Dunkelheit des hinteren Raumes kommt sie auf sie zu. Fremde Finger streichen ihr etwas auf die Lippen. Sie schließt die Augen und spürt eine tiefe Zufriedenheit. Still liegt sie da und kann es sich nicht erklären. Der Duft frischer Frühlingsblumen steigt ihr in die Nase. Wie schön das ist, denkt sie. Sie beginnt, ein Lied aus ihrer Kindheit zu summen.
»Anna, es ist soweit«, flüstert die Tröscherin. Sie legt ihr ein kühlendes Tuch über das Gesicht und streift ihr die Kleiderlumpen vom Bauch. Sie spürt, wie jemand von hinten an sie herantritt und ihr mit zarten Fingerspitzen die Schläfen zu massieren beginnt. Es ist gut, alles ist gut.
Wie aus kleinen blauen Flammen reflektiert die Sonne ihre Strahlen in den Weinkelchen auf dem Tisch am Fenster. Von der Decke des riesigen Raumes hängen Tücher in den Farben des Regenbogens, so, als schweben sie ungebunden und frei in der Luft. Über ihr leuchtet ein silberner Stern nur für sie. Sie streicht sanft mit beiden Händen über die kostbaren Bezüge des Bettes, in dem sie liegt, und muss mit den Augen blinzeln im Angesicht des mit Blattgold geschmückten Bettrahmens, und der Himmel über ihrem Schlaflager ist aus kostbarem Brokat gewebt worden. Hier will sie liegen bleiben und nie mehr aufstehen. Aber eine unbekannte Energie hebt sie hoch und lässt sie durch den Raum schweben, bis sich ein Fenster öffnet, und alle Menschen vor dem Schloss unter ihr fallen auf die Knie und bekreuzigen sich. Sie ist im Himmel angekommen. Die Wärme der Sonne am Mittag lässt sie behaglich schweben, und von dem nagenden Schmerz des Hungers spürt sie nichts mehr. Sie hält ihre Hände und Arme gegen das Licht. Durchsichtig wie Glas sind sie und sie kann ihr pulsierendes Blut durch die Adern fließen sehen. Das Land unter ihr ist blau eingefärbt bis zum Horizont und die Sonne trägt einen glühenden Goldrand. Sie will nie mehr auf die Erde zurückkehren. »Lass mich hier bleiben!«, ruft sie, aber ihre Stimme ist nicht zu hören. So sehr sie sich auch bemüht, ihre Stimme bleibt unhörbar. Als sie an sich herunterschaut, sieht sie, dass sie in einem nackten Mädchenkörper steckt, der sich noch im Frühling der Jungfräulichkeit befindet. Er trägt keinerlei Spuren der Geburten und keine Male der vielen Wunden, die ihr die schwere Arbeit geschlagen hat. Sie ist schön anzuschauen. Glücklich und zufrieden greift sie sich einen Sonnenstrahl und lässt sich von ihm wärmen. Jemand ruft ihren Namen, doch sie weiß nicht mehr, dass sie einmal so gerufen worden ist. Sie wartet auf die Begegnung mit der Heiligen Jungfrau Maria. Ihr ganzes Leben lang hat sie gebetet, die Heilige Jungfrau Maria möge ihr den Weg für ein freundliches Leben ebnen. Nun ist ihr Flehen in Erfüllung gegangen und sie will sich bedanken. Sie durchschwebt einen Wald aus blühenden Kirschbäumen, deren weiße Blüten ihr ein duftiges Kleid webten, damit sie vor die Herrin der Welt treten kann. Endlich ist sie tot.
Die Landschaft unter ihr verändert sich. Ein langer Schatten, wie von einem riesigen Vogel geworfen, liegt über dem Land. Die Bäche und Seen beginnen grün zu funkeln. Schwere Wolken segeln heran und es kommt ein leichter Wind auf. Das kann nicht das Paradies sein, da ist sie sich ganz sicher. Wieder hört sie, wie jemand ihren Namen ruft.
»Anna!«
Hufe schlagen auf dem Boden auf und ein Pferd schnaubt laut und unüberhörbar. Anna begreift, dass sie auf einem fahrenden Wagen liegt. Das neugeborene Kind hat man ihr direkt auf die Haut gelegt, es schläft. Sie spürt unter sich einen Sack mit Stroh und tastet ihre Kleidung ab. Es ist nicht mehr ihre Kleidung. Auf ihr liegen mehrere wärmende Decken. Sie riechen frisch gewaschen und fremd. Ihr beginnen, die Tränen über die Wangen zu laufen. Warum darf sie nicht dort bleiben, wo es ihr so gut gefallen hat? Der Kopf schmerzt und ihr Unterleib brennt wie Feuer. Was ist mit ihr geschehen? Nein, darüber sollte sie besser nicht nachdenken. Sie erinnert sich, wie die zarten Fingerspitzen ihre Lippen und Schläfen berührt hatten und sie danach einfach davongeflogen ist. Was geschah mit der Nachgeburt? Besser ist es, sie würde niemals mehr daran denken. Wer weiß, was sonst mit ihr geschehen wird.
Der Wagen fährt ratternd und schwankend über den holprigen Weg. Anna blickt auf den Rücken des Kutschers, der über ihr auf einem Brett hockt und das Pferd antreibt. Über seine Schultern hat er eine Wolldecke geworfen, die genau jenen entspricht, mit der sie zugedeckt auf dem Wagen liegt. Sie wirft einen Blick in den hellen Himmel. Es ist also Tag und sie hat ihr Kind geboren, das nun still neben ihrer Brust schläft. Die Tröscherin war nicht mehr da und diese unheimliche weiße Frau auch nicht. Wohin soll sie gebracht werden? Sie kann sich nicht daran erinnern, dass man ihr schon einmal erlaubt hat, auf einem Wagen mitzufahren. Bisher hatte sie in ihrem Leben alle Wege zu Fuß bewältigen müssen. Ist sie tot? Dachte man, sie sei gestorben und fährt sie nun zu ihrem Grab? Sie will sich aufsetzen, aber es fehlt ihr die Kraft dazu. Warum kann sie sich nicht mehr an das Paradies erinnern? So sehr sie es auch versucht, es sind keine Bilder mehr vorhanden. Wie ausgelöscht, so fühlt sie sich und sie denkt an die zarten Finger an ihren Schläfen. Jetzt kommt ihr überraschend noch etwas aus der Erinnerung zurück. Sie hatte gespürt, wie man ihr mit sanften Strichen etwas Klebriges auf die gespannte Bauchhaut strich. Nun war sie sicher, dass die Tröscherin eine weise Frau an ihre Seite gestellt hatte. Wenn sie eine Hexe gewesen war, dann wird sie die Nachgeburt für ihre Zauberei verwenden. Sie beißt sich auf die Lippen und schwört, niemals darüber ein Wort zu verlieren. Wenn sie jemand auf die Geburt ansprechen sollte, wird sie sagen, es war wie immer. Das bedeutet, sie hat das Kind alleine zur Welt gebracht. Sie wird sagen, ich habe dieses Kind alleine zur Welt gebracht. Sie will das Kind nicht anschauen, denn sie fürchtet sich vor ihm. Dann gibt sie doch ihrer inneren Stimme nach und schiebt das Bündel über ihren Busen und öffnet das Brusttuch. Anna versucht ein herzensgutes Lächeln. Sie stellt fest, dass das Kind, bis auf einige rote Flecken im Gesicht, ganz normal wirkt. Sie denkt, vielleicht ist dieses Kind doch wie ein himmlisches Wesen und ich soll Gott dafür dankbar sein. Sie zieht das Tuch ein wenig zur Seite und sieht, dass sie ein Mädchen geboren hat. Diese Nachricht wird ihren Johannes nicht sehr erfreuen. Mädchen konnten nicht so arbeiten, wie es die Burschen können. Sie lässt sich zurück auf den Strohsack fallen und beginnt, wie aus dem Himmel gelenkt, ihr Kind zu streicheln. Jetzt will sie an nichts mehr denken. Nie in ihrem Leben hat sie eine Entscheidung treffen dürfen, das hatten immer andere für sie getan. Anna schließt die Augen und starrt in ihre innere Leere. Besser ist es, nichts zu denken, sie bekommt schon Kopfschmerzen.
Der Winter zieht kräftig über das Land und die Kälte wird fühlbarer. Anna hat sich ein wenig erholt, als sie die Augen wieder öffnet. Der erlittene Blutverlust und die Nachwirkungen der Geburt verursachen nicht nur ihre körperliche Schwäche, sondern geben ihr auch Gedanken in den Kopf, wie sie in ihrem üblichen Leben nie da gewesen sind. Kunterbunt purzelt es durch ihren Kopf, dass sie nicht auf den Weg achtet und ihre sonst so starke Furcht vor allem und jedem spurlos verschwunden ist. Im Gegenteil, sie bleibt der Gegebenheit gegenüber gleichgültig, und wohin sie der Kutscher bringen wird, ist ihr einerlei. Einzig die aufkommende Kälte macht ihr Sorgen. Sie weiß nicht, wie sie ihr Kind davor schützen kann, ohne ihre eigene Körperwärme. Eine Elster hebt sich in die Lüfte. Die bauchigen Wolken eilen über den grauen Himmel. Die Sonne hat sich längst in eine andere Welt zurückgezogen. Nun wird es leicht, sich vorzustellen, wie der Schnee sich über das Land legt, wie die Wasser zu Eis werden, wie die Erde nach und nach ermüdet und einschläft, die Bäume kraftlos ihre Äste baumeln lassen und die Menschen geduckt und trübsinnig umhergehen. Die dunkle Jahreszeit ist die Zeit des Todes, und in vielen Häusern wird ihm der Hunger helfend zur Hand gehen.
Anna ist erneut schläfrig, aber sie versucht, dagegen anzukämpfen. Was geht nur vor in ihr? Wenn sie ihren Arbeiten nachging, dachte sie an nichts und am Abend war sie zu müde, um irgendetwas zu denken.
Es wird daran liegen, dass ich hier auf dem Wagen kauere, statt etwas Richtiges zu tun, sagt sie sich und richtet sich ein wenig auf. Der kalte Wind schlägt ihr ins Gesicht. Sie sieht die Blutbuche am Feldrain stehen und erkennt durch sie die Gegend. An den Feldern des Meierhofes fahren sie also vorbei, und sie bekommt eine Gänsehaut bei dem Gedanken an den alten Meierbauern, der nur brüllend und wütend die Arbeit auf den Feldern begleiten kann. Mit Johannes hatte sie für ihn bei den Ernten gearbeitet und immer darum betteln müssen, dass sie auch etwas für ihre Arbeit bekamen. Zumeist gab es einen Korb mit Esswaren, selten nur landeten ein paar Münzen in ihren Händen.
Ein paar Schneeflocken schweben durch die Luft und gleich darauf beginnt ein kräftiges Schneetreiben. Die Räder des Wagens ziehen Spuren durch das frische Weiß. Vom Poltern der Räder aufgeschreckt, flieht ein Hase in wilden Sprüngen über die leeren Felder.
Anna neidet ihm seine Freiheit, und sie muss an die Blutbuche denken, die sie hinter sich gelassen haben. Sie weiß, sie hat eine Erinnerung an ein Ereignis im Zusammenhang mit diesem Baum, aber es fällt ihr nicht gleich ein. An ihren schrundigen Händen platzt die Haut auf und blutet. Schnell versteckt sie ihre Arme unter die Decken. Ohne eigenen Willen beginnen ihre Hände zärtlich ihr Kind zu streicheln. Anna schaut in den verschneiten Himmel und denkt wieder einmal, es ist besser, nicht zu denken. Jemand wird wissen, warum sie das Kleine liebkost. Dabei denkt sie, nie wieder ein Kind, nie wieder.
Anna wischt sich die kleinen Flocken aus dem Gesicht und richtet sich ein wenig auf. Schnell zieht sie ihren Kopfschal tiefer in die Stirn, um nicht zu nass zu werden. Nur wenige Meter vor ihnen führt eine Eichenallee hinüber zu den Gebäuden des Meierhofes und sie sagt sich, dort möchte ich aber bestimmt nicht hin, als der Kutscher eine scharfe Kehre fährt und genau diesen Weg nimmt. Allein der Gedanke an den alten Meierbauern lässt sie zittern. Sie hat dort doch absolut nichts verloren. Das alles verheißt ihr nichts Gutes.
Der Kutscher lenkt den Wagen in den Hof und stößt einen scharfen Pfiff aus. Sofort erscheint eine Magd, die Anna vom Wagen hilft und sie in das Wohngebäude führt. Noch nie war sie in einem solchen Gebäude. Die Scheune hatte sie betreten dürfen, auch die Ställe, aber doch niemals das Wohnhaus. Sie wird in die Küche geführt und bleibt ängstlich an der Tür stehen. Vor ihr sitzt der Pfarrer am Tisch, der einen Bierkrug zum Mund führt, einen tiefen Schluck nimmt und sich die Lippen mit dem Ärmel abwischt. Neben ihm hockt die alte Meierbäuerin, die ihr mit ihrem harten Mund und ihren bösen Augen Furcht einflößt. Am Fenster steht, zum großen Erstaunen Annas, die Tröscherin. Neben ihr, am alten Küchenherd, lehnt die Frau des Jungbauern. Kaum hat Anna den Raum betreten, werden die Mägde hinausgewiesen.
Der Pfarrer betrachtet Anna und beginnt zu sprechen.
»Ich hörte, der Herr hat dich noch einmal mit einem gesunden Kind beschenkt. Danken wir dem Herrn für seine Güte.«
»Amen«, sagen die Anwesenden und bekreuzigen sich.
»Wie soll es denn gerufen werden?«, fragt der Pfarrer.
Soeben war Anna noch in ihrer furchtsamen Enge die Luft abgeschnürt worden, doch bei dieser Frage schießt ihr die Antwort direkt aus dem Mund.
»Maria Anna«, antwortet sie sehr leise.
Der Pfarrer nimmt noch einen Schluck aus dem Bierkrug, wischt sich erneut mit seinem Ärmel den Mund ab und sieht sie wieder an.
»Gut so. Das ist der Name unserer Mutter Gottes und es ist der Name der Mutter unserer Mutter Gottes. Sehr, sehr schön.«
Es entsteht eine kleine Pause, weil der Pfarrer nichts weiter sagt. Die Tür schlägt Anna mit einem kräftigen Schwung in den Rücken, weil eine Magd dampfendes Essen hereinträgt und auf den Tisch hebt. Eine zweite Magd, die ihr direkt folgt, stellt eine Kanne Bier auf den Tisch, fügt einen Krug hinzu, den sie mit dem frischen Bier füllt, und verschwindet wieder.
»Iss nur!«, sagt der Pfarrer und wischt diesmal über sein ganzes Gesicht.
Anna steigt der Duft dieses Mahls in die Nase und erst jetzt wird ihr bewusst, dass sie seit Tagen vor der Geburt nichts gegessen hat. Vor Hunger verliert sie völlig den Respekt vor den Anwesenden, und in kurzer Zeit hat sie diese wundervoll schmeckende Mahlzeit verschlungen. Erst als sie ihren Kopf wieder hebt und in die Augen der alten Meierbäuerin schaut, erkennt sie wieder, dass sie hier nicht unter Freunden weilt. Die betagte Bäuerin nimmt ihr jeden Bissen übel und in ihrem Gesicht kann jeder lesen, was sie von dieser Veranstaltung hält.
Die Tröscherin ist es, die sie plötzlich am Ärmel hinauszieht und über den Flur schleift. Gleich neben dem Hauseingang öffnet sie eine Tür, hinter der ein Säugling kreischend schreit. Neben seiner Wiege steht eine hilflose Magd mit angstvoll geweiteten Augen. Die Tröscherin gibt ihr ein Zeichen zu verschwinden, was die Magd gerne befolgt.
»Die Frau vom jungen Meier ist so trocken wie ein alter Brunnen«, flüstert die Tröscherin. »Der Wurm wird sterben, wenn nicht schnell Änderung eintritt.«
Langsam begreift Anna, weshalb man sich um sie gekümmert hat. Mit ihren Burschen gab es nie Probleme, konnte sie die Knaben doch bis weit nach der Geburt stillen und ihnen so die Armseligkeit der leeren Teller ersparen. Auch jetzt war ihr die Milch lange schon eingeschossen.
Die Tröscherin hebt das schreiende Bündel aus der Wiege und geht mit ihm auf und ab. Das gibt Anna Gelegenheit sich umzuschauen. Gleich neben der Wiege befindet sich ein gemauerter Ofen und an der breiteren Wand steht ein schwerer, schwarzer Schrank. Die schmalere Wand wird durch eine fein gearbeitete Truhe geschmückt, über der ein Kruzifix hängt. Selbst der Boden ist mit starken Eichenholzbrettern ausgelegt.
So ein schöner Raum für ein einziges Kind, denkt sie. Sie bleibt einfach schweigsam und wartet. Nach einigen Schritten hin und her durch den Raum, reicht die Tröscherin ihr das fremde Kind.
»Setz dich, Anna, und leg das Gespenst an. Mach einfach die Augen zu.«
Aber Anna will nicht die Augen verschließen und erschrickt heftig, als sie in das Gesicht des Kindes schaut. Tatsächlich sieht es aus wie ein Gespenst, so abgehärmt und dünnhäutig, wie es ist. Sie nimmt ihre Tochter an die Brust, die sich nicht lange bitten lässt, aber das Gespenst macht gar keinen Versuch zu trinken. Konnte es passieren, dass sie ihre Milch verliert, wenn auf diesem kalten Wesen ein Fluch liegt? Schnell will sie es von sich stoßen, doch die Tröscherin vereitelt diese Absicht sofort.
»Bist du närrisch? Du siehst doch, dass es bald verhungert und verdurstet ist. Versuche es, dann wird es dein Schaden nicht sein, Anna!«
Es klopft an der Tür und die Tröscherin öffnet. Jetzt fällt Anna auf, dass die Tröscherin ein neues Kleid trägt. Eine Magd stellt zwei prall gefüllte Körbe in den Raum und verschwindet wieder. Anna sieht geräucherten Schinken, einen frisch abgezogenen Hasen, Eier, Brot und weitere Esswaren, die ihr Herz höher schlagen lassen.
»Das gehört dir, wenn du hier bleibst!«, sagt die Tröscherin. »Wenn es anfängt zu trinken und wächst, bekommst du mehr und dann kannst du zu den Deinen zurück. Der Meierbauer braucht einen Erben, also wird er dich mit dem Pferdewagen abholen und zurückbringen lassen.«
Anna schaut auf den armseligen Wurm, der sie mit trüben Augen ansieht.
»Und wenn ich nicht mag?«
Die Tröscherin stemmt ihre Hände in die breiten Hüften und schnauft.
»Nichts da!«, sagt sie. »Am Tisch reden die Meiers schon davon, dass jemand ihre Schwiegertochter verhext hat und ihr die Milch gestohlen wurde. Auch vom Exorzisten haben sie schon gesprochen. Und du, Anna, du hast Milch für mehr als zwei Säuger. Was glaubst du, was der alten Meier in den Kopf kommt? Bei der Ernte habt ihr euch hier keine Freunde gemacht, der Johannes und du. Sie haben euch im Verdacht, dass ihr mit dem Teufel im Bunde seid und durch Blitzschlag die Blutbuche angezündet habt. Mach dich nicht unglücklich, Anna!«
Was soll sie antworten? Sie ist durch die unverhohlene Drohung dermaßen verängstigt, dass sie kein Wort mehr herausbringt. Anna laufen die Tränen über das Gesicht.
»Ich werde die Körbe mit den Leckereien zu deinen Leuten bringen, Anna, das verspreche ich dir. Aber du musst mir schwören, dass du dieses Kind rettest, sonst wird der alte Meier uns alle ins Verderben stürzen. Was sind wir schon gegen die Meierfamilie?«
Die Antwort kennt Anna und nickt nur. Die Tröscherin geht hinaus und kommt mit der alten Meier, ihrer jungen Schwiegertochter und einer Magd zurück, die einen Strohsack mit Decken auf den Boden legt und eine Kanne Bier mit Krug neben Anna stellt. Die Tröscherin sieht sie lange an und gibt ihr schließlich ein Zeichen. Anna nimmt eine ihrer Brüste in die Hand und lässt einen Strahl Milch über das Gesicht des Gespenstes spritzen. Schweigend drehen die Meierfrauen sich um und gehen. Die Tröscherin nimmt die Körbe und verschwindet ebenso wortlos. In dieser Angelegenheit gibt es nichts mehr zu sagen.
Anna ist mit den beiden Kindern alleine. Ihr Herz klopft wie wild vor Angst. Sie ist eingesperrt und kann sich nur in ihr Schicksal fügen. Sie hat nichts mit dem Teufel zu tun. Warum lässt Gott den Teufel überhaupt gewähren? Das begreift sie nicht. Gott könnte ihn töten.
Vom kleinen Fenster aus schaut sie hinüber zum Schweinestall, dessen Tür vom Wind hin und her gerissen wird. Sie bleibt lange stehen und lauscht dem Rauschen des Windes. Grau ist der Tag. Eine Krähe zieht schreiend über den Hof. Noch nie in ihrem Leben hat sie einfach nur an einem Fenster gelehnt und geschaut.
Der Mond tritt auf und lässt zuweilen Wolken silbern blinken. Drüben geht sie vom Schweinestall zur Wasserpumpe, trägt die vollen Eimer in das Haus. Der Wind weht scharf von Westen und rüttelt heftig an den schwachen Holzwänden der Stallungen. Eine Katze verschwindet hastig hinter dem großen Misthaufen. Anna sieht sich zu, wie sie, als Dienerin Anna, vorsichtig die Tür des Stalls aufschiebt und über den Hof schaut. Dann schleicht sie im Schatten der Stallungen hinter das Haus und verlässt das Anwesen. Alles nur ein Traum. Sie gehört nicht hierher, aber fliehen kann sie auch nicht. Anna trägt die beiden Kinder in den Armen und setzt sich auf einen Stuhl. Die Bilder in ihrem Kopf machen ihr noch mehr Angst, denn nun erinnert sie sich auch wieder, was es mit der Blutbuche auf sich hatte. Damals hatte ihr der Meierbauer eine Arbeit gegeben und ihr befohlen, die Schweine nicht alleine zu lassen, weil die Zeichen am Himmel auf ein kommendes schweres Gewitter hindeuteten. Aber sie wollte zu ihren Kindern, die auch voller Angst waren, und sie musste ihnen doch etwas zu essen geben. Deshalb stahl sie sich davon und wollte quer über die Felder laufen, sich den Weg dadurch verkürzen, und so schnell es ging, wieder auf den Meierhof zurückkehren. Aber dann kam das Wetter.
Anna versucht, diese Erinnerung wegzuwischen und beschäftigt sich mit den Kindern. Wenigstens hat sie erreicht, dass das Kind der jungen Meierfrau nicht mehr schreit. Sie hält es an ihr Ohr und lauscht seinen Herztönen. Auch wenn es so leicht wie eine Feder ist, hört sie seinen Herzschlag.
Die Luft ist voller Echos ferner Donnerschläge. Signale kommen auch von den schweren Wolken und den Feueraugen hinter dem Himmel. Grün leuchtet die Erde, aber sie bückt sich tief und abwartend unter der Drohung des kommenden Wetters. Geheule der Dämonen war aus dem nahen Wald hinter dem Meierhof zu hören.
Anna sieht, wie das Vergangene aus dem Nebel der Erinnerung heraustritt. Wie ein furchtsames Wild hatte sie Witterung aufgenommen und sich an den Bäumen und Sträuchern vorbeigeschlichen. Ihre Gedanken hatten sich nur mit ihren Kindern beschäftigt, denn sie wusste, sie würden sich voller Angst aneinanderkrallen.
Jetzt durchlebt sie die Vergangenheit, als wäre sie auferstanden. Da war der Mond, der blässlich zwischen einem dünnen Wolkengewebe hindurchschien. Der Sturm wurde schärfer und riss an ihren Kleidern. Dann schlug ihr ein Schwall Wasser mitten ins Gesicht und sie suchte schnell Schutz. Dampfend tanzte der Regen auf dem freien Feld. Anna sah die Blutbuche vor sich und eilte unter deren starke Äste. »Die Buchen sollst du suchen«, flüsterte sie, »die Buchen sollst du suchen.« Sie wusste, sie würde es nicht mehr zu ihren Kindern schaffen, zu nah war das Wetter schon bei ihr. Sie fühlte die Nässe bereits auf ihrer Haut. Intensiv spürte sie die Furcht vor den immer näher kommenden Blitzschlägen. Sie war innerlich aufgewühlt wie im Fieber. Schwer beladen hingen die Wolken wie greifbar über ihr. Der Sturm hatte den Mond vertrieben, sprang wild hin und her, sodass sie gar nicht reagieren konnte, um der Nässe zu entgehen. Wie graue Tücher wehten die Regenschauer über die Äcker, undurchschaubar und gruselig. Als die Blitze zuckten, warf sie sich auf den klebrig nassen Boden. Dann hörte sie das Nachtgespenst wie irrsinnig brüllen, dazwischen ein böses Lachen und ein wieherndes Pferd. In Todesangst hob sie den Kopf, um dem Teufel in die Augen zu sehen. Wer konnte es anders sein, als Lucifer, der bei diesem leuchtenden Gewitter seinen Spaß hat? Sie sah den Kopf des Pferdes und dann die Augen, diese bösen Augen, die direkt gegen sie gerichtet waren. Es war nicht der Teufel. Der älteste Sohn des Meierbauern, der wieder einmal gewildert hatte, stand vor ihr. Das frisch erlegte Reh lag quer über dem Pferderücken. Am Boden kriechend, blieb sie hilflos und musste mit ansehen, wie er seinen kurzen Spieß zog, um sie, die Zeugin, zu töten. Der Meierbauer musste seinen Sohn endgültig verstoßen, wenn der wieder einmal im Klosterforst gewildert hatte. Anna sah die blutigen Hände, die kurz zuvor noch das Reh ausgenommen hatten und nun ihr Leben beenden wollten. Nicht einmal beten konnte sie noch. Dann kam ein fürchterlicher Blitz, und hell durchleuchtet stand er vor ihr. So durchleuchtet, dass sie sein klopfendes Herz sehen konnte. Mit einem Mal schlugen Flammen aus seinen Füßen und der ganze Mann stand im Feuer. Anna sprang auf und rannte um ihr Leben. Sie umlief die Gebäude und kletterte durch eine Lücke zurück in den Stall. Später stand der Meierbauer auf dem Hof und hielt das Pferd fest. Es musste noch vor dem Blitzschlag geflohen sein. Das erlegte Reh lag am Boden. Dann kam ein Knecht mit einer Schubkarre, auf der die verbrannte Leiche lag. Der Meierbauer stand breitbeinig neben dem am Boden liegenden Reh und schaute auf seinen Sohn. Anna steckte ihren Kopf aus der Tür, und just in diesem Augenblick drehte sich der Bauer um und schaute in ihr Gesicht. »Hexe!«, brüllte er. Der Mann stand da und richtete die Fäuste fluchend gegen den Himmel. Es hatte aufgehört zu gewittern und der Himmel klarte auf. Die Vögel zwitscherten wieder.
Anna sitzt auf dem Stuhl und zittert. Sie sieht die Augen des Sterbenden.
Der Alte verdächtigt sie, mit dem Tod seines Sohnes zu tun zu haben.
Maria Anna liegt auf ihrem Schoß. Mit einem Finger benetzt sie die Lippen des kalten Kindes mit ihrer Milch. Es trinkt nicht. Könnte sie doch einfach gehen. Sie streicht in Trance Milch über die Lippen des kalten Kindes und beginnt, ein Lied zu summen. Sie will die Nacht über kein Auge schließen.
»Gott steh uns bei, Maria Anna«, sagt sie. »Gott steh uns bei.«
2
Neben der Blutbuche stehen zwei Weidenkörbe am Boden. Die Tröscherin erhebt sich langsam und streckt ihre strapazierten Glieder. Sie bricht ein Stück Brot vom Laib ab und schiebt es vorsichtig in ihren zahnlosen Mund. Maria Anna arbeitet still weiter und denkt an das, was sie von der Tröscherin erzählt bekommen hat. Sie hat keine rechte Vorstellung von ihrer Mutter. Ihre Brüder hat sie seit dem Tod der Eltern nicht mehr gesehen.
Erneut kommt der Reiter quer über die abgeernteten Felder und treibt sein Pferd zu immer höherem Tempo an. Schweißnass und schnaubend gehorcht der Rappe dem Jungen. Bei der Buche lässt er das Pferd eine Kehre machen und sprengt laut juchzend wieder davon.
»Er wird das Pferd noch zuschanden reiten«, schimpft die Tröscherin.
Maria Anna sieht dem Jungen nach, dessen weißes Hemd sich im Tempo des Ritts aufbläht. Er ist kräftig und der einzige Sohn am Meierhof.
Sie kann nicht glauben, dass Georg der verhungerte Säugling gewesen sein soll, der mit ihr zusammen an der Brust ihrer Mutter gelegen hat. Aber das ist es eigentlich gar nicht, was sie so sehr beschäftigt. Ihr laufen immer wieder kalte Schauer über den Rücken, wenn sie daran denkt, dass genau an dieser Stelle der Bruder des Meierbauern vom Blitz getötet worden war. Er wäre der Herr des Gehöftes geworden und nicht der jetzige Meierbauer, dessen Sohn Georg war, und der von seinem Vater dieses schöne Ross geschenkt bekommen hat. Maria Anna schaut auf die Blutbuche und geht einige Schritte aus Furcht zur Seite, als könnten die Äste des Baumes sie greifen und verschwinden lassen. Sie will die Tröscherin nach dem Toten fragen, aber sie traut sich nicht. Man schweigt über ihn. Und wenn einer nur das Wort ›Wilderer‹ ausspricht, konnte es passieren, dass jemand aus der Meierfamilie zuschlug. Einfach so, weil das Wort ›Wilderer‹ verboten war. Maria Anna sieht den Meierbauern, wie er mit dem Wagen über die Eichenallee hinaus auf die Felder fährt, um die letzten gebundenen Ähren aufzuladen und dann zum Dreschen in den Hof zu bringen. Sie zischelt der Tröscherin etwas zu, die sofort aufspringt und versucht, die mageren Halme aufzuklauben und zu binden. Es ist jederzeit möglich, dass der Meierbauer sie davonjagt. Sie ist alt und kann natürlich längst nicht mehr soviel schaffen wie die Jungen. Maria Anna arbeitet an ihrer Seite doppelt, damit die alte Frau weiterleben kann und nicht verhungern muss. Doch der Meierbauer beachtet sie gar nicht, sondern fixiert seinen Sohn Georg, der erneut quer über die Felder geprescht kommt und aus purem Übermut bei der Blutbuche Maria Anna mit seiner Gerte schlägt. Der Bauer brüllt etwas Unverständliches und sofort hält Georg seinen Rappen an. Das Spektakel ist vorbei. Mit gesenktem Kopf reitet Georg die Eichenallee Richtung Meierhof davon. Er muss an dem alten Meierbauern vorbei, der auf einem Stuhl am Feldrain hockt und dem der Speichel aus dem Mund rinnt.
Die Gerte hat Maria Anna leicht im Gesicht verletzt. Die Tröscherin nimmt ein Tuch, gießt ein wenig Wasser aus einem Tonkrug darüber und wischt Maria Anna die Wange vom Blut sauber.
»Er ist so ein dummer Junge«, sagt die Tröscherin, und es klingt nicht wie ein Vorwurf.
Maria Anna sieht Georg hinterher. Noch nie hat der sie nach ihrer Mutter gefragt. Ohne die Tröscherin würde sie die Geschichte ihrer Mutter nicht kennen. Von Westen her ziehen einige Schäfchenwolken heran. Wenn Maria Anna traurig ist, dann legt sie sich gerne irgendwo in die Wiese und schaut in den Himmel. Aber dann ist es kein Tag wie heute, an dem sie den beißenden Hunger spürt und trotzdem keinen Drang hat, in das alte Brot der Tröscherin zu beißen. Vielleicht bekommt sie am Abend etwas im Meierhof zu essen? Was das sein könnte, das weiß sie nicht, aber häufig, wenn sie am Küchenfenster vorbeigeht, duftet es schon so kräftig, dass ihr das Wasser im Mund zusammenläuft.
Ein Vogel schwebt über die leeren Äcker und sucht nach Beute. Maria Anna staunt immer wieder darüber, wie gut die Vögel aus großer Höhe sehen können, um am Boden Beute zu machen. Das letzte Ährengebinde ist fertig aufgestellt und Maria Anna lehnt sich an den Baum, um sich etwas auszuruhen.
Einige Monate später, sie ist inzwischen auf dem Hof des Bauern Hösch untergekommen, trägt Maria Anna zwei schwere Wassereimer vom Brunnen zum Stall, als ihr jemand einen Stein in den Rücken wirft. Sie muss sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass es der Bauer gewesen ist, dem sie wieder einmal zu langsam läuft. Schneller kann sie nicht gehen, denn dann wird das Wasser überschwappen und auch das würde eine Strafe nach sich ziehen. Sie hat es beim Höschbauern mehr als schlecht getroffen, aber sie muss die Zähne zusammenbeißen. Eine andere Arbeit gibt es nicht für eine wie sie. Und dann geschieht es doch, dass sie einfach fortgeschickt wird. Sehr früh an einem grau durchwirkten Morgen, an dem der Himmel sich einfach nicht öffnen will, jagt sie der Hösch in den Wald hinter dem kleinen Mühlbach, den alle nur Marienforst nennen. Vorüberfahrende Händler hatten vor langer Zeit die Heilige Maria über die Bäume schweben sehen. Seitdem gilt der Wald als geweihte Stätte und niemand wagt es, sich dort aufzuhalten oder gar einen Baum zu fällen. Aber genau das hat der Höschbauer vor, und mit drei Knechten und einem Gespann mit zwei schweren Ochsen macht man sich auf den Weg. Seit Maria Anna auf dem Höschhof lebt, hat sie ihren Schlafplatz über dem Schweinestall mit Marianne geteilt, die wie sie keine Eltern mehr hat und ebenso versucht, sich irgendwie durchzuschlagen. Natürlich hatte der Höschbauer ihnen nichts davon gesagt, dass er im Marienforst einen Baum schlagen will. Sie laufen voraus und als sie am Rande des Waldes angekommen sind, bleiben sie einfach stehen. Der Bauer brüllt laut und zwingt sie, tiefer in den Wald hineinzugehen. Maria Anna und Marianne bekreuzigen sich und wagen kaum zu atmen. Sie glauben, noch niemals in einem Wald gewesen zu sein, in dem es so still ist wie in diesem. Maria Anna sagt, sie riecht Weihrauch und bekreuzigt sich erneut. Dem Höschbauern geht das alles viel zu langsam, also schlägt er nach den Mädchen. An einer kleinen Lichtung schauen sie auf einen Baum, der in Mannshöhe eine frische Kerbe im Stamm trägt. Es ist eine Eberesche, die kerzengerade in die Höhe gewachsen ist und nun umgeschlagen werden soll. Die Knechte mit ihren langstieligen Äxten und den schweren Seilen kommen herbei und stieren stumpf auf den Baum. Maria Anna spürt genau, dass sie ebenso furchtsam sind wie sie selbst. Es ist ein Frevel, im Wald der Heiligen Maria einen Baum zu fällen, da ist sie sich ganz sicher. Außerdem gehört der Wald dem Grafen Hohenstein. Der Höschbauer entreißt einem seiner Knechte eine Axt und drischt wie von Sinnen auf den Baumstamm ein, als habe er mit ihm eine alte Rechnung zu begleichen. Dabei flucht er laut und beschimpft die Knechte als Hasenfüße und stinkende Ochsen. Dann schlagen sie im Rhythmus ihrer ausschwingenden Bewegungen gegen den Stamm, sodass große Späne weit davongeschleudert werden. Der Höschbauer befiehlt den Mädchen, die Späne sorgfältig aufzuklauben und bloß keinen zu übersehen. Doch so sehr die Männer auch schwitzen, die Eberesche will nicht fallen. Tief klafft eine große Wunde im Holz und Maria Anna fürchtet sich davor, dass Blut aus dieser Wunde austreten wird. Sie bekreuzigt sich erneut und bekommt dafür vom Höschbauern einen Schlag ins Gesicht, dass sie der Länge nach zu Boden fällt. Sofort rappelt sie sich wieder hoch und setzt ihre Arbeit fort. Marianne hält sich abseits und tut so, als suche sie fleißig nach Spänen. Plötzlich schreit der Baum auf und fällt langsam zur Seite um. Zu Tode erschrocken werfen sich die beiden Mädchen zu Boden und halten sich an den Händen. Die Männer rufen und der Höschbauer stößt einen Fluch nach dem anderen aus. Aber ihm ist nichts geschehen. Auch der Knecht neben ihm, der bleich wie der Sensenmann ist, bleibt aufrecht stehen. Die zwei anderen Knechte hat der Baum mit seinen Ästen gestreift. Einer, der nur der Ursch gerufen wird, liegt mit einer blutenden Wunde am Kopf am Boden. Er ist klein und stämmig, hat wohl deshalb mehr Glück gehabt als der Pirm, den sie Österreicher rufen, der schlank und groß ist. Über dessen linkem Bein liegt ein schwerer Ast, der ihm das Bein gebrochen hat. Er schreit nicht, liegt nur da und schaut mit weit aufgerissenen Augen zum Himmel hinauf. Der Höschbauer flucht weiter und schimpft, weil es nun schon Mittag geworden ist und wenn sie nicht alle solche Idioten wären, hätten sie den Baum längst unbeschadet auf den Hof geschafft. Der Ursch reißt sich einen Ärmel seines Hemdes ab und bindet sich den Stoff um den Kopf. Die drei Männer versuchen, den schweren Ast vom Bein des Liegenden anzuheben und zur Seite zu drehen. Das gelingt erst, nachdem der Höschbauer den Ast mit der Axt durchschlagen hat. Der Österreicher stöhnt laut auf und bittet um Wasser. Maria Anna taucht die Kelle in den Krug und gibt ihm zu trinken, was den Höschbauern erneut in Wut bringt.
»Schütte ihm doch gleich den Krug über den Kopf«, schimpft er, »dann bleibt eben nichts mehr übrig.«
Sie tragen den Österreicher zur Seite und beginnen, dem Baum die Äste abzuschlagen. Dabei müssen auch die Mädchen helfen, die mit ihren kleineren Äxten aber nicht zur Zufriedenheit des Bauern arbeiten. Sie sehen sich nur an, um sich gegenseitig zu bestätigen, weshalb das Unglück geschehen ist. Erst am späten Nachmittag kann das Ochsengespann zum Einsatz kommen. Sie haben nun die schwereren Äste beseitigt und die starken Tiere reißen mit dem zehn Meter langen Baumstamm eine Schneise in den Wald. Der Österreicher wird über einen der Ochsen gelegt und so machen sie sich auf den Heimweg. Die Abenddämmerung zieht hinter ihnen langsam am Himmel herauf und der Verletzte wimmert leise vor sich hin. Niemand spricht ein Wort. An der Weggabelung kommen ihnen zwei Mönche entgegen, deren Köpfe in großen Kapuzen stecken, sodass ihre Gesichter nicht zu erkennen sind. Marianne stößt Maria Anna in die Rippen. Es ist ein Zeichen der bösen Tat, dass sie nun auch noch den zwei Mönchen begegnen.
Auf dem Hof angekommen, befiehlt der Höschbauer Maria Anna, zur Tröscherin zu laufen und ihr zu sagen, sie muss sofort kommen. Dann lässt er den Mädchen jeweils einen kleinen Sack mit Lebensmitteln reichen und drückt jeder eine Münze in die Hand.
»Ihr braucht nicht mehr zurückkommen«, sagt er und verschwindet im Haus.
Marianne schließt sich Maria Anna an, die ein zügiges Tempo anschlägt, damit sie nicht in die Nacht geraten. Maria Anna ist froh, den Weg nicht alleine gehen zu müssen, zumal Marianne mit ihren 16 Jahren zwei Jahre älter als sie ist. Über das Geschehen im Marienforst verlieren sie kein Wort. Das bringt Unglück. Doch beide sind fest davon überzeugt, für diesen Frevel noch büßen zu müssen.
Beim Laufen bemerkt Maria Anna, dass sie sich im Marienforst das Kleid zerrissen hat. Wenn das ihre Strafe sein soll, dann wäre sie damit sofort einverstanden. Ein Windstoß weht ihnen den Geruch von feuchtem Waldboden zu. Der Moorgeruch zeigt an, sie sind nicht mehr sehr weit von der Tröscherhütte entfernt. Sie müssen sich sputen, denn die Nacht steht schon über dem Land. Irgendwo in der Ferne kräht ein Hahn. Endlich sind sie angekommen und Maria Anna ruft nach der Tröscherin. Gleich darauf wird die Tür geöffnet und die alte Frau winkt die Mädchen zu sich herein.
»Der Österreicher hat sich im Marienforst ein Bein gebrochen«, sprudeln die Worte aus Maria Anna heraus, »und der Hörschbauer hat mir aufgetragen, du sollst sofort kommen.«
Von der umgehauenen Eberesche erzählt sie lieber nichts. Die Mädchen dürfen es sich an der Feuerstelle bequem machen. Über der Glut hängt ein rußgeschwärzter Topf mit einer Suppe. Es riecht nach Rüben und Kohl. Die Tröscherin nimmt zwei Tonschalen und gießt den Mädchen etwas von der Suppe hinein.
»Esst nur, ihr seht schon aus wie zwei Hungerleider.«
Maria Anna greift in ihren Beutel und zieht einen Kanten Brot heraus. Er ist sehr hart. Sie beißt einige kleinere Stücke ab und lässt sie in die Suppe fallen, damit sie aufweichen. Der Raum ist dunkel. Das matte Licht der Glut unter dem Topf ist die einzige Lichtquelle. Es riecht stark nach Rauch und Maria Anna muss deshalb husten.
»Ihr werdet hier übernachten. Morgen werden wir weitersehen.«
Die Tröscherin zieht sich in die Dunkelheit zurück.
Die Wärme in ihrem Bauch tut gut und Maria Anna stellt die leere Schale neben die Feuerstelle. Ein Huhn springt von oben herab auf den Boden und gackert. Erst jetzt erkennt Maria Anna den Tröscher, der, auf seine Arme gestützt, zu ihnen hinüberstarrt. Sie muss wieder husten und ist froh, dass nichts gesprochen wird.
Die Mädchen legen sich neben die Feuerstelle auf den Boden, kuscheln sich aneinander und warten auf den Schlaf. Draußen geht der Wind um die Hütte und spricht. Maria Anna würde gerne wissen, wie der Wind aussieht. Sie glaubt an einen großen und kräftigen Mann, ähnlich dem Hörschbauern, nur noch schwerer, der durch die Wälder streift und dabei kräftig aus den Lungen bläst, oder auch nicht, denn es war nicht immer windig. Marianne sagt, der Wind wird von vielen kleinen Engeln gemacht. Die Mädchen lauschen hinaus und schlafen ein, ohne es zu merken.
Der Morgen ist ungewöhnlich dunkel und kühl. Schwer liegen die tief hängenden Nebel in den Bäumen. Ein Fuchs streift durch das Gelände, verharrt kurz und verschwindet schließlich zwischen den Bäumen.
Maria Anna stolpert schlafverstört aus der Hütte und schüttelt sich. Die Tröscherin treibt die Mädchen sogleich zur Eile an.
»Schnell hinaus! Hinter dem Hof des Höschbauern lauft ihr am alten Mühlbach vorbei bis zur Landstraße.« Sie hebt drohend den Zeigefinger. »Auf der anderen Seite müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht zu lange am kleinen See entlang geht, sonst verirrt ihr euch. Ihr müsst durch das Birkenwäldchen und dann am braunen Bach den Berg hinauf bis zur Quelle.«
Die Tröscherin beginnt hart zu husten und legt sich ihren Schal um den Hals.
»Die Hunde vom Hösch werden nicht anschlagen, weil sie euch kennen. Also seid schön brav und macht, was ich gesagt habe.«
Die Mädchen nicken. Marianne gefällt es, durch die Wälder zu streifen, und sie freut sich schon darauf, wie sie Maria Anna mit ihren schaurigen Geschichten erschrecken kann.
»Hier«, sagt die Tröscherin. »Jede von euch bekommt einen Flusskiesel. Den zeigt ihr vor, wenn ihr angekommen seid, denn dann weiß Ursula, dass ich euch schicke und was sie euch mitgeben soll.« Maria Anna drückt den Kiesel fest in ihre Faust und zittert bei dem Gedanken, dass die Tröscherin sie zu einer wahren Hexe schickt, denn nichts anderes ist diese Ursula für sie. Das war so, weil sie den Namen Ursula in diesem Zusammenhang schon gehört hat. Mehr als einmal hatte sie Frauen darüber flüstern hören, dass hinter dem Marienforst auf dem Berg eine Hexe lebt.
Kurz vor dem Höschhof kommen ihnen die zwei Mönche vom gestrigen Tag entgegen. Sie müssen beim Hösch übernachtet haben, denkt Maria Anna und senkt den Kopf. Aber die Mönche sind gedankenversunken in ein Gespräch vertieft, sodass sie die Tröscherin und die vorübergehenden Mädchen gar nicht zu bemerken scheinen. Wenig später verabschiedet sich die Tröscherin und schärft den Mädchen noch einmal ein, nur ja nicht vom rechten Weg abzukommen. Maria Anna und Marianne laufen am Höschhof vorbei und tatsächlich schlagen die Hunde nicht an. Marianne schaut auf die spindeldürre und blasshäutige Maria Anna, mit ihren fransigen Haaren und den immer aufgeplatzten Lippen. Vielleicht sieht sie ja genauso aus? Sie hat sich noch nie in einem Spiegel gesehen. Von einem Baum ruft ein Vogel eine Warnung in den Wald, den die Mädchen nun betreten.
»Hörst du«, sagt Marianne, »was der Vogel ruft: Keiner liebt dich! Keiner liebt dich!«
Maria Anna sieht Marianne an und versteht nicht, warum sie das sagt. Der Vogel ist ein Vogel und kann nicht sprechen. Marianne sieht in das ungläubige Gesicht Maria Annas und lacht ihr helles Mädchenlachen.
»Still«, flüstert Maria Anna, »hast du schon vergessen, was die Tröscherin gesagt hat?«
Sie betreten die schmale Landstraße, die den Marienforst vom Hexenwald trennt. Kaum hat Maria Anna ihre Warnung ausgesprochen, da sprengen zwei Reiter von Süden her auf sie zu. Marianne unterdrückt einen Schrei. Sie rennen über die Straße in den Wald und versuchen, den Männern zu entkommen. Ihre panische Flucht mussten sie nicht verabreden. Über die Pferdeburschen auf den Landstraßen sprechen die Frauen zwar nur hinter vorgehaltener Hand, aber was mit gefallenen Mädchen geschieht, das hatten sie beide schon erlebt. Die Burschen nehmen sich das Mädchen, welches ihnen über den Weg läuft, und amüsieren sich köstlich, auch wenn die Mädchen noch so jammern und flehen. Die Reiter eskortieren Kaufleute, die ihre kostbare Fracht vor Räubern oder Neidern schützen lassen, denen es aber gleichgültig ist, was neben der Stra