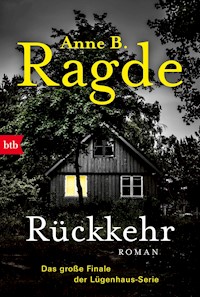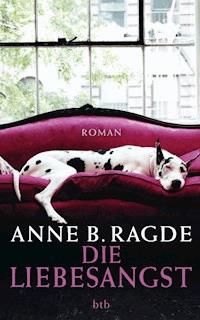8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Verstreut meine Asche am Strand in Dänemark« – bis Anne B. Ragde ihrer Mutter diesen letzten Wunsch erfüllen kann, vergehen lange Monate des Wartens. Monate, in denen Anne an ihrem Bett sitzt und die Zustände im Pflegeheim hautnah mitbekommt. Monate, in denen sie sich manchmal nur ein schnelles, friedliches Ende für ihre Mutter wünscht. Monate, in denen sie ihr zuhört, den Geschichten von früher, aus Annes Kindheit, aber auch aus der Jugend der Mutter, von ihren Träumen und Wünschen – und so entsteht allmählich, wie ein Puzzle, das Bild einer ganz außergewöhnlichen Frau: stark, schwach, liebevoll, streng, exzentrisch, ganz normal – das Bild einer Mutter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
»Verstreut meine Asche am Strand in Dänemark« – bis Anne B. Ragde ihrer Mutter diesen letzten Wunsch erfüllen kann, vergehen lange Monate des Wartens. Monate, in denen Anne an ihrem Bett sitzt und die Zustände im Pflegeheim hautnah mitbekommt. Monate, in denen sie sich manchmal nur ein schnelles, friedliches Ende für ihre Mutter wünscht. Monate, in denen sie ihr zuhört, den Geschichten von früher, aus Annes Kindheit, aber auch aus der Jugend der Mutter, von ihren Träumen und Wünschen – und so entsteht allmählich, wie ein Puzzle, das Bild einer ganz außergewöhnlichen Frau: stark, schwach, liebevoll, streng, exzentrisch, ganz normal – das Bild einer Mutter.
Zur Autorin
ANNE B. RAGDE wurde 1957 im westnorwegischen Hardanger geboren. Sie ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Autorinnen Norwegens und wurde mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt mit dem Preis der Norwegischen Akademie für Sprache und dem Norwegischen Buchhandelspreis. Mit ihrer Trilogie »Das Lügenhaus«, »Einsiedlerkrebse« und »Hitzewelle« schrieb sie sich in die Herzen der Leserinnen und Leser; ihre Romane erreichten in Norwegen eine Millionenauflage. Anne B. Ragde lebt heute in Trondheim.
Anne B. Ragde
Die letzte Reise meiner Mutter
Roman
Deutsch von Gabriele Haefs
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Jeg har et teppe i tusen farger« bei Forlaget Oktober, Oslo.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2016, btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenCopyright © 2014, Forlaget Oktober A/SUmschlaggestaltung: semper smile, MünchenUmschlagmotiv: © plainpicture/Elektrons 08Satz: Uhl + Massopust, Aalencb · Herstellung: scISBN 978-3-641-16187-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Besuchen Sie unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de
Für Eva
I
»ES MUSS GANZ SCHRECKLICH für dich gewesen sein, mich als Mutter zu haben, Anne. Als du klein warst.«
»Ach?«
»Ja. Du Arme.«
Es war Sommerwetter und Nachmittagssonne auf meiner Veranda zu Hause in Ila in Trondheim, ich hatte gerade angefangen, das Geschirr in die Spülmaschine zu räumen, nachdem ich erst einmal eine geraucht hatte.
Wir hatten auf der Veranda und im Garten eine Menge Besuch gehabt, von Nachbarinnen aus alten Zeiten. Aus meiner Kindheit, aus Mamas Kindheit und Erwachsenenleben. Ich hatte Daim-Eistorte serviert, Waffeln mit Erdbeeren, Brownies voller Nüsse und Schokolade und einige Gläschen trockenen Madeira für die, die so etwas zu sich nehmen durften: die nicht fuhren, die keine blutverdünnenden Mittel nahmen. Es war ein schöner und munterer Nachmittag gewesen, bis zum Schluss. Locker und lustig und entspannend.
Seit Mama nach Oslo gezogen war, lud ich immer ihre alten Freundinnen zu mir ein, wenn sie im Sommer nach Trondheim kam, auch wenn sie jedes Mal abwehrte und meinte, das wäre doch viel zu viel für mich. Wie so oft unterschätzte sie mein tägliches Aktivitätsniveau, oder vielleicht kokettierte sie und meinte eigentlich, ich sollte mir doch nicht die Mühe machen, ihre alten Freundinnen zu unterhalten.
Aber ich folgte diesem mir selbst auferlegten Brauch nun seit vielen Jahren, seit Mama in ihrer Verzweiflung in den Süden gezogen war, um dem Trondheimer Klima und ihrer Arbeit als Maschinenführerin in einer Plastiktütenfabrik voller Kommunisten zu entgehen und als Zeitarbeitskraft für Manpower zu arbeiten, fünfhundertzwanzig Kilometer von ihrem einzigen Enkelkind entfernt, meinem damals vier Jahre alten Sohn. Ein Verrat, von dem ich eigentlich nie begriffen habe, wie sie damit leben konnte.
»Ja, ich verlange nicht, dass du mich liebst, Anne, das nun wirklich nicht.«
»Na gut. Nun übertreib nicht. Und wieso fällt dir das gerade jetzt ein?«
Sie saß da in einer eierschalenfarbenen Bluse, die über den großen Brüsten ein wenig spannte, einer Bluse, die ich an diesem Morgen für sie gebügelt hatte, aus Dankbarkeit, weil sie für mich in den Laden gegangen war, sobald der um neun Uhr aufgemacht hatte.
Das war, rein egoistisch betrachtet, das Beste an ihren Besuchen, nämlich die Fürsorge, die sie mir am frühen Morgen erwies, lange, ehe ich selbst aufstand. Ich war daran gewöhnt, immer alles zu machen, aber wenn Mama hier war, konnte ich zu frischen Brötchen, frisch aufgebrühtem Kaffee und Zeitungen aufstehen, und alles auf meiner Einkaufsliste war schon erledigt. Sie nahm auch immer die leeren Flaschen mit, die sie unter dem Spülbecken fand, sie wusste, wie ich es hasste, wenn sich leere Flaschen auftürmten, sie wusste auch, dass ich die Flaschen ab und zu in die Mülltonne warf, zu ihrer tiefen Missbilligung. Außerdem hatte sie das Geschirr vom Vorabend aus der Spülmaschine geräumt und alle Arbeitsflächen in der Küche abgewischt. Und sie sagte erst etwas zu mir, wenn sie hörte, dass ich mir die erste Zigarette des Tages ansteckte.
Ein Morgen mit Mama zu Besuch war einfach wunderbar, ich kam mir vor wie eine echte Tochter, hatte das Gefühl, ihr wichtig zu sein.
Ich war also guter Laune, als ich Kuchenteller und Likörgläser aufeinanderstapelte, und ihre Bemerkung traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wenn auch nicht total überraschend, ich war durchaus an Blitze aus heiterem Himmel gewöhnt, wenn es um Mama ging. Nicht zuletzt, wenn wir einige Stunden miteinander und mit dem Leben der anderen verbracht hatten, und wenn auf der hintersten Kochplatte ihres Gehirns düstere Gedanken vor sich hin köchelten, während wir über alles Mögliche plauderten.
»Mir fallen immer zwei Dinge ein, wenn ich mit den Damen zusammen bin. Sie waren liebevolle Mütter, Anne. Das war ich nicht.«
»Was für ein Unsinn. Damals waren alle Mütter gleich, alle putzten und kochten und hatten keine Zeit für ihre Kinder. Keine war eine liebevolle Mutter. Heute dreht sich das Weltall um jedes einzelne Kind. Ihr hattet keine Zeit für so was.«
»Sieht das in deiner Erinnerung so aus?«
Sie sah mir ins Gesicht, ihre graugrünen Augen wirkten hinter den dicken Brillengläsern stark vergrößert.
»Warte mal, ich bring nur den letzten Rest hier ins Haus, und dann bekommst du noch einen Madeira. Und ich brauche ein Bier, Madeira und Erdbeeren stehen mir schon bis sonst wohin.«
»Ich bring auch keinen Madeira mehr runter.«
»Vielleicht einen Eierlikör?«
»Ja, das wäre keine dumme Idee. Einen kleinen.«
Ich räumte die Spülmaschine ein, presste das kleine, in Folie gepackte Spültab in das Fach und drückte auf den Startknopf. Das Rauschen des sauberen Wassers, das sofort in das ausgeklügelte Spülsystem strömte, beruhigte mich ein wenig. Lieber hätte ich mich jetzt ganz still mit einem kalten Bier hingesetzt, die letzten Stunden waren voller Stimmen gewesen, die sich vermischten, voller Lachen, gemeinsamer Vergangenheit, alter Geschichten, es hätte gutgetan, alles jetzt einsinken zu lassen, mir fielen immer die seltsamsten Dinge aus meiner Kindheit ein, wenn ich mit den Damen zusammen war. Sie hatten mich als kleines Mädchen gesehen, als Mädchen, das ich nicht mehr war, und ich verschlang jede einzelne Anekdote, in der dieses Mädchen einen Teil der Handlung ausmachte, es wäre schön gewesen, das alles erst einmal verarbeiten zu dürfen.
Plötzlich wünschte ich mir, dass jetzt ein unerwarteter Besuch unten an der Haustür klingelte, denn dieses Gespräch konnte ich fast nicht ertragen, ich wusste, was kommen würde. Sie saß dort draußen und wartete auf mich, in ihrer eierschalenfarbenen Bluse, und bald würde sie ein Getränk in der gleichen Farbe vor sich stehen haben und vor Reue und dem mir bekannten Bekenntnisdrang geradezu überlaufen.
Ich goss ein wenig Cognac in den Likör, sie würde das nicht merken, auch wenn sie nur wenig vertrug, da sie fast nie Alkohol trank. Aber vielleicht würde der Cognac sie aus dieser Melancholie holen und zu einem anderen Gesprächsthema schwemmen, das sie wieder munter stimmen könnte. Ich wollte, dass sie fröhlich war, ich wollte doch nur, dass sie fröhlich war, und sicher war sie fröhlich, wenn lustige Dinge passierten, aber danach kam die Melancholie, weil es hinter ihr lag, es war verschwunden, es war Vergangenheit.
Mama war eine Spezialistin in der Kunst, alles Gute, das ein Ende nimmt, ausgiebig zu betrauern. Und jetzt ging es also um diesen schönen Nachmittag in der Sonne, mit alten Freundinnen und Waffeln und Erdbeeren.
Ich stellte das Likörglas vor sie und das Bier vor mich selbst auf den Tisch und nahm mir eine Zigarette. Ihre Haare waren an der Kopfhaut dunkel und feucht, es war warm, sicher vierundzwanzig Grad im Schatten, die Haare über dem Schweißrand hatten die klassische Pudelfrisur, sie ließ sich alle sechs Wochen eine neue Dauerwelle legen und kämmte sich jeden Tag nur nach dem Duschen.
»Weißt du, was ich einmal irgendwo gelesen habe, Anne?«
»Nein, Mama.«
»Man hat die Pflicht, seine Kinder zu lieben, aber nicht die Pflicht, seine Eltern zu lieben.«
»Du sollst Vater und Mutter ehren, das steht in der Bibel.«
»Was für ein Unsinn, Anne. Bist du betrunken?«
»Von drei mikroskopisch kleinen Gläsern Madeira? Nein. Das nun nicht gerade.«
»Die Bibel … meine Güte. So was hab ich ja noch nie gehört. Außerdem ist ehren nicht dasselbe wie lieben. Ehren bedeutet einfach, den Mund zu halten und zu gehorchen.«
»Sag mal, Mama, hast du nicht damals geholfen, Bibeln in die Sowjetunion zu schmuggeln? Hallo?«
»Das ist ja wohl etwas ganz anderes. Es ging doch um Aufruhr gegen das Regime! Wenn es keine Bibeln gewesen wären, dann eben Schwimmringe oder Staubsauger. Alles, was verboten war. Das musst du doch verstehen.«
»Tja … aber dennoch.«
»Ich habe meine Mutter doch gehasst.«
»Ja, das weiß ich. Prost, Mama, auf einen wunderschönen Nachmittag.«
Ich prostete ihr mit meinem Bierglas zu, sie machte sich an dem Likörglas zu schaffen, wollte mich nicht ansehen.
»Wir sind alle so alt geworden …«
»Knapp über siebzig? Das ist ja wohl nicht alt!?«
»Doch, Anne. Das ist alt. Natürlich ist das alt. Natürlich ist das alt. Alles ist zu spät. Alles.«
Sie hob das Likörglas. Für einen Moment glaubte ich, sie wollte mir den Inhalt ins Gesicht schleudern, und ich wollte schon den Kopf einziehen, als sie es auf einen einzigen Zug leerte. Ihr Kehlkopf war spitz und sonnenbraun, sie briet sich so oft sie konnte in der Sonne, eingeschmiert mit Euterfett, und ging den ganzen Winter hindurch zweimal pro Woche ins Solarium. Ich sog den Zigarettenrauch ein, dass meine Mundhöhle nur so brannte, mein Mann würde frühestens in zwei Stunden zu Hause sein, das hier drohte wirklich ein langer Nachmittag zu werden. Zum Glück fiel mir das Essen ein, und ich sagte:
»Ich mache einen Auflauf mit Kartoffeln und Petersilie und Knoblauch und Koriander, und dazu gibt es Schinken und Erbsen, klingt das nicht gut? Und ich habe eine richtig gute Rotweinsoße im Tiefkühlfach. Die ist mit Hühnerbrühe gekocht, aber sie passt trotzdem sehr gut.«
»Das wird sicher lecker, Anne. Kochen kannst du.«
»Hab ich ja auch von dir gelernt.«
»Ja, ihr könnt beide gut kochen, du und Elin, das darf ich ja wohl sagen.«
»Das darfst du.«
»Auch wenn ich überhaupt kein Geld hatte.«
»Du hast es trotzdem geschafft, weil du eben so lecker kochen konntest, egal, was es war.«
»Immer reichlich Fett und Salz, Anne. Butter, wenn ich mir das leisten konnte, Margarine, wenn nicht. Der beste Geschmacksverstärker auf der Welt.«
»Es macht solchen Spaß, mit dir übers Essen zu reden, Mama.«
»Es zu kochen, es zu verzehren, darüber zu reden. Aber kannst du dich erinnern, dass ich dich jemals auf den Schoß genommen und mit dir geschmust habe? Dir nahe war?«
Ich konnte meinen Blick gerade noch davonwandern lassen, ehe er ihrem begegnete.
»Das nun nicht gerade, aber du hast mir immer viel vorgelesen«, sagte ich.
Jetzt war ich ins tiefe Wasser geraten, das wusste ich sofort, als diese Wörter meinen Mund verlassen hatten.
»Großer Gott … was war ich für eine Mutter. Vorgelesen! Als ob das Liebe ersetzen könnte!«
»Ich bin doch Schriftstellerin geworden. Das kann ja auch damit zu tun haben, dass du mir vorgelesen hast.«
»Schriftstellerin bist du ganz von selbst geworden, Anne. Die Ehre kann ich mir nicht zuschreiben.«
»Aber natürlich kannst du das. Ich bin doch von Büchern umgeben aufgewachsen.«
»Ich hab es mit Elin ein bisschen besser geschafft. Vielleicht, weil sie so oft krank war und mir in regelmäßigen Abständen fast unter den Händen weggestorben wäre. Ich habe mit ihr geschmust und getan, auf jeden Fall, bis sie in die Schule kam. Mit dir habe ich das aber nie gemacht. Ich habe dich gestillt, bis du sechs Monate alt warst, da warst du ganz nah bei mir, aber danach … Ich habe Elin nicht viel vorgelesen, das habe ich nicht geschafft. Vielleicht geht es darum, entweder Bücher oder Liebe.«
Sie fing an zu weinen, nahm die Brille ab, der kleine Schuss Cognac hatte offenbar genau die entgegengesetzte Wirkung, die ich erhofft hatte. Sie rieb sich mit der Faust die Augen, als kleines Kind hatte ich es immer schrecklich gefunden, ihr dabei zuzusehen.
»Ach, jetzt heul ich auch noch los …«
»Ich begreife ja nicht, wie du gerade jetzt daran denken kannst. Und dann tropft es auch noch auf deine feine Bluse. Soll ich dir einen Kaffee kochen? Noch einen Eierlikör holen? Einen Captain Morgan?«
»Anne! Ich kann doch jetzt nicht auch noch Rum trinken, nach allem anderen!«
»Kannst du dich nicht einfach damit zufriedengeben, dass wir einen wunderschönen Nachmittag mit der Bande aus dem Block hatten?«
»Nein. Das schaffe ich nicht. Und tausend Dank dafür, dass du alles so schön gemacht hast. Ich bin ungeheuer dankbar, das kannst du mir glauben.«
Ich hörte ihre Schritte auf der Wendeltreppe, es waren schwere Schritte. Ich drückte die Zigarette aus und brachte ihr Glas ins Haus, wusch es mit der Hand ab, weil die Maschine schon lief, spülte den Spüllappen gründlich aus und wischte Verandatisch und Gartentisch ab. Sie hustete unten im Gästezimmer, aber ich hörte zum Glück kein Weinen in diesem Husten. Wenn sie aufwachte, würde sie sich über ein leckeres Essen freuen, munter mit meinem Mann plaudern und sich danach mit irgendeiner Fernsehsendung amüsieren. Oder wir könnten Trivial Pursuit spielen, da fegte sie uns immer von der Bahn, und sie freute sich, wenn ihr das gelang, und es brachte dann ihre Laune in Schwung.
HABE ICH MAMA GELIEBT? Das kann ich mich selbst fragen, wieder und wieder.
Wenn ich mich darüber freute, sie zu sehen, dann, weil ich geplant hatte, etwas für sie zu tun. Etwas, das ihr gefallen würde, etwas, über das sie sich freuen würde. Ich lebte mit dieser ewig langen Hoffnung, sie zufriedenstellen zu können, ihren Tag gut werden zu lassen, ihr eine schöne Erinnerung zu geben, mit der sie weiterleben könnte. Vor allem jetzt, wo sie älter wurde, war das so.
Als sie jünger war, war sie immer in Fahrt, immer war etwas los, und ich musste sehen, wie ich mit ihr Schritt hielt. Sie verlangte wenig, sie lebte ihr eigenes Leben, nach ihren eigenen Prämissen. Aber als sie damit aufhörte, so ungefähr mit sechsundsechzig, wurden andere Saiten aufgezogen.
Von nun an redete Mama über den Tod, sie war jetzt in Rente und in eine Sozialwohnung gezogen. Alles in Schränken und Schubladen war jederzeit sorgsam aufgeräumt und geordnet, und alles Überflüssige wurde weggeworfen.
»Dann wird es für dich und Elin einfacher, euch zurechtzufinden, wenn ich tot bin.«
Fünfzehn Jahre vergingen dann noch, ehe Elin und ich uns mit diesen Schränken und Schubladen befassen mussten. Fünfzehn Jahre lang war Mama bereit.
Sie warf immer wieder etwas weg und hatte ganz hinten in Schränken und Schubladen gar nichts liegen. Das Einzige, was sie nicht wegwarf, auch wenn sie es in der nächsten Zukunft nicht brauchte, waren Kleider für die verschiedenen Jahreszeiten, eine kleine Schachtel mit Christbaumschmuck und Bücher. Was Kleider angeht, ist das allerdings nicht die ganze Wahrheit.
Der Winter überraschte sie immer vollständig, die Winterkleider aus dem Vorjahr waren verschlissen, da sie immer nur das Billigste kaufte, von Stiefeln bis zu Jacken. Sie kaufte ihre Sachen nie im Winterschlussverkauf, so verdrängte sie den Gedanken an einen weiteren Winter und wollte nichts damit zu tun haben, bis sie im Herbst in Matsch und Schnee mehrere Paar Sommerschuhe ruiniert hatte. Erst dann griff sie mutlos und widerwillig zu den verschlissenen Kleidungsstücken aus dem Vorjahr, bis sie sich dann geschlagen geben und neue Stiefel und eine neue Jacke kaufen musste, die billigsten, die sie finden konnte.
Sie fror den ganzen Winter hindurch, weil ihre Neueinkäufe von so elender Qualität waren. Sie durchlitt jeden einzelnen Winter und lief fluchend in Stiefeln umher, die Wasser aufsogen wie ein Schwamm, hin und her zu den beiden extravaganten Solariumstunden der Woche, bloße Zehen in den Stiefeln, niemals Strümpfe oder Strumpfhose unter der langen Hose, bis das Thermometer unter zehn Grad minus sank. Es war einfach, ihre kleine Wohnung zu leeren, ihre Habseligkeiten zu verteilen, zwischen Müllcontainer, Kartons, die wir mit nach Hause nehmen wollten, und Nachbarn, Freundinnen und dänischer Verwandtschaft, denen sie etwas hinterlassen wollte.
Einen Teil des Hausrats gaben wir dem Hausmeister im Stovner Senter 14, er war auch zuständig für Nummer 16. Und er hatte gern einen kleinen Vorrat von notwendigen Dingen, da neue Bewohner oft eingewiesen wurden, ohne irgendetwas mitzubringen, nicht einmal eine Kaffeekanne, ihnen wurden die Wohnungen von Menschen zugeteilt, die verstorben oder im Krankenhaus oder in der Psychiatrie gelandet waren, hier wohnten Drogensüchtige und psychisch Kranke, und der Feueralarm lief fast ohne Unterbrechung.
Der Hausmeister sollte Tassen und Teller und Besteck bekommen, Bügeleisen und Bügelbrett, Kochtöpfe und Bratpfanne und Stövchen und Bettwäsche, um das alles weiterreichen zu können, er bekam sogar Mamas Bett. Er kam summend mit einer großen Schubkarre aus dem Fahrstuhl und lud sie voll, sorgfältig und umständlich, damit auf der langen Fahrt fünf Stockwerke nach unten nichts herunterfallen konnte.
Elin und ich hatten von allem genug. Und Mama besaß weder Dachbodenraum noch Kellerverschlag, nur einige kleine Schränke. Hier gab es für Elin und mich wahrlich keine Kartons voller Kindheitserinnerungen zu holen, keine alten Muttertagskarten oder Kinderkleider oder Puppen und Spielzeug, über die wir in Nostalgie versinken könnten.
Einmal hatte ich mehr Zeit als sonst gehabt, als ich beruflich in Oslo gewesen war, es war sicher aufgrund eines abgesagten Interviews zwischen vielen anderen gewesen, und ich kam mit dem Taxi zur unangemeldeten Stippvisite, ich brachte Sushi und Kuchen aus dem Deli de Luca mit. Neben dem Rollator stand auf dem Gang ein schwarzer Müllsack.
Ich schaute kurz hinein.
»Fotoalben?«, fragte ich.
»Hm …?«
»Du kannst doch keine Fotoalben wegwerfen!«
Ich nahm das oberste heraus. Es war von der Reise nach England, die Mama und Elin unternommen hatten, als Elin fünfzehn war. Mama hatte zwei Jahre lang gespart, sie brauchten nur die eigentliche Reise zu bezahlen, sie konnten bei Mamas Jugendfreundin Audrey in Southampton wohnen und essen.
»Lass das liegen. Können wir zum Sushi Tee trinken? Geht das? Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich doch eine Flasche Limonade gekauft. Oder Wein.«
»Mama! Du kannst doch nicht einfach ein Fotoalbum wegwerfen!«
»Ich werde nur traurig, wenn ich reinschaue. Und ich schaue ja auch gar nicht mehr rein, ich werde schon traurig, wenn ich die Alben nur da liegen sehe. Das Leben, das vergangen ist, wie munter wir waren, wie schön alles war.«
»Hast du Elin gefragt, ob sie das Album vielleicht haben will?«
»Nein.«
»Ich finde, das solltest du aber tun.«
»Sicher. Aber sie ist ja immer so beschäftigt, ich sehe sie so selten.«
Tatsache war, dass Elin sie fast jeden Tag anrief oder bei ihr vorbeischaute, sie wohnte nicht sehr weit entfernt. Elin und ich lachten oft darüber, am Telefon, das mussten wir, wir mussten einfach darüber lachen, uns blieb nichts anderes übrig, und es ist fast nicht zu fassen, dass Mama nicht begriff, dass wir ihren Bluff durchschauten, dass er für immer entlarvt war, jedes Mal, wenn sie das sagte.
Aus dem Taxi zurück zum Hotel rief ich Elin an und erzählte von den Alben, sie konnte einen Tag später einige retten, nahm sie mit nach Hause, aber nach Mamas Tod entdeckten wir, dass noch weitere Alben verschwunden waren.
Wenn Fremde in die Wohnung gekommen wären und hätten raten sollen, was für ein Mensch dort wohnte, dann hätten sie auf eine viel jüngere Person getippt. Mama besaß nicht mehr als eine gut ausgerüstete Bewohnerin eines Studentenheims, aber die Wohnung war gemütlich und einladend, mit ihrem eng stehenden Schatz an grünen Pflanzen vor dem einen kleinen Wohnzimmerfenster zum Balkon, und den Büchern vom Boden bis zur Decke. Bücher und Pflanzen und ein brauchbarer Fernseher, dessen Bild nicht schlingerte und dessen Ton nicht aussetzte, das war das Wichtigste für sie.
An Esstellern mit identischem Muster gab es höchstens drei, die Bratpfanne war unten verbeult und von der billigsten Sorte, Mama besaß drei kleine Kochtöpfe, aber sie konnte in einer Wohnung von achtunddreißig Quadratmetern auch keine großen Feste veranstalten. Die Fremden hätten sicher auch bemerkt, dass es eine ziemlich saubere Wohnung war, und daraus vielleicht geschlossen, dass hier doch kein ganz so junger Mensch wohnte.
Bücher waren das, wovon sie am meisten hatte. Sie waren ihr liebster Besitz, sie lebte und atmete für Belletristik, für Romane und Poesie. Sie liebte klassische Lyrik, ganz besonders Herman Wildenvey, Karin Boye, Emily Dickinson, Steen Steensen Blicher. Als ich eine Biografie über Sigrid Undset für Jugendliche schrieb, stellte ich fest, dass Steen Steensen Blicher auch ein Lieblingsautor von Sigrid Undset gewesen war, und Mama fühlte sich sehr geschmeichelt.
»Da siehst du, Anne«, sagte sie. »Mein Literaturgeschmack liegt doch nicht so ganz daneben, sie hat ja schließlich den Nobelpreis bekommen.«
Außerdem besaß und liebte Mama Sachbücher über alles vom Tal der Könige in Ägypten und Petra in Jordanien bis zu den Maya, aber in den Orten, über die sie las, musste es warm sein. Ihre Abscheu vor Kälte führte auch dazu, dass mehrere meiner Romane, die sie immer als Manuskript lesen durfte, ihr eine unerwartete Gänsehaut bescherten. Sie konnte nicht fassen, dass ich es auch nur über mich brachte, über Kälte zu schreiben, ganz zu schweigen davon, dass ich sie noch dazu aufsuchte, und sie deutete eine mögliche Vertauschung auf der Wochenstation an.
Sie sammelte auch Bücher über bildende Kunst. Marc Chagall war ihre große Leidenschaft, sie identifizierte sich stark mit ihm, immer ein Heimatloser zu sein, immer anderswo sein zu wollen, immer mit geräuschvollen Kindheitserinnerungen umgehen zu müssen. Als ich in den Neunzigerjahren einmal nach Berlin musste, während dort gerade eine große Chagall-Ausstellung gezeigt wurde, und als ich ihr erzählte, dass ich kehrtgemacht hatte, als ich die lange Schlange sah, die bei sengender Sonne vor dem Eintrittskartenschalter stand, knallte sie den Hörer auf die Gabel und ging tagelang nicht ans Telefon.
Sie räumte ihre Bücherregale in regelmäßigen Abständen um, neue Regale wurden dort angebracht, wo noch Platz war, und alle paar Monate wurde ein Buch nach dem anderen sorgfältig staubgesaugt und abgewischt. Dafür konnte sie mehrere Tage brauchen, sie vertiefte sich in einzelne Bücher und setzte sich damit hin und blätterte hin und her, bis sie die ganze Geschichte wieder klar im Kopf hatte. Sie warf Bücher niemals weg, aber oft verschenkte sie eins und sagte:
»Das habe ich viermal gelesen, jetzt kannst du es haben.«
Das passierte zum Beispiel mit Marc Chagalls »Mein Leben«.
Das war allerdings vor Berlin.
Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie es danach zurückverlangt hätte. Aber so weit kam es nicht, sie dachte sicher, ich hätte es noch nicht gelesen, denn dann hätte ich ja wohl beim Anblick der unglaublich langen Schlange nicht die Flucht ergriffen.
Sie hatte recht.
Ich hatte es noch nicht gelesen.
Jetzt habe ich. Und ich schäme mich. Statt mich atemlos in die Schlange zu stellen, setzte ich mich fröhlich mit zwei Freundinnen vor das Hotel Adlon, um Austern zu essen. Im deutschen Binnenland, mitten im Sommer, wenn Austern so schäbig und elend sind wie sonst nie. Wir wurden nicht krank, aber das wurde Mama, beim bloßen Gedanken, obwohl sie zum Glück nicht wusste, womit ich mich hier vollgestopft hatte.
Und zum Glück konnte ich es ein wenig wiedergutmachen, als Mama und ich im Dezember 2009 in Wien die MoMA-Ausstellung besuchten und sie sich mitten in dem Saal mit den Chagall-Bildern auf ein braunes, flaches Kunstledersofa setzen und sagen musste: »Ich möchte nur weinen, wenn ich diese Bilder sehe. Siehst du, Anne? Verstehst du jetzt?«
»Ja, Mama. Jetzt verstehe ich. Entschuldige.«
Und ich schaffte es, sie zu umarmen, es war nicht so schwer, eine kleine, alte Dame wie sie zu umarmen, das Schwierige war die Frage, ob sie es wagen würde, sich für mich zu öffnen, in dieser Umarmung, das war ihre größte Angst, denn genau in diesem Augenblick würde die Umarmung wohl ein Ende nehmen. Aber das tat sie nicht, ich wurde angenommen. Dennoch nahm ich den Widerstand wahr. Nicht einmal ihrer eigenen Tochter konnte sie voll und ganz vertrauen und sich von ihr umarmen lassen.
Da ihre Wohnung so klein war, lieh sie sich oft Bücher in der öffentlichen Bibliothek von Stovner aus, sie las die Buchrezensionen in Dagbladet, VG und Aftenposten immer genau und ließ sich in die Warteliste für die Bücher eintragen, die sie lesen wollte, in der Sekunde, in der sie erschienen. Als Merethe Lindstrøm mit dem Literaturpreis des Nordischen Rates ausgezeichnet wurde, war meine Mutter völlig außer sich, denn sie hatte noch nie etwas von ihr gelesen, und sie stauchte mich telefonisch zusammen, weil ich sie nicht auf diese Autorin hingewiesen hatte!
»Ich verschwinde aus meinem Leben, wenn ich lese. Und das ist doch wirklich Grund genug.«
Als ich im Jahre 2005 anfing, richtig gut zu verdienen, fing ich zugleich mit dem Versuch an, ihr etwas von diesem Geld abzugeben. Aber das führte nur zu Tränen.
»Es müsste doch andersrum sein, Anne, wenn ich mich im Leben richtig verhalten und vernünftig überlegt hätte«, schluchzte sie. »Ich kann kein Geld von dir annehmen, das bringe ich nicht über mich, ich schäme mich so.«
Also kaufte ich von nun an rechtzeitig, im Spätsommer, Winterkleider und Stiefel und schickte sie in großen Postkartons. Auch das führte zu Tränen. Weil sie so dankbar sei, behauptete sie, aber vor allem, weil es sie daran erinnerte, dass der Winter kurz bevorstand.
»Alles, was du gekauft hast, ist so schön, Anne, und ich bin so dankbar.«
»Hast du die Mäntel und die Stiefel denn schon anprobiert?«
»Nein …«
»Warum nicht?«
»Nein, denn dann hab ich gleich das Gefühl, es ist schon Winter. Und diese Vorstellung ist einfach unerträglich.«
Wenn in Oslo der erste Schnee des Jahres fiel, saß Mama mit einer Decke um die Schultern vor dem Fernseher und lugte vorsichtig zu den rieselnden Flocken hinüber, während ich immer das Schneelied aus »Pu der Bär« sang, tamteram, und mich am Christbaumschmuck zu schaffen machte.
»Jetzt brauchst du jedenfalls nicht zu frieren. Das sind gute Stiefel, und wasserdicht sind sie auch, und beide Mäntel sind dick gefüttert.« – »Ja, das sehe ich, Anne. Das ist Qualität. Ich sehe es. Ich bin nicht dumm. Das ist offenbar sehr hohe Qualität.«
Wie um diesen Tatsachen und Gegebenheiten zu trotzen, konnte sie dennoch mitten im Winter mit den Stiefeln und einem der Mäntel, die ich ihr geschickt hatte, bei Elin ankommen und blaue Lippen haben, weil sie vergessen hatte, einen Schal umzubinden, Handschuhe oder eine Mütze anzuziehen, oder weil sie bei vielen Graden unter null in den Stiefeln barfuß war.
Wie ein Kind.
Aber wenn es um Bücher ging, dann war sie anders. Mit beiden Händen und mit großen Plastiktüten nahm sie an. Zweimal im Jahr, von 2005 bis zu ihrem Tod 2012, verabredeten wir uns zum Mittagessen in der Bibliothekbar des Hotel Bristol. Sie wusste, was bevorstand, auch wenn wir vorher niemals darüber sprachen, wir sprachen nur darüber, dass ich sie zum Essen einladen würde. Anfangs protestierte sie auch dagegen, aber diesen Protest konnte ich schon ganz früh durch die Lüge ersticken, dass mein Verlag absolut alle meine Ausgaben bezahlte, wenn ich im Bristol wohnte. Die Wahrheit war, dass außer dem Zimmer alles auf meine Rechnung ging.
Sie war verrückt nach Kuchen und Desserts und allem Süßen, aber sie kämpfte sich doch zuerst durch ein turmhohes Krabbenbrot, immer mit demselben Kommentar:
»Großer Gott, die haben ja so viel auf einer Scheibe Brot, das muss doch eine ganze Dose gewesen sein. Ich hätte zu Hause mit dieser Menge mindestens fünf Krabbenbrote belegen können!«
Danach trippelte sie glücklich zum Kuchenbüfett hinüber und füllte einen Teller mit guten Sachen, in der sicheren Überzeugung, dass Verlagsleiter Berdahl vom Oktober Verlag alles begleichen würde, ich konnte sie bisweilen sogar zu einem kleinen Eierlikör zum Kaffee überreden. Mit roten Wangen und gefülltem Magen ließ sie sich dann zurücksinken, und ich sagte, wie immer:
»Dann schauen wir jetzt mal bei Tanum vorbei.«
»Bei Tanum?«, wiederholte sie und ließ ihren Blick mit aufgesetzter Gleichgültigkeit umherwandern.
»Ja, du hast doch sicher eine Liste gemacht?«
»Eine Liste?«
Natürlich hatte sie eine Liste. Und einen Briefumschlag mit ausgeschnittenen Rezensionen. Alles war in ihrer Handtasche, auch eine Plastiktüte mit einem sauberen, feuchten Lappen, den sie jetzt hervorzog, um sich sorgfältig die Hände zu säubern, ohne auf die Blicke von den Nachbartischen zu achten.
»Man darf auf Bücher keine Fettflecken machen, weißt du, Anne. Das sieht doch unmöglich aus.«
Sie war so froh, wenn wir zu Tanum gingen, sie war so froh wie sonst fast nie, es war eine zügellose Freude, die wirklich wochenlang anhielt, es war das größte Geschenk, das ich ihr machen konnte, tausendmal größer als warme Winterkleidung.
Die Buchhändlerinnen rannten herum und holten Bücher, während sie die Titel nannte, ich riss dann auch noch etliche an mich, um dem Besuch einen Anflug von alltäglichem Einkauf zu geben, so, als hätte ich ohnehin zu Tanum gehen wollen, auch das gehörte mit zum Spiel. Ab und zu schaute sie aufgeregt und fragend zu mir auf.
»Wenn du noch mehr auf der Liste hast, Mama, dann sag schon.«
»Aber ich kann das doch gar nicht alles tragen …«
Das war das Stichwort für die nächste rituelle Mitteilung meinerseits: »Du nimmst natürlich ein Taxi, ich gebe dir fünfhundert Kronen mit, und du schickst mir dann die Quittung mit der Post. Ich krieg das vom Verlag doch zurück, weißt du.«
Damit rannten die Tanum-Frauen wieder los.
Nur einmal irrte sie sich mit einem Buch, ein dicker Wälzer von arabischem Wörterbuch, das über tausend Kronen kostete. Sie war wie erschlagen beim Gedanken an diesen Preis, und es dauerte Wochen, bis sie am Telefon alles zugab:
»Das war wohl ein bisschen zu … heftig für mich. Was sollen wir tun, Anne? Ich habe es kaum aufgemacht. Und es sind keine Fingerabdrücke auf dem Umschlag, und außerdem habe ich es in Zellophan eingeschlagen.«
»Du tauschst es einfach um.«
»Großer Gott, nein, das trau ich mich nicht. Wie peinlich! Ich habe dieser netten Frau doch gesagt, ich könnte ein bisschen Arabisch, und sie war so beeindruckt. Das geht also nicht.«
»Dann mach ich das. Überhaupt kein Problem.«
»Aber wie …«
»Ich nehm es mit, wenn ich dich das nächste Mal besuche, oder du hinterlegst es im Bristol, wenn du in der Stadt bist.«
»Ich muss nächste Woche zum Optiker. Dann mach ich das.«
»Schreib auch einen Zettel, welche Bücher du stattdessen möchtest. Dann besorg ich die.«
»Geht das denn?«
»Ja, Mama. Das ist dein Buch.«
»Aber du hast doch selbst … das ist nicht von Oktober?«
ENDE DER LESEPROBE