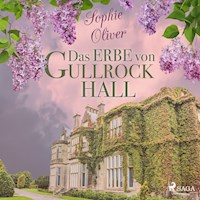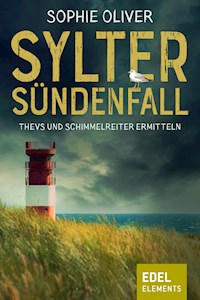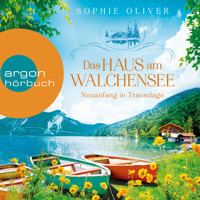Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein viktorianischer Krimi mit den Ermittlern des Sebastian Club
- Sprache: Deutsch
London, 1898. Ein talentierter Trompeter bricht während eines Konzerts tot zusammen. Kurz darauf reist sein Orchester im Rahmen einer Tournee weiter nach Karlsbad. In ihrem neuen Fall tauchen die Gentlemen vom Sebastian Club in eine Welt voller Intrigen, Schein und Eitelkeit ein. Denn das Opfer hatte eine zweite Identität. Und auch einige seiner Kollegen setzen alles daran, ihre Geheimnisse zu bewahren. Die Detektive stehen vor einem Ensemble voller Lügner, von denen einer ein Mörder ist, der jederzeit erneut zuschlagen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die letzte SinfonieKapitel 1: Prolog – London, August 1898 – Lord PhilipKapitel 2: Mayfair – Lord PhilipKapitel 3: Westminster – FreddieKapitel 4: City of London – FreddieKapitel 5: Middlesex – FreddieKapitel 6: Mayfair – FreddieKapitel 7: Karlsbad – CrispinKapitel 8: Mühlbrunnkolonnaden – Lord PhilipKapitel 9: Meierhöfen – FreddieKapitel 10: Hirschensprung – Doktor PebsworthKapitel 11: Grandhotel Pupp – Lord PhilipKapitel 12: Kaiserbad – Lord PhilipKapitel 13: Theater – Doktor PebsworthKapitel 14: Oberer Bahnhof – FreddieKapitel 15: London – FreddieKapitel 16: Billingsgate – CrispinKapitel 17: Mayfair – CrispinKapitel 18: Kensal Green – FreddieKapitel 19: Soho – FreddieKapitel 20: Bloomsbury – Lord PhilipKapitel 21: Mayfair – Doktor PebsworthKapitel 22: Romford – FreddieKapitel 23: Belgravia – CrispinKapitel 24: Epilog – Mayfair – Lord PhilipKapitel 25: Die handelnden PersonenKapitel 26: GlossarDanksagungImpressumKapitel 1: Prolog – London, August 1898 – Lord Philip
Staub lag auf den Möbeln. Lord Philip sah Partikel in den Sonnenstrahlen tanzen, die durch das Buntglasfenster der Haustür einfielen. Er roch ihn, schmeckte ihn sogar auf der Zunge.
Eineinhalb Jahre waren seit dem Tod von Professor Brown vergangen.
Achtzehn Monate, in denen die Zeit in seinem Haus in der Manchester Street stillgestanden hatte. An der Garderobe hing sein Mantel, Hut und Handschuhe lagen auf dem Tischchen daneben, gerade so, als könne er jeden Moment ausgehen.
Er hatte seinen kompletten Nachlass dem Sebastian Club vermacht. Dessen neuer Vorsitzender, Lord Philip Dabinott, hatte sich noch nicht dazu durchringen können, irgendetwas im Stadthaus seines Vorgängers zu verändern. Aber er kam gelegentlich vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, heute zusammen mit seiner Nichte Freddie Westbrook.
Die ansonsten gesprächige junge Frau stand sinnierend im Flur und wirkte in sich gekehrt.
»Ich kann mich noch immer nicht daran gewöhnen, dass er weg ist«, sagte sie leise.
»Mir geht es ebenso. Deshalb habe ich alles gelassen, wie es war. Obwohl das ein oder andere Clubmitglied schon Vorschläge gemacht hat, wie wir die Immobilie nutzen könnten. Als Unterkunft für Gäste, die in London übernachten wollen, beispielsweise.«
»Die Zimmer am Berkeley Square sollten dafür genügen.«
»Oder als ausgelagerte Bibliothek.«
»Auf keinen Fall. Die Bücher gehören zum Clubhaus wie das Dampfbad und das Billardzimmer. So war es schon immer.«
Philip lächelte. »Du hörst dich konservativer an als der alte Lord Cranmore und der ist seit über sechzig Jahren Mitglied, nicht erst seit eineinhalb, wie du.«
Es schien, als würde die kleine Stichelei Freddie aus ihrer Melancholie zurückholen. Sie stieß ihren Onkel leicht mit dem Ellenbogen in die Seite und wies zur Treppe. »Ich bin eben eine alte Seele. Gehen wir hinauf. Immerhin sind wir nicht grundlos hier. Bringen wir es hinter uns, bevor die Trauer wieder zuschlägt.«
Beginnen Sie mit diesem hier.
Die letzten Worte seines alten Freundes, als Notiz an eine Fallakte geheftet, suchten Lord Philip heim, wie ein Spuk. Sie raubten ihm den Schlaf und geisterten durch seine Gedanken. Er hatte sich nicht daran gehalten, weil er nicht konnte. Lieber hatte er sich in aktuelle Aufgaben gestürzt, mit den Kollegen Fälle gelöst, die sich anboten. Alles nur, damit sie beschäftigt waren und sich nicht mit dem Unvermeidlichen auseinandersetzen mussten. Dass nichts jemals wieder sein würde wie vorher. Aber auch das hatte ihn nicht vor dem Nachdenken geschützt. Daher würde er sich nun dem Wunsch des toten Freundes fügen.
Nach Monaten des Haderns fühlte er sich stark genug, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, das zwischen zwei Aktendeckeln abgeheftet war und direkt mit Brown zu tun hatte. Seine Nichte würde ihm dabei helfen. Und Doktor Pebsworth. Und Crispin Fox. Zu viert würden sie dem letzten Rätsel des Professors auf den Grund gehen.
»Ich fühle mich wie ein Eindringling«, flüsterte Freddie, als sie im Schlafzimmer das Nachtkästchen öffnete. »Er war so ein privater Mensch, hat kaum etwas von sich preisgegeben, und nun schnüffeln wir in seinen Sachen. Wo genau sollen sie sein?«
»Zieh die Schublade ganz heraus und dreh sie um. Der Professor hat notiert, dass er die Briefe darunter befestigt hat.«
Unten im Flur schlug die große Standuhr und Philip fuhr zusammen, als würden sie bei etwas Verbotenem erwischt. Zu seiner Erleichterung sagte Freddie: »Tatsächlich, hier ist ein Kuvert, in dem sich zwei, nein drei Briefe befinden. Ich habe geglaubt, es wären mehr.«
Vorsichtig löste sie den Umschlag ab und steckte ihn ein. »Lass uns gehen, Onkel Philip. Es fühlt sich nicht richtig an, hier zu sein.«
Gemeinsam sahen sie sich im Raum um. Professor Browns Schlafzimmer war spartanisch ausgestattet, verströmte aber mit seinen hellgrauen Wänden und den schlichten Holzmöbeln jene Nüchternheit, die es wandernden Gedanken gestattet, zur Ruhe zu kommen. Philip konnte sich gut vorstellen, wie sein Freund sich nach einem langen Tag im Club hier entspannt hatte. Die Abwesenheit viktorianischer Wohnopulenz passte zu ihm.
Beginnen Sie mit diesem hier.
Warum? Weshalb sollten die Gentlemen vom Sebastian Club in der Vergangenheit des verblichenen Vorsitzenden herumschnüffeln, der, wie Freddie absolut treffend bemerkt hatte, zu Lebzeiten kaum etwas von sich persönlich geteilt hatte?
Er war in einem Waisenhaus aufgewachsen, hatte sich alles, was er besaß, hart erarbeitet. Es war schwer, sich Brown als jungen Mann vorzustellen.
»Ich denke, es hat etwas mit Liebe zu tun«, bemerkte Freddie unvermittelt.
»Wie bitte?«
»Die Briefe. Ich habe zwar nur einen flüchtigen Blick auf sie geworfen, aber die Handschrift ist die einer Frau. Und wenn ich daran denke, was der Professor mir geraten hat im Hinblick auf Crispin, dass ich auf mein Herz hören soll, du weißt schon«, sie errötete, »dann bin ich davon überzeugt, dass er einmal unglücklich verliebt war.«
Philip sah in die Augen seiner Nichte, die ebenso intensiv blau waren wie die seinen. »Es würde überhaupt nicht zu ihm passen, uns Jahrzehnte alte amuröse Verstrickungen entwirren zu lassen. Nicht der Aristotle Brown, den ich kannte.« Er dirigierte sie zur Schlafzimmertür hinaus, warf einen letzten Blick über die Schulter zurück und spürte den Schmerz des Verlustes in seiner Brust stechen.
»Wenn es lediglich um Liebe ginge …«, murmelte er vor sich hin, »nein, nein. Da müsste schon etwas Gravierenderes dahinterstecken. Mord, Verrat oder wenigstens Diebstahl. Sonst würde er kein Aufhebens darum machen.«
»Lediglich um Liebe?« Sie imitierte seinen Tonfall. »Ich glaube, du unterschätzt unseren Professor. Er wirkte zwar stets beherrscht, aber ich glaube, unter der Oberfläche war er ein sehr leidenschaftlicher Mann.«
»Gefühlsduselei«, brummte Lord Philip. Er wandte sich endgültig zum Gehen. Freddie legte ihm sanft eine Hand auf die Schulter.
»Lass dich bitte nicht vollständig von deiner neuen Verantwortung auffressen, Onkel Philip. Nicht dass dein mitfühlendes Herz eines Tages abkühlt. Das wäre eine Tragödie.«
Ihre Worte klangen in ihm nach. Von allen Menschen verstand seine Nichte ihn am besten. Er persönlich hatte sich selbst nie für besonders emotional gehalten. Sein bisweilen aufflammendes Temperament konnte er mittels Boxtraining gut umleiten. Was er anderen über seine Gedanken und Gefühle mitteilte, überlegte er sich vorher genau. Aber Freddie konnte er nichts vormachen. Sie waren eine Familie, einander ähnlich und gleichzeitig grundverschieden, und sie musste ihn oftmals nur ansehen, um zu wissen, was er dachte. Wenn sie ihn davor warnte, sich vom Sebastian Club nicht zu sehr vereinnahmen zu lassen, dann war das etwas, worüber er nachdenken wollte. Jedoch nicht im Moment.
Gemeinsam schritten sie die Treppe nach unten.
»Seltsam, dieses Kästchen neben der Garderobe passt nicht zu den restlichen Möbeln. Es ist opulent, mit Schnitzereien versehen, wie eine antike Schatzkiste und sticht regelrecht heraus«, sagte Philip.
Die Kommode war schmal, mit einer Schublade und zwei Türen, aber massiv und schwer und schien aus extrem hartem Holz gefertigt.
»Professor Brown war als junger Mann in Indien. Womöglich hat er sie damals mit nach Hause gebracht.«
»Und in seinen Flur gestellt, wo er sie jeden Tag sieht?«
Freddie nickte. »Genau. Wo er sie jeden Tag sieht.« Sie öffnete nacheinander die Fächer. »Leer. Es befindet sich absolut nichts darin.«
Nachdenklich verließen sie das Haus und stiegen in das Daimler Automobil, das sie sich von Doktor Pebsworth ausgeliehen hatten. Auf der Fahrt von Marylebone nach Mayfair sahen einige Passanten dem auffällig elfenbeinfarben lackierten Fahrzeug mit seinen schwarzen Kanteneinfassungen und dem roten Sitzleder hinterher. Der Doktor hatte es sich kürzlich nach ausgiebigem Testen und Vergleichen zugelegt und war auf vehemente Kritik seitens einiger besonders konservativer Clubkollegen gestoßen. Hätte er sich doch für ein englisches Fabrikat entscheiden müssen und nicht für eines aus dem Deutschen Kaiserreich? Lord Philip hingegen fand das Fahrzeug vollendet und schätzte sich glücklich, dass sein Kollege es bereitwillig an ihn verlieh, um im Auftrag des Sebastian Club Fahrten zu erledigen. Es war wesentlich komfortabler, als auf Droschken oder Hansom Cabs angewiesen zu sein, die just dann nicht auftauchten, wenn man sie am dringendsten benötigte.
Die Stimmung in den altehrwürdigen Clubräumen des großen Hauses am Berkeley Square war anders seit dem Tod des Professors. Besonders in seinem Büro, das nun Lord Philip gehörte. Kein behaglich süßer Pfeifenrauch lag mehr in der Luft. Die sonore Bassstimme und das ansteckende Lachen waren längst in den Gängen verhallt und existierten nur noch in der Erinnerung derer, die Brown gekannt hatten.
Es war keine einfache Aufgabe, in seine Fußstapfen zu treten. Lord Philip wusste, dass er seinen eigenen Weg finden musste.
»Es ist viel Zeit vergangen, seitdem der Professor uns verlassen hat. Trotzdem vergeht kein Tag, an dem wir nicht an ihn denken, von ihm sprechen oder an ihn erinnert werden. Wir haben getrauert. Und nun ist es an der Zeit, in die Zukunft zu blicken. Daher sollten wir endlich das letzte Rätsel lösen, das Aristotle Brown uns gestellt hat«, teilte er seinen drei versammelten Kollegen mit und hielt demonstrativ die dünne braune Akte hoch, in der die spärlichen Informationen gelistet waren, die ihnen dafür zur Verfügung standen.
»Und worum handelt es sich konkret?« Crispin Fox hob fragend die Brauen.
Normalerweise trafen sich die Detektive zu Besprechungen in einem kreisrund geschnittenen Raum, an dessen Wänden Bilder berühmter Clubmitglieder hingen. Auch Professor Browns Porträt befand sich nun darunter. War das der Grund, warum die vier sich lieber im Büro versammelten? Sich um einen kleinen Besuchertisch drängten, auf dem so wenig Platz war, dass die Kaffeekanne auf dem Servierwagen bleiben musste und jeder im Stehen eine Tasse trank, bevor es an die Arbeit ging? Philip seufzte. Irgendwann würde es leichter werden. Vielleicht.
Er öffnete die Fallakte, an die, wie eine Mahnung, noch immer die handgeschriebene Notiz geheftet war.
Beginnen Sie mit diesem.
»Schon bevor er vergiftet wurde, legte Professor Brown diese Akte an. Er ist stets davon ausgegangen, vor uns zu sterben, und will uns etwas mitteilen, worüber er zu Lebzeiten nicht sprechen konnte. Vermutlich handelt es sich dabei um eine sehr persönliche Angelegenheit. Wir verfügen nicht über viele Informationen, sondern wissen lediglich, was er für uns zusammengestellt hat. Hier ist seine handschriftliche Aufzeichnung über die Meuterei der Garnison in Merath, Indien, im Mai 1857. Er schreibt, dass er sich zu diesem Zeitpunkt im Rahmen seines Anthropologiestudiums mit Kommilitonen aus Oxford und einem Professor in der Gegend aufhielt. Was genau er dort gemacht hat, geht nicht aus den Aufzeichnungen hervor, er bleibt recht vage. Die einzigen Personen, die er namentlich erwähnt, sind ein gewisser Colonel Alfred Ellingford, der in Diensten der Ostindien-Kompanie stand und ein schottischer Studienkollege namens Merrit Fraser. Sowohl Professor Brown als auch Mister Fraser wurden während des Aufstands in ein Krankenhaus eingeliefert. Es muss sich um ein schlimmes Massaker gehandelt haben, bei dem nicht nur Soldaten, sondern auch zahlreiche Zivilisten ums Leben kamen.«
»Wenn ich mich recht erinnere, gilt die Meuterei in Merath als Beginn des Sepoy-Aufstandes«, warf Doktor Pebsworth ein.
Lord Philip sah in aufmerksam auf ihn gerichtete Augen und dann auf seine Notizen. »Ganz recht. Ich muss gestehen, dass ich diesbezüglich historisch nicht allzu firm bin, daher habe ich in der Bibliothek nachgelesen. Der Sepoy-Aufstand dauerte etwa ein Jahr, forderte zahlreiche Todesopfer auf indischer wie britischer Seite, markierte das Ende der Ostindien-Kompanie und die formelle Eingliederung Indiens als Kronkolonie ins Empire.« Er machte eine Pause, bis die Kollegen nickten, dann sprach er weiter.
»Professor Brown wurde vermutlich durch einen indischen Aufständischen verwundet. Er lag viele Monate im Krankenhaus und trat die Rückreise nach England an, sobald es ihm möglich war. Hier«, er hielt einen alten Krankenbericht hoch, »steht, dass ihm eine Wunde mit einer langen Klinge zugefügt wurde. Des Weiteren befindet sich in der Akte der Kupferstich eines Landsitzes namens Ridgeway House. Und eine blonde Haarlocke, die mit einem blassrosa Band zusammengehalten wird«, schloss er leise.
»Ich wusste es! Eine Herzensgeschichte.« Freddie sprang auf, dabei stieß sie gegen den Servierwagen und der Kaffee schwappte in der Kanne.
Lord Philip bemerkte, wie Crispin Fox nur mühsam ein Schmunzeln unterdrückte und Freddie zublinzelte. »Da weiß Miss Westbrook mehr als ich. Mir ist nämlich noch immer nicht klar, worum es Professor Brown überhaupt geht. Sollen wir herausfinden, wer ihn verwundet hat? Das scheint mir nach all den Jahren unmöglich. Oder gibt es noch etwas anderes, das mit den beiden Personen, Ellingford und Fraser, zu tun hat? Wir müssen einfach ins kalte Wasser springen.«
»Das lässt sich wohl nicht vermeiden.« Doktor Pebsworth strich über seinen Schnauzbart. Die Geste wirkte gedankenvoll. Scheute er sich davor, in die Vergangenheit seines verstorbenen Freundes einzutauchen? Das könnte Lord Philip durchaus nachvollziehen, ihm selbst erging es ebenso.
»Dann schlage ich vor, dass wir zunächst in Erfahrung bringen, wo Ridgeway House steht und wem es gehört, und dann werden wir den Leuten dort einen Besuch abstatten. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn wir wollen sie ausfragen und wissen nicht, worüber. Das kann schnell in einer peinlichen Situation enden.«
»Ich übernehme die Recherche«, bot Crispin Fox an. »Und informiere mich gleichzeitig über die Herren Ellingford und Fraser.«
Dankbar nickte Lord Philip ihm zu. Mister Fox war hervorragend, wenn es darum ging, zügig aussagekräftige Informationen zu beschaffen. Zudem schien er keine Vorbehalte gegen diese sehr persönlichen Ermittlungen zu haben, im Gegenteil, er machte einen eifrigen Eindruck. Der Clubvorsitzende löste die Runde auf und sah auf seine Taschenuhr. Er musste sich beeilen. Fletcher Markward, ein bekannter Mäzen der schönen Künste, hatte zum Konzert geladen. Dieser Abend war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen er sich auf Annabel Arnholtz’ Begleitung freuen durfte. Es lag nicht an ihm, dass er die meisten gesellschaftlichen Verpflichtungen alleine wahrnahm, Annabel lehnte so gut wie jede Einladung ab. Über ihre Beweggründe hatten sie oft diskutiert. Sie fand, es schickte sich nicht, dass ein Mitglied der Upper Class mit einer ehemaligen Bordellbetreiberin ausging. Zu groß wäre die Gefahr, früheren Kunden zu begegnen und Lord Philip zu brüskieren. Ihrer Erfahrung nach waren es gerade diejenigen mit einem Doppelleben, die sich betont konservativ gaben. Annabel verurteilte übertriebene, zur Schau getragene Prüderie und wollte sich nicht mehr mit ihr auseinandersetzen, seitdem sie in ihrem Anwesen in Greenwich ein neues Leben begonnen hatte. Ihr genügten ihre wenigen Vertrauten, neben Lord Philip war dies Iggy Hegan, ihr Ziehsohn, sowie Freda, der gute Geist des Hauses. Der Rückzug aus der Stadt machte sie derart zufrieden, dass sie nicht oft den Wunsch verspürte, am Gesellschaftsleben teilzunehmen. Was wiederum bei Lord Philip für Betrübnis sorgte.
Er atmete tief durch. Warum fiel es ihm schwer, den Kopf frei zu bekommen? Er sehnte sich nach einem unbeschwerten Abend und danach, die Akte Brown bald schließen zu können.
Dabei konnte er nicht ahnen, dass ihm weder das eine noch das andere vergönnt sein würde.
Kapitel 2: Mayfair – Lord Philip
Nicht viele Londoner Stadthäuser konnten sich damit rühmen, über einen eigenen Konzertsaal zu verfügen. Ballsäle, ja. Billardzimmer, Orangerien, Bibliotheken, selbstredend. Tiermenagerien und andere Überspanntheiten hoben die reichen Exzentriker sich für ihre Landhäuser auf. Und konzertante Veranstaltungen fanden üblicherweise in Gärten, auf Terrassen oder in einem der zahlreichen ohnehin vorhandenen Räume statt. Niemand baute deswegen gleich ein privates Theater. Außer Fletcher Markward, finanzkräftiger Förderer der schönen Künste. In seinem Palais in Mayfair gab es eine Bühne, die bei Schauspielern, Musikern sowie dem Publikum keine Wünsche offenließ. Markwards Vermögen war ererbt. Es stammte aus Afrika. Diamantminen. Oder Gold? Lord Philip erinnerte sich nicht daran, womit Markwards Großvater, ein einfacher Mann ohne Titel und Herkunft, reich geworden war. Der Mittsechziger selbst war im Luxus aufgewachsen, und hatte keinen einzigen Tag seines Lebens gearbeitet. Lieber gab er sein Geld mit beiden Händen aus, was ihm einen Harem an Schmarotzern und Schöntuern bescherte, der ihn auf Schritt und Tritt umschwirrte wie Fliegen einen Kothaufen.
Er tat Lord Philip leid. Nie konnte er sich sicher sein, ob er wegen seines Geldes oder seines Charakters gemocht wurde. Aber er hatte sich selbst in diese Lage manövriert. Was sprach dagegen, in vornehmem Understatement zu leben? Markward war ein unruhiger Geist, ständig darauf aus, neue Talente zu entdecken und sich deren immerwährende Dankbarkeit zu sichern. Vor allem dann, wenn sie es zu Ruhm und Ehre gebracht hatten. Was sich bei dem Mäzen nie einstellte, war ein Zustand der Zufriedenheit. In Philips Augen ein häufiges Problem derer, die zu schnell an Geld gekommen waren. Sie standen unter dem Zwang, nach außen hin etwas darstellen zu müssen. Was illusorisch und äußerst anstrengend war, denn die wankelmütige Masse – sogar die der sozial Gleichgestellten – änderte ihre Präferenzen unablässig. Wer heute als à la mode galt, konnte morgen schon wieder reizlos sein. Alten Familien hingegen war egal, was jeder Tom, Dick and Harry über sie dachte. Sie hatten Traditionen, die ihnen Würde aufzwangen. Jahrhundertealte Landsitze, Burgen und Schlösser, die bewahrt werden mussten und Zeit und Unsummen verschlangen, was wiederum für Beschäftigung sorgte. Und wenn man sich wie Philip als Vorsitzender eines detektivisch tätigen Herrenclubs für einen anderen Weg entschied, kannte man die Gebräuche, mit denen man brach. Ein Zurückfallen darauf war jederzeit möglich.
»Lord Philip«, begrüßte Markward ihn mit Bassstimme, in der ein weicher südafrikanischer Akzent mitschwang. »Was für eine Freude, dass Sie es heute Abend einrichten konnten. Noch dazu in reizender Begleitung.« Er war ein imposanter Mann. Das graumelierte Haar aus der breiten Stirn gekämmt, überragte er all seine Gäste. Sein Handschlag war fest und als er lächelte, entblößte er eine Reihe perfekter Zähne, die ein wenig zu weiß strahlten, um echt zu sein.
Nachdem Philip Annabel vorgestellt hatte, die in ihrem nachtblauen Abendkleid wahrhaft atemberaubend aussah, meinte sie: »Wenn Tschaikowski gespielt wird, kann ich nicht widerstehen. Ich bin eine große Bewunderin seiner Kunst und besonders das heutige Programm hat es mir angetan.«
Markward nickte schwärmerisch. »Ja, die vierte Sinfonie. Faktum, Schicksal, hat der Meister sie genannt. Und wie treffend ist dieser Name. Mir ist klar, dass sie den Rahmen eines bescheidenen Hauskonzerts etwas sprengt, aber ich habe mir persönlich vom Dirigenten gewünscht, dass sie Teil der Europatournee ist.«
Das Boston Orchestra, in unablässiger Konkurrenz zum Boston Symphony Orchestra und chancenlos dagegen aus dessen übermächtigem Schatten zu treten, war Markwards neueste Entdeckung. Er bezahlte die Konzertreise und hatte es sich zum Ziel gesetzt, das Ensemble endlich europaweit bekannt zu machen. Dazu hatte er an diesem Abend die Spitze der Londoner Gesellschaft geladen. Lord Philip wusste, dass es sich bei den Musikern um eine begabte Truppe aus unterschiedlichen Ländern handelte. In einem eigens aufgelegten Heft, das Markward seinen Gästen vorab hatte zukommen lassen – ebenso wie der Presse – stellte er die Künstler und deren bisherigen Werdegang vor. Mit Interesse hatte Philip vernommen, dass der Dirigent, Raphael Wilfried, ein in die Vereinigten Staaten ausgewanderter Brite war. Was dort besser sein sollte als in England, fragte sich der Vorsitzende des Sebastian Clubs zwar, aber möglicherweise ergab sich nach dem Konzert die Gelegenheit zu einem Plausch, bei dem er nachfragen konnte.
Markwards Konzertsaal beeindruckte ihn. Allein im Parkett fanden an die sechzig Personen Platz, dazu kamen die beiden umlaufenden Ränge.
»Es wundert mich, dass er sich keine Königsloge hat einbauen lassen«, flüsterte Annabel Lord Philip zu.
»Dafür hat er bei der Ausstattung an Opulenz nicht gespart.« Er wies auf die kristallenen Lüster und den üppigen Stuck. Sie saßen auf ihren Plätzen und ließen das Sehen und Gesehen werden über sich ergehen. Das Ehepaar Shrewsbury, zwei Reihen links hinter ihnen, steckte die Köpfe zusammen und tuschelte, dabei warfen sie auffällige Blicke in ihre Richtung. Lord Philip, der sie aus dem Augenwinkel beobachtet hatte, grüßte freundlich. Die Tochter der Shrewsburys hatte sich eine Zeit lang darum bemüht, ihn in den Hafen der Ehe zu steuern, sich aber zügig umorientiert, als ihre Anstrengungen nicht zielführend waren. Er hatte gehört, dass Mabel mittlerweile nicht nur verheiratet, sondern Mutter eines kleinen Sohnes war.
Endlich wurde die Beleuchtung gedimmt.
Im Dunkel des Zuschauerraums nahm Lord Philip Annabels Hand und drückte sie sanft. Der Moment, bevor das Orchester einsetzte, war wie ein tiefes Atemholen. Gespannte Stille legte sich über alle Anwesenden, der Dirigent hob mit theatralisch zackiger Geste den Taktstock und die bombastischen Klänge der Blechbläser eroberten augenblicklich den Raum. Hörner, Posaunen und Trompeten bildeten den Auftakt. Die Holzbläser übernahmen und ein ruhigerer Musikfluss stellte sich ein, bis schließlich die Streicher in karamellweicher Nostalgie an die russische Seele des Komponisten erinnerten, die in jedem einzelnen Takt spürbar war.
Annabel Arnholtz, den Blick gebannt nach vorne gerichtet, schien kaum zu atmen. Im Profil sahen ihre gerade Nase und die hohe Stirn besonders klassisch aus, wie die Renaissanceschönheiten der italienischen Maler. Sie genoss die Musik und Lord Philip fand ihren Gesichtsausdruck dabei geradezu sinnlich. Zwei Plätze weiter saß Lew Melnikow, ein Exilrusse und Künstler, der seit Jahrzehnten in London lebte. Er wischte sich verstohlen eine Träne weg. Sodann richtete auch Lord Philip seine Aufmerksamkeit vollends auf die Bühne und genoss die Mischung aus Glück und Schwermütigkeit des ersten Satzes. Die Musiker spielten brillant, es war eine Freude, ihnen zuzuhören.
Zu Beginn des zweiten Satzes, gerade als das Solo der Oboe endete und vom Orchester wieder aufgegriffen wurde, sprang einer der Trompeter unvermittelt von seinem Platz auf und ließ sein Instrument fallen. Er torkelte ein paar Schritte, stieß dabei seinen Notenständer um und kippte gegen den ersten Klarinettisten, an dem er sich abstützte. Er fasste nach Luft ringend an seine Brust. Die anderen Musiker bemerkten, dass etwas nicht in Ordnung war und der Wohlklang der Töne verwandelte sich in Chaos. In Panik oder Schmerz, von seiner Position aus konnte Lord Philip es nicht exakt benennen, stolperte der Trompeter weiter durch die Reihen der Holzbläser. Als auch der letzte Musiker sein Instrument erschrocken sinken ließ, brach der Mann auf Höhe der Bratschen mit einem lauten Gurgeln auf dem Bühnenboden zusammen und blieb liegen. Es wurde noch stiller als zu Beginn des Konzerts.
Einem Augenblick der Schockstarre folgte Tumult, der ähnlich unisono losbrach, wie zuvor die Musik, gerade so, als hätte der Dirigent den Einsatz dazu gegeben. Zwei seiner Kollegen versuchten dem Trompeter zu helfen, sie beugten sich über ihn, um ihm aufzuhelfen. Was ihnen nicht gelang, denn er schien das Bewusstsein verloren zu haben. Fletcher Markward erklomm die Bühne und tastete nach einem Puls, zuerst am Handgelenk, dann am Hals. Mit Schweiß auf der Stirn lief er nach vorne an den Bühnenrand und spähte hinab in den Zuschauerraum, bis sein Blick auf den von Lord Philip traf. Er winkte den Vorsitzenden des Sebastian Clubs zu sich. Auch Annabel blieb nicht auf ihrem Platz, sondern kämpfte sich mit ihm durch die wild durcheinanderredenden Menschen. Das gestaltete sich kompliziert, denn mittlerweile waren die meisten Zuschauer aufgestanden, verstopften die Durchgänge und Reihen oder drängten nach vorne, um besser sehen zu können.
Von der Bühne aus winkte Mister Markward nun seinem Personal, das jedoch am entgegengesetzten Ende des Konzertsaals keine Chance hatte, zu ihm vorzudringen.
»Ruhe!«, brüllte er schließlich über die Köpfe aller hinweg. Und dann noch einmal, »Ruhe, Ladies und Gentlemen, ich bitte Sie!«
Das Licht ging endlich an und tatsächlich verebbte das Stimmengewirr so weit, dass der Hausherr weitersprechen konnte.
»Offensichtlich handelt es sich hier um einen Notfall, der meine Aufmerksamkeit braucht. Aber seien Sie beruhigt, ein Arzt ist bereits unterwegs. Ich bin mir sicher, die Situation wird sich in Kürze klären. Ich darf Sie bitten, meinem Personal hinüber in den Salon zu folgen, wo Erfrischungen gereicht werden.«
Es dauerte etwas, bis sich der Saal soweit geleert hatte, dass Lord Philip und Annabel auf die Bühne klettern konnten.
Die Musiker hatten einen Kreis um den Bewusstlosen gebildet. Einzig Dirigent Wilfried stand wie versteinert hinter seinem Pult, den Taktstock noch immer in der Hand und die schreckgeweiteten Augen auf den Tumult gerichtet.
»Welchen Arzt haben Sie informiert?«, fragte Lord Philip.
Fletcher Markward schob einen Geiger zur Seite, um Platz für ihn zu machen. »Keinen, wo denken Sie hin? Das habe ich nur gesagt, um für Ruhe zu sorgen.«
Lord Philip kniete sich auf den Boden und kontrollierte ebenfalls zuerst den Puls des Trompeters. »Wenn Sie möchten, schicke ich nach Doktor Pebsworth. Er wohnt in der Nähe und ist sehr diskret. Allerdings wird er für den bedauernswerten Herrn hier nichts mehr tun können, denn er ist tot.«
Markward nickte.
»Ich werde auch gleich Chief Inspector Woodard von Scotland Yard alarmieren«, setzte Lord Philip hinzu.
Er ließ Annabel kurz allein, um die beiden Telefonate zu führen. Als er zurückkam, saß sie inmitten der Musiker, die sich mittlerweile, wahrscheinlich auf Geheiß von Markward, im Zuschauerraum niedergelassen hatten. Er bedeutete ihr, sitzen zu bleiben, und verharrte selbst wartend am Bühnenrand.
Außer Atem und mit zerzaustem Haar traf Doktor Pebsworth wenig später ein. Sicher war er mit überhöhter Geschwindigkeit durch Londons Straßen gebraust.
»Wie heißt der Mann?«, fragte er, nachdem er den Trompeter untersucht hatte.
»Carl Belami«, antwortete Raphael Wilfried von seinem Platz in der ersten Reihe. Er hatte sich wohl wieder gefangen.
»Und Sie sind der Dirigent?«
»Dirigent und Generalmusikdirektor.«
»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Mister Belami höchstwahrscheinlich keines natürlichen Todes starb.«
Markward stieß einen erstickten Laut aus, Wilfried schlug eine Hand vor den Mund und ein Raunen ging durch die wartenden Musiker. Wie zu erwarten, wirkten alle erschüttert. Besonders ein dunkelhaariger Herr mit rundem Gesicht und dicken Lippen machte einen betroffenen Eindruck. Mit geschultem Blick erfasste Lord Philip die zitternden Hände, die eine Posaune umklammert hielten. Irgendwie kam er sich vor wie in einem Theaterstück, einer Inszenierung.
Doktor Pebsworth schnupperte am Leichnam und unterzog ihn einer eingehenden Musterung, sein Kollege sah ihm dabei zu. Der Tote war sicherlich nicht älter als Mitte vierzig gewesen, groß und von schlanker Statur, mit gepflegt gestutztem Vollbart, dichtem Haar und einer dominanten Nase. Als er mit seiner Beschau fertig war, winkte er Lord Philip zu sich.
»Gift?«, fragte der leise.
Der Arzt nickte. »Ich vermute Arsen, aber nageln Sie mich nicht darauf fest. Darüber hinaus hat noch eine Darmentleerung stattgefunden, im Augenblick als der Muskeltonus erstarb.«
Der Auftritt von Chief Inspector Alwin Woodard, im wallenden Mantel, den Hut in die Stirn gezogen und mit ein paar uniformierten Polizisten im Schlepptau, läutete gewissermaßen den zweiten Akt ein. Wie immer sah der Beamte zerknautscht aus, an diesem Abend mehr noch als sonst, fand Lord Philip. Mit Tränensäcken und blutunterlaufenen Augen machte er einen geradezu miserablen Eindruck.
»Meine Tochter und ihr Mann sind zu Besuch«, raunte er zur Begrüßung, den Blick seines Gegenübers korrekt deutend. »Zusammen mit meinem Enkelkind. Der Junge ist vier Monate alt und hat ständig Blähungen, er schläft so gut wie überhaupt nicht. Genau wie wir.«
Lord Philip klopfte ihm mitfühlend auf die Schulter und erklärte rasch die Situation. Woodard notierte mit, runzelte dann die Stirn und fragte: »Und warum, meine Herren, sind Sie schon wieder vor Ort?«
»Mister Markward hat mich und Mrs Arnholtz zum Konzert geladen. Ich habe Doktor Pebsworth informiert, als Mister Belami kollabiert ist.«
Woodard kniff die Augen zusammen und warf einen Blick in den Zuschauerraum. »Aha. Mrs Arnholtz. Ist sie tatsächlich nur als Ihre Begleitung hier? Oder steht zu befürchten, dass der Sebastian Club eine weitere weibliche Ermittlerin aufnimmt?« Er stieß ein amüsiertes Grunzen aus, als Lord Philip rasch verneinte.
Mit hochgezogenen Augenbrauen nickte der Chief Inspector sodann dem Doktor zu.
»Vermutlich vergiftet«, erklärte der. »Ich würde auf Arsenik tippen, lasse mich aber gerne von Ihrem Pathologen eines Besseren belehren.«
Woodard seufzte. »Es wird sicher nicht notwendig sein, dass Sie die Mitarbeiter von Scotland Yard stören. Ab hier übernehmen wir. Banes!«, er winkte einen der Uniformierten heran. »Begleiten Sie die Musiker in die Garderobe und passen Sie auf, dass niemand abhandenkommt. Das schließt den Dirigenten mit ein. Ich werde einen nach dem anderen vernehmen, wenn es an der Zeit ist. Das Publikum«, er winkte nachlässig in Richtung Salon, »kann nach Hause gehen. Wird lang genug dauern, ein ganzes Orchester zu verhören.«
»Wir reisen kommende Woche weiter nach Karlsbad«, warf Mister Wilfried ein. »Auch wenn es pietätlos klingt, aber wir sind auf Europatournee, die Säle sind gebucht, die Konzertkarten verkauft, wir müssen uns an unseren Zeitplan halten.«
»Wie der aussieht, werde ich Ihnen mitteilen, sobald ich mir ein Bild von der Sachlage gemacht habe«, schnappte Woodard.
Die Musiker entfernten sich. Einzig der Leichnam blieb inmitten von leeren Stühlen liegen, als wäre er Teil eines dramatisch inszenierten Bühnenbilds. Und Annabel, die letzte Zuschauerin des makaberen Spiels, saß auf ihrem Platz und wartete auf Lord Philip.
»Sie können gehen, meine Herren. Und Dame. Falls ich Fragen an Sie habe, weiß ich, wo Sie zu finden sind.« Die Laune des Inspektors war ebenso angegriffen wie sein Aussehen. Es kam ihm klar ungelegen, am Samstagabend zu einem Mord gerufen zu werden. Er widmete seine Aufmerksamkeit dem Gastgeber und drehte Lord Philip demonstrativ den Rücken zu.
»Dann fange ich mal mit Ihnen an. Sie sind Fletcher Markward und dies ist Ihr Haus und Ihre Bühne?«
Es machte keinen Sinn, länger hierzubleiben. Woodard würde nur noch unleidiger werden.
»Warum hast du die ganze Zeit über geschwiegen? War es sehr erschreckend für dich?«, fragte Lord Philip Annabel im Wagen. Der Doktor fuhr sie nach Hause.
»Nein, ich fand es aufregend. Tragisch, natürlich, aber in meinem früheren Leben in Whitchapel habe ich weiß Gott Schlimmeres gesehen.«
»Das kann ich mir vorstellen«, warf der Doktor ein.
»Ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck, es wurde von mir erwartet, dass ich mich im Hintergrund halte.« Annabel klammerte sich an den Sitz, als der Wagen holpernd um eine Kurve bog. »Es wäre von den Herren sicherlich nicht gut aufgenommen worden, hätte ich als einzige anwesende Dame das Wort ergriffen.«
Tatsächlich waren außer ihr nur Männer im Konzertsaal gewesen, nachdem das Publikum hinausbefördert worden war. Philip war das nicht aufgefallen, weil er sich zu sehr auf den Todesfall konzentriert hatte. Manchmal kam er sich vor wie ein Bluthund. Sobald es um Mord ging, legte sich in seinem Kopf ein Schalter um, seine Gedanken fokussierten sich und er setzte alles daran, dem Täter auf die Spur zu kommen. Dabei war es die Jagd nach dem Mörder, die ihm am meisten Spaß machte. Er genoss es, wenn sich sein Puls beschleunigte, sobald er Indizien wie Puzzlesteine zusammenfügte. Und er war davon überzeugt, dass Carl Belami einen gewaltsamen Tod gefunden hatte.
»Wer war der Herr neben dir, Annabel? Der mit der Pomadefrisur, der unablässig auf dich eingeflüstert hat?«
»Mister Verbier. Er spielt die zweite Trompete. Und dachte wohl, ich wäre ein verschrecktes Weibchen, das Beistand braucht. Oder vielleicht hat ihn der Vorfall auch selbst derartig schockiert, dass er Redebedarf hatte.«
»Er schien sehr an dir interessiert zu sein.«
Sie lächelte amüsiert. »Das konntest du beobachten, während du mit einer Leiche beschäftigt warst?«
»Es war unübersehbar. Hat er nicht sogar versucht, deine Hand zu halten?«
Nun verzog sie das Gesicht. »Ja. Um mich zu beruhigen, meinte er. Aber wie gesagt, dafür hatte ich keinen Bedarf und ich lasse mich auch nicht von fremden Männern anfassen. Das habe ich ihm klar gemacht. Ab dann schwieg er. Wenig später hat er den Platz gewechselt. Aber auch das ist dir bestimmt nicht entgangen.«
»Wie sicher sind Sie sich bezüglich der Todesursache, Doktor?« Lord Philip wechselte das Thema.
Der Fahrtwind pfiff durchs offene Fahrzeug. Sie fuhren an der Themse entlang stadtauswärts, über ihnen leuchtete ein blassgelber Vollmond, der sich auf dem Wasser spiegelte und sie zu begleiten schien.
»Dass er vergiftet wurde, steht außer Frage. Bei der Art des Giftes bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, da müsste ich ein paar Tests machen. Was mir Scotland Yard mitnichten gestatten wird, wie wir alle wissen. Also wären wir darauf angewiesen, dass uns irgendjemand Einsicht in den Obduktionsbericht gewährt.« Sie saßen eng aneinandergedrängt auf der einzigen Sitzbank des Automobils und Doktor Pebsworth warf Lord Philip einen kurzen Seitenblick zu, bevor er sich wieder auf die Straße konzentrierte. »Möchten Sie, dass ich nachhake?«
»Nein. Wir haben keinen Ermittlungsauftrag. Das kann Woodard sicher prima alleine lösen, lassen Sie ihn nur.«
Wie falsch er mit dieser Annahme lag, erfuhr Lord Philip gleich am nächsten Tag, als ein erboster Fletcher Markward im Clubhaus vorsprach und sich lautstark über das Unvermögen von Scotland Yard und Chief Inspector Woodard ausließ. Und die Gentlemenermittler bat, sich der Sache anzunehmen.
»Wie stehe ich denn da?«, klagte er. »Ein spektakulärer und noch dazu dubioser Todesfall in meinem Haus! Während eines Konzerts! Das muss schnellstens aufgeklärt werden.« Er senkte die Stimme. »Lady Treadwell ist in Ohnmacht gefallen und Mister Connelly-Smith hat sich derart aufgeregt, dass ihm seine Herztropfen verabreicht werden mussten. Vor allen Leuten im Salon. Stellen Sie sich das Gerede vor, den Klatsch. Entsetzlich, ganz entsetzlich.«
Ein Gefühl von Genugtuung ließ Lord Philip lächeln. Die ganze Nacht über hatte er spekuliert, was hinter dem Tod des Trompeters stecken könnte. Sein Dahinscheiden war wahrhaft spektakulär gewesen, das sah Mister Markward richtig. Es würde ein interessanter Fall werden.
»Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung«, informierte er sein Gegenüber.
Kapitel 3: Westminster – Freddie
»Ein vergifteter Amerikaner, der erst seit drei Tagen in London ist und außer Fletcher Markward und seinen Orchesterkollegen niemanden kannte. Dazu drängt die Zeit, weil die Musiker weiterreisen wollen. Und Chief Inspector Woodard hat das ganze heute kurzerhand zu einem Unfall erklärt und den Fall zu den Akten gelegt. Kein Wunder, dass Mister Markward uns engagiert hat. Herrlich!« Lord Philip klatschte in die Hände.
Knifflige Umstände spornten ihren Onkel zu Höchstleistungen an, wusste Freddie. Und die vorliegenden waren exakt nach seinem Geschmack.
»Ein Unfall?«, Crispin schnaubte. »Lächerlich. Wie erklärt er das?«
Die vier Ermittler saßen im Schatten einer ausladenden Scharlacheiche neben dem kleinen See des Saint James Parks. Enten schwammen am Ufer vorbei und auch der ein oder andere Schwan. Auf einer karierten Decke stand eine Obstschale, dazu gab es Biskuits und Sandwiches. Auf den ersten Blick wirkte die Szene eher wie ein entspanntes Picknick als eine berufliche Besprechung. Aber der Tag war herrlich sommerlich, so dass die Gentlemen bereitwillig Freddies Vorschlag gefolgt waren, sich im Park zu treffen, anstatt in den Clubräumen. Wohl hauptsächlich deshalb, weil sie versprochen hatte, für einen gefüllten Picknickkorb zu sorgen.
Doktor Pebsworth, der seine Leibesfülle auf einen bedenklich knarzenden Klappstuhl verteilte, weil er sich nicht wie die anderen auf den Boden setzen wollte, schnaubte laut. »In seinem Bericht steht, dass es keine eindeutigen Anzeichen für Mord gibt. Er behauptet, der Tote wäre rauschgiftabhängig gewesen, hatte zudem Alkohol im Blut und sich wahrscheinlich aus Versehen selbst vergiftet.«
»Wie bitte?«
»Seine zweite Theorie lautet, Mister Belami hätte im Alkoholrausch sein Trompetenöl mit Gift verwechselt und sich möglicherweise auf diese Art – Sie ahnen es – irrtümlich ins Jenseits befördert.«
Betretenes Schweigen war die Folge. Normalerweise gab Woodard keine derartigen Abstrusitäten von sich.
»Der Sachverhalt eines Mordes wäre nicht zweifelsfrei gegeben. Sagt er«, schloss Doktor Pebsworth.
Crispin lachte. Er hatte sich auf der Picknickdecke ausgestreckt, rollte auf die Seite und stützte sich auf einen Ellenbogen. »Das ist absurd und alles an den Haaren herbeigezogen. Der Chief Inspector weiß genauso gut wie wir, dass der Trompeter ermordet wurde. Was ist los mit ihm? Ich finde, er sollte sich aufs Altenteil zurückziehen, wenn er seinen Biss verliert. Hat er keinerlei Ermittlungsantrieb mehr?«
»Ja und nein. Der gute Woodard ist schlichtweg überlastet. Er hat mit einer Einbruchserie zu kämpfen, die gerade aus dem Ruder läuft. Viele wohlhabende Londoner haben sich wegen der Hitze auf ihre Landsitze zurückgezogen und in den letzten Wochen wurden mehrere Stadthäuser ausgeraubt. An sich nichts für Scotland Yard, wenn nicht kürzlich ein überraschend nach London zurückgekehrter Adelssproß die Räuber überrascht hätte und ermordet worden wäre. Das schlägt natürlich Wellen und Woodard soll die Täter schleunigst dingfest machen. Alles andere interessiert ihn nicht. Am wenigsten ein toter Amerikaner. Niemand wird protestieren, wenn er den Fall zu den Akten legt.«
»Und Sie sind so gut informiert, Doktor, weil …?«
» … ich Freunde in gewissen Positionen habe, Miss Westbrook.« Er grinste Freddie an und zog ein Stück Papier aus seiner Tasche, auf dem jemand mit Bleistift eng Zeile um Zeile gekritzelt hatte. »Scotland Yard hat einen neuen Pathologen eingestellt, Doktor Haddock. Dessen Mutter ist meine Cousine dritten Grades und der Junge ein sehr fähiger Arzt, der weiß, was er seiner Familie schuldig ist. Daher war er auch so freundlich, mir gewisse Informationen aus dem Autopsiebericht des Toten zukommen zu lassen.«
Nun setzte sich Crispin vollends auf und Freddie schob die Obstschale beiseite, um näher an Doktor Pebsworth zu rutschen. Er hatte ihre volle Aufmerksamkeit. Einzig Lord Philip blieb entspannt sitzen, den Rücken an den dicken Eichenstamm gelehnt, und beobachtete seine Kollegen mit wohlwollendem Gesichtsausdruck.
Um vorlesen zu können, brauchte der Doktor seinen Kneifer, dann strich er den Zettel glatt.
»Carl Belami wurde mit Arsen vergiftet, wie ich es vermutet hatte. Was Woodards Theorie von Abhängigkeit und Unfall eventuell den Rücken stärkt.«
»Ich habe noch nie gehört, dass jemand arsensüchtig ist«, sagte Freddie. Soviel sie wusste, war Arsenik Jahrhunderte lang das Mittel der Wahl für Giftmorde gewesen, weil es nicht nachweisbar war. Erst vor etwa sechzig Jahren hatte ein Chemiker, dessen Namen sie sich nicht gemerkt hatte, eine Nachweisreaktion entwickelt. Weshalb sollte jemand freiwillig das Gift zu sich nehmen?
Doktor Pebsworths Wangen röteten sich. Er war in seinem Element. »Ein wenig bekannter Umstand, aber das gibt es. Vor Jahren hat mir ein Kollege von Arsenessern in abgelegenen Berggebieten des Österreichischen Kaiserreiches berichtet. Dort nehmen die Leute kleine Dosen des Gifts als Aufputsch- und Allheilmittel. Natürlich hat das langfristig verheerende Folgen, aber es gibt nichts, was sich der Mensch nicht zuführt, wenn es einen Rauscheffekt hat.«
»Faszinierend«, bemerkte Crispin.