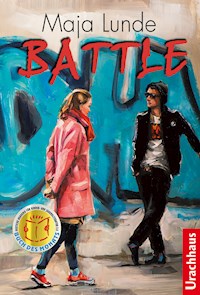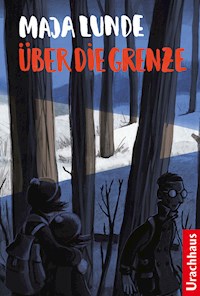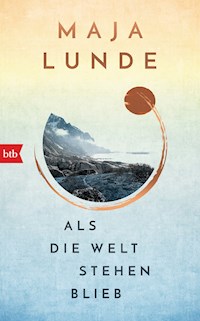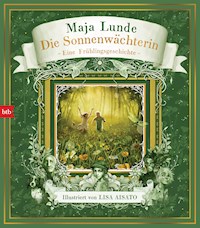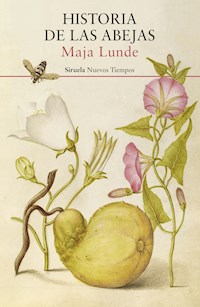10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klima Quartett
- Sprache: Deutsch
Drei Familien, drei Jahrhunderte und der alles entscheidende Kampf gegen das Aussterben der Arten.
Vom St. Petersburg der Zarenzeit über das Deutschland des Zweiten Weltkriegs bis in ein Norwegen der nahen Zukunft erzählt Maja Lunde von drei Familien, dem Schicksal einer seltenen Pferderasse und vom Kampf gegen das Aussterben der Arten. Ein bewegender Roman über Freiheit und Verantwortung, die große Gemeinschaft der Lebewesen und die alles entscheidende Frage: Reicht ein Menschenleben, um die Welt für alle zu verändern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
St. Petersburg, 1881
Dem Zoologen Michail wird der Schädel eines getöteten mongolischen Wildpferdes gebracht. Er kann kaum fassen, was er in den Händen hält: Es könnte der Schädel eines Urpferdes sein, das eigentlich seit Tausenden von Jahren als ausgestorben gilt. Michail plant eine Expedition in die mongolische Steppe, um es zu finden. Ein großes Wagnis, für das er die Hilfe des Abenteurers Wolff benötigt.
Mongolei, 1992
Die Tierärztin Karin reist mit ihrem Sohn Mathias von Berlin in das Naturschutzgebiet Hustai. Mathias möchte mit seinem früheren Leben abschließen und seine Mutter besser kennenlernen. Karin wiederum ist ihrem Ziel ganz nah, eine Herde des fast ausgestorbenen Przewalski-Pferdes in die freie Wildbahn zu entlassen. Seit ihrer Kindheit widmet sie den Pferden ihr Leben. Doch das hat seinen Preis, damals wie heute.
Norwegen, 2064
Der Klimakollaps ist eingetreten, Europa zerfällt. Viele Menschen mussten ihre Heimat verlassen, nur Eva und ihre Tochter Isa leben noch immer auf ihrem Hof. Das Verhältnis ist angespannt: Isa möchte gehen, Eva will bleiben und kämpfen, auch wenn die Nahrung knapp wird. Sie möchte um jeden Preis ihre beiden letzten Wildpferde retten. Bis plötzlich eine fremde Frau Zuflucht auf dem Hof sucht …
Zur Autorin
MAJA LUNDE wurde 1975 in Oslo geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt. Ihr Roman »Die Geschichte der Bienen« wurde mit dem norwegischen Buchhändlerpreis ausgezeichnet und sorgte auch international für Furore. Das Buch wurde in 30 Länder verkauft, stand monatelang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Nach »Die Geschichte der Bienen« und »Die Geschichte des Wassers« ist »Die Letzten ihrer Art« der dritte Teil des großen literarischen Klimaquartetts von Maja Lunde.
MAJA LUNDE
DIE LETZTEN IHRER ART
Roman
Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Przewalskis hest« bei H. Aschehoug & Co., Oslo.
Die Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert. Der Verlag bedankt sich dafür.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS
Published in agreement with Oslo Literary Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Shutterstock/Runrun2; art_of_sun; K Derina
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22509-4V005
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Jesper, Jens und Linus
EVA
Heiane, Akershus, Norwegen 2064
Wie im Rausch trieb es den Hengst zur Stute. Der Instinkt bestimmte ihn durch und durch, machte ihn unberechenbar, wild. Als Mensch würde ich ein solches körperliches Verlangen nie nachvollziehen können. Oder doch, es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich mich unter die Oberfläche ziehen lassen, die Vernunft ignoriert. Aber immer nur kurz, für wenige Sekunden. Das ist lange her, seither konnte ich mir diesen Luxus nie wieder leisten. Das einzige Verlangen, das meine Handlungen jetzt noch beherrscht, ist der Hunger. Der Hunger führt manchmal zu irrationalem Verhalten, erinnert an Wahnsinn, treibt einen Menschen zu Unvorstellbarem.
Mit Argumenten wurde man den Gelüsten der Tiere jedenfalls nicht Herr, und mir blieb nichts anderes übrig, als meine Stute Nike zu beschützen.
Rimfakse ließ nicht von ihr ab, obwohl die Zäune eigentlich ausreichen müssten, um ihn von Nike und ihrem Fohlen Puma fernzuhalten. Ich konnte noch so sehr schreien und gestikulieren, Nikes Brunst lockte ihn auf die Hafenweide. Im vergangenen Herbst hatte Nike ihren Gefährten verloren, den Hengst Hummel. Er war alt und ausgemergelt gewesen, ich hatte ihn aufgeben müssen. Und jetzt war Nike allein. Ich wusste, dass sie keine Ruhe finden würde, ehe sie trächtig war. Diesen Willen konnte ich ihr aber nicht lassen, denn sie war ein Takhi, eines der letzten Wildpferde auf dieser Welt, und Rimfakse nur ein ganz gewöhnliches Hauspferd, das von Richard ausgesetzt worden war, ehe er vor einem Jahr den Nachbarhof verlassen hatte. Nike durfte sich nicht mit einem wie ihm paaren, denn bei solchen Kreuzungen überwogen die Eigenschaften des Hauspferdes, ihre Erblinie würde nach nur zwei Generationen aussterben, und dann wären alle Mühen, sie herzubringen, all die Arbeit, die investiert worden war, damit ihre Art weiterhin auf dieser Erde lebte, vergebens gewesen. Vergebens und wertlos, sie würde ihren Wert verlieren, wenn ich ihm seinen Willen ließe.
»Verschwinde, Rimfakse!«
Der Hengst rieb sich am Zaun, streckte den Kopf nach Nike, versuchte, sie zu erreichen, und die Stute ermunterte ihn, hob ihren Schweif und drehte ihm das Hinterteil zu.
Ich lief näher heran, fuchtelte mit den Armen.
»Hau jetzt ab! Ksch!«
Rimfakse wieherte mich an, drehte sich hin und her und trat auf der Stelle, ehe er mir beleidigt den Rücken zukehrte und davontrabte.
»Vergiss es einfach!«, schrie ich ihm hinterher. »Such dir eine Stute von deinem eigenen Schlag!«
Bald musste ich sie zum Glück nicht mehr auf diese Weise bewachen. Es war schon September, und vor Nike lagen sechs Monate ohne Brunst, sechs Monate Ruhe für sie und mich. Im Winter hatte ich die Kontrolle über das Verhalten der Tiere und über meine eigene Situation. Solange die Speisekammer ausreichend gefüllt war, solange die Winterstürme nicht zu heftig wüteten und solange der Strom nicht ausfiel, war das Leben im Winter übersichtlicher.
Ich ging bis an den Zaun heran, lehnte mich über eine Latte und streckte den Wildpferden die Hände entgegen.
»Guten Morgen, Nike. Hallo, Puma.«
Sie wandten mir die Köpfe zu, sie kannten meine Stimme. Puma war als Erster bei mir. Seine dünnen Beine staksten eifrig über den Boden, er war immer noch neu auf der Welt, bewegte sich ein wenig unsicher und tastend voran. Er schob sein Maul unter dem Zaun hindurch und schnaubte leise.
»Ob ich wohl was für euch habe?«, fragte ich lächelnd. »Glaubst du, ich habe was für euch?«
Ich steckte die Hand in die Tasche.
»Aber nur heute.«
Inzwischen war auch Nike gekommen. Ihre Nüstern weiteten sich, als sie die Karotten entdeckte.
»Bitte schön, mein Kleiner.« Ich gab Puma die erste Karotte. Sie war klein, denn er war noch zu jung und konnte neben der Muttermilch nicht viel andere Nahrung verdauen.
Nike stampfte mit dem Huf.
»Jaja, du bekommst auch was.«
Ich streckte ihr die größte Karotte hin, die blitzschnell und krachend in ihrem Maul verschwand.
»Aber nicht Isa verraten«, sagte ich.
Nike schnaubte und schlug mit dem Schweif.
»Isa ist streng? Ja, meine Tochter ist streng.«
Anschließend blieb ich einen kurzen Moment stehen und betrachte sie einfach nur, ohne dass sie groß Notiz von mir nahmen, dann drehte ich mich um und eilte zurück zum Hof. Heute war Freitag, Einkaufstag. Ich musste zusehen, dass ich zum Hafen kam, denn ab und zu tauchten dort am Kai immer noch Jäger oder Fischer auf. Letzte Woche hatten die Hühner viele Eier gelegt, vielleicht würde jemand Interesse daran haben.
Ich eilte am geschlossenen Kiosk vorbei, wo die Scheiben eingeschlagen und die Werbeplakate verblichen waren, stapfte den Hang hinauf und um die Gehege herum, in denen früher Katzen aller Arten untergebracht gewesen waren, vorbei an dem kleinen Sumpfgebiet, das mein Großvater einst für die bedrohten Amphibien angelegt hatte, und an dem eingezäunten Waldstück, in dem sich noch vor kurzem die Wölfe versteckt hatten, die scheuste unserer Tierarten.
Die Tiere hatten es immer gut bei uns gehabt, über alle drei Generationen hinweg, in denen meine Familie den Park betrieben hatte, und sie hatten es uns gezeigt, indem sie sich vermehrten. Die Besucher waren gekommen, um sich zu amüsieren und um etwas zu lernen, aber den Höhepunkt bildeten die Tierjungen. Dann jauchzten und lachten sie, streckten die Finger aus und riefen guck mal, guck mal, wie süß! Einmal bekam die Schneeleopardin Drillinge, ein historisches Ereignis. Wir hatten nie so viele Besucher empfangen wie in diesem Sommer.Für uns war neues Leben ein sehr ernstes Thema. Ich erinnere mich, dass uns die anderen Kinder in der Schule seltsam fanden und wir uns schämten, wenn sie uns besuchten. Denn Themen wie Paarung und Trächtigkeit wurden bei uns täglich am Esstisch besprochen. Und wenn diese kleinen neuen Wesen auf die Welt kamen, umhegten wir sie wie unsere eigenen Kinder … Sie waren unsere eigenen Kinder. Nein, nicht unsere, sie sind ihre eigenen Kinder, sagte mein Vater immer, unsere Aufgabe besteht lediglich darin, dafür zu sorgen, dass sie ein möglichst gutes Leben haben und deshalb neues Leben zeugen wollen.
Jetzt waren die Schneeleoparden weg, genau wie die meisten anderen Tiere. Nur einige wenige waren mir geblieben. Eine Herde Waldrentiere existierte noch in dem großen alten Gebiet, in dem früher auch die Wölfe gelebt hatten. Die Rentiere zählten zwar nicht zu den bedrohten Arten, aber sie kamen dort unten größtenteils allein zurecht, deshalb hatte ich sie noch nicht freilassen müssen. Auch zwei zerrupfte Wanderfalkenweibchen hielt ich nach wie vor in einer Voliere. Sie waren anspruchslos in der Pflege, aber ich fürchtete, sie würden noch am selben Tag sterben, ab dem ich sie nicht mehr versorgen konnte. Eine einzelne schottische Wildkatze wohnte allein im Westen des Parks, doch ich brachte es nicht über mich, sie laufen zu lassen, denn dann würde sie sich nur mit einer Hauskatze paaren und aussterben. Und natürlich Nike und Puma, mein wertvollster Besitz. Ich beschützte sie mit aller Kraft.
Meine Schwester Anne hatte sich damals dafür eingesetzt, dass wir Wildpferde bekamen, schon als Kind hatte sie von nichts anderem gesprochen. Ich erinnerte mich daran, wie sie immer wieder dieselben Filme auf YouTube gesehen hatte, ganz in ihrer eigenen Welt versunken, mit dem iPad auf dem Schoß und ihren Kopfhörern auf den Ohren, während die Pferde über den Bildschirm galoppierten. Sie hatte so viel Zeit darin investiert, einen Hengst und eine Stute aus einem Naturschutzgebiet in Frankreich zu kaufen und einem internationalen Zuchtprogramm beizutreten. Nike und Hummel gehörten zu den letzten Pferden, die noch unter Tierparks verkauft worden waren. Pferde wie Rimfakse würden immer überleben, aber von den Wildpferden gab es inzwischen viel zu wenige. Ich hoffte jedoch, wenn all das überstanden wäre, wenn sich das Leben wieder stabilisierte und es erneut möglich war, mit den Kooperationspartnern dort draußen in Verbindung zu treten, würde es auch möglich sein, einen neuen Hengst für Nike anzuschaffen. Denn in der Mongolei gab es vielleicht nach wie vor Wildpferde. Es hatte schließlich so viele gegeben. Einige von ihnen mussten doch noch existieren.
Nike und Puma waren nach Sportschuhen benannt. Anne hatte sie so getauft, wie all unsere Tiere. Sie hießen wie ausgestorbene Markenprodukte, Kleidung, Elektronik, Uhren und Autos. Isa fand das lustig, sie konnte immer noch über die Namen lachen. Mich selbst erinnerten sie viel zu oft an Anne. Ich vermisste sie. Nicht nur ihren Humor, sondern auch ihren Tatendrang. Und ihre Nähe, vielleicht hingen die beiden Eigenschaften zusammen. Sie war vielseitig, und sie schaffte eine Menge.
Doch Anne war weg, samt ihrer kräftigen Stimme und ihrem Körper, der immer in Bewegung gewesen war. Sie hatte Heiane verlassen, hatte uns verlassen und ihre Pferde. Sie hatte gesagt, es wäre nur für ein paar Monate, aber sie war nie zurückgekehrt. Als ich das letzte Mal mit ihr sprach, war sie bereits bis Nordland gekommen. Das war fast ein Jahr her. Seither funktionierte das Telefon nicht mehr. Die Verbindung war abgebrochen, und wir waren wirklich allein. Ich fing an, jeden Abend die Tür abzuschließen. Hier sind wir sicher, versicherte ich und montierte von innen einen Riegel.
»Wann kommst du wieder?«, fragte Isa.
Ich stand neben dem Auto, um zum Kai zu fahren.
»Du weißt, dass ich das nicht sagen kann. Vielleicht ist heute niemand da, der etwas anzubieten hat. Letztes Mal musste ich mehrere Stunden warten.«
»Kann ich denn nicht mitkommen? Die Kühe können wir auch später zusammen versorgen, wenn wir wieder da sind.«
»Aber es ist besser, wenn du hier bleibst.«
»Allein.« Sie erschauderte. »Kannst du mir nicht bald das Fahren beibringen?«
»Du bist erst vierzehn, Isa.«
»Wer sollte uns hier schon anhalten.«
Ich nutzte die Gelegenheit, um die Hand auszustrecken und ihr durch den Pony zu zausen.
»Ich werde mich beeilen.«
Sie entzog sich meiner Liebkosung.
»Wenn Fremde kommen, schließt du dich ein. Denk dran, auch den Riegel vorzuschieben.«
»Ja doch.«
»Und tu so, als wärst du nicht zu Hause.«
»Ich weiß, Mama.«
»Und noch was: Könntest du bitte kontrollieren, ob die Kellertür auch wirklich geschlossen ist? Ich möchte nicht, dass es reinregnet.«
»Ja.«
»Mach’s gut, mein Kind.«
Ich drückte sie kurz an mich, und sie erwiderte die Umarmung. Freitag war der einzige Tag, an dem sie das tat. Mittlerweile war sie genauso groß wie ich und hatte Pickel auf der Stirn, aber ihre Wangen waren noch kindlich und glatt. Für mich war Isa immer noch ein Kind, und wenn ich sie dann sah, erschrak ich jedes Mal. Sie war lang, dünn und ungelenk. Kleine Brüste unter dem T-Shirt. Hohe, markante Wangenknochen. Vor nur einem Jahr war sie noch so klein gewesen. Jetzt bewegte sie sich ein wenig federnd, selbstbewusst und bedacht, als würde sie sich präsentieren, als gäbe es hier jemanden, dem sie sich zeigen könnte. Ich überlegte, ob ich von jetzt an immer erschrecken würde. Ob ich immer überrascht sein würde, mein Kind zu sehen, und ob es allen Eltern so ging.
Isa ließ mich abrupt los, ihr war wieder eingefallen, dass sie zu alt war, um mich so zu umarmen. Wir verstummten, sie sah beschämt weg.
»Du denkst an die Kellertür, ja?«, fragte ich, um ihr zu helfen.
»Ja«, sagte sie. »Und jetzt fahr endlich.«
Ich setzte mich ins Auto und startete es. Der Himmel verdunkelte sich, und die ersten Tropfen prasselten hart gegen die Windschutzscheibe. Isa blieb trotzdem auf dem Hofplatz stehen, ich konnte sie im Rückspiegel erkennen. Wenn ich die Augen zusammenkniff, sah sie immer noch aus wie sieben oder acht, sie stand da wie früher, die Füße leicht nach außen gedreht und mit verschränkten Armen. Ich musste schlucken und konzentrierte mich auf die Straße.
Nachdem ich ein Stück die Hauptstraße entlanggefahren war, ohne einen Menschen zu sehen, tauchte plötzlich auf der linken Seite eine kleine Gruppe auf. Mutter, Vater, zwei Töchter. Sie trugen jeweils einen Rucksack auf dem Rücken und zogen einen mit Gepäck vollbeladenen Fahrradanhänger mit neongelbem Schriftzug hinter sich her. Der Regen triefte von ihnen herab, die Gesichter waren unter großen Kapuzen verborgen, ihre Kleidung dunkel vor Nässe. Nur die Aufschrift des Anhängers leuchtete unbeirrbar, Sport Extreme. Der Vater reckte einen Daumen in die Luft, als er mich sah, einen weißen, einsamen Finger, der von einer mageren Hand abstand, das universelle Zeichen dafür, dass man einer von ihnen war, ein Wanderer.
Ich trat aufs Gaspedal, fuhr so schnell an ihnen vorbei, wie ich konnte, und mied einen Blick in den Rückspiegel, um ihre Reaktion nicht mitansehen zu müssen.
Isa bedrängte mich immer, auch aufzubrechen, so zu leben wie sie, auf der Straße. Heiane zu verlassen und gen Norden zu wandern, wie alle anderen, auf der Suche nach den kleinen Dörfern, die es dort nach wie vor gab, auf der Suche nach einer menschlichen Gemeinschaft, in der das Leben jenem glich, das wir früher geführt hatten. Ganz Europa ging, ohne Richtung, ohne Ziel. Schon seit vielen Jahren wanderten die Menschen, die Dürre hatte sie zur Flucht gezwungen. Schon in meiner Jugend waren im Norden alle Grenzen geschlossen worden. Dann folgte der Kollaps, und der Krieg. Sieben Jahre hielt er an. Die Menschen kämpften um Nahrung und Wasser. Anstatt ihre Kräfte zu sparen und sich auf das vorzubereiten, was unweigerlich bevorstand, setzten sie alles daran, zu siegen. Doch niemand siegte. Alle verloren. Anschließend kämpfte auch niemand mehr, denn das, wofür man gekämpft hatte, war weg. Selbst die Grenzen waren verschwunden.
Wir hatten Glück, hier zu wohnen. Wir hatten Glück, immer weit vom Krieg entfernt gewesen zu sein und einen Brunnen voller Wasser zu haben. Einen Hof, ein Zuhause, etwas zum Anbauen, Tiere für die Zucht. Solange wir den Hof hatten, mussten wir nicht wandern. Daran hätte man eigentlich nicht zweifeln dürfen. Dass Anne gegangen war, hatte jedoch etwas verändert, und als kurz darauf auch noch Richard und seine Familie aufbrachen und damit auch Isas einzige Freunde Agnes und Lars verschwanden, begann sie, mich zu bedrängen. Sie verstand nicht, warum wir immer noch hier lebten, und fing immer wieder davon an. Unsere Vorräte behielt sie genau im Auge, ständig sprach sie darüber, dass sie zur Neige gingen und dass uns die Tiere weniger gaben als früher, weil sie älter wurden, die Kühe und die Hühner und auch Boeing, das Schwein, das wir eigentlich schon letztes Jahr an Weihnachten hatten schlachten wollen. Richard und seine Familie waren nach Norden gegangen. Sie behaupteten, in der Nähe von Bodø hätten sie Verwandte, die dort immer noch ein gutes Leben führten. Es gebe genug Fische im Meer, um über die Runden zu kommen, und die Gemeinschaft erinnere an ein kleines Dorf. Dorthin wolle sie auch gehen, sagte Isa mitunter, wenn ich sie fragte, wie ihr Plan denn genau aussehe. Als ob es uns gelingen könnte, dorthin zu kommen, als ob es ausgerechnet diese kleine Dorfgemeinschaft weiterhin gab, obwohl sich alle anderen längst aufgelöst hatten. Wenn wir aufbrächen, würde die Landstraße zu unserem Zuhause werden … Außerdem vergaß Isa die Tiere. Es war schließlich nicht so, dass sie nur für uns da waren. Wir waren genauso sehr für sie da. Die wenigen Tiere, die noch in unserem Park übrig waren, brauchten mich. Vor allem Puma. Wir konnten das Fohlen nicht zurücklassen, vor allem jetzt nicht, da das Gras welkte und ein Hauch von Fäulnis in der Luft hing.
Schon vor mehreren Jahren war der Laden geschlossen worden. Schon vor mehreren Jahren hatte ich aufgehört, Geld auszugeben. Meistens bezahlte ich mit Milch und Eiern, davon hatten wir das ganze Jahr über genug. Im Sommer und Herbst ernteten wir auch Mais, anderes Gemüse und Obst, aber in dieser Saison hatte der Regen vieles zerstört. Das Gemüse und das Obst, das wir anbauten, behielten wir selbst. Es war sehr wertvoll, denn die Blüten mussten von Hand bestäubt werden. Noch gab es ein paar wilde Insekten, die uns dabei halfen, aber die Bienenstöcke hatte ich längst aufgegeben. Jetzt standen die Beuten im Schuppen und verströmten noch immer einen süßlichen Geruch von Honig und Wachs, der in dem gesamten großen Raum schwach präsent war. Manchmal ging ich in die Ecke, wo die Beuten standen, sog die Luft durch die Nase ein und spürte, wie mich der Duft erfüllte, und gleichzeitig erstaunte es mich, wie lange er sich hielt, dieser Duft, der mich an all das erinnerte, was ich verloren hatte.
Meistens tauschte ich meine Waren gegen Fleisch oder Fisch. Proteine für Isa. Manchmal kamen Jäger an den Kai. Sie hatten Wild aus dem Wald dabei, Eichhörnchen, Wildschweine und Füchse, aber auch entlaufene Haustiere, wilde Hunde und Katzen. Und Elstern, erlegte Elstern gab es immer.
In den ersten Jahren nach dem Kollaps hatten die Leute prophezeit, alle Tiere würden sterben, weil das Ökosystem aus dem Gleichgewicht geraten sei. Wenn ein Element daraus fehlte, würde alles verschwinden. Sie vergaßen jedoch, dass es immer Arten gibt, die übernehmen, die den Platz ausfüllen, die sich anpassen. Und sie vergaßen, dass wir, die Menschen, dann weniger Raum brauchen würden.
Den anpassungsfähigen Arten ging es besser als je zuvor.
Nicht alle Vogelarten konnten ohne Insekten leben. Allesfresser wie Krähen und Elstern vermehrten sich jedoch. Sie fraßen das, was ihnen in den Weg kam, Nüsse, Kompost, kleinere Vögel, Aas, Nacktschnecken, Würmer, die Eier anderer Vögel, sie waren nicht wählerisch, ließen sich überall nieder, fütterten Nester voller kreischender Jungen. Sie wurden größer und größer, schwebten am Himmel entlang, krächzten mit ihren heiseren Stimmen, waren stets über uns, als würden sie die Welt beherrschen.
Der Regen nahm jetzt zu. Der Himmel kam näher, ein riesiger, bedrohlicher Körper, der sich auf die Landschaft herabsenkte. Die Tropfen prasselten laut auf das Autodach und die Ladefläche. Während der vorige Sommer so trocken und heiß gewesen war, dass nichts mehr wuchs, und ich immerzu Brände befürchtet hatte, war die Sonne dieses Jahr so gut wie verschwunden. Ich trug immerzu Regenjacke, Regenhose und Stiefel, fühlte mich nicht durchnässt, aber klamm, die Feuchtigkeit kroch überall herein. Als ich ein Kind war, hatten wir zwischen Regen und Trockenheit unterschieden, jetzt unterschieden wir nur noch zwischen den verschiedenen Arten von Niederschlag. Der leichteste lag wie ein Nebel in der Luft, man nahm ihn nicht wahr, ehe man mit einem Mal bemerkte, wie die Feuchtigkeit von der Jacke abperlte. Dann gab es Niesel- und Sprühregen, was ich für ein und dasselbe hielt, aber Isa beharrte darauf, dass Nieselregen leichter sei. Und der Landregen, dieser trostlose Niederschlag, der an windstillen Tagen senkrecht von oben herabfiel, ohne große Dramatik oder Aufdringlichkeit, abgesehen davon, dass er aus Wasser bestand. Der peitschende Regen, der vom Wind in Bewegung gesetzt wurde. Und der intensive Sturzregen, bei dem der Himmel all seine Schleusen öffnete, die Welt in ein Meer verwandelte, und ich nicht anders konnte, als an Noah zu denken.
Als ich vom Hof fuhr, pladderte noch der gleichmäßige Landregen, doch kaum war ich beim Kai angekommen, verdunkelte sich der Himmel, und mir wurde klar, dass er an Stärke zunehmen würde. Die letzten heftigen Regenfälle waren mehrere Wochen her, aber der Boden war immer noch von Feuchtigkeit gesättigt. Das Wasser konnte nicht mehr versickern, und ich dachte an den Keller, stellte mir vor, wie das Wasser eindringen, wie es den Boden bedecken und ansteigen würde.
Hoffentlich hatte Isa daran gedacht, die Kellertür zu schließen. Die Außentreppe verwandelte sich in einen Sturzbach, wenn es viel regnete, und wenn die Tür offen stand, war der Schaden noch größer. Wir lagerten unser Mehl dort unten, im Sommer hatte ich mir zweihundert Kilo Vollkornmehl ertauscht, und unser Gemüse, obwohl die Ernte nach dem verregneten Sommer geringer ausgefallen war als erhofft, und außerdem zehn Kilo Reis, den ich vor ein paar Wochen glücklicherweise ergattert hatte. Seit dem letzten Sturzregen hatte ich die Säcke weit oben platziert, aber vielleicht nicht weit genug.
Heiane war 1500 Jahre lang ein Handelsplatz gewesen, wir waren immer stolz auf unsere Geschichte, hatten sogar ein kleines Museum, in dem Besucher alten Schmuck und Werkzeug aus jener Zeit bestaunen konnten, als sich die Wikinger hier trafen und ihre Waren tauschten. Inzwischen war der Schmuck längst aus dem Museum gestohlen worden, und alle anderen sichtbaren Spuren unserer Geschichte waren ebenfalls aus dem Ort verschwunden. Heiane bestand nur noch aus einer Ansammlung von Häusern und Ferienhütten am Kai, außerdem erstreckte sich die Bebauung einige sanfte Hügel hinauf. Einst waren die Häuser rot und weiß gewesen, jetzt blätterte der Anstrich ab, und sie hatten unterschiedliche Schattierungen, wie Batik. Nur wenige waren noch bewohnt, immer mehr Menschen zogen weg; alle, die ich gekannt hatte, waren schon lange nicht mehr da. Alle bis auf Einar. Er hauste mit seinen Freunden in einem der ehemals schönsten Gebäude der Stadt, einem alten Fischerhaus mit einem großen Wintergarten, doch jetzt war die Farbe abgeplatzt und die Panoramascheiben geborsten. Für diese Lage, direkt am Meer, hätte man früher mehrere Millionen Kronen ausgegeben. Zuletzt war das Wasser jedoch immer näher gerückt, nachdem der Meeresspiegel nahezu unbemerkt gestiegen war, ein paar Millimeter jedes Jahr. Vor dem Haus konnte ich niemanden sehen, und es brannte auch kein Licht. Solange ich Einar aus dem Weg gehen konnte, war alles in Ordnung. Ich fürchtete auch die Wanderer und den verzweifelten Hunger, der sie antrieb, doch bislang hatte niemand unseren Hof gefunden, und niemand kam auf die Idee, dass der beinahe zugewachsene Kiesweg tatsächlich irgendwo hinführte, zu irgendwem, und deshalb sah ich lediglich Einars verlebtes, grobes Gesicht vor meinem inneren Auge, wenn ich abends die Tür verriegelte.
Ich fuhr bis zur See hinab und parkte nur ein paar Meter vom Kai entfernt, blieb einen Moment im Auto sitzen und sah mich um. Im letzten halben Jahr waren freitags immer weniger Menschen hergekommen. Manchmal tauchte überhaupt keiner auf. Auch heute wirkte der Kai nahezu verlassen, lediglich ein fremder Fischer saß dort allein in seinem Boot. Ein Mann, es waren immer Männer ohne Begleitung. Da ich außer ihm niemanden sehen konnte, stieg ich trotzdem aus, nahm meinen Korb und wagte mich zu ihm.
Aus einer rissigen Styroporkiste starrte mich ein einsamer Dorsch an, er wog höchstens ein paar hundert Gramm, für Isa und mich war er aber groß genug. Ich sagte, ich wolle ihn kaufen, und bot ihm im Gegenzug drei Eier an, die ich dabeihatte.
»Vier«, entgegnete er.
»Drei«, hielt ich dagegen. »Das ist alles, was ich habe.«
»Der Dorsch ist mehr wert als drei, das wissen Sie.«
»Ich nehme stark an, dass Sie keinen Fisch mehr sehen können. Und ich nehme an, dass Sie große Lust auf Eier haben.«
Er starrte mich an, seine Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Ich hätte noch ein paar Möwen anzubieten«, sagte er schließlich. »Von denen könnten Sie eine haben für Ihre Eier.«
Er deutete auf das Deck seines Schiffes. Dort lagen zwei tote Vögel, die er geschossen hatte, beide blutig. Einige ihrer Verwandten schwebten am Himmel entlang und zogen Kreise über dem Boot, als seien sie über die Morde entrüstet.
»Wir essen keine Möwen«, erwiderte ich. »Es gibt nicht mehr genug von ihnen. Sie müssen aufhören, sie zu jagen. Außerdem schmecken sie schrecklich.«
»Man muss sie nur ordentlich würzen, um den Trangeschmack zu übertünchen.«
»Ich hätte aber lieber Ihren Fisch.«
»Das verstehe ich gut. Er ist ganz frisch, ich habe ihn heute erst gefangen. Frisch und sauber.«
»Sauber ist der nicht, das wissen Sie genauso gut wie ich. Ich gebe Ihnen drei Eier dafür.«
»Ich will aber vier haben.«
»Hören Sie mal«, begann ich. »Ich habe eine Tochter, die noch im Wachstum ist. Wir brauchen unsere Eier selbst.«
»Und ich habe zwei Söhne«, entgegnete er. »Zwillinge, sie sind acht. Ich sehe sie nur selten, weil ich die ganze Woche draußen auf dem Wasser bin … und jetzt sind die Fischbestände so stark zurückgegangen, dass ich bald auch am Wochenende rausfahren muss.«
»Ich habe auch noch einen Sohn«, behauptete ich. »Und einen Mann. Wir müssen uns diesen Fisch zu viert teilen.«
Ich spürte, wie ein paar Tropfen meinen Hals hinabrannen, ob Wasser oder Schweiß, konnte ich nicht sagen. Ich wollte nur noch nach Hause, mir die Regensachen herunterreißen, den Fisch braten und ihn mit Isa teilen, ordentlich satt werden.
»Drei Eier«, versuchte ich es ein letztes Mal. »Bitte, das ist alles, was ich habe.«
Ich führte die Hand zum Hals, um die Tropfen wegzuwischen, und vielleicht war es diese Bewegung, die seine Aufmerksamkeit auf meinen Körper lenkte, seinen Blick an mir entlangwandern ließ. Nach unten, über die Brüste, die Hüften, alles, was unter dem unförmigen Regenzeug versteckt war.
»Wie alt sind Sie?«, fragte er mit einem neuen Unterton.
Also war er einer von denen. Ich bereute meine Geste, dass ich es nicht geschafft hatte, vollkommen stillzustehen.
»Zu alt für Sie«, erwiderte ich.
Ich versuchte mich aufzurichten, den Rücken zu strecken.
»Sie können den Fisch umsonst haben«, bot er an. »In meiner Kajüte ist es warm.«
Er musterte mich weiter, ich starrte zurück und zwang ihn, mir in die Augen zu sehen. Ich bin nicht diejenige, die hier etwas bereuen muss, die sich schämen muss, dachte ich, sondern du. Die Tropfen rannen weiter nach unten, über mein Schlüsselbein, zwischen die Brüste, mein feuchter Wollpullover kratzte auf der Haut, und ich stand reglos da.
Endlich schlug er seinen Blick nieder und wand sich ein wenig peinlich berührt. Davon ermutigt, zog ich eine alte Zeitung aus dem Korb und schnappte mir den Fisch, um ihn einzuwickeln.
»Ich nehme den hier. Als Bezahlung für Ihre Dummheit.«
Ich spürte seine Verwunderung, sah ihn jedoch nicht an, sondern packte nur so schnell wie möglich den Fisch ein. Er war glitschig und ließ sich nur schwer in das Papier einschlagen. Ich hatte Schleim und Blut an den Fingern, und vielleicht auch an der Stirn, nachdem ich mir mit der Hand darübergefahren war.
»In Ordnung«, antwortete er. »Entschuldigung.«
»Das können Sie sich sparen«, erwiderte ich.
»Ich weiß nicht, warum ich das vorgeschlagen habe«, sagte er. »Ich hatte gehört, dass andere es machen … und da dachte ich …«
»Tun Sie das nicht wieder«, sagte ich. »Schlagen Sie das nie wieder vor. Niemandem.«
»Nein, nein«, murmelte er. »Das habe ich schon verstanden.«
Dass er überhaupt Lust bekommen hatte. Ich wusste, wie ich aussah. Das feuchte Haar klebte an meinem Kopf, meine Haut war in den letzten Jahren fahl geworden, mein Gesicht eckig, der Kiefer trat so stark hervor, dass ich einem Tier glich, einem Luchs, bei dem die Kaumuskulatur am stärksten ausgeprägt war. Ein alterndes Tier, denn ich hatte mir schon lange nicht mehr die Haare gefärbt, seit es keine Haarfarbe mehr gab, und immer mehr stahlgraue Strähnen kamen zum Vorschein. Vermutlich sah ich älter aus als dreiundvierzig. Ich hatte keine Lust mehr, mich im Spiegel anzusehen.
Wieder strich ich mir mit den Fingern über die Stirn, wollte das Blut wegwischen, das dort möglicherweise klebte. Dann trat ich einen Schritt von ihm weg, wollte gehen.
»Aber die Eier hätte ich trotzdem gern«, sagte er.
»Ja, das kann ich mir denken.«
Ich steckte die Hand in meinen Korb und holte drei Eier hervor, zwei braune und ein weißes. Ich versuchte, nicht an seine achtjährigen Söhne zu denken, und ob es sie überhaupt gab, war ja ohnehin nicht sicher. Vielleicht hatte er das lediglich behauptet, genau wie ich einen Mann und ein weiteres Kind erlogen hatte.
Behutsam nahm er die Eier. Drei Eier gegen einen Fisch. Ich hatte gewonnen, denn der Fisch war vier Eier wert. Mindestens. Er hatte mir etwas stehlen wollen, aber am Ende war ich diejenige, die ihn bestahl.
Ich wandte mich von ihm ab, ein bisschen schamerfüllt und gleichzeitig immer noch wütend. Ich musste gehen, weg von ihm, nach Hause zu Isa.
In dem Moment sah ich sie.
Eine Frau, die allein an der Bushaltestelle stand. Eine Wanderin.
Sie trug einen kleinen Rucksack, ihr einziges Gepäck. Und hielt einen Regenschirm.
Einen Regenschirm. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal jemanden mit Regenschirm gesehen hatte.
Das Wasser strömte daran herab, und der Wind erfasste den Regen und wehte unter ihr kleines, schwarzes Schutzdach. Doch das spielte wohl keine Rolle, denn sie war bereits triefnass, ihre Jeans waren dunkel, und es tropfte von den Riemen ihres Rucksacks herab.
Ich legte den Fisch in meinen Korb und ging zum Auto. Weder war ich für die Söhne des Fischers verantwortlich noch für die Frau mit dem Schirm.
Trotzdem konnte ich nicht anders, als mich noch einmal umzudrehen, ein letztes Mal nach ihr zu sehen.
In der Windstille zwischen zwei Böen entspannte sie sich.
Sie stand mit geradem Rücken da und wartete, obwohl der Fahrplan längst heruntergerissen worden war und hier ganz eindeutig kein Bus mehr fuhr.
Der Fischer war inzwischen dabei, sein Boot loszumachen. Er würde sie nicht anrühren. Doch es gab andere. Einar und seine Kumpel, ihre schmutzigen Hände und die Aggression, die entstand, wenn Hunger und zu viel Alkohol und Drogen aufeinandertrafen. Sie waren dumm, sie waren lächerlich, aber sie waren stärker als eine Frau.
Der Regen wurde wieder intensiver. Auch der Wind frischte auf und wehte das Wasser unter ihren Schirm.
Ich dachte erneut an die Kellertür, Isa hatte sie bestimmt vergessen.
Unsere Vorräte konnten beschädigt werden.
Ich wollte die Autotür öffnen. Die Frau stand vielleicht zehn Meter von mir entfernt, und jetzt sah sie mich auch an. Ihr Gesicht lag halb unter dem Schirm verborgen, aber ich konnte sie trotzdem gut erkennen. Ihre Miene war unbeweglich, sie musterte mich mit einem Blick, vor dem ich mich nicht verstecken konnte.
Der Gestank des Fischs stieg aus meinem Korb auf. Ich hatte ihn mir für drei Eier genommen, obwohl er mindestens vier wert war.
Ich hob die Hand. Sie stank ebenfalls nach dem Blut und dem Schleim des Fischs, bestimmt hatte ich Blutflecken im Gesicht.
»Brauchst du Hilfe?«
»Nein«, antwortete die Frau.
Ihre Reaktion kam so schnell, dass ich ihr nicht glaubte.
»Nein, na dann«, sagte ich. »Wo willst du hin?«
Sie zuckte die Achseln. »Nach Norden.«
»Der Bus fährt nicht.«
»Ich weiß.«
»Schon seit Jahren nicht mehr.«
»Ja.«
»Wo kommst du her?«
»Aus dem Süden.«
»Bist du per Anhalter gefahren, mit dem Boot?«
»Ja, per Anhalter. Mit dem Auto, einem Trailer, noch einem Auto, einem Boot, einem Auto, noch einem Boot. Wahrscheinlich sogar mehr. Vielleicht habe ich etwas vergessen. Ich erinnere mich nicht genau.«
»Und jetzt?«
Sie verzog das Gesicht. »Habe ich doch gesagt, nach Norden. Wenn ich hier warte, nimmt mich vielleicht jemand mit.«
»Du solltest lieber zur Hauptstraße gehen«, riet ich. »Hier unten kommt niemand vorbei.«
»Okay«, erwiderte sie. »Danke.«
Ich öffnete die Tür des Pick-ups. Sie blieb stehen. Mir fiel auf, wie klein und dünn sie war. Sie bewegte sich leicht von einer Seite zur anderen, selbst wenn sie stand. Und sie war nicht viel größer als Isa. Doch obwohl sie klein war, oder vielleicht gerade deswegen, waren ihre Wangen rund. Vielleicht brauchte sie nicht so viel Essen, um ihr Gewicht zu halten, oder vielleicht war sie besser als die meisten anderen darin, es sich zu beschaffen. Zudem war sie ja ganz offensichtlich allein, sie hatte niemanden bei sich, dem sie die besten oder fettesten Bissen zuschieben musste. Ihre Augen waren ebenfalls rund, ein wenig aufgesperrt, auf der Hut, als würde ihr nichts entgehen.
Ich setzte mich hinters Steuer, startete den Wagen und fuhr langsam los. Die Ladeanzeige stand fast auf Null, ich schaltete weder Lüftung noch Scheibenwischer ein und hoffte, die Batterie würde noch bis nach Hause reichen.
Als ich in den Rückspiegel sah, hatte sie sich ebenfalls in Bewegung gesetzt. Diese dünne Frauengestalt, allein auf der Straße.
Sie ist nicht dein Problem.
Ein ganzer Fisch für drei Eier.
Wir brauchten diesen Fisch. Isa brauchte ihn. Und außerdem … eine Wanderin, denen konnte man nicht vertrauen.
Aber eine einsame Frau, so leicht zu packen, festzuhalten, zu überwältigen.
Ich bremste und öffnete die Tür.
»Spring rein«, rief ich. »Hier ist es warm und trocken.«
Sie schielte zum Beifahrersitz, als würde sie sich nach der Wärme des Autos sehnen.
»Nein, ich brauche keine Hilfe«, antwortete sie.
»Trotzdem, spring rein.«
Die Frau zögerte. Inzwischen regnete es noch stärker, die Tropfen prasselten auf ihren Schirm, es sah aus, als würde er bald unter dem Gewicht zerreißen, als würden die Nähte des dünnen Stoffes platzen. Sie zitterte vor Kälte.
»Nein, ich muss weiter«, sagte sie. »Ich brauche keine Hilfe.«
Sie hob den Kopf und versuchte, stark auszusehen, aber ihre kieksende Stimme verriet sie. Sie brauchte Hilfe, wollte es aber nicht zugeben, vielleicht nicht einmal vor sich selbst.
»Vielleicht brauche ich Hilfe«, entgegnete ich.
Sie wand sich ein wenig, der Regenschirm zitterte schwach in ihrer Hand, ließ kleine Bäche auf den Boden rinnen. Sie sah mich an, das Auto.
»Bist du allein?«, fragte sie.
»Ja, ich wohne allein mit meiner Tochter.«
Sie nickte.
»Vielleicht könnte ich eine Nacht bleiben«, sagte sie dann. »Nur bis meine Klamotten wieder trocken sind.«
»Wir haben ein freies Bett für eine Nacht«, erklärte ich. »Und Eier und Milch.«
»Danke«, erwiderte sie leise und stieg ein.
ISA
Lieber Lars,
immer wenn ich einen neuen Brief in deinen Briefkasten werfe, versuche ich zu hören, wie er darin aufkommt, ob er auf dem leeren Metallboden landet oder auf anderen Briefen. Mittlerweile höre ich das Geräusch von Metall gar nicht mehr.
Gestern habe ich eine Haarnadel mitgenommen und sie ins Schloss gesteckt. Ich habe es lange versucht, und ein paar Mal hatte ich das Gefühl, ich hätte es fast geschafft, das Schloss würde gleich nachgeben, aber am Ende gelang es mir doch nicht. Wahrscheinlich ist es auch besser so. Eigentlich will ich gar nicht sehen, wie viele Briefe ich dir schon geschrieben habe.
Wenn ich Internet hätte, könnte ich dir einfach eine Nachricht schicken, und du würdest sie sofort lesen. Und ein Foto von mir könnte ich auch schicken. Ich habe mich verändert, seit du weggegangen bist. Mein Gesicht ist schmaler geworden. Inzwischen bin ich genauso groß wie meine Mutter. Und ich habe Brüste, und zwar richtige, nicht so wie die, die du damals angefasst hast.
Ich denke daran, wenn ich aufwache, ich denke daran, wenn ich einschlafe. Wir stehen ganz hinten im Stall, du schiebst deine Hand unter meinen Pullover und streichelst meinen Bauch. Dann führst du sie weiter nach oben. Erst liegt sie nur reglos dort, und ich sage nichts, aber ich möchte, dass du sie hin- und herbewegst, mich streichelst. Und gleichzeitig wünschte ich, du würdest sie wegnehmen. Wir haben uns ja noch nicht mal geküsst, und es ist falsch, dass du mir an die Brüste greifst, obwohl wir uns noch gar nicht geküsst haben. Ich winde mich. Weißt du das noch, wie ich mich gewunden habe? Ich habe viel darüber gegrübelt, was du damals gedacht hast, ob du angenommen hast, es würde bedeuten, dass du weitermachen sollst. Oder aufhören. Oder ob du überhaupt nicht darüber nachgedacht hast, was ich wollte. Dann kam meine Mutter, und du bist abgehauen.
Ich weiß, wie sich eine Jungenhand auf den Brüsten anfühlt, aber ich weiß nicht, wie es ist, sich zu küssen. Und meine Voraussetzungen dafür, es herauszufinden, sind leider nicht gerade ideal.
Tiermütter lecken ihre Jungen rein. Wenn Menschenmütter ihre Kinder küssen, ist das also eigentlich ein misslungener Versuch, sie zu säubern. Für das richtige Knutschen gibt es dagegen keinen eindeutigen Grund. Das machen nur die wenigsten Tiere. Die früheren Jäger und Sammler haben sich auch nicht geküsst. Ich habe gelesen, dass bei einem Zungenkuss achtzig Millionen Bakterien von einem Mund zum anderen übertragen werden. Anscheinend ist das also eine ziemlich sinnlose Bakterienparty, mit der wir erst in der neueren Zeit angefangen haben.
Meine Mutter hat schon mal jemanden geküsst, aber ich kann sie auf keinen Fall fragen, wie das ist und ob es sich überhaupt lohnt, sich danach zu sehnen. Denn sie hat Einar geküsst.
Ich habe viel darüber nachgedacht, wie es gewesen wäre, wenn meine Mutter statt Einar jemanden wie Richard gewählt hätte. Dann wäre das Haus jetzt von den Geräuschen vieler Menschen erfüllt. Dann könnte ich von Zimmer zu Zimmer gehen und ständig jemanden treffen. Ich würde die Kontrolle darüber verlieren, wer wer ist. Und wenn meine Mutter und ich uns streiten würden, wären immer noch andere da, es gäbe immer jemanden, der sich zwischen meine Mutter und mich stellen könnte.
Wäre Richard an Einars Stelle, wären wir vielleicht nicht mehr hier. Dann hätte meine Mutter es vielleicht gewagt, endlich aufzubrechen.
Dass ich einen Vater vermisse, könnte ich meiner Mutter niemals sagen. Ich weiß genau, was sie antworten würde. Du darfst niemals glauben, dass du einen Mann brauchst, um im Leben zurechtzukommen. Du darfst nie glauben, wir beide würden das nicht allein schaffen. Denk an die Pferde. Die Fohlen brauchen auch nur eine Stute, der Hengst gehört nie dazu. Meine Mutter mag Tiermetaphern.
In meinem ganzen Leben habe ich nur sieben Menschen kennengelernt. Meine Mutter, dich, deine Eltern, deine Schwester. Und Tante Anne. Einar habe ich noch dazu genommen, aber eigentlich zählt er nicht, weil ich mich immer in meinem Zimmer verstecke, wenn er kommt. Sieben Menschen, das ist gar nichts. Vor allem, wenn fast alle von ihnen verschwunden sind. Eigentlich gibt es nur einen Menschen in meinem Leben. Und im Vergleich dazu, wie sehr sie sich mit Tieren auskennt, hat meine Mutter wirklich ziemlich wenig Ahnung von Menschen. Davon, wie wir leben sollten und was wir brauchen.
Manchmal, vor allem abends in der Küche, wenn meine Mutter mich unterrichtet, habe ich das Gefühl, ich bekäme einen allergischen Anfall. Wenn sie mir etwas erklärt, ist ihre Stimme so gepresst, dass es nicht mehr natürlich klingt, viel höher und dünner als sonst, und ich verstehe nicht, warum ihr das selbst gar nicht auffällt. Wenn ich sie höre, jucken mir die Augen, und ich kann nicht mehr richtig einatmen und auch nicht aus. Die Luft bleibt mir im Hals stecken, und der Sauerstoff wird knapp. Ihr Körper ist überall, sie ist dürr, und trotzdem nimmt sie so viel Platz ein, ihre Essgeräusche, ihre Seufzer, wenn sie sich nach etwas auf dem Boden bückt. Ich kann ihren Körper hören, auch wenn ich sie nicht sehe.
Ich fühle mich gemein, wenn ich so etwas schreibe. Ich bingemein. Die ganze Zeit arbeitet sie, richtig hart sogar, und wenn sie nicht arbeitet, will sie mir etwas beibringen. All das tut sie nur für mich … Schon der Gedanke daran nimmt mir die Luft zum Atmen.
MICHAIL
Bericht über meine Reise in die Mongolei und das, was ich dort fand
Aufgezeichnet in St. Petersburg, im September 1883
KAPITEL 1
Eine außergewöhnliche Entdeckung
Im Haus herrscht Stille, nur das Dienstmädchen rumort in der Küche, und ich sitze an meinem Schreibtisch und habe beschlossen, meinen Bericht aufzuzeichnen. Ich versuche schon seit geraumer Zeit, diese Worte zu Papier zu bringen, in langen Briefen, die alle an denselben Mann gerichtet sind, doch bislang ist jeder einzelne von ihnen als zusammengeknüllter Schneeball im Papierkorb gelandet. Heute, nach einem Spaziergang im Sommergarten, habe ich endlich verstanden, dass meine Versuche einer Korrespondenz zu nichts führen werden. Ein Brief ist nicht die geeignete Form, und Wolff soll auch nicht mein Leser sein. Diese Erzählung handelt nicht von ihm oder mir, sondern von den Wildpferden und dem Leben von Mensch und Tier in der Steppe. Es ist ihre Geschichte, und jemand muss sie aufschreiben, ehe sie in Vergessenheit gerät.
Hoffentlich wird mein Text den ein oder anderen Leser erreichen. Die Geschichte über unsere Suche nach den Wildpferden müsste alle fesseln, die wenigstens ein Quäntchen zoologisches und ethnographisches Interesse besitzen, und sollten Sie zu diesen Lesern gehören, möchte ich Sie bitten, ein Nachsehen mit meinen womöglich überflüssigen und langwierigen Exkursen zu haben. Aus Respekt vor den tatsächlichen Ereignissen habe ich es nicht gewagt, allzu viel auszusparen, denn wer weiß schon, was sich als bedeutsam für die Nachwelt erweisen wird?
Mein Bericht beginnt an einem gewöhnlichen Montagmorgen im Mai 1880 mit dem Klappern von Hufen und dem lauten Brrrr des Kutschers auf der Straße vor unserer Wohnung. Anschließend hörte ich eine Wagentür, die geöffnet wurde, und Schritte auf dem Boden, ehe schon in der nächsten Sekunde der Türhammer dreimal hart und energisch gegen das Holz geschlagen wurde.
Damals wie heute saß ich in meinem Arbeitszimmer im ersten Stock, Mutter war soeben hinausgegangen, um einige Besorgungen zu machen, und ich war allein und wollte gerade zum zweiten Mal den Jahresbericht durchgehen, ehe ich mich zu meinem Arbeitsplatz begab. Ich verspürte eine leise Irritation angesichts des metallischen Klopfens, aber auch eine gewisse Erleichterung. Die Bilanz des Zoos war alles andere als eine erbauliche Lektüre. Sooft ich auch darauf blickte, die Zahlen verbesserten sich doch nicht. Ich ertappte mich bei dem Wunsch, sie könnten sich bewegen, den Platz tauschen, Minus könnte zu Plus werden und Plus zu Minus, sie könnten zum Leben erweckt werden und ebenso irrational, spontan und warmblütig werden wie die Tiere, die sie repräsentierten. Am Vorabend hatte ich das Rechnungsbuch sogar nach dem Genuss einiger Lebenswässerchen eingehender studiert und gehofft, der Rausch würde sie zum Tanzen bringen. Doch selbst das half nichts. Mein Fachgebiet ist die Naturwissenschaft, zu der man bekanntlich auch die Mathematik zählt, aber der Weg von den lebenden Wesen, denen ich mich als assistierender Direktor im Zoo von Petersburg verschrieben hatte, bis hin zu diesen blauen Tintenstrichen auf grauweißem Papier, erschien mir weiter als von der Erde bis zum Merkur.
Die Krux war Berta, ein deutsches Nilpferd, auf dessen Kauf ich einige Monate zuvor beharrt hatte. Der Direktor überließ diese Angelegenheiten mir, er kümmerte sich um den Betrieb und die Angestellten, die Tiere aber waren meine Angelegenheit, und damit fiel Berta in meine Verantwortung; samt aller Herausforderungen, die ihre Anschaffung mit sich brachte. Tatsächlich zog sie die Besucher an, ja, die Petersburger liebten dieses große, behäbige Tier, und vor ihrem Gehege sammelte sich stets eine kleine Menschenschar und jubelte, wann immer sie auch nur das kleinste Schnaufen oder Grunzen von sich gab. Für mich bot sie dagegen schon lange keinen Anlass zum Jubel mehr. Natürlich war sie ein, wie soll man sagen, auffälliges Tier, viele bezeichneten sie gar als stattlich, aber die Kosten für ihren Transport von Hamburg waren noch viel stattlicher gewesen. Ich hatte mich schlicht und ergreifend an der stattlichen Berta verhoben.
Pjotr, unser Diener, trat leise ins Zimmer und stellte das silberne Tablett mit der Visitenkarte vor mir ab, während er auf seine zurückhaltende Art den Besuch anmeldete.
Ich nahm die Karte entgegen und studierte sie.
»Iwan Poljakow, Zoologisches Institut?«
»Wenn der Herr gestatten«, ergänzte Pjotr, »möchte ich darauf hinweisen, dass Poljakow ganz rotwangig und atemlos war. Als sei es dringlich.«
»Danke, Pjotr. Seien Sie doch so freundlich und bitten Sie ihn herein.«
Schon in der nächsten Minute ging die Tür auf, und Poljakow stand vor mir. Der Biologe war mein engster Mitarbeiter am Institut, dennoch trafen wir uns nicht oft. Von Zeit zu Zeit kam es vor, dass er mich zu Neuigkeiten über größere Tiertransporte informierte, die für weitere Neuanschaffungen interessant sein könnten, zu Hause aufgesucht hatte er mich jedoch noch nie. In der Tat war er sowohl rotwangig als auch atemlos, Pjotr hatte allerdings verschwiegen, dass Poljakow außerdem so breit grinste, dass er dabei all seine braunen Zähne offenbarte.
»Treten Sie ein«, bat ich.
»Mein werter Michail Alexandrowitsch«, sagte Poljakow. »Mein guter Freund.«
»Bester Iwan Poljakow«, erwiderte ich. »Ich hoffe, alles steht zum Besten bei Ihnen und Ihrer reizenden Familie. Ihrer bezaubernden Frau und Ihren ebenso entzückenden Kindern.«
»Ähm, ja.« Er stutzte ein wenig. »Gewiss.«
Vermutlich waren meine Floskeln wieder einmal übertrieben gewesen. Situationen wie diese, in denen ich mit anderen Männern allein war, brachten mich gern einmal aus der Fassung. Ich hütete mich davor, allzu aufdringlich oder überschwänglich zu sein, und fürchtete zugleich, dadurch arrogant zu wirken.
Poljakow schien meine Nervosität aber gar nicht wahrzunehmen. Ohne meine Aufforderung abzuwarten, nahm er am Salontisch Platz. Dann bemerkte er seinen Fauxpas und sprang wieder auf, als sei er vom Stuhl gebissen worden.
»Ich bitte Sie, mein Freund, setzen Sie sich doch!«, sagte ich. »Verzeihen Sie meine Trägheit, ich bin ein wenig zerstreut, die Bilanzen. Es ist wieder diese Zeit im Jahr, Sie wissen ja, wie das ist …«
Ich beendete meinen Satz nicht, weil mir auffiel, dass er keineswegs wusste, wie es war, und ich nicht mit seinem Verständnis rechnen konnte. Als Angestellter des Zoologischen Instituts wurde ihm sein Salär in einem so gleichmäßigen Takt überwiesen, wie die kaiserliche Garde marschierte.
»Wie auch immer«, fuhr ich fort. »Ich sehe doch, dass Ihnen etwas auf der Seele brennt. Und nun kommt Pjotr auch schon mit dem Samowar, lassen Sie uns doch ein Gläschen Tee genießen, bitte schön.«
»Tee? Das wäre doch nicht nötig gewesen, aber wenn Sie ihn mir schon so freundlich anbieten …«
Mit einer flinken Bewegung nahm er das Glas, das Pjotr ihm reichte, seine Hand zitterte leicht, und als er es mit einem leisen Klirren auf dem Tisch absetzte, schwappten einige Tropfen über. Dann nahm er die Zuckerzange, gab nicht weniger als vier Würfel hinein, rührte fünf Mal um und kippte das Getränk in drei großen Schlucken herunter.
»Da scheint es aber jemandem zu schmecken!«
Er zog ironisch eine Augenbraue hoch, und mir wurde bewusst, dass ich wie meine eigene Mutter klang.
»Ich möchte, dass Sie mich ins Institut begleiten«, bat Poljakow. »Es gibt etwas, das ich Ihnen zeigen muss. Gestern Abend kam ein Bote mit einer Sendung aus der Mongolei zu mir.«
»Aus der Mongolei? Und um mir das zu berichten, sind Sie persönlich erschienen?«
»Die Sendung stammt von Oberst Przewalski. Er befindet sich derzeit noch auf der Heimreise, aber die Sendung traf vor ihm ein. Und ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie diese Objekte in Augenschein nähmen.«
»Und um welche Objekte genau handelt es sich?«
»Ein Fell und einen Schädel.«
»Ein totes Tier? Ich befasse mich eigentlich lieber mit den lebenden.«
»Von einem Pferd, einem Wildpferd.«
»Ach, wirklich?«
»Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen«, sagte er und öffnete den Mund erneut zu einem großen, braunen Grinsen.
Ehe ich mit meiner Darstellung der Ereignisse fortfahre, erscheint es mir vonnöten, einige biographische Informationen über die Hauptperson dieser Erzählung vorwegzuschicken, also mich, den Verfasser höchstselbst. Hauptperson nicht in dem Sinne, dass ich die zentrale Figur in diesem eigenartigen Abenteuer wäre, so etwas würde ich mir nie anmaßen, und ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass mein Name später einmal nicht in den Geschichtsbüchern auftauchen wird. Möglicherweise wird er aber immerhin Ihnen, werter Leser, in Erinnerung bleiben.
Mein Name ist Michail Alexandrowitsch Kowrow, ich wurde 1848 in Petersburg geboren, dem Jahr der Aufstände in Paris, in deren Folge König Louis-Philippe abdankte. Die Unruhen breiteten sich auch im übrigen Europa aus, und in Österreich musste der Kanzler seinen Hut nehmen. Unser eigener Kaiser bewies jedoch wie immer Stärke, und als erste Funken von Ungehorsam in Moldawien und der Walachei entfacht wurden, erstickte er sie im Keim. Ich selbst ahnte natürlich nichts von all dem, mein Leben beschränkte sich ganz auf die liebevollen Arme meiner Mutter und die strenge, aber gerechte Justiz meines Vaters. Wir hatten ein gutes Leben. Mein Vater, Alexander Kowrow, genoss als Rittmeister der Kavallerie große Anerkennung. Er hatte Mutter erst spät kennengelernt, und sie bekamen nur ein Kind. Dennoch gewann ich den Eindruck, ihre Ehe und ihr kurzes Zusammenleben wären sowohl glücklich als auch erfüllend gewesen, und sie hätten einen tiefen Respekt voreinander gehabt.
Als ich sieben Jahre alt war, nahm dieses Dasein eine jähe Wende. Das fatale Ereignis, das alles auf den Kopf stellen sollte, trug sich an einem Nachmittag im Januar zu. Draußen herrschte bereits nächtliche Finsternis, wie immer in den Winternachmittagen hier im Norden, die so anders waren als die weißen Nächte im Mai oder Juni. Mein Vater befand sich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und wollte eine Straße überqueren. Ich weiß nicht, ob er die in wilder Fahrt herannahende Kutsche noch sah, und ich weiß auch nicht, wie schnell er starb. Und seine Schmerzen mag ich mir gar nicht ausmalen. Sowohl der Kutscher als auch die Fußgänger, die sich zufällig in der Nähe befanden, berichteten vom Geräusch der Hufe, die den Körper meines Vaters auf dem Kopfsteinpflaster trafen, harte Hufeisen auf weichem Menschenleib. Ich versuchte mir immer wieder vorzustellen, wie es geklungen haben muss, einmal legte ich mich sogar auf den Boden der Bibliothek und ließ ein rostiges Hufeisen auf meinen nackten Jungenbauch fallen, was allerdings gar kein besonderes Geräusch erzeugte.
Dies geschah im Übrigen beinahe zur selben Zeit, als sich Zar Nikolaus I. eine fürchterliche Lungenentzündung zuzog, eine ärztliche Behandlung ablehnte und bedauerlicherweise kurz darauf verstarb. Während das ganze Land trauerte, trauerten auch wir. Der Zar lag zwei Wochen auf dem Paradebett, und meine Mutter schloss sich weinend in ihrem Zimmer ein. Als sie es endlich wieder verließ, tat sie es nur, um den toten Zaren zu sehen. Ich erinnere mich, wie wir ungeheuer langsam am aufgebahrten Nikolaus I. vorbeidefilierten, wie Mutter mein Gesicht an ihre Rockschöße presste und schluchzte, sie wisse nicht, für wen sie mehr weine, für den Landesvater oder meinen Vater, während ich vorsichtig den Kopf zur Seite drehte, um einen Blick auf die Leiche zu erhaschen. Seither habe ich große Lebenseinschnitte stets mit der Zarenfamilie in Verbindung gebracht.
Anschließend blieben Mutter und ich allein. Immerhin waren wir jedoch nicht mittellos, sondern hatten dank der Pension meines Vaters ein gutes Auskommen. Wir konnten nicht mehr so leben wie zuvor, behielten aber unser Zuhause, die großzügige Wohnung in der Kriwtsow-Gasse, und hatten genügend Mittel, um ein bescheidenes, aber doch verhältnismäßig angenehmes Dasein zu führen.
Meine Kindheit werde ich immer mit den großen, stillen Zimmern unserer Wohnung und der Wärme meiner Mutter in Verbindung bringen. Sie war immer aufopferungsvoll gewesen. Was mein Wohlergehen anbelangte, machte sie keinerlei Kompromisse. Bei Tisch bekam ich immer die besten Fleischstücke, und ich wurde auf eine ausgezeichnete Schule geschickt.
Die Schule, ja … der Leser möge es mir erlauben, auch einen kurzen Abstecher zu diesem kurzen und brutalen Abschnitt meines Lebens zu machen. An meinen ersten Schultag erinnere ich mich noch allzu gut. Mutter hatte mich bis zum Tor gebracht, mir drei Abschiedsküsse gegeben und mir nachgewunken, als ich über den Hof auf das große, dunkle Gebäude zustrebte. Ich wechselte mit keinem der anderen Kinder ein Wort und kannte auch keines von ihnen. Das System sprach mich aber sofort an. Es war, als wäre die Schule in einer langen Kolonne organisiert, als wären wir keine einzelnen Kinder, sondern Teil einer Kette. Wir saßen in Reih und Glied, wir marschierten im Takt. Zumindest, bis die Schulglocke schellte. Danach blieb ich mit einem Mal allein zurück.
Mit der kühlen Ignoranz der ersten Wochen hätte ich leben können, doch nachdem sich die Konstellationen gefestigt und die meisten ihren Platz gefunden hatten, entstand eine neue Dynamik: Die anderen Jungen fingen an, nach einer Bestätigung dafür zu suchen, dass genau diese Konstellationen zusammengehörten. Und die Bestätigung suchten sie gern im Konflikt mit den anderen Gruppen, häufiger aber, indem sie die wenigen von uns bloßstellten, die nicht dazugehörten.
Ich erinnere mich an meine neue Schiefertafel. Sie war mein ganzer Stolz gewesen, als ich in der Schule anfing. Ich erinnere mich, wie sie kaputtgeschlagen wurde, wie die Jungen wetteten, was härter war, mein Kopf oder die Tafel.
Es war mein Kopf.
Als ich zum dritten Mal mit unerklärlichen Verletzungen nach Hause kam und nicht verraten wollte, wie sie entstanden waren, erzählte Mutter mir, sie habe sich nach einem Privatlehrer für mich erkundigt.
»Privatlehrer?« Es war das schönste Wort, das ich je gehört hatte.
Anschließend spielte sich der Großteil meines Lebens in unserer Wohnung ab, mit den besten Lehrern, die es in ganz Petersburg gab, ich wurde auf Russisch und Französisch unterrichtet und musste unsere Straße nie mehr verlassen.
Nur drei Hauseingänge entfernt, gegenüber von unserem Gebäude, befand sich die Geographische Gesellschaft. Schon früh waren mir die verschiedenen Herren aufgefallen, die dort ein- und ausgingen. Oft war ihre Kleidung schmutzig und staubig, sie kamen fast immer allein, trugen Leinensäcke voller Flecken und Koffer, deren ursprüngliche Farbe unter Kerben und Kratzern verschwunden waren, ihre Haut war wettergegerbt, die Hände braun und sehnig und ebenso verschlissen und zerkratzt wie ihr Gepäck. Eifrig lauschte ich ihren Gesprächen, entwickelte ein Talent dafür, mich in ihrer Nähe aufzuhalten und alles aufzuschnappen. Mit gespitzten Ohren versuchte ich zu erfahren, wo sie gewesen waren, wie sie gereist waren und mit wem, und nicht zuletzt, welche Tiere sie gesehen oder sogar gefangen hatten. Die Fauna dort draußen sei ganz anders als das uns vertraute, russische Tierleben, hörte ich sie erzählen. Sie sprachen von Vögeln und anderen Arten, die so farbenfroh und merkwürdig waren, dass man es sich kaum vorstellen konnte, ehe man sie nicht mit eigenen Augen gesehen hatte. Ich bettelte Mutter nach neuen Büchern an, und jeden Freitag schleifte ich sie in die Kunstkammer, die naturwissenschaftliche Sammlung Peters des Großen, wo man neben vielen missgebildeten Föten in Gläsern auch ausgestopfte Tiere aus allen Ecken der Welt bestaunen konnte.
Dass ich mich an der Universität für Zoologie einschreiben wollte, kam für Mutter wohl wenig überraschend, und sie unterstützte mich in meiner Studienwahl. Als ich später die gute Anstellung am Zoologischen Garten von Petersburg fand, waren wir beide glücklich. Da der Tierpark in privater Hand war, konnte ich zwar nicht den Rang meines Vaters erreichen, genoss beim Bürgertum der Stadt jedoch dennoch hohes Ansehen und erhielt einen respektablen Lohn. Der Zoo war unter den Bürgern der Stadt ein beliebtes Ausflugsziel und diente vor allem den jüngeren Besuchern der Zerstreuung und der Bildung. Dadurch ergab meine Arbeit einen Sinn. Und zu Hause führten wir weiterhin ein geruhsames Dasein. Mutter und ich aßen morgens und abends gemeinsam. Es herrschte eine angenehme, wohlige Wärme in den Zimmern, die immer sauber und schwach nach Mutters Parfüm rochen, einige seltene Male empfingen wir Gäste zum Tee oder Diner, die meiste Zeit aber blieben wir mit den Hausangestellten allein. Ich war mit meinem Leben zufrieden. Natürlich kam es hin und wieder vor, dass Mutter die Sache mit den Mädchen ansprach. Mitunter berichtete sie begeistert von einer Cousine ersten oder zweiten Grades oder einer anderen geeigneten Kandidatin, doch mir gelang es meistens geschickt, das Thema zu wechseln. Meine große Leidenschaft war die Arbeit im Tierpark … Ein wenig zu groß, hätte man vielleicht meinen können. Seit ich vor fünf Jahren als assistierender Direktor angefangen hatte, war auf mein Betreiben hin eine beeindruckende Zahl neuer Arten angeschafft worden, darunter die bereits erwähnte Berta. Das Nilpferd war die größte aller finanziellen Herausforderungen gewesen. Und als Poljakow mich an jenem Morgen im Mai 1880 aufsuchte, weckte er in mir nicht allein Neugier, sondern auch die Hoffnung auf neue Einnahmen.
Er hatte die Kutsche warten lassen. Der Kutscher kauerte fröstelnd auf seinem Bock, während der Regen offenbar sein Bestes tat, in seinen Ledermantel einzudringen. Seine Miene erhellte sich vor Erleichterung, als wir hinauskamen.
»Wieder auf direktem Wege zurück«, bat Poljakow und drückte dem Kutscher eine ganze Faust voller Münzen in die Hand. »So schnell Sie können.«
Es prasselte auf das Dach, und das Wasser spritzte, die Achse knirschte, der Kutscher schwang seine Peitsche, er machte es sich fürwahr zur Aufgabe, Poljakow den vollen Gegenwert für seine Kopeken zu bieten, und ich bemühte mich, so gut es ging, nicht an meinen armen Vater zu denken. Stattdessen versuchte ich Poljakow auszufragen, ich bohrte nach, erkundigte mich nach der Größe und Farbe des besagten Fells, nach der Form des Schädels. Er bat mich jedoch zu warten.
»Lassen Sie es uns zusammen ansehen. Ich bin auf Ihre Meinung über diese Art angewiesen.«
Für den Rest der Fahrt schwiegen wir.
Ein Tarpan, es musste ein Tarpan sein, eines der Wildpferde, die früher frei in der Steppe Preußens und östlich des Uralflusses gelebt hatten. Im Zoologischen Garten von Moskau gab es noch ein Exemplar, aber soweit ich wusste, war man sich bezüglich der Abstammung dieses Hengstes unsicher; ob er reinrassig war oder eine Kreuzung. Davon abgesehen war er ohnehin schon alt und konnte keine Nachkommen mehr zeugen. Ich hatte meine Geburtsstadt noch nie verlassen und das Pferd somit auch nie mit eigenen Augen gesehen, doch seit man mir eine Fotografie gezeigt hatte, konnte ich die Zweifel an seiner Herkunft nachvollziehen. Es war klein, dunkel und struppig, kein bisschen so, wie ich mir diese Wildpferde einst vorgestellt hatte; im Galopp über die Steppe, mit wehenden Mähnen und Schweifen.
Poljakow eilte vor mir die Treppe hinauf und in sein Büro. Dort stellte er sich neben den Schreibtisch, der von Schreibzeug und Büchern freigeräumt worden war. Mitten auf der Tischplatte lagen einige Knochenreste, ein Schädel und ein Fell.
»Hier haben wir ihn also«, begann Poljakow, und ich ahnte ein schwaches Zittern in seiner Stimme. »Getötet von einem Jäger namens Kirghiz, Nachname unbekannt, in der Nähe eines Ortes namens Guchen, fragen Sie mich nicht, wo das liegt. Als Geschenk überreicht an Oberst Nikolaj Michailowitsch Przewalski, der die Bedeutung dieses Fundes im Nu erfasste und ihn herschicken ließ.«
Im ersten Moment war ich überrascht, ja geradezu enttäuscht. Das Fell war kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte, weder braun noch schwarz, sondern falbe, nahezu grau, mit einem schwarzen Streifen, der vom Kopf bis zum Schweif verlief. Auch der Schädel war nicht weiter bemerkenswert, er sah aus wie die meisten Schädel, harter Knochen, leere Augenhöhlen.
»Erstaunlicher Fund«, sagte ich in einem lahmen Versuch, ein wenig Enthusiasmus aufzubringen.
»In der Tat!«, erwiderte Poljakow.
Ich trat an den Schreibtisch heran und nahm den Schädel in die Hand. Der Knochen war kühl und trocken. Ich fuhr mit den Fingern darüber, kniff die Augen zusammen, wie ein Blinder tastete ich mich voran und versuchte, das Pferd vor mir zu sehen, dem er einmal gehört hatte. Und es war, als würde diese körperliche Berührung mit dem, was einmal ein Tier gewesen war, etwas in mir auslösen, meine Finger erkannten ein anderes Tier. Ich konnte es vor mir sehen.
»Ein breiter Nasenrücken, beinahe ein wenig römisch«, stellte ich fest.
»Gut beobachtet«, bestätigte Poljakow. »Ich dachte dasselbe.«
»Und das Fell«, ich legte den Schädel wieder ab und strich mit den Fingern darüber. »Sehr hell. Und groß, nicht wahr?«
Er nickte und zwinkerte. »Aber kleiner als andere Pferde.«
»Das bestätigt nun endgültig, dass der Hengst aus Moskau kein reiner Tarpan ist«, sagte ich.
»Ach, wirklich?«, fragte Poljakow.