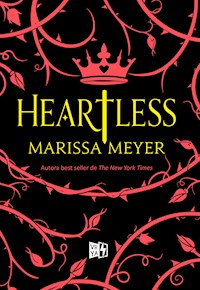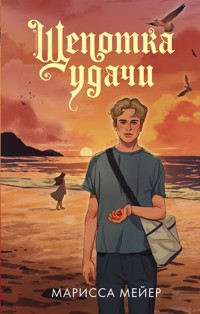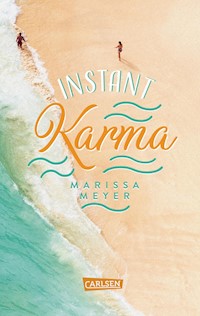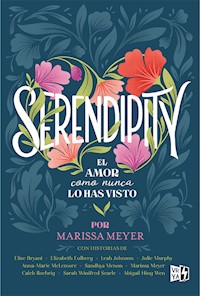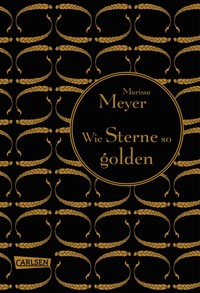
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die coolste Rapunzel aller Zeiten! Ein rasanter Mix aus Grimms Märchen und SciFi, mit einer romatischen Liebesgeschichte on top. Steampunkig und spannend! Seit ihrer Kindheit hat Cress die Erde nur aus der Ferne betrachten können. Unter strenger Aufsicht der bösen Königin Levana führt sie in ihrem Satelliten ein wenig abwechslungsreiches Leben. Doch immerhin hat sie sich mit den Jahren zu einer begnadeten Hackerin entwickelt und verschafft sich so Zugang zu Levanas geheimen Plänen. Da taucht plötzlich das Raumschiff von Cinder bei ihr auf, die ihr zur Flucht verhilft. Doch wird sie auf der Erde den Ritter in der glänzenden Rüstung finden, von dem sie immer geträumt hat? »Umwerfend!« Los Angeles Times Marissa Meyers Bestseller-Serie über Märchen, die in eine fantastische Sci-Fi Welt in der Zukunft verlegt sind, haben bereits jede Menge gühende Fans! So modern wurde die Geschichten von Cinderella, Rotkäppchen, Rapunzel und Schneewittchen noch nie erzählt ... Alle vier Bände der packenden Luna-Chroniken – jeder Band einzeln lesbar: Wie Monde so silbern (Band 1) Wie Blut so rot (Band 2) Wie Sterne so golden (Band 3) Wie Schnee so weiß (Band
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Marissa Meyer
Die Luna-Chroniken 3: Wie Sterne so golden
Aus dem Englischen von Astrid Becker
Seit ihrer Kindheit hat Cress die Erde nur aus der Ferne betrachten können. Unter strenger Aufsicht der bösen Königin Levana führt sie in ihrem Satelliten ein wenig abwechslungsreiches Leben. Doch immerhin hat sie sich mit den Jahren zu einer begnadeten Hackerin entwickelt und verschafft sich so Zugang zu Levanas geheimen Plänen. Da taucht plötzlich das Raumschiff von Cinder bei ihr auf, die ihr zur Flucht verhilft. Doch wird sie auf der Erde den Ritter in der glänzenden Rüstung finden, von dem sie immer geträumt hat?
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Viten
Für Jojo, Meghan und Tamara * high fives *
Erstes Buch
Als sie noch ein Kind war, schloss die Zauberin sie in einen Turm, der weder Treppe noch Türe hatte.
1
Sechzehn Stunden brauchte ihr Satellit, um den Planeten Erde zu umrunden. Es war ein Gefängnis mit einem atemberaubenden Blick – riesige blaue Meere, wirbelnde Wolken und Sonnenaufgänge, die die halbe Welt in Brand setzten.
In der ersten Zeit ihrer Inhaftierung hatte sie oft Kissen auf den Schreibtisch getürmt, die Bildschirme mit Bettlaken verhängt und sich so eine kleine Höhle gebaut. Dann spielte sie, sie sei nicht in einem Satelliten, sondern in einem Beischiff auf dem Weg zum Blauen Planeten. Und würde bald landen, echte Erde betreten, echten Sonnenschein fühlen und echten Sauerstoff einatmen.
Sie starrte stundenlang auf die Kontinente und stellte sich vor, wie es dort unten wohl wäre.
Luna anzusehen, vermied sie. An einigen Tagen schwebte ihr Satellit so dicht daran vorbei, dass der Mond die gesamte Fensterbreite einnahm und sie die gewaltigen glitzernden Kuppeln und die funkelnden Städte ausmachen konnte, in denen die Lunarier lebten. Wo sie auch gelebt hatte. Vor Jahren. Bevor sie verbannt worden war.
Als Kind hatte sich Cress in diesen quälend langen Stunden vor dem Mond versteckt. Manchmal war sie ins kleine Bad geflüchtet und hatte sich damit abgelenkt, ihre Haare in raffinierte Zöpfe zu flechten. Oder sie hatte sich unter dem Schreibtisch verkrochen und Wiegenlieder gesungen, bis sie tatsächlich einschlief. Oder von einer Mutter und einem Vater geträumt und sich ausgemalt, wie sie mit ihnen spielte, wie die Eltern ihr Abenteuergeschichten vorlasen und ihr dabei liebevoll die Haare aus der Stirn strichen, bis endlich – endlich – der Mond hinter der schützenden Erde versunken war und sie sich wieder sicher fühlen konnte.
Selbst jetzt nutzte Cress diese Stunden, um unter das Bett zu kriechen, zu schlafen, zu lesen, sich Lieder auszudenken oder komplizierte Codes zu knacken. Sie sah nicht gerne auf die Städte von Luna hinab, weil sie eine paranoide Vorstellung hatte: Wenn sie die Lunarier sehen konnte, so mussten die Lunarier sie doch auch jenseits ihrer künstlichen Himmel entdecken können.
Es war wie ein Albtraum, der nun schon länger als sieben Jahre andauerte.
Doch obwohl die silberne Kuppe Lunas schon in eine Ecke ihres Fensters gekrochen war, schenkte Cress ihr nicht die geringste Aufmerksamkeit. Denn jetzt spielte sich auf den unsichtbaren Schirmen ein ganz anderer Albtraum ab. Unter grauenerregenden Schlagzeilen tauchten brutale Fotos und Videos auf, die langsam vor ihren Augen verschwammen, während sie von einem Artikel zum nächsten scrollte. Sie konnte gar nicht schnell genug lesen.
14 STÄDTE ANGEGRIFFEN
MASSAKER DAUERTE ZWEI STUNDEN
16000 TOTE ERDBEWOHNER
GRÖSSTES BLUTVERGIESSEN DER DRITTEN ÄRA
Im Netz nichts als Angst und Schrecken. Auf den Straßen lagen Tote mit aufgeschlitzten Bäuchen, deren Blut in die Rinnsteine lief. Menschenähnliche Wesen rannten mit blutverschmierten Kiefern und verkrusteten Nägeln zwischen den Toten herum. Cress hielt die Hand vor den Mund, als sie die Bilder ansah. Ihr Atem ging immer flacher, denn langsam dämmerte ihr die Wahrheit.
Es war ihre Schuld.
Monatelang hatte sie lunarische Schiffe so getarnt, dass die Radare der Erde sie nicht orten konnten, so wie Herrin Sybil es ihr befohlen hatte. Weil sie nichts als eine gut ausgebildete Lakaiin war. Jetzt wusste sie, was für Bestien an Bord dieser Schiffe waren. Jetzt verstand sie, was Ihre Majestät geplant hatte, doch nun war es zu spät.
16000 TOTE ERDBEWOHNER
Niemand hatte etwas von der drohenden Gefahr geahnt. Und alles nur, weil sie nicht tapfer genug gewesen war, sich den Befehlen der Herrin zu widersetzen. Sie hatte ihre Arbeit getan und der Wahrheit nicht ins Auge sehen wollen.
Jetzt tauchte neben den Bildern über das Massaker eine andere Nachricht auf, die sie fast noch mehr entsetzte.
Imperator Kaito aus dem Asiatischen Staatenbund hatte den Angriffen ein Ende bereitet, indem er in eine Heirat mit Levana, der Königin von Luna, eingewilligt hatte.
Königin Levana würde Herrscherin über den Staatenbund werden.
Auf der Erde bemühten sich fassungslose Journalisten, ihre Standpunkte zu dieser diplomatischen Allianz zu erläutern. Einige entrüsteten sich, dass sich der Staatenbund auf einen Krieg und nicht auf eine Hochzeit vorbereiten solle, während andere die Allianz eilig rechtfertigten. Cress drehte den Ton höher, um zu hören, was einer von ihnen über die möglichen Vorteile zu sagen hatte: Es gebe keine Angriffe mehr und keine Spekulationen, wann der nächste Angriff stattfinden würde. Die Erde werde die Kultur Lunas besser verstehen lernen. Erde und Luna könnten sich über ihre jeweiligen technischen Fortschritte austauschen. Sie würden Verbündete sein. Außerdem wolle Königin Levana doch nur über den Staatenbund – und nicht über die ganze Union Erde – herrschen.
Doch Cress wusste, dass sie sich täuschten. Wenn Königin Levana Kaiserin wäre, würde sie Kaito umbringen lassen, das Land zu ihrem eigenen erklären, ihre Armee dort versammeln und es als Basis für die Invasion der restlichen Länder der Union nutzen. Sie würde erst Ruhe geben, wenn sie Herrscherin des gesamten Planeten wäre. Dieser Überfall, diese lächerlichen sechzehntausend Toten – das war erst der Anfang.
Cress stellte den Ton ab, stützte die Ellenbogen auf den Schreibtisch und raufte sich die aufgetürmten blonden Haare. Trotz der gleichbleibenden Temperatur im Satelliten fröstelte sie plötzlich. In ihrem Rücken las eine Kinderstimme etwas vor. Den Schirm hatte sie programmiert, als sie zehn Jahre alt war, um nicht vor Langeweile wahnsinnig zu werden. Die Stimme war zu munter für das, was sie vortrug: Ergebnisse einer Autopsie an einem lunarischen Soldaten aus einem Medizinblog der Amerikanischen Republik.
Die Knochen wurden mit kalziumreichem Biogewebe verstärkt und in die Knorpel der großen Gelenke wurde eine salzhaltige Lösung gespritzt, um sie flexibler und geschmeidiger zu machen. Die Eck- und Schneidezähne wurden gegen wolfszahnähnliche Implantate ausgetauscht und auch die Kieferknochen wurden verstärkt, um ihnen mehr Kraft zum Zermalmen von Knochen und anderem Gewebe zu verleihen. Eine Umpolung des zentralen Nervensystems und langwierige psychologische Manipulationen sind für die ununterdrückbaren Aggressionen und das wolfsähnliche Verhalten verantwortlich. Dr. Edelstein hat die Theorie aufgestellt, dass eine ausgefeilte Manipulationstechnik der bioelektrischen Hirnströme auch eine Rolle bei der ...
»Ton aus.«
Die süße Stimme der Zehnjährigen verstummte. Im Satelliten waren nur noch die Geräusche zu hören, die Cress schon lange nicht mehr bewusst wahrnahm. Das Surren der Kühlgebläse. Das Pochen des Lebenserhaltungssystems. Das Gurgeln des Wassers im Recyclingtank.
Cress packte ihre dicken Haarsträhnen im Nacken und zog den Pferdeschwanz über die Schulter – die Haare gerieten leicht unter die Rollen des Bürostuhls, wenn sie nicht aufpasste. Über die Schirme flackerten neue Nachrichten von der Erde. Auch aus Luna kamen Parolen über »tapfere Soldaten« und einen »hart erkämpften Sieg« – von der Krone abgesegnete Floskeln. Cress sah schon seit ihrem zwölften Lebensjahr keine Nachrichten mehr aus Luna.
Gedankenverloren wickelte sie den Pferdeschwanz um den linken Arm – vom Ellenbogen bis zum Handgelenk, ohne sich darum zu kümmern, dass sich die Haare dadurch in ihrem Schoß verknoteten.
»Oh, Cress«, murmelte sie. »Was willst du jetzt bloß tun?«
Ihr zehnjähriges Gegenüber flötete zurück: »Bitte erläutere deine Wünsche etwas näher, große Schwester.«
Cress schloss die Augen, um das grelle Geflimmer auf den Bildschirmen nicht mehr sehen zu müssen. »Soweit ich weiß, versucht Imperator Kai den Krieg zu beenden. Aber er muss wissen, dass eine Heirat Ihre Majestät nicht aufhalten wird. Sie wird ihn töten, wenn er sich darauf einlässt – und was wird dann aus der Erde?« Ihre Schläfen pochten. »Ich war mir sicher, dass Linh Cinder es ihm auf dem Ball gesagt hat, aber was ist, wenn ich mich irre? Was ist, wenn er noch immer nicht weiß, in welcher Gefahr er schwebt?«
Sie wirbelte auf dem Drehstuhl herum, wischte über einen stumm gestellten Nachrichtensender, gab einen Code ein und rief das versteckte D-TELE-Fenster auf, in das sie hundertmal am Tag sah. Es öffnete sich wie ein schwarzes Loch, leer und stumm. Linh Cinder hatte immer noch nicht versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Vielleicht war ihr Chip schon lange konfisziert oder zerstört worden. Oder sie hatte ihn verloren.
Ärgerlich verließ Cress den Link. Mit ein paar eiligen Anschlägen auf der Tastatur öffnete sie ein Dutzend neuer Fenster, die das Netz ununterbrochen nach Nachrichten über den lunarischen Cyborg absuchten, der vor einer Woche inhaftiert worden war. Über Linh Cinder. Das Mädchen, das aus einem Gefängnis in Neu-Peking geflohen war. Das Mädchen, das Cress’ einzige Chance gewesen war, Imperator Kaito die Wahrheit über Königin Levanas Absichten zu sagen, wenn er sich auf die Heiratsallianz einlassen würde.
Die wichtigste Seite war schon seit elf Stunden nicht mehr aktualisiert worden. In der Hysterie über die lunarische Invasion schien die Erde ihren meistgesuchten Flüchtling vollkommen vergessen zu haben.
»Große Schwester?«
Cress umklammerte die Stuhllehne. »Ja, Kleine Cress?«
»Schiff der Herrin entdeckt. Erwartete Ankunft in zweiundzwanzig Sekunden.«
Cress schoss in die Höhe, das Wort Herrin hatte in all den Jahren nichts von seinem Grauen verloren.
Ihre Bewegungen glichen einem präzise choreografierten Tanz, den sie in all den Jahren vervollkommnet hatte. Während Kleine Cress die Sekunden abzählte, stellte sie sich vor, wie eine Ballerina aus der Zweiten Ära im Halbdunkel über eine Bühne zu tänzeln.
00.21 Auf den Knopf zum Herunterlassen der Matratze drücken.
00.20 Sich wieder zu den Schirmen umdrehen und alle Nachrichten über Linh Cinder unter Lagen von lunarischer Propaganda verstecken.
00.19 Die Matratze landet mit einem dumpfen Aufprall auf dem Boden. Kissen und Decke sind noch so zusammengeknüllt wie nach dem Aufstehen.
00.18 … 17 … 16 Mit tanzenden Fingerkuppen Nachrichten und Internetgruppen von der Erde wegklicken.
00.15 Eine volle Drehung. Nach den Ecken der Bettdecke suchen.
00.14 Eine lockere Bewegung aus den Handgelenken und die Decke bläht sich wie ein Segel in der Luft.
00.13 … 12 … 11 Die Laken glatt ziehen und sich den anderen Bildschirmen ihres Wohnraums zuwenden.
00.10 … 09 Spielfilme, Musik und Literatur aus der Zweiten Ära der Erde: weg damit.
00.08 Eine Pirouette zum Bett. Anmutiges Fallenlassen der Decke.
00.07 Zwei Kissen aufschütteln und symmetrisch am Kopfteil anordnen. Die Haarsträhne, die unter der Decke liegt, hervorziehen.
00.065 Eine Rutschpartie über den Boden im Zickzack, um alle Socken und Haarklemmen aufzusammeln und sie in den Wäscheschacht zu pfeffern.
00.043 Schreibtische abwischen, die einzige Schüssel, den einzigen Löffel, das einzige Glas in den Vorratsschrank stellen.
00.02 Ein letztes Herumwirbeln. Ein letzter Blick auf ihre Arbeit.
00.01 Erleichtert ausatmen, übergehend in eine anmutige Verbeugung.
»Die Herrin ist eingetroffen«, sagte Kleine Cress. »Sie wartet auf das Ausfahren des Kopplungssystems.«
Die Bühne, das Halbdunkel, die Musik – alles war wie weggeblasen, nur das geübte Lächeln blieb.
»Selbstverständlich«, flötete sie und wandte sich zur großen Einstiegsluke. Es gab zwei Luken, aber nur eine wurde benutzt. Sie war sich nicht einmal sicher, ob der gegenüberliegende Eingang funktionierte. Beide Luken waren mit zusätzlichen Metalltüren gesichert und hinter ihnen war nichts als das All.
Es sei denn, es hatte dort – so wie jetzt – ein Beischiff angedockt. Das der Herrin.
Cress tippte einen Befehl ein. Ein Diagramm auf dem Bildschirm zeigte an, wie das Kopplungssystem langsam ausgefahren wurde. Cress hörte den Aufprall, als das Schiff mit einem Ruck andockte.
Was nun kam, kannte sie im Schlaf; sie konnte sogar vorhersagen, wie viele Herzschläge zwischen den vertrauten Geräuschen lagen. Wie die Motoren des kleinen Raumschiffs herunterfuhren. Das Klacken der Luke beim Andocken. Das Zischen der Luftschleuse. Dann der Piepton zur Bestätigung, dass man nun zwischen beiden Einheiten wechseln konnte. Das Öffnen des Raumschiffs. Schritte, die im Verbindungsgang widerhallten. Das Pfeifen der Tür zum Satelliten.
Es hatte eine Zeit gegeben, in der Cress auf Wärme und Freundlichkeit von der Herrin gehofft hatte. Darauf, dass Sybil sie einmal ansehen und sagen würde: »Meine liebe, süße Cress, du hast das Vertrauen und den Respekt Ihrer Majestät, der Königin, verdient. Deswegen darfst du jetzt auch als eine von uns mit mir nach Luna zurückkehren.«
Doch das war schon lange her und Cress’ geübtes Lächeln blieb selbst im Angesicht der Kälte ihrer Herrin unverändert. »Ich wünsche Euch einen guten Tag, Herrin.«
Sybil schnaubte. Die bestickten Ärmel ihrer weißen Jacke breiteten sich über den großen Kasten in ihren Händen, in dem der übliche Proviant für Cress war: Essen und frisches Wasser und natürlich das Medizintäschchen. »Dann hast du sie also gefunden?«
Bei Sybils eisigem Lächeln erschrak Cress. »Sie gefunden, Herrin?«
»Wenn es ein guter Tag ist, dann musst du wohl die einfache Aufgabe gelöst haben, die ich dir übertragen habe. Und hättest dich einmal als nützlich erwiesen. Also, Crescent, hast du den Cyborg gefunden?«
Cress senkte den Blick und bohrte die Fingernägel in die Handflächen. »Nein, Herrin, ich habe sie nicht gefunden.«
»Ich verstehe. Dann ist es also doch kein guter Tag.«
»Ich meinte auch nur … Eure Gesellschaft ist immer …« Sie brach ab. Sie zwang sich, ihre Hände zu lösen und Herrin Sybils Blick zu erwidern. »Ich habe gerade die Nachrichten gesehen, Herrin. Und ich habe mir gedacht, wir wären erfreut über die Verlobung Ihrer Majestät.«
Sybil setzte den Kasten auf das glattgestrichene Bett. »Wir sind erst zufrieden, wenn die Erde unter der Kontrolle Lunas ist. Bis dahin gibt es viel Arbeit, und du solltest keine Zeit mit Nachrichten und Klatsch verschwenden.«
Sybil näherte sich dem Monitor, auf dem sich der geheime D-TELE verbarg, der Beweis, dass Cress sich der lunarischen Krone widersetzte. Cress stand wie angewurzelt da. Aber Sybil stellte nur den Schirm dahinter ab, auf dem Imperator Kaito vor einer Flagge des Asiatischen Staatenbundes sprach. Der Bildschirm wurde durchsichtig, dahinter kam die Metallwand und ein Gewirr von Heizrohren zum Vorschein.
Langsam atmete Cress aus.
»Ich darf aber doch sicherlich annehmen, dass du irgendetwas gefunden hast.«
Cress richtete sich auf. »Linh Cinder wurde gegen achtzehn Uhr Ortszeit in der Europäischen Föderation gesichtet, in einer kleinen südfranzösi–«
»Das ist mir längst bekannt. Und dann ist sie weiter nach Paris, wo sie einen Thaumaturgen und ein paar nutzlose Spezialagenten getötet hat. Sonst noch etwas, Crescent?«
Cress schluckte und wickelte sich ein paar Haarsträhnen um die Handgelenke. »Um 17.48 Uhr hat ein Angestellter eines Ersatzteilladens für Raumschiffe im französischen Rieux ein Update der Inventur des Ladens vorgenommen. Er hat eine Batterie gestrichen, die mit einer Albatros 214, Typ 11.3 kompatibel ist, aber keine Zahlung vermerkt. Ich habe mir gedacht, dass Linh Cinder sie vielleicht gestohlen … oder ihn vielleicht mit ihrem Zauber …« Sie stockte. Sybil tat immer so, als sei sie fest davon überzeugt, dass der Cyborg eine Hülle war, dabei wussten sie natürlich beide, dass das nicht stimmte. Im Gegensatz zu Cress, die tatsächlich eine Hülle war, hatte Linh Cinder die lunarische Gabe. Sie hatte vielleicht unter irgendetwas begraben oder versteckt gelegen, aber auf dem alljährlichen Ball des Staatenbundes war sie mit aller Macht zum Vorschein gekommen.
»Eine Batterie?«, fragte Sybil und überging Cress’ Zögern.
»Sie konvertiert verdichteten Wasserstoff in Energie, um etwas anzutrei–«
»Ich weiß, was eine Batterie ist!«, fuhr Sybil sie an. »Willst du mir etwa sagen, du hast nur herausgefunden, dass sie ihr Schiff repariert? Und es demzufolge noch schwerer wird, sie aufzuspüren? Was du ja noch nicht einmal geschafft hast, als sie auf der Erde waren?«
»Tut mir leid, Herrin. Ich versuche es ja. Es ist nur so …«
»Ich habe kein Interesse an deinen Ausflüchten. All die Jahre habe ich Ihre Majestät davon überzeugen können, dich am Leben zu lassen. Doch die Bedingung dafür ist, dass du etwas Wertvolles zu geben hast, etwas Wertvolleres als dein Blut. Hab ich mich etwa getäuscht? Hätte ich dich lieber nicht protegieren sollen, Crescent?«
Cress biss sich auf die Unterlippe und verkniff sich aufzuzählen, was sie seit ihrer Inhaftierung alles für Ihre Majestät getan hatte. Sie hatte unzählige Spionagesysteme erfunden, die die Herrscher der Erde ausforschten, hatte sich in die Kommunikationswege zwischen Diplomaten eingehackt und Satellitensignale gestört, damit die Soldaten der Königin unbemerkt auf der Erde landen konnten – und nun klebte das Blut von sechzehntausend Erdbewohnern an ihren Händen. Aber all das schien keine Rolle zu spielen, denn Sybil sah immer nur ihre Versäumnisse. Und dass sie Linh Cinder nicht fand, war Cress’ größtes Versäumnis.
»Es tut mir leid, Herrin. Ich werde mir noch mehr Mühe geben.«
Sybils Augen verengten sich zu Schlitzen. »Ich werde sehr verstimmt sein, wenn du das Mädchen nicht bald findest.«
Unter Sybils Blick fühlte sich Cress wie eine Motte, die man auf ein Sezierbrett gepinnt hatte. »Ja, Herrin.«
»Gut«, sagte Sybil und tätschelte ihr die Wange. Es fühlte sich fast wie die lobende Geste einer Mutter an, aber nur fast. Dann betätigte Sybil den Schließmechanismus des Kastens. »Und nun«, sagte sie und holte eine Injektionsnadel hervor, »halt mir deinen Arm hin.«
2
Wolf schwang sich von der Kiste und schoss auf sie zu. Cinder kämpfte gegen die aufsteigende Panik. Obwohl er sie noch nie verletzt hatte, spannte sie jetzt jeden Muskel an. Sie kniff die Augen zusammen. Gleich würde seine Faust auf sie niedersausen. Sie konzentrierte sich.
Der Schmerz fuhr ihr wie ein Meißel in den Kopf. Sie biss die Zähne zusammen, um sich gegen die Woge der Übelkeit zu wappnen. Der Schlag kam nicht.
»Öffne. Deine. Augen.«
Mit verkrampften Kiefern zwang sie sich, erst ein Auge zu öffnen, dann das andere. Wolf stand direkt vor ihr, seine rechte Hand schwebte in der Luft knapp neben ihrem Ohr.
Sein Körper war wie aus Stein – weil sie ihn zurückhielt. Sie spürte seine heiße Energie. Nur mit der Kraft ihrer lunarischen Gabe hielt sie ihn in Schach. »Mit geschlossenen Augen fällt es mir leichter«, fauchte sie ihn an. Selbst die paar Worte kosteten sie große Anstrengung. Wolfs Finger zuckten. Er kämpfte gegen ihre Macht.
Plötzlich warf er einen schnellen Blick hinter sie, und unmittelbar darauf fuhr ihr ein dumpfer Stoß zwischen die Schulterblätter und ließ sie nach vorne gegen Wolfs Brust taumeln. Er konnte sie gerade noch rechtzeitig auffangen.
Hinter ihr kicherte Thorne. »Und man kann sich leichter an dich heranschleichen.«
Cinder wirbelte herum und versetzte Thorne einen Stoß. »Hast du den Verstand verloren? Das ist doch kein Spiel!«
»Thorne hat Recht«, sagte Wolf. Er klang erschöpft. Sie war nicht sicher, ob von den ständigen Kämpfen oder von der Anstrengung, eine Anfängerin wie sie trainieren zu müssen. »Wenn du die Augen schließt, bist du angreifbar. Du musst lernen, deine Umgebung bewusst wahrzunehmen, auch wenn du die Gabe anwendest, damit du jederzeit eingreifen kannst.«
»Eingreifen?«
Wolf reckte den Kopf, bis sein Nacken laut knackte, dann schüttelte er Arme und Beine aus. »Ja, eingreifen. Was, wenn wir es mit einem Dutzend Soldaten zu tun haben? Mit etwas Glück kannst du vielleicht neun oder zehn von ihnen manipulieren – obwohl mir das im Moment mehr als optimistisch vorkommt.«
Sie rümpfte die Nase.
»Das bedeutet, du bist den anderen immer noch schutzlos ausgeliefert. Du musst lernen, ganz da zu sein, wenn du mich kontrollierst. Mental und körperlich.« Er ging einen Schritt zurück und raufte sich die Haare. »Wenn sich selbst Thorne an dich heranschleichen kann, stecken wir in ernsten Schwierigkeiten.«
Thorne krempelte die Ärmel hoch. »Unterschätz niemals die Gerissenheit eines kriminellen Superhirns.«
Scarlet saß im Schneidersitz auf einer Frachtkiste, wo sie sich ihre Schüssel Haferbrei schmecken ließ, und lachte plötzlich lauthals. »Kriminelles Superhirn? Wir zerbrechen uns jetzt schon seit einer geschlagenen Woche den Kopf, wie wir uns bei der königlichen Hochzeit einschleusen können. Und was machst du? Versuchst rauszufinden, welches Palastdach das größte ist, damit dein heiß geliebtes Schiff bei der Landung keine Kratzer abbekommt.«
Ein paar Deckenlampen flackerten auf. »Ich bin absolut einverstanden mit Kapitän Thornes Prioritäten«, schaltete sich Iko über die Lautsprecher ein. »Es könnte sich um meinen ersten großen Auftritt im Netz handeln, und dabei möchte ich so gut wie möglich rüberkommen, vielen Dank.«
»Das hast du schön gesagt, Süße.« Thorne zwinkerte zum Lautsprecher hinauf, obwohl Ikos Sensoren solche Feinheiten nicht erfassen konnten. »Und ich möchte euch anderen darauf aufmerksam machen, dass Iko mich korrekterweise mit Kapitän angesprochen hat. Ihr könnt euch alle eine Scheibe von ihr abschneiden.«
Scarlet lachte wieder, während Wolf sich kaum die Mühe machte, eine Augenbraue zu heben. Im Frachtraum stieg die Temperatur an; Iko stieg das Kompliment zu Kopf. Cinder beachtete sie nicht weiter, sondern leerte in einem Zug ein Glas lauwarmes Wasser. Wolfs Warnung machte ihr zu schaffen. Sie wusste, dass er Recht hatte. Wolf unter Kontrolle zu bekommen, beanspruchte all ihre Fähigkeiten, während ihr die Manipulation von Erdbewohnern wie Thorne und Scarlet so leicht von der Hand ging, wie einen kaputten Androiden-Sensor auszuwechseln.
Mittlerweile hätte sie eigentlich zu beidem in der Lage sein müssen.
»Auf ein Neues«, sagte sie und zog ihren Pferdeschwanz straff.
Wolf sah sie aufmerksam an. »Vielleicht solltest du mal eine Pause machen.«
»Wenn die Soldaten der Königin hinter mir her sind, kann ich ja auch keine Pause einlegen, stimmt’s?« Sie lockerte die Schultern, um ihren Kreislauf in Bewegung zu bringen. Die Kopfschmerzen hatten nachgelassen, aber ihr T-Shirt klebte ihr schweißdurchnässt am Rücken und ihre Muskeln zitterten von dem zweistündigen Kampf gegen Wolfs Bioenergie.
Wolf rieb sich die Schläfen. »Hoffentlich wirst du nie mit den echten königlichen Soldaten konfrontiert. Wahrscheinlich haben wir gegen die Thaumaturgen und Spezialagenten eine Chance, aber die hochgezüchteten Soldaten sind eine ganz andere Sache. Das sind eher Bestien als Menschen und Gehirnmanipulationen mögen sie gar nicht.«
»Aber Menschen mögen das, oder wie?«, fragte Scarlet und nahm noch einen Löffel.
Er warf ihr einen Blick zu und seine Gesichtszüge wurden ganz weich. Seit Scarlet und er zur Belegschaft der Albatros gestoßen waren, hatte Cinder diesen zärtlichen, intimen Blick schon Hunderte Male gesehen und doch musste sie jedes Mal intuitiv wegsehen, weil sie sich wie ein Eindringling vorkam. »Sie sind unberechenbar, auch wenn sie unter dem Einfluss eines Thaumaturgen stehen. Oder irgendeines Lunariers. Die Soldaten werden einer genetischen Veränderung unterzogen, die sich nicht nur physisch, sondern auch psychisch auswirkt. Sie sind wild und äußerst gefährlich.«
Thorne lehnte sich an Scarlets Frachtkiste und flüsterte ihr so laut zu, dass alle es hören konnten: »Er weiß aber schon, dass er ein ehemaliger Straßenkämpfer ist und sich ›Wolf‹ nennt, oder?«
Cinder biss sich auf die Innenseite ihrer Wange, um nicht loszulachen. »Nur ein weiterer Grund, mich so gut vorzubereiten, wie ich kann. Ich tue alles dafür, dass es nicht noch mal so eng wird wie in Paris.«
»Da bist du nicht die Einzige.« Wolf wippte auf den Fußballen. Früher hatte Cinder geglaubt, dass er damit seine Kampfbereitschaft signalisieren wollte, aber inzwischen wusste sie, dass es einfach zu ihm gehörte, er war immer ruhelos, immer in Bewegung.
»Dabei fällt mir ein, dass ich gern noch ein paar von diesen Beruhigungspfeilen hätte, wenn wir das nächste Mal landen. Je weniger Soldaten wir bekämpfen oder manipulieren müssen, desto besser.«
»Beruhigungspfeile, geht in Ordnung. Ich habe mir außerdem die Freiheit genommen, diese praktische Countdown-Uhr zu programmieren. Der Countdown läuft. Bis zur königlichen Hochzeit sind es noch fünfzehn Tage und neun Stunden.« Auf dem Netscreen erschien eine riesige Digitaluhr, auf der die Zeit in Zehntelsekunden ablief.
Bei dem Anblick wurde Cinder übel. Dann überflog sie eine Liste ihres aktuellen Masterplans zur Verhinderung einer Hochzeit zwischen Kai und Levana. Links neben der Uhr waren Dinge aufgelistet, die sie noch besorgen mussten: Waffen, Werkzeuge, Verkleidungen. Die Beruhigungspfeile waren bereits notiert.
In der Mitte des Bildschirms war der Plan des Palastes in Neu-Peking.
Rechts daneben eine endlose Aufstellung von Vorbereitungen. Obwohl sie den Plan nun schon seit Tagen ausarbeiteten, war noch kein einziger Punkt erledigt.
Punkt eins bestand darin, Cinder auf den unvermeidlichen Augenblick vorzubereiten, in dem sie Königin Levana und ihrem Hof erneut von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würde. Obwohl Wolf es nicht geradeheraus gesagt hatte, wusste Cinder, dass sich ihre lunarische Gabe zu langsam entfaltete. Sie glaubte allmählich, es würde Jahre dauern, bis sie Punkt eins abhaken konnten. Und ihnen blieben nur noch zwei Wochen!
Der grobe Plan war, am Tag der Hochzeit ein Ablenkungsmanöver zu starten, so dass sie sich während der Zeremonie in den Palast einschmuggeln und aller Welt verkünden konnten, dass Cinder die verschollene Prinzessin Selene war. Im Licht der internationalen Medien würde Cinder von Levana die Krone fordern. Mit einem Schlag würden sie also nicht nur die Hochzeit verhindern, sondern auch Levanas Herrschaft beenden.
Was danach kam, vermochte Cinder sich kaum vorzustellen. Ihr machten vor allem die mutmaßlichen Reaktionen der Lunarier zu schaffen, wenn sie erfuhren, dass ihre verloren geglaubte Prinzessin nicht nur ein Cyborg war, sondern auch so gut wie nichts von ihrer Kultur, ihren Traditionen und ihrer politischen Ausrichtung wusste. Nur die Überzeugung, dass sie unter keinen Umständen eine schrecklichere Herrscherin als Levana sein konnte, bewahrte Cinder davor, zu verzweifeln.
Sie hoffte nur, dass die anderen das auch so sahen.
In ihrem Bauch blubberte das Wasser, das sie in sich hineingekippt hatte. Zum tausendsten Mal überkam sie das Bedürfnis, sich so lange unter der Bettdecke ihrer Koje zu verkriechen, bis alle Welt vergessen hatte, dass es überhaupt jemals eine Prinzessin gegeben hatte.
Stattdessen wandte sie den Blick vom Screen und lockerte die Muskeln. »Alles klar, ich bin bereit. Wir probieren es noch mal«, sagte sie und stellte sich in die Kampfhaltung, die Wolf ihr beigebracht hatte.
Aber nun saß Wolf neben Scarlet und kratzte ihren Haferbrei aus. Mit vollem Mund deutete er auf den Fußboden. »Liegestütze.«
Cinder ließ ihre Arme sinken. »Was?«
Er richtete den Löffel auf sie. »Wir verbinden das jetzt mal und trainieren gleichzeitig deinen Körper und deinen Geist. Achte auf deine Umgebung. Konzentrier dich!«
Fünf Sekunden sah sie ihn zornig an, dann ließ sie sich gehorsam zu Boden fallen.
Sie hatte gerade bis elf gezählt, als Thorne von der Kiste sprang. »Wisst ihr, als Kind hat man mir weisgemacht, Prinzessinnen trügen Diademe und gäben Teegesellschaften. Jetzt treffe ich eine echte Prinzessin und ich muss schon sagen: Ich bin ein bisschen enttäuscht.«
Cinder wusste nicht, ob das eine Beleidigung sein sollte, aber allein das Wort »Prinzessin« machte sie nervös.
Sie atmete scharf aus und folgte Wolfs Anweisungen. Konzentrierte sich. Wie leicht es ihr fiel, Thornes Energie zu kanalisieren, als er an ihr vorbei zum Cockpit ging!
Sie war gerade bei ihrem vierzehnten Liegestütz, als sie Thorne dazu brachte, stehen zu bleiben.
»Hey!«
Cinder drückte sich hoch und kickte Thorne gegen die Wade. Er schrie auf und landete ächzend auf dem Hinterteil.
Freudestrahlend sah Cinder Wolf an und hoffte auf ein Lob, doch Scarlet und er konnten sich kaum halten vor Lachen. Selbst seine spitzen Eckzähne blitzten, die er immer verbarg.
Cinder stand auf und reichte Thorne die Hand. Auch er musste grinsen, wenn auch etwas verzerrt, während er sich die Hüfte rieb.
»Wenn wir die Welt gerettet haben, suchen wir beide ein Diadem aus.«
3
Der Satellit bebte, als Sybils Beischiff sich aus dem Kopplungssystem löste und Cress wieder allein in der Galaxie war. Obwohl sie sich so sehr nach Gesellschaft sehnte, war sie heute noch erleichterter als sonst, als Sybil wieder fort war. Normalerweise kam die Herrin nur alle drei bis vier Wochen, um eine Blutprobe zu nehmen, aber seit den Angriffen der Wolfshybriden war das bereits ihr dritter Besuch. Nie zuvor war die Herrin so nervös gewesen. Königin Levana schien immer verzweifelter nach dem Cyborg-Mädchen zu suchen.
»Die Herrin ist weg. Spielen wir jetzt was?«
Wenn sie nicht noch so mit Sybils Besuch beschäftigt gewesen wäre, hätte Cress gelächelt, wie immer, wenn Kleine Cress ihr diese Frage stellte. Denn es zeigte ihr, dass sie doch nicht ganz allein war.
Vor Jahren hatte Cress herausgefunden, dass das Wort »Satellit« aus dem Lateinischen stammte und »Begleiter«, »Günstling« oder auch »unterwürfiger Knecht« bedeutete. Das hatte sie angesichts ihrer Einsamkeit immer als bittere Ironie empfunden, doch seit sie Kleine Cress programmiert hatte, sah sie das etwas anders.
Der Satellit leistete ihr tatsächlich Gesellschaft. Er hörte immer auf sie, stellte ihr keine dummen Fragen und nervte sie nie mit irgendwelchen verrückten Ideen.
»Später vielleicht«, sagte sie. »Wir müssen erst die Ordner durchgehen.«
»Selbstverständlich, große Schwester.«
Das war die zu erwartende Antwort, schließlich hatte sie sie selbst programmiert.
Cress fragte sich oft, ob es sich so anfühlte, wenn man die lunarische Gabe besaß, dass man so eine Macht auf ein menschliches Wesen ausüben konnte. Sie träumte davon, Herrin Sybil so programmieren zu können wie die Satellitenstimme. Wie schön wäre es, wenn die Herrin einmal nach ihrer Pfeife tanzen müsste!
»Alle Schirme einschalten.«
Cress stand vor dem Panorama der kleinen und großen Bildschirme, die auf dem eingebauten Schreibtisch und ringsherum an der Wand platziert waren. In dem kreisrunden Raum hatte sie von überall eine optimale Sicht.
»Alle Verbindungen trennen.«
Die Schirme wurden transparent; dahinter kam die schmucklose Wand zum Vorschein.
»Ordner anzeigen: Linh Cinder; 214er Albatros, Typ 11.3; Imperator Kaito vom Asiatischen Staatenbund. Und …« Sie zögerte und genoss die Vorfreude: »Carswell Thorne.«
Auf vier Bildschirmen erschienen die gewünschten Informationen. Cress setzte sich und betrachtete die Dokumente, die sie inzwischen fast auswendig kannte.
Am Morgen des neunundzwanzigsten Augusts waren Linh Cinder und Carswell Thorne aus dem Gefängnis von Neu-Peking ausgebrochen. Vier Stunden später hatte Sybil Cress einen Befehl erteilt: Finde sie. Er stammte von Königin Levana höchstpersönlich, wie Cress im Nachhinein herausfand.
Um Informationen über Linh Cinder zu beschaffen, hatte sie nur drei Minuten gebraucht – aber sie waren fast alle frei erfunden. Eine gefälschte irdische Identität für ein Mädchen aus Luna. Cress konnte nicht einmal herausfinden, wie lange Linh Cinder schon auf der Erde lebte. Die elfjährige Linh Cinder war vor rund fünf Jahren urplötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Cress fand auch Angaben zu ihrer vorgeblichen Familie und zu ihrer Schule. Dann kam der »Hover-Unfall«, der ihre »Eltern« tötete und zu der Cyborg-Operation führte. Bei dem Versuch, Linh Cinders Abstammung zurückzuverfolgen, landete Cress schon nach den Großeltern in einer Sackgasse. Die Angaben zu ihrer Identität waren nur ein missglückter Versuch, irgendetwas zu vertuschen.
Cress überflog Linh Cinders Ordner und widmete sich dann den Informationen über Imperator Kaito.
Seine Datei war bedeutend größer, da jeder Augenblick seines bisherigen Lebens festgehalten worden war – sowohl von Fangruppen im Netz als auch von offizieller Regierungsseite. Ständig kam etwas Neues dazu, und seit der Bekanntgabe seiner Verlobung mit der Königin von Luna gab es kein Halten mehr. Nichts davon half ihr jetzt weiter. Cress schloss die Datei.
Carswell Thornes Akte hatte ihr etwas mehr Kleinarbeit abverlangt. Sie hatte vierundvierzig Minuten gebraucht, um sich in die Datenbank des Militärs und weiterer fünf Ämter der Amerikanischen Republik einzuhacken. Dann hatte sie Gerichtsprotokolle und Artikel zusammengestellt, Militärakten und Schuldokumente, die Daten seiner Fahr- und Flugprüfungen sowie sämtliche Einkommenssteuererklärungen. Und sie fand eine Chronik, an deren Anfang seine Geburtsurkunde stand, gefolgt von unzähligen Auszeichnungen und Preisen, die er in seiner Jugend gewonnen hatte. Mit siebzehn war er dann in die Armee der Amerikanischen Republik aufgenommen worden. An seinem neunzehnten Geburtstag klaffte eine Lücke. Da hatte Thorne seinen ID-Chip entfernt, ein Raumschiff gestohlen und war desertiert. Ab diesem Zeitpunkt war er zum kriminellen Einzelgänger geworden.
Acht Monate später setzte sich die Chronik fort: Thorne war im Asiatischen Staatenbund aufgegriffen und verhaftet worden.
Neben den offiziellen Berichten waren nach seinem zweifelhaften Ruhm ziemlich viele Fanclubs aus dem Boden geschossen. Wenn er auch nicht annähernd so viele Fans hatte wie Imperator Kai, schienen doch viele irdische Mädchen den gut aussehenden Ganoven, der sich auf der Flucht vor dem Gesetz befand, attraktiv zu finden. Cress scherte sich nicht weiter um sie, denn sie wusste, dass die anderen einen vollkommen falschen Eindruck von Thorne hatten.
Seine Akte krönte ein dreidimensionales Hologramm, das ihn bei einer militärischen Zeremonie zeigte. Cress zog dieses dem berühmten Gefängnisfoto vor, auf dem er in die Kamera winkte. Denn auf dem Hologramm trug er eine frisch gebügelte Uniform mit glänzenden Silberknöpfen und hatte ein schiefes, selbstsicheres Grinsen aufgesetzt.
Wenn Cress dieses Grinsen nur sah, schmolz sie dahin.
»Hallo, Mr Thorne«, hauchte sie dem Hologramm wie üblich zu. Dann widmete sie sich seufzend dem letzten Ordner.
Der Albatros 214, Typ 11.3, dem militärischen Frachtschiff, das Thorne gestohlen hatte. Cress wusste alles über das Schiff, von der Raumaufteilung bis zum Wartungsplan – dem ordnungsgemäßen und dem tatsächlichen.
Einfach alles.
Einschließlich seiner Position.
Sie klickte auf ein Symbol in der Menüleiste und ersetzte damit Carswell Thornes Hologramm durch ein Koordinatennetz zur galaktischen Positionsbestimmung. Die Erdkugel schob sich ins Bild. Die Umrisse ihrer Kontinente waren Cress ebenso vertraut wie Kleine Cress. Schließlich hatte sie ihr halbes Leben damit zugebracht, diesen Planeten aus einer Entfernung von sechsundzwanzigtausendeinundsiebzig Kilometern zu betrachten.
Von der Erde bis zum Mars flackerten Tausende kleiner Pünktchen, die Raumschiffe und Satelliten anzeigten. Nach einem flüchtigen Blick aus dem Fenster bemerkte Cress, dass ein ahnungsloses Aufklärungsschiff des Asiatischen Staatenbundes an ihrem unauffindbaren Satelliten vorbeiflog. Früher hätte sie sich zurückhalten müssen, um es nicht freudig zu begrüßen, aber was brachte das schon?
Kein Erdbewohner würde jemals einem Lunarier trauen, geschweige denn einen retten.
Cress ignorierte das Schiff und ließ summend die winzigen Markierungspunkte verschwinden, bis nur noch die ID der Albatros übrig blieb. Ein einzelner gelber, überproportional großer Punkt. Sie bestimmte seine Distanz zur Erde.
Das Schiff befand sich zwölftausendvierhundertvierzehn Kilometer über dem Atlantischen Ozean. Dann rief sie die ID ihres eigenen Satelliten in der Umlaufbahn ab. Die Luftlinie von ihrem Satelliten bis zur Erdmitte durchschnitt die Küste der Provinz Japan.
Sie waren weit voneinander entfernt. Wie immer. Schließlich war die Erdumlaufbahn gigantisch groß.
Die Koordinaten der Albatros ausfindig zu machen, war der Höhepunkt in Cress’ Karriere als Hackerin gewesen. Doch selbst dafür hatte sie nur drei Stunden und einundfünfzig Minuten gebraucht, obwohl ihr Puls gerast war und ihr das Adrenalin in den Adern gerauscht hatte.
Sie musste sie als Erste finden.
Um sie zu beschützen.
Am Ende war es eine Frage der Logik gewesen: Über das Satellitenfunknetz hatte sie Signale von allen Schiffen abgefangen, die die Erde umrundeten. Die, die sich zurückverfolgen ließen, konnte sie von vornherein ausschließen, denn auf der Albatros waren alle Geolokationsinstrumente ausgebaut und über Bord geworfen worden. Dann sortierte sie alle aus, die zu groß oder zu klein waren.
Es blieben hauptsächlich lunarische Schiffe übrig, und die standen bereits alle unter ihrer Beobachtung. Seit vielen Jahren störte sie die von ihnen ausgehenden Signale und Radarwellen. Viele Erdbewohner glaubten, Schiffe aus Luna wären auf Grund irgendwelcher lunarischen Manipulationen unsichtbar. Wenn sie nur wüssten, dass es eine wertlose Hülle war, die ihnen so viele Schwierigkeiten bereitete!
Letztendlich erfüllten nur drei Schiffe in der Umlaufbahn die Suchkriterien. Zwei davon – offensichtlich Piratenschiffe – waren gar nicht erst auf der Erde gelandet, als sie bemerkten, dass sie in den groß angelegten Suchaktionen sofort aufgegriffen worden wären. Aus Neugier hatte sich Cress etwas später in irdische Polizeiakten eingeklinkt und herausgefunden, dass beide Schiffe bei dem Versuch, wieder in die Erdatmosphäre zurückzukehren, entdeckt worden waren. Keine cleveren Kriminellen.
So blieb nur noch ein Schiff übrig. Die Albatros mit Linh Cinder und Carswell Thorne an Bord.
Innerhalb von zwölf Minuten hatte Cress ihre genaue Position lokalisiert und alle Signale verschlüsselt, durch die sie aufgespürt werden konnten. Wie von Zauberhand war die 214er Albatros im All verschwunden.
Zitternd vor Anstrengung war Cress danach in ihr ungemachtes Bett gefallen und hatte glücklich die Decke angestrahlt. Sie hatte es geschafft! Jetzt waren sie unsichtbar!
Ein Zwitschern von einem der Bildschirme lenkte Cress von dem schwebenden Pünktchen ab, hinter dem sich die Albatros verbarg. Cress drehte sich auf dem Stuhl herum und zuckte zusammen, als sich eine Haarsträhne in den Rollen verfing. Mit einer Hand zog sie sie heraus und mit der anderen stupste sie den Schirm an. Dann vergrößerte sie die Ansicht.
VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN DER DRITTEN ÄRA
»Nicht schon wieder«, murmelte sie.
Seit dem Verschwinden des Cyborg-Mädchens geiferten die Verschwörungstheoretiker um die Wette. Linh Cinder arbeite für die Regierung des Staatenbundes oder für Königin Levana oder sie steckte mit einem Geheimbund unter einer Decke und sei darauf angesetzt worden, verschiedene Regierungen zu stürzen. Sie sei die verschollene Prinzessin von Luna oder kenne zumindest deren Aufenthaltsort. Sie habe etwas mit der Verbreitung der Letumose zu tun. Oder sie habe Imperator Kaito verführt und trage einen lunarisch-irdischen Cyborg-Bastard aus.
Fast so viele Gerüchte drehten sich um Carswell Thorne. Was war denn nun der wahre Grund für seinen Gefängnisaufenthalt? Die Planung eines Attentats auf den verstorbenen Imperator oder die angebliche Zusammenarbeit mit Linh Cinder schon Jahre vor seiner Verhaftung? Oder die Verbindung zu einem Untergrundnetzwerk, das in weiser Voraussicht das Gefängnissystem infiltriert hatte? Nach der allerneuesten Verschwörungstheorie war Carswell Thorne in Wahrheit ein verdeckter lunarischer Thaumaturg, der Linh Cinder zur Flucht verhelfen sollte, um Luna einen Vorwand für den Kriegsbeginn zu liefern.
Im Grunde wusste niemand Bescheid.
Außer Cress, die alles wusste über Carswell Thornes Straftaten, das Gerichtsverfahren und seine Flucht – zumindest über den Teil der Flucht, den sie sich von den Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis und den Aussagen der Wächter zusammenreimen konnte.
Cress war jedenfalls fest davon überzeugt, dass sie mehr über Carswell Thorne wusste als irgendein anderer. Er war unversehens zum Mittelpunkt ihres eintönigen Lebens geworden. Anfangs hatten sie seine offensichtliche Habgier und Rücksichtslosigkeit abgestoßen. Bei seiner Desertion hatte er ein halbes Dutzend Kadetten und zwei Offiziere auf einer Insel in der Karibik zurückgelassen. Einem privaten Sammler hatte er wertvolle Göttinnenstatuen der Zweiten Ära gestohlen und aus einem Museum in Australien venezuelische Traumpuppen entwendet, die aller Wahrscheinlichkeit nach nun nie wieder der Öffentlichkeit gezeigt werden konnten. Außerdem legte man ihm einen missglückten Raub antiker Schmuckstücke bei einer jungen Witwe aus dem Asiatischen Staatenbund zur Last.
Fasziniert von seiner Selbstzerstörung hatte Cress seine Vergangenheit immer weiter durchforstet. Wie bei der nahenden Kollision zweier Asteroiden konnte sie einfach nicht wegschauen.
Aber dann fielen ihr bei der Recherche einige merkwürdige Dinge auf.
Als Thorne acht Jahre alt war, stand ganz Los Angeles tagelang kopf, weil ein seltener Sumatra-Tiger aus dem Zoo entlaufen war. Die Überwachungskamera zeigte, wie der junge Carswell Thorne bei einem Ausflug mit der Klasse den Käfig geöffnet hatte. Später erklärte er den Ermittlern, er bereue seine Tat nicht, denn der Tiger habe hinter den Gitterstäben so traurig ausgesehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, nicht einmal der Tiger.
Er war elf, als seine Eltern bei der Polizei zu Protokoll gaben, sie seien über Nacht ausgeraubt worden – im Schmuckkasten seiner Mutter fehlte eine Diamantkette aus der Zweiten Ära. Die Kette tauchte auf einer Auktionsseite im Netz auf, wo sie gerade für 40000 Univs an einen brasilianischen Händler verkauft worden war. Carswell war aber noch nicht dazu gekommen, die Kette loszuschicken. Man zwang ihn, das Geld zurückzuüberweisen und sich öffentlich zu entschuldigen, damit andere Teenager seinem schlechten Beispiel nicht folgten. Er erklärte, dass er nur Geld für eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation hatte sammeln wollen, die für ältere Menschen Betreuungsangebote durch Androiden organisierte.
Im Alter von dreizehn Jahren wurde Carswell Thorne eine Woche lang von der Schule suspendiert, weil er sich mit drei Mitschülern geprügelt hatte. Dem Bericht des Schul-Medidroiden zufolge hatte er die Schlägerei verloren. Doch die drei Jungen hatten vorher einem Mädchen namens Kate Fallow den Portscreen gestohlen und Carswell wollte ihn ihr zurückgeben.
Diese Vorfälle hatten Cress nachdenklich gestimmt. Diebstahl, Gewalt, Hausfriedensbruch, Schulverweise, Verwarnungen durch die Polizei. Gab man ihm jedoch die Chance, sich zu den Vorwürfen zu äußern, hatte Carswell immer eine Erklärung parat. Gute Erklärungen, die ihr den Atem nahmen und ihr Herz höherschlagen ließen.
So langsam wie die Sonne über dem Horizont der Erde aufging, begann sich ihre Wahrnehmung zu verändern. Carswell Thorne war gar kein herzloser Schuft. Wenn man sich die Mühe machte, ihn kennenzulernen, entdeckte man seine mitfühlende und ritterliche Seite.
Er war ein Held, wie ihn sich Cress immer erträumt hatte.
Es dauerte nicht lange, bis sie jede wache Minute an Carswell Thorne dachte. Sie träumte von einer engen Seelenverwandtschaft, leidenschaftlichen Küssen und aufregenden Abenteuern. Sie war sich sicher, dass er augenblicklich das Gleiche für sie empfinden würde, wenn sie sich nur treffen könnten. Die große Liebe auf den ersten Blick und bis in alle Ewigkeit. Eine Liebe, der selbst der Tod nichts anhaben konnte.
Denn eines wusste Cress über Helden: Einer Jungfrau in Not konnten sie nicht widerstehen.
Und sie war eine Jungfrau in Not.
4
Scarlet presste einen Wattebausch auf Wolfs Mundwinkel und schüttelte den Kopf. »Sie trifft vielleicht nicht oft, aber wenn, dann richtig!«
Trotz der Kieferprellung strahlte Wolf. »Hast du gesehen, wie gekonnt sie mir ein Bein gestellt hat? So schnell konnte ich gar nicht reagieren!« Etwas benommen rieb er seine Hände an den Oberschenkeln ab und kickte mit den Füßen gegen den Tisch. »Ich glaube, wir machen endlich Fortschritte.«
»Schön, dass du stolz auf sie bist. Trotzdem wäre es gut, wenn sie das nächste Mal nicht mit ihrer Metallhand zuschlägt.«
Scarlet zog den Wattebausch zurück. Über dem oberen Reißzahn war Wolfs Lippe aufgeplatzt, die Wunde blutete aber nicht mehr so stark. Scarlet tupfte etwas von der Heilsalbe auf. »Noch eine Narbe für deine Sammlung. Wenigstens sieht dein Mund jetzt symmetrisch aus.«
»Die Narben sind mir egal.« Er zuckte die Achseln und sah sie verschmitzt an. »Jetzt kann ich endlich schöne Erinnerungen damit verbinden.«
Scarlet hielt inne, ein Klecks Salbe auf der Fingerspitze.
Wolf begutachtete seine verschränkten Finger, eine leichte Röte auf den Wangen.
Sofort wurde ihr warm. Sie erinnerte sich an die Nacht, die sie als blinde Passagiere an Bord einer Magnetschwebebahn verbracht hatten. Wie sie über die verblasste Narbe auf seinem Arm gestrichen hatte, wie sie ihn zärtlich auf die kleinen Kratzer im Gesicht geküsst hatte, wie er sie in den Arm genommen hatte …
Sie gab ihm einen Klaps auf die Schulter. »Grins nicht so«, sagte sie und tupfte noch etwas Salbe auf die Wunde. »Sonst hört das nie auf zu bluten.«
Seine Gesichtszüge entspannten sich zwar, aber als er zu ihr aufblickte, lag noch immer ein Glitzern in seinen Augen.
Bisher hatte es nur den einen Kuss in der Magnetschwebebahn gegeben. Als sie von seinem Rudel gefangen genommen worden war, hatte er sie zwar auch geküsst, aber nur, um ihr heimlich einen ID-Chip zu geben, der ihr letztendlich zur Flucht verhalf. Doch der Kuss war leidenschaftslos gewesen, deshalb zählte Scarlet ihn nicht.
Aber jetzt, seitdem sie an Bord der Albatros waren, hatten die Erinnerungen an ihre Reise mit der Magnetschwebebahn ihr mehr als eine schlaflose Nacht beschert. Oft lag sie wach und stellte sich vor, wie sie aus dem Bett schlüpfte und über den Gang in Wolfs Kajüte schlich. Dort würde sie sich wortlos an ihn schmiegen und seine Haare zerzausen. Und sich in seinen Armen geborgen fühlen.
Aber sie hatte es nicht getan. Nicht aus Angst vor seiner Ablehnung – Wolf versuchte ja gar nicht, seine begehrlichen Blicke zu verbergen. Und sie spürte genau, dass er jede noch so harmlose Berührung genoss. Er hatte nie zurückgenommen, was er ihr nach dem Angriff gesagt hatte: Du bist die Einzige, Scarlet. Du wirst immer die Einzige sein.
Scarlet wusste, dass er auf ein Zeichen von ihr wartete.
Aber immer wenn sie den ersten Schritt wagen wollte, dachte sie an die Tätowierung auf seinem Arm, die ihm für immer den Stempel eines ›lunarischen Spezialagenten‹ aufdrückte. Der Verlust ihrer Großmutter hatte ihr das Herz gebrochen. Und die Gewissheit, dass Wolf sie hätte beschützen können. Er hätte all das verhindern können.
Doch im Grunde war das unfair. Denn das war, bevor er Scarlet kennengelernt und sich für sie interessiert hatte. Und wenn er wirklich versucht hätte, ihre Großmutter zu retten, hätten die anderen Agenten ihn sofort umgebracht. Und dann wäre Scarlet jetzt ganz allein.
Vielleicht zögerte sie aber auch, weil er ihr, wenn sie ehrlich war, immer noch Angst einjagte. Sie konnte seine dunkle Seite problemlos übersehen, wenn er gut gelaunt mit ihr flirtete und manchmal so komisch unbeholfen dabei war. Aber Scarlet hatte ihn zu oft kämpfen sehen, um seine dunkle Seite ganz verdrängen zu können. Und mit Kämpfen meinte sie nicht die harmlosen Raufereien mit Cinder, sondern solche, in denen er seinem Gegner skrupellos das Genick brach oder ihm mit seinen scharfen Zähnen das Fleisch von den Knochen riss.
Die Erinnerungen daran ließen sie erschauern.
»Scarlet?« Wolf betrachtete sie stirnrunzelnd. »Was ist los?«
»Nichts.« Sie setzte ein Lächeln auf; es fiel ihr gar nicht so schwer.
Ja, er hatte etwas Dunkles an sich, aber er war inzwischen ein Anderer. Was auch immer die Wissenschaftler aus Luna ihm angetan hatten, Wolf hatte bewiesen, dass er seine eigenen Entscheidungen treffen konnte. Dass er sich verändert hatte.
»Ich habe an deine Narben gedacht«, sagte sie, während sie die Tube wieder zuschraubte. Wolfs Lippe blutete nicht mehr, aber den blauen Fleck würde man noch ein paar Tage sehen.
Sie umfasste sein Kinn und drückte ihm behutsam einen Kuss auf die Wunde. Er atmete scharf ein, hielt jedoch erstaunlicherweise einmal still. »Du wirst es überleben«, sagte sie und warf den Verband in den Müllschacht.
»Scarlet? Wolf?« Ikos Stimme kam knackend über die Lautsprecher. »Könnt ihr in den Frachtraum kommen? In den Nachrichten zeigen sie etwas, das euch interessieren wird.«
»Wir kommen schon«, sagte Scarlet, während sie das Verbandszeug beiseiteschaffte und Wolf von der Liege sprang. Er lächelte, als sich ihre Blicke trafen, und berührte unwillkürlich seine Wunde.
Im Laderaum saßen Thorne und Cinder auf Frachtkisten und spielten Karten. Cinders Haare waren noch zerzaust von ihrem siegreichen Kampf.
»Gut, dass ihr kommt«, sagte Thorne und blickte auf. »Scarlet, sag Cinder, dass sie nicht schummeln darf.«
»Ich schummele nicht!«
»Du hattest mehrmals hintereinander ein Doppel! Das kann gar nicht sein!«
Cinder verschränkte die Arme. »Thorne, ich habe mir gerade die Spielregeln runtergeladen. Ich weiß genau, was geht und was nicht.«
»Siehst du!« Er schnipste mit den Fingern. »Du kannst nicht einfach mitten im Spiel irgendwas runterladen! Das ist gegen die Spielregeln. Du schummelst!«
Cinder pfefferte ihre Karten gegen die Wand. Scarlet bekam eine Karte zu fassen. »Ich glaube auch, dass man nicht mehr als einmal ein Doppel haben kann. Aber vielleicht nur, weil meine Großmutter das so gespielt hat.«
»Ja, oder weil Cinder schummelt.«
»Stimmt doch gar nicht«, fauchte Cinder.
»Iko wollte uns auf etwas aufmerksam machen«, sagte Scarlet und legte die Karte auf den Stapel.
»Oui, Mademoiselle«, sagte Iko mit dem Akzent, den Thorne oft aufsetzte, wenn er mit Scarlet sprach. Bei ihr klang es allerdings um einiges französischer. »Eine Eilmeldung über die lunarischen Spezialagenten.« Der Bildschirm an der Wand flimmerte auf, als Iko die Countdown-Anzeige und den Grundriss des Palastes durch ein Video ersetzte, auf dem sich verschwommen Reporter erkennen ließen und bewaffnete Soldaten, die ein halbes Dutzend muskelbepackte Männer in einen gepanzerten Hover verfrachteten. »Nach den Angriffen hat die Amerikanische Republik Ermittlungen aufgenommen. In New York, Mexico City und São Paulo ist der Geheimdienst aktiv. Es wurden bereits fünfundneunzig Agenten und vier Thaumaturgen als Kriegsgefangene genommen.«
Scarlet sah sich die Bilder aus Manhattan genauer an. Eine Gruppe Spezialagenten, die in einer verlassenen U-Bahn-Station untergetaucht war, wurde gerade von Soldaten umzingelt. Obwohl die Spezialagenten an Händen und Füßen gefesselt wurden, sahen sie so unbekümmert aus, als pflückten sie gerade Wiesenblumen. Einer grinste sogar in die Kamera, als er abgeführt wurde. »Erkennst du einen von ihnen?«
Wolf grunzte. »Nein. Zwischen den Rudeln gibt es nur wenig Kontakt. Aber ich glaube, beim Essen oder beim Training könnten mir ein paar von ihnen schon über den Weg gelaufen sein.«
»Sie machen einen ziemlich unbekümmerten Eindruck«, bemerkte Thorne. »Offensichtlich haben sie noch nie Gefängnisessen gekostet.«
Cinder stellte sich neben Scarlet. »Sie werden nicht lange im Gefängnis bleiben. Die Hochzeit ist in zwei Wochen, danach werden sie entlassen und nach Luna zurückgeschickt.«
Thorne hakte die Daumen im Gürtel unter. »Wenn das so ist, handelt es sich ja um eine ganz schöne Zeit- und Ressourcenverschwendung.«
»Das finde ich nicht«, sagte Scarlet. »Die Leute können ja nicht ewig in Angst und Schrecken leben. Die Regierung will zeigen, dass sie alles tut, um solche Massaker in Zukunft zu verhindern. So haben sie die Situation halbwegs unter Kontrolle.«
Cinder schüttelte den Kopf. »Aber was passiert, wenn Levana sich rächen will? Die Heiratsallianz soll sie doch gerade besänftigen.«
»Sie wird keine Vergeltung wollen«, sagte Wolf. »Es ist ihr wahrscheinlich ziemlich egal.«
Scarlet sah auf die Tätowierung an seinem Unterarm. »Nach all dem Aufwand, den sie mit euch hatte, um euch … ich meine, um die zu erschaffen?«
»Sie würde die Allianz für nichts und niemanden aufs Spiel setzen. Schon gar nicht für die Agenten, die nur die Erdbewohner in Angst und Schrecken versetzen und sie daran erinnern sollten, dass Lunarier unberechenbar sind.« Wolf trat von einem Bein aufs andere. »Jetzt braucht sie uns nicht mehr.«
»Hoffentlich hast du Recht«, sagte Iko. »Jetzt, wo sie die ersten Agenten aufgespürt haben, erwarten die Erdbewohner, dass die gesamte Union mitzieht.«
»Wie haben sie sie denn überhaupt gefunden?«, fragte Cinder und zog ihren Pferdeschwanz fester.
Ein Seufzer zischte durch das Kühlsystem. »Die Lunarier haben in der ganzen Welt Medidroiden aus Quarantänestationen umprogrammiert. Die haben den Letumoseopfern ihre ID-Chips herausgeschnitten, die dann den Agenten implantiert wurden. So konnten sie sich unbemerkt unter die Erdbewohner mischen. Als die Regierung das durchschaut hatte, musste sie nur die ID-Chips zu den Stützpunkten der Agenten verfolgen.«
»Peony!« Cinder sah auf den Bildschirm. »Deshalb wollten die Androiden ihren Chip. Heißt das, ihr Chip war für einen von denen da vorgesehen?«
»Du hast ja viel für unsere Freunde mit den Reißzähnen übrig«, sagte Thorne.
Cinder rieb sich die Schläfen. »Tut mir leid, Wolf. Ich meinte nicht dich.« Sie zögerte. »Obwohl … irgendwie doch. Sie war meine kleine Schwester. Wie viele Menschen mussten wohl sterben? Und dann wurden auch noch ihre persönlichen Daten so missbraucht! Nimm es mir nicht übel, Wolf.«
»Ist schon okay«, sagte Wolf. »Du hast sie geliebt. Mir würde es genauso ergehen, wenn jemand Scarlets Identität für Levanas Armee einsetzen würde.«
Scarlet erstarrte; Hitze stieg ihr in die Wangen. Wollte er damit etwa andeuten …?
»Aaaaah«, kreischte Iko. »Hat Wolf gerade gesagt, dass er Scarlet liebt? Wie süß ist das denn?«
Scarlet wand sich. »Er hat nicht … er wollte nicht …« Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Können wir bitte wieder über die verhafteten Agenten reden?«
»Wird sie rot? Sie klingt jedenfalls so!«
»Ja, wird sie«, bestätigte Thorne, während er die Karten mischte. »Wolf sieht aber auch ein wenig verlegen aus, wenn du mich fragst.«
»Jetzt konzentriert euch mal bitte«, sagte Cinder. Scarlet hätte ihr am liebsten einen Kuss gegeben. »Sie haben also die ID-Chips von Pesttoten gestohlen. Und weiter?«
Es wurde etwas dunkler im Raumschiff, als Ikos Übermut verflog. »Das wird jetzt aber nicht mehr passieren. In dieser Sekunde werden in Amerika, und bestimmt auch im Rest der Union, alle Androiden in den Quarantänestationen neu programmiert.«
Auf dem Bildschirm sahen sie, wie in Manhattan gerade der letzte Agent in einen gepanzerten Hover verladen wurde. Die Tür krachte scheppernd hinter ihm zu.
»Eine Gefahr weniger«, sagte Scarlet und dachte an das Rudel, das sie gefangen gehalten und ihre Großmutter auf dem Gewissen hatte. »Ich hoffe, dass sie in Europa auch gefunden und getötet werden.«
»Hoffentlich denkt man in der Union nicht, dass ihr Job damit erledigt ist«, sagte Cinder. »Wie Wolf gesagt hat: Der Krieg hat noch gar nicht richtig begonnen. Die Erde muss in höchste Alarmbereitschaft versetzt werden.«
»Und wir sollten alles dransetzen, die Hochzeit zu verhindern, damit du den Thron besteigen kannst«, fügte Scarlet hinzu. Cinder zuckte zusammen. »So könnten wir den Krieg beenden.«
»Ich möchte einen Vorschlag machen«, sagte Iko und schaltete von den Nachrichten über die lunarischen Agenten zu einem Bericht über die bevorstehende Hochzeit. »Wenn wir sowieso schon in den Palast von Neu-Peking einbrechen, könnten wir dann nicht einfach ein Attentat auf Levana verüben? Nicht, dass ich mir das leicht vorstelle. Aber würde es uns nicht eine Menge Ärger ersparen?«
»So leicht ist das nicht«, sagte Cinder. »Denk mal dran, über wen wir hier reden. Sie kann problemlos Hunderte von Menschen manipulieren.«
»Mich nicht«, sagte Iko. »Und dich auch nicht.«
Wolf schüttelte den Kopf. »Man bräuchte schon eine ganze Armee, um überhaupt in ihre Nähe zu kommen. Sie wird unzählige Wächter und Thaumaturgen um sich haben. Ganz zu schweigen von all den Erdbewohnern, die sie als Schutzschild oder in Waffen umfunktionieren kann.«
»Selbst Kai«, gab Cinder zu bedenken.
Der Motor stotterte, so dass die Wände wackelten. »Du hast Recht. Das können wir nicht riskieren.«
»Nein, aber wir können der Welt vor Augen führen, dass Levana eine Betrügerin und Mörderin ist. Alle wissen, dass sie böse ist. Jetzt muss die Welt nur noch erfahren, dass niemand mehr sicher ist, wenn sie Kaiserin wird.«
5
»Schirm vier«, sagte Cress und blinzelte auf das Symbolraster. »Bube auf … D5.«
Ohne abzuwarten, wie der Narr Rad schlagend seine Position wechselte, wandte sie sich dem nächsten Spiel zu. »Schirm fünf. Rubine und Dolche nehmen. Kronen ablegen.« Der Schirm blinkte, aber sie war schon weiter.
»Schirm sechs.« Sie zögerte und kaute auf ihren Haarspitzen. Zwölf Zahlenreihen standen auf dem Schirm. Einige Felder waren noch leer, andere bunt oder gemustert. Sie zermarterte sich das Hirn nach einer passenden Gleichung. Als sie sie gefunden hatte, erschien ihr die Lösung des Puzzles plötzlich glasklar.
»Die gelbe 4 auf die 3A. 7B ist die schwarze 16. 9G ist die schwarze 20.« Die Zahlenreihen lösten sich auf und wurden durch einen Sänger aus der Zweiten Ära ersetzt, der einen Freudensong trällerte. Applaus brandete auf.
»Gut gemacht, große Schwester«, sagte Kleine Cress. »Du hast gewonnen!«
Cress’ Sieg war von kurzer Dauer. Sie rollte auf dem Stuhl zum vierten Bildschirm und nahm das erste Spiel wieder auf. Kleinlaut bemerkte sie, welchen Zug Kleine Cress in der Zwischenzeit gemacht hatte: Sie hatte sie in die Ecke gedrängt. »Schirm eins«, murmelte sie, schleuderte ihren Zopf über die Schulter und wickelte die Haarspitzen um die Finger. Ihren Sieg auf Schirm sechs hatte sie schon vergessen. Dieses Spiel würde Kleine Cress gewinnen.
Sie seufzte und machte einen Spielzug, doch unmittelbar darauf setzte Kleine Cress ihren König in die Mitte des holografischen Labyrinths und forderte den goldenen Kelch. Ein lachender Narr erschien und verschluckte das ganze Spielfeld.
Cress stöhnte und wartete resigniert auf die Aufgabe, die ihr jüngeres Ich ihr nun aufs Geratewohl stellen würde.
»Ich hab gewonnen!«, rief Kleine Cress. Die anderen Spiele schlossen sich automatisch. »Du schuldest mir zehn Minuten Squaredance zu Countrymusik nach diesem Video hier, und danach dreißig Sprünge aus der Hocke. Los geht’s!«
Cress verdrehte die Augen und wünschte, sie hätte die Satellitenstimme nicht ganz so vorlaut programmiert. Aber als ein bärtiger Mann mit Cowboyhut, die Daumen in den Gürtelschlaufen, auf dem Bildschirm erschien, erhob sie sich schicksalsergeben vom Bett.
Vor ein paar Jahren war Cress aufgefallen, dass ihr Satellit nicht sonderlich viele sportliche Aktivitäten bereithielt, und war einem Fitnesswahn verfallen. Sie programmierte die Spiele so, dass sie als Strafe für eine Niederlage irgendein Fitnessprogramm absolvieren musste. Obwohl sie es im Nachhinein oft bereut hatte, bewahrte es sie davor, den ganzen Tag nur herumzusitzen. Und inzwischen machten ihr die täglichen Tanz- und Yogaübungen sogar Spaß. Auf die Sprünge aus der Hocke konnte sie allerdings verzichten!
Gerade als ein Gitarrenakkord den Einsatz zum Tanz gab, erklang ein lauter Glockenton und gewährte ihr einen Aufschub. Die Daumen noch in ihren nicht vorhandenen Gürtelschlaufen, sah Cress zu den Bildschirmen hinüber.
»Was ist das, Kleine Cress?«
»Eine Anfrage von einem direkten Kommunikationslink: Ein unbekannter Nutzer namens Mechanikerin.«
Ihr Magen machte einen Salto.
Mechanikerin.
Cress schrie auf und stolperte auf den kleinsten Bildschirm zu. Fast wäre sie hingefallen, so aufgeregt war sie. Hastig tippte sie den Code zum Ausblenden des Fitnessvideos auf diesem Bildschirm ein. Sie vergewisserte sich, dass die Firewall und die Sicherheitseinstellungen funktionierten, und dann sah sie sie. Eine D-TELE mit der unschuldigen Frage:
Annehmen?
Ihr Mund war wie ausgetrocknet. Cress strich sich über die Haare. »Ja! Annehmen!«
Das Fenster verschwand, der Schirm wurde schwarz. Und dann … dann … war er da.
Carswell Thorne.
Er lümmelte mit hochgelegten Füßen in einem Stuhl, so dass Cress auf die Sohlen seiner Stiefel sah. Hinter ihm standen drei Leute, aber Cress konnte den Blick nicht von ihm abwenden, nahm nur seine blauen Augen wahr, die sie unverwandt anstarrten und sich nun mit derselben atemlosen Scheu füllten, die sie auch empfand.
Mit derselben Verwunderung.
Demselben Entzücken.
Obwohl zwei Bildschirme und das überwältigende All zwischen ihnen lagen, spürte sie, wie eine tiefe Verbindung zwischen ihnen entstand, die sich nicht wieder lösen lassen würde. Sie hatten sich das erste Mal angesehen, und doch wusste sie genau, dass er dieselben Gefühle hatte wie sie. Er sah sie vollkommen verblüfft an.
Röte stieg ihr in die Wangen, ihre Hände zitterten.
»Wow!«, murmelte Carswell Thorne. Er nahm die Füße runter und beugte sich vor, um sie besser betrachten zu können. »Sind das alles Haare?«
Cress’ Traum von der Liebe auf den ersten Blick löste sich in Luft auf.
Plötzlich bekam Cress vor Panik keine Luft mehr. Mit einem Aufschrei hechtete sie unter den Tisch, wo sie so hart gegen die Wand knallte, dass sie die Zähne zusammenbeißen musste. Mit klopfendem Herzen, feuerrot im Gesicht, kauerte sie sich zusammen und starrte ihr Zimmer an, auf das auch er nun freie Sicht hatte. Die zerwühlten Decken und den bärtigen Mann auf allen Schirmen, der sie gerade aufforderte, sich einen Partner zu schnappen und ihn herumzuwirbeln.
»Was … wo ist sie denn hin?«, fragte Thorne vom Bildschirm her.
»Also ehrlich, Thorne.« Eine Mädchenstimme. Linh Cinder? »Denkst du auch mal nach, bevor du was sagst?«
»Wieso? Was hab ich denn gesagt?«
»Sind das alles Haare?«
»Hast du die denn nicht gesehen? Wie eine Mischung aus einem Elsternest und einem Wollknäuel, mit dem ein Gepard gespielt hat.«
Einen Herzschlag später: »Ein Gepard?«
»Das war die erste Raubkatze, die mir eingefallen ist.«
Hektisch versuchte Cress ihre zotteligen Haare zu glätten. Seit man sie in den Satelliten verbannt hatte, waren ihre Haare nicht mehr geschnitten worden. Inzwischen reichten sie ihr fast bis auf die Knöchel, aber Sybil brachte nie scharfe Gegenstände mit. Und Cress hatte schon lange damit aufgehört, sich ordentliche Zöpfe zu flechten. Für wen sollte sie sich die Mühe machen?
Oh, wenn sie sich heute Morgen nur gekämmt hätte! Wenn sie nur ein Kleid ohne Loch im Kragen angezogen hätte! Hatte sie sich überhaupt nach dem Frühstück die Zähne geputzt? Sie konnte sich nicht erinnern. Wahrscheinlich hatte sie noch Spinatreste von den gefriergetrockneten Eiern auf florentiner Art zwischen den Zähnen.
»Komm, lass mich mal.«
Ein Schlurfen.
»Hallo?« Wieder ein Mädchen. »Ich weiß, dass du mich hören kannst. Tut mir leid, dass mein Freund so ein Trampel ist. Beachte ihn einfach nicht.«
»Das machen wir auch immer so«, ließ sich die andere weibliche Stimme vernehmen.
Verzweifelt sah sich Cress nach einem Spiegel um, oder nach irgendetwas anderem, worin sie sich betrachten konnte.
»Wir müssen mit dir reden. Hier ist … ich bin Cinder. Die Mechanikerin, die den Androiden repariert hat, weißt du noch?«
Cress warf vor Schreck den Wäschekorb neben ihr um, der gegen den Bürostuhl kippte, woraufhin dieser durch den halben Raum rollte und an den Ecktisch stieß. Sie beobachtete erstarrt, wie ein halb volles Glas Wasser zu wackeln begann und über den Memory Stick zu kippen drohte, in dem Kleine Cress wohnte.
»Ähm. Sollen wir es vielleicht später noch einmal …?«
Das Glas blieb stehen, ohne dass ein Tropfen verschüttet worden war.
Cress atmete langsam aus.
So war das nicht geplant. Sie hatte es sich immer ganz anders ausgemalt. Was hatte sie in diesen Träumen denn noch gesagt? Wie hatte sie reagiert? Was für ein Mensch war sie gewesen?
Sie konnte an nichts denken als an den peinlichen Country-Tänzer (»Und zum Partner wenden und einmal do-si-do!«), an ihr Elsternesthaar, ihre schwitzenden Handflächen und ihr klopfendes Herz.
Sie kniff die Augen zusammen und versuchte sich zu konzentrieren. Denk nach.
Sie war kein kleines Mädchen, das sich unter dem Tisch versteckte. Sie war … sie war …
Eine Schauspielerin!
Eine wunderschöne, selbstbewusste, begabte Schauspielerin. Und sie trug ein betörendes Kleid mit Pailletten, die wie Sterne funkelten. Sie zweifelte nicht an ihrem Charme, ebenso wenig wie ein Thaumaturg seine Fähigkeit, eine Menge zu manipulieren, in Frage stellen würde. Sie war atemberaubend. Sie war … immer noch unter dem Tisch.
Ein Schnauben. »Na, das läuft ja richtig gut.« Die Stimme von Carswell Thorne.