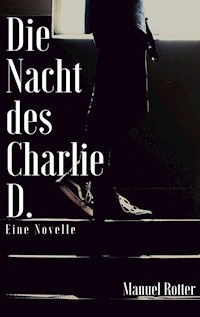Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Helden von Alba
- Sprache: Deutsch
Seit fünf Jahren herrscht Frieden in Alba. William Cornbreak und die Amazone Lina haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und führen ein friedliches Leben in einer entfernten Hütte am Strand. Doch als eine Dienstmagd des Königs spurlos verschwindet, werden sie von Zac aufgesucht, der die Helden von Alba erneut versammeln muss, um einer neuen Bedrohung aus dem Zauberwald zu begegnen. Dort kehrt die Dunkelheit zurück und die Burg der westlichen Hauptstadt wird von einem Zauber heimgesucht, der den König in einen Winterschlaf versetzt hat. Niemand scheint zu wissen, wer den Zauber gewirkt hat. Alba scheint dem heraufziehenden Feind schutzlos ausgeliefert zu sein. Um das Rätsel zu lösen, müssen William und seine Gefährten in eine fremde Welt reisen. So beginnt der Kampf um Alba von Neuem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 906
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Eins: Prolog
Zwei: Schatten im Paradies
Drei: Ungewöhnliche Zeichen
Vier: Herzschlag
Fünf: Jede Menge Fragen
Sechs: Der magische Spiegel
Sieben: Unvorhergesehene Entwicklungen
Acht: Rätselraten
Neun: Feenzauber
Zehn: Die Antwort auf alle Fragen
Elf: Fremde Welt
Zwölf: Beobachtet
Dreizehn: Verbündete
Vierzehn: Boten der Finsternis
Fünfzehn: Eisblumen
Sechzehn: Streitgespräch
Siebzehn: Der Herzog von Liddith
Achtzehn: Die Hexe und der Kobold
Neunzehn: Die Macht zweier Herzen
Zwanzig: Meister Pillar und die Gabe des Feuers
Einundzwanzig: Ein Teil von dir
Zweiundzwanzig: Zwischen Licht und Dunkelheit
Dreiundzwanzig: Schwere Entscheidungen
Vierundzwanzig: Hoffnung und Verzweiflung
Fünfundzwanzig: Für Calidon
Sechsundzwanzig: Herz aus Eis
Siebenundzwanzig: Feindliche Nähe
Achtundzwanzig: Was die Zeit überdauert
Neunundzwanzig: Epilog
Danksagung
Über den Autor
Lina
EINS: PROLOG
Rachel liebte die Burg der westlichen Hauptstadt. Schon als Kind war sie gerne durch die vielen Gänge gelaufen, war hier und dort die verschnörkelten Treppen auf der einen Seite der zahlreichen Türme hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf gestiegen. Am liebsten verbrachte sie ihre freie Zeit damit, hinter den Wandteppichen, die auf den langen Fluren der Burg die kahlen Steinwände zierten, zu lauschen, was die edlen Lords und Ladys, welche die über eintausend Kammern und Gemächer der Burg bewohnten, beredeten. Manchmal waren es einfach nur alltägliche Dinge, an anderen Tagen wiederum schnappte sie das eine oder andere Gerücht auf. Meistens war es Getuschel über einen der hohen Diener des Königs. Mit wem er sich umgab und welchem Edelmann er Amtsgeheimnisse weitergab und dergleichen. Für diese Gerüchte und Geschichten interessierte sich Rachel am meisten. Viel weniger war sie jedoch an dem Getuschel der Frauen interessiert. Allenthalben sprachen sie nur über das Wetter, welche Kleider sie trugen und aus welchen Stoffen diese gemacht waren. Immerzu sprachen sie nur über Belanglosigkeiten, die Rachel bei bestem Willen nicht interessierten.
Die Burgküche war für Rachel ein besonderer Ort. Dort herrschte zwar ein allgegenwärtiger Trubel, aber sie mochte die Leute dort unten in den Katakomben. Von der Küche aus führten enge Tunnel quer durch die gesamte Burg. Ihre Mutter pflegte immer zu sagen, dass alle Wege in die Küche führen. Der Grund dafür lag auf der Hand. Nur so war es den zahlreichen Angestellten möglich, die Speisen und Getränke zu ihren Meistern zu bringen, ehe diese vor Hunger oder Durst starben, weil die Dienerschaft durch die halbe Stadt laufen musste, um Befehle auszuführen. Ja, die Burg war beinahe schon eine eigene große Stadt. Die Flure, Gänge und Tunnel waren die Straßen und die Kammern, Gemächer und Hallen die Dörfer, die Türme, welche alles miteinander zu verbinden schienen, die Villenviertel.
Und beim Schöpfer, Rachel liebte diese Stadt. Die Burg war seit ihrer Geburt Rachels Zuhause, hier war sie aufgewachsen. Gelegentlich schickte ihre Mutter sie in die Unterstadt, um dort auf dem Markt für das Abendessen einzukaufen. Das Abendessen war die einzige Zeit, die Rachel mit ihrer Mutter allein verbrachte. Da Rachel überall mithalf, wo sie nur konnte, und ihre Mutter als Dienerin einer hohen Lady im vierten Westturm arbeitete, sahen sie sich tagsüber kaum. Deshalb war sie froh, wenigstens den Abend mit ihr verbringen zu können.
Ab und an half Rachel ihrer Mutter sogar bei der Arbeit. Dann machte sie die Betten, überzog die Matratzen mit frischen Leintüchern und schlug die Polster aus, um sie wieder flauschig weich zu machen. Eine Lady mochte es nicht gerne, auf durchgelegenen Polstern zu schlafen oder eingewickelt in kratzigen Decken zu liegen.
Im Sommer sorgte Rachel dafür, dass die Gemächer der Lady mit frischen Blumen geschmückt waren. Das Mädchen liebte den Geruch frischer Schnittblumen – am liebsten waren ihr aber Orchideen. Zu diesem Zweck schickte ihre Mutter sie im Frühling und Sommer einmal die Woche zum Blumenmarkt an der Flusspromenade – der Blumengarten des Königs war allein ihm und seinem engeren Kreis vorbehalten.
Wenn Rachel die Burg verlassen musste, fühlte sie sich allerdings unwohl. Die Menschen der Stadt waren ganz anders als jene in der Burg. Während die Lords und Ladys in edlen Gewändern über die Flure stolzierten, trugen die Stadtbewohner zuweilen einfachere Kleidung, und je weiter man sich von der Burg entfernte, schienen sie auch jegliches Gefühl für Körperpflege zu verlieren. Rachel hielt sich nicht gerne außerhalb der Burgmauern auf.
Im Winter, wenn die Tage kurz und die Nächte lang waren, sah es ihre Mutter überhaupt nicht gerne, wenn Rachel zu viel Zeit damit zubrachte, in der Burg herumzulaufen. Obgleich die Flure mit Fackeln ausgestattet waren – in den Türmen sogar mit Kerzen und warmen Kaminfeuern –, war es dennoch sehr kühl und der Wind pfiff durch die Ritzen und Schießscharten der Wehranlagen. Rachels Mutter hatte wohl Angst, ihre Tochter könnte sich erkälten oder gar eine Lungenentzündung einfangen. Sie machte sich immerzu Sorgen um Rachel.
In den langen Wintermonaten hielt sich Rachel dann tagsüber in der Dienstkammer auf, in der sie mit ihrer Mutter gemeinsam wohnte. Der König stellte eine solche Kammer jeder Familie zur Verfügung, die in seinem Dienst stand. König Edward war in seiner ganzen Person ein gütiger Mann, trotz seines jungen Alters. Einmal die Woche ließ er Brot an die ärmere Bevölkerung verteilen und im Sommer kehrte er draußen auf den Feldern vor der Stadt ein, um den Bauern bei der Ernte zu helfen. Im Winter ließ er Decken an die Dienerschaft verteilen, damit diese in den kalten Kammern der Katakomben nicht fror. Er sorgte sich um sein Volk wie ein Vater um sein Kind.
Rachel mochte den König. Er war ein junger Mann, im Alter von gerade einmal fünfzehn Jahren. Obgleich er mit zehn Jahren die Krone an sich genommen hatte – seine Mutter war früh verstorben und die ersten Jahre seines Lebens hatte er damit zubringen müssen, die Thronräuberin, die man überall nur Schwarze Hexe nannte, zu bekämpfen –, war er doch bereits ein starker und gerechter König. Er war an den Verlusten gewachsen, die ihm das Leben so früh beschert hatte. Und obwohl er seine Mutter nie persönlich getroffen hatte, liebte er sie. Als Weiße Königin war Elaina nicht nur die Anführerin des heiligen und ehrwürdigen Rates der vier Weisen gewesen, sondern auch die schönste und gütigste der vier Schwestern. Aber der Krieg hatte seine Opfer gefordert. Nun war nur noch Edward übrig. Er war der letzte Nachfahre des Lichts, und als dieser König von Alba.
Rachel vermochte sich überhaupt nicht vorzustellen, wie einsam sich der König fühlen musste. Er war der Einzige aus seiner Familie, der noch am Leben war, und obgleich er viele Freunde und ein ganzes Volk besaß, das ihm treu ergeben war, musste er sich an manchen Tagen doch sehr einsam fühlen. Rachel war Teil dieses Volkes und ihm ebenso treu ergeben wie alle anderen. Ihre Mutter sagte immer, die Stärke eines Königs zeige sich in der Treue seines Volkes. Ein König, dem sein Volk nicht treu ergeben sei, sei auch kein wahrer König. Edward brauchte manchmal nicht einmal um etwas zu bitten, da wurde ihm sein Wunsch auch schon von den Augen abgelesen. Die Dienerschaft war froh, ihm einen Teil seiner Bürde von den Schultern nehmen und ihn dabei unterstützen zu können, den Frieden in Alba zu bewahren. Auch Rachel trug dazu bei.
Ihre Mutter hatte Rachel vor einem Jahr erlaubt, in den Dienst des Königs zu treten, obwohl sie erst sechszehn Jahre alt war. Was war Rachel glücklich darüber gewesen, dass ihre Mutter ihre Bitte erhört und dem zugestimmt hatte. Rachel war zwar nur eine von vielen Dienstfrauen des Königs, doch sie tat alles, um die Arbeit zu seiner vollsten Zufriedenheit zu erledigen. Und sie glaubte sogar, dass er sie mehr mochte als die anderen Frauen. So war sie rasch in seinen engeren Kreis aufgestiegen und hatte somit auch Zutritt zu seinen Privatgemächern erhalten. Sie machte seine Wäsche, sorgte dafür, dass immer ein warmes Feuer im Kamin brannte, und sorgte sich um das Wohlergehen des Königs. Die Arbeit war keine leichte, doch sie gewährte es Rachel, in Edwards Nähe zu sein. Dem noch nicht genug war ihr Dienst auch mit einem höheren Einkommen verbunden. Nicht, dass es Rachel um das Geld gegangen wäre, nein, Edwards Nähe war Belohnung genug, doch ihre Mutter und sie konnten jeden Penny brauchen.
Nun, da dieser Tage wieder der Frühling in Alba einkehrte, befand sich die gesamte Burg in Aufregung. Hunderte Diener liefen durch die Tunnel und brachten die Burg in Schuss. Aus allen Ecken wurde der Staub entfernt, die zahlreichen Säulen und Fenstersimse wurden mit frischen Frühlingsboten geschmückt und die Fenster wurden von der Kälte des Winters befreit. Alles wurde für den Frühling und die Wiedergeburt Albas vorbereitet.
Aus diesem Grund befand sich Rachel auch seit dem Morgengrauen auf den Beinen. Im Frühling wechselte alles seine Farbe. Der rote Bettbezug wurde durch den blauen ersetzt, die Winterteppiche durch die Sommerteppiche. Der Kamin musste gesäubert und das Mobiliar ausgetauscht werden.
Rachel war gerade dabei, die Wintervasen durch die Frühlingsvasen zu ersetzen. Dies hatte oberste Priorität. Im Winter bevorzugte der König Vasen, die mit Winterlandschaften verziert waren, während er sich im Frühling gerne mit blühenden Wiesen und Feldern umgab. Im Sommer zeigten die Vasen Bilder von Flüssen, weiten Landschaften und grenzenloser Natur. Die Bilder des Herbstes behagten Rachel überhaupt nicht – sie waren trüb und kalt. Dies lag wahrscheinlich daran, dass zu dieser Jahreszeit die Mutter des Königs, die Weiße Hexe, ihr Leben gelassen hatte, um ihren geliebten Sohn vor ihren Schwestern zu beschützen. Zu dieser Jahreszeit legte sich eine allgegenwärtige Trauer über ganz Alba.
Mit einer Trage voll Vasen zwängte sich Rachel durch die prallgefüllten Flure hindurch. Der Weg von den Gemächern des Königs in die Katakomben, in denen sich ungezählte Räume befanden, in denen die ganzen Dinge lagerten, die man gerade nicht brauchte, war weit und Rachel musste ihn heute bestimmt noch öfter zurücklegen. Deshalb hatte sie es auch eilig und wollte sich nicht lange mit Tratsch und dergleichen aufhalten. Flink wie ein Wiesel stahl sie sich an den Menschenmassen vorbei und durchquerte die Große Halle. Die Tore waren bereits früh am Morgen geöffnet worden, weswegen selbst die kleinsten Winkel der Halle mit Botschaftern und Abgesandten gefüllt waren.
Rachel bog am Treppenhaus ab und verschwand durch eine kleine Türöffnung im Dunkel. Eine lange, weitgebogene Wendeltreppe führte sie in die tieferen Schichten der Katakomben hinunter. Dort waren die Wände nur spärlich mit Fackeln ausgestattet, weswegen sich ein matter Lichtschein über sie legte, der kaum mehr als den halben Weg vor ihren Füßen beleuchtete. Das machte nichts. Sie musste nichts erkennen, um den Weg zu finden – sie war ihn bereits so oft gegangen. Hier unten kannte sie sich besser aus als die meisten anderen. Das lag wohl daran, dass sie als Kind in diesen Gängen aufgewachsen war.
Die Tunnel brachten sie schließlich an der Küche vorbei. Aus dem niedrigen Gewölbe schlugen ihr die feinsten und köstlichsten Gerüche entgegen, die sie kannte. Zu gerne hätte sie Halt gemacht und kurz hineingesehen, um ihre Freunde in der Küchenmannschaft zu besuchen und sich das eine oder andere Stück Torte oder Kuchen zu stibitzen. Doch war ihr Pflichtbewusstsein stärker. Sie rückte sich die Trage in den Händen zurecht und ließ die Küche hinter sich.
Am Ende eines langen Ganges bog sie mehrere Male in verschiedene Richtungen ab, ehe sie in die tiefsten Winkel der Burg vordrang. Hier war Licht kaum mehr als eine verblasste Erinnerung. Rachel kniff die Augen zu, damit sie sich an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen konnten. Mit einer schlaksigen Bewegung öffnete sie eine Tür und schob sie mit der Hüfte weiter auf, um den dahinter liegenden Raum zu betreten.
Es war eine große Kammer, deren Inneres mit den verschiedensten Gegenständen und Artefakten vollgestopft war. Die gelagerten Gegenstände bildeten ein enges und verschnörkeltes Gassensystem. Erneut rückte sie die schwere Trage zurecht, wischte sich mit einer ungelenken Bewegung eine der roten Strähnen aus dem Gesicht, stieß mit einem lauten Seufzer sämtliche Luft auf einmal aus den Lungen und schob sich durch die engen Gässchen des Innenlebens dieses bedrückenden Raumes.
Am anderen Ende angekommen fand sie weitere Tragen vor, welche mit den Frühlings-, Sommer- und Herbstvasen gefüllt waren. Sie hievte die Trage auf einen freien Platz und ließ sich gemütlich gegen die Tischkante in ihrem Rücken fallen, um kurz durchzuatmen, bevor sie sich auf den Rückweg machte. Die Luft hier unten war stickig und voller Staub. Rachel tat sich sehr schwer damit zu atmen. Den Berg an Frühlingsvasen begutachtend atmete sie bei dem Gedanken, sie alle heute noch nach oben schaffen zu müssen, schwer aus. Dann schlug sie sich entschlossen auf die Oberschenkel und wollte gerade nach einer prallgefüllten Trage greifen, als sie ein Geräusch auf der anderen Seite des Raums wahrnahm. In der Bewegung innehaltend begann ihr Herz instinktiv schneller zu schlagen. Sie wischte sich eine lose Strähne aus dem Gesicht und versuchte, sich nicht zu bewegen. Als sie nichts weiter hörte, war sie unentschlossen. Oft hielten sich hier unten die Burschen der Dienerschaft auf, immerzu darauf bedacht, den Frauen und Mädchen einen Schrecken einzujagen.
»Wer ist da?«, wollte Rachel erfahren. Keine Antwort. »Ich weiß, dass du da bist, also komm heraus und hilf mir gefälligst, die Vasen nach oben zu schaffen!«
Ihre Worte gingen in der Fülle der Gegenstände unter. Sich selbst tadelnd, dass sie sich wegen dieses Geräusches so fertigmachen ließ, beutelte sie den Kopf. Dann griff sie die nächstbeste Trage mit Frühlingsvasen und hievte sie sich auf die Hüfte, um sie besser tragen zu können.
Rachel!
Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Hatte da gerade jemand ihren Namen gesagt? Das konnte doch eigentlich nicht sein. Es war, als hätte sie ihn nur in ihrem Kopf gehört. Zögerlich drehte sich Rachel um. Doch da war nichts. Nur Gegenstände, die unbedacht hingestellt und vergessen worden waren.
»Du wirst langsam verrückt, Rachel«, sagte sie bei sich.
Gerade als sie gehen wollte, hörte sie die Stimme erneut.
Rachel!
Ganz ohne Zweifel, da sagte jemand ihren Namen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Rachel stellte die Trage zurück an die Stelle, von der sie sie aufgehoben hatte, und wandte sich dem leeren Gässchen vor sich zu.
»Wer ist da?«, wollte sie erfahren. »Antworte mir, na los!«, rief sie mit Nachdruck.
Rachel! Komm zu uns!
Wie durch einen Zauber ausgelöst setzten sich ihre Beine in Bewegung. Rachel konnte sich dagegen überhaupt nicht erwehren, die Füße gehorchten ihr nicht länger. Am liebsten hätte sie laut geschrien, um sich bemerkbar zu machen und Hilfe zu holen. Aber zum einen brachte sie kein Wort heraus und zum anderen hätte sie hier unten ohnehin niemand gehört. Sie spürte, wie eine Träne über ihre Wange lief. Die Angst schnürte Rachel die Brust zu, machte es ihr unmöglich zu atmen. Was war das? Es konnte nur Magie sein!
Komm zu uns, Rachel! Befreie uns!
Als Rachel auf der anderen Seite des Raums anlangte, stockte ihr der Atem. An dieser Stelle weitete sich der Raum. Die vielen vergessenen Gegenstände waren zu einem Kreis geformt hier abgelegt worden, sodass sich vor ihr eine Lichtung offenbarte, auf die sie ungewollt vordrang. Rachel konnte sich der magischen Kraft nicht widersetzen, die ihren Bewegungsapparat kontrollierte. An der breitesten Seite der Lichtung erhob sich eine dünne Säule aus dem steinernen Boden. Die Säule war mit Runen bemalt, die Rachel nicht lesen konnte. Ihr Herz raste und sie zitterte am ganzen Leib. Auf dem Sockel der Säule stand eine große Amphore. Von dieser schien die Macht auszugehen, die Rachels Bewegungen lenkte.
»Hilfe«, stammelte Rachel in den Raum hinein, obwohl sie wusste, dass niemand da war, um ihr Flehen zu erhören. Ihre Worte waren kaum mehr als ein Flüstern. Niemand würde ihr helfen.
Befreie uns!
Der kalte Hauch der eisigen Worte ließ Rachel die feinen Härchen in ihrem Nacken aufstellen. Das ohnehin kaum vorhandene Licht zog sich weiter in den Raum zurück. Die Gegenstände, die sich wie ein enges Gefängnis um sie schlossen, schienen näher zu rücken, als wollte die Amphore das Mädchen zu sich heranziehen. Ungewollt streckte Rachel den rechten Arm aus, um nach der Amphore zu greifen. Ein kleiner Blitz, wie eine kurze, kaum sichtbare elektrische Entladung, zuckte zwischen dem Gefäß und ihren Fingerspitzen. Rachel riss den Arm zurück und stieß ein lautes Stöhnen aus.
»Was ist das?«, flehte sie die unsichtbare Macht an, sich ihr zu offenbaren.
Befreie uns!
Die Worte klangen immer süßer, wollten sie locken. Wie ein kleines Kind, das sich nach Süßigkeiten verzehrte, setzte Rachel ein Bein vor das andere, bis sie so nah an der Amphore stand, dass sie kaum noch die Kraft aufwenden musste, nach ihr zu greifen. Ihre Fingerspitzen berührten den oberen Gefäßrand. Ein grässlicher Schmerz schoss durch Rachels gesamten Körper, bohrte sich in jede Faser ihres Seins und ließ sie schreien. Dann löste sich der Porzellanverschluss. Wie von einem Zauber ausgelöst wurde Rachel nach hinten geschleudert und landete mit einem gedämpften Knall an der Kante eines alten Schreibtisches. Ihr Kopf schmerzte. Dieses grässliche Gefühl, der Blitz, schoss noch immer durch ihren Körper, ließ ihr Blut in den Adern kochen. Sie konnte kaum noch die Augen offenhalten, spürte bereits, wie die Schwärze sie nach und nach niederrang.
Doch noch besaß Rachel genug Kraft, um zu sehen, wie aus der Amphore drei gewaltige Energiestrahlen emporschossen. Der erste, so weiß wie Schnee und so kalt wie Eis, schlug am Boden auf und wirbelte, ausgelöst durch den Aufprall, kleine Gesteinssplitter auf, die Rachel bei Kontakt die Haut aufkratzten. Schützend zog sie die Arme hoch, um das Gesicht zu bedecken. Aus dem weißen Strahl formte sich die Gestalt einer schlanken Frau. Sie trug ein eisblaues Kleid, das eng um die Beine lag und sich in feinen Konturen an ihren Hals schmiegte. Das lange, silberne Haar fiel ihr sanft um die rechte Schulter. Die eiskalten Augen sahen sich im Raum um, wirkten allerdings verwirrt. In der rechten Hand hielt die Frau einen Zauberstab, der ihren Augen an Schönheit ebenwürdig war.
Der zweite Strahl war ein Bündel unkontrollierten Feuers. Die Flammen schlugen nach allen Seiten hin aus und schickten sich an, Rachels Haut zu versengen. Das Mädchen zog sich instinktiv weiter zurück, um den Flammen zu entkommen. Der haselnussbraune Teint der Haut wirkte wild, während das Feuer in den Augen der Frau Rachel in Angst und Schrecken versetzte. Das feuerrote Haar hatte sie zu einem Zopf gebunden, der ihr der Wirbelsäule entlang bis zur Hüfte reichte. Auch sie trug einen Zauberstab in Händen.
Rachel fuhr in sich zusammen, als der letzte Strahl das Gestein der Bodenplatten in Stücke riss. Pechschwarz und voller dunkler Energie erhob sich eine Gestalt aus dem Nebel, der sich über den gesamten Boden ausbreitete. Die Frau funkelte sie aus rabenschwarzen, glänzenden Augen heraus an, wie eine wilde Bestie, die ihre Beute begutachtete. Die Frau trug eine Krone in Form eines wunderschönen Diadems auf dem Haupt, von der sich hohe Zacken abspreizten. Im Zentrum des Reifs lag eine Einfassung, die einen Obsidian beherbergte, dessen Glanz Rachel an die dunkelste Nacht erinnerte, die sie sich überhaupt vorzustellen vermochte. Der Obsidian strahlte in derselben dunklen Farbe wie das Haar der Frau, als würde sich das Licht einer klaren Sternennacht in ihm widerspiegeln. Diese Frau, das stand außer Frage, war die Anführerin der drei Gestalten. Der Zauberstab in ihrer linken Hand schien zu glühen.
»Was ist geschehen?«, verlangte die rote Frau zu erfahren.
»Sei still, Elmira!«, zischte die Schwarze Hexe.
Rachel wusste nicht, was sie tun sollte. Sie hatte bereits von diesen drei Frauen gehört – in Geschichten. Damals war sie zu jung gewesen, als dass sie sich noch an etwas Genaues erinnern konnte. Zumal sie nur ein einfaches Mädchen war, das nicht an den kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen war. Doch sie war sich ganz sicher: Dies waren die drei Schwestern, die sich gegen die Weiße Königin erhoben hatten, um sie zu stürzen. Diese Frauen waren am Tod der letzten Königin, Edwards Mutter, schuld. Die Schwarze Hexe, die Eishexe und die Feuerhexe. Jede für sich war bereits gefährlich genug, doch zusammen waren sie nahezu unaufhaltsam. Vor fünf Jahren hatte es alle Mächte Albas benötigt, sie aufzuhalten. Und der Preis war hoch gewesen. Wie war es möglich, dass sie nun vor Rachel standen, unversehrt und lebendig?
»Lass uns diesen Moment genießen.«
Die Schwarze Hexe sog die abgestandene Luft des Lagerraums genüsslich in ihre Lungen ein, wollte jede Sekunde des Lebens in sich aufnehmen und sich ihm zur Gänze hingeben. Rachels Mutter hatte gesagt, die Schwarze Hexe hätte damals den Tod gefunden. Wie war es möglich, dass sie nun, in diesem abscheulichen Moment, vor Rachel stand und mit ihren Schwestern sprach? Ein lähmender Gedanke ließ Rachels Kehle austrocknen. Es war Magie!
»Wir glaubten dich tot«, ergriff die Eishexe das Wort. Rachel bemerkte, wie die Frau ihre Schwester voll Abscheu ansah, mit eiskalten Augen.
»Das war ich auch«, bestätigte die Schwarze Hexe. »Du trägst nicht minder Schuld daran, Rabea!«
Die Schwarze Hexe wandte sich der Schwester zu, den Griff um den Zauberstab festigend.
»Wie ist das alles möglich, Serafina?«, wollte Elmira nun endlich erfahren. »Der Mutzler hat dich getötet und uns beide in diese Amphore gesperrt!«
Die Schwarze Hexe nickte zustimmend.
»Daran erinnere ich mich.«
Keine von ihnen schien Rachel zu bemerken. Also wollte sie die Chance ergreifen. Langsam, so vorsichtig sie konnte, schob sie sich in den Schatten der um sie lagernden Gegenstände hinein. Dort zog sie die Beine fest an die Brust und versuchte, keinen Mucks zu machen.
»Der Mutzler ist tot«, meinte Serafina, »anders kann ich es mir nicht erklären.«
Sie reckte den Hals, als wollte sie die Luft noch tiefer in ihre Lungen saugen.
»Fragen wir das Mädchen!«
Rachel riss die Augen auf. Hatte sie da gerade richtig gehört? Mit einem Wink des Zauberstabes zog die Schwarze Hexe Rachel aus dem Schatten heraus und fing sie mit einem kräftigen Ruck aus der Luft auf. Rachels Beine zappelten über dem Boden. Der feste Griff der Schwarzen Hexe ließ Rachel keuchend nach Luft ringen.
»Wo befinden wir uns?«, die Schwarze Hexe brachte das Gesicht direkt vor Rachels.
»In der Burg der westlichen Hauptstadt«, winselte sie.
»Was ist geschehen?«
»Ich weiß nicht, was Ihr meint!«
»Was ist geschehen?«
»Du tust ihr weh, Serafina«, mahnte Rabea, ohne sich vom Fleck zu rühren.
»Das sehe ich«, die Schwarze Hexe brachte ihre Schwester zum Schweigen, ehe sie sich wieder Rachel zuwandte. »Sag mir, Kind, was genau ist geschehen? Wo ist der Mutzler? Wieso befindet sich die Welt nicht im Krieg?«
»Ich weiß nicht … wen Ihr meint«, Rachel fasste nach den Handgelenken der Schwarzen Hexe, um sich mehr Halt zu verschaffen.
»Du weißt nicht, wer der Mutzler ist?«
Rachel beutelte den Kopf. Daraufhin ließ die Frau von ihr ab und Rachel knallte schmerzhaft auf den Boden. Umgehend zog sie sich wieder in den Schatten zurück. Serafina begann aufgeregt auf und ab zu laufen und hielt dabei den Nasenrücken zwischen Daumen und Zeigefinger gefasst.
»Er muss besiegt worden sein«, Serafina stoppte auf halben Weg und wandte sich ihren Schwestern zu, »anders kann ich es mir nicht erklären. Pan muss ihn besiegt haben. Aber wie?«
»Nein, so kann es nicht gewesen sein. Hätte er ihn lediglich besiegt, würde dieses Mädchen wissen, wovon wir sprechen. Zudem würde es nicht erklären, weshalb du noch am Leben bist, Serafina«, sagte Elmira. »Es muss einen anderen Grund geben!«
»Und der wäre?«, fragte die Schwarze Hexe aufgebracht.
Sie wollte Antworten. Diese Ungewissheit brachte sie beinahe um den Verstand. Natürlich war sie froh, noch am Leben zu sein, aber wenn ihr Leben an einem Zauber gebunden war, wollte sie wissen, welcher Art dieser war und wie sie ihn beherrschen konnte. Wieder am Leben wollte sie nicht riskieren, dieses gleich wieder zu verlieren.
»Der Mutzler hat gesiegt«, sagte Rabea kaum hörbar.
»Was?«, Serafina funkelte sie grimmig an.
»Sein Plan war es doch, alle Welten zu zerstören und damit das Licht zu vernichten. Du wolltest die Dunkelheit bannen, um sie besser kontrollieren zu können und deine eigenen Kräfte zu stärken, doch damals hat die Dunkelheit, in Form des Mutzlers, dich kontrolliert, Serafina. Hast du es bereits vergessen? Er wollte die Welten, das Leben und das Sein auslöschen. Er hat dich getötet und deine Seele mit uns in diese Amphore gesperrt«, die Hexe zeigte auf das Gefäß. »Der einzige Grund, wie es sein kann, dass wir alle nun hier stehen, ist, dass er gesiegt und die Welten zerstört hat. Aber die Magie der Worte steht über der Magie des Lichts und der Dunkelheit. Ihr einziger Daseinszweck ist es, Leben hervorzubringen und die Welten so zu formen, dass Leben in ihnen überhaupt erst existieren kann.
Der Mutzler hat das nicht bedacht, weswegen er ebenso vernichtet wurde. Die Magie der Worte hat daraufhin die Welten neu erschaffen. Eine neue Zeitlinie begann. Deshalb kann sich dieses Mädchen auch an nichts erinnern. Sie war damals überhaupt nicht geboren. Wer weiß, wie viel Zeit seitdem vergangen ist? Es könnten nur wenige Tage sein, aber ebenso gut mehrere Jahre. Wir können das nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber die erneute Erschaffung der Welten in einer neuen Zeitlinie würde das alles erklären.«
»Das ergibt Sinn«, stimmte Elmira nickend zu.
»Bis auf einen Punkt. Warum lebe ich? Wenn es stimmt, was du sagst, und davon können wir ausgehen, schließlich kennt niemand die Magie der Zeit so gut wie du, wurde neues Leben erschaffen. Ich aber starb in der alten Welt und wäre demnach in dieser nicht erneut geboren worden.«
»Der Mutzler hat dich in dieser alten Welt getötet, Serafina, ja, aber er hat deine Seele behalten und sie zu Elmira und mir in diese Amphore gesperrt. Ich konnte sie die ganze Zeit über bei uns spüren.«
»Das stimmt, ich konnte dich ebenso bei uns spüren, Schwester«, bestätigte Elmira.
»Ich verstehe, was du meinst«, sie zeigte mit dem Zauberstab auf die Amphore. »Aber weshalb existiert die Amphore in dieser Welt dann noch? Sie hätte doch mit allem Sein ausgelöscht werden müssen!«
»Das muss an der Magie des Mutzlers gelegen haben«, schlussfolgerte Rabea. »Die Magie der Dunkelheit ist an die Magie des Lichts gebunden. Sie sind voneinander abhängig. Licht und Dunkelheit bedingen einander. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Die Magie der Worte besteht aus einer Symbiose beider Mächte, weswegen sie nicht vernichtet werden können. Solange es Licht gibt, gibt es auch Dunkelheit. Umgekehrt verhält es sich gleich. Man kann nicht die eine Seite vernichten, ohne auch die andere zu zerstören. Und da die Magie der Worte beide Mächte beinhaltet und sie das Leben selbst ist, können weder Licht noch Dunkelheit vernichtet werden. Außer man löscht das Leben an sich aus, was unmöglich ist.
Der Mutzler war die gebannte Dunkelheit. Wir haben ihre Macht in ihm gebündelt, gaben ihr eine feste Form. Pan muss dasselbe mit dem Licht getan haben. Ich weiß nicht, in welche Form er es gebannt hat, aber Licht und Dunkelheit mussten sich gegenseitig vernichtet haben, weswegen alles Sein aufhörte zu existieren und die Magie der Worte dazu in der Lage war, eine neue Welt zu erschaffen, eine neue Zeitlinie.
Da die Dunkelheit, wie auch das Licht, aber nicht vernichtet werden kann, hat sie überlebt. Diese Amphore wurde aus der Magie der Dunkelheit erschaffen, trägt ihre Symbole. Die Runen haben die Amphore vor der Vernichtung allen Seins bewahrt. Deshalb hat sie weiterexistiert und sich offensichtlich in diesem Lagerkeller wiedergefunden. Nur so ist es möglich, dass wir überlebt haben. Hätte der Mutzler uns nicht in diese Amphore gesperrt, wären wir mit der alten Welt, mit der alten Zeitlinie untergegangen.«
»Ja, das ergibt Sinn!«, stimmten beide Schwestern zu.
»Du, Mädchen, komm her«, befahl die Schwarze Hexe.
Als Rachel nicht folgte, half Serafina mit Magie nach. Rachel bewegte sich wie eine Marionette durch den Raum. Die Hexe fasst ihr Gesicht und brach Rachel dabei beinahe den Kieferknochen.
»Lebt Pan noch?« Rachel nickte verwirrt. Ihre Mutter hatte ihr schon oft von dem allgegenwärtigen Waldhirten erzählt. »Wer herrscht über diese Welt? Etwa er?«
»König Edward!«, brachte Rachel unter Qualen hervor.
»Wer soll das sein?«, verlangte die Hexe zu erfahren.
»Der Sohn der Weißen Königin«, quickte Rachel. Der Griff der Hexe festigte sich so stark, dass Rachel zu weinen begann.
»Der Sohn dieser …«
Die Eishexe feuerte einen Zauber gegen ihre Schwester ab, der diese am Arm traf und sie zur Seite schleuderte. Rachel schlug mit dem Kopf am zersplitterten Steinfußboden auf. Sie konnte Blut schmecken und alles drehte sich.
»Du wagst es?«, Serafina nahm eine elegante Kampfposition ein.
»Lass sie in Ruhe, Serafina!«, presste die Eishexe zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Oder willst du ihr genauso wehtun wie mir einst?«
»Spiel nicht das Opfer. Du hast mich doch an den Mutzler verraten. Du hast ihm gesagt, dass ich ihn vernichten wollte, um selbst die Macht über die Dunkelheit zu erlangen!«
»Du hast Philipp ermordet!« Die Augen der Eishexe waren mit Tränen gefüllt. »Du hast in mir genommen.«
»Weil er dich schwach gemacht hat. Deine Liebe zu ihm hat dich schwach gemacht. Ich wollte dich wieder stark machen.«
Während die beiden Hexen sich gegenseitig Beschuldigungen an den Kopf warfen, wusste Elmira nicht, wie sie sich verhalten sollte. Sie wollte nicht zwischen die Fronten geraten, also stand sie still da und zog das Schweigen einer Parteinahme vor.
»Das hast du auch über Elaina gesagt.«
Elaina war die vierte Weise gewesen, ihre gemeinsame Schwester und Mutter des Königs. Auch sie hatte einst einen Mann geliebt.
»Rabea, ich bin gewillt, dir zu vergeben, wenn du jetzt deinen Zauberstab sinken lässt und mir zuhörst.«
»Warum sollte ich das tun?«
»Weil der Mutzler uns eine neue Möglichkeit eröffnet hat, Alba unserem Willen zu unterwerfen. Er existiert nicht länger, und Elaina ist tot. Wir können diese Welt unterwerfen. Niemand steht uns mehr im Weg.«
»Du würdest nicht zögern, mich oder Elmira zu töten, wenn wir uns dir widersetzten«, war das Einzige, das Rabea darauf erwiderte. Serafina besaß kein Gewissen und schon gar keine Bindung zu ihrer Familie. Sie hatte Elaina getötet und sie würde auch ihre anderen beiden Schwestern töten. Das Einzige, das sie interessierte, war Macht.
»Gut, wie du möchtest. Dann kann ich dir nicht länger helfen. Du stellst eine Gefahr für Elmira und mich dar!«
Mit einer weitausholenden Bewegung wirbelte die Schwarze Hexe den Zauberstab herum und erzeugte auf diese Art ein magisches Loch in der Decke. Zu Rachels Überraschung hagelten jedoch nicht bereits in der nächsten Sekunde gigantische Gesteinsbrocken auf sie herab, nein, die Decke wurde aufgerissen und es öffnete sich ein Portal, hinter dem Rachel nichts außer Dunkelheit zu erkennen vermochte.
»Was machst du da?«, brüllte Elmira über den tosenden Lärm hinweg, den das Portal erzeugte. »Serafina?«
»Sie ist eine Gefahr für uns, Elmira. Doch möchte ich sie nicht töten, sie war einmal eine von uns. Ich werde sie verbannen – in eine andere Welt!«
Rabea konnte sich dem gewaltigen Sog nicht erwehren. Das Portal zerrte an ihr, versuchte sie mit sich zu reißen. Sie wurde in die Luft gezogen, direkt auf das schwarze Nichts zu, das hinter dem Tor zu dieser anderen, fremden Welt lauerte. Mit allerletzter Kraft versuchte Rabea, einen Zauber zu wirken, doch es wollte ihr nicht gelingen. Bevor sie durch das Portal verschwand, traf sich ihr Blick ein letztes Mal mit dem ihrer Schwester. In Serafinas Augen lag nur Boshaftigkeit, weiter nichts. Da war nichts außer dem puren Hass, den sie gegen alles und jeden in dieser Welt empfand.
»Ich werde dich vernichten, dich und alles, das du begehrst, Serafina«, waren ihre letzten Worte, ehe Rabea von dem Portal verschlungen wurde und dieses sich wieder schloss.
Elmira hatte sich die ganze Zeit über an der Säule festgehalten, um nicht selbst von dem Portal verschlungen zu werden. Nachdem es sich geschlossen und der Lärm sich gelegt hatte, löste sich die Hexe von der Säule und zupfte das Kleid zurecht.
»War das wirklich notwendig?«, fragte sie gefühllos.
»Sie wäre zu einer großen Gefahr für uns geworden. Nichts ist gefährlicher als eine Frau, die auf Rache sinnt, Elmira. Das solltest du am besten wissen.«
»Schon gut. Und jetzt?«
»Jetzt müssen wir erst einmal herausfinden, was wirklich geschehen ist.«
»Und wie?«, Elmira wartete auf Instruktionen. Dies war der einzige Grund, weshalb sie überhaupt fragte. Sie war schon immer eine Person gewesen, die Befehle nicht erdachte und an andere richtete, sondern sie ausschließlich befolgte.
»Wir teilen uns auf. Du begibst dich zu den alten Tempeln und ich gehe zu den verborgenen Orten im Zauberwald. Bevor wir nicht wissen, was wirklich geschehen ist, können wir nicht damit beginnen, diese Welt erneut unserem Willen zu unterwerfen.«
»Du meinst deinem Willen«, korrigierte Elmira ihre Schwester.
»Macht das einen Unterschied?«, fragte Serafina abschätzend.
»Nicht für mich, Schwesterchen«, ein grässliches Grinsen zeichnete sich auf ihren Lippen ab. »Was ist mit dem Mädchen?«
Serafinas Blick fiel auf die am Boden liegende Rachel, die nicht einmal mehr die Kraft fand, einen Finger zu rühren.
»Wir nehmen sie mit. Sie ist in dieser Welt aufgewachsen. Vielleicht kann sie uns noch nützlich sein!«
ZWEI: SCHATTEN IM PARADIES
William atmete konzentriert ein, während er den Bogen mit der linken Hand fester griff und mit der rechten Hand den auf der Sehne angelegten Pfeil auf das Ziel richtete, das nicht unweit von ihm am Bachlauf in erreichbarer Nähe lag. Der Widerstand der Sehne veranlasste, dass sich sämtliche Muskeln in seinem Körper spannten. Der Pfeil wurde zur Verlängerung seines Auges. Das Blickfeld verengte sich, alles konzentrierte sich auf einen einzigen, winzigen Punkt in der Ferne. Beinahe konnte er das kleine Herz in der Brust des Hasen schlagen hören, das Blut, wie es in Wallungen durch die feinen Äderchen des Geschöpfs pochte. Die Augen des Hasen sahen sich kurz um, als die Sehne ein knarrendes Geräusch von sich gab. William spannte den Bogen kaum sichtbar weiter, um der aufziehenden Brise entgegenzuwirken.
Bei der Jagd kam es nicht darauf an, wie stark man war. Der Jäger musste nicht nur die Beute auffinden und erlegen, das gesamte Umfeld musste miteinbezogen werden. Die Entfernung, damit auch verbunden die Größe des Ziels, spielte dabei kaum eine Rolle. Ein guter Schütze konnte jedes Ziel auf eine beliebige Entfernung ohne Probleme treffen. Worauf es jedoch ankam, war die Seele des Jägers. Befand sie sich in Aufruhr, dann auch er selbst. Ein unruhiger Jäger war kaum dazu in der Lage, den Bogen ruhig zu spannen, den Atem für diesen einzigen, allzu kurzen Moment zu konzentrieren. Ein unruhiges Auge war nicht dazu in der Lage, das Ziel zu fixieren. Ferner kam es auf den Wind an – ihn einzuberechnen war von äußerster Wichtigkeit. Dazu kamen der Schusswinkel und die Feuchtigkeit in der Luft – da diese den Pfeil und die Sehne träge machte –, aber vor allem die Entschlossenheit. Zu jagen bedeutete zu töten. Wenn man nicht bereit war, das Leben eines anderen, vom Schöpfer gegebenen Wesens binnen einer einzigen Sekunde auszulöschen, konnte man nicht erfolgreich jagen.
William hatte bereits viele Leben ausgelöscht, nicht nur auf der Jagd. Als Admiral der Königlichen Flotte war er in den Großen Krieg vor fünf Jahren involviert gewesen. Damals waren viele Menschen gestorben. Nicht nur ihm untergebene Soldaten, sondern auch zahlreiche Feinde und, dies zerriss ihm noch heute das Herz, auch Zivilisten. Die Schergen der Schwarzen Hexe hatten ganze Dörfer ausgelöscht, samt der Bewohner. Ja, William Cornbreak wusste um das Töten Bescheid. Löschte man das Leben eines anderen Geschöpfs aus, vernichtete man auch einen Teil der eigenen Seele, veränderte sich, konnte nie wieder der sein, der man zuvor gewesen war. Mit dem Töten, auch auf der Jagd, war ein hoher Preis verbunden. Entweder war man dazu bereit, ihn zu zahlen, oder man scheiterte. William hatte den Preis bereits zu oft bezahlt. Und es hatte ihn verändert.
Hätte er nicht Lina an seiner Seite, die ihm allzeit den rechten Weg wies, hätte er schon längst den Verstand verloren, wäre zu einem Mörder oder Schlimmeren geworden. Lina war der Anker in dem Sturm, den er Leben nannte. Sein Leben war stets von Verlusten gezeichnet gewesen. Bereits als Kind hatte man ihn schlimm misshandelt. Die anderen Kinder in der Schule hatten ihn nicht nur verprügelt, sondern auch gefoltert. Die ältesten Narben an seinem geschundenen Körper zeugten davon. Sie hatten ihn unter Wasser gedrückt, bis er keine Luft mehr bekam. Anschließend hatten sie ihm die Haut mit stumpfen Messern aufgeritzt und ihn mit Stöcken geschlagen. Damals war es sein Bruder George gewesen, der ihn am Leben gehalten hatte. Heute war es Lina.
George hatte sein Leben im Großen Krieg vor fünf Jahren verloren. William vermisste ihn sehr. Sein Bruder war damals der Mensch gewesen, der ihn aufrichtete, wenn William am Boden lag und nicht mehr den Willen aufbrachte, aus eigener Kraft aufzustehen. Zu oft hatte man ihn niedergeschlagen und blutend zurückgelassen. George hatte ihm stets Mut zugesprochen und ihm die Kraft gegeben, weiterzumachen. Diese Rolle hatte nun Lina inne, seine geliebte Lina, die Williams Herz besaß. Nie hätte der Seefahrer, dessen Lebensmittelpunkt solange allein mit der offenen See verbunden gewesen war, gedacht, dass einmal eine Frau es sein würde, die sein Leben umso viel reicher machte.
Dabei war es äußerst bemerkenswert. Lina war eine Amazone. Für gewöhnlich hielten sich Amazonen Männer nur als Sklaven und um den Fortbestand ihres Volkes zu sichern. Amazonen liebten nicht, sie begehrten. Das Einzige, das sie interessierte, war der Kampf. Ihn allein liebten sie und für ihn taten sie alles. Eine Amazone, die im Kampf ihr Leben ließ, wurde von den Überlebenden als Göttin verehrt. Dennoch hatte Lina Gefühle für William entwickelt. Und obgleich sie es oft schwer gehabt hatten, weil beide sich die Nähe zueinander nicht eingestehen wollten, hatten sie am Ende zusammengefunden. Der Krieg hatte sie zusammengebracht und geeint. Ihre Leben waren nunmehr unwiderruflich miteinander verbunden.
Lina war Williams Zuflucht vor dem Leben, das ihn solange gequält hatte. Sie lauschte seinen Sorgen und er hatte keine Geheimnisse vor ihr – seiner Lina erzählte er einfach alles. Für ihn war sie nicht nur die schönste Frau, die es auf der Welt gab, sondern auch die gütigste und liebevollste Person. Und obwohl sie es nicht offen zeigte, gelang es ihm, hinter die selbsterrichtete Mauer aus Stein zu blicken und ihr wahres Wesen zu erkennen. Ihm gegenüber war sie ebenso ein offenes Buch wie er für sie.
Erging es ihm in den tiefen seiner Seele schlecht, was nicht selten vorkam, kehrte er bei ihr ein, um sich zu erholen und die bösen Gedanken aus seinem Geist zu verbannen. Sie gewährte es ihm, sich an ihre Brust zu legen und dem einzigartigen Klang ihres ruhig schlagenden Herzens zu lauschen. Für William war es das reinste und schönste Geräusch, das er kannte. Lauschte er ihrem Herzschlag, gelang es ihm, zur Ruhe zu kommen. Dann entspannte sich sein tobender Verstand. Die Muskeln lösten die Spannungen des anstrengenden Tages und die Dunkelheit in seinem Geist löste sich auf, der Nebel lichtete sich und er fand endlich zur Ruhe. In diesen Momenten hielt sie ihn einfach nur im Arm, und obwohl er sich dabei schwach und verletzlich fühlte, konnte er sich keine bessere Gefährtin für sein Leben vorstellen. Lina war sein ein und alles. Ohne sie hätte er bereits vor langer Zeit aufgegeben.
Lina erging es mit ihm nicht anders. Obwohl sie eine Amazone war, die eigentlich keine Gefühle kannte, hatte sie ihn lieben gelernt. Es war ein langer, sich über Jahre ziehender Kampf gewesen, doch am Ende hatte ihr Herz gesiegt. Bereits bei ihrem ersten Aufeinandertreffen hatte sie gewusst, dass dieser Mann einen besonderen Platz in ihrem Leben einnehmen würde. Und so war es auch gekommen. Mit der Zeit hatte sie sich ihm geöffnet, ihn an ihrem Leben teilhaben lassen, und am Ende waren sie zu Gefährten geworden, die ihr Leben miteinander teilten und ohne dem anderen nicht mehr wussten, wie sie es bestreiten sollten. Lina konnte sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen.
Nach dem Großen Krieg hatten sie sich dazu entschlossen, den Zauberwald, in dem das Volk der Amazonen angesiedelt war, zu verlassen. Am Strand, nicht unweit von der östlichen Hauptstadt entfernt, hatten sie ein Haus errichtet. William liebte das Meer. Lange Zeit war es sein Zuhause gewesen. Die grenzenlose Freiheit der offenen See hatte einst Linas Platz in seinem Herzen besessen. Er liebte das Geräusch der tosenden Wellen, die sich am Ufer niederschlugen, den Geruch des weiten Meeres und dessen Berührung an seinen Fußknöcheln, wenn er frühmorgens am Ufer stand, tiefversunken im nassen Sand und sich ganz der Woge der Glückseligkeit hingebend. Es war nicht viel, das die beiden besaßen, doch gerade genug, um ein Leben in Zufriedenheit zu führen.
Vor zwei Jahren hatte William dann den Dienst in der Königlichen Marine quittiert und sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Die Lebensrente reichte aus, um ihr Zusammensein zu finanzieren. Wenn sie nicht gerade in den angrenzenden Wäldern jagten, König Edward persönlich hatte ihnen dieses Recht zugesprochen, kauften sie die Dinge, welche sie zum Überleben benötigten, am Markt in der östlichen Hauptstadt oder in den zahlreichen Geschäften dieser prächtigen Stadt. William und Lina fehlte es an nichts. Fernab des Trubels genossen sie das gemeinsame Leben.
Mit dieser Glückseligkeit im Herzen entließ er den Pfeil mit gewaltiger Energie. William sah dabei zu, wie die Spitze auf das Ziel zuraste. Der Hase wusste kaum, wie ihm geschah, bekam nichts von alldem mit. Der Pfeil bohrte sich durch das Herz des kleinen Geschöpfs, es war sofort tot, spürte keinen Schmerz – dafür hatte William gesorgt.
Zufrieden trat er aus den Büschen hervor, in denen er sich versteckt hatte, und kehrte am Bachufer ein. Die warme Sommersonne küsste die Haut an den nackten Armen und die Wärme drang durch seinen muskulösen Körper, erfüllte ihn mit neuer Kraft. William legte die Stange, an der, mit dünnen Bändchen befestigt, zwei weitere Hasen hingen, die er bereits weiter oben am Bachlauf erlegt hatte, gemeinsam mit dem Bogen beiseite und kniete sich hinab, um sich der Beute anzunehmen.
Der in Alba nunmehr langsam einkehrende Sommer trieb das Wild aus den Winterverstecken und ermöglichte damit eine herrliche Jagd. Der Frühling war verregnet gewesen, weswegen der Boden fruchtbar und genau passend für die hungrigen Geschöpfe des Waldes war. William liebte die Zeit, in der der Frühling zum Sommer wurde und das Land den Wechsel von fruchtbarer Lebensfreude zur Erntezeit vollzog. Durch ein warmes Weizenfeld zu spazieren bereitete ihm große Freude, ebenso sehr, wie mit Lina auf einer Wiese zu picknicken und das Leben zu genießen.
William zog den Pfeil aus dem Hasen und richtete ein stilles Gebet an den Schöpfer allen Seins. Er hatte ihm diese Beute beschert, also fand William es angemessen, dem Schöpfer Dank auszusprechen. Der Schöpfer sorgte in den letzten Jahren gut für Lina und William.
Eines der dünnen Bändchen aus der Hose kramend nahm er das tote Tier auf und befestigte es sorgfältig neben seinen Artgenossen an der Stange. Dann wusch er sich das Blut im Bach von den Händen und schlug sich eine Handvoll kalten Wassers ins Gesicht.
Es war bereits kurz vor Mittag. Lina wartete bestimmt schon auf ihn. Während er bei Sonnenaufgang auf Jagd ging, kümmerte sie sich um das Mittagessen. Meistens bereitete sie einen Eintopf vor, dem sie nur noch das Fleisch beimengen musste, das William für sie besorgte. Einen Blick in den strahlend blauen Himmel werfend sog William die warme Frühsommerluft in die Lungen und nahm das Zeug auf, um sich auf den Heimweg zu machen.
An diesem Morgen hatte er sich nicht weit entfernt, weswegen er bereits nach kurzer Zeit in die weniger bewachsenen Regionen des Waldes vordrang. Von dort aus folgte er dem Bachlauf hangabwärts bis zum Waldrand, wo er abbog und sich gen Westen wandte. An dieser Stelle verließ William den Wald und legte die letzten paar Hundert Meter auf freiem Gelände zurück. Der Pfad, dem er folgte, wirkte stark frequentiert. Die Händler aus dem Westen nutzen ihn, um die Waren auf großen Karren in die östliche Hauptstadt zu bringen, wo sie frohen Mutes hofften, sie um einen guten Preis an den Mann bringen zu können.
An der nächsten Weggabelung folgte William der Abzweigung, welche in Richtung Meer führte. Nach einer halben Stunde wechselte der Boden unter seinen Füßen die Beschaffenheit. Die Wiese wurde zunehmend brauner und mischte sich mit der feinen Sandoberfläche des wenige Meter weiter vorne überlappenden Strandes. William spürte, wie sich der Sand in seine Stiefel stahl – ein Gefühl, das ihm sagte, dass er nicht mehr weit von Zuhause entfernt war.
Das Geräusch der sich am Ufer brechenden Wellen drang an seine Ohren. Dann konnte er auch schon den Rauch aus dem Schornstein des Hauses aufsteigen sehen, in dem er mit Lina lebte. Es war kein großes Haus, bot gerade so viel Platz, wie sie zum Überleben brauchten. Lina hatte auf ein zweites Stockwerk bestanden, in dem sich das Schlafzimmer und eine angrenzende Kammer befand, die sie derzeit zur Aufbewahrung ihrer umfangreichen Waffensammlung nutzten. Im Erdgeschoss trennte eine Wand den Waschbereich von der Küche. William hatte seinerseits auf eine Veranda bestanden, auf der er abends den Anblick der untergehenden Sonne genießen konnte. Zu diesem Zweck hatte er sich als Tischler versucht und sich selbst einen Schaukelstuhl gefertigt. Gemeinsam mit Lina diesen herrlichen Anblick zu genießen, erinnerte William stets daran, wie glücklich er mit ihr war.
Den Bogen neben der Tür abstellend, öffnete er diese und nahm den wohltuenden Geruch des Eintopfs in sich auf. Die Fenster standen offen, um die warme Mittagsluft einzulassen. Lina wusste, wie sehr William das Gefühl des Sonnenlichts auf der Haut liebte.
Die Amazone stand an der Feuerstelle und rührte gerade den Eintopf um, als sie sich zu ihm drehte und William ein Lächeln schenkte, das stets nur ihm galt und niemand anderem. William erwiderte die Geste, legte die Beute an der Arbeitsplatte neben der Feuerstelle ab und packte Lina an der Hüfte, um sie an sich zu ziehen. Sie ließ es mit sich geschehen. Eine Sekunde später stellte sie sich auf die Zehenspitzen, um seinen Kuss zu erwidern. Sie nahm den Geschmack seiner Lippen in sich auf, genoss diesen Augenblick einfach und wünschte sich, dass er nie enden sollte.
»Wie war die Jagd?«, fragte sie, sich mit den Fingern an seinem Hemd festkrallend. Der Kuss ließ sie schwindeln. Sie liebte dieses Gefühl, obgleich sie es nie zugeben würde.
»Ergiebig«, er wies in Richtung der Beute.
»Gut«, sie schmunzelte. »Geh dich waschen, ich mache einstweilen das Essen fertig. Treffen wir uns auf der Veranda?«
Die Antwort gab er in Form eines Kusses, bevor er im Waschraum verschwand.
∞
Lina stand im Glanz der untergehenden Sonne bis zu den Knien im Wasser. Wie sanfte Schlingen schlossen sich die brechenden Wellen um ihre schlanken Beine. Das naturblonde Haar nahm die Farbe der Sonne an, schimmerte in einem rötlichen Ton, der William an das Herz eines warmen Feuers erinnerte. Wie die leichte Brise sich über sie legte, wirkte Lina wie ein Engel, der aus dem Himmel hinabgestiegen war, um William den Frieden zu bringen, den er sich so lange ersehnt hatte.
Er selbst lag etwas weiter hinten im Sand. Den Oberkörper entblößt, genoss er das Ende dieses prächtigen Tages, sog die Luft tief in seine Lungen ein und entspannte die Muskeln, die müde von der Jagd waren. Was hätte er gegeben, diesen Moment nie vorübergehen zu lassen? Es schien beinahe so, als würde sich Williams Liebe für Lina im Sonnenuntergang widerspiegeln.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte er Gemälde eines solchen Augenblicks gefertigt. William war ein begabter Maler. Lina liebte seine Bilder, fasst so sehr wie ihn selbst. Meistens fertigte er Skizzen von Landschaften, die sich in der Umgebung des Hauses befanden. An Tagen, da ihn die Lust am Malen packte, zog er noch vor Sonnenaufgang los und kehrte erst mit dem Abendrot zur Hütte zurück. Manchmal fragte sich Lina, was so lange dauern mochte, ein einfaches Bild zu malen.
William hatte es ihr einst derart erklärt, dass er sich mit der Natur verbinden müsse, sie zur Gänze in sich aufnehmen, ansonsten würde er bloß eine einfache Kopie des Zeichengegenstandes anfertigen. Dies jedoch lag fern seiner Absichten. Nein, William wollte die Göttlichkeit der Natur einfangen. Seiner Ansicht nach war alles in Alba existierende Leben vom Schöpfer allen Seins erschaffen, um die Menschen daran zu erinnern, wie klein sie in Wirklichkeit waren. Jeder Grashalm, jede Pflanze, jeder Mensch, ja gar jedes Insekt stammte vom Schöpfer. In ihrer einfachsten Art waren sie perfekt. Diese Perfektion suchte William in seinen Gemälden einzufangen. Und zuweilen gelang ihm das auch.
Zac, einer ihrer ältesten Freunde, sagte einmal, William besäße die Gabe, das Wesen einer Person zu erkennen und dieses mit einem Pinsel einzufangen. Er bilde nicht nur eine Person ab, er gäbe ihr in seinem Schaffen als Maler überhaupt erst ein Gesicht. Zac war ein Kobold und mit allem Leben in Alba durch die Magie der Worte verbunden. Wenn er etwas derartiges behauptete, wollte es William nicht infrage stellen. Zac kannte das Leben besser als die meisten anderen – einschließlich William und Lina. William fühlte sich durch dieses Kompliment geehrt. In den Tiefen seines Herzens aber war er anderer Ansicht als sein Freund.
Das Leben hatte er erst lieben gelernt, als Lina in sein Leben getreten war. Sie gab allem überhaupt erst einen Sinn. Lina war das Licht am Morgen, das ihn weckte, und der Mondschein, der ihn ruhig einschlafen ließ. Sie war alles, das er brauchte, um morgens aus dem Bett aufzustehen. Um nichts in der Welt würde er sie aus seinem Leben wünschen. Ganz im Gegenteil. Würde man sie ihm nehmen, würde er die Welt niederbrennen. Allein schon eine Sekunde von ihr getrennt zu sein, versetzte sein Herz in Aufruhr. Dann wünschte er sich tot. Er wollte jede Sekunde seines Lebens mit ihr verbringen. Sie war sein Zuhause, seine Zuflucht. Lina besaß sein Herz. Ohne sie war er einfach nicht vollständig.
Bevor Lina in sein Leben getreten war, hatten sich die Tage dunkel aneinandergereiht und böse Gedanken hatten seinen Verstand verdorben. Die Grausamkeit, welche ihm in seiner frühsten Kindheit widerfahren und sich anschließend immerzu wiederholt hatte, hatte William zu einem verbitterten jungen Mann gemacht. Jedoch hatte er gelernt, seinen Hass auf die Welt und alles Leben hinter einer Maske der Glückseligkeit zu verstecken. Verließ er das Haus, so setzte er sie auf, zeigte der Außenwelt ein fröhliches Lächeln, um den Schmerz zu verbergen, der ihm die Tränen in die Augen trieb. Ausschließlich seinem Bruder George gegenüber hatte er sein wahres Ich offenbart. Ihm konnte er seinen Schmerz nicht vorenthalten. Und beinahe schien es lange Zeit so, als wäre George der Einzige, der diesen Schmerz verstehen konnte, der ihn als Teil von Williams Persönlichkeit anerkannte. Zumindest so lange, bis Lina kam und William dabei half, einen Teil seines Leids zu tragen.
Durch sie hatte er das Leben wieder lieben gelernt. War sein Herz in der Sekunde zuvor noch ein Trümmerhaufen scharfkantiger Scherben gewesen, so hatte sie sich die Zeit genommen, die es benötigte, sein Herz zu heilen. Sie hatte sich mit aller notwendigen Geduld hingesetzt und es Stück für Stück wieder zusammengesetzt. Aus diesem Grund liebte er sie. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen hatte sie sich die Zeit genommen, sein kaputtes Wesen zu entschlüsseln. Sie hatte ihn nicht von sich gestoßen. Lina hatte William die Hand gereicht und ihn von der Dunkelheit befreit. Sie war das Heilmittel, das er brauchte, um wieder glücklich zu sein. Lina war das Licht zu seiner Dunkelheit.
All das, seine so schmerzhaften Erfahrungen und das ihm widerfahrene Leid, hielt er in seinen Arbeiten fest. Oft auf eine abstrakte Weise, sodass die Betrachter seiner Bilder sie nicht gleich erkannten, doch gleichsam waren seine Arbeiten von einer Wahrhaftigkeit beseelt, die einem die Tränen in die Augen steigen ließ. William war vom Schöpfer gesegnet. Seine Gemälde waren Meisterwerke und er ein Künstler.
Beinahe war es ironisch. Einerseits war er Soldat, ein Mensch, der Leben auslöschte, und andererseits ein Künstler, der Leben mit Pinsel und Farbe erschuf. Vielleicht war dies ein Teil der Symbiose, die das Leben in seinen Grundfesten ausmachte. Licht und Dunkelheit bildeten die Symbiose der Magie der Worte. In jedem Lebewesen kämpften die beiden Mächte um die Vorherrschaft. Gut gegen Böse. Licht gegen Dunkelheit. Leben gegen Tod. Schöpfung gegen Zerstörung. William verkörperter diesen Kampf mit seinem gesamten Wesen.
»Woran denkst du?«, holte Lina ihn aus seiner Traumwelt zurück. Sie stand direkt über ihm, mit gespreizten Beinen, die bis zu den Knien nass und mit Sand bedeckt waren. Das lange, naturblonde Haar lag über ihrer rechten Schulter und reichte bis zur Hüfte. Ihr Körper war ein Meisterwerk der Schöpfung. Als Amazone war sie nicht nur Frau, sondern auch Kriegerin. Zu diesem Zweck hatte sie der Schöpfer mit einem muskulösen Körper gesegnet. William würde niemals freiwillig im Kampf gegen sie antreten. Diese Frau wusste zu kämpfen.
»Daran, wie sehr ich dich liebe!«, erwiderte er, woraufhin sie lächelte.
Lina ließ sich auf ihn fallen, saß direkt auf seiner Hüfte. Nun gab es kein Entkommen mehr. Sie hatte ihn binnen einer Sekunde bewegungsunfähig gemacht. Dann ließ sie sich nach vorne fallen, legte den Kopf mit dem linken Ohr an seine Brust und lauschte dem Klang seines Herzens. Es war stets eine Mischung aus stiller Zufriedenheit und stürmischer See. Auch in diesem Sinne glich William der Schöpfung selbst.
Seine Hand strich sanft über ihren Rücken. Er liebte das Gefühl, jede Kontur ihrer perfekten Muskelkraft zu ertasten. So sanft er konnte, strich er durch Linas Haar. Sie genoss seine Berührung, ließ ihn gewähren, um sich ganz der Zärtlichkeit dieses Augenblicks hinzugeben.
»Ich wünschte, dieser Moment würde nie enden«, flüsterte sie an seiner Brust. Williams Brummen ging ihr durch Mark und Bein, war Ausdruck seiner Zustimmung.
»In diesen Momenten fühle ich mich dem Leben so nah, der Schöpfung selbst. Dann gibt es keine Vergangenheit, nur die Zukunft. Ich möchte sie nur mit dir verbringen, Lina.« Er küsste ihren Haaransatz. »Nur mit dir, hörst du?«
»Ich werde nicht weggehen«, sie schob den Kopf etwas weiter nach oben, um seinen Blick zu erwidern. »Das habe ich dir versprochen!«
»Es herrscht Frieden, Lina.« Sie wusste nicht ganz, was er damit meinte, stimmte aber zu, indem sie sich enger an seine Brust schmiegte. »Du sagtest einmal, wenn Frieden in Alba herrsche, dürfe ich dich zur Frau nehmen.«
Daran erinnerte sie sich sehr gut. Es war kurz nach dem Ausbruch des Großen Krieges gewesen, als überall in Alba Chaos geherrscht hatte. Allein Williams Liebe zu ihr hatte sie damals nicht den Verstand verlieren lassen. Damals hatte sie ihm ein Versprechen gegeben. Nun, Jahre danach, erinnerte er sie daran.
»Lass uns heiraten, Lina«, er packte sie an der Hüfte und zog sie weiter nach oben, bis sie sich mit den Augen direkt gegenüber lagen. Er liebte Linas Augen, mehr noch als alles andere an ihr. William besaß seit jeher die Gabe, das Wesen eines anderen Menschen an dessen Augen zu erkennen. Niemand konnte sich seinem alles durchdringenden Blick entziehen. In Linas laubgrünen Augen hatte er damals Verständnis für seinen Schmerz gefunden. Der Grund, weshalb er sich ihr überhaupt erst geöffnet hatte. Jeder andere Mensch zuvor hatte ihn ehrfürchtig und voller Schrecken angesehen, als wäre er nicht normal, als wäre er … ein Monster. Lina aber hatte ihn in den Arm genommen und getröstet. In ihren Armen durfte er schwach sein, konnte der sein, der er war.
»Warum jetzt?«, wollte sie erfahren.
»Du hast es versprochen«, sagte er.
»Was macht das denn für einen Unterschied, Will? Wir sind jetzt zusammen, sind glücklich. Warum etwas daran ändern?«
»Dann denkst du, wir wären nicht mehr glücklich, wären wir verheiratet?«, der Glanz in seinen Augen verfinsterte sich. Lina war die Einzige, die dazu in der Lage war, das zu erkennen. Nur sie kannte ihn so gut, um zu wissen, was dies bedeutete. Williams Herz wurde von Selbstzweifeln befallen.
»Das habe ich nicht gesagt. Was ich meine, ist, dass wir doch jetzt schon ein perfektes Leben führen und ich keinen Grund sehe, etwas zu erzwingen, nur um den Schein zu erwecken, dass wir noch glücklicher sein müssten.«
Ihre Worte verwirrten ihn offenkundig, denn seine Augen verfinsterten sich mit jedem ihrer Worte mehr. Dass er von ihrem Haar abließ, zeigte Lina, dass sein Verstand versuchte, ihn zu beschützen. William besaß seit jeher ein zweites Gesicht, eine Maske, die er aufsetzte, um sich vor Schmerz zu schützen. Anscheinend fürchtete er sich davor, was Lina zu sagen beabsichtigte.
»Ich möchte doch nur mit dir zusammen sein!«, sagte er niedergeschlagen.
»Und ich mit dir. Das sind wird doch, William. Warum willst du mich gerade jetzt heiraten?«, sie strich ihm sanft über die Wange, um ihn zu beruhigen. Unter sich konnte sie sein Herz schneller schlagen spüren, unruhig und voller Zorn.
»Weil …«
»Du kannst es mir sagen, Will, ich werde nicht böse auf dich sein«, bestärkte sie ihn.
»Weil ich fürchte, dass der Frieden schon bald vorüber sein wird. Du hast gesagt, ich dürfe dich zu meiner Frau machen, wenn Frieden herrscht. Dieser Zeitpunkt ist jetzt, denn ich fürchte, er wird schon bald vorüber sein.«
»Wie meinst du das?«
»Ich …«
»Hast du wieder diese Träume?«, sie fasste sein Gesicht mit beiden Händen, um zu verhindern, dass er es abwandte, um seine wahren Gedanken vor ihr zu verbergen.
»Immerzu denselben«, hauchte er besorgt aus.
»Der Mann mit der Maske?«
Er hatte ihr von diesem Traum erzählt. Seit mehr als fünf Jahren plagten ihn schon dunkle Träume. Boshafte Phantasien von einem Mann mit einer grässlichen Maske und einem Wesen, dass alles Böse in sich trug. Sie quälten ihn derart, dass er bereits fürchtete, sie könnten eines Tages real werden. In diesen Träumen verlor er Lina auf die entsetzlichste Art, die er sich nur vorzustellen vermochte – er tötete sie mit eigenen Händen.
»Du hast Angst, mich zu verlieren«, Lina küsste ihn, um ihm ihre Nähe spüren zu lassen. Auf diese Art gelang es ihr jedes Mal, William vor dem Bösen zu bewahren, das versuchte, sein Herz zu erobern. »Du wirst mich nicht verlieren. Hörst du, William Cornbreak? Ich werde immer da sein, um dich vor deinen Träumen zu beschützen.«
Er zog sie am Kinn zu sich hinunter, um sie zu küssen. Der Geschmack ihrer Lippen, das Gefühl, sie auf sich zu spüren, erregte ihn. Die Liebe zu ihr vertrieb die Schatten, die sein Paradies verdunkelten.
»Wenn es dir so viel bedeutet, Will, können wir heiraten!« Nun lächelte er aus vollstem Herzen. »Aber ich möchte alle bei uns haben. Zac, Tiny, Edward, einfach alle. Verstanden?«
»Wir werden in der Basilika heiraten«, schwor er. »Unsere Freunde werden bei uns sein.«
»Aber du musst mir eines versprechen«, forderte sie, sich seinen Lippen entziehend.
»Alles, was du willst!«
»Dass du mir dann auch ja ein guter Vater wirst!«
»Unsere zwanzig Kinder werden sich keinen besseren Vater wünschen können«, er drehte sie herum, sodass er es nun war, der über ihr lag.
»Zwanzig?«, sie musste bei dem Gedanken lachen.
»Zu wenig? Fünfundzwanzig?«, neckte er sie liebevoll.
»Wieso geht das bei dir immer in die falsche Richtung?«
Sie zog ihn an den Armen zu sich hinab und ließ ihn gewähren, als er ihre Knie auseinanderdrückte. Sie wollte ihn bei sich spüren. Lina wollte mit ihm verschmelzen, zu einer Person werden.
»Sie werden alle so wunderschön und stark sein wie du«, er küsste ihren Hals, liebkoste sie, forderte Lina auf, sich ihm zu ergeben. Bereits jetzt konnte sie einen zweiten Herzschlag unter ihrer Brust spüren.
∞
William kniete mit gefesselten Händen vor dem Mutzler. Dieser war das absolut Böse in Form eines schwanzlosen Katers. Eine Bestie, allein zu dem Zweck erschaffen, alles Leben zu vernichten. Obgleich der Mutzler, gewandet in prachtvolle Kleider, aufrecht vor ihm stand, das Gesicht abgewandt und die Arme im Rücken verschränkt, konnte William die Boshaftigkeit in dessen Augen erahnen.
»Wer bist du?«, verlangte der Mutzler zu erfahren. Seine Worte hallten von den hohen Wänden der Halle wider, in die die Piraten William geschleift hatten.
»Kapitän William Cornbreak«, antwortete William. Sein Herz raste in der Brust. Das Tosen des Bluts, welches in rasender Geschwindigkeit durch seine Adern pochte, dröhnte in Williams Ohren, machte es ihm schwer, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. Das Einzige, was zählte, war, Lina vor dem sicheren Tod zu bewahren.
»Ich kenne deinen Namen.«